Ursula Krechel: Die da
ZEITENFOLGE
Ein blendenderes Futur wäre vorgestern gewesen
und übermorgen wirst du eine Vergangenheit haben
die sich gewaschen hat und dazwischen pendelst du
Staubtrockene Echtzeit, von blinden Spiegeln umstellt
und wenn du aufblühst im nächsten Frühjahr: presente
über vergilbtem Papier, wird Vergangenheit Vorvergangenheit ganz unperfekt
Nachwort
Die Kontinuität des eigenen Werkes zu behaupten, ist eine kühne und gleichzeitig mißliche Sache. Schon das Werk zu schreiben und es eben so zu nennen, ist eine Behauptung im doppelten Wortsinn. Eine Selbstbehauptung und eine rückblickende Initiation. Von der Diskontinuität, der Fragmentarisierung, von Werkgruppen, Phasen und Abschnitten zu sprechen, ist fraglos die gegenwärtigere Lösung, die wiederum so plausibel erscheint, daß sie alle möglichen und notwendigen Fragen abschneidet. Es geht nicht um Bruchstücke einer großen Konfession (auch einer großen Behauptung), es geht um Entitäten, die sich anziehen und abstoßen, sich überlagern und miteinander in Kontakt treten. Es geht auch um das Einzelne in luftiger Gestalt, das so einzeln nicht ist, um Brüche, Abbrüche, Gewaltsamkeiten, um Entfernungen und Näherungen, auch um Veränderungen in der Chronologie. Verwandlung und Verwerfung, erneute Aneignung; der Spiegel, in den geschaut wird, spiegelt unendlich zurück.
Die Freude an Heteronymen, am Wechsel der Gattung, am Auftauchen aus einer Arbeit in einer anderen mit neu gefundenen Formen spricht für sich. Schon ein Lebens- und Schreibkontinuum zu behaupten und gleichzeitig editorisch zu dokumentieren, ist eine Fiktion, die nicht selbstverständlich gesetzt werden kann. Es gibt Autoren, die aus guten Gründen (Unwille, Krankheit, Todesnähe, bestenfalls Abhaltung durch neue, drängende Schreibaufgaben) an diesem Prozeß nicht beteiligt sein wollen oder können, ja ihn gerne vertrauensvoll in andere (kompetentere, geduldigere?) Hände legen. Es gibt Autoren, die die Spuren verwischen oder gar nicht zurückschauen wollen. Und es gibt solche, für die der Zwischenzustand der Sammlung und Sichtung des vorhandenen Materials eine produktive Herausforderung ist: aus Teilen ein unvorhergesehenes anderes Ganzes werden zu lassen oder es zumindest so erscheinen zu lassen. Als Seamus Heaney 1980 Selected Poems herausgab, stutzte er das doch in den Augen vieler Leser makellose Frühwerk auf eine überraschend geringe Anzahl von Gedichten zusammen. Es war ihm fremd geworden, während es Lesern über die Jahre hinweg nahe geblieben war. Was als Selbstoptimierung gedacht war, wurde als eine Art von Selbstverstümmelung wahrgenommen, als eine übermäßige Strenge oder gar als Desinteresse an der Vergangenheit des gegenwärtigen Schreibens. Goethe, der seit 1787 seine Schriften zu sammeln beginnt, gab bei Cotta ab 1806 zum ersten Mal „Goethes Werke“ in der 13bändigen Ausgabe heraus, die auf so wenig Interesse stieß, daß sie verschleudert werden mußte. Trotzdem folgte 1817 noch ein 14. Band, und ab 1815 brachte er eine zwanzigbändige Ausgabe auf den Weg, der die Ausgabe letzter Hand folgte. Goethe ist das andere Extrem, der Protagonist einer Selbstvergewisserung, Auto-Monumentalisierung, die freilich nicht ohne helfende Hände, Schreiber, Diktat-Empfänger möglich gewesen wäre. (Und einen langmütigen, die Höhen und Tiefen der Beziehung auslotenden Verleger voraussetzte.)
Aber auch der Verzicht auf eine eigene editorische Praxis kann voraussehbaren oder unbewußten Strategien folgen. Eine Tradition wird begründet, ein wissenschaftlicher Apparat wird angeschoben, eine externe Autorität waltet und wird in Dienst genommen, eine Sichtweise auf das Werk wird vom Autor stillschweigend gebilligt oder befördert. Man könnte auch sagen, die ästhetische Intention bleibt pur, die strategische wird ausgelagert (oder indirekt gesteuert). Wie es bildende Künstler gibt, die „es sich nicht nehmen lassen“, wie die rhetorische Formel der Kunstkritik heißt, zur Installation einer Werkschau anzureisen, „Hand anzulegen“ und andere, die diesen Arbeitsvorgang vertrauensvoll einem Kurator und seinem Team überlassen. Einflußnahme versus Verzicht auf Einfluß. Arbeit an der Schärfung des Werkbegriffes versus Historisierung, Authentizität versus Objektivierung.
Als ich zum ersten Mal für den Band Ungezürnt (1997) Gedichte aus den drei früheren Bänden, Nach Mainz!, Verwundbar wie in den besten Zeiten und Vom Feuer lernen sowie unveröffentlichte frühe Gedichte zusammengestellt hatte, kam es mir auf Perspektiven, Durchblicke an. Tische waren näher gerückt, Deutlichkeiten waren in eine unbestimmte Ferne verwiesen worden, dem Staunen wurde Raum gegeben, der Sprachlosigkeit im Sprechen. Der Raum, der Rausch des Beginnens standen im Vordergrund, die Spezifik des Aufbruchs, auch des Aufpralls nach dem Aufbruch. Damals wie heute mußte wegen ihres Umfangs eine Werkgruppe ausgeschlossen werden, die mir nach wie vor am Herzen liegt und die auf Erweiterung wartet: die der zyklischen Gedichte sowie die Poeme Rohschnitt (1983), Stimmen aus dem harten Kern (2005) und Mittelwärts (2006). Es verbot sich von selbst, einzelne Teile herauszubrechen, die Struktur zu zerstören. Sie sind späteren Editionen vorbehalten.
Jetzt, Gedichte aus einem ungleich größeren Zeitraum sichtend, kam es mir eher auf die Verflechtung des Vorhandenen an, auf Motivketten und formale Übereinstimmungen und Gegensätze, auf das Lesen der Subtexte, die vielleicht erst in einer größeren Textmenge deutlicher werden, Herkunft und Zukunft der ästhetischen Arbeit. Eine ganze Gruppe von Texten nimmt das innere Gespräch von Dichtern miteinander auf; Paarungen und Parteiungen, die verehrende Anrede und die Ausrede, der Kommentar.
Doch die Auslassungsgesten bleiben sichtbar: Vom vollendeten Bruch zurück zur Brechung, vom Abschied zum Verschiedensein, Licht bricht durch, ein Farbton, der entfernt an eine erstrebenswerte Eigenschaft erinnert: Weisheit/Weißheit, Gescheckheit und ein Nachtlicht brennt noch. Dunkelheit erhellte sich jäh. Und die Dunkle spricht vom Licht. Aus der möglichen staunenden Veränderung der Chronologie ist eine Zeitenfolge geworden, der die ungewisse Zukunft des Emigranten ebenso eingeschrieben ist wie der Dekonstruktion einer (jeglicher) Gewißheit. Dies kleine Haus hätte ein Zelt werden können, der Möglichkeitssinn regiert die Sprachlogik. Ist das Gedicht, ist seine emphatische Behauptung eine Gewißheit? Es zu behaupten, könnte eine mit dem Rücken zu den Texten versicherte Naivität sein. Es in Zweifel zu ziehen, könnte das Ende des Kontinuums des poetischen Prozesses sein, eine gänzlich unerwünschte Folge. Der Prozeß scheint unabschließbar.
Ursula Krechel, Nachwort, Juni 2013
Inhalt
So viel Anerkennung Ursula Krechel auch für ihre großen Romane letzthin erhalten hat, zunächst einmal und vielleicht sogar vor allem ist sie Lyrikerin. Um auch ihren neugewonnenen Leserinnen und Lesern einen Einblick in ihr überaus vielfältiges Werk zu geben, hat die Autorin hier selbst eine Auswahl aus ihren nicht-zyklischen Gedichtbänden getroffen. Beobachtung des Gegen- und Miteinanders, die Gegenwart der Geschichte und die Geschichten der Gegenwart finden Aufnahme in diesen materialreichen Gedichten, in denen das Persönliche zum Spiegel allgemeiner Erfahrung wird. Die Genauigkeit der Wahrnehmung und die Lust am Spiel mit den Wörtern bestimmen die kontrapunktische Spannweite dieser Lyrik.
Jung und Jung Verlag, Ankündigung
Die Hand führt die Schrift,
und die Schrift führt dich auf ein unbekanntes weites Feld
– „Lieber! Leser! Liebe! Lies!“: Ursula Krechel, trotz ihrer großen Romanerfolge vor allem eine Lyrikerin, hat eine Auswahl aus ihren eigenen Gedichten getroffen. –
Seit ihren zwei großen Romanen – Shanghai fern von wo und Landgericht – zählt Ursula Krechel zu den bekanntesten Autorinnen unserer Gegenwart. Darüber vergisst sich leicht, dass die Schriftstellerin seit ihren Anfängen und bis heute vor allem Lyrikerin ist. Noch vor drei Jahren hat sie den schönen Band Jäh erhellte Dunkelheit vorgelegt, der in seinem Titel die Macht des Epiphanischen beschwört. Und jetzt – vielleicht um die neu hinzugewonnenen Leser ihrer Romane mit ihrem lyrischen Werk vertraut zu machen – lässt Ursula Krechel eine repräsentative Auswahl ihrer Lyrik folgen.
Die da lautet der klein und bescheiden gehaltene Titel – Die da, das könnte wegwerfend klingen. Es könnte ebenso ängstlich gemeint sein, als ginge es um geliebte Geschöpfe, die noch nicht die rechte Beachtung gefunden haben. Dann wären Die da jene Gedichte, die Ursula Krechel uns besonders ans Herz legen möchte. Oder mit denen sie vielleicht auch an unseren Verstand, unsere intellektuelle Einsicht appellieren möchte. Für Letzteres spricht, dass die Dichterin ihnen gleich zwei Prosatexte nachgeschickt hat: den Essay „Auslassungen und Weglassungen“ und ein regelrechtes „Nachwort“ mit editorischen Informationen. Im „Nachwort“ weist Krechel etwa darauf hin, dass sie ihre zyklischen Gedichte – so die sechzig Sequenzen von „Rohschnitt“ – nicht für die Gedichtauswahl auflösen wollte. Man darf annehmen, dass es dafür einen eigenen Sammelband geben wird.
Sehr wichtig ist der Essay. Darin umkreist Krechel ein einziges Wort als das Zentrum der eigenen Poetologie. Es ist das Wort „verheert“ aus Ingeborg Bachmanns Gedicht „Mein Vogel“:
Was auch geschieht, die verheerte Welt
sinkt in die Dämmerung zurück.
Zwar weiß sie, dass die Bachmann dieses Wort „besetzt“ hält. Gleichwohl ist es für Krechel ein Grundmotiv des eigenen Schreibens: Die Prämisse, dass die „Verheerungen des Faschismus“ fortstrahlen und dass die Poesie von diesen Verheerungen handeln muss – Krechels Romane, wie man jetzt weiß, eingeschlossen.
Dass dem so ist, kann selbst dem Leser nicht entgehen, der die essayistischen Zugaben versäumte und sich gleich den Gedichten zuwendet. Die Themen von Faschismus und Unterdrückung, von Emanzipation und Revolte erscheinen vor allem in den ersten der acht Kapitel. Da gibt es noch einige politische Allegorien à la Enzensberger:
Mit den Wölfen heult schon das gerissene Lammfleisch.
Doch Krechels eigener Ton zeigt sich in der bösen „Hymne auf die gebändigte Schönheit der Frauen der bürgerlichen Klasse“. Vor allem gelingt ihr ein Gedicht wie „Meine Mutter“, das wahrhaft anthologiewürdig ist. Es ist die ergreifende Elegie auf die Mutter, der erst im Gedicht der Tochter die lebenslang verweigerte weibliche Befreiung zuteil wird. Ähnlich suggestiv triumphiert die balladeske Phantasie „Nach Mainz!“ über die seinerzeitige politische Aktualität. Da schwimmt das lyrische Ich zusammen mit Angela Davis und der Jungfrau Maria gegen den Strom, nämlich rheinaufwärts nach Mainz, wo ein sozialistischer Staat entsteht.
Dieses Gedicht aus Krechels Erstling Nach Mainz! (1977) weiß bereits, dass die Utopien gefährdet sind. Knapp zehn Jahre später, in dem Band Vom Feuer lernen, der 1985 erschien, spricht die Desillusion aus dem Befund:
Die blaue Welt vergreist
was rund und bunt war – eine Wüstenei. Schon
leiden wirs. Die Klassiker sind abgereist.
Mancher erinnert sich: In den achtziger Jahren sprach man von den Klassikern auch und gerade dann, wenn man die Klassiker des Marxismus meinte. Tempi passati?
Nicht im Gedicht. Ursula Krechel ist es in ihrer Lyrikauswahl ohnehin nicht um Entwicklungschronologie und Dokumentation zu tun, sondern um die Aktualität ihrer Poesie.
Sie komponiert nicht historisch, sondern poetisch. Man kann ihre Auswahl als ein einziges Großgedicht lesen. Die Überschriften der acht Kapitel geben andeutungsweise eine lyrische Essenz:
Stimmen wie Hundegebell
Hörnerklang und Hall
Entblößung ist nur ein Wort
Wörterleiber
Licht wies nach Norden
Präferenzen keine
Ohne Fremdverschulden gehofft
Aus Wolken gefallen
Klingt das nicht wie ein eigenes Gedicht?
Krechel hat keines ihrer politischen Motive preisgegeben, nur sind ihr die poetischen wichtiger geworden. Wichtig ist ihr die „Verflechtung des Vorhandenen.“ Sind die Klassiker also zurückgekehrt? Nicht dass Krechel sich zum Klassiker stilisiert, doch „das innere Gespräch von Dichtern miteinander“ ist ihr wichtig geworden. „Präferenzen keine“ heißt das Kapitel, darin sie ihren Eideshelfern huldigt: Baudelaire und Flaubert, Celan und Rilke, Anne Sexton und Ingeborg Bachmann.
Bei diesem Dichtergespräch kann es nicht ausbleiben, dass das Gedicht selbst seine Stimme erhebt. Es spricht selbstbewusst, ja spröde, doch ohne jede Anbiederung. Da muss der Leser folgendes hören:
Ich bin es, die schreibt, und du liest
so werden wir niemals Geschwister.
Wenn man aber weiterliest, wird man durch die alt-neue Verheißung der Poesie belohnt: „Ich bin es, die schreibt.“
Auf diesem Feld, erfahren wir, dass auch das strenge Gedicht nicht ohne uns Leser auskommt. Es ruft uns – wenige Seiten später – in seiner Überschrift zu: „Lieber! Leser! Liebe! Lies!“ Mehr Ausrufungszeichen gibt es in dem ganzen Buch nicht. Daher sollten wir dem bewegenden Liebesangebot einer Dichterin, die stets auf billige Emphase verzichtet, folgen. Lesen wir also Krechels Die da, große Gedichte, die sich eher klein machen als aufplustern. Es lohnt sich.
Harald Hartung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.10.2013
„Es ist mir, als kennte ich diese Züge“ von Ursula Krechel
– Ursula Krechel hat für ihren neusten Gedichtband ihre zwölf bereits veröffentlichten Lyrik-Werke durchforstet. Die Auswahl repräsentiert eindrucksvoll ihr lyrisches Schaffen seit Beginn ihrer schriftstellerischen Arbeit. –
Wem die 1947 in Trier geborene Ursula Krechel nicht als Lyrikerin geläufig ist, wird sich vielleicht daran erinnern, dass sie auch als Verfasserin von Essays, Theaterstücken, Hörspielen, Prosa und Romanen bekannt geworden ist, und zuletzt für ihren hochgelobten Roman Landgericht den Deutschen Buchpreis erhalten hat. Aber trotz ihrer vielfachen Begabung kann man die Lyrik durchaus als Hauptsache ihrer Arbeit bezeichnen. Rund 150 Gedichte enthält der Band Die da, deren Unterteilung sich an, von ihr so genannten „Motivketten“ bzw. an formalen Gesichtspunkten orientiert. Es ist ein gewaltiger Kosmos, der Ursula Krechels Gedichte durchdringt, scheinbar mühelos und leicht kommt die „Orthopädie des aufrechten Ganges“ daher, der „Bethmannpark winterlich“ oder das wundervolle Gedicht „Die Königin von Saba ordnet ihre Staatsgeschäfte“. Außergewöhnliche schöne Dichtung, erhellend, inspirierend und über den Tag hinaus im Kopf lebendig.
Matthias Ehlers, WDR 5, 2.11.2013
Das Wort zur Wahrheit
– Der Regelverstoß hat es Ursula Krechel angetan. Der Reiz beim bewussten Schwarzfahren, die Ausschüttung von Hormonen, das sei doch etwas Wunderbares, sagt die Autorin. Und das gelte auch für einen Bereich, der mit besonders vielen Regeln belegt ist: die Lyrik. –
Im Literaturhaus hat Ursula Krechel jetzt ihren neuen Gedichtband Die da vorgestellt, eine Werksammlung von 1977 bis heute. Krechel versteht sich als Lyrikerin, auch wenn sie ihren bisher größten kommerziellen Erfolg mit einem Roman hatte. Für Landgericht erhielt sie 2012 den Deutschen Buchpreis.
Danach wollte sie sich wieder der kürzeren Form widmen. Für Krechel sind solche Bände nicht Veröffentlichungen von alten Versen in neuem Einband. Es geht ihr auch darum, wie Gedichte neben anderen stehen, wie sie die lyrischen Nachbarn spiegeln und so auch in einem anderen Licht erscheinen. Krechel liest das Gedicht Nach Mainz! von 1977. Frauenrechtlerin Angela Davis, die Jungfrau Maria und Ursula Krechel liegen im Krankenhaus.
Sie haben gerade ihre Kinder entbunden und wollen fliehen, über den Rhein, der die Demarkationslinie bildet zum sozialistischen Süden. Sie schwimmen und schwimmen, und in Mainz, am Ufer, da steht die Rote Hilfe und reicht den ausgelaugten Flüchtenden Frottierhandtücher. Krechels Gedichte sind durchzogen von Witz und Wortwitz, aber auch vom Streben nach Wahrheit. Und so sprach Krechel mit Literaturkritiker Michael Braun im Literaturhaus auch über das Zusammenspiel von Dichtung und Wahrheit, vom Eindringen der Lyrik in die reale Welt.
Ein Gedicht hat nicht die eine Zeit, in der es gültig ist, glaubt Krechel. Nach Mainz! könne man durchaus auf die RAF beziehen, den Terror im Jahr 1977 und den Terror des Staates, der Intellektuelle unter Generalverdacht gestellt habe, auch Krechel selbst, die im „Deutschen Herbst“ 30 Jahre alt war. Heute kommen den Lesern andere Assoziationen, wenn sie auf schwimmende Flüchtlinge blicken. In zehn Jahren ist die Wahrheit dieser Dichtung eine andere.
Krechel spricht auch über ihre Liebe zu Büchern. Früher habe sie ein oder zwei Theaterstücke am Tag gelesen. Heute nimmt sie sich an jedem Morgen Zeit, liest, fast ein wenig besessen. Und wenn sie jemand fragt, ob Krechel die vielen Bücher in ihrer Berliner Wohnung wirklich gelesen hat, dann sagt sie einfach „Ja“, und versucht, bei der Frage nicht ärgerlich zu werden.
Die ehemalige Dramaturgin an den Städtischen Bühnen Dortmund hat auch einen Sinn für die Inszenierung, wenn sie ihre Gedichte vorträgt. Sie betont klar, und man spürt ihre Freude an den Silben und Worten, die sie sich seit 1977 erdacht hat. Zum echten Schauspiel aber zieht es sie nicht mehr :
Im Theater wird unerträglich viel getrunken, was auch nicht zur Klugheit beiträgt.
Gerd Schild, Hannoversche Allgemeine, 21.2.2014
Lyrik-Logbuch
– Eintragungen zu Gedichten der Gegenwart. –
WEISS WIE
Meine Mutter liebte die weißen Männer
Hals über Kopf aber die weißen Männer
Liebten keine Frau wie sie oder andere
Nicht vorbei war es mit den weißen Männern
Mutter war hin und weg Liebe blieb brannte
Beiläufig ging Gottfried von Cramm
In Leinen blendendweiß auf dem Rasen
Aufschlag über das Netz und weiter
Gegnerisch ins Herz der Mutter und ein
Raunen auf den Rängen leinwandgroß
In der Wochenschau Nuntius Pacelli
Später Papst und sehr verklärt verehrt
Blickte herab und meine Mutter im Sperrsitz
Sah wie er Männer weiß und hochrangig
Wie er mit dem Tennisschläger segnete und
Sie. Aufschlag für den Nuntius nieder
Kniete meine Mutter hielt ihren gläubigen
Blick hielt den Segen aus und weiter
Weiß sie Schwarzes blieb schwarz und
Schweiget o mein Vater das Geröll aus
Den Wiesen steiget und blieben immerdar
Im verschlossenen Gemüt und die Sieger
Unter sich der Ball übers Netz ins Aus
Wunsch daß Männer in großen Schritten
Stürmen ohne wenn aber ohne Verzug
„Der Körper der Mutter, das ist der erste Ort neben dem Ich, der, von dem man sich loslösen muss und der doch bleibt als Gewissheit, er war von Anfang an da.“ Mit dieser These eröffnete die Dichterin Ursula Krechel vor einem Vierteljahrhundert ihre Poetikvorlesungen in Wien. Das war als Hinweis auf die Urszene ihres Schreibens zu verstehen – die Auseinandersetzung mit ihrer früh verstorbenen Mutter. Das allererste Gedicht ihres Debütbandes Nach Mainz! (1977) war bereits ihrer Mutter gewidmet, die vom katholischen Milieu in der rheinland-pfälzischen Provinz geprägt war – und auch im Band Jäh erhellte Dunkelheit von 2010 tauchen signifikante Mutter-Spuren auf. Für die gottesfürchtige Mutter im Gedicht „Weiß wie“ stehen zwei unerreichbare „weiße Männer“ im Zentrum ihres Begehrens: Der Tennisstar Gottfried von Cramm, der Boris Becker der 1930er-Jahre – und „Nuntius Pacelli“, der spätere Papst Pius XII. Die Liebe brennt – und bleibt unerfüllbar, denn die „weißen Männer“ sind Sehnsuchtsgestalten, nach denen man sich verzehrt und denen man gleichwohl nicht nahekommt. Aber kurz darauf marschieren die soldatischen Männer des Faschismus „in großen Schritten“ ins Verderben.
In ihren frühen Gedichten ging es Ursula Krechel um den Entwurf einer weiblichen Genealogie. „Im Persönlichen war immer das Politische“, schreibt sie im Nachwort zu Nach Mainz!, „in der schweifenden Form war eine Festigkeit, der ich trauen lernte; in den Gedichten begriff ich, was ich in Begriffen nie begreifen wollte.“ In späteren Gedichten weitet sich der Blick zu einer großen metaphysischen Erkundung der Welt und die Autorin entdeckt ihr Lebensthema: Motive der Emigration, Bilder von Heimatverlust, Entwurzelung und Bodenlosigkeit.
Michael Braun, Volltext, Heft 1, 2014
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Beat Mazenauer: Alle diese Gedichte da
literaturkritik.de, Mai 2014
Ein Gedicht und sein Autor: Ursula Krechel und Jan Wagner am 17.7.2013 im Literarischem Colloquium Berlin moderiert von Sabine Küchler.
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Andreas Platthaus: Keine Magermilch, und bloß keine Kreide
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.12.2017
Landesart: Ursula Krechel zum 70.
SWR, 2.12.2017
Fakten und Vermutungen zur Autorin + KLG + IMDb + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
Bogenberger Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Ursula Krechel – Neue Dichter Lieben, Komposition und Klavier: Moritz Eggert, Bariton: Yaron Windmüller, Expo 2000 Hannover.


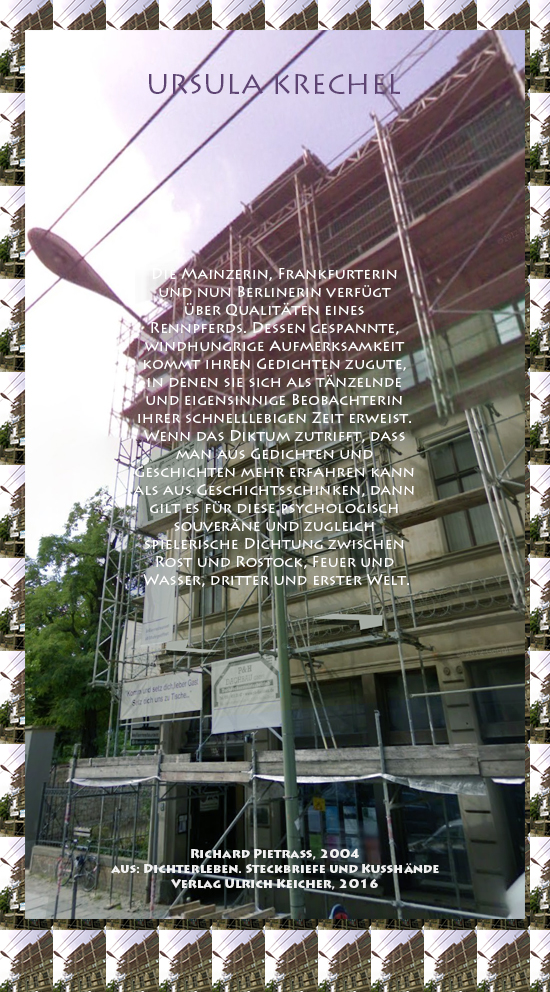












Schreibe einen Kommentar