Ursula Krechel: Stimmen aus dem harten Kern
SIMULATION
HEIMKEHRUMKEHR
1
Wo früher die kugelsichere Weste ummantelte, klebt
aaaaanun
Die Creditcard in der Brusttasche des verschwitzten
aaaaaHemdes
Dazwischen ein Langstreckenflug und eine sanfte
aaaaaLandung
Wir sind Heldendarsteller, verabschiedet, schlüpfen in Anzüge
Von Bankangestellten. Summen, die früher die Toten zählten
Sind an Zinssätze gekoppelt, Kids lümmeln mit Plastikpistolen
Stellungskrieg des Normalen; Hausbaukredite im freien Fall
Rasende Kopfschmerzen nachts, wir träumen von Rinderherden
Mit Stricken aneinandergefesselte Tiere, die wir für Feinde hielten
Niedergemetzelt im Irrtum, sie griffen uns an, wie wir ihnen contra
Wenn Aias schrie am Morgen ai, ai, als wäre sein Name ein Schmerz
Sind wir Aias, Mörder: schuldig und ruhiggestellt durch Tranquilizer.
Dieses Poem
folgt dem Ruf einer quer durch Mythen und historische Epochen ziehenden Truppe – vom Peloponnesischen Krieg bis zu den Schützengräben des 20. Jahrhunderts, den Invasionen des 21. Es horcht auf die Motive des Aufbruchs, zeichnet Invasion und Okkupation nach – des Geländes, der Sprache –, sieht die Spuren der Verwüstung und der Verheerung in den Köpfen, auf den Schlachtfeldern, fragt nach dem erschöpftem Glück der Heimkehr. Warum rotten sich Menschen zusammen und gehorchen einem Befehl? Warum wird gekämpft, warum getötet? Die Stimmen, die hier zur Sprache gebracht werden, sind die von Invasoren, Kolonisatoren, marodierenden Scharen und ihren Opfern. Zwei Gestalten treten als Individuen hervor: Lord Byron, der dichtende Stratege, und die mythische Figur des Philoktet als Verwundeter, ohne den der Sieg nicht zu haben ist. Mit der Gewalt des Gegenstandes korrespondiert die strenge Regelhaftigkeit der Form: in grandiosen 12 mal 12 mal 12 Versen bildet Ursula Krechel die Züchtigung durch die Geschichte ab, das furchterregende Kontinuum des Imperialen sowie die Aufrüstung des Wortmaterials. Dabei rückt sie die düsteren Gefechte in die Helligkeit ihrer Sprache. Sie erweist sich hier einmal mehr als Dichterin auf der intellektuellen und poetischen Höhe der Zeit.
Jung und Jung Verlag, Ankündigung
Stimmen aus dem harten Kern
– Gedicht von Ursula Krechel. –
Woher kommt Literatur eigentlich? Das war neulich die Frage an einen Autor während seiner Lesung. Konkret gefragt, woher kommt das Gedicht der Autorin Ursula Krechel, das sie Stimmen aus dem harten Kern nennt?
Sie selber nennt im Anhang einige Publikationen und erklärt, dass sie daraus vorgefundene Texte und „Texturen“ zitiert und montiert. Damit reiht sie sich unter die Autoren, die das Schreiben als „Machen“, und nicht als Improvisieren, verstehen; denen Poesie im ursprünglichen Sinn ein „Herstellen“ ist, dabei auch auf vorhandene Literatur zurückgreifen, um sie in ihre eigenen sprachlichen und formalen Experimente einzubauen und um ihnen dadurch Respekt zu erweisen.
Hier geht es zunächst nicht um die Quellen, sondern um den Impuls, ein Buch zu schreiben, nämlich dieses Gedicht, das offensichtlich kein „Gedicht“ nach Umfang und Inhalt im herkömmlichen Sinne ist; der Klappentext nennt es ein „Poem“. Solche Diskussion um Gattungsbegriffe ist unwichtig. Vielmehr geht es hier um ein subtil erdachtes und gearbeitetes Sprachkunstwerk, eine tiefgehende und weitreichende Dichtung über die wahnsinnige Logik des Krieges bzw. seinen logischen Wahnsinn.
Dieses Gedicht schreibt gegen den Krieg an und gegen alles, was seit Troja und Ajas und Pfeil-und-Bogen des Philoktet bis zu kugelsicheren Westen und Kampfmaschinen des 21. Jahrhunderts aufgeboten worden ist und was Städte und Seelen verheert hat – was für ein passender Ausdruck.
Die Benennung als „Gedicht“ deutet auf die artistische Bauweise und Sprechweise hin, auf ein Rollenspiel, wie es mitten im Text einmal so zu lesen ist (VII 12):
Ich bin die Stimme nicht, die spricht, wer spricht
Ein Laubbaum lässt die Blätter fallen, wer spricht
Zur Form des Werkes: Es besteht aus zwölf Abschnitten, deren Überschriften inhaltliche Hinweise bieten wie „Motivation – Orakeldeutung“ (I), „Konzentration – Vorrücken“ (II) oder „Operation – Klopfzeichen“ (IV) usw., jeweils zwei Titel, einen eher abstrakten und einen eher konkret-sinnlichen – etwa „Russische Obduktion – Pfützen“ (VI) oder „Kalkulation – Lawinenverschüttetensuchgerät“ (V). Jeder dieser Abschnitte besteht aus zwölf Passagen (oder Gedichten), die selber wiederum jeweils aus zwölf Versen gebaut sind. Diese sind nicht gereimt und auch in keinem festen Versrhythmus, sondern in einer leicht rhythmisierten Prosa. Also sind es 12 mal 12 mal 12 Verse. Die formale Strenge des Aufbaues kontrastiert mit der Fülle und Reichhaltigkeit des sprachlichen Materials, mit den manchmal wilden, aber kontrollierten Sprüngen der Gedanken und Assoziationen aus phantastischen Abgründen. Klüfte und Abgründe auf jeden Fall.
Dafür steigt die Autorin in Kostüme und Masken, um „wir“ zu sagen, vielleicht um aufzuzeigen, was sie nicht ist, nicht sein will und kann. Aber sie nähert sich diesem Kollektiv, das „wir“ sagt, um es uns wie von innen heraus darzustellen in seinen Monstrositäten.
Tatsache ist: Wir haben den Peloponnesischen Krieg nicht begonnen
Scharmützel, alles auf eine Karte, Beschreibung eines Schildes
Gewiß: wir haben mit dem Peloponnesischen Krieg nichts am Hut
Und als Troja brannte, waren wir nachweislich über alle Berge
Der Krieg ist uns aufgezwungen worden von solchen, die leicht=
Fertig unsere Gegner werden wollten am Rand der bewohnten Welt
Erde verbrannt haben sie selbst angerichtet, Köder ausgelegt, das Hemd
Aufgeschlitzt, damit die nackte Brust, das nackte Mitleid sich paaren
Wir haben Opfer gebracht, um uns selbst nicht unglückselig zu opfern
Als Opfer unserer zukünftigen Gegner, die sich zu spät formierten
Und dringen in rechtsfreie Räume vor in geordneten Textverbänden
Wollen beschrieben (besungen?) werden, damit wir schweigen können.
Dies ist die ganze erste Passage (I 1) als Beispiel für die Verwendung von konkreten Bildern und abstrakten Begründungen, auch dafür, wie die Autorin mit dem „Wir“ umgeht. Der Abschnitt I beschreibt ein Gemenge aus Phrasen von Pflichterfüllung und Befehlsausführung, samt einer technisch genauen Gebrauchsanweisung für das Schießen, um dann den genugsam bekannten Satz der Angriffskrieger als Zitat ans Ende zu stellen:
„Und morgen die ganze Welt“ (I 12). Das wäre wohl „unser“ Ziel, das des Kollektivs „wir“. Aber eine andere Wendung folgt in der nächsten Zeile und konterkariert schon die fragwürdige Motivation zur gemeinschaftlichen Eroberung der Welt, mit dem realistischen Ausblick auf die schmutzige Schlacht: „Wir lagen in Wolhynien im Morast“.
Es ist ein Zitat von Theodor Kramer, dem aus Österreich gebürtigen Lyriker, 1938 ins Exil getrieben. Andere Schriftsteller, auf deren Werke die Autorin zugreift, sind nach ihren Angaben etwa Arthur Rimbaud, Ernst Stadler (Kriegsteilnehmer erster Weltkrieg), Jochen Klepper (im zweiten Weltkrieg ein NS-Opfer), Mein Kriegstagebuch von Benito Mussolini (aus dem ersten Weltkrieg, er vermisste damals im Stellungskrieg gegen die Österreicher „den ganzen Schmuck früherer Kriege“) und andere, zum Teil auch ungenannte Autoren. Ursula Krechel hat ein schöpferisches und kritisches Verhältnis zur Literatur: Sie reiht sich in Traditionen ein, mit denen sie solidarisch sein kann, oder sie zieht, wenn es sein muss, gelegentlich Abschreckendes heran, um Authentizität zu erreichen (Mussolini).
Es bedeutet auch, dass sie nicht einen Anti-Kriegs-Essay vorlegen möchte, sondern dass ihre Kombinationen oder Montagen von scheinbar inkohärenten Elementen und Bildern zu ihrer Poesie gehören, dass diese manchmal hart aufeinanderprallenden Kontraste zur Substanz ihrer Dichtung beitragen.
Weiße Blätter, das Chlorophyll herausgewaschen, nur die Adern
Noch zartgrün, und Spinnen, die ihre sanften Fäden zogen
Von Blatt zu Blatt,…
Ich war ein Zeichen,… ich war
Ein weißes Blatt…
… und das alles im Angriff in der rauch geschwärzten Luft (I 11). Sicher wissen wir, dass Krieg nichts als Tod bedeutet, aber dies, unsere skelettierten Körper in der Metapher der noch zartgrünen Adern weißer Blätter aufzuheben, das ist gewaltig.
Es ist hier weder möglich noch beabsichtigt, den vielfältigen Inhalt des Gedichtes wiederzugeben. Aber ich will auf einige Themen kommen, die Ursula Krechel uns vorlegt oder mit denen sie arbeitet.
Der Abschnitt III „Faszination – Blockbuster Byron“ stellt einen „Helden“ vor, den romantischen Dichter und englischen Lord George Byron, 36jährig in Griechenland 1824 am Fieber gestorben, noch bevor er im Befreiungskrieg der Griechen „haushoch über die Osmanen siegen“ konnte. Aber Pistolen hat er, will das Töten beherrschen und nicht nur durch seine Verse und Dichtungen berühmt sein. „Der Dichter schont die Sprache so wenig wie die Menschen“, und im Zusammenhang erscheint diese privilegierte Überheblichkeit als Zynismus:
„Phantasien sind Kostümproben, mein einziger Feind: die profunde Langeweile“, lässt sie den „Dandy im Exil“ (den Goethe sehr schätzte, ja überschätzte) sagen. Er ist ein Rebell, der zu konventionell ist, der zwar „spitze Verse“ schreibt, ein Mann, den die Nähe des Krieges fasziniert, der aber am Militärischen scheitert. Dieses Scheitern erscheint sogar noch sympathisch. Aber wir sollten uns dadurch nicht vereinnahmen lassen!
Einem mythischen Krieger gilt der Abschnitt XI „Selbststimulation – Philoktet in zwölf humpelnden Schritten“. Wegen seiner unheilbaren Wunde unfähig zu kämpfen, ist der Grieche Philoktet nach der Sage und bei den Dramatikern wie Sophokles im Besitz von Pfeil und Bogen des sagenhaften Herakles, und ohne diese Waffen können die griechischen Helden die Festung Troja nicht erobern. Erst brauchten sie ihn nicht, da ist er unglücklich; jetzt brauchen sie ihn wieder, er kann sich nützlich machen, und „ein Befehl ist ein Befehl“ (XI 6). Was will er persönlich? Frei sein. Was ist die übergeordnete Notwendigkeit? Dass er mitkämpft. Heiner Müller hat ihn zur tragischen Hauptperson eines Stückes gemacht (1968).
Philoktet ordnet sich – in der Sprache von Ursula Krechel – dem „Wir“ unter – Nur die Autorin und wir die Leser wissen, dass er sich täuscht, wenn er sagt:
„Ich sehe mich vereint mit mir“ – er wird nämlich wieder töten, um Teil des Kollektivs von „Kampf, Männlichkeit, Ehrenhalle“ zu werden.
Die Stimmen aus dem harten Kern arbeiten mit der Technik der Verfremdung. Die Autorin verschärft den Kontrast zwischen sich und ihrem Thema – den Eroberern, Siegern, Okkupanten –, indem sie deren sprachliche Wir-Form annimmt. Ist das Gedicht deshalb für Frauen weniger relevant? Ich glaube das Gegenteil, denn gerade das Anprobieren einer fremden Rolle kann sowohl ästhetischen Genuss als auch Erkenntnis bringen.
Frauen kommen im Text vor, nicht oft. Aber es gibt Szenen der Vereinigung, „Körpergewühl, Ekstase, Seufzerglück“, es sind die Invasoren – in der Zweideutigkeit des Wortes –, die „gerettet werden wollen“ in einer Frau, aus einer Frau – „Samen – Amen“. Der Abschnitt VII ist ein besonders wilder dunkel-trauriger Wirbel zwischen beiden Geschlechtern. „Wir fliegen nicht, wir üben und darüber fallen wir“ (VII 12) Diesmal ist es ein „Wir“, das aus zwei Ich entstanden ist, einem weiblichen und einem männlichen, und eine Vogelart, der Zwergsegler – gibt es ihn überhaupt? –, dient als Bild für „Singsang und Einklang, sehnsüchtige Litanei“.
Im Abschnitt „Wilde Spekulation – die andere Seite“ (IX) kommt ein anderes Wir zur Sprache. Es erhebt sich die Stimme der „Wilden“, der Eroberten und Kolonisierten. „Daß wir ein Rohstoff geworden waren“ für die Fremden, die Ingenieure (IX 9). Krieg ist hier im weiteren Sinne verstanden, als Imperialismus, dem die Welt „verfügbar“ erscheint und der in seinem Zugriff auf „Sandelholz“ und „unsere Gene“ die Sachen und Seelen verheert.
Von Paul Celan wird berichtet, er habe die „Undurchsichtigkeit“ für die wahre Eigenschaft der Poesie gehalten. Das Gedicht an sich müsse „opak“ sein, nicht „kristallin“. Wie ließe sich diese Unterscheidung auf die Dichtung von Ursula Krechel anwenden?
Ihre Absicht ist verständlich-kristallin, nämlich klarzumachen, dass für jeden Krieg der „Feind“ erfunden werden muss, dass er eine Konstruktion ist. Aber die dichterische Ausarbeitung, die Präsentation von Bildern, seien sie in beschreibender oder expressiver Sprache, das geht über den Gegensatz durchsichtig-undurchsichtig hinaus:
Staunen, wie eine Kirche brennt, Schreiende darin…
Begegnungen in den ausgeräumten Wölbungen der Macht
Hitze steht darin, auch Geruch von verbranntem Gummi
Schüttere Zedern am Rand, unpassierbar die Furt, Sicherheits=
Abstand: minimal. Der Schatten des Objekts legt sich aufs Ich.
(II 9 und 10)
Das Wir des Kollektivs zerfällt; im Text taucht plötzlich ein Ich auf, nicht ein lyrisches Ich zur Identifikation für den Leser, sondern eine Sprachfigur, die auf die Absurdität des Wir verweist.
Nicht nur in diesem prekären Verhältnis von Ich und Wir, sondern auch in der patchwork-Methode von Montage und Zitieren, im anti-illusionistischen Gestus und in der Dekonstruktion des Mythos (Troja, Philoktet, Lord Byron) hat mich Ursula Krechels Gedicht an T.S. Eliot Das Wüste Land (The Waste Land, 1922/1935; deutsch 1957)) erinnert. Freilich ist es formal anders, strenger gebaut, ich möchte sagen mehr „entpersönlicht“ und klarer strukturiert. Es gehört dem 21. Jahrhundert, bei höherer Temperatur gebrannt und deshalb härter geworden. Aber beide Werke, Krechels und Eliots Gedicht, „begegnen der Verwüstung mit Kreativität“, wie Wolfgang Wicht über das Gedicht des Nobelpreisträgers von 1948 (in einer Ausgabe von 1988) schrieb. Und darum lesen wir diese Texte, ohne Voyeure zu sein, weil sie kostbar sind, wie schon die Epen Homers kostbar waren, auch wenn uns dabei manchmal schaudert.
Höchst artistische Metaphorik verwandelt das Schaudern. Sie handelt von der Teilhabe an den „Schlachten als Schlachtfesten“ und „feldgrau getünchten Säuberungen“, und verwandelt die besprochenen Schrecken in eine andere Wirklichkeit, eine sprachliche. Damit haben wir umzugehen.
Und die Frage nach dem Impuls, aus dem dieses Buch entstanden ist, findet Antwort in der Sympathie (heute sagt man meist Empathie), in den Schwingungen, die es im Leser erzeugt. Er sieht die Mechanismen, nach denen unsere Welt abläuft, hier gespiegelt. Ursula Krechels Spiegelungen sind nicht einfach, sie verlangen viel Aufmerksamkeit beim Entzerren der Verzerrungen. Sie sind manchmal sogar komisch: „Das Pferd, militärisch gesehen, ist der soldatischste Mensch“ (V 12). Sie machen traurig, aber sie machen Auge und Ohr weit für eine höchst verdichtete Sprache, für die das Wort von Charles Baudelaire nicht ganz falsch ist – Poesie hat das Vermögen, „das persönliche Herz zu neutralisieren“ –
Mich hat sie damit überzeugt.
Hedwig Winkler, manuskripte, Heft 170, 2005
Ein besonderes Buch
Ursula Krechel ist eine großartige Dichterin, eine besondere Autorin. Was sie in diesem Buch tut, sie zieht eine Spur durch die Zeitgeschichte. Es ist ein Poem das anknüpft und aufknüpft, das abhängt und hin hängt. Man kann sich darin verlieren, man findet sich wieder, man scheint anzukommen und ist doch so unendlich weit weg. Diese Autorin hat was, sie bringt etwas mit und nimmt uns was weg, um es uns wieder zu geben, um uns da zu lassen, um uns etwas da zu lassen. Das Buch ist voll von Lesemomenten, von himmlischen Zeilen und brechender Schwermut. Es ist Zeit wird das Buch zu dir sagen. Es steht im Raum wie alles was im Raum steht das einfach nur groß ist. Und ich finde diesem Buch ist es gelungen. Die Frage ist nur, ob es dem Leser gelingt sich auf dieses Poem einzulassen. Wenn er es tut, wird er es nicht bereuen.
Hanno Hartwig, amazon.de, 30.5.2013
„Weiche Themen in beinharter Zeit“
Mit ihrem dritten Buch im Salzburger Verlag Jung und Jung präsentiert sich Ursula Krechel nach mehreren Essays und Erzählungen wieder als Lyrikerin. Statt einer Sammlung jüngster Gedichte legt sie ein durchkomponiertes, aus zwölf mal zwölf Texten bestehendes Poem vor. Ein an den Blankvers angelehnter rhythmischer Grundpuls durchzieht das Gedicht, das fernste Zeit- und Kulturräume zusammenspannt: Vom trojanischen Krieg über die Weltkriege des 20. Jahrhunderts bis zu den afrikanischen Völkermorden der Gegenwart folgt die Autorin den Spuren der Gewalt durch die Geschichte. Kühl protokollierend angesichts der Schrecken, sarkastisch sezierend angesichts der ideologischen Verbrämungen des Mordens, messerscharfe lyrische Bildsequenzen immer wieder abbrechend und mit sprachlichen Fremdkörpern konfrontierend, macht Ursula Krechel die Konflikte, die sie beschreibt, auch in den Sprachbewegungen ihres Textes greifbar.
Gewalt erweist sich in ihrem Gedicht als „harter Kern“ des Menschen, untrennbar verflochten mit seinem erotischen Begehren ebenso wie mit seinem wirtschaftlichen Streben. Abgesehen von seiner beeindruckenden kontrollierten Sprachmagie besticht das Gedicht nämlich vor allem durch die hellsichtige Radikalität, mit der Ursula Krechel Themen wie die Kolonisierung und die heutige wirtschaftliche Benachteiligung der so genannten Dritten Welt als ähnlich gewaltsame Akte zeigt wie den offenen Krieg. Die Überblendung europäischer Alltagsszenerien mit Bildern vom Verrecken unter südlicher Sonne hinterlässt beim Leser die Erkenntnis, dass für die Privilegien seiner Existenz unweigerlich jemand in einer anderen Weltgegend bezahlen muss, oft genug mit dem Leben.
Stimmen aus dem harten Kern ist somit ein beeindruckender Beleg dafür, wie welthaltig und „engagierend“ eine zeitgenössische Lyrik sein kann, die sich ihrer sprachlichen und kompositorischen Mittel sicher ist. Und wie Gerhard Falkners jüngst erschienenes Langgedicht Gegensprechstadt – ground zero belegt auch Ursula Krechels neues Buch: Langen Gedichten ist es eher möglich, diese Art von Diskursfähigkeit zu wahren. Statt ihren Gegenstand entweder in einer hermetischen Chiffre zu verrätseln oder ihn plakativ zu benennen, können sie ihn in mannigfacher Brechung umkreisen – so oft, bis er dem Leser unübersehbar vor Augen tritt, ohne dabei seine lyrische Vieldeutigkeit einzubüßen.
Gerald Fiebig, satt.org, Dezember 2005
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Kirstin Breitenfellner: Ein Buchtip
readme.cc
Ute Eisinger: Verflüchtigung des Erlässlichen
literaturkritik.de, September 2005
Silke Scheuermann: Wortfindungslust pur. Laudatio zum Orphil-Preis
Ein Gedicht und sein Autor: Ursula Krechel und Jan Wagner am 17.7.2013 im Literarischem Colloquium Berlin moderiert von Sabine Küchler.
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Andreas Platthaus: Keine Magermilch, und bloß keine Kreide
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.12.2017
Landesart: Ursula Krechel zum 70.
SWR, 2.12.2017
Fakten und Vermutungen zur Autorin + KLG + IMDb + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
Bogenberger Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Ursula Krechel – Neue Dichter Lieben, Komposition und Klavier: Moritz Eggert, Bariton: Yaron Windmüller, Expo 2000 Hannover.


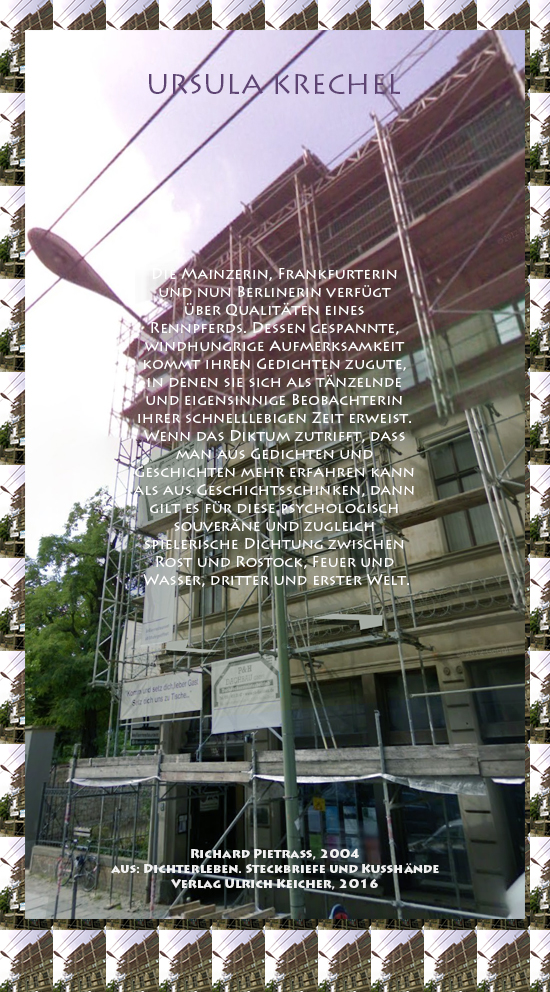












Schreibe einen Kommentar