Wolfgang Hilbig: Werke Band 1 – Gedichte
MONOLOG AUS EINIGEN TAGEN MEINES LEBENS
Im Innern ruht der Wille,
doch ein Ziel, das ist so weit
und das Ziel heißt: Freier leben,
doch das ist keine Kleinigkeit.
Das zu erreichen mußt du lügen,
reden wider den Augenschein.
Laß dich dabei nicht unterkriegen,
im Lügen mußt du besser sein.
Besser als die Andern,
denn die Andern sind die Macht.
Als die Macht sie sich erkauften,
haben sie auch nicht an dich gedacht.
Nach der Freiheit stark zu streben,
sei des Menschen stetes Tun,
denn die Freiheit läßt im Leben
des Menschen Unglück schneller ruhn.
drum sprich auch mal für deine Zeit,
wirst zwar ein Gesinnungslump,
doch Freiheit ist keine Kleinigkeit
und wär’s nur ein bißchen auf Pump.
Es hat keinen Zweck, darum herum zureden
− Ein Nachwort zu Wolfgang Hilbigs Gedichten, Thomas Beckermann zugeeignet. −
Die lange während Symbiose mit dem Tod lehrt uns
alles; durch sie wissen wir alles.
E.M. Cioran
Denken wir daran, dass der Poet (sei er Dichter, Sänger,
Maler oder Bildhauer) nicht die Marke des Pegels ist,
unter der die anderen Menschen dahinkriechen;
die Menge ist der Pegelstand, und er, er schwebt.
Stephane Mallarmé
Bei Gelegenheit einer gewöhnlichen Schreibkrise Wolfgang Hilbig zu treffen, war ein Segen. Sprach ein Kollege ihm gegenüber davon, den Einstieg in einen Text nicht zu finden, so war seine Antwort: Beginne einfach mit dem Satz, dass du den Anfang nicht findest.
Ich finde den Anfang nicht zu einem Text über Wolfgang Hilbigs Gedichte. Das ist überhaupt nicht gut, wo es um das Nachwort zum ersten Band einer Werkausgabe geht. Ein Wunder ist es nicht. Das Gelände ist bestellt, um nicht zu sagen vermint. Die Deutung der Fakten seiner Biographie ist in dreißig Jahren seiner öffentlichen Existenz als Schriftsteller geschehen, und zwar von Anfang an und quasi unumstößlich. Akademische Welt und Literaturbetrieb – soweit beide nicht miteinander identisch sind – haben gesprochen. Ausführliche, positive Rezensionen begleiteten seine Bücher, die wichtigsten westdeutschen Literaturpreise begleiteten sein Leben, das zweite jedenfalls, das 1979 begann, mit der Veröffentlichung des ersten Gedichtbands unter dem Deutung anlockenden Titel abwesenheit im westdeutschen S. Fischer Verlag, sowie (vielleicht) das dritte von 1985 an, da er Pass und Ausreisevisum der DDR erhalten hatte und den ostdeutschen Staat verlassen durfte, um in Hanau und Nürnberg, dann, nach einem Stipendienaufenthalt, im schönen Edenkoben in der Pfalz zu leben, bis er in den 90er Jahren nach Berlin zog. Nach 1989/90 machte ihn seine Prosa sogar zu einem beinahe populären Schriftsteller.
Die Deutung also ist geschehen: Der Arbeiter, der ein Schriftsteller ist, der Schriftsteller, der ein Arbeiter ist, beide dem Milieu nach DDR für immer, mit DDR-Themen und -Anruch… Wie Leben und Werk bei diesem Dichter eins sind, so stammen die meisten Fährten, auf denen da gegangen und gedeutet wurde, von ihm selbst.
Um angemessen über Wolfgang Hilbig zu schreiben, muss man etwas nachvollziehen, das er vorgelebt hat: Sich zurückziehen auf ein Gebiet, das nur einem selbst gehört, sich abschließen von der Welt, als sei man ein Verächter derselben. In meinem Fall nach tausenderlei Entschuldigungen. Es ist ein Gebiet, auf dem nur Dichtung wohnt. Ein Raum, in dem es dämmert, in dem sich nichts regt jenseits eines unsichtbaren Fiebers. Vollkommene Verbundenheit mit der Welt in vollkommener Abgeschiedenheit von ihr. Man muss sich zurückziehen auf das Wesen, von dem Benn sagt, es sei „der Tendenz nach asozial“, so eines, wie es Wolfgang Hilbig hatte. Also versuche ich zu schweben
so wie dieser Mann – mit sich allein, abgeschlossen wie Bonaventura, der die Welt überschaut und detailliert wahrnimmt, wenn es allüberall finstere Nacht ist −, wie dieser zu schweben, ohne die Fähigkeit zu haben, die er selbstverständlich und vermutlich von allem Anfang an hatte. Jene, die hier die Statur des lebendigen Mannes vor sich sehen, werden schmunzeln, aber auch dieses Schmunzeln, wenn nicht gar ein ungeniertes Lachen gehörten, ach was!, gehören dazu.
Sein Einzelgängertum war etabliert und allseits anerkannt. Freunde litten darunter, auch „naturgemäß“ sein Verlag und jene, die ihn einladen wollten, unter ihnen zu sein, Gedichte zu lesen, jene, die ihn mit einem der vielen Preise, denen er würdig war, ehren wollten. Was wir seit der ersten Begegnung davon hatten und für immer davon haben, ist seine Dichtung. Es gilt ein Phänomen zu beschreiben, das in der Literaturgeschichte nur gelegentlich vorkommt. Für unseren Sprachraum mögen die Namen Hölderlin, Trakl und Rolf-Dieter Brinkmann stehen. Es sind Leben, die sich radikal umgewandelt haben in künstlerischen Ausdruck, und deren Kunst nicht leugnet, das jeweilige Leben zu spiegeln. Es sind solche, von denen wir alles erfahren, aber auch erfahren wollen. Dabei ist im Werk alles Private getilgt (bei Hölderlin und Trakl und Hilbig). In unserem Fall ist es ein Leben, das im Nachhinein betrachtet nichts anderes hervorzubringen in der Lage war als Dichtung. Dazu wurde es gelebt. Absolutheit und Pathos dieser Feststellung folgen aus der Lektüre der Gedichte von Wolfgang Hilbig. Es hat keinen Zweck, darum herumzureden.
In einer Rezension zu dem Gedichtband Bilder vom Erzählen lesen wir: „In dem Gedicht Die Zisterne heißt es rührend ungeschickt: Einmal ihr Musen noch blättern / im Traumbuch der Moderne.“ Der freundlich herablassende Rezensenten-Satz belegt zum einen das Missverständnis, das der Begegnung des akademischen Literaturbetriebs mit diesem Dichter stets innewohnte, zugleich jedoch weist er mit dem, was er oberflächlich zitiert und von seinem Katheder herab kommentiert, auf den Kern dieser Dichtung. Der war allerdings auch kaum zu verfehlen. Hilbigs Gedichte stellen sich freiwillig und von Anfang an in die Tradition der dichterischen Setzung und des Sagens in dem Sinne, dass ein höherer Auftrag aus ihnen spreche. Es handelt sich fraglos um ein Amt, in das die Person als Mund eingesetzt ist, das schreiende amt. Die Anspielung an die homerische Anrufung der Musen ist bei weitem nicht der einzige Hinweis darauf, dass hier keine Berührung gescheut wird. Insbesondere nicht die mit der Antike, weder mit der Odyssee noch mit Herodots Historien noch mit der Art, wie die Cantos von Ezra Pound oder James Joyce’ Prosa mit den Mythologien und historischen Vorlagen verfahren. Und ob der offensichtlich ironische Bruch zur hochreflektierten zweiten Zeile jenes Quasi-Sonetts Die Zisterne vom Traumbuch der Moderne direkt auf Mallarmé zurückgeht, dem wir allentwegen und in vielen Ebenen der Gedichte begegnen, oder ob dieses Traumbuch ein allgemeines und jenes der Moderne eine Hilbig’sche Findung und eine gar feine Denkaufgabe ist, der sich dereinst die junge Autorin einer Dissertation hingeben möchte, steht dahin. Vielleicht variiert der Dichter auch nur sein berühmtes Gedicht „episode“, wo wir über den gleißenden Fasan auf dem Kohleberg im Kesselhaus lesen, er war herrlicher und schöner / als ein surrealistischer regenschirm auf einer nähmaschine.
Hilbig spricht selbstverständlich in einer Tradition, und zwar in der größten, wo die Luft dünn ist, wo schwächere Talente bekanntlich in den Kitsch umfallen. Oft hat dieses Sprechen den Charakter erhellenden Zugriffs. Dass sich durch die Gedichte ein Strom von direkten Zitaten zieht, gehört dazu. Sie teilen diese Leidenschaft für das gelegentlich Sprunghafte, die Technik der Collage mit den Surrealisten. Charakteristisch ist es auch für die Kunst des „miglior fabbro“, des von T.S. Eliot als größtem Verse-Schmied oder Vers-Schlosser verehrten Ezra Pound.
Worum es in Hilbigs Aufnahme des allzeit missverstandenen und aus geistiger Schmalbrüstigkeit geschmähten l’art pour l’art jedoch vor allem und unverblümt immer wieder geht (alles andere als „rührend“): um Abstand vom Anstand, um die düsteren Lüster dicht unter den schäbigen Bodendielen der guten Stuben, um Sex und sogenannte Laster, um die Freude am bedingungslosen Gesang, ob er Tabus verletzt oder nicht oder überhaupt welche tangiert, ganz egal, nur frei sei er, frei wie der wirkliche und der bildliche Abschaum dessen, was die Gesellschaft (jegliche) ausspeit. Und um die Verweigerung der Moden geht es, auch literarischer, ja, um gesunde Abscheu vor dem Sprachbrei der sechziger oder neunziger oder welcher Jahre vor oder nach der deutschen Teilung auch immer. Bei diesem Meister, der sich zeitlebens als Lehrling verstand, erfuhr das Ganze selbstverständlich frühe Verschärfung dadurch, dass rings um ihn die Kleingeisterei des Realsozialismus herrschte. Dieses konkrete Elend, diese lebenspraktische und geistige Öde hat den Abstand zu den unbilligen Forderungen jeglicher Art, es hat die Lust an der Verweigerung vervielfacht. Verweigerung, die der Stern der Geburt bei einem Halbwaisen anzettelte, dessen Vater in der Gegend von Stalingrad geblieben war und der dann in jener Zone respektive jenem jungen deutschen Teilstaat aufwuchs, der zu lange so tat, als könnte er mit der deutschen Geschichte brechen oder sich die Rosinen des „Guten, Wahren, Schönen“ aus dem verbrannten Kuchen der deutschen Kultur holen. Der Schmerz der abwesenheit war groß – die Abwesenheit von der Teilnahme am sozialistischen Gesellschaftsspiel aber wurde gewiss nicht vermisst und war kaum gemeint.
Hilbig war mit seiner Haltung und in seiner Konsequenz nicht allein: Die ausgegrenzten und sich ausgrenzenden Schriftsteller Gert Neumann, Heide Härtl, Siegmar Faust waren seine Freunde. In diesem Kreis gingen die Lektüre und der Disput darüber herum, Lektüre all dessen, was verboten war, was lange oder in manchen Fällen bis zum Ende des Dreibuchstabenlandes DDR auf dem Index stand. Es waren offenbar nicht in erster Linie Orwells oder Solschenizyns Bestseller. Solcherart Konterbande wurde gewiss auch eingeschmuggelt. Aber die in unserem Zusammenhang wichtige, weil für Hilbigs Werk konstituierende, ist eine ganz andere, in einem tieferen Sinne subversive, das herrschende Gesellschaftsspiel außer Kraft setzende. Es ist jene, die mit der klassischen Moderne französischer und englischsprachiger Provenienz beginnt und die in Stilistik, Anspielungen und ausgestellten Zitaten in Wolfgang Hilbigs Gedichten gespiegelt, anverwandelt, lebendig erhalten wird: Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Poe, Eliot. Die Surrealisten, Apollinaire, Breton, Benjamin Péret. Die Rede ist von den Außenseitern: Celine und Ezra Pound, Stefan George und d’Annunzio. Die Rede ist von radikaler Kulturkritik: de Sade, Nietzsche, Bataille, Cioran. Die Rede ist vom Anspruch und der Schönheit unorthodoxer Prosa: Kafka, Joyce, Bruno Schulz, Gombrowicz, Beckett. Die Rede ist von Helden wie dem Dulder Ulyss und dem Ewigen Juden Ahasver oder von Melmoth, dem Wanderer – ein anderer schritt im spiegel / ein anderer vorwand zur lust −, von Getriebenen, denen die Ankunft in der gewöhnlichen Wirklichkeit aus tiefen Gründen verwehrt wird, deren Unterwegssein unausweichliches Schicksal ist, ananke, mit gesunder Verachtung angenommen. Nicht zu vergessen die Suchterfahrenen wie Malcolm Lowry oder William S. Burroughs. Ein elitärer, vielleicht sogar arroganter Klüngel, könnte man sagen. Das könnte dieser Kreis tatsächlich gewesen sein in den vergammelten Gründerzeitbauten Leipzigs in den 1960er und 70er Jahren, ein Kreis von wieder auferstandenen Poetes maudits. Ein sich des Verlorenseins bewusstes Grüppchen von Verlorenen, die das Verlorensein feierten und ihm Kunst abzugewinnen suchten. Hilbig ist der erfolgreichste von ihnen geworden. Der erfolgreichste Verdammte.
Vielleicht hat das damit zu tun, dass die romantische Seite seiner Muse stark genug ist, uns zu erreichen. Vielleicht kommt es auch daher, dass der vielfach in die Gedichte eingeschriebene Ekel immer wieder „scheitert“ am Pathos der Gewissheit, dass da Schönheit sei… oder vielmehr kommt es daher, dass dies Ekelhafte eben die dunkle Version des Schönen ist, einzig noch auf uns gekommen, die wir in Zeiten der Selbstzerstörung der Gattung leben und eine andere Fassung, ein anderes Bild nicht mehr haben… Kleinere Münze, pardon!, haben wir nicht. Und dass die Welt dieser Gedichte mehr mit dem Menschenbild und vor allem mit dem ästhetischen Anspruch des fin de siècle zu tun hat als mit den Verkrümmungen des Einzelnen in der sozialistischen Diktatur, das steht nur zu deutlich darin.
Wolfgang Hilbig war Arbeiter von Herkunft, Wesen und Stolz, Dichter von Berufung und Stolz sowie als Dichter Autodidakt (und auch darauf stolz), und all das ist er unter dem Namen und Deckmantel eines erfolgreichen Schriftstellers bis zum Schluss geblieben. Seine Gedichte gehen ständig mit dieser Zwickmühle der Ansprüche an sich selbst um, sie sind in einem starken Aspekt poetologisch. Das teilen sie, in Pathos und Emphase, mit manchen Strophen Hölderlins wie beispielsweise in „Dichterberuf“: „Zu lang ist alles Göttliche dienstbar schon / Und alle Himmelskräfte verscherzt, verbraucht / Die Gütigen, zur Lust, danklos…“ Die Rede ist von demselben Schmerz des dichterischen Sprechens und dem, der nun nicht anders kann, und „dem dann auch nicht zu helfen ist“ (Franz Fühmann), von einer Sendung, die nicht ankommt dort, wo sie ihrem Selbstbewusstsein nach hingehört:
alles das letzte ist uns zerstört unsere hände
zuletzt zerbrochen unsere worte zerbrochen: komm doch
geh weg bleib hier – eine restlos zerbrochne sprache
einander vermengt und völlig egal in allem…
Und nun las dieser von der Abwesenheit verstörte, zerstörte junge Mann:
April ist der grausamste Monat, er treibt
Flieder aus toter Erde, er mischt
Erinnern und Begehren, er weckt
Dumpfe Wurzeln mit Lenzregen… ich war weder
Tot noch lebendig, und wußte nichts,
Schaute ins Herz des Lichtes, des Schweigens.
öd und leer das Meer
T.S. Eliot: The Waste Land.
Und Hilbig antwortete und variierte immer wieder:
aprilmeere grünverschneit
fluchtwogen unverhoffter horizonte… nur küsten traum
und schleierkraut
erfände ich mich selbst
blieb von der flutgezeit
ohne dein leuchten nichts an meiner kalten haut
die tod umkreist…
Wir könnten ein Hilbig-Gedicht diversen Quellen zuordnen, nein, nicht den eigentlichen Quellen, die bleiben Vermutung, wenn der Dichter es nicht anders will, und das Gedicht ist ja nur in Teilaspekten angeregt von Lektüre. Doch auf Herkunft können wir schließen, auf einen Abgrund verschiedener Abkunft, auf den Mutterkuchen der Lektüre, auf die ewig frische Grube, die Odysseus einst auf Rat der Kirke hin aushob, um einen Eingang zur Unterwelt zu öffnen, in dem er nun dem Seher Teiresias und seiner toten Mutter begegnete und seinen vor Troja gefallenen Kameraden. Dort will mir diese Dichtung herkommen, aus einer solchen vom Blutopfer schwarzen Grube, die einer sich selbst zu öffnen vermag, aus so einem Unterwelt-Eingang. Gedicht ist, was aus Erinnerung hergestellt wird, was einer aus ihrem Diktat macht. Selten handelt es sich um die bewusste, täglich verfügbare, oft nicht einmal unbedingt um die eigene Erinnerung. Auf der Insel Kirkes, mächtig als Zauberin und als Liebende, sind wir mit dem englischen Dichter Robert Graves auch schon im weiten Reich der omnipotenten „weißen Göttin“, von den Römern und ihren Abkömmlingen Luna genannt und oft genug trivial angehimmelt. Hier lernen wir, dass diese mächtige Dame in ihrem grausam fordernden – und den Dichter Hilbig beherrschenden Nachtaspekt die Herrin der Unterwelt ist. In Novalis’ Heinrich von Ofterdingen trägt eine ihrer Inkarnationen den Namen einer lieblichen Jungfrau:
Er sah hinauf, und der blaue Strom floß leise über ihrem Haupte. Wo sind wir, liebe Mathilde? Bei unsern Eltern. Bleiben wir zusammen? Ewig, versetzte sie, indem sie ihre Lippen an die seinen drückte und ihn so umschloß, dass sie nicht wieder von ihm konnte. Sie sagte ihm ein wunderbares, geheimes Wort in den Mund, was sein ganzes Wesen durchklang. Er wollte es wiederholen, als sein Großvater rief und er aufwachte. Er hätte sein Leben darum geben mögen, das Wort noch zu wissen.
Da haben wir die Initiation des Dichters, und sie geschieht in einem Traum, in dem das Leben unter Wasser, im Jenseits, selbstverständlich weitergeht. So ähnlich muss es bei Wolfgang Hilbig geschehen sein. ach ich habe das wort geträumt doch ich hab es vergessen, heißt es in dem Gedicht zeugung, in dem auch von einem aquaralen keller die Rede ist und von etwas Seltenem, fast Unerhörtem: meine liebe gestillt. Im Hause des Bergmanns-Großvaters lebend, in einer kleinen grauen Stadt an den Gestaden von jenem meer in sachsen, das ein unterirdisches, gepreßtes, schwarzes Meer der Kohle ist. Die Liebe wird gestillt, die Sehnsucht erfüllt, nicht in den glanzlosen Gefilden der „langweiligen“ grauen Heimatstadt, sondern an einer viel dunkleren, unerhört produktiven Quelle.
Wir sind ganz nahe an dem, worum es geht, genau da, wo diese Gedichte siedeln. Weder von dieser Nähe noch von ihrer Speise selbst kann man allzu viel nehmen, und dies alltäglich zu tun, wird auch nicht empfohlen. Es wird Rausch ohne Wein sein, auch wenn der Durst übermäßig ist, dieser grandiose durst als die letzte verlockung, der eine Metapher ist, in der Lage, wirklichen Durst auszulösen, nun jedoch der Wort – Rausch des Geistes am Rand der von Lebenden bewohnten Welt. Unheimlich ist uns. Die Säulen des Herakles haben wir hinter uns gelassen, alles Vertraute versinkt. Das ewig finstere Land der Kimmerier ahnen wir irgendwo voraus. Der sindbadischen Seefahrts- und Meermotive sind Legion, der Unterweltmetaphern nicht minder. Das ist Hilbig-Land. In der Verbeugung vor dem Romantiker Novalis, einem Sonett, erkennen wir eines der vielen Selbstporträts (-portraits!):
ich ging von ihren tischen voller speisen
hinaus und trank im saal der schatten
…
allem ledig seh ich nun vor meinen füßen
licht zerspringen und die hohen nächte grüßen
mit freiheit mich und ich hab raum
für meinen schmerz in dem die liebe ruht
und gottesnah und frei von hab und gut
geh ich und unerschöpflich wird mein traum.
Wie sollte er es nicht? Wenn einer mit den Toten Brüderschaft getrunken hat, wenn er einer der ihren ist (revenant: was wenn ich wiederkomme hat mich ausgespien… aus maßlos totem mondlicht…). Mehr Freiheit ist nicht zu denken als die Freiheit der Toten, der Wiedergänger, derer, die die Halden bevölkern im sächsischen Hades und die Dörfer, die lang schon der Bagger geholt hat, und ebenso die Hades-Nächte der Großstadt – der nicht mehr relative raum des todes −, sichtbar sie alle nur dem, der einer der ihren ist, gewachsen aus großen traditionen von tod. Liebesnächte kennen sie selbstverständlich auch, diese freien Geister. Die scheinen nur – wie sollte es anders sein in diesem Milieu? – aus dem Schauerroman zu stammen:
es huschten jäh sekundenlange
bleiche blitze des mondes matt
übers bett und uns.
Ich bin dabei, Verrat zu begehen. Es läuft darauf hinaus. Ein Verdacht und ein Klischee, welche die Literatur und insbesondere die Dichtung begleiten, sagen bekanntlich, sie seien für diejenigen, die ihnen frönen, die schreiben und mit dem Schreiben hier und da sogar ihr materielles Dasein fristen, wesentlich Sublimierung. Das stimmt. Es wäre banal, dies zu leugnen. Kein Dichter unter uns war im Hinblick darauf so ehrlich wie dieser, keiner hat so genau sich selbst, seinen Ort, die Orte seiner Verletzlichkeit bezeichnet, sie uns, den Lesern verraten, sie also verraten (ich folge ihm nur mit meinem Verrat!), jedoch tat er es um den Gewinn eines poetischen Sprechens, das offenkundig nicht anders zu haben war: haar; traum; nacht; schlaf; durst; sonne; wind; leib; lust; mund; trinken; schmecken; trunken; rose; gras; regen; baum; licht; phosphor; feuer; flamme; dunst; duft; schweiß; sturz; tod; blau und, als Quintessenz: durst. So die markanten und markierenden, das Werk charakterisierenden Worte, auf die schon Franz Fühmann hinwies – und so hockt er am tisch der fremde / wenn ich allein im zimmer bin. Der Tisch im Heizungskeller der Fabrik, noch mehr Archetyp jener in der Küche in Meuselwitz, beide mit ihrem Wachstuch: … auf dem tisch liegen meine ellenbogen und im Schattenriss im Vordergrund des Fernsehbildes die Mutter … und schweigen. Als ich dieses Bild sah – so eingenickt vorm fenster in den lauf der regentropfen −, im Zweiten Deutschen Fernsehen aus Anlass des Erscheinens des Romans Das Provisorium, dachte ich, was für ein großes Tabu nun gefallen sei. Und was nun −. Das ist nicht irgendein Großschriftsteller, der sich vor seiner Jagdhütte oder an seiner Schreibmaschine oder in seinem Ohrensessel ablichten lässt. Das ist ein Dichter, der sein genuines poetisches Material, der seinen Ort ausliefert. Es hatte etwas davon, Hölderlin im Turm zu besuchen.
Gewöhnlich sollen das Leben einerseits und die Dichtung andererseits möglichst wenig miteinander zu schaffen haben, es ist von der Sprache die Rede, wenn öffentlich über Gedichte gesprochen wird, während doch in den Gedichten – weiß jeder, für den sie nicht zur Seite des Papiers gehören – vom Leben die Rede geht. Es ist ein gottverdammtes Versteckspiel, an dem so viele Personen beteiligt sind, dass alles andere außen davor bleibt im Verlauf des Prozesses, der seit Erfindung der Schriftstellerei und ihres Trägers, des sogenannten Schriftstellers, also seit etwa 300 Jahren stattfindet. Und jede und jeder wird naiv geschimpft, die oder der die Brücke zwischen Leben und Literatur betritt, wenn er es nicht mit dem Vokabular tut, das in denselben Jahrhunderten eben diesen Verbindungsweg als Vorschrift überwuchert hat. Halten wir uns dennoch wacker auf dieser Brücke. Hören wir diese Stimme, den schweren, konstitutionellen sächsischen Dialekt, welcher aber nie den Eindruck schmälerte und nie die Hochachtung. Es war da immer ein Abstand, war immer Raum um Wolfgang Hilbig herum. Zum einen entstand er aus Verehrung, das fraglos, denn Bewunderung, Verehrung umgab den meist stillen Mann immer, den still trinkenden, rauchenden, hustenden Mann, von dem alle, die mit ihm um etwelche Tische herum saßen, wussten oder rasch ahnten, wie groß er war. Auch wenn er eine Anekdote aus dem Arbeiterleben in rüder, direkter Art zum besten gab, bestand der Abstand, auch wenn alle Tränen lachten. Oder auch dann, wenn die Bitterkeit im Raum waberte und nicht abzog, die aus dem Zigarettenrauch und den fast toten Gedanken in der stehenden Zeit sich zusammensetzte, selbst oder vielleicht gerade dann gab es keinen Zweifel: Dieser Dichter war einer, während jene, die in seiner Nähe herumlungerten, oft ahnten oder wussten, dass sie es in der Art, wie er es war, nie sein würden. – Woher diese Aura um einen Mann, mit dem schwer ein Gespräch zu führen war auf die gewohnte Art? Wenn die gewohnte Art eine analytische war, eine der Untersuchung, was Poesie sei oder wie das Gedicht bestehen kann in geistfeindlicher, geistferner Welt oder, dann, später, in der Wüstenei des Konsums. Oder wenn unsereiner vom Woher und Wohin plauderte, Namen fallen ließ, tratschte. Mit Hilbig waren solche Gespräche nicht in der gewohnten Art zu führen. Da ragte viel Schweigen herein. Und dieses Schweigen schuf Abstand. Trotz des Biers, das wir tranken, das andere tranken, das alle mit ihm getrunken haben, das viele Bier, das nie so beschrieben worden ist wie in seiner Prosa. Apokalyptisches Bier.
Als der Mann Hilbig in die obere Etage des westdeutschen Literaturbetriebs aufstieg auf eine seltsame Art, wie unfreiwillig, wie unbeteiligt, wie ahnungslos, wie somnambul…, als das geschah, von der Mitte der achtziger Jahre an, als er mit einem Dauervisum nach Westdeutschland kam, gab es für ihn Gründe, einen Psychiater aufzusuchen, sagen wir einmal, in der Stadt Nürnberg. Und gehen wir einmal davon aus, dass es sich um einen der Versuche handelte, die Alkoholsucht in den Griff zu bekommen. Der Psychiater jedenfalls sagte nach einer der wenigen Sitzungen zu ihm, er würde ihn auch gern weiter privat zu Gesprächen treffen, aber heilen könnte er ihn nicht. Die Einsicht des Fachmanns gereicht seiner Zunft zur Ehre. Was er erkannt hatte, hat sonst nämlich weit und breit kaum einer gesehen: die Tode, die diese Person schon gestorben war und, dass jeder Tag, den sie weiter lebte, ein Geschenk war, und den nicht psychische Konstellationen, sondern geistige Tunnelarbeit zu bestimmen hatte.
Ein Dichter von seiner Herkunft ist und bleibt gespalten. Wir haben davon auch und mehr in seiner Prosa gelesen: vom Hadern, vom Zweifeln des Arbeiters, der dem Schriftsteller in sich mehr und mehr nachgibt. Und wiederum vom Schriftsteller an seinem Tisch, der den Arbeiter beschwört, welcher ihn nun bedrängen wird, dieser Alter-Ego-Arbeiter und seine eigentümliche Wahrnehmung der Welt. Schließlich wird immer unklarer, wer spricht. Es sind Dr. Jekyll und Mr. Hyde, nur einander näher und in sich komplexer. Wie in jener Story kann der eine nicht ohne den anderen leben, obwohl die Aktivität des einen den anderen erst hervor-, das heißt ans trübe Licht der Nacht gebracht hat. Der eine versucht vom anderen getrennt zu leben, der Andere weiß vom Einen nichts, der eine will vom anderen nichts wissen, doch längst durchdringt das Leben des einen das des anderen und sie können, ach sie wollen ohne einander nicht mehr leben. Beide sind schließlich, wie im Gedicht García Lorcas von den beiden Tauben, dieselben.
Wir hören Wolfgang Hilbigs Stimme in einem Rundfunkinterview von 2001:
Man muss sich immer rechtfertigen, warum man Schriftsteller ist, ja, vor Lesern, glaube ich…, man ist ja als Schriftsteller so ’ne Figur, die eigentlich den ganzen Tag nichts tut, wenn man nicht schreibt…, sondern nur nachdenkt über das, was man schreiben könnte, das sieht nach außen eher wie Müßiggang aus… Das muss man vor sich selbst… rechtfertigen…, man vertut eigentlich sein Leben. Man hat das Gefühl, sein Leben zu versäumen.
Wer spricht? Der Jekyll-Schriftsteller oder der Hyde-Arbeiter? Oder ist die Rollenverteilung nicht eher anders herum? Ist der Arbeiter nicht die helle Figur, die sich sehen lassen darf, zu der man sich bekennen kann, wie weit unten ihr Stand in der (Flimmer-)Welt öffentlichen Interesses und öffentlicher Bewertung auch sein mag, die allemal ihren Stolz, ihr Ehrgefühl aus sich selbst bezieht mit schöner Selbstverständlichkeit („Ich bin Bergmann, wer ist mehr?“)? Während dieses Nachtschattengewächs von Dichter in seinem zwischen Ohnmacht und Größenwahn siedelnden Tun etwa in Heinrich Heines „Wintermärchen“ davon träumt, es tauche seine Finger ins eigene offene, blutige Herz und markiere Haustüren, in welche die Tat seines Gedankens hernach eintritt als düstere Gestalt mit dem Beil und mordet. Der Arbeiter hebt sich davon ab als redliche Figur. Dichter sind gefährlich, man darf ihnen auf keinen Fall trauen. Sie geben sich unüberschaubaren Exzessen des Worts hin, in denen alles möglich ist, ach, sichtbar wird, das sonst unter der Bettdecke bleibt, außerhalb des Lichtkegels. Ob schön oder hässlich, ob erhaben oder schäbig, sie spülen es in der Suada ihrer Verse so weich, dass wir oft erst nach dem Rausch erkennen, wie schamlos wir an ihrer Seite geworden sind, wie weit wir gehen an der Hand dieser Verführer. Wer hat es sie gelehrt, so unverfroren ihre räder ketten transmissionen zu gebrauchen? Gut getarnte dritte griechisch faule metren hektikdithyramben? Wer hat sie geheißen, in die Bibliothek von Babel einzusteigen, vermutlich nachts ohne legalen Leihschein, vermutlich in einem Alter, in dem ihre Eltern besser auf sie hätten aufpassen sollen, das augenverderbende Lesen mit der Taschenlampe unterbinden, wo sie das ihnen angenehme Maß entdeckten, einen Rhythmus erlebten, von dem es bis zur Erfindung des eignen (Vers- )Maßes nicht mehr weit war. Hilbigs Tendenz zum Jambus, der Wechsel vom Blankvers zum Alexandriner, das Umspielen des Sonetts, der geschmeidige Odensatz, das trickreiche Enjambement und überhaupt seine Regelverletzungen, diese kalkulierten Stellen, an denen der Leser aufschreckt, weil er zuvor ausgeliefert war einem, das so lauwarm lullt! – oh noch einmal einen abend ausruhn / vor der unendlichkeit der nacht… contra regenzersägtes licht / rosa neon befällt gestreift die straße / die grenzen des landes meiner generation / sind fließend / gezeichnet von blut / und kastrationsurin.
Es gibt grundsätzlich zwei Kreise von Personen oder, in einem anderen Jargon, zwei Schichten der Gesellschaft, die von außen auf das Gedicht und auf seinen Produzenten schauen. Die eine Schicht ist von Berufs wegen mit dem Gedicht befasst – und zuweilen mit der überlegenen Deutung gegenüber dem Urheber und dem von ihm Produzierten. Aus ihr jedenfalls rekrutiert sich der professionelle Leser und Kritiker, der das Bild des Dichters gern noch einmal bestätigt: es ist das uraltvertraute vom Genie und vom Dummkopf gleichermaßen. Die professionellen Deuter liefern für ihre Kolleginnen und Kollegen, für die Lehrer in den Schulen die Matrix für den Kanon, der stets ein wenig erweitert und neu justiert wird. Ein schrumpfender Kanon im Meer der Literatur zwar, aber doch einer: Was und wie ein Gedicht sei, wird festgelegt, der jüngeren Entwicklung des Gedichts nachgeforscht, nachgesetzt, hinterdrein geschaut.
Die andere Schicht, der andere Kreis derjenigen, die auf das Gedicht von außen schauen, das ist die alphabetisierte Allgemeinheit. Diese Menge Mensch umfasst erstinstanzlich die treue Mutter und den untreuen Vater des Dichters, die grundlos traurige Schwester und den eifrigen Neffen, die sinnliche Cousine, die mystisch veranlagte Großmutter und den wohlwollenden Großonkel; und die Freunde; und vielleicht noch den Mann oder die Frau an der Seite des Dichters; und die Leserin, ja, die Leserin. Das gilt nicht nur für Wolfgang Hilbig, doch für das Umfeld eines jeden, dessen Berufung das Gedicht ist, für seine Zwangslage. Das Ja oder das Nein, Zustimmung oder Ablehnung, die über ein Gedicht bestimmen, die nämlich entscheiden, ob es eines ist, kann aus beiden Gruppen kommen. Beide bestimmen immer wieder neu über Wohl und Wehe jenes „Flimmertieres“ (Benn). In einem Gespräch mit Harro Zimmermann sagte Wolfgang Hilbig: „In bezug auf Lyrik reagiere ich allergisch auf unhaltbare Ergebnisse. Gedichte sind für mich die Essenzen literarischer Arbeit.“ Doch zum anderen ist es so – und noch einmal hören wir Hilbigs Stimme aus dem Jahr 2001:
da bin ich vielleicht mir selber gegenüber zu rechtfertigungsbedürftig, also ich muss mich jeden Tag rechtfertigen, dass ich Schriftsteller bin, jeder Text ist auch ein Rechtfertigungsversuch…
Wer sitzt in ihm? Wer nimmt ihm die Luft? In unserem Fall hat die zweite Gruppe die tatsächliche Macht, übt sie Gewalt aus, weil sie tief im Dichter selbst haust, weil sie ein Teil von ihm ist. Man gestatte, dass ich die zwei Fragen persönlich beantworte. Was in die literarische Konstitution dieses Dichters eingegangen ist, ist ein Stück weit auch meine Erfahrung, auch wenn man mich der Anmaßung zeihen mag: Uns umgab und prägte die düstere Anwesenheit nicht verstehender oder missverstehender Menschen, mit denen wir den Alltag von Kindheit an teilten, mit denen es aber keine gemeinsame Sprache gab, obwohl das erwachende Bewusstsein sich verzweifelt mühte, verstanden zu werden. Im Gegenteil, gerade, wenn einer nun anfing zu schreiben, verabschiedete er sich von diesen Menschen mit jedem Wort, das er ihnen widmete, das an sie gerichtet war, mit dem er ja gerade ihnen Sprache geben wollte, ihnen, von denen er herkam, mit denen er immer gelebt hatte, mit ihrer Geschichte und ihrem stummen Aufschrei in der Geschichte, d.h. eben ihrer Abwesenheit… Gerade darin, damit, an dieser tief sitzenden Wurzel seines Schaffens wird ein solcher Dichter nicht verstanden, wird er der Arroganz geziehen und der Undankbarkeit. Und er findet sich selbst undankbar, und er steht den Verzweifelten gegenüber mit seiner Verzweiflung.
Hilbigs Kunst aber läßt diese Abwesenheit erblühen, verwandelt die unerhörte Fremde eines grausam oder schäbig oder einfach nur zu Naheliegenden in die handhabbare Distanz seiner Sprache. Täglich Brot seines Schreibens mit dem selbstgesetzten Ziel, etwas zu sein, das ich, lächerlich genug, einen Schriftsteller nannte. Der Aufsatz Über den Tonfall, in dem einer wieder einmal so etwas über sich sagt, er beginnt mit den Worten: Geschwätzig vor Trauer; endlose Nacht… Ohne das erste Epitheton der Anfang für ein Gedicht.
Im Nachwort zu des Iren Charles Robert Maturins Roman Melmoth, der Wanderer schreibt Dieter Sturm:
Die hoffnungslose Geschichte des pauperisierten und unterdrückten Landes… ist auch in die Trauer und… Aufsässigkeit seines Stils eingegangen.
Wir können diese Worte getrost auf das versunkene Land, dem er entstammte, und auf das Werk Wolfgang Hilbigs beziehen.
Uwe Kolbe, Nachwort, Januar/Februar 2008
Nachbemerkung zu dieser Ausgabe
Diese Ausgabe sammelt in ihrem ersten Teil Wolfgang Hilbigs Gedichtbände abwesenheit (1979) – die erste Buchveröffentlichung −, stimme stimme (1983) – die einzige Buchveröffentlichung in der DDR −, die versprengung (1986) und Bilder vom Erzählen (2001). In der Anordnung der einzelnen Bände folgt sie deren Erscheinungsdaten, in der Anordnung der einzelnen Gedichte folgt sie der ursprünglichen Reihung. Überschneidungen innerhalb dieser Bände – mehr als die Hälfte der Gedichte aus stimme, stimme findet sich bereits in abwesenheit, etwa ein Viertel aus die versprengung schon in stimme, stimme – wurden für die Werkausgabe bereinigt.
Die in den Prosa und Lyrik mischenden Auswahlbänden Das Meer in Sachsen (1991) und Zwischen den Paradiesen (1992) erstmals veröffentlichten Gedichte finden sich in dieser Ausgabe zusammen mit den Zeitschriftenpublikationen unter „Verstreut veröffentlichte Gedichte“.
Den insgesamt 188 veröffentlichten Gedichten stehen im vorliegenden Band 153 nachgelassene Gedichte gegenüber, die hier erstmals zugänglich gemacht werden. Die Anordnung dieser Texte erfolgt prinzipiell chronologisch, bei Gedichten mit gleichem Erscheinungsjahr alphabetisch, Ausnahmen sind inhaltlich begründet.
Die frühesten im Nachlass erhaltenen Gedichte bilden einen eigenständigen Lyrikband betitelt Scherben für damals und jetzt, im Original ein Schreibheft im DIN-A-5-Format mit 53 Gedichten in Hand- und Reinschrift, vom Autor mit Titelblatt, Widmung, Inhaltsverzeichnis, mottoartigen Zitaten und gliedernden Zwischentiteln versehen.
Offenkundig war dieses Schreibheft vom Ministerium für Staatssicherheit der DDR beschlagnahmt worden und erst nach dem Zusammenbruch der DDR wieder in die Hände seines Eigentümers gelangt, jede Seite versehen mit dem Stempel der BstU (= Die/der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik). Einige Hinweise in den Gedichten selbst legen eine Datierung dieser in sich abgeschlossenen Sammlung früher Gedichte in die erste Hälfte der 1960er Jahre nahe; ein Gedicht nennt das Jahr 1964 – das Jahr, in dem man den jungen Autor zu einem „Zirkel schreibender Arbeiter“ in Leipzig delegierte.
Angesichts der Tatsache, dass nach bisherigem Kenntnisstand Wolfgang Hilbig alle vor 1965 entstandenen Texte verbrannt hatte (so der Autor im Gespräch mit seinem ersten Lektor Thomas Beckermann), kommt dieser Entdeckung besondere Bedeutung zu. Hier lässt sich in Thematik und Motivik die Selbstgründung dieses Autors studieren und sein Ringen (im Scheitern und Gelingen) um die angemessene Ausdrucksform. Von hier aus lässt sich – in den Gedichten der dem „Scherben“-Komplex folgenden letzten Abteilung dieser Ausgabe – die Entwicklung eines Schreibens beobachten, das bis zur Publikation von abwesenheit ein in mehrfacher Hinsicht untergründiges war, unsichtbares: Fast fünfzehn Jahre lang hat dieser Autor Texte verfasst, ohne dass eine größere Öffentlichkeit davon erfuhr. Die Gedichte, die in dieser Zeit entstanden, sind nicht aus Gründen mangelnder Qualität unveröffentlicht geblieben – sie sind nur außerhalb jeder Publikationsmöglichkeit entstanden.
Zur Beschreibung der Auswahlkriterien für die nachgelassenen Gedichte dieses Bandes ist es hilfreich, sich die verschiedenen Fertigstellungsgrade der Texte vor Augen zu führen sowie die Arbeitsweise des Autors, der seine Texte handschriftlich verfasste, gegebenenfalls korrigierte, anschließend mit der Schreibmaschine erfasste und bei Bedarf wiederum handschriftlich ergänzte oder eine neue Maschinenfassung erstellte ein Prozess, der sich auch über Jahre hinziehen konnte und eine Vielzahl von Vorstufen und Varianten hervorbrachte. Von den etwa 500 unveröffentlichten Gedichten und Fragmenten des Nachlasses – der größte Teil von ihnen handschriftlich in den Notizbüchern und -blöcken – tragen etwa 300 einen Titel, unter 221 von diesen stehen Signum („W. H.“, „Hilbig“) und Jahreszahl, wobei die Jahreszahl in der Regel die erste vor dem Auge des Autors bestehende Fassung bezeichnet. 210 der insgesamt 500 unveröffentlichten Texte lassen sich zu 53 thematischen oder motivischen Werkgruppen von jeweils zwei bis fünf Gedichten zusammenstellen. „Landschaft“, „Hier ist mein Exil“, „Kein Ort“, „Die Kindheit: gegangen“, „Jugend“, „Mutter, dein Sohn“, „Vaters Tor bleibt mir verschlossen“, „Die Aufgabe“, „Mysterium“ lauten Überschriften oder zentrale Verse von einigen dieser Werkgruppen – es ist der Stoff, aus dem Leben und Schreiben dieses Dichters gemacht sind.
Etwa 100 der 500 unveröffentlichten Texte sind maschinengeschrieben und tragen Signatur und Jahresangabe; allein sie wurden in die letzte Abteilung dieses Bandes aufgenommen. Darüber hinaus wurde eine Auswahl getroffen aus den handschriftlich vorliegenden Gedichten; auch hier wurden lediglich mit Signatur und Jahresangabe versehene Texte berücksichtigt.
Diese Ausgabe versteht sich als Leseausgabe; die Anmerkungen beschränken sich auf Nützliches und Notwendiges. Sie erschließt den literarischen Nachlass, aber sie schließt ihn nicht. Gedankt sei der S. Fischer Stiftung und der Berliner Akademie der Künste, in deren Händen dieser Nachlass liegt; gedankt sei zudem Insa Wilke und Michael Zuch für die Mitarbeit an diesen Band sowie Christiane Rusch für jegliche Unterstützung bei der Entstehung der Werkausgabe.
Jürgen Hosemann, Februar 2008
Als Wolfgang Hilbig am 2. Juni 2007 starb,
verlor die deutschsprachige Literatur eine einzigartige Stimme. Bis zuletzt gelangen ihm Gedichte von dunkler, träumerischer Schönheit; sie waren der Anfang und das Ende seines Schreibens. Selbst in seinen großen Romanen war der lyrische Ton unüberhörbar. Ausgehend von den Traditionen der Romantik, des Symbolismus, des Expressionismus und geprägt von den Alltagserfahrungen eines Arbeiterlebens in der DDR, schuf er sich seine eigene Sprache: leidenschaftlich und voll brennender Sehnsucht, elegisch, grüblerisch, zärtlich.
Dieser Band – Band I der Werkausgabe – sammelt die Gedichte aus abwesenheit, stimme stimme, die versprengung, Bilder vom Erzählen und ergänzt sie um die verstreut veröffentlichten Texte. Hinzu kommen mehr als 150 Gedichte aus dem Nachlass, die hier erstmals zugänglich gemacht werden. Erkennbar wird, von den furiosen Jugendgedichten bis zum grandiosen Spätwerk, die Selbstgründung und Entwicklung eines Dichters, der sich aus der Enge des Schweigens befreit und hinaustritt in den unendlichen Raum der poetischen Sprache.
S. Fischer Verlag, Klappentext, 2008
Die Zärtlichkeit meiner Rose im Schädel
− Für die Schublade zu schreiben, fand er unwürdig, und doch musste er es in der DDR lange tun. Jetzt sind die Scherben von damals zusammengefügt – und funkeln: Wolfgang Hilbigs gesammelte Gedichte. −
Mitte der sechziger Jahre, in Meuselwitz, dem verdrecktesten Braunkohleort der DDR, schrieb ein junger Mann, der zum Bohrwerksdreher ausgebildet worden war und von wechselnden Jobs lebte, Verse in ein DIN-A5-Heft, versah diese dreiundfünfzig Gedichte mit Motti und Kapitelgliederungen und gab ihnen den Titel „Scherben für damals und jetzt“. Das war vermutlich 1964, um die Zeit, da man ihn zu einem Zirkel schreibender Arbeiter nach Leipzig delegierte. Wolfgang Hilbig mag sich damals die Publikation dieser Gedichte versprochen haben.
Es kam anders. Die Stasi beschlagnahmte das Heft. Und der Autor muss es verlorengegeben haben. Er hatte nicht mit dem bürokratischen Ordnungssinn der Stasi gerechnet. Aus ihrem Nachlass gelangte das konfiszierte Manuskript, jede Seite versehen mit dem Stempel der Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen, in die Hände seines Eigentümers zurück. Der Titel von einst erhielt damit eine späte Rechtfertigung: Die Scherben von damals wurden wieder zusammengefügt, ordnen sich jetzt dem Gesamtwerk ein. Man darf das eine Sensation nennen. Die dreiundfünfzig Gedichte kann man nun in der Gesamtausgabe des im Vorjahr verstorbenen Autors lesen. Sie eröffnen den zweiten Teil dieser Ausgabe, der einen erstaunlich umfangreichen Bestand an nachgelassener Lyrik enthält. Auf zweihundert Seiten ist hier dokumentiert, wie ein Autor knapp fünfzehn Jahre lang ohne Aussicht darauf schrieb, dass ihn eine größere Öffentlichkeit wahrnahm. Hilbig folgte einfach nur seinem Traum, Dichter zu werden.
Diese Hoffnung wider alle Hoffnung muss ihn alle die Jahre beflügelt haben, in Meuselwitz, später in Ost-Berlin. Der meistens als Heizer tätige Nachtarbeiter, der in der bleiernen Erschöpfung der Arbeitswoche nach Freiräumen suchte, im Boxen, Raufen, im exzessiven Trinken, fand sein Lebenselixier im Schreiben, das aus nicht minder exzessiver Lektüre erwuchs. Hilbig zeigt in seinen dreiundfünfzig Scherben die bekannten Schwächen des Autodidakten. Er bedichtet die Maimorgensonne und das Fröschlein am Ufer des Quells, reimt Schwermut auf Herzblut und schaut gläubig zu Hermann Hesse auf.
Aber er öffnet sich auch der Moderne. Die Sequenz „Die Sprache eines Feuerfressers“ bezieht sich auf Tristan Corbière, und das ist gewiss kein Allerweltsname. Sie beschwört, gespeist durch seine Erfahrung als Heizer, auf kraftvolle Weise das Feuer: „Ich geboren, / unterm Feuer der Zeit, / verkohlt, verräuchert, entmoralisiert“. Der junge Dichter schreibt ein vorweggenommenes Epitaph: „auf meinen Grabstein hau man mir / ein Herz, durchbohrt mit einem Schwert.“ Hier kündigt sich jenes Pathos an, das bei Hilbig mit dem Leiden zusammenhängt. Doch Hilbig besaß Nehmerqualitäten und hielt es für eine Perversion, für die Schublade zu schreiben. 1968 schickte er an die Neue Deutsche Literatur folgende Anzeige: „Welcher deutschsprachige Verlag veröffentlicht meine Gedichte? Nur ernstgemeinte Zuschriften an W. Hilbig, 7404 Meuselwitz, Breitscheidstraße 19b.“ Die Redaktion druckte die Annonce, unsicher im Dschungel der Anweisungen oder überrascht von Hilbigs provokatorischer Chuzpe. Es gab keine Reaktion, weder in Ost noch West. Und so dauerte es noch weitere zehn Jahre, ehe Hilbigs erstes Buch erschien, der Gedichtband abwesenheit.
Er erschien, vermittelt von Karl Corino, bei S. Fischer in Frankfurt. Noch am Vorabend der Manuskriptübergabe glaubte Hilbig das Manuskript verloren. Er hatte in der Leipziger Wohnung eines Freundes daraus vorgelesen und rief: „Das wurde von der Stasi geklaut.“ In diesem Falle freilich nicht: Das Konvolut fand sich, von Rotweinflecken gesprenkelt, unter dem Reisstrohteppich des Bücherzimmers. Die West-Veröffentlichung trug Hilbig eine Strafe von 2.000 Mark ein, weil sie vom Büro für Urheberrechte nicht genehmigt war. Eine unbeabsichtigte Reklame. Das nun erlangte Renommee schützte ihn fortan vor weiteren Schikanen der DDR-Literaturbürokratie. Hilbig war endlich bekannt, und das in beiden deutschen Staaten. Spätestens nach Hilbigs Übersiedlung in den Westen 1985 wuchs der Ruhm, 2002 kam der Büchner-Preis.
Bemerkenswert, was er den Umständen vorher abrang. „Auschwitz-Prozeß“, aus dem Juli 1965, ist ein galliger Kommentar zu den Mechanismen der Verdrängung. Illusionslose Klarsicht bewährte sich auch in eigener Sache. „Hiobswoche“ von 1966 zeichnet schon früh den fatalen Zirkel des Alkoholismus:
das war die Woche in der ich die Menschen nur
durch Schwämme erblickt hab in der ich all
mein Geld vernichtet hab und meine Liebe und
die Zärtlichkeit meiner Rose im Schädel.
Doch die Rose im Schädel war nicht endgültig zu vernichten. Dieser Hiob wollte kein heiliger Trinker sein. Im Jahr der „Hiobswoche“ wählte er sich einen dichtenden Arzt zum Eideshelfer. Für „vom traum der dichtkunst“ nahm er das Motto von William Carlos Williams: „new books of poetry will be written“. In diesem Gedicht gibt es einen scheinbar autoaggressiven Schluss: „tretet mir auf den mund tretet / mir doch auf den mund.“
Das kann nur sagen, wer weiß, dass seine Stimme unauslöschlich ist.
Zumindest einen Versuch der Staatsmacht, Hilbig mundtot zu machen, hat es gegeben. Im Mai 1978 wurde er beschuldigt, nach der Maifeier eine Fahne, also ein staatliches Emblem, heruntergeholt und verbrannt zu haben. Die Anklage wegen „Rowdytums“, die auf der Aussage eines schwer alkoholisierten Zeugen basierte, musste fallengelassen werden, und Hilbig kam nach knapp zwei Monaten frei, aber das Gefängnistrauma wirkte nach.
Man liest Hilbigs nunmehr gesammelte Lyrik anders, wenn man die Gedichte der Schweigejahre hinzunimmt. Man liest auch die bekannten Gedichtbände, die den Ruhm begründeten, pointierter, nämlich als die Summen dreier poetischer Epochen. Da fungiert abwesenheit (1979) als eine Absage an staatliche Bevormundung; versprengung (1986) als anarchisch-revoltierende Zerstäubung von Subjekt und Sinnbezug; und die späten Bilder vom Erzählen (2001) als Heimkehr zu den großen Figuren des abendländischen Erbes. Es ist die Heimkehr zum „Traumbuch der Moderne“, zu Poe, Eliot und Ezra Pound, der das Ithaka der Poesie wiederfinden wollte.
In dieser großen Abendphantasie teilt sich auch Hilbig einen Platz zu, keinen überzogenen, doch auch keinen allzu bescheidenen. Die letzten Zeilen aus diesem letzten Gedichtband enden mit dem Aufruf zu neuem Aufbruch:
was gestern licht und wert war ist verschwendet –
und es ist Nacht und Zeit daß du dich wandelst.
Das ist, mit dem Titel des Gedichts, „Pro domo et mundo“ gesprochen, für Haus und Welt. Es zitiert den Titel einer Aphorismensammlung von Karl Kraus. Und so verstand Hilbig, um Kraus, fortzuspinnen, das Haus als das alte Haus der Sprache und sich als den Letzten derer, die darin wohnen.
Harald Hartung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.8.2008
Wüste Kohlehalden
− Vor einem Jahr starb der Dichter Wolfgang Hilbig. Nun erscheint der erste Band einer Werkausgabe. −
Viele Jahre saß dieser Dichter an tellurischen Orten fest – tief unten in den Dunkelzonen von Kesselhäusern und den Restlöchern sächsischer Tagebaue. Niemand wollte in dem Tiefbauarbeiter und Heizer, den seine Vorgesetzten wegen mangelnder Arbeitsdisziplin rüffelten, einen Schriftsteller sehen. Wolfgang Hilbig quälte sich durch endlose Nachtschichten, um sich in aller Stille seiner großen Passion zu widmen – der Poesie.
In diesen Wüstungen der realsozialistischen Zwangsgesellschaft entstand das ungeheure Werk eines Autodidakten, dessen visionäre Kraft alles hinter sich lässt, was in den vergangenen dreißig Jahren an deutschsprachiger Lyrik geschrieben worden ist.
Wolfgang Hilbig, der im Juni 2007 verstorbene Traumwandler aus Meuselwitz, war kein Lyriker in dem Sinne jener pflegeleichten Subjekte, die in unseren Literaturhäusern von einem Poesie-Event zum nächsten geschleust werden. Viel eher kann man ihn mit einem klassischen Sänger vergleichen, der noch einmal den hymnischen Tonfall seiner Vorbilder Rimbaud, Novalis und Hölderlin aufnahm und als „ungestalter gast aus dem schwarzen / und schimmernden landmeer“ die vergifteten Landschaften des Ostens beschwor. Der immer etwas ungelenk wirkende Bergarbeitersohn mit seinem sächsischen Dialekt fand sich im Literaturbetrieb nur schwer zurecht. Und doch haben die Gedichte dieses Mannes eine überwältigende Wucht, neben der sich ein Großteil der zeitgenössischen Produktion doch recht dürftig ausnimmt.
Als er 1968 in der Neuen Deutschen Literatur, der damaligen Zeitschrift des DDR-Schriftstellerverbands, eine Annonce aufgab, um einen Verlag für seine Gedichte zu suchen, hatte er schon einige Jahre lang unerhörte Texte in seinen Kesselhäusern geschrieben. Was damals entstand, galt lange als verschollen; Hilbig selbst hatte stets behauptet, seine frühen Gedichte habe er verbrannt.
Es ist ein großes Verdienst der jetzt von Jürgen Hosemann edierten Gesamtausgabe von Hilbigs Gedichten, dass sie über 150 Gedichte aus dem Nachlass erstmals zugänglich macht. Die frühesten Gedichte stammen aus einem Konvolut von 53 Gedichten, das Hilbig mit „Scherben für damals und jetzt“ betitelt hatte und das von der Stasi beschlagnahmt worden war. Diese Texte sind erst nach dem Zusammenbruch der DDR wieder in die Hände ihres Verfassers gelangt, der danach offenbar keine Versuche mehr unternahm, sie in seinem Hausverlag S. Fischer unterzubringen. Dabei ist in diesen frühen Hilbig-Poemen vieles präfiguriert, was in den ab 1979 veröffentlichten Gedichtbänden zum zentralen Topos wurde: die Beschwörung der Nacht und die Artikulation eines existenziellen Verlorenseins. Wer die Texte aus den Gedichtbänden abwesenheit (1979), die versprengung (1986) und Bilder vom Erzählen (2001) vergleicht, kann sehr genau die aufschlussreichen Metamorphosen verfolgen, die Hilbigs Dichtung durchlaufen hat. In den um 1963/64 entstandenen Frühwerken dominiert noch ein zarter Lied-Ton, den Hilbig den Romantikern abgelauscht hat. In der stilistischen Maske Brentanos und Eichendorffs besingt der unbehauste Poet seinen Sehnsuchtsort, das Meer:
Von fern besing ich dich, o Meer,
zu deinen Füßen lagen einst die Nächte,
doch über ihnen schien silbern es daher,
wie wenn Gott ein Himmelslicht dir brächte.
Unten, im Schatten, trieb mein Boot.
Damals wußt’ ich noch keine Lieder,
doch dein Atem beschwor mich bis an den Tod,
nun will ich dich singen, wieder und wieder.
Es dauerte nur wenige Jahre, bis Hilbig zu einer eigenen Stimme fand und seinen Gesang mit visionären Bildern und weit ausschwingenden Langzeilen bereicherte. Inspiriert von der trunken-surrealistischen Fantasie Rimbauds, verließ er das „düstere kesselhaus“ und entdeckte in einem seiner frühen Meisterwerke „das meer in sachsen“. Als ein „flaneur de la nuit“ beobachtet das lyrische Ich die „wassermühlen“ und gerät in den Mahlstrom der Bilder.
Am Gipfelpunkt von Hilbigs Dichtung steht schließlich das lange Poem prosa meiner heimatstraße, das bislang nur auszugsweise in Zeitschriften zu lesen war und nun in der Gesamtausgabe der Gedichte erstmals vollständig vorliegt. Es entstand in den Monaten des politischen Umbruchs in der DDR und kombiniert den Hymnenton Hölderlins mit grellen expressionistischen Bildern und ambivalent flackernden Befreiungs-Visionen. Dem „vaterland der asche“ und den „wüsten kohlehalden“ entkommen, richtet sich der Blick des Sängers auf die Umwälzung der trostlosen Verhältnisse. Das Fluten der bizarren Traumbilder und Phantasmagorien wird unterbrochen durch eine Rhapsodie zu Ehren der Revolution:
schön ist ein volk in waffenlosem aufruhr. schön ist die revolution der windhunde traumtänzer taschenspieler trickbetrüger und aller übrigen betrogenen…
Im Leben des Dichters Wolfgang Hilbig blieb indes die Revolution der Verhältnisse aus. Nachdem er 1985 in den Westen gegangen war, geriet er auf einen langen Kreuzweg der Selbstzerstörung. Was wir mit dem Tod dieses visionären Einsiedlers verloren haben, erhellt nun der erste Band der Hilbig-Werkausgabe in großer Eindringlichkeit.
Michael Braun, Der Tagesspiegel, 2.6.2008
Der Tanz auf der Mauer
− Wolfgang Hilbigs gesammelte Gedichte sind ein Ereignis. −
Sachsen, wo es am heruntergekommensten, von den Folgen realsozialistischer Planwirtschaft am meisten gebeutelt und der Akzent der Menschen am wenigsten goutierbar ist, war Wolfgang Hilbig zufällige Heimat und notwendiger Bildspender zugleich. Er wusste allerdings, dass er selber von noch viel weiter her stammte:
mein großvater…
nach europa trug den honigduftenden samen…
wie das steppengras zischte und die halme sich rieben so
klangen seine polnischen flüche in seinem lachen
grollten hufe und gewitter seine stirn ein feuer
wetterleuchtete fern die rote kolchis
unwissend und tief im orkus
Hilbig hat die sächsische Braunkohlenlandschaft, der er trotz späteren Aufbruchs gen Westen und in die Berliner Metropole biographisch stets verbunden blieb, nie verleugnet. Was er von ihr zu bezeugen hatte, wissen ihm bis heute die wenigsten dort zu danken:
der dörfer fischgerüche zogen mich in tagebaue
der dörfer dasein war in mir verworren und gespalten
die feuerluft
der tage war der flammenschatten jener nächte
glutsinne flammennerven bauten
verflogene namen spiegelungen auf
Eine solche Landschaft brauchte Hilbig nicht zu suchen, sie hatte sich ihm aufgedrängt. Und doch lagen jene, die in seinen Versen nichts weiter als lyrisch denunzierende Protokolle schamloser Naturausbeutung suchten, von Anfang an falsch. Seine Poesie erschöpft sich nicht in Bildern eines vergewaltigten Lebensraums, sondern destilliert aus solchen Eindrücken autonome Kunstgebilde – und hier schon ist sie in tieferen, entfernteren Schichten daheim; beim protestantischen Kirchenlied etwa, bei Hölderlin, Novalis, den Weltsprachen der modernen Poesie. Der Bildraum von Hilbigs poetischen Landschaften ist in seiner Eindringlichkeit mit den schwermütigen Kinolandschaften Andrej Tarkowskis vergleichbar; morbid-real wie sie in der Optik des Dichters aufscheinen, sind sie wiederum auch zum Erbarmen schön:
am wald wartete
einst ein steinernes haus…
nun ist es zerbrochen
das dach die wände zerfalln
das wasser voll steinbrocken
allein
der keller steht noch
morsch in der mulde wo
herbstliches gras sich an die erde
schmiegt wie hundeohrn im wind.
Um ein anderes Beispiel für die Durchdringung von äußerster Welt und innerster Provinz anzuführen: Als Motto zum bereits 1966 entstandenen Gedicht „abwertung eines unverständlichen gegenstands“ zitiert Hilbig Verse eines amerikanischen Zeitgenossen, dessen Namen er offiziell, auf Meuselwitzer Radius geeicht, gar nicht hätte kennen können – „I cannot be more than / the man who watches“. Diese von Robert Creeley auf die Beziehung zur Tochter gemünzten Worte (in „The Name“ am Schluss der Sammlung „For Love“) gewinnen für Hilbig eine ganz neue Bedeutung – umreißen sie doch seine desolate frühe Lage, mit „unverständlichen Gegenständen“ wie Gedichten in der aus Parolen gezimmerten Gesellschaft zum passiven Zuschauer, zum Abwesenden verdammt zu sein. Eine derart eigenwillige Transformation eines lyrischen Vorbilds (das dazu noch der Kultur des offiziellen Klassenfeinds angehörte) dürfte jedenfalls zu den Seltenheiten der Literaturgeschichte gehören.
Der stöhnende Herzapparat
Entdeckungen dieser Art gestattet der jetzt vorliegende Sammelband von Hilbigs Gedichten; zum ersten Mal kann sein in den Bänden abwesenheit (1978), die versprengung (1986) im Westen, sowie in den ostdeutschen Auswahlpublikationen stimme stimme (1983) und zwischen den paradiesen (1991) veröffentlichtes Werk, dem nach der Wende noch in Zeitschriften verstreute Gedichte sowie die zu seinem 60. Geburtstag 2003 herausgekommenen Bilder vom Erzählen folgten, nahezu umfassend überschaut werden. Außerdem wird ein erster Einblick in Hilbigs umfangreichen lyrischen Nachlass gewährt – von einem in seiner Stasiakte wiedergefundenen frühen Zyklus von Liebesgedichten bis hin zu Reinschriften von Entwürfen der Berliner Zeit. Auch wenn die Herausgeber gute Gründe haben, ihren Anmerkungsapparat zu beschränken, so hätte man sich doch gerade für diesen Nachlass, der immerhin ein gutes Drittel des Buchs ausmacht, eine etwas großzügigere Mitteilungspolitik erhofft, was Ort, Zeit, Kontext der Entstehung und Art der Überlieferung betrifft. Und es mag für die Belange einer Leseausgabe seine Richtigkeit haben, Gedichte Hilbigs, die mehrmals in Büchern veröffentlicht wurden, nur am Ort ihrer Erstveröffentlichung anzugeben – die Komplikationen seiner Publikationsgeschichte werden so aber einfach unter den Tisch gekehrt, als spielte es etwa keine Rolle mehr, dass seinerzeit die ostdeutschen Zensoren sein Programmgedicht „das meer in sachsen“ nur in einer verstümmelten, sinnentstellten Kürzung im Reclamheftchen stimme stimme abgedruckt hatten.
Sei es drum: Diese Werkausgabe von Wolfgang Hilbigs Gedichten ist ein Ereignis für die Lyrik im deutschsprachigen Raum, wie es in jüngster Zeit vielleicht nur noch der „Kaddish“-Zyklus Paulus Böhmers gewesen ist – ein Ereignis für die Literatur im Ganzen, beginnt man sich einmal auf die Funktion der Lyrik als Speerspitze im literarischen Progress zu besinnen: „In bezug auf Lyrik reagiere ich allergisch auf unhaltbare Ergebnisse. Gedichte sind für mich die Essenzen literarischer Arbeit“, hatte Hilbig einmal gesagt. Der Rabe Edgar Allen Poes wird für ihn zum Sinnbild eines Anspruchs, wie er höher nicht sein könnte:
war es notwendig
den stöhnenden herzapparat in die marionette zu pflanzen –
war die erfindung des wagenrads der anblick
unserer stärke notwendig war der käfig der unsterblichkeit
an dem dieses röcheln sich wetzt war
dieser schmutzige gesträubte rabe notwendig.
Auroren an die Kehle
Wie Poe war Hilbig auch Erzähler, manischer Chronist einer Realität, die immer wieder ins Spukhafte entglitt, wie Poe diente ihm die Beschäftigung mit Lyrik dann als Rettungsanker im verfließenden Strom von Geschichten, deren Entwicklung und Ausgang er selber nicht in der Hand zu haben schien. Schildern seine Geschichten die unkontrollierbar wuchernden Geschwüre einer Wirklichkeit, die ihr Spiegelbild nur noch im Wahnsinn, der schizophrenen Persönlichkeitsverdopplung und -entäußerung findet, so sind vor allem die nach der Periode des Erzählens entstandenen (wieder in Großschreibung gedruckten) Gedichte aus der Flut von Phänomenen gerettete Bilder vom Erzählen – luzide, exemplarische Montagen, geschaffen für einen Einstieg in sein Gesamtwerk vom Ende her.
Konsequenterweise schließen die Bilder vom Erzählen den Kreis um Hilbigs Schriftstellerdasein; vier Jahre vor seinem Tod erschienen, nehmen sie diesen bereits vorweg – und das, was von ihm bleiben könnte: die „Essenz”, die epiphanische Vision vom Eintauchen ins Mythische in unmittelbarster Gegenwart. Sie führt an die Ursprünge der modernen Poesie, die ihrerseits die Ursprünge der Antike berührt: zu Pounds Cantos, die mit dem Elften Gesang der Odyssee einsetzen – dem Abstieg in die Unterwelt. Für Hilbig, der in der DDR zur Abwesenheit, zum Untergrund („nach unten gehn heißt oben bleiben“), im Westen zu Selbstflucht, Abtauchen, Doppelleben („hier in der luft der lüge“) verdammt war, hätte kein Mythos näher gelegen. Und musste sich demjenigen, der schon 1986 mit Zeilen wie „es drehn / sich die brüder im tanz auf der mauer“ das vermeintliche Ende der Geschichte vorausgesehen hatte, die Dimension des Mythischen nicht von selbst aufdrängen?
Es ist diese Identifikation mit den Mythen des poetisch autonom Erzeugten, die ihn dazu befähigte, der Sterblichkeit des eigenen Körpers ein Überdauern im Gedicht entgegenzuhalten und „wie Brüder die durch Äonen / geschieden sind“ in einem real erblickten Raben (während eines Schreibaufenthalts in Amerika) das von Edgar Allen Poe an ihn übergegangene Totemtier zu grüßen. Man muss lange nach einem Dichter wie Hilbig suchen, der derart mühelos mit den Größen der Literaturgeschichte ins Zwiegespräch treten konnte, so dass jeder Vergleich mit direkten Zeitgenossen ins Leere gehen muss. Etiketten wie „DDR-Emigrant“, „Heizer und Symbolist“, „Sächsischer Surrealist“ erklären kaum seine Einzigartigkeit. Hilbig war Dichter und spätestens mit der nun vorliegenden Werkausgabe dürfte klar sein, dass er zu den allergrößten hierzulande zählt, die monolithisch und nur durch sich selbst erklärbar in der Literaturgeschichte stehen.
Poesie, die die Zeiten überdauern soll, lässt sich nicht an der Anzahl errungener Preise und Stipendien oder einer medienkompatiblen Allseitsfreundlichkeit ermessen. Sie geht – „auroren an die kehle“ – aufs Ganze, ohne sich um die Konsequenzen ihrer Kompromisslosigkeit zu scheren. Das ist sie der fragilen Materie des Gedichtes schuldig. Wolfgang Hilbig wusste das: ein Aufrechter, dem die Poesie den einzigen Halt im Leben schenkte. Mag sein, dass ihn das unsterblich machen wird.
Jan Volker Röhnert, Süddeutsche Zeitung, 28.5.2008
Poet der Vergänglichkeit
− Gedichte von einzigartiger sprachlicher Eleganz und zerbrechlicher Schönheit versammelt der erste Band der Werkausgabe von Wolfgang Hilbig. Das Besondere: Es sind auch bisher unveröffentlichte Verse aus dem Nachlass enthalten, von denen man dachte, sie seien verschwunden. −
Es ist eine Sensation! Der erste Band der Werkausgabe von Wolfgang Hilbig enthält neben 188 bereits bekannten Gedichten weitere 153 nachgelassene, bislang unveröffentlichte Verse des Sprachvirtuosen aus dem sächsischen Meuselwitz. Das ist ein Auftakt nach Maß für die auf sieben Bände geplante Ausgabe seiner Schriften.
Viel zu früh ist Wolfgang Hilbig am 2. Juni 2007 im Alter von 65 Jahren verstorben. Dass die deutsche Gegenwartsliteratur mit Hilbigs Tod einen ihrer bedeutendsten Autoren verloren hat, dringt erst allmählich ins Bewusstsein der literaturinteressierten Öffentlichkeit. Wolfgang Hilbig hat getan, was man von einem Dichter erwarten darf: Er hat geschrieben.
Doch ein „nur“ schreibender Dichter wird in der medialen Welt von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Der ehemalige Heizer, der 1985 die DDR verließ und in den Westen ging, war nur selten in Talkshows zu sehen und noch seltener hat er sich zu seinem Werk geäußert. Das Fernsehen war nicht Hilbigs Medium. Er wollte nicht im Bild erscheinen, sondern von Bildern erzählen. Bilder vom Erzählen, so lautet der Titel seines letzten, 2001 erschienenen Gedichtbandes, in dem sich das Gedicht „Saturnische Ellipsen“ findet:
Ach meine Zeit ist um
war schon vorbei als ich zum ersten Mal von ihr gehört.
Wolfgang Hilbig wollte gelesen werden! Der erste Band der Werkausgabe ist eine Einladung, diesem Wunsch zu folgen. Seine Gedichte sind von einer einzigartigen sprachlichen Eleganz. Die Bilder, die er in seinen Versen entwirft, sind so fragil, dass sie im nächsten Moment zu zerbrechen drohen. Er beschreibt die Risse, die bereits zu sehen sind, er sieht die Schatten, die die Landschaft verdunkeln – seine Texte sind bis zum Zerspringen mit Vergänglichkeit gefüllt.
Debütiert hat Hilbig 1979 mit dem Lyrik-Band abwesenheit, den der Autor in der DDR nicht veröffentlichen durfte. Darin heißt es:
Wir werden nicht vermißt
unsere worte sind gefrorene fetzen
Hilbigs Gedichte gleichen Magazinen. In ihnen ist aufgehoben, was erinnert werden muss.
Lange Zeit musste man davon ausgehen, dass seine vor 1965 geschriebenen Texte verloren gegangen sind. Er selbst sprach davon, dass er sie verbrannt habe. Nun ist im Nachlass des Dichters ein durchkomponierter Band mit dem Titel „Scherben für damals und jetzt“ aufgetaucht. Das offensichtlich von der Staatssicherheit beschlagnahmte Exemplar muss Hilbig nach 1989 von der Gauck-Behörde zurückbekommen haben. Darin findet sich das Gedicht „Frage“, das bereits jenen Ton anschlägt, der Hilbigs spätere Texte auszeichnet:
Ach, Gott, es rinnen meine Tage
Wie träges Öl so ruhig hin. Gib Antwort mir auf meine Frage,
Wann und wo ich glücklich bin.
Diese Frage stellt sich Hilbig nicht nur in seinen Gedichten, sondern auch in seiner Prosa. Einem der letzten Gedichte aus dem Nachlass mit dem Titel „Selbstbildnis“ (2001) ist keine Antwort auf das „Wann“ und „Wo“ eingeschrieben, vielmehr verweist es auf Abgründe, indem die Wege andeutet werden, die der Suchende gegangen ist:
Die letzte Bleichsucht hat die lange Nacht
auf mein Gesicht verwandt: ich gehe wie ein Alter
aus und ein in meinem schlagseitigen Zimmer
das halb gekentert ist und keine Fahrt mehr macht
und weiß
gedunsen weiß im Fenster spiegle ich mich halb
halb schwind ich hin: im Uferlosen abgesoffner Schwimmer.
Man darf gespannt sein, welche Schätze sich noch in Hilbigs Nachlass finden. Doch Entdeckungen lassen sich bereits jetzt in seinen Texten machen. Wo man sie auch aufschlägt, wird man von Schönheit umfangen.
Michael Opitz, Deutschlandradio Kultur, 29.5.2008
Orte der Verletzlichkeit
„Gedichte sind für mich die Essenzen literarischer Arbeit“ sagte der Büchnerpreisträger Wolfgang Hilbig in einem Interview. Ein Jahr nach seinem Tod erschien im Fischer-Verlag der erste einer auf sieben Bände angelegten Werkausgabe. Es mutet fast schon symbolisch an, dass dieses erste Buch die gesammelte Lyrik enthält, denn mit Gedichten, dem 1979 im Westen publizierten Band abwesenheit, begann Hilbigs literarische Karriere. 1941 in Meuselwitz geboren, arbeitete er jahrzehntelang in den Tagebauen rund um Leipzig. Nachts beschrieb der Autodidakt den Dreck und die Zerstörungen an der Landschaft und in den Menschen mit einer ästhetisch vollendeten Sprache: „verloren hatt ich all meine kumpane / die übern tisch mir bier um bier herüberschoben / – es nährten andre sich von meinem wahne / verzückte gaffer die auf ihren thron mich hoben“, heißt es in dem Gedicht „der verlorene beweis“.
Interessante Einblicke in Hilbigs Arbeitsweise erhält der Leser immer dann, wenn die Herausgeber Jörg Bong, Jürgen Hosemann und Oliver Vogel verschiedene Versionen der einzelnen Gedichte nebeneinander stellen. In immer neuen Anläufen versuchte Hilbig sich dem anzunähern, was für ihn die adäquate sprachliche Entsprechung seiner noch wortlosen Gedanken war. Deutlich sieht man es daran, dass die einzelnen Versionen kaum ähnliche Verse enthalten. Jede Version ist ein gänzliches neues Gedicht unter einem thematisch gleichen Titel.
Unter den nachgelassenen Gedichten befindet sich ein vollständiges Manuskript, datiert auf das Jahr 1964, das von der Stasi beschlagnahmt worden war und erst nach 1989 Hilbig wieder zugestellt wurde. Was diesen Fund so bemerkenswert macht, ist die Tatsache, dass Hilbig nach eigenen Angaben alle vor 1965 entstandenen Texte verbrannte. So wurde die Stasi unfreiwillig zum Bewahrer eines literarischen Zeugnisses, an dem sich ablesen lässt, wie schwer ein junger Dichter um die eigene Sprache kämpfte. Heraus kam eine hochpoetische Dichtung, die für Hilbig existenziell wurde. Er lebte, um zu schreiben. Kaum ein anderer Autor hat das eigene Leben so radikal in Literatur umgesetzt, wie Hilbig. Das gibt seinen Texten die ihnen so eigentümliche Authentizität, das macht sie aber auch zu Orten der Verletzlichkeit, wie Uwe Kolbe im Nachwort schreibt. In jedem Gedicht, jedem Vers gab Hilbig etwas von sich selbst preis.
Karen Lohse, glanzundelend.de
Die Sprache eines Feuerfressers
Vor einem Jahr starb Wolfgang Hilbig. Sein Leben ist von Mythen umringt. Sie kommen aus Unverständnis, Erschütterung und Bewunderung. Das gebremste Leben will so gar nicht zur Größe seines Werkes passen. Der Topos vom „Surrealisten aus dem Kesselhaus“ ist richtig und falsch zugleich. Wer sich so verausgabt, ist wirklich frei von Zuordnung. Hilbig kann in M., sprich Meuselwitz, einem Industrie-Moloch südlich von Leipzig, wo er 1941 geboren wurde und fast bis ins vierzigste Jahr ein Leben als Heizer führte, nicht einfach tradierte Bilder abrufen. Aber er rührt als Erzähler und Dichter früh am Vergessenen, Unsagbaren und Absurden unter den unerbittlichen Gegebenheiten, in die er geworfen wurde. Prosa und Lyrik lösen sich mit korrespondierenden Motiven in großen Blöcken ab. Keines von beiden ein Nebenwerk. Dichter und Erzähler haben gleiches Gewicht.
Als 23-Jähriger schreibt Hilbig die Sammlung „Scherben für damals und jetzt“, die von ihm später verloren gegeben wird, bis sie sich in den Spitzel-Akten wiederfand. Erschütternder Beleg, wie früh die Stasi-Infamie bei einem schreibenden Arbeiter einsetzt. Hilbig hat diese gut fünfzig Gedichte auch nach dem Wiederfund für eine Veröffentlichung nicht gelten lassen, aber in eine Werkausgabe seiner Gedichte gehören sie. Weniger um die Schleichwege zur Moderne kenntlich zu halten, als die Urkraft von Hilbigs Sprache dem Klischee vom Autodidakten entgegenzustellen. Diese sehr frühen Gedichte sind mehr als Stilübung und Stimmungsbild, sie sind Signale eines sich frei Schreibenden. Auf eigene Art von einem Beispiel angezogen werden, heißt hier Hölderlin und Novalis.
In dem Gedicht „Die Sprache des Feuerfressers“ schreibt sich Hilbig einen „Epitaph“ auf sein ungelebtes Leben, und der Name des Symbolisten Corbière leuchtet auf.
Ich,
geboren, unterm Feuer der Zeit,
verkohlt, verräuchert, entmoralisiert
in der Hitze der Verlassenheit,
in den Flammen der Angst vertiert,
erhitzt am Morgen,
am Tage entzündet,
leuchtend am Abend,
in der Nacht verbrannt
Im „Traumbuch der Moderne“ blättert der Mann aus Meuselwitz Stück für Stück, wie sich an den nach 1965 geschriebenen Gedichten des Bandes abwesenheit, aber auch im weiteren Nachlasses zeigt.
Wer wie Hilbig immer auf der Suche bleibt nach Bild und Sprache für die unbeherrschbaren Dinge dieser Welt, für das Harsche der Menschenkälte, für die Geräusche der Angst und die Weite der eigenen Verlorenheit, kann gar nicht anders, als die literarische Moderne zu adaptieren. Hat er Baudelaire, Rimbaud und Mallarmé oder Apollinaire, Breton und Péret einmal eingeatmet, wird er sie auch nicht mehr los. Hilbigs Aneignung ist ekstatisch und doch kann er seinen poetischen Sinn selbst erzeugen, er ist zur Selbstfindung verurteilt.
Aus dem Warteraum befreit
Die gesammelten Gedichte erscheinen jetzt als erster Band einer auf sieben Teile konzipierten Werkausgabe bei S. Fischer. Zu den Gedichten der Bände abwesenheit (1979), stimme, stimme (1983, einziges Buch Hilbigs in der DDR), die versprengung (1986), Bilder vom Erzählen (2001) und verstreuten Stücken kommen noch 153 Gedichte aus dem Nachlass hinzu. Wohl 120 abgeschlossene Gedichte aus vierzig Jahren soll es noch geben und jedes ist, wie anders bei Hilbig, eine Selbstbehauptung. An diese Unbedingtheit erinnert, fragt man sich, was für die Gesammelten Gedichte als unnötig betrachtet wurde.
Auch die Anmerkungen zu den Nachlassgedichten bedürften weniger der Lebensdaten von Rousseau, als der Entschlüsselung der Widmungsgedichte. So erfährt Heide Härtl eine Widmung, aber keinen Hinweis, dass sie mit Gert Neumann in Leipzig zum einzigen Autorenkreis gehörte, dem Hilbig je nahe stand. Auch ist ein Wort zu den Zensureingriffen bei der Leipziger Reclam-Ausgabe stimme, stimme zwingend, wie überhaupt zur Editionsgeschichte mit ihren Verzögerungen.
Zumindest ein großer Teil der Schubladen-Verse ist endlich aus dem langjährigen Warteraum befreit, immerhin zweihundert Seiten, und zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Eine Nachwelt, die nicht seine ist, erlebt jetzt eine Unmittelbarkeit von Welteinlassung, die mehr ist als „Befindung“ und Befund. Schon das frühe Gedicht „aus der tiefe“ wird zu Hilbigs de profundis:
hilf mir
und sieh wie meine zornige zunge blutet
in einem wald von fahnenstangen
häusern und gepflegten höfen
hat mich der wind
überwältigt
…
hilf mir und helft mir alle aber
zähmt mich nicht weil ich
weiterleben will
Hilbig weiß um den Zinseszins des versäumten Lebens und erschreibt sich schon vor vierzig Jahren ein Revirement aller Bedeutungen. „es ist schwer überprüfbar inwieweit dieser landstrich / einem ort ähnelt aus einem canto von ezra pound / (usura is a murrain) wo denn / liegt dieser ort – hier nicht – / wer weist das nach“. Hilbig schreibt nicht voraussetzungslos, kehrt aber immer zum eigenen Ursprung zurück, auch in den späten Gedichten. „dort wo ich abfiel als ich wiederkehrte – – / gegen den untergang der meinen schatten aus der sonne schnitt.“ Aus den letzten Jahren zeigen sich nur wenige Gedichte. Vieles aus der frühen Zeit, auch was der Moderne als Pathos und Emphase gilt, wird wieder gegenwärtig.
Das Meer verhüllt von Licht: verhüllt von Helligkeit…
im Sinn von Licht: ein Lilienweiß um nichts zu sein
als Weiß der Lilien – und Meer um nichts als Meer
zu sein und ohne Maß: und Mond-Abwesenheit −
welch Leuchten das seine lange Überfahrt antritt
und jedes Land vergißt auf nichts bedacht als Ewigkeit −
das Meer; das nicht mehr Tag noch Nacht ist sondern Zeit.
Und der Dichter ist nichts als Dichter, „und ohne Maß“. Selten spürt man das Ungenügen als Rezensent so deutlich wie bei diesen Gedichten. Mit einer Besprechung ist es nicht getan. Wolfgang Hilbig ist noch nicht ausgelesen, der Fall nicht abzuschließen, um das mindeste zu sagen.
Jürgen Verdofsky, Frankfurter Rundschau, 28.7.2008
Schwere Kost, aber gehaltvoll
Schwere Lyrik, für den Hobbyleser oder Lyrikeinsteiger sehr schwere Kost. Aber wer wirklich daran interessiert ist, starke Dichtung zu erlesen und dann auch zu erfühlen liegt hier richtig. Hilbigs Lyrik ist keine Hilfe für den Tag oder lustiges Reimspiel, viel mehr eine Darlegung eines Charakters, dem jedem Gedicht innewohnt. Einem Charakter der sich dem Leser so offenbart wie er ist, rastlos umherirrend zumeist oder einfach nur berührend. Je mehr man eintaucht in diese Lyrik, desto mehr wird man es schade finden, dass dieser Dichter nicht mehr unter uns weilt.
Glabowski, amazon.de, 15.10.2011
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Wolfram Malte Fues: Das Rätsel fängt an aus sich selber zu singen
fixpoetry.com, 25.6.2009
Christian Riedel: Plötzlich auf dem Brikettberg: Schönheit
literaturkritik.de, Juli 2008
Sostenuto für Wolfgang Hilbig
Nun fällt die Nacht: die Zeit die dauernd endet
und dir gebrichts am Wort mit dem du ferner handelst
was gestern licht und wert war ist verschwendet –
und es ist Nacht und Zeit daß du dich wandelst.
Wolfgang Hilbig: „Pro domo et mundo“
Baumstämme im Wasser
Baumstämme im Wasser: dieses Glimmen, das mit der Fäulnis heraufkommt und in den Nächten als flackerndes Rötlich oder bläuliches Weißgrau sich zeigt. Wir wissen nicht, daß vor den Häusern das Sumpfland beginnt, daß es bereits beginnt, zu den Türen hineinzuwachsen… durch die Dielen… über das Dach… unüberschaubar, eine unüberschaubare, graue, irrlichternde Flut. Wir glauben, noch immer, in Sicherheit zu leben, in den geordneten Ummauerungen unseres Daseins. Wir wissen, daß wir uns die schleichenden Gase nur einbilden dürfen; und wir hören an den Tagen den Verkehr auf den Straßen und, wie wir meinen, die Schritte vorübereilender Passanten, vital und unausgesetzt. Wir könnten ahnen, daß es das Fletschen wilder und hungriger Tiere sein muß, die kommen und uns fressen; daß die Zeit gekommen ist, unserer Hoffart ein paar Riegel vorzulegen. Aber wir nehmen es einfach nicht wahr.
LARGO CON MOTO: SOMMERENTWURF
1
Über den brennenden Kanälen
steht Trauer, kein Atem.
Die Schiffe sind zerbrochen, das
Gut von den Rampen geplatzt.
Glut steigt von den Kadavern – wenn
die verrotzten Herden geschlachtet
sind, verworfen, geht beißender
Dampf von den Gräbern. Schlieren
die starrbeinigen Körper hinweg.
O welch ein Geruch in den Sommern:
zerblatterte Wolken, Pesturnen
aus Fleisch. Silberner Schimmel
der Ahndung. Silbernes Vergehen der
Orte, wenn die stakenden Tänzer
sich in den Leibermeeren verliern.
2
Ja, und Tänze. Die wirren Füße
verkreuzt, wackeln die Mägde
verschwitzt, und schwangere Elfen
schaukeln vorbei. O des Trinkens
in den verbrannten Augüsten!
All mein Liegen zerknickt. In den
schattigen Bunkern zu träumen
kein Lohn. Keine der Frauen, die
bleibt, um nicht zu verschwinden.
Denn das Gleißen geht über die
Lichthorizonte und stürzt und
wandelt sich in lederne Schwärze.
Bleibt liegen, wenn die Mondhorden
Über mich herfalln, meine
gläsernen Glieder, in denen
der Schmerz geronnen abliegt und
meine starren Blicke wie Tau
bricht. Blicke wie Tau… solche
Erregung für mich, neugierige
Augen, mich einmal zu streifen –
einmal, bevor die Hitze eintritt.
Zwischenspiel: Notturno da capo al fine
Hier ist es endlich still. Die Dinge schweben über ihren verlassenen Schatten. Das Schweigen repariert die Trommelfelle, vergilbt über dem Kopf zu einer höheren Stille. Der Pfeilschaft in der Schulter, noch eben ein rasender Schmerz, blinkt jetzt und blakt wie ein ehernes Talglicht, dem sich nun die Luftzufuhr Stück für Stück in die Leere entzieht. Du schwebst, wie die Dinge betrachtest du deinen Schatten, eine unförmige, doch inzwischen schwerelose Furchung dein Leib, die Arme streng gewinkelt mit dem knirschenden Geräusch deines vertrocknenden Fleischs. Du schwebst und liegst zugleich noch in den Bergen, wo ich dich traf, mit Blicken zunächst, die nicht ausreichten dann – dein Körper gelinde gedreht in einer pudrigen Wüste aus Schnee, und das schartige Gefieder der Vögel dreht sich, ohne dich noch zu erreichen, ebenso schweigend und still in der Nähe. Jetzt erst siehst du die zerhackten, zerschnittenen Ballen der Hand – wie sie dir auf deiner überstürzten wie sinnlosen Flucht nicht auffallen konnten, zieht sich jetzt der Schmerz aus ihnen zurück, läuft an den sich verkrümmenden Sehnen entlang, verschwindet in der verkümmernden Dattel deines Körpers… wo du die letzte Mahlzeit noch fühlst… jetzt, jetzt, schwächer werdend, jetzt nicht mehr, nun hast du sie vergessen und spürst dem Verschwinden deines Beingefühls nach, während du dich, in stiller Rotunde, um dich selbst drehst, ein schwindender Schatten dein Leib… das Schweigen repariert die Trommelfelle, und das weise Knistern des Abschieds erreicht, überrollt dich mit Wärme. Es ist das einzige Geräusch und das Tröstlichste, was dir deine vertrocknenden und zugleich gesundenden Ohren jetzt bieten. Nun bist du erleichtert, drehst in der Rotunde auf dem Gebirg’, das dein verlorener Glaube ist, an alles, die Sühne, den Geist deines Tuns. Der Gedanke ans Licht heißt: das Nachlassen des Schmerzes. Er steht auf dir und leuchtet, betrachtet dich wie den Schatten seines eigenen Leibs. Ein Fluß von Strahlen wie Hände auf dir, ein Leuchten, ein Irrlicht, eine frohe Verheißung. Keine Pein mehr in den Gliedern… wie beim letzten Schritt, als dich der Blick und der Pfeil traf. Nur Stille. Die Séance der Erlösung, wie sie über dir, unter dir, Schatten deines Leibs, und inmitten dir schwebt. Das Blinken des Pfeilschafts erloschen, das Rumoren der Spitze im Fleischsaum der Schulter verstummt. Das Klirren der Waffen und Schnäbel entfernt. Die gurgelnde Mahlzeit im sich verbiegenden Leib das vergessene Pfand für das Andere, das, denkst du, ohne zu wissen (oder denkt dich der Strahl des Gedankens?)… das dich nach dem Durchschreiten der Stille erreicht. Aber noch drehst du dich in der Rotunde aus Schweigen und Licht, und nimmst schwindend wahr, und auch die Dinge verschwinden um dich, reiten durch die schwindende Luft in den Schutz der schwindenden Mauern aus Fels, drehn ihre Runden hinter einem gleißenden Spalier aus Graten und Licht… und gehn dir vergessen: wie du sie vergißt und dich und alles in diesem stummen, kaum rauschenden Inferno des nachlassenden Schmerzes, der, ein guter Gedanke, dem alles verschluckenden, dem Ablicht zutreibt, das hinter der Stille, der Erlösung des nachlassenden Schmerzes, beginnt und dich in eine noch viel unendlichere Stille, und den Schatten deines Leibs, endlich befreit. Gelinde dreht sich das Schweigen. Die Schatten schweben über den verlassenen Dingen.
GRAVE
Ein Spiel, gedacht zur Entspannung
Von Augen, Herz, Stimmung –
Wer sich bewegt, gerät noch tiefer
In die Schlingen hinein.
Geh – und sieh dich nicht um, die nächste
Hand, die nach dir greift, wird dich
Erwischen, und du sinkst in die Tiefe
Der Vergessenheit weg.
Der Schwarz-weiß-Gestreifte
Ist zu erlangen – er wird
Mit Gold aufgewogen… oder
Dem Leben der Andern.
Nichts wird sein wie zuvor – einzig
Dein Trachten bewegt sich
Auf der Bahn unserer Notdurft –
Die du nicht mehr verläßt.
Oder aber: bewege dich nicht,
Spiel nicht mit den Blicken
Der Verheißung – sie branden ins Holz,
Ihr ledernes Werg reibt dir kühl
Über die Fläche, rühre dich nicht:
Der fallende Schwarm der
Leoniden, er fällt nicht für dich;
Sei still und bleibe gewarnt.
Menuett und Reprise
1
Aber das ist noch längst nicht entschieden. Einzig eine Frage der Wahrnehmung, sagst du. „Überhaupt sehen wir nur, was wir auch erblicken wollen – darin liegen Gnade und Fehler zugleich.“ Pompeji, meinst du, Erewan… der Ararat… in unseren Träumen und deshalb nie zu erreichen für uns – es sei denn, als Repliken im mitteldeutschen Rayon, über und über zerwühlt, fürs Kreisenlassen der Schaufeln benutzt… Oder: auf unseren Reisen im Kopf, betrunken, in einem Zug, der nicht ankommt, an den, du weißt es, nur geträumten Orten Zeitz und Pegau vorbei, etwa, zum Beispiel… Unser Schlaf in voller Beleuchtung: ein Schlaf, der noch von unserem Mangel an Schlaf entleert ist. Das also ist unsere Deckung – hellwach in den Träumen zu wandeln – wir drehn uns, in den Nächten, im schwindenden Licht, Traum um Traum, in getragenen Tänzen durch die unveränderbar malträtierte Landschaft, die mit den Planen der Neuzeit bedeckt ist, bemäntelt, trügerisch und unverständlich wie je. Über dem Desaster ein kreisender Bussard, ein Menuett aus Flügelschlägen und Rufen, ein starker Auftritt der Natur, der der glazialen Serie unserer Unnatur folgt. Irgendwo platzt ein Kraftwerk, Scharen von Rauch, sich mischend mit Dampf. Lippendorf. Böhlen. „Dort hatte ich eine Geliebte“, sag’ ich, du lächelst und prostest mir zu. „Pompeji“, sagst du und bezweifelst, ob es sie je gegeben hat. Dein Lächeln bedeckt deinen Zorn: du hebst die blinkende Flasche zum Mund, der schon die Schluckregung macht… du stemmst sie dir in den Rachen, der tief in dem Kopf endet, der dies gedacht hat und alles hinter den Schleppnetzen schwerer Vokale verbirgt. In der Hauptstadt werden sie dich, den gefeierten Mann, in der Gosse finden, mit dem traurigen Glanz deines Ruhmes behängt, den knirschenden Glasstaub der Unrast wieder im Blut. Es bleibt: bei diesem betörenden Sommer. Draußen wanken in gemessenen Schritten die gesprenkelten Leichen der Bäume vorbei.
2
Ich erinnere mich: wir waren völlig betrunken… mir schien, als könnten wir in Streit geraten sein über eine Nichtigkeit. Die anderen waren bereits auf der Rückseite des Schlafs angelangt, hatten die Täler durchwandert. Meine Blicke verschwammen ins Nichts. „Baumstämme im Wasser“, sagtest du plötzlich, riebst dir die Schulter an dem Punkt, wo ich die Narbe vermutete, gingst auf meinen letzten Anwurf nicht ein. Ich hatte mich vergaloppiert und suchte, mich in den Griff zu bekommen. Dein Schweigen hielt meiner Verzweiflung kühl stand. Du hattest neue Texte gelesen, mir zuliebe ein paar alte Gedichte, mit der knarrenden Ratlosigkeit der wenigen noch kommenden Zeit. Wir saßen, tranken und rauchten unbeirrt weiter, setzten fort, was wir einst mit Kaffee bedächtig begonnen hatten, im Gewimmel der Messen, die nicht zu uns paßten: wie in maßgeschneiderten Jacketts, für gefönte Riesen gemacht, hingen wir auf ihnen herum. Ich trank schweigend, du rauchtest dazu, lächeltest, trankst immer, wenn die Blicke sich senkten. Fern das Gleißen der Felswand, über der mitteldeutschen Ebene, aus der du dich fortgemacht hattest, woanders zu trinken, zu rauchen… nachdem du das eine gelassen hast für lange Zeit, das andere nicht lassen konntest. Du hattest sie nie so genannt, es war die Ebene einer namenlosen Versprengung für dich. „Ich weiß, der Ararat kommt wieder nach Sachsen, er stürzt in den Himmel – mit seinen Scharten und Gletschern zerreißt er den Wolken das Fleisch“, lallten die Äther. Als ich es nicht mehr aushielt, erhob ich mich und ging, gegen das Gefühl unseres Überworfenseins kämpfend. Ich war längst draußen, da flog die Kneipentür auf, du kamst mir nach und umarmtest mich, als du mich erreicht hattest, zum Abschied. Ausgesöhnt mit dem Abend, setzte ich meinen Weg fort. Du eiltest in die Kaschemme zurück. Es war das letzte Mal, daß ich dich sah. Ich drehte mich dem Viertel zu, in dem ich lebte… In meinem Kopf murmelten die Sätze, die ich noch hatte sagen wollen. Und Musik: ‚Peace be with you…‘, dröhnte es in mir, es klang wie der verschollene Song einer der großen Bands, von der wir bald nichts mehr hören sollten. Ein hoher Gitarrenakkord verfing sich in seiner eigenen Harmonie, steigerte sich bis auf ein beinahe unaushaltbares Plateau, dann brachen die Synthesizer und Orgeln ein, daß man für einen Moment die Schlagzeug- und die Bassläufe nicht mehr ausmachen konnte: Peace. Be. With. You. ‚Peace be with you…‘, dachte mein rauschendes Hirn: ‚Friede sei mit dir.‘ Dann kam Wind auf, und ich setzte meinen Weg in die Nacht zielstrebig fort.
REISE DURCHS LICHT
Heute blühn die Magnolien für dich.
Magnolien, im August, wirst du sagen.
Aber so ist es – mit Porzellanblüten
Schlägt heute jeder Strauch, ja, Straßen-
Mast aus, um dich zu ehren. Und
Ruhe nun aus: wo die dürstende Erde
Die wunderlichsten, auf dieser Seite
Der Welt noch nicht erblickten Blüten
Austreibt: Wolfswegerich, Feistblatt
Und Araratkraut, Lilien mit Schwertern
Wie Abteiltüren schwer, und schwarze
Gladiolen… Bald stehn die Plejaden
Günstig und du findest den Orionweg –
Mit dampfenden Früchten behangen,
Steigst du ins Irrlicht. Solange blühn
Die Magnolien, heulen die Zerberusse
Für dich… ein sanftes Glimmen und
Glühen für dich, in der Nacht von Berlin.
André Schinkel, glossen, Heft 35, Oktober 2012
Wolfgang Hilbig und die „schöne Revolution“
– Eine Reminiszenz. –
Hilbigs fluchbeladene Welt ist kein Alptraum, aus dem man erwachen könnte. Erwachen in ein harmonisch-göttliches Dasein, wie es in Jean Pauls „Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, daß kein Gott sei“ schließlich versprochen wird. Und doch gibt es auch in Hilbigs Welt Momente der Erlösung und Kommunion.
Zwischen 1988 und 1990 schrieb er an dem Fragment gebliebenen Langgedicht prosa meiner heimatstraße; die ersten drei Teile erschienen 1990 in der Neuen Rundschau (Heft 2) und in Sinn und Form (Heft 4). Das Poem ist der Gesang einer Rückkehr, der Wiederkehr des Dichters – er übersiedelte 1985 aus der DDR in die Bundesrepublik –, nein, nicht in das „Heimatland“. Die Herkunft wird nicht in einem erinnerungsseligen Milchwald-Surrealismus à la Dylan Thomas vergegenwärtigt, sondern eine „unterwelt der asche […] der ich niemals entkam“ wird in düsteren Bildkaskaden ins Gedächtnis gerufen.
Erinnert wird die „Unterwelt“ in mehrfacher Bedeutung des Wortes – als vergangene, unter der Gegenwart liegende, als soziale der kleinen Leute und underdogs, als metaphorisch-apokalyptische „schattenwelt der asche“.
Vor dem dunklen Hintergrund dieser Aschen- und Schattenwelt hebt sich der dritte Abschnitt des aus einer Einleitung und fünf Teilen bestehenden Langgedichts ab. Er feiert die Demonstrationen in Leipzig und anderen Städten der DDR vor zwanzig Jahren – und damit den wiedergefundenen Sinn der Wörter, die Poetik der Revolution:
… schulter an schulter: so erinnert
die straße sich geschluckten sinns der wörter
endlich geformt zu zeilen…
Die Reihen der Demonstrierenden und Protestierenden werden zu Zeilen einer grandiosen poetischen Inszenierung. In biblischem Ton werden die Mühseligen und Beladenen aufgerufen, und man spürt, wie die Begeisterung den Dichter überwältigt und mitreißt, in der Aufzählung wird keine Schattenexistenz ausgelassen, eher ist es das Bürgerliche und Kleinbürgerliche, das Wohlgesittete und -gesinnte, die hier fehlen müssen und dürfen. Die sarkastische Auflistung persifliert wohl auch die offiziellen Losungen, wie sie jeweils zum 1. Mai von der Parteipropaganda erstellt wurden, wobei keine sozial relevante Menschen- und Berufsgruppe fehlen durfte. Und sie korrespondiert zugleich mit dem Witz und Geist der Aufrufe, die in befreiender Respektlosigkeit gegenüber angemaßter Herrschaft auf den Herbstdemonstrationen 1989 zu hören und zu sehen waren.
schön ist die rebellion der habenichtse vorbestraften und verkrachten schön ist die revolution der dummen und geohrfeigten der demoralisierten der anästhesierten der pseudonyme. (…) schön ist die revolution der windhunde traumtänzer taschenspieler trickbetrüger und aller übrigen betrogenen. die revolution der aufschneider und verkrochenen der randexistenzen und der hektiker in den metropolen. o die revolution der marionetten der beauftragten und nichtbeauftragten der fehlenden bei den empfängen der unterbezahlten befehlsempfänger und der ausgezeichneten schwarzarbeiter der arbeitsscheuen der arbeitslosen der arbeiter und bauern
Der Augenblick der Schönheit ist der Augenblick der Rebellion und umgekehrt, er vereint die Erniedrigten und Beleidigten in einer Art Unio mystica. Dieses Einmalige und Irreale wird provokant ausgestellt; es verdankt sich einer entfesselten, assoziativen Mechanismen folgenden Sprache; höhnisch Widerspenstiges beglaubigt das Pathos.
schön ist die straße der revolutionären massen angeführt von konterrevolutionären spinnern. schön ist die revolution der abtrünnigen der verräter der huren des kapitals der dekadenten der pasquillanten der hyänen der schakale der aasgeier der verbrecherischen elemente der verleumderischen elemente der gewissenlosen elemente der blutbesudelten elemente der tollwütigen elemente der käuflichen subjekte…
der schreiberlinge der finsternis und der feiglinge aus irrsinn
schön ist das feuer in dem der kurze lehrgang der geschichte der KPdSU (B) verbrennt schön alle überlebenden papiere schön ihre einsamkeit und trauer schön ist jeder künftige anruf der schönheit
und ich rufe euch an: schön seid ihr endlich in der revolte
die ihr nicht vergessen werdet denn ihr seid gepriesen
waffenlos gewaltlos rückhaltlos und gepriesen
die ihr die straße mit euren lange verschütteten worten
gefüllt: abschaum
der auf schöner woge flog
gepriesen da ihr der schönheit die namen zurückgabt
und entfacht habt in der straße
Auf der Straße schlägt die Stunde der Wahrheit, zugleich eine Geisterstunde, in der die Opfer des stalinistischen Sozialismus – die „räudigen“ und die „tollwütigen Hunde“ in der Sprache Wyschinskis, des Anklägers in den Moskauer Schauprozessen der Jahre 1935-38 – als Wiedergänger erscheinen.
… es wimmelt nur so, ein ganzer Haufen von Wiedergängern erwartet uns dort: Leichentücher, herumirrende Seelen, Kettengerassel in der Nacht, Stöhnen, gellendes Gelächter, und dann all diese Köpfe, so viele Köpfe, die uns unsichtbar betrachten, die größte Ansammlung von Gespenstern in der ganzen Geschichte der Menschheit.
So eine Notiz Derridas zu Marx’ Schrift Deutsche Ideologie; sein Buch Marx’ Gespenster widmet sich dem Marxismus als „Gespenstergeschichte“, beschwört das Unbewältigte und das Unabgegoltene – in der Verantwortung gegenüber den Toten und den noch nicht Lebenden. Auch Dichtung ist in diesem Sinn Geisterkunde, ist Schattenwirtschaft, die das reale menschliche Wirtschaften geisterhaft begleitet.
schön ist ein volk in waffenlosem aufruhr
empörung die am mittag noch schlief sie hält die fahrbahn dicht besetzt:
wer jetzt ausgeht durchgeistigt und fahl
öffnet nicht umsonst seine tür er hört sich
im lärm der meuterei unter den fußgängerbrücken
(…) auch er voll dumpfen bluts
ein egel in der grube der nation
im massenhaften aufschrei fährt er endlich nabellos ins licht…
schön ist ein volk das niedre ohn gewalt verheerend
ohnmächtig psalmodierend bis der gott ertaubt
schön solcher woge fortgang über ämter throne sakristein
die woge die tribünen aushebt und kulissentrümmer schwemmt
schön ist der dilettanten aufstand im orchestergraben. …
Vielleicht ist Hilbigs Poem der letzte gewaltige abendländische Revolutionsgesang, im Geiste des 19. Jahrhunderts gleichsam, mehr großer Abgesang als Auftakt und Verheißung. Noch einmal wird es aufgerufen – das kostbare Ideen- und Bildgut, das Pathos und die Emblematik der Revolution. „schön solcher woge fortgang über ämter throne sakristein“ – die Bezeichnung der Herrschaftsinstitutionen eben gemahnt ans 19. Jahrhundert, von dessen Poesie dieses ekstatische Gedicht zehrt. Ja, wie denn – welche Realität ist bezeichnet, wenn nicht die eines poetischen Nachscheins? Weggeschwemmt wurden höchstens Sakristein im übertragenen Sinne; Wortführer der „Wende“ waren im wesentlichen Pfarrer und Theologen, Rechtsanwälte und Geistesschaffende.
Und auch im Bild des Dichters wirkt mächtig der Mythos. „… wer jetzt ausgeht durchgeistigt und fahl“ – das ist wohl der Poet selbst als Einsamer, der in der Menge, die mit pfingstlich gelöster Zunge spricht, den „Sinn der Wörter“ wiederfindet. War er wie diese „voll dumpfen bluts“, ein egel, fährt er nun aus der „grube der nation“ als Engel nabellos auf ins Licht.
Der Aufruhr verspricht die rauschhafte Erlösung aus der Einsamkeit durch das Bad in der Menge; in ihm finden Poesie und Nächstenliebe zueinander, im schönen, freilich nicht dauernden Augenblick. Man erinnere sich des Prosatextes „Die Menge“ von Baudelaire, in dem es heißt:
Der einsame, gedankenvolle Wanderer wird auf sonderbare Weise trunken von dieser Gemeinschaft mit allen. Wer sich leicht der Menge verbindet, der kennt erregende Genüsse, die dem Selbstsüchtigen, der wie ein Schrein verschlossen ist, und dem Trägen, der wie die Molluske in einer Schale lebt, auf ewig versagt sind. Er aber bekennt sich zu jedem Stand, zu allen Freuden und allem Elend, die ihm die Umstände bieten. Was die Menschen Liebe nennen, ist so klein, so begrenzt, so schwach, verglichen mit dem unsagbaren Fest, dieser heiligen Preisgabe der Seele, die sich dem Unvorhergesehenen, dem Unbekannten, das erscheint und vorübergeht, ganz hingibt – hingibt als Poesie und als Liebe zum anderen.
Hilbigs Poem ist das Bewußtsein der Einmaligkeit eingeschrieben – „schöne zwischenzeit des november“ heißt es an einer Stelle. Sie beschwört den Begriff der „schönen Revolution“ herauf, mit dem Marx die Februarrevolution 1848 in Frankreich bezeichnete, im Unterschied zur Junirevolution des gleichen Jahres, als die Gemeinsamkeit des Volks, von Bürgertum und Proletariat also, im Kampf gegen die Monarchie zerbrochen war und die neuen Gegensätze aufbrachen.
Dussardier, eine Figur in Flauberts Roman Lehrjahre des Gefühls, beteiligt sich an den Kämpfen der Februarrevolution und schwärmt:
Ich komme von dort! Alles geht gut! Das Volk triumphiert! Arbeiter und Bürger liegen sich in den Armen! Ach, wenn ihr wüßtet, was ich gesehen habe! Was für tapfere Leute! Wie schön das ist!
Marx nannte die Februarrevolution deshalb eine „Revolution der allgemeinen Sympathie“, weil die Macht des Wortes noch den (unentwickelten) sozialen Interessenkonflikt verdeckte.
Die Phrase, welche dieser eingebildeten Aufhebung der Klassenverhältnisse entsprach, war die fraternité, die allgemeine Verbrüderung und Brüderschaft. Diese gemütliche Abstraktion von den Klassengegensätzen, diese sentimentale Ausgleichung der sich widersprechenden Klasseninteressen, diese schwärmerische Erhebung über den Klassenkampf, die fraternite, sie war das eigentliche Stichwort. (Marx: „Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850“)
Die Analogie drängt sich auf: Die Novemberwende war eine „schöne Revolution“ unter der Herrschaft des Worts und der Phrase, der allgemeinen Verbrüderung, die weite Kreise umfaßte. Sie war die Ausnahme, der alsbald die Regel folgte: die „Häßlichkeit“ der normalen Verhältnisse, der harten Interessengegensätze und -kämpfe, der Spaltung der Gesellschaft in diejenigen, die steigende Einkommen, und diejenigen, die gerade mal ihr Auskommen haben, in die Reichen und Armen, die Betuchten und Bedachten einerseits, die Unbetuchten und Obdachlosen andererseits. Und es hat schon seine Richtigkeit, die blühenden Landschaften sind erst recht pittoresk, wenn es Bettler und Obdachlose in ihnen gibt. Der Zeit der Begeisterung über die Einheit folgte die Entgeisterung – wie sollte es anders sein, wenn die realen Verhältnisse in den Blick treten.
Einen Nachtrag zur „schönen Revolution“ lieferte Wolfgang Hilbig 1997 in seiner Dankesrede zur Verleihung des Lessing-Preises. Seine Weigerung, die Verheißungen der „Herrschaft des Profits“ für bare Münze zu nehmen, verärgerte die anwesende Politprominenz. Dabei war diese Skepsis nichts anderes als das „naive“ Beharren darauf, daß Freiheit Perspektiven eröffnet und nicht begrenzt. Hilbig sagte damals:
Wir haben eine Welt gewählt, die vollkommen ohne Alternative erscheint. Es gab da, zu Beginn des letzten Dezenniums, in diesem Jahrhundert einen Moment, in dem wir glaubten, mündig zu sein, es war ein glücklicher Moment, aber er führte uns in eine Unmündigkeit zurück, die wir uns so nicht im Traum vorgestellt hatten. Dieser Moment entgrenzte die Herrschaft des Profits und seiner Mechanismen bis zur Ausweglosigkeit.
Jürgen Engler, Sinn und Form, Heft 3, Mai/Juni 2009
Ort der Gewitter (Wustrow)
– Eine Erinnerung an den letzten Besuch bei Wolfgang Hilbig. –
Als der Regen schwächer wurde, ging ich vom Hotel aus noch einmal zur Seebrücke; es war elf Uhr abends, und niemand sonst war dort. Obwohl sich das Gewitter entfernt hatte, fehlte mir aus Angst vor den Blitzen der Mut, bis an die Spitze der langen, schmalen, stegartigen Konstruktion zu gehen, die aufs Meer hinausführte. Ich stand jetzt an jener Stelle, an der er ein paar Tage zuvor zum letzten Mal die Ostsee gesehen hatte; danach war er zu schwach gewesen, das Haus noch einmal zu verlassen.
Bis zum Beginn des Regens war ich noch bei ihm gewesen (wie er, eine Hand auf der Brust, in dem abgedunkelten Zimmer schlief; wie er uns von seinem Sessel im Wohnzimmer aus draußen beim Essen zusah; wie er nach einem Wort oder Namen suchte und sich leise entschuldigte, als er es nicht fand). Mit den ersten Regentropfen hatte ich dann etwas überstürzt das Haus in dem kleinen Ferienort verlassen und war zurück in mein Hotel gegangen, wo mir auf den Fluren Menschen in weißen Bademänteln begegneten; ich war, ohne es zu wollen, in ein auf Wellness spezialisiertes Urlaubsparadies geraten, während er kaum zweihundert Meter entfernt im Sterben lag. Auf dem Zimmer hatte ich begonnen, in seinen Briefen und ungedruckten Texten zu lesen und dann noch einmal in „Ort der Gewitter“, einer Kindheitserinnerung an die 5oer Jahre, in der eine ganze Stadt einen Sommer lang auf das erlösende Unwetter wartet (– alles, was ich las, war ein Schreiben bei Gewitterlicht).
Das Gewitter da draußen geisterte jetzt unruhig über dem Meer herum, als wüsste es nicht wohin. Am Land, zu beiden Seiten der Seebrücke, hockten abweisend und desinteressiert die Strandkörbe. Ein oder zwei Kilometer weiter erhellte ein weißes Leuchtfeuer die Nacht, das Signal war Kurz-Kurz-Lang. Die Regenluft streute das Licht in weitem Umkreis, und als ich es das erste Mal sah, dachte ich, ein Auto käme mir dort aus den Dünen entgegen (als münde die Straße direkt ins Meer). Die Lichter der westlicher liegenden Orte, die gestern Abend deutlich zu sehen gewesen waren (sogar das Feuerwerk über Rostock), hatte die Nacht verschluckt; auch nach der anderen Seite, wo Ahrenshoop lag, war völlige Schwärze, in der nur manchmal und wie vom Wind geworfen ein rotes Licht auftauchte.
Ein Geräusch ließ mich zum Land zurückblicken; eine in ihrer Kleidung unförmige Gestalt, die eine Art Einkaufswägelchen hinter sich herzog, kam auf mich zu. Als der Mann heran war, sah ich, dass es einer der Angler sein musste, die abends die Seebrücke bevölkerten.
„Als das losging“, sagte der Mann und zeigte zum Himmel, „sind die anderen ja alle gleich weg. Hätte doch keiner gedacht, dass das dann auch so schnell wieder weg sein würde.“
Ich wollte sagen, dass nach meinem Gefühl die Blitze wieder zahlreicher geworden waren, aber dann fragte ich nur, ob er heute Nacht noch mit weiteren Anglern rechne. „Nein“, sagte der Mann, der unter seiner Kapuze kaum zu erkennen war. „Bei Gewitter soll man ja nicht hinausgehen.“
Die Sätze, die ich eben noch im Hotel gelesen hatte, trieben noch immer durch mein Gedächtnis, als werfe das Meer selbst diese schimmernden Worte an Land, wo ich sie nur aufzusammeln brauchte… Jeder lauscht seiner eigenen See.
„Dorsch und Plattfisch“, sagte der Mann. „Noch bis um eins.“
Ich sah, dass er ein rundes, gerötetes Gesicht hatte und noch eine Kappe unter der Kapuze trug.
„Dann noch guten Fang“, sagte ich; ich wusste nicht, wie ich mich verabschieden sollte.
„Bei Gewitter soll man ja nicht hinausgehen“, sagte der Mann wieder und nickte.
Ich sah ihm nach, wie er langsam kleiner wurde, als er sich mit seinem Wägelchen auf der Seebrücke in Richtung Spitze entfernte. Er ging sehr langsam, als könne er nur mühsam laufen, vielleicht hinkte er auch, und bei jedem Blitz, der den Himmel erhellte, blieb er erneut stehen, als überlege er, ob er wirklich weitergehen solle. Tatsächlich schienen die Blitze jetzt wieder größere und kompliziertere Strukturen zu bilden… Das Meer verhüllt von Licht: verhüllt von Helligkeit…, während der darauf folgende Donner aus ganz anderer Richtung heranzurollen schien, was das Gefühl von Gefahr noch verstärkte. Noch immer hatte der Mann nicht die Spitze der Seebrücke erreicht, aber er kam mir schon jetzt unerreichbar vor und verloren.
Ich war dann wohl eine Weile mit den Hilbig-Sätzen in meinem Kopf beschäftigt… das elektrische Aroma einer ozeanischen Wolke / (unsichtbar für den nachtblinden Dichter)… und mit meinen Gedanken an das Haus (wie er langsam an seiner Zigarette zog und eine Hustenwelle ihn durchrollte; wie er an einem Likörglas mit Wasser nippte, das er seinen Cocktail nannte), denn als ich wieder die Seebrücke hinunterschaute, lag sie leer und verlassen vor mir. Der Angler musste die breitere Plattform an ihrem Ende erreicht haben (das war die naheliegende Begründung), wo ich ihn nicht mehr erkennen konnte (die Dunkelheit und zugleich die blendenden Laternen, die Regentropfen auf meiner Brille, vielleicht sogar die Wirkung der Haschzigarette, die sein Pfleger im Haus noch herumgereicht hatte, obwohl ich nichts davon zu spüren glaubte).
Eigentlich aber war mir (noch während ich durch den nun wieder stärkeren Regen zum Hotel zurücklief; späte Bademäntel, candlelight dinner show), als hätte ich hier an der Seebrücke von Wustrow, an der Gespensterküste der Stadt, ein vollendetes Bild vom Verschwinden des Dichters Wolfgang Hilbig gesehen. In meiner Vorstellung („in Wirklichkeit“) ist er jener anonyme Angler gewesen, der in dieser Nacht des 27, Mai 2007, Pfingstsonntag, ganz allein den langen schmalen Steg hinaus ins Meer gegangen ist… das Meer: das nicht mehr Tag noch Nacht ist sondern Zeit…, zögernd und zielstrebig zugleich, in eine von unregelmäßigen Blitzschlägen erhellte Schwärze hinein, die dennoch Schwärze blieb – ach wie ich träumen werde nach dem Abzug der Gewitter.
Sechs Tage später ist Wolfgang Hilbig in Berlin gestorben.
Jürgen Hosemann, aus Karen Lohse: Wolfgang Hilbig. Eine motivische Biografie, Plöttner Verlag, 2008
HILBIG IN EDENKOBEN
Der Wingert war bereitet
für das Schweigen, müde Hände
gruben um ihn, den die Schwärze aufsog.
Das Diamantblatt einer rostigen Schneide
schliff an den Ziegeln, Brocken.
Platzte es auf, hieß man ihn willkommen
trat er auf, wurde die Erde terrestrisch.
Meuselwitz – eine Erfindung. Arbeiter
mit zwei linken Händen. Sitzt in der Küche
hustet ein Oratorium. Leiht sich eine Zeile
von Lautreaumont. Spuckt Galle und Steine.
Hier, in der Pfalz, jedenfalls kennt ihn keiner.
Dunkle Häuserecken. Korn und bitterer Speichel.
Flaschenzüge hinauf; die Zukunft der Friedhöfe
von der er wusste, die Ehrengräber.
Ein Mann muss sich schlachten; Krieg
ist Krieg. Die Haut, ein Panzer. Lässt
nichts mehr ein.
Das blinde Gesöff, das ruhig stellt.
Er schwieg es aus. Über den Hügeln
Zitat, der Wald steht schwarz.
Tom Schulz
Elmar Schenkel: Dekadenz und Arbeit – Ein Abend für Wolfgang Hilbig, Charles Baudelaire und Arthur Rimbaud.
Pauline de Bok: Der Mann aus Meuselwitz. Prosa und Lyrik von Wolfgang Hilbig – Kommentar und Übersetzung
Leben habe ich nicht gelernt. Jürgen Holtz liest Texte von Wolfgang Hilbig aus Anlass des ersten Todestages von Wolfgang Hilbig. 5. Juni 2008. Eine Veranstaltung der Galerie auf Zeit – Thomas Günther – in Zusammenarbeit mit den Tilsiter Lichtspielen Berlin-Friedrichshain.
Versprengte Engel – Wolfgang Hilbig und Sarah Kirsch ein Briefwechsel
Lesung in der Quichotte-Buchhandlung in Tübingen am 8.12.2023 mit Wilhelm Bartsch und Nancy Hünger sowie Marit Heuß im Studio Gezett in Berlin.
Begrüßung: Wolfgang Zwierzynski, Buchhandlung Quichotte
Einleitung: Katrin Hanisch, Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft e.V.
Hilbigs Moderne. Auf die Suche nach den Quellen und Gesichtern von Hilbigs Moderne gehen: die Schriftsteller Peter Wawerzinek (Unangepasstheit als Lebensprogramm) Ingo Schulze (poetische Traditionen), Dieter Kalka (Moderator), Sebastian Kleinschmidt (Hilbigs Lesebiografie – seine Quellen der Moderne), Clemens Meyer (Nacht-Topos bei Hilbig)
Herr Hilbig, bitte Platz nehmen in der Weltliteratur! Mit der Schriftstellerin Katja Lange-Müller (Hilbigs singuläre Poetik), den Schriftstellern Clemens Meyer (Wirkungen in anderen Ländern, von den USA bis Italien), Ingo Schulze (poetischer Anspruch vs. Mainstream), Peter Wawerzinek (Chancen für poetische Eigenart heute), Alexandru Bulucz (Hilbigs Poetik – Fortsetzung bei den Jungen) und dem Verleger Michael Faber (Verlegerfahrungen mit einem Dichter), moderiert von Andreas Platthaus
Wolfgang Hilbig Dichterporträt. Michael Hametner stellt am 3.11.2021 in der Zentralbibliothek Dresden den Dichter vor. Mit dabei am Bandoneon Dieter Kalka.
Helmut Böttiger: Hilbig – die Eigenart eines Dichters. Geburtstagsrede auf einen Achtzigjährigen
Vitrinenausstellung und Archivsichtung „Der Geruch der Bücher – Einblicke in die Bibliothek des Dichters Wolfgang Hilbig“ am 3.6.2022 in der Akademie der Künste
Vortrag von Jürgen Hosemann zur Tagung Die Sprache eines Feuerfressers. Wolfgang Hilbig verorten, interpretieren, übersetzen an der Universität Turin am 9.11.2021
Vortrag von Clemens Meyer zur Tagung Die Sprache eines Feuerfressers. Wolfgang Hilbig verorten, interpretieren, übersetzen an der Universität Turin am 9.11.2021
Vortrag von Michael Opitz zur Tagung Die Sprache eines Feuerfressers. Wolfgang Hilbig verorten, interpretieren, übersetzen an der Universität Turin am 9.11.2021
Wolfgang Hilbig am 29.1.1988 im LCB
Wolfgang Hilbig am 26.11.1991 im LCB
Gesprächspartner: Karl Corino, Peter Geist, Thomas Böhme
Moderation: Hajo Steinert
Lesung Wolfgang Hilbig am 13.3.2006 im LCB
Gespräch und Lesung I – Thomas Geiger spricht mit Wolfgang Hilbig über seinen Werdegang, der Autor liest Gedichte aus dem Band abwesenheit.
Gespräch und Lesung III – Gespräch über die Auswirkungen von Hilbigs Stipendienaufenthalt in Westdeutschland 1985, anschließend liest er aus seinem Roman Ich.
Gespräch IV – Thomas Geiger fragt Wolfgang Hilbig, ob er sich von der Staatssicherheit bedrängt fühlte, anschließend führt Hilbig in die Lesung ein.
Gespräch V – Wolfgang Hilbig berichtet von seinen Bemühungen in der DDR an bestimmte Literatur zu gelangen.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Ralph Rainer Wuthenow: Anwesend!
Die Zeit, 30.8.2001
Helmut Böttiger: Des Zufalls schiere Ungestalt. Gespräch
Der Tagesspiegel, 31.8.2001
Welf Grombacher: Ein Jongleur der Elemente
Rheinische Post, 31.8.2001
Horst Haase: Weisheit eines Geplagten
Neues Deutschland, 31.8.2001
Richard Kämmerlings: Geschichte und Geruchssinn
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.8.2001
Zum 65. Geburtstag des Autors:
Gunnar Decker: Der grüne Fasan
Neues Deutschland, 31.8.2006
Christian Eger: Der Mann, der aus der Fremde kam
Mitteldeutsche Zeitung, 31.8.2006
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Jayne-Ann Igel: Das Dunkle oder Die Vordringlichkeit von Tatsachen
der Freitag, 31.8.2011
Ralph Grüneberger: Heute vor 70 Jahren wurde Wolfgang Hilbig geboren
Dresdner Neueste Nachrichten, 31.8.2011
Zum 1. Todestag des Autors:
Hans-Dieter Schütt: „Vom Grenzenlosen eingeschneit“.
Neues Deutschland, 2.6.2008
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Jörg Schieke: eisiger regen fressende kälte
MDR, 30.8.2016
Christian Eger: Schriftsteller Wolfgang Hilbig „In Deutschland gibt es keine Dichter mehr“
Mitteldeutsche Zeitung, 1.9.2016
Beulenspiegels literarische Irrf-Fahrt 4: Wolfgang Hilbig zum 75. Geburtstag
machdeinradio.de, 2.9.2016
Wilhelm Bartsch: Am Ereignishorizont von Wolfgang Hilbig
Ostragehege, Heft 87, 5.3.2018
Zum 1o. Todestag des Autors:
Clemens Meyer: „Diese Sprache schneidet mich regelrecht auf!“
MDR, 2.6.2017
Zum 11. Todestag des Autors:
Eine Wanderung zum 11. Todestag von Wolfgang Hilbig durch seine Geburtsstadt.
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Internationales Wolfgang-Hilbig-Jahr 2021/22
Eberhard Geisler: 80. Geburtstag von Wolfgang Hilbig – Paul Celans Bruder
Frankfurter Rundschau, 30.8.2021
Nils Beintker: Einer, der sich nicht duckte: Wolfgang Hilbig
Br24, 30.8.2021
Karsten Krampitz: Als einer den Wessis von der DDR erzählte
der Freitag, 31.8.2021
Wilhelm Bartsch: Warum die Dichtkunst von Wolfgang Hilbig wesentlich für das Werk von Wilhelm Bartsch war
mdr Kultur, 31.8.2021
Ralf Julke: Die Folgen einer Stauseelesung: Am 31. August wird die Gedenktafel für Wolfgang Hilbig enthüllt
Leipziger Zeitung, 29.8.2021
Cornelia Geißler: 80 Jahre Wolfgang Hilbig: Botschaften über die Zeiten hinweg
Berliner Zeitung, 31.8.2021
Cornelia Geißler: Hilbigs Flaschen im Keller und die Schrift an der Wand
Berliner Zeitung, 2.9.2021
Frank Wilhelm: Ein unbeugsamer Poet ließ sich nicht verbiegen in der DDR
Nordkurier, 1.9.2021
Constance Timm: Versprengte nacht – Wolfgang Hilbig zum 80. Geburtstag
MYTHO-Blog, 31.8.2021
Helmut Böttiger: Giftige Buchstaben, brütendes Moor
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.12.2021
Katrin und Volker Hanisch: Gespräch über Wolfgang Hilbig
Literaturland Thüringen auf Radio Lotte, 3.8.2021
Zum 15. Todestag des Autors:
Vor 15 Jahren starb Wolfgang Hilbig. Eine Kalenderblatterinnnerung von Thomas Hartmann
Wolfgang Hilbig. Die Lyrik. Anja Kampmann, Nico Bleutge und Alexandru Bulucz erforschen im Literarischen Colloquium Berlin am 4.10.2021 in Lesung und Gespräch den lyrische Kosmos des Autors.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Interview + KLG + IMDb +
YouTube + Internet Archive + Kalliope + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Wolfgang Hilbig: FAZ ✝ Die Welt ✝ Die Zeit 1 +2 ✝
titel-magazin ✝ Goon Magazin ✝ Spiegel ✝ Focus ✝ der Freitag ✝
Der Tagesspiegel ✝ NZZ ✝ ND ✝ BZ ✝ taz ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Claudia Rusch: How does it feel?
Neue Rundschau, Heft 2, 2008
Christian Eger: Im Abseits arbeiten
Mitteldeutsche Zeitung, 4.6.2007
Sebastian Fasthuber: Wolfgang Hilbig 1941–2007
Der Standard, 4.6.2007
Christoph Schröder: Wie sich das Ich auflöst
Frankfurter Rundschau, 4.6.2007
Uwe Wittstock: Wolfgang Hilbig-Wegweiser ins Unwegsame
uwe-wittstock.de
März, Ursula: Als sie noch jung waren, die WindeDie Zeit, 14.6.2007
Uwe Kolbe: Eingänge, Zugänge, Abgänge
Michael Buselmeier (Hrsg.): Erinnerungen an Wolfgang Hilbig, Der Wunderhorn Verlag, 2008
Günter Gaus im Gespräch mit dem Schriftsteller Wolfgang Hilbig. Aus der Reihe Zur Person, gesendet am 2. Februar 2003



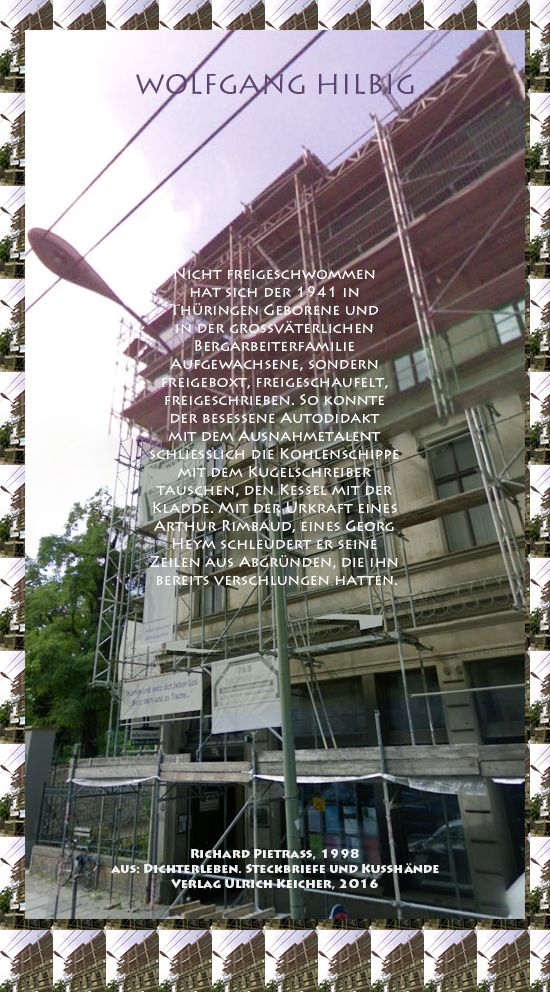












Schreibe einen Kommentar