DIE HIMMELSSCHEIBE VON NEBRA I
aaaaaaaaaaaaaaaaNach
nordnordwesten zu
da liegt ein brocken
mir im blick.
blickbrocken.
gesplittertes bild.
den sehen, sehen wir
vom erdwerk aus,
im horizont.
aaaaaaaaaaaaaaaaden sehen,
den fixieren sie
vom erdwerk aus: bei klarer luft
und festem datum.
aaaaaaaaaaaaaaaasind irgend feiern das,
mit ausgefeilter lichtregie −
ich weiß es nicht, und darf das auch
nicht wissen,
von denen wir
nichts wissen dürfen.
(erwerk schürfen).
und nur die palisade ahmt den zahnstand nach.
![]()
Inhalt
Das Durchröntgen der Sprache gehört seit jeher zum poetologischen Programm von Thomas Kling. So wie es in seinem Zyklus „Mahlbezirk“ im neuen Buch heißt: „mühlensprache sprach sie: flüssig / in zerkleinerungsform. / sprach wie im rausch.“ Der Dichter weiß von Spiegelzauber und vom Zauberspiegel Sprache, zugleich betreibt Thomas Kling in Auswertung der Flugdaten so intensiv wie noch nie seine „Vorzeitbelebung“ der Tradition im Ausgang von der dionysischen Herkunft unserer Poesie. In einer weit ausholenden Interpretation, ansetzend bei Euripides’ letztem Stück, den „Bakchen“, über Rudolf Borchardts Antikenannäherung und Stefan Georges „Binger Voodoo“, begegnen wir Thomas Kling bei der Lektüre von Gedichten eines Ezra Pound oder des späten Gottfried Benn. Aber beim „Andocken“ à la Thomas Kling – in der antiken, der hochmittelalterlichen, barocken oder der klassischen Literatur der Moderne – bleibt er doch immer ein Lyriker mit einem klaren Blick auf die Historie. „Sprach-Programm“ von Thomas Kling ist auch die Auseinandersetzung um das „Gemäldegedicht“, um das Verhältnis von künstlerischem Bild und dichterischer Schrift, so im Zyklus „Die anachoretische Landschaft“, der sich mit dem Isenheimer Altarbild von Grünewald beschäftigt.
Auswertung der Flugdaten, das bedeutet aufs Neue, die Chiffren der literarischen Überlieferungen für uns sichtbar zu machen. Im Umgang mit den Beständen unserer Archive zeigt sich erst die Stellung dieses Dichters in der Gegenwart, erweist sich seine Glaubwürdigkeit. Was ist Sprache anderes als „dies ständige, ständige, vollständige Fragment“?
DuMont, Ankündigung
Prophezeiungen aus hingestückter Stimme
− Aber die Sprache, dieses vollständige Fragment: Thomas Klings letzter Gedichtband Auswertung der Flugdaten, das Vermächtnis eines Wortschatzgräbers. −
Über welches Leben spricht man, wenn man über Poesie spricht? Welche Poesie schreibt man, wenn man über den Tod schreibt? Und welche Worte soll man schließlich finden, wenn man weiß, daß man stirbt? Will man wenigstens die Kontrolle über die Worte bewahren, wenn man schon die Kontrolle über sein Leben verliert? Und welche Worte findet man genau für diesen Zusammenhang? Auf was wird man sich noch verlassen können? Auf das unverkennbare eigene Idiom? Was könnte dieses Etwas sein, das man auf der Habenseite glaubt? „Frantic“ – rasend, wütend, außer sich sein. Und da muß sich die Poesie erproben, ob sie haltbar machen kann, ins Bild setzt, was schwindet.
Wenn nicht mehr viel Zeit ist, droht das Außer-sich-Sein überhandzunehmen. Ist auch die eigene Sprache vom Tod bedroht? Was ist die eigene Sprache? Ist sie nicht immer das, was andere übriglassen? Und so geht die eigene Poesie immer durch die Kläranlage anderer Stimmen, anderer Texte. Daß man noch einen Funken Poesie herausschlägt. Einen Prozeß fixieren, der unaufhaltsam ist. Ihn vom Ende her denken. Poesie als Diagnose, die Bilanz zieht. Und immer janusköpfig ist: die in den Archiven blättert und parallel dazu die laufenden Ereignisse filtert. Diese final gedachten Ereignisse stehen nicht für sich, sie werden rückgekoppelt mit analogen Sinnbildern.
Auch in seinem letzten Buch, Auswertung der Flugdaten, oszilliert Thomas Kling zwischen (Fremd-)Sprachen, Dialekten, Idiomen, zwischen Stimme und Schrift, neuem und altem Text (als Referenzgröße), neuer und alter Sprache (als Beglaubigung qua Tradition), um am Sprachrand etwas Nichtsprachliches zu fassen: den Tod. Was Gilles Deleuze in Kritik und Klinik über die stotternde Verfahrensweise Alfred Jarrys schreibt, kann auch von der Poesie Klings gesagt werden. „Von einem Element zum anderen, zwischen der alten Sprache und der gegenwärtigen, die von ihr affiziert wird, reißen Klüfte und Lücken auf, die allerdings mit unermeßlichen Visionen angefüllt sind.“ In diesem Sinne (er)schrieb (sich) Kling eine eigene Minderheitensprache, die sich Deleuze zufolge durch die Art definiert, wie sie die dominierende Sprache behandelt. Und diese spezifische Behandlungsweise einer sprechabrichtenden Normsprache macht die Größe der Poesie von Thomas Kling aus.
Wer ein solches zugleich beharrendes und vorantreibendes Verständnis von Poesie lebt, könnte leicht selbst zum „Oberbescheidwisser“ werden, als welchen Kling in der Flugdaten-Abteilung „Projekt ,Vorzeitbelebung‘“ Rudolf Borchardt, den „außergewöhnlichen Sprachmacher“ der „Bakchischen Epiphanien“, porträtiert. Nicht bloß ein Gedichtband ist also Auswertung der Flugdaten, sondern auch eine Art poetologische Botanisiertrommel, in der Fundstücke unterschiedlicher Quellen abgelegt werden – als das Eigene. Mit dieser seiner Botanisiertrommel erweist sich Thomas Kling selbst als „Spracharchäologe“, als „Wortschatzgräber“ mit ausgesprochener „Fundlust“ und als Abgrenzungsstratege – Adelungen, mit denen er in seinem Düsseldorfer Vortrag „Zum Gemäldegedicht“ seinen Bingener Kollegen Stefan George würdigte. Die Aufnahme dieses Textes in den Band ist allein schon durch seine schriftarchäologischen, wortkundlichen und poetikhistorischen Entdeckungs- und Korrekturqualitäten gerechtfertigt. Überhaupt bilden Poesie und Poetologie bei Thomas Kling immer eine programmatische Einheit.
Bei all diesem Rekursnehmen, Beharren und Aufklären – dieser Dichter trug keinen Bart. Und schon gar keinen „Lichtbart der Patriarchen“. Seine Poesie lallt nicht, sie stottert. Das Stottern ist eins ihrer ästhetischen Prinzipien, wie Deleuze es beschrieben hat. Sie verbietet sich das Lallen, sie ist hochpräzise: „Das präzise Wahrnehmungsinstrument Gedicht, das kleinste subkutane Bewegungen der Sprache sichtbar und hörbar zu machen versteht, dieses steinalte Präzisionswerkzeug“, schreibt Kling in „Zum Gemäldegedicht“. Ein Stottern (in) der Sprache selbst praktiziert er, um konventionalisierte grammatikalische und syntaktische Codes zu unterminieren, indem auf diese so allererst aufmerksam gemacht wird. Gerade weil auch Klings Poesie die „Mehrfachbelichtung“ vorzieht.
Poesie ist das eigentliche Reden
Die Gedichte in Auswertung der Flugdaten zeugen von ihrer Scharnierfunktion, das Janusköpfige der Poesie gleichzeitig zu denken, das Entgegengesetzte zu versöhnen. Thomas Kling gehörte zu den ganz wenigen, die eine kämpferische Versöhnung von Tradition, Moderne und Experiment geleistet haben, ohne voreilig gewesen zu sein, aber mit kompromißloser innerer Überzeugung und einer hellhörigen Scharfsinnigkeit. Scharfsinniger Stil zeichnete Kling wie kaum einen anderen Dichter der Gegenwart aus. So ist es nur folgerichtig, daß er in seine Minderheitensprache die Poesie (und Poetik) des Barock implantierte, den Gerhard Rühm mit der Herausgabe der Gedichtsammlung Die Pegnitz-Schäfer (1964) für den deutschen Sprachraum folgenreich wiederentdeckte. Verwunderung, Verblüffung erzeugen: der italienische Rhetoriker und Schriftsteller Emanuele Tesauro (1592 bis 1675), der erste wichtige Metaphern- und Figurentheoretiker, bezeichnete „argutezza“ als „geistreiches Enthymen“, eine Form des Syllogismus, die durch Verkürzung und Verdichtung frappierende Effekte erzielt. Die Scharfsinnigkeit hat die „Kraft des ingeniösen Arguments“.
Die Poesie von Thomas Kling ist ingeniöse Sprachausstellung. Sie zeigt, daß Poesie das eigentliche Reden ist. Daß man dem Tod wenigstens das abgerungen hat. Daß der Tod die Poesie auf den Punkt kommen läßt: „jetzt ist es“. Dabei ist die Rede von „selbsttätigen bildern“ (aus dem Zyklus „Mahlbezirk“) das genaue Kontrastmittel zur Bergbau-Metaphorik in „Gesang von der Bronchoskopie“. Diese Metaphorik dient ihm dazu, die krankheitsaffizierte Selbstwahrnehmung, Veränderungsprozesse der Innen- und Außenwelt sowie die poetisch protokollierende und ins Bild setzende Spracharbeit selbst zu sezieren. Die poetologische Anverwandlung von geologischem und Bergbau-Fachvokabular ist eine romantische Technik. 1798 fragte der Bergbauingenieur Novalis in einem Fragment: „Kann es auch einen schönen Bergbau geben?“ Mit seinem Heinrich von Ofterdingen gab er die – positive – Antwort, indem er die „große Chiffrenschrift“ (aus „Die Lehrlinge zu Sais“) der Natur beziehungsweise des Bergbaus philosophisch-ästhetisch einsetzte und eine naturkundliche Metaphorologie inszenierte, die er symboltheoretisch abstützte. Poesie manifestiert und entziffert die hierdurch evozierte Synthese von innen und außen, Natur und Mensch. Eine solche Synthese und Entzifferung leistet auch die Poesie Klings. Wahrnehmung, das macht sie deutlich, wird gesteuert von diesen überlagernden Bildern: Sehbildern, Sprachbildern. Und plötzlich hat man einen ganz alten Blick auf die Dinge, dessen Zeitgenossenschaft sich erst durch das Mitgesehene erweisen muß, das sich in der Sprache der Gedichte zeigt. „aber die sprache, / aber die sprache, / aber die sprache: // dies ständige, ständige, / vollständige fragment“, heißt es in dem Gedicht „Über das Bildfinden II“. Eine Poetik der Romantik in nuce?
Oft genug ist bei Thomas Kling das Vergessene, Abgedrängte, Unbekannte dominant, das sich durch die poetische Textur wieder seinen Weg an die Oberfläche bahnt. An dieser Oberfläche kann es der Leser abholen. Die Gefahr bei einer solchen die Tiefenstrukturen auslotenden Lektüre ist, die Zentralchiffre „Tod“ als Generalschlüssel der Dechiffrierung absolut zu setzen – auch rückwirkend:
währenddessen durchs ausguckfenster
schattenwanderung sich anbahnt
und draußen
das wasser sich eindunkelt bereits
Das ist Poesie: die Anverwandlung vorgefundener Metasprachen, die eigentümliche Umcodierung von in spezifischen Sprachkontexten definierten Denotationen. In „Vitriolwasser“ benutzt der behandelnde Arzt ein „gezähe“, das Werkzeug des Bergmannes zur Erzgewinnung, und füllt vorher den „muthzettel“ aus, ein bergbaurechtliches Formular mit der Anmeldung eines Fundes und dem Antrag auf Erteilung der Schürfrechte. Mit dem „gezähe“ „teuft“ der „eintäufer“ ein, gräbt einen Schacht, ist Teufel und Täufer zugleich. „,mein handwerkszeug kann mir brot und tod geben!‘ spricht“ dabei nicht nur „der doctor unser“. Das spricht auch der Dichter. Das Handwerkszeug der Poesie gräbt aus und nimmt Biopsien vor. Die lateinische Schreibweise und das Bergbauvokabular machen aus dem Arzt eine Gestalt zwischen religiöser Anrufungsinstanz und Scharlatan, Ergebenheit und Albtraum:
jetzt ist es. jetzt werd ich:
zum schacht, zum lungen-
schacht wird ich.
,schacht arnika‘: die
firstenzimmerung droht in
arnikabläue aufzugehn!
wohinein ins
unvermutete das
liecht sich verliert.
Mit „liecht“ (leicht, Licht) wird eine Schreibung aufgegriffen, wie man sie in der Lutherbibel (1545) findet. Das sind prompte Kurzschlüsse, „Vorzeitbelebungen“ morphologischer und etymologischer Art, die – auch Distanz schaffend – das Generalthema Tod ausweisen als das ganz Alte, als das Thema der Poesie schlechthin. Kurzschlüsse bis zur Deckungsgleichheit von Frage und Antwort:
wie soll man sich fühlen, wenn man am rande der grube steht? fragt
der poundbärtige von wien in den hörer, als poundbärtig er am rande der grube stand. nun! die grube bin ich. genau.
Der „poundbärtige von wien“? Wohl kein anderer als der im Dezember 2000 verstorbene Dichter Hans Carl Artmann, dem Kling stark verbunden war und dem er unter anderem im poetologischen Essayband Botenstoffe (2001) seine Reverenz erwies. Das Gedicht endet mit einer Hölderlin-An-Muthung. Hyperions „So kam ich unter die Deutschen. Ich forderte nicht viel und war gefaßt, noch weniger zu finden“ wird bei Kling zu „so kam ich – / kam ich unter. / so kam ich zum erliegen“ transformiert. Erliegen wiederum nimmt den Titel des Gedichts wieder auf. In einer unter anderem von E.T.A. Hoffmann bearbeiteten Sage wurde in einem Erzbergwerk im schwedischen Falun ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod ein Bergarbeiter gefunden, körperlich unversehrt in Vitriolwasser.
Das 21strophige Gedicht zu je fünf Zeilen „Neues vom Wespenbanner“ setzt Thomas Klings Lebensprojekt der poetisierten Stimmenverschriftung fort als kontaminierte Stimmenmaskerade samt eingehörtem Selbstporträt – ich bin, was ich höre:
so
steht er und schweigt wie er spricht, die gottes-drossel. verschriebene
druckstele. wie gedrosselt der hals und die kehle noch warm,
warum,
und der leer bleibende schlund – ein erstbesteiger wieder.
Mit der identitätsstiftenden Zusammensicht verschiedener Personen aus unterschiedlichen Zeiten und Kontexten nimmt das Gedicht eine Technik wieder auf, die Ezra Pound in seinen „Cantos“ anwendete. Und mit Pound beziehungsweise Homer steigt Kling auch in sein(en) „Wespenbanner“ ein, eröffnet das im Titel angekündigte „Neue“ also mit dem Alten: „The old men’s voices“. Die Stelle bei Pound im Wortlaut:
And
poor old Homer blind,
blind as a bat,
Ear, ear for the sea-surge;
Rattle of old men’s voices
(aus „Canto VII“.)
Die folgende Wendung „the old voice lifts itself“ entnimmt Kling einer Huldigung von Pound an Henry James aus demselben Canto.
Menschenstimmen, auf Ohrenhöhe erinnert
Es folgt ein anderer „Erstbesteiger“, einer, den es in sprichwörtlich luftige Höhen trieb: Josef Pichler alias das „Pseirer-Josele“, ein Paßeirer Gamsenjäger, der 1804 als erster Südtirols höchsten Gipfel bestieg, den Ortler. Allesamt „eintreffende menschenstimmen“, auf Ohrenhöhe erinnert, vor Augen gestellt. Auch Beckett fällt ein mit seinem letzten Band. Oder ist es bloß die sich selbst vernehmende Stimme? Zeitzeuge Sprachaufzeichnung, die Zeichnung kann abgekratzt werden, die eigene Stimme als blätternde Antike:
eintreffende menschenstimmen, als ein abkratzbares,
als scheppernde aufnahme. und zwar nahaufnahme: als band,
das sich klebrig in sich selbst auflöst, nachdem es dreißig jahre
nicht abgehört worden ist. räuspern, dann: „hier
spricht der wespenbanner!“, worauf das BASF-tape den
geist aufgibt
Abkratzen, auflösen, abhören; das Sterben, Kritik und Klinik, „jetzt ist es“. „mein bruder macht beim tonfilm die ge- / räusche doch hör ich näher hin: bin ich / das selbst, was aus der ferne dringt“ – der Bruder Tod zum Tonfilm Ich, ein Schlager.
Erinnert wird in diesem Gedicht auch an den syrischen Asketen und Einsiedler Symeon Stylites den Älteren (390 bis 459), den ersten Säulenheiligen der Kirchengeschichte. Im Alter von 32 Jahren setzte er sich auf eine drei, später zwanzig Meter hohe Säule, wo er den Rest seines Lebens mit Beten verbringen sollte. Er galt als heiliger „Friedensstifter der Wüste“ und hielt politisch einflußreiche Ansprachen an ratsuchende Pilger. Als „Simon del desierto“ begegnet er uns im gleichnamigen Film Buñuels und in Klings Gedicht, und als Säulensteher inszeniert sich der Dichter auf dem Cover seiner Flugdaten.
Auch in Klings eigene „Antikenverwaltung“ schreibt sich das bei ihm untergründig immer mitlaufende Geschwisterpaar Stimme und Schrift mitsamt seinen medialen Transformationen ein, etwa im Zyklus „Vergil. Aeneis – Triggerpunkte“. Selbstwahrgenommene Antike, autobiographisch:
Sibylle Hellespontica
Alter magnetbänder schweres mahlen.
prophezeiungen aus hingestückter stimme,
verzerrt. fast eine ältre frauenstimme kaum, bei un-
mißverständlichem inhalt −
band schleift; stimmband in auflösung begriffen.
der ihr pelzbesatz; das rote, theure cape.
von den schläfn wehend: tüllschleier – durch tüllschleier
sprache;
und der pokal steht feste über einem buch.
Thomas Kling war ein starker Dichter, wie ihn Harald Bloom in „Eine Topographie des Fehllesens“ beschrieben hat. Einfluß-Angst, daß Fremdlektüre die eigene Spur aufreißt oder gar vom Wege abkommen läßt, hatte Kling wohl nicht. Dafür war seine Poesie von Anfang an viel zu sehr auf das Überprüfen der Recycelfähigkeit von Fremdtexten quer durch die Jahrhunderte als „Botenstoffe“ und „Sprachspeicher“ und das Kontaminieren von Genus humile und Genus grande, von Slang, Rotwelsch, Gosse und Pathos, Schlager- und Märchenton angelegt. Was Paul Celan betrifft, so hat Kling auch dessen poetische Flugdaten ausgewertet, ihn aber nicht kopiert. Trotz aller „Vorzeitbelebung“ und Fremdtext-Abtastungen ist Thomas Kling mit seiner Poesie „ein erstbesteiger“ gewesen, den es nun gilt, nicht zum Säulenheiligen hochzustilisieren.
„Das ist es. Das ist das sehr alte Schreiben. Das ist sie: die alte Schrift“, heißt es im „Projekt ,Vorzeitbelebung‘“:
Die sehr alte Schrift – geschrieben unterm Machandelboom. An dem, schweigst du nun und schreibst du nun, vernehmbar die Juliwespe sägt.
„Von dem Machandelboom“, ein plattdeutsches Märchen, Baum der Erkenntnis. Selbstabschiede. Absondern als selbstrettende Tätigkeit der Poesie. Abgerungen. Das Stottern, das stolpernde Voranrücken der Wörter, „das / endet in einzelbildschaltung, // endet in keinem / aufwachraum“, heißt es im Zyklus „Die Himmelsscheibe von Nebra“ – metamorphotische Lesarten der 1999 gefundenen Metallplatte aus der Bronzezeit, die als die weltweit älteste konkrete Himmelsdarstellung gilt und deren Goldapplikationen vielfache Interpretationen erfahren haben.
Nachlese? Nach der Lese? Von den Gedichten Klings geht eine höchst produktive Beunruhigung aus. Eine sternenklare Nacht hat viel zu verbergen. Eine genaue Lektüre der Gedichte von Thomas Kling steht aus. Vorlese, Wort für Wort.
Michael Lentz, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.8.2005
Alles ins Fliessen gebracht
„Dichtung: Das kann eine Atemwende bedeuten.“ Auf diese poetologische Sentenz Paul Celans wird man zurückverwiesen, wenn man in diesen Tagen das Abenteuer der Lektüre von Thomas Klings Lyrik auf sich nimmt. Wer diese erschütternden neuen Gedichte Klings liest, der gerät auf eine Hadesfahrt ohne Aussicht auf Erlösung. Ihre poesie- und hoffnungsstiftende Atemwende haben sich diese Gedichte des Bandes Auswertung der Flugdaten in einem ganz existenziellen Sinne erkämpft: gegen das Verstummen – und gegen das drohende Ersticken.
Am Anfang dieses faszinierenden Buches steht der grosse „Gesang von der Bronchoskopie“, ein ergreifender, an Todesahnungen rührender Gedichtzyklus, in dem das lyrische Subjekt seine Lage „am rande der grube“ reflektiert. Es sind Gedichte von der kühlen medizinischen Erkundung und Durchleuchtung des Körpers, Gedichte eines schwer Versehrten, der den für seine Dichtung typischen kulturarchäologischen Blick auf sich selbst richtet. Der Leib des lyrischen Subjekts erscheint nicht als bloss physisches Objekt der medizinischen Visite, sondern als Geschichtsmaterie, der Eingriff in den Körper firmiert als geologisches Experiment. Der Atemraum des Ich wird dabei mit Metaphern des Bergbaus beschrieben. An gleich zwei Stellen dieses Zyklus wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem moribunden Ich und der romantischen Sage vom toten Bergarbeiter im schwedischen Falun. Diese u.a. von Johann Peter Hebel und E.T.A. Hoffmann aufgegriffene Geschichte erzählt von der wundersamen Unversehrtheit des toten Körpers im Erzbergwerk, wo er ein halbes Jahrhundert in „Vitriolwasser“ lagerte.
Spracharchäologie
Im „Gesang von der Bronchoskopie“ porträtiert sich das lyrische Ich nun als „stollenbahrer“, verbannt in den „lungenschacht“, wo das Subjekt „zum Erliegen kommt“. Es dominiert eine Sprache des Schmerzes, in der sich nüchternes medizinisches Fachvokabular mit kühner Metaphorik verbindet. Da ist in riskanter Verschmelzung disparater Bildsphären vom „bahreliegen / unter heimeligem stammheimdeckenmond“ die Rede, an anderer Stelle vom „atemtelegramm“ und vom „heiseren gebell“ des Moribunden. Und in den „lungenschacht“ hinein stossen die medizinischen Apparaturen – die in diesem Fall bergmännischen Werkzeugen, so etwa dem „gezähe“, gleichen:
,mein handwerkszeug kann mir brot und tod geben!‘, spricht der doctor,
der doctor, und nimmt sein gezähe zur hand. Füllt vorher den muthzettel aus.
und nimmt sein gezähe zur hand. der doctor teuft ein – unser allwissend, doctor
hall-weisend, doctor halb, doctor alpwissend, du, eintäufer rein, rein stocher
-stocher in meine gestochene, wie scharf gebeizte lunge.
wie soll man sich fühlen, wenn man am rande der grube steht?
Die für seine jüngeren Gedichte so charakteristische geologische Perspektive forciert Kling auch in der somatischen Selbsterkundung. Das Graben in alten Wortschichten, das archäologische Schürfen und Buddeln in den „Mergelgruben“ der europäischen Kulturgeschichte, wird zum dominanten Zeichen seiner Körper-Poesie. In seinem Gedichtband Sondagen von 2002 hatte Kling in alten Zauberliedern und Hexensprüchen nach den magischen Anfängen der Dichtung geforscht. Die kunstvolle Vermischung alter und neuer Bildsphären, die gezielte Konfrontation von frühgeschichtlichem und modernem, medientechnologischem Material brachte Gedichte von hypnotischer Suggestivität hervor.
Auch im neuen Band Auswertung der Flugdaten gelingen Kling Bildfügungen von intensiver Leuchtkraft. Wie in den Sondagen verläuft die chronologische Struktur dieser Gedichte rückwärts: Von der körperlichen Ausgesetztheit des Ich in der Gegenwart führt der Weg im Wechsel von Gedicht und Essay ins Mittelalter, dann in die kulturelle Frühgeschichte und schliesslich in den mythischen Urgrund des Menschengeschlechts. Emphatische „Vorzeitbelebung“ betreibt Kling dabei in der sympathetischen Anrufung von Rudolf Borchardt und Stefan George, zwei Portalfiguren bei der erhabenen Wiedergewinnung der antiken Mythologie.
Virtuose Kombinatorik
Hatte Thomas Kling seine geistige Herkunft bisher immer aus den sprachreflexiven Traditionen der Wiener Avantgarde abgeleitet – unter Einschluss dissidenter Barock-Autoren wie Georg Philipp Harsdörffer und Athanasius Kirchner -, so situiert er sich nun in der Nähe der entschieden antimodernistischen Grenzgänger Borchardt und George. So staunt man nicht wenig, wenn diese Geistesaristokraten, an mehreren Stellen als „Oberbescheidwisser“ verspottet, zu den artifiziellsten Handhabern des „steinalten Präzisionswerkzeugs“ Gedicht erhoben werden. Danach erkundet der Blick des lyrischen Historikers Kling die „anachoretische Landschaft“ des Isenheimer Altars von Matthias Grünewald, schweift ab zu einem der frühesten Kulturzeugnisse der Menschheitsgeschichte, der Himmelsscheibe von Nebra – und landet bei den sibyllinischen Orakeln.
Bei einem grossen Dichter wie Thomas Kling bleibt die „Vorzeitbelebung“ nicht im Modus raunender Andeutung stecken. An Exempeln aus unterschiedlichsten Epochen – von Hildegard von Bingen über das finnische Kalevala-Epos bis hin zu Stefan George – wird über die Wahrnehmungstechnik von Gedichten und über den Vorrang visueller oder akustischer Momente nachgedacht. „Es geht darum“, so der Autor kürzlich in einem Interview, „dass die alten Wortschichten untereinander zum Glimmen gebracht werden.“ In seinen neuen Gedichten und Essays ist es Thomas Kling gelungen, alte Stoffe der Vorzeit und neueste Fundstücke aus der Medienwelt dank einer virtuosen Sprachkombinatorik in grosse Reibungshitze zu versetzen:
rotglut der bilder. aufschmelzungen.
und alles – alles
ins fliessen gebracht:
in meiner bildschmiede,
schildschmiede.
Seit sonnenaufgang bin ich – Vulcan.
Michael Braun, Neue Zürcher Zeitung, 2.3.2005
Wo Doktor Alpwissend keinen Zutritt hat
− Auswertung der Flugdaten, der letzte Band mit Gedichten und Essays des im April viel zu früh verstorbenen Dichters Thomas Kling. −
Der von Thomas Kling vor seinem Tod noch fertiggestellte Band Auswertung der Flugdaten wird eröffnet mit dem „Gesang von der Bronchoskopie“, einem Zyklus von sieben Gedichten, die Einblick gewähren in die Erkrankung des Dichters. Thomas Kling hatte sich entschieden, mit der Diagnose – Lungenkrebs – offen umzugehen. Offen heißt: mit seiner ihm eigenen Sprache auf die aussichtslose Situation zu reagieren. Die Krankheit als Material betrachtend, konnte Thomas Kling weitermachen, mit „heiserer Stimme“, wie es im Motto von Ludwig Bechstein über „Gevatter Tod“ sicherlich nicht zufällig heißt. Denn Klings Stimme, die einmal so wirkmächtig war, so virtuos modulierend und fordernd, diese Stimme, das Instrument seiner legendären Performances, war ihm abhanden gekommen.
Für einen Dichter, der sich immer schon für die Apparate und deren semantische Verschaltungen faszinierte, werden die medizinischen Geräte zur Herausforderung eines poetischen Projekts, das Verzweiflung und Panik bannen will: „wenn diagnose steht ersma’ – frantic.“ Kling taucht ab in den „lungenschacht“. Im Krankenhaus „zu Neuss am Rhein“ erkennt er nicht nur den Hochmut der Ärzte – „unser / allwissend doktor“, „doktor alpwissend“ −, sondern auch die Schichten der Poesie, mit denen er sich wappnet, das ist klar: Zu dieser Sphäre hat Dr. med. Alpwissend nämlich keinen Zutritt; im Unterschied zu den Schwestern, denen Kling einen klösterlich-milden Touch verleiht, wenn es etwa heißt:
alle viertelstunden kommt
eine knappin vorbei, schiebt eine lore,
ausm OP übern flur, auf denen gebraucht,
im hellen schleim, gebrauchsschleim
liegt schlauchiges gezäh im schlamm,
liegt obenhin in linnen dürftig eingeschlagen:
dass Du’s, mein kind, auf diesem flur
gut
sehen kannst.
für die unsaubere seite.
Du, mein Kind: Das dürfte die Stimme der Mutter sein. Angesichts des „Diagnosezeugs“, wie Kling die schleimigen Abfälle aus dem Operationssaal nennt, scheint der Dichter sich selbst mit der Stimme seiner Mutter beschwichtigen zu wollen, oder besser: trösten, beruhigen zu wollen. Eines der Gedichte des vorliegenden Bandes ist Heidi Kling (1927-2005) gewidmet, seiner Anfang dieses Jahres, wenige Monate vor ihm selbst, verstorbenen Mutter. Mit ihr, einer Deutschlehrerin, habe Kling eine enge, auch eine enge literarische Beziehung verbunden, ist aus dem Umfeld des Dichters zu hören. Besonders Paul Celan habe zwischen Mutter und Sohn eine wichtige Rolle gespielt.
Einmal aufmerksam gemacht, sind in der Tat erhebliche Anleihen der Celan’schen Poetik bei Kling zu entdecken: „da, körnig: / am hang das speismohn-gärtchen. / wo höhen luft mich kirret, dich gleich mit.“ Celans Mohn und Gedächtnis läuft quasi als Hintergrundmusik. Auch lassen sich die enigmatischen Anfangsverse von Klings Gedicht „Arnikabläue“ (aus dem Zyklus „Gesang von der Bronchoskopie“) in Hinblick auf ein Celan-Motiv entschlüsseln: „so fran- / st grafit das hochgebirge aus mir: / den kopf, die abzählbaren kuppen.“ Das Hochgebirge in mir? Könnte das nicht wiederum das Gebirge des Wanderers Lenz sein? Lenz im Gebirg’, Celan im Kopf: Die Verbindung wäre dann als Allegorie der Sprachfindung bedroht, nämlich „gefranst“ durch „frantic“, durch Panik. Fransen, ausfransen; Wortspiele, Wortzerteilungen, prosodisch (neu)geordnet: auch das ein Erbe des Granit- und Grafitarbeiters Celan, ein Erbe, das Kling mit dem der Wiener Schule – Mayröcker, Jandl – mühelos zu vermengen weiß.
Das seiner Mutter gewidmete Gedicht heißt „Bärengesang“: eine melancholische Sprachlehre in drei Strophen, eine Kinderethymologie, versetzt mit Märchen-, Bibel- und Traummotiven. Auch wenn der Band Auswertung der Flugdaten die beiden Gedichte auseinanderreißt, dazwischen liegen mehr als hundert Seiten, so korrespondieren doch der „Bärengesang“ der Mutter mit dem „Gesang von der Bronchoskopie“ des Sohnes in ergreifender Weise. Eindeutig geht aus dem „Bärengesang“ hervor, dass die Mutter die Sprachlehrerin, ja eigentlich die Sprachkünstlerin war:
Ich kannte alle worte
für kralle, magen, mund und kopf.
für bärenkralle, bärenmagen,
bärenzungenspitze,
für meinen bärenkopf.
die kenn ich nun nicht mehr.
die brauch ich nun nicht mehr.
Nicht den kleinen, den „Großen Tod des Bären=ich“ starb seine Mutter. Ingeborg Bachmanns „Anrufung des Großen Bären“ klingt an, das berühmte Gedicht jener Dichterin, die wiederum mit Celan eine innige Beziehung unterhielt.
Ein Nachlass zu Lebzeiten
Im Ganzen betrachtet, ist Auswertung der Flugdaten weit davon entfernt, ein homogenes Buch zu sein, zu unterschiedlich sind die Themen und Textsorten. Man liest es vielmehr als Nachlass zu Lebzeiten: Gedichte und Gedicht-Zyklen aus Klings letzter Schaffensperiode sind untergebracht, aber auch zwei längere Prosatexte, darunter ein Düsseldorfer Vortrag „Zum Gemäldegedicht“ – Kling hat etliche Gemälde emblematisch be- und verdichtet. Besonders jedoch ragt der Essay „Projekt ,Vorzeitbelebung‘“ heraus.
Dieser vierzigseitige Text umkreist in kurzen bis kürzesten, mehr oder weniger wilden Abschnitten ein von Rudolf Borchardt vorgegebenes Thema, nämlich dessen Versuch, Euripides’ Bakchen sich für die eigene Gegenwart anzueignen. Euripides’ letztes Stück handelt von der ekstatischen Feier städtischer Frauen jeden Alters, die sich zur Feier des Gottes Dionysos in einem Wald zusammengefunden haben und heimlich von einem Hirten belauscht werden. Borchardts Bacchische Epiphanie entstand zwischen 1901 und 1912; Kling bezeichnet sie als „Re-Konstruktion einer solchen Göttererscheinung“ respektive als „Vorzeitbelebung“. Dieser Terminus Borchardts hat es Kling angetan, bei aller Distanz zu dessen „Oberbescheidwisser-Attitüde“. Gemeint ist mit Vorzeitbelebung das „Andocken“ (Kling) an antike und hochmittelalterliche Literaturen. Abgesehen vom Sujet der Ekstase, das dem Mentalitätsforscher und Zutiefst-Rheinländer Kling natürlicherweise am Herzen liegt, betrifft die Übersetzung – einer Epoche in eine andere – auch seine eigene Arbeitsweise im Kern.
Einen hohen Anspruch hatte Thomas Kling, und konnte doch den hohen Ton nicht leiden. Ein formales Problem ist die Folge, das er durch schroffe Abrenzung und pathetische Bekenntnisse in den Griff zu bekommen versuchte. Seine Feinde unter den Dichtern heißen Rilke (vor dessen „Kitsch-Attacken“ man nie sicher sei), Valéry („gravitätischer Weihrauchschwenker“) und Grünbein („Sandalenfilme aus den Grünbein-Studios“). Die Feindschaft zu seinem Zeitgenossen – und Konkurrenten – verblüfft, denn so verschieden sind Grünbeins und Klings dichterische Vorhaben keineswegs, nämlich die gesamte Literaturgeschichte, etliche Epochen und Sprachen zu durchdringen. Beide sind wildentschlossen, der abendländischen Bildung und ihren akademischen Repräsentanten die Stirn zu bieten. Und holen sich bezeichnenderweise vor allem in ihren Prosaarbeiten einige Beulen; dort also, wo Darstellung und Argumentation der Poesie leichter in die Quere kommen als im Gedicht.
So kommt es, dass Klings Text über Borchardts „Antikenverwaltung“ teilweise genial glückt – wenn er seine Einsichten in die unnachahmliche Schnodderigkeit kleidet; teils bleiben die Ausführungen etwas belehrend. Der Ton ist nicht einheitlich. Dennoch bleibt die Annäherung spannend, auch deshalb, weil sie sich an der Feindschaft zwischen Stefan George und Rudolf Borchardt weidet. Das gibt der Sache Pfeffer. Und die Sympathien sind klar verteilt. Mit George, dem er bereits einen seiner besten Essays widmete („Leuchtkasten Bingen“ aus dem Band Botenstoffe), verbindet Kling neben dessen Dichtung, an der er sich schulte, auch Biographisches. Beide stammen aus Bingen im Rheingau. 1957 ebendort geboren, aufgewachsen in Düsseldorf, blieb Kling seinem und dem Geburtsort Stefan Georges (und der Wirkungsstätte der Hildegard von Bingen, für die in diesem Band ebenfalls ein Text reserviert ist) verbunden.
Sein upgedateter Stefan George ist ein Gastwirtssohn, der gern trinkt und den rheinhessischen Slang spricht. Dessen „Bodenständigkeit“ sei seine „Geheimwaffe“ gewesen: „So konnte Rudolf Borchardt einem George gegenüber unmöglich punkten“, freut sich Kling. Borchardt sei dagegen hasserfüllt gewesen, schwulenfeindlich – siehe dessen späte Aufzeichnung Stefan George betreffend – und von karrierehinderlichen, gestelzten Umgangsformen. Also lautet Klings Resultat: Überlegenheit Georges in weltlichen Dingen – aber nicht unbedingt Unterlegenheit Borchardts in poetischen Dingen: „Borchardt ist gerade in seinen Bakchen ein Sprachmacher – ein außergewöhnlicher Sprachmacher.“
Hervorgehoben sei noch Klings subtiles Gemäldegedicht zu Matthias Grünewalds Isenheimer Altar, das sich in diesen intellektuell-papstfrömmelnd-restaurativen Zeiten wie ein vorweggenommener Widerspruch liest, und nicht nur ein ästhetischer Widerspruch. Papst Benedikt XVI. interpretierte Grünewalds Kreuzigungsbild von 1516 als „Realismus des Leidens bis zum Äußersten radikalisiert“, als Einladung zur „inneren Meditation von Christi Weg“. Bei Kling heißt es über dasselbe Bild:
Dein antlitz: mein dreckig
Schweißverschmiertes, wenn ich
Es denn verstecken muß? Das meine.
Die Theorie zu seiner christlichen Leidenspoetik liefert Kling in einem kurzen Text, „Jagdzauber“, den man in diesem reichhaltigen Band nicht übersehen sollte:
Ja, das Gedicht braucht, wie das Gemälde, den „schmutzigen Daumen“ (…). Und unter seinem Nagel darf und muss ein Blutrest sein. Denn: daß das Gedicht sehr wohl, auf diese letztlich dokumentierende Art, die Funktion des (selbstverständlich didaktikfreien) Blutzeugen erfüllen kann, steht für mich außer Frage.
Selbstverständlich didaktikfrei? So selbstverständlich ist das nicht. Umso mehr sind wir Thomas Kling, der am 1. April mit 47 Jahren gestorben ist (s. FR vom 4. April), zu Dank verpflichtet.
Überwältigend aber ist vor allem jener entwaffnende Humor, den der Dichter nicht einmal verlor, als er „op bahre“ gestemmt wurde, „als heckenpennes im krankehus“. Dies Dialekt-Gedicht aus dem „Gesang von der Bronchoskopie“ heißt ebenso passend wie todtraurig: „Ach je“.
Ina Hartwig, Frankfurter Rundschau, 11.5.2005
Ein Buch als Vermächtnis
− Thomas Kling gilt als einer der bedeutendsten Lyriker der Gegenwart. Er ist vor wenigen Tagen im Alter von 47 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Sein letztes Buch, Auswertung der Flugdaten, ist deswegen zu einem Vermächtnis geworden. −
An dem ersten Gedichtzyklus, „Gesang von der Bronchoskopie“, arbeitete er bis kurz vor seinem Tod: es geht darin um den Krankenhausaufenthalt, um die Untersuchungsmethoden, um den Körper und den wissenschaftlichen Zugriff darauf. Es sind scharf sezierende Texte, ohne vordergründige Gefühligkeit, kalt, rhythmisch, mit grellen Bild- und Toneffekten.
Auswertung der Flugdaten ist aber nicht einfach nur ein Gedichtband. Kling hat in letzter Zeit immer häufiger Programmatisches geschrieben, Essayistisches. In diesem Buch gibt es mehrere „Projekt“ genannte Stücke, die Motive durcharbeiten – das geht in kürzeren und auch längeren Prosaschüben vor sich, mit analytischen und poetischen Passagen, und auch vor Polemik scheut Kling nicht zurück.
Einmal benennt er direkt seinen größten Konkurrenten um den zeitgenössischen Lyrik-Thron, Durs Grünbein, und der Ton ist nicht einfach nur ironisch – er ist ausgesprochen hämisch:
Wenn den Antikefreund das Fell juckt, er aber kein Gefühl für Geschichte hat? Dann bekommt man Kostümfilm – Sandalenfilme aus den Grünbein-Studios.
Kling und Grünbein sind die gegenwärtigen Lyrik-Antipoden. Sie stehen in unterschiedlichen Traditionslinien. Während Grünbein die Bildmetaphorik der Moderne fortsetzt, ist für Kling das Grundmaterial die Sprache selbst. Er schließt an die Lautpoeten an, an die Performancetraditionen der Moderne. Das Klangliche spielt in seinen Texten die ausschlaggebende Rolle.
Kling trat in den achtziger Jahren im Gefolge von Punk und Performances der Bildenden Kunst auf und erregte Aufsehen durch seine Art des Gedichtvortrags: „Rampensau“ ist für ihn ein hoch positiv besetztes Wort. Er war schulbildend: Viele Lyriker aus der Pop- und Slamszene beziehen sich ausdrücklich auf ihn. Musik ist für ihn genauso wichtig wie die Schrift, gerade in der Lyrik.
Das Vermögen, bewundernde Jünger um sich zu scharen, ist nicht die einzige Gemeinsamkeit zwischen Kling und Stefan George. Beide sind in Bingen am Rhein geboren, Kling verehrt den Meister des „Bingener Voodoo“, und charakteristisch ist, in welchen Worten er das tut: George sei „extrem timingsicher“, es sei ihm ständig darum gegangen, „sein image zu wahren“, es ging ihm immer um die „überwachung des nächsten publicity-shots“ und die „verbannung unbotmäßiger aus seinem staff“.
Kling aktualisiert George mit den Worten unbedingter Zeitgenossenschaft, und das wirkt manchmal richtiggehend überreizt, hyperzeitgenössisch.
Das Rhetorische ist für Kling ein wichtiger Maßstab, und sein „Andocken an die Geschichte“, wie er es nennt, rekurriert deswegen vor allem aufs Mittelhochdeutsche, aufs Barock, auf Expressionismus und Dadaismus.
Die Flugdaten stehen für ihn gleichzeitig für einen Rausch, das Technische ist gleichzeitig das Dionysische, es geht um rasantes Augenblicksbewusstsein. In diesem Zeichen steht auch seine „Vorzeitbelebung“, sein Andocken an die Antike, oder seine Beschäftigung mit dem Isenheimer Altar von Matthias Grünewald.
Helmut Böttiger, Deutschlandradio Kultur, 10.5.2005
Eingefrorenes Wehleid
− Große Literatur: Thomas Klings Gedichte leuchten aus der Ferne und funkeln in technischer Bläue. −
Du sollst dir kein Bild machen! Hüte dich vor Identifikation! Keine Einfühlung! Benutze deinen Verstand auch dann noch, wenn dich die Lust kitzelt, wenn dich der Schmerz packt! Thomas Kling hat sich immer gewehrt gegen Verstehens- und Verständigungskulte. Fremd und hell und plötzlich brach er über seine Hörer herein; ebenso seine Gedichte über den Leser. So mitreißend-heftig er liest, so wenig lässt er sein Publikum an sich heran. Ein Profi der Inszenierung, nicht der Selbstdarstellung. Ihn einzuladen für einen kultivierten Poesieabend mit unterhaltsamem Auftrittsevent kam manchen Impresario teuer zu stehen. Er wusste nachher nicht mehr, wo ihm der Kopf stand.
Auf dem Cover des jüngsten Buches ist Thomas Kling erstmals leibhaftig zu sehen. Seltsam genug. Ein sympathischer Mittvierziger steht auf einer fast mannshohen Säule vor altem Gemäuer und hält sich am Efeu fest. Vielleicht ist es auch eine Klematisranke. Wieso steht er da oben und sieht ein wenig ängstlich auf uns herunter? Oder ist eine Sprungbereitschaft darin? Eine Frage an uns? Oder verkündet er gleich etwas? Zum Beispiel etwas von den Sockeln, auf denen wir alle stehen? Sockeln aus Sprache, Landschaft, Geschichte und Bildern, die wir in uns tragen und die uns tragen?
Alles ist fern und fremd und kalt und geht unter die Haut
Die Flugdaten beginnen niederschmetternd und großartig. Statt auf Säulen zu künden, liegt im ersten großen Zyklus des Bandes, dem „Gesang von der Bronchoskopie“, ein Beobachter flach und voll verkabelt im High-Tech-Center einer Klinik, und statt bunter Weltdaten auf Unterhaltungsbildschirmen fließen Herzrhythmus- und Atemfrequenzdaten über Monitore, fließen Nährlösungen und gut gemischte Gifte durch Schläuche.
Nun konkurrieren in Kling-Gedichten in der Regel die Erfahrungsdaten mit den Aufzeichnungstechniken, die sie vermitteln. Nichts ist unvermittelt da, alles geht durch die historisch geschichtete Zeit und die elaborierte Darstellungs- und Ausdrucksform hindurch. Etymologie, Geologie, Archäologie liefern die Basisverfahren der lyrischen Erkundungen; die neuen Medientechniken werden vorausgesetzt, nicht modernistisch vorgeschoben. Und so ist es auch bei der indirekten Beobachtung eines Eingriffs in die Atemorgane, deren „Gegenstand“ der Betrachter selbst ist. Was dabei nicht gesagt wird, sind der Schmerz und die Angst, die überschwemmenden Kräfte, die jede differenzierte Wahrnehmung verhindern. Die strengen Exerzitien des Gedichts dienen im Gegenteil der Abkühlung dieses bohrenden Kerns, der kunstvollen Verspiegelung eines Leidens, das bei direktem Zugriff den Betrachter zerreißen würde. So liegt einer auf der Trage im Krankenhausflur, „unterm heimeligen stammheimdeckenmond“. Alles ist fremd und fern und kalt und geht doch viel weiter als unter die Haut, in den Lungenschacht nämlich.
In Kling-Gedichten ist nicht viel von ICH die Rede, geschweige groß geschrieben wie manchmal die ersten Buchstaben GOttes. Doch dann haben wir eins, in der vierzehnten von sechzehn Strophen des langen ersten Gedichts, der Arnikabläue: „Jetzt ist es. jetzt werd ich: / zum schacht, zum lungen- / schacht wird ich.“ Man kann den ersten Satz mit einem „so weit“ ergänzen. Dann wäre es so weit. Doch vor allem steht hier ein sächliches Personalpronomen im Zentrum. Das ist entscheidend. Denn in der nächsten Zeile wird die Grammatik gekrümmt, um das Schluss-ich sachlich-anonym werden zu lassen. Ich geschieht sozusagen, und zwar so: „Lungenschacht wird ich“.
Die sprachliche Nachbildung einer vom Verstehen ungeglätteten, also immer psychisch und technisch verzerrten Wahrnehmung macht die Kling-Gedichte so intensiv. Dass man nicht „in sie hineinkommt“, wie es manche Leser gerne hätten, ist ihr Gesetz; sie tauschen dauernd das Innere mit dem Außen, um eben diese Penetration des Verstehens zu verhindern. Hier im Falle einer schmerzhaften Lungenpenetration. Sie vermeiden die direkte Gefühlsbekundung. Doch ist sie spürbar in dem, was nicht konventionell subjektiv hingelitten und -gesagt wird. Manchmal ist es aber auch umgekehrt: Die Empfindung sagt sich in schlagwortartiger Überdirektheit und Lakonie: „frantic“ heißt es wiederholt am Strophenende – frantic. Auch dieser coole Anglizismus ist ein wirkungsstarker Kälteschutz.
Der neue Kling-Band beginnt also mit einer fulminanten Reihe von K-Gedichten. K wie Krankenhaus und Krieg, der in ihm herrscht; wie Körper und Konkretion, die ihn zum Datum macht, wie Kälte und Kunst, die jedes Wehleid einfrieren in Wort und Bild. Deshalb tun sie weh, diese Aufzeichnungen eines Apparat und System gewordenen Schmerzes.
Bald darauf, nach einem weiteren Gedichtzyklus „mahlbezirk“, versehen mit Schwarzweißnahaufnahmen von Ute Langanky, die eine alte Mühle zeigen, öffnet sich die Auswertung der Flugdaten auf eigentümliche Weise, nämlich die literarischen Gattungen betreffend. Es folgt ein langer Essay Projekt „Vorzeitbelebung“, und weitere Prosatexte wechseln mit Gedichten ab. Eine Seltenheit, eine Seltsamkeit. Wir kennen zwar Gedichtbände, die von einem Essay begleitet werden, meist zur Erläuterung des ansonsten lyrisch Verrätselten; oder umgekehrt Essaybände, die auch einmal ein Gedicht enthalten. Doch hier haben wir es mit dem raren Fall zu tun, dass beide Gattungen vom Gewicht her gleichrangig nebeneinander stehen, sich thematisch und motivlich aber heftig durchdringen.
Es ist kein kleines Risiko, das Kling hier eingeht. Als Dichter mit ganz eigenem, oft beschriebenem und nachgerade stil-(nicht schul-)bildend gewordenem Idiom hat er einiges zu verlieren, wenn er auf essayistischem Weg versucht, ganze Traditionslinien und Motivketten der abendländischen Literatur auszuziehen: In den unter Extremdruck zusammengestauchten Wissens- und Bildungsschichten könnte die Kling-typische blitzartige Erhellung eines Zusammenhangs verschwinden, die seine gewagten „Einzelbildschaltungen“ in den Gedichten bewirken. Was wird also aus dem wespenhaft aggressiven, Schönheit wie Gift transportierenden Bedeutungsrauschen, das sich plötzlich entlädt in einer schmerzlich-beglückenden Erkenntnis, wenn historisch angeschafft und verglichen, abgeleitet und umgedeutet wird? Was wird aus den spontanen Einfällen, wenn Autoritäten zitiert und mit den großen Meistern des Fachs von Euripides bis Borchardt, von Nietzsche bis Kerenyi, von Gongora bis George von Du zu Du diskutiert wird? Kann so viel Stepptanz auf den Schultern von Riesen gut gehen in einem literarischen Klima dieser Republik, in dem zumal die Lyriker gerne auf die ältesten sumerischen Göttinnensprüche zurückgreifen oder aufs urbane Dichter-Lotterleben im späten Rom und sich wechselseitig wegen ihrer Griechisch- und Lateinkenntnisse beargwöhnen? Besonders die Elite der mittleren Generation von Raoul Schrott bis Durs Grünbein, dem eine treffende Sottise des begnadeten Polemikers Kling gilt: „Wenn den Antikenfreund das Fell juckt, er aber kein Gefühl für Geschichte hat? Dann bekommt man Kostümfilm – Sandalenfilme aus den Grünbein-Studios.“
„Unwandelbares in ungewandelten Formen“
Kann also so viel schwerer Stoff, mit klugem Witz gemischt, uns angehen? Er kann, und das hat angebbare Gründe. Sie liegen in der hintergründigen Komposition des Bandes. Kling geht einem speziellen, wenn auch grundlegenden abendländischen Motivkomplex nach: dem der wilden, zerreißenden Frauen, die in frühen Mythen und in der antiken Dichtung die undomestizierte Wildnis verkörpern oder die Rache an ihrer Beobachtung und Ausbeutung – die Mänaden, die Bakchen, die rasenden Begleiterinnen des Dionysos und später die Nachfolgerinnen und Verwandten, von den Gorgonen über die Ovidsche Diana bis hin zu germanischen Schamaninnen. Kling ist ganz offenkundig einer paradoxen Doppelfaszination erlegen. Denn ausgerechnet den formstrengen Kulturmonumentalisten Rudolf Borchardt nimmt sich Kling zum Führer in die tobende Unterwelt des Weiblichen. Ausgerechnet mit jenem in den letzten Jahren wieder entdeckten Dichtungsheroen, der „Unwandelbares in ungewandelten Formen“ sucht, geht Kling die wilde Meute aus Begierde und Überwältigung, Rausch und Raserei an, die geordnete Dichterworte tödlich bedroht.
Als Muster ist es deutlich genug: Wie im Gedichtzyklus von der „Bronchoskopie“ jene Sphäre des Schmerzes und der Angst nur in kunstvoller Verspiegelung zugänglich ist, so ist auch die schlangenbewehrte Drohung der Medusa nur in der schlauen technischen Intervention zugänglich. Perseus blickt auf Geheiß der Athene in den eigenen, spiegelglänzenden Schild, um die Macht der Medusa zu brechen. Er bannt den Schrecken in ein optisches System. In diesem Sinne sind die Essays des Bandes immer auch Annäherungen an das grundsätzliche Umweg-Verfahren der Kunst selbst – und an Klings eigene Gedichtpraxis aus faszinierter Hingabe und distanzierender Strenge.
Man muss tief Luft holen, um zuzugeben, dass man von Klings Texten ergriffen ist. Weil sie in technischer Bläue kalt funkeln, weil sie aus großer Ferne leuchten und jede Form der Intimität, des Gemeinmachens, des billigen Verstehens streng verhindern. Doch Kling macht es einem nicht mutwillig schwer, er erinnert lediglich daran, dass wir den anderen nicht kennen lernen, indem wir seine Augen sehen, sondern seinen Blick auf die Welt. Und wenn es ein Kamerablick ist, wie im letzten Gedicht des Bandes:
DER SCHILD DES AENEAS
Einäugig geschmiedet,
zyklopen-retina, einäugig geschmiedete Panoramakamera.
parallelgeschehen, zeitenwenden. wie:
romulus tierfilm zeigt – wölfinlefzen
gut im Bild, tonschnitt in ordnung, etwas
übersteuert.
kampfgeschehen.
Hubert Winkels, Die Zeit, 23.3.2005
Im Wortsinn radikal
− Denkbeschleuniger ohne Vergleich: Auswertung der Flugdaten, das letzte Buch des kürzlich verstorbenen Lyrikers Thomas Kling. −
Es stand zu befürchten, dass dieser Band sein letzter zu Lebzeiten sein würde. Anfang April ist der Lyriker Thomas Kling im Alter von gerade 47 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Kurz zuvor erschien ein neues Buch, dessen Titel in seiner Nüchternheit nun eine beinahe sarkastische Geste enthält: Auswertung der Flugdaten – das ist die gefundene Blackbox, deren Daten gedeutet, vielleicht jedoch erst einmal gelesen sein wollen: der letzte Band. Das letzte Band. Stimmenaufzeichnung.
Aber was für eine Stimme: „wie von polarfuchs heiseres gebell“. Schon die erste Serie, „Gesang von der Bronchoskopie“, schnürt einem beim Lesen den Brustkorb ein wie mit Draht. Thomas Kling spricht aus dem Hallraum der Lungenstation, vom „bahreliegen, / unter heimeligem stammheimdeckenmond“, von den peinigenden Behandlungen, von Arnika und Vitriol und natürlich der nackten Angst.
Aber er tut es nicht als Hinfälliger, sondern selbst hier mit der ihm sehr eigenen Mischung aus Aggressivität und kalter, intellektueller Distanz; heiser vielleicht, aber präziser, schärfer, buchstäblich eindringlicher denn je. Die „Sondagen“, diese historischen und geologischen Tiefenbohrungen, mit denen Kling bisher das Material seiner Texte an die Oberfläche beförderte, finden jetzt am eigenen Körper statt:
wie man eintäufte in meine brust,
rumfuhrwerkte darin und loren proben
abtransportierten, nix von gemerkt
frantic.
Der Brustkorb wird zum Grubenschacht, die schmerzhafte Lungenspiegelung zur Einfahrt ins Bergwerk:
riss und schründe;
schacht und schicht.
Dass einem dabei die Redewendung „Schicht im Schacht“ im Hals stecken bleibt, ist jenem beißenden Humor geschuldet, den Kling auch in früheren Texten immer punktgenau einzusetzen wusste.
Der folgende Zyklus „Mahlbezirk“ schließt unmittelbar an. Wieder geht es ins Innere. Schwarzweißfotos von Ute Langanky zeigen die Eingeweide einer verrottenden Mühle: die ausgetretenen Holzstufen, das Mahlwerk, den Stein, „getriebe innen.“ Kling sucht in den Bildern – oder in der Mühle selbst, das spielt keine Rolle, denn mediale Vermittlung ist bei ihm ständiger Teil der Wahrnehmung – nach dem, was die Ruine an Sprachsubstanz hergibt. Und er wird fündig:
ihre mühlensprache sprach sie: flüssig,
in zerkleinerungsform.
sprach wie im rausch.
Auch hier ein Reflex auf ältere Arbeiten. morsch heißt ein Band von 1996. Das Wort teilt mit „mahlen“ denselben etymologischen Ursprung, und beide charakterisieren eine der grundlegenden Techniken Kling’scher Textarbeit, nämlich das „Zermahlen“ fester Fügungen, angewandt auf die Semantik bis in die Lautstruktur einzelner Wörter, wie auch auf Bildfolgen in der Segmentierung zur „Einzelbildschaltung“. Überhaupt dient das Kameraauge in einigen Gedichten zur jeweils nötigen Blickverengung („zoom“) oder -weitung („panorama“). Dann scheint ein Riss durchs Buch zu gehen. Ein längerer Essay unter dem Titel „Projekt ,Vorzeitbelebung‘“ begibt sich ins Gebiet der antiken Mythologie, ausgerechnet mit Hilfe zweier Mittelsmänner, die sich nicht leiden konnten und zunächst so gar nicht in den Sprachraum Klings passen wollen: der „Antikenverwalter“ des Jugendstils, Rudolph Borchardt, und der Binger „Voodoo-Priester“, Stefan George, mit dem Kling wenigstens die niederrheinische Herkunft teilt.
Aber eben nur scheinbar ein Riss, nur scheinbar unpassende Figuren. Das tertium comparationis sind die „Bakchen“ des Euripides, an deren Rekonstruktion sich Borchardt ein Jahrzehnt lang versucht hat. Was Kling an dieser Konstellation interessiert, ist dreierlei: die textliche wie personale Inszenierung der Antagonisten Borchardt und George, die Strategien der Verfügbarmachung antiker Stoffe und diese Stoffe selbst. Vor allem der in den „Bakchen“ geschilderte Dionysoskult mit seinen rasenden Mänaden, die gerne so manchen Mythenheld zerrissen. „Disiectio membrorum: die schamanistische Gliederverstreuung. Eben auch: Die Wortauswerfung.“ Wie im Vorbeigehen lässt Kling seine scharf gestochene Poetik fallen. In den Botenstoffen von 2001 war der Essay noch eine mehr oder weniger separierte Gattung. Hier funktioniert er wie ein Mischpult, voll verkabelt mit dem Kling’schen Soundsystem; denn die übrigen Gedichte gehen weit zurück in die Geschichte bis zur Himmelsscheibe von Nebra („die gesichtete, gesichelte // gegnd in fetzn“) und den sibyllinischen Orakeln („ihre bereitschaft zur raserei“), aber alle auf demselben Träger, in ihrer Tonspur.
Das letzte Band. Der letzte Band. Stimmenaufzeichnung. Erst allmählich wird klar, wie exakt und detailbesessen dieser Band konstruiert ist. Die motivische Vernetzung über die Gattungsgrenzen hinweg, der zurückgedrehte Zeitpfeil, das kunstvoll beherrschte Rasen der „Schädelmagie“. Thomas Kling überfliegt noch einmal sein Gelände und lässt den Flugschreiber zurück:
so kam ich
kam ich unter.
so kam ich zum erliegen.
Es ist bitter, dass mit diesem großartigen Buch ein Dichter das Schreiben einstellt, der schon bei seinen ersten Auftritten in den Achtzigerjahren eine singuläre Erscheinung war und es seitdem geblieben ist. Man sagt das so leicht hin, bei Kling war es tatsächlich der Fall. Wer es an den frühen Publikationen, erprobung herzstärkender mittel oder geschmacksverstärker (1985/86), noch nicht erkannte, dem wurde es spätestens bei Klings Bühnenauftritten deutlich. Das waren keine Lesungen, das waren eindrucksvolle Inszenierungen, „Sprachinstallationen“, wie er sie nannte, die adäquate Präsenz seiner Texte im akustischen Raum bei konsequenter Vermeidung jeglicher Form von Anbiederei. Und es zeigte Wirkung.
Kling hatte, was seine Arbeitsweise betraf, Einfluss auf etliche jüngere Autoren. Die Wahl der Stoffe, seine Montagetechnik, das Überblenden der Bildbereiche, der virtuose Umgang mit den unterschiedlichsten Tonlagen und Sprechhaltungen, vom angesägten Pathos bis zur lautschriftlich mitnotierten Umgangssprache, und vor allem die zwingend gründliche Materialrecherche als unbedingte Voraussetzung jeder ernsthaften Textarbeit. Immer selbstverständlich und im Wortsinn radikal, immer spröde, aber eingängig selten, moralisch, didaktisch gar nie. Lesen ist Arbeit. Ein Denkbeschleuniger ohne Vergleich. Epigonen hat er keine. Es ist unmöglich, ihm nachzuschreiben.
Nicolai Kobus, Die Tageszeitung, 23.4.2005
Seit Sonnenaufgang bin ich – Vulcan
− Nach dem Tod des Dichters Thomas Kling: Wer erprobt jetzt die herzstärkenden Mittel? −
Bereits nach seinem ersten Auftritt in den Wiener Margaretensälen im Januar 1983 ahnte Friederike Mayröcker, dass ihr „der Magier einer ins nächste Jahrtausend weisenden Sprachverwirklichung“ begegnet war. Mit dem jungen Thomas Kling hatte ein Dichter die Bühne betreten, der so gar nichts gemein hatte mit den nuschelnden Alltagsrealisten, die in diesen Jahren die Poesie beherrschten. Plötzlich war ein Autor aus dem Nichts aufgetaucht, der Sprache wieder ihren Körper, ihre sinnliche Materialität zurückgab. Thomas Kling, der am 1. April im Alter von 47 Jahren an Krebs gestorben ist, war ein Sprachekstatiker. Seine Passion: die „Sprachkörperbetrachtung“, das kunstvolle und traditionsbewusste Zerlegen und Neukomponieren von Sprachstoffen. In der Ethnologie bezeichnet man solche zaubrischen Sprachforscher als „Memorizer“: Sie sind, wie es Kling selbst in seinem großartigen Essay Itinerar (1997) beschrieben hat, „die Gedächtnisverantwortlichen unter den Clanmitgliedern“.
Im Dichterclan der nunmehr mittleren Generation war und ist Thomas Kling der Verantwortliche für das Sprachgedächtnis. Nach seiner Wiener Premiere begann er mit wachsendem Erfolg, Sprach-Räume mit seiner Stimme zu gestalten und die Wörter seines Gedichts mit allen nur denkbaren Formen der Deklamation zu dynamisieren und bis zu ihrem Siedepunkt zu erhitzen: So begann die Ära der “Sprachinstallation”, die kein Lyriker seiner Generation so mitreißend zu inszenieren verstand wie eben Thomas Kling. Seine Gedichtbücher mit ihren technizistischen und schrillen Titeln – auf das 1987 vorgelegte Debüt erprobung herzstärkender mittel folgte 1991 brennstabm und 1993 nacht.sicht.gerät – wurden zu Grundbüchern seiner Generation. Da hatte ein Wörter-Alchemist die Büchse der Pandora geöffnet und ließ daraus alle Wirkungsmöglichkeiten der Sprache auffliegen.
1957 in Bingen geboren, dem Heimatort Stefan Georges, hat sich Thomas Kling stets am gusseisernen Formalismus des rheinhessischen „Meisters“ und anderer Autoren der klassischen Moderne abgearbeitet. Historische Recherche, spracharchäologische Detailarbeit und seine furiose „Etymologiebegeisterung“ betrieb Kling bis zum Exzess.
Als er Anfang der achtziger Jahre mit seiner systematischen Sprachkörperbetrachtung begann, war es freilich ein österreichischer Dichter, der heute weithin vergessene Reinhard Priessnitz, der ihm den Weg zu seiner eigenen „polylingualen“ Kunst wies. Weil er sich immer wieder auf Priessnitz und dessen Wiener Kombattanten berief, hat man Thomas Kling oft als bekennenden Epigonen der „experimentellen Lyrik“ missverstanden. Nie ging es aber in seinen Gedichten darum, Sprachzertrümmerungen um jeden Preis zu organisieren oder gar serielle „Permutationen“ vorzuführen. Wenn er spezifische Techniken lyrischer Raffung, Komprimierung und schroffer Fügung durchprobierte, dann aber nur, um die sinnliche Materialität des Textkörpers erfahrbar zu machen. Seit 1994 lebte der Dichter zusammen mit seiner Frau, der Malerin und Fotografin Ute Langanky, auf einer ehemaligen Raketenstation, nahe der Museumsinsel Hombroich, einer klimatischen Schnittstelle am Nordrand der Kölner Bucht, die zum „Denkgelände“ für den Autor und zum Pilgerort für junge Dichter wurde.
Thomas Klings spracharchäologische Besessenheit manifestierte sich am intensivsten in seinem Gedichtband Sondagen (2002), seinem umfangreichsten lyrischen Opus. Hier finden wir faszinierende Anverwandlungen der alten Zauberlieder und Hexensprüche, die am oralen Anfang jeder Poesie stehen. Diese lyrische Rückholbewegung hat aber nichts naiv Vergangenheitsseliges, liefert keine Schamanismus-Reprisen, sondern vollzieht sich stets aus der Perspektive des distanzierten Historikers, des in vorzeitlichen Sprach- und Boden-Schichten grabenden Archäologen.
Der „Kennungsdienst“ des Gedichts besteht hier in der Kunst, das emphatische Evozieren des frühgeschichtlichen Materials mit dem kühlen Blick des Historikers und den Wahrnehmungsleistungen des jeweiligen Aufzeichnungsmediums zu synchronisieren.
Aus allen Epochen zitiert Kling seine „Vanitas-Inschriften“ herbei, schaut sich um im „archäologischen Park“, betreibt sein „kartenlesen im unverzeichneten“. Da werden zunächst, im zweiten und dritten Zyklus der Sondagen, in den Kratern und Kegeln der Eifel und im Bergischen Land die Hinterlassenschaften der frühen Menschheitsgeschichte aufgespürt. Auf den Spuren des Archäologen Johann Carl Fuhlrott, dem Entdecker des Neanderthalers, schürft und gräbt Kling in vulkanischen Böden und erstarrten Basalten, vergegenwärtigt „eiszeitjäger“, zitiert die Riten eines germanischen Regenzaubers und lässt am Ende des zweiten Zyklus sogar eine allegorische „Historia“ auftreten.
Im Zyklus Beowulf spricht positioniert sich Kling in unmittelbarer motivgeschichtlicher Nähe zu seinem großen Kollegen Seamus Heaney. Denn der „Beowulf“ ist ein altenglisches Heldenepos über einen unerschrockenen Drachentöter, das Heaney vor einigen Jahren in einer aktualisierenden Übersetzung zu neuem Leben erweckt hat. Wenn hier „aus torfen und mudden“ eine Moorleiche auftaucht, dann reflektiert Kling immer auch den Wahrnehmungsprozess bei der Bergung der Toten. Dann wird „im kopf“ ein „bergungsfoto“ produziert, wird der Körper mit den Augen „abgescannt“, wie es in einem häufig verwendeten technizistischen Terminus heißt.
Und selbst antike Weissagungen geraten bei Kling in medientechnische Zusammenhänge. Denn die „letzte Äußerung des delphischen Orakels“ wird gleich in zwei Versionen präsentiert. Da ist zum einen die wörtliche Übersetzung der Orakel-Spruchs aus der Griechischen Anthologie, zum anderen die Wiederholung des Spruchs in seiner medialen Verzerrung als Radiostimme. Von „delphis benommener stimme“ ist dann nur noch ein Wimmern und Knistern zu hören: „fading, schwund, wellen-/ getriller, steingepolter übern sender, und das wars.“
Zu den intensivsten Texten in diesem Buch zählt sicherlich der Zyklus Manhattan Mundraum Zwei, der uns mitten in die Gegenwart des Weltbürgerkriegs führt, in den „toten trakt von Ground Zero“ nach dem denkwürdigen 11. September 2001. Die Ereignisse des 11. September sind hier zurückgenommen in suggestive Chiffren: das „loopende auge“, der „algorithmen-wind“, die „lichtsure“, das „totnmehl“. Mitunter glaubt man Anspielungen auf Augenzeugenberichte zur Katastrophe zu vernehmen, nebst einem deutlichen Hinweis auf Celans Todesfuge, etwa im Begriff der „Luftsiedler“, denen bei Celan „ein Grab in der Luft“ geschaufelt wurde. Der Tod ist nun allerdings nicht mehr ein „Meister aus Deutschland“, der religiöse Ursprung des neuen Schreckens taucht nur in Ausdrücken wie „lichtsure“ oder „rache-psalm-partikel“ auf.
Neben diese an Paul Celan gemahnenden Verse in extremer Engführung treten die bewegenden Gedichte der Hombroich-Elegie. Hier vergegenwärtigt Kling in schönen dichten Bildsequenzen seine poetischen Wappentiere: den Turmfalken, die Biene – und immer wieder die Wespe.
In den erschütternden Versen des zuletzt erschienenen Bandes Auswertung der Flugdaten (2005) wurde man auf das Verstummen dieses großen Dichters vorbereitet. Am Anfang dieses faszinierenden Buches steht der große Gesang von der Bronchoskopie, ein ergreifender, an Todesahnungen rührender Gedicht-Zyklus, in dem das lyrische Subjekt seine Lage „am rande der grube“ reflektiert. Es sind Gedichte von der kühlen medizinischen Erkundung des Körpers, Gedichte eines Moribunden, der den für seine Dichtung typischen kulturarchäologischen Blick auf sich selbst richtet. Der Leib des lyrischen Subjekts erscheint nicht als bloß physisches Objekt der medizinischen Visite, sondern als Geschichtsmaterie. Der Atemraum des Ich wird dabei mit Metaphern des Bergbaus beschrieben. An gleich zwei Stellen dieses Zyklus wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem moribunden Ich und der romantischen Sage vom toten Bergarbeiter im schwedischen Falun. Diese unter anderem von E.T.A. Hoffmann aufgegriffene Geschichte erzählt von der wundersamen Unversehrtheit des toten Körpers im Erzbergwerk, wo er ein halbes Jahrhundert in „Vitriolwasser“ lagerte.
In den „lungenschacht“ des Kranken hinein stoßen hier die medizinischen Apparaturen – die im Gedicht als bergmännische Werkzeuge (zum Beispiel als das „gezähe“) apostrophiert werden: der doctor teuft ein – unser allwissend, doktor
hall-weisend, doctor halb, doctor alpwissend, du, eintäufer rein, rein stocher
-stocher in meine gestochene, wie scharf gebeizte lunge.
wie soll man sich fühlen, wenn man am rande der grube steht?
Von der körperlichen Ausgesetztheit des Ich in der Gegenwart führt der Weg ins Mittelalter, dann in die Frühgeschichte der Zivilisation und schließlich in den mythischen Urgrund des Menschengeschlechts. „Es geht darum“, so Thomas Kling in einem seiner letzten Interviews, „dass die alten Wortschichten untereinander zum Glimmen gebracht werden.“ In seinem letzten Buch ist es Thomas Kling gelungen, alte Stoffe der Vorzeit und neueste Fundstücke aus der Medienwelt dank einer virtuosen Sprachkombinatorik in große Reibungshitze zu versetzen:
rotglut der bilder. aufschmelzungen.
und alles – alles
ins fließen gebracht:
in meiner bildschmiede,
schildschmiede.
Seit sonnenaufgang bin ich – Vulcan.
Was Thomas Kling einmal über Reinhard Priessnitz, sein 1985 früh an Krebs gestorbenes Vorbild, geschrieben hat, lässt sich nun ohne Einschränkung auf ihn selbst übertragen: Er war und ist „der zweifellos bedeutendste Dichter seiner Generation“.
Michael Braun, Badische Zeitung, 16.4.2005 und in: der Freitag, 3.6.2005
Ein steinaltes Präzisionswerkzeug
Die Auswertung der Flugdaten fängt an, wenn die Aufräumungsarbeiten beendet sind, das Wrack geborgen und der Flugschreiber sichergestellt ist. Keine Auswertung der Flugdaten ohne einen Crash, der ihr voranging. Dann beugen sich Experten über die Reste einer Kommunikation, die zwischen Himmel und Erde ein jähes Ende nahm. Auswertung der Flugdaten heißt das letzte Buch von Thomas Kling, der am 1. April dieses Jahres in Dormagen, unweit der Raketenstation Hombroich, wo er lebte, gestorben ist. Es enthält neben Gedichten einen programmatischen Essay über „Euripides’ Bakchische Epiphanien“ und Rudolf Borchardts an ihnen praktizierte „Antikenverwaltung“ und einen Vortrag zu Tradition und Aktualität des Gemäldegedichts. Kein Gedichtband also, sondern eine poetologische Bilanz, in der Beispiele aus der lyrischen Produktion neben Beiträgen stehen, die man mit „Forschung und Entwicklung“ überschreiben könnte. Wenig lässt Kling darin dem Leser zur Einsicht übrig, was er nicht selbst schärfer gesehen und klarer formuliert hätte. Was das Gedicht, dieses „präzise Wahrnehmungsinstrument“, „dieses steinalte Präzisionswerkzeug“ im technischen Zeitalter noch vermag, hat Kling in Büchern demonstriert, deren Titel, geschmacksverstärker, nacht.sicht.gerät, Botenstoffe, Sondagen, bereits den Ingenieursgeist anzeigen, von dem der Autor sich anstacheln ließ.
Im ersten Gedichtzyklus, „Gesang von der Bronchoskopie“, wird die klinische Szenerie in Anmutungen aus „Arnikabläue“ und „Vitriolwasser“ getaucht. Die Brust des Krebskranken ist ihm darin zum Bergwerk geworden, in dem „loren proben / abtransportieren“ durch „riss und schründe; / schacht und schicht“. „Jetzt ist es“, heißt es dann weiter, „jetzt werd ich: / zum schacht, zum lungen- / schacht wird ich.“ Aus der ersten Person („werd“) ist am Ende eine dritte Person („wird“) geworden; die Verwandlung ist vollzogen, das Ich übergegangen in die Unterwelt des eigenen Körpers, und dies „unter heimeligem stammheimdeckenmond“. Das ist die Spannweite von Klings Spracharbeit: hier sucht und findet sie Assonanzen an die Gegenwart, an Vorstellungs- und Wörterwelten des gewöhnlichen Mediennutzers, dort sondiert sie in (für uns) entlegenen lexikalisch-etymologischen Beständen, denen der Montanistik etwa und ihrer romantischen Neuerfindung.
Wider die Scheinriesen
In ein und derselben Zeile schwingt Klings Sprache zwischen äußerster Schnoddrigkeit und rätselhaftester „Vorzeitbelebung“, so sein gern entlehntes Borchardt-Wort. Dass all dies vor lauter Verschiedenheit nicht auseinander fällt, sondern inmitten des ausgelegten Materials einer sichtbar wird, der spricht, dies macht Klings große Kunst aus. Zu großer Kunst gehört zumeist auch das unbeirrte Gefühl eigener Größe. Klings Ton kann schneidend werden, wenn es um Kollegen geht, die selbst den Dichterthron beanspruchen und nach seinem Dafürhalten bloß Scheinriesen sind. Es ist etwas Gebieterisches, Unduldsames in seiner Attitüde, vor allem, wenn es um die Konkurrenz geht. Sein Bingener Landsmann Stefan George hat nicht nur in dieser Hinsicht stilbildend auf ihn eingewirkt.
„Vorzeitbelebung“, „Antikenverwaltung“, das sind die Stichworte in Klings weitverzweigtem Essay über die „Bakchen“ des Euripides. Im Bacchanal selbst, der ekstatischen Zerreißung und Zerstreuung der geopferten Glieder, erkennt Kling den Grundzug seiner Poetik, die „Wortauswerfung“, die „Wortverwerfung“, die Arbeit des „Wortaufklaubens“. „Dichten – Schinden – Gerben“ sind für ihn verwandte Tätigkeiten, Prozeduren des Geschmeidigmachens, bei denen es ohne ätzenden Gestank nicht abgeht. Zur Poetik gehört neben ihrer Grundlegung auch der Einzug von stabilen Trennwänden. Hauptsächlich zu diesem Zweck kommt Kling ausführlich auf Rudolf Borchardt und dessen Monumentalwerk, die „Bacchischen Epiphanien“, zu sprechen; hier hat er einen, von dem er sich, bei durchaus vergleichbarer Ausgangslage, gern unterscheiden will. Zwar ist Kling bereit zu konzedieren, dass Borchardt „ein außergewöhnlicher Sprachmacher“ gewesen sei, zwar würdigt er dessen „Bakchenraserei, die im zwanzigsten Jahrhundert ihresgleichen nicht hat“, als „großes Kino“, aber trotzdem mag er Borchardts „Antikenverwaltung“ kein gutes Zeugnis ausstellen. Zu marmorn, zu bildungstrunken, zu traditionsbesessen der Mann.
Wie anders dagegen zur selben Zeit Stefan George, ein Feind der akademischen Bildung und Konvention, dafür „extrem timingsicher“ und ein Autokrat im eigenen Reich, stets beschäftigt mit „rausschmiß, wenn nicht pulverisierung, unbotmäßiger, nichtzügelbarer, bekanntermaßen auch aus seinem staff…“, fast ein Mann wie Thomas Kling, nämlich ein Performer, ein „Virtuose und ein Rock-Idol“, um Falcos „Rock me Amadeus“ zu zitieren, einen Künstler, dem Kling gewiss näher stand als Rudolf Borchardt und seinen Wiedergängern. Namentlich an Zweien dieser Borchardt-Nachfolger muss Kling häufiger sein Mütchen kühlen, an Durs Grünbein, dem „Antikefreund“, dem das „Gefühl für Geschichte“ fehlt, weshalb man von ihm nur „Kostümfilm – Sandalenfilm aus den Grünbein-Studios“ erwarten dürfe, und an Raoul Schrott, dem „habilitierten Tyroler Schelmchen“. Wie Rilke und Valéry zählt Kling sie zum Lager der Domestizierten, der timingschwachen Nicht-Performer. In Düsseldorf, nah an Punk und Pogo, hatten Klings lyrische Anfänge gelegen, und sie sind auch in diesem federnd angriffslustigen Buch gegenwärtig. Das letzte Wort im letzten Gedicht des letzten Buchs heißt: „kampfgeschehen“.
Christoph Bartmann, Süddeutsche Zeitung, 16.6.2005
Thomas Kling: Auswertung der Flugdaten
Sieben Abschnitte Lyrik, Bronchoskopien Eurypides’, Ezra Pounds, Matthias Grünewalds und Vergils, Sondagen also nicht nur der Wort- sondern auch von Bildender Kunst, welche der Düsseldorfer Vortrag „Zum Gemäldegedicht“, der in diesem Gedichtband ebenfalls abgedruckt wird, poetologisch zentriert – das bietet Thomas Klings (1957–2005) letzter Gedichtband Auswertung der Flugdaten. In Anlehnung an barocke Dichtungstheorien charakterisiert Kling das Gedicht als „verborgene Sendschreiben“ (Harsdörffer) und erklärt den Titel der Abhandlung aus der Auseinandersetzung mit der „Dichtkunst des Spaten“ von Kaspar Spieler:
Anhand der Bildvorlage entsteht nun das Gemäldegedicht; es mobilisiert seine Metaphernsprache, erzeugt seine eigene Bildlichkeit, um mit der gar nicht so fremden Fremdsprache des Bildes mithalten zu können. Dichten auch hier als Dolmetschvorgang, als Übersetzungsprozeß. Das Gemäldegedicht wird geschrieben, um letztlich mit dem Künstler gleichzuziehen; und nur das wäre für den Dichter optimal.
Der den Band eröffnende „Gesang von der Bronchoskopie“ folgt diesem Programm, die diagnostische Radiologiemaßnahme im Brustraum liefert Bilder einer arnikablau strahlenden Sonne („die im blauen kranz / herzkranz austobt sich“) und Gewebeproben („wie man eintäufte in meine brust / rumfuhrwerkte darin und loren proben / abtransportierten, nix von gemerkt – frantic.“). Der lyrische Befund wird schließlich mit der ärztlichen Diagnose enggeführt.
jetzt ist es. jetzt wird ich:
zum schacht, zum lungen
schacht wird ich.
„schacht arnika“: die
firstenbezimmerung droht in
arnikabläue aufzugehen!
wohinein ins
unvermutete das
liecht sich verliert.
Auch nach den endoskopischen Betrachtungen, denen auch die Nachbehandlung vor dem Inhalator zu poetischen Reflexionen Anlaß gibt („atemmail, wie metal aim / gezahnte lüfte. so lautet inhalt, kurz hall mail, / so inhaliert uns der dichter“), geht es ins Innere einer Mühle, geht es in den bereits 2003 in der Neuen Rundschau veröffentlichten „Mahlbezirk“. Um neun Fotografien der Fotografin und Malerin Ute Langanky, der der Gedichtband als Ganzer zugeeignet ist, um neun Fotographien herum ist dieser Teil organisiert und hält ein Echo auf den „Inhalator“ bereit. Nach dem Besuch im Bergwerk des Ich heißt es über das Mahlwerk der Sprache, das der Dichter selbst instand setzt:
machte da am triebloch herum:
unter schwebender feder
mein atem!
reißt das seil
Das folgende Projekt „Vorzeitbelebung“ knüpft an Euripides’ und vor allem an Rudolf Borchardts „Bacchische Epiphanie“ an. Borchardt, der mit seiner „Grabschrift der Schwalbe“ in Klings Lyrikanthologie Sprachspeicher vertreten war – und, wie kann es anders sein, dort vom ihm verhaßten Bingener Gastwirtssproß Stefan George mit sechs Gedichten auch qua Präsenz lässig ausgestochen wurde – wird im Plauderton vorgerührt, seine wilhelminisch-hochgeschlossene Schlüssellochperspektive engt eben auch das Sujet, den Tier- und Menschenopfer fordernden Dionysos und die archaischen Bacchenvorstellungen ein. Das von Kling beanstandete Mißverständnis der Antike als verschwitzt-verschwiemeltes historisches Herrenvergnügen steht auch hinter dem kontemporären Kollegen-Bashing:
Wenn den Antikefreund das Fell juckt, er aber kein Gefühl für Geschichte hat? Dann bekommt man Kostümfilm – Sandalenfilme aus den Grünbein-Studios.
Vergleichsweise harmlos kommt die Schelte ob der „Antikenverwaltung vs. Vorzeitbelebung“ daher, bei Euripides wird der Voyeur noch zerrissen und auch Orpheus findet einen gewaltsamen Tod (die disiectio membrorum als eine Art Berufsrisiko antiker Dichter wird dem Heutigen immerhin nicht mehr angedroht, was aber natürlich auch am Adressaten liegen kann).
An diese schamanistische Gliederzerstreuung schließen auch die „Poetik“ überschriebenen Abschnitte an, in denen die „Wortauswerfung“ und „Worverwerfung“ des Schreibens, das „Zerreißen und Wieder-Zusammensetzen der Einzelglieder“ in leicht anrüchiger Katachrese in eine dem Gerberhandwerk entlehnte Trinitas überführt wird, in einen Dreischritt von „Dichten – Schinden – Gerben“. „Die gesprochene, hin auf die Einzelteile gesprochene Schrift“ heißt es weiter, „das unausgesetzte, das naturgemäß vollständige Ausgesetztsein im Schreiben, mit der, und – haargenau – in der Schrift“, diese Beobachtung ist konstitutiv für Klings „Poetik“, der sich dann auch die beobachteten Gegenstände unterordnen. Das Gedicht als „Wahrnehmungsinstrument und Abgrenzungsmittel“ wird ernst genommen und auch im eigenen Schaffen verortet, Anregungen durch Bilder Goyas, Polkes oder Leals (oder Katalogtexte zu diesen Künstlern) stehen neben den Bildern von Feldpostkarten aus dem Ersten Weltkrieg und TV-Bildern von vorgestern. So, faßt Kling zusammen, so will er weiter „Wegmarkierungen anlegen […], diese Sprachknoten“, denn es gibt Adressaten, es gibt „immer welche, die versiert sind und sich ein Bild machen können, ein Bild von deutlicher Knotenschrift“.
Vom Bild zum Sprachknoten, weiter zur Knotenschrift und wieder zurück zum Bild spannt sich das Gewebe der Lyrik Thomas Klings, in allen Vermittlungsstufen Ortega y Gasset zitierend:
Irrig zu glauben, Dichtung sei Natürlichkeit: das war sie noch nie, seit sie Dichtung ist.
Ein prekäres Unterfangen ist Dichtung, mit Gefahr für Leib und Leben mitunter. Wie etwa im den Band beschließenden Gedicht „Der Schild des Aeneas“, in dem der Schild, das Gedicht, „parallelgeschehen, zeitenwenden“ zeigt. Klings lyrische Kriegsberichterstattung mit intermedialer Selbstrezension:
parallel geschehen, zeitenwenden. wie:
romulus’ thierfilm zeigt – wölfinlefzen
gut im bild, tonschnitt in ordnung, etwas
übersteuert.
aaaaaaaaaakampfgeschehen.
Oder wie in der „Himmelsscheibe von Nebra IV“, bei der handfesten Auswertung persönlicher Flugdaten:
glaubt es, durchs zeiss-glas:
über harsch-
aaaaaaaaaaflecken
aaaaaaaaaaaaaaaahin-
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaasegelnd, steil
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaübern
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajägersteig, abwärts,
rasant und im stoppenwollen
schon handknochn zeigend,
und über und über
das stürzn, der sturz –
aaaaaaaaaaaaaaaaaadas endet,
verschwiegenen glucksens,
im rinnsal, im sinnsal;
aaaaaaaaaaaaaaaaaadas
endet in einzelbildschaltung,
endet in keinem
aufwachraum.
Nein, leider nicht. Nur der Leser findet sich nach der Lektüre der Kling’schen Gedichte etwas übersteuert im Aufwachraum, der „Sondengänger“ und „nachtaktive Raubgräber“. Kling ist seit April 2005 in die Einzelbilder seiner Gedichte gefroren und in ihnen aufgehoben. „Das letzte Bild bleibt auf der Netzhaut stehen“, heißt es im Band. Die Bilder Klings werden sich wohl noch eine ganze Weile bewegen.
Christian Schlösser, Deutsche Bücher, Heft 3, 2005
Über den Berg
– Thomas Klings „Gesang von der Bronchoskopie“. –
Girl in amber trapped forever spinning down the hall
(Nick Cave & The Bad Seeds)
Zwei Seelen wähnt der Deutsche allzu gerne in seiner Brust. Von zwei Seelen sprach Faust in Worten, die Goethe ihm in den Mund gelegt. Als im 18. Jahrhundert das Subjekt gerade frisch aus der Taufe gehoben ward, versetzt Goethe es in persona Fausts zunächst einige Jahrhunderte zurück und spaltet es sogleich: zwei Seelen in einer Brust / einem Subjekt / einer Person. Den Staub auf dem zur verkürzten Floskel herabgekommenen Vers kann man gegenwärtig fast schmecken. Nun kennt und schätzt allerdings auch die gegenwärtige Dichtung die Zweiheit als Schema. Nur nicht als mit sich selbst im Clinch liegende Dualität, sondern als komplementäre Funktion. Statt den zwei Seelen in einer Brust birgt des Dichters Brustkasten zwei Schätze: nämlich Herz und Lunge, die beiden Rhythmusmaschinen, ohne die das Gedicht nicht ist.
Thomas Klings aus sieben Gedichten bestehender Zyklus „Gesang von der Bronchoskopie“, der dessen letzte Publikation zu Lebzeiten, Auswertung der Flugdaten, eröffnet und von der Lungenkrankheit des Dichters und ihrer Behandlung berichtet, inkorporiert eben diese beiden Organe als Keimzellen des Gedichts. Die Bedeutung der Lunge prägt zu weiten Teilen den Fokus der Rezeption des „Gesangs von der Bronchoskopie“. Das ist in Anbetracht der Hin- und Verweise, die der Zyklus gleich Brotkrumen streut, verständlich, gar berechtigt. Doch auch das Herz spielt seine Rolle, nur liegt es ein wenig verborgener dem Text zugrunde.
Zunächst zur Lunge: Die Chronologie der einzelnen Gedichte des Kling’schen „Gesangs“ beschreibt in nahezu sukzessiver Folge – liest man den auf den ersten vier Seiten a vier Dreizeilern ausgebreiteten Auftakt „Arnikabläue“ als Synopse – die Diagnose und Behandlung der Lungenerkrankung in einer Dramatik der Ereignisse, die der Form nach an ein Stationendrama erinnert. Der hauptsächlich aktivierte Bildbereich entstammt dem Bergbau, seiner entwickelten Terminologie, seinem Jargon sowie der zugehörigen Tradition und Kultur. Marcel Beyer braucht das in seiner Münchener Lyrik Kabinett-Rede Aurora nicht hervorzuheben, er spitzt diesen Umstand über die Teufe, die Tiefe, das Teufen, das senkrechte Graben, Ausheben von Schächten im Bergbau zu. Mit der 1580er Übersetzung von Agricolas Berckwerck Buch zur Hand, verweist er auf die Funktion des Bergreihens, jenes bei der ungemein strapaziösen Arbeit unter Tage gesungenen Liedguts der Bergarbeiter, das die Anstrengungen der Maloche vergessen machen soll; das die Furcht vor einem verheerenden Unglück, die Angst vor dem Aberglauben zu bannen versucht. Beyer also schreibt:
Vielleicht lässt sich der gesamte Zyklus „Gesang von der Bronchoskopie“ als Bergreihen auffassen – nur dass hier der Sänger eben nicht in die Welt hinauszieht oder in den Berg steigt. Der Sänger ist sich selber zum Berg geworden, in den andere steigen, in den andere einen Schacht graben.
Die derart beschriebene Drastik spiegelt diejenige, die Klings Zyklus evoziert:
so folgt nach mutung einschlag.
ärztlicherseits.
sie täufen ein.
jetzt ist es. jetzt werd ich:
zum schacht. zum lungen-
schacht wird ich.
So weit, so hart, was die Analogie betrifft. „Der Gesang von der Bronchoskopie“ verortet sich auf mehrfache Weise: im Krankenhaus, wie der „doctor“ / „doktor“ und die Schwestern, die Überschriften der Gedichte [„Flur. Diagnose“], [„Flur. Diagnosezeug“] oder [„Radiologische Mutungen“] bezeugen; außerdem „Zu Neuss am Rhein“, wie es in „Ach je“ schließlich verlautet. Das Bergwerk, das der Dichter derweil ist, ist über ihn hinaus ein spezifisches, ein in der deutschsprachigen Literatur keineswegs unbekanntes. Nach einigen Anspielungen tritt es den Lesenden unverhohlen entgegen: „(falun)“.
Das Bergwerk von Falun zirkuliert als literarischer Stoff im deutschsprachigen Raum seit 1800. Es ist das Märchen vom verschütteten Bergmann Elis Fröbom, dessen sterbliche Überreste 50 Jahre nach einem verheerenden Grubenunglück geborgen werden. Keiner der Anwohner Faluns ist in der Lage, den zu Tage geförderten Leichnam – der in Vitriolwasser konserviert auf wundersame Weise frei von jeglicher Verfallserscheinung ist – zu identifizieren. Alleine die greise Braut Elis’ erkennt den Toten, der damals am Tag ihrer beider Hochzeit, dem Johannistag – der auf die Sommersonnenwende folgt –, nicht aus der Teufe wiederkehrte. Über all die Jahre ist sie dem Geliebten treu ergeben geblieben.
Vom Versuch, den Tod durch die Erhabenheit der Liebe zu überwinden, spricht auch das dem „Gesang von der Bronchoskopie“ vorgeschaltete Motto aus Ludwig Bechsteins Gevatter Tod. In Klings Wiedergabe lautet es:
„Wer bist du?“
„Ich bin der todl“ sprach jener
mit ganz heiserer stimme.
Klaus, ein armer, kinderreicher Mann, ist auf der Suche nach einem Paten für seinen jüngst geborenen Sohn. Wie von Kling in nuce geschildert, befragt Klaus schließlich den Tod, der einwilligt. Diesem verdankt der herangewachsene Sohn in seinem späteren Beruf als Arzt dann auch seine vorzügliche Heilkunst. Der Tod rafft seinen Günstling dann doch früh dahin, als dieser versucht, seine Geliebte vor dem Tod, der dies selbstverständlich nicht ungestraft geschehen lassen kann, zu bewahren.
Wer von solcher Erhebung der Liebe über die Macht des Todes Kunde geben kann – und sie somit bricht –, das ist selbstverständlich der Dichter. Marcel Beyer schreibt:
So übersteht der Sänger, übersteht der Berg das Eintäufen in seine Lungen. Worauf er, unter Ausnutzung seines gesamten Lungenrestvolumens, erneut zu singen beginnt.
Nur, wie ist es möglich für den Dichter, einen schweren Eingriff wie das Eintäufen zu überstehen? Die Antwort ist – und das muss einmal für Klings Gedicht gesagt werden: durch die Kraft seines Herzens, das mit dem Gesang, dem Bergreihen beschworen wird und nicht aufhört zu schlagen. Wo die Lunge unter Tage hart angegangen wird, erhebt sich immer wieder das Herz, den Kollaps zu verhindern. Hierbei weiß der Dichter von Anfang an, welches Präparat er zu beschwören hat. So beginnt der „Gesang von der Bronchoskopie“, seiner Mittelchen sicher, mit dem Gedicht „Arnikabläue“:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaso fran-
st grafit das hochgebirge aus mir:
den kopf, die abzählbaren kuppen.
sonne strahlt arnika, trotzdem: frantic,
reichlich alles. die im blauen kranz,
herzkranz austobt sich, protuberanzen.
Bei aller Panik bezeugt der Pulsschlag die Herzaktion, die dokumentiert wird in der nervösen Aufzeichnung eines Elektrokardiogramms. Jede auf diese Weise, in dieser Schrift ausschraffierte Kuppe vor und nach dem Abflachen des Pulses ist ein Anzeichen des Fortlebens. Der Dichter ist über den Berg, mit jedem Herzschlag.
Über den Berg sein, das heißt gemeinhin: etwas ist überstanden, eine Krankheit befindet sich auf dem Rückzug, der Patient fortan auf dem Wege der Besserung. Die bekannte Redewendung funktioniert metaphorisch, sie überträgt das Bild des Gebirgspasses, dessen Verlauf den Weg über den Berg bezeichnet, um die Verbindung eines Sicherheit versprechenden Tals mit dem nächstnahen herzustellen, mit der Überwindung einer anderen Strapaze, nämlich einer das Leben bedrohenden Krankheit. Über den Berg sein, das bedeutet, dass einer übermächtigen Herausforderung getrotzt wird. Welche Anstrengungen hierzu nötig sind, drückt die Bildlichkeit der Redewendung auf größtmögliche Weise aus.
Der Dichter des „Gesangs von der Bronchoskopie“ bewältigt seinen Kampf um Liebe und Leben mithilfe der Echten Arnika, Arnica montana, auch bekannt als: Bergwohlverleih. Nachgesagt wird der Pflanze, deren Blütenkorb und -blätter gelb wie die Sonne strahlen, eine wohltuende Wirkung gegen Verletzungsschocks, sie soll Blutungen stillen, die Sauerstoffverwertung anregen und die Herzleistung steigern. Der sehr alte Goethe habe mit der Einnahme von Arnika versucht, seinen Herzbeschwerden und dem nahen Tod zu trotzen. Dem (deutschen) Aberglauben – Jakob Grimm – zufolge sind die Blätter, die am Johannistag gesammelt werden, besonders heilkräftig.
Über den „Gesang von der Bronchoskopie“ hinaus hat sich Arnika an einer weiteren Stelle – und darüber hinaus als Selbstzitat „arnikalitanei“ aus dem Zyklus „stromernde alpmschrift“ im Band Auswertung der Flugdaten eingeschrieben. Namentlich in der abschließenden Strophe des Gedichts „Neues vom Wespenbanner“:
arnikalitanei, sich sonnend. was in der flasche
auf dem eternitdach liegt des schobers, sechs
tage liegen muß: die blüten, wurzeln auch blitz-
gelber blaubestrahlter ernte, die auf zerrung
und ergüsse aufgetragen werden wird.
Dasselbe Gedicht beginnt mit den Stimmen der Säulenheiligen, die von ihren Höhen aus in die Tiefen steigen und sodann zu den nächsten Höhen hin erklingen. Die Stimmen passieren die Kuppen, verbinden die Täler und ziehen sich wie eine Sinuskurve durch die Geschichte, die immer auch eine persönliche ist. Wo die „säulensteher[n]?“ in einem früheren Gedicht wie „manhattan mundraum“ verzweifelt auf das grassierende Sterben aufmerksam machen wollen, aber nicht verstanden werden, da ihre Rufe anscheinend unentwegt auf Widerstände prallen, die sie nicht überwinden können, gelangen die Stimmen der Säulenheiligen in „Neues vom Wespenbanner“ über den Berg. Sie künden davon, dass der Dichter gemäß der beliebten Gottfried Benn’schen Maxime jedes Material – so auch den Tod – kalt halten kann. Ein kaltes Herz aber, das kennt das Gedicht nicht.
Literatur:
– Marcel Beyer: Aurora. Münchener Reden zur Poesie. Hg. von Ursula Haeusgen und Frieder von Ammon. München 2015
– Thomas Eicher (Hg.): Das Bergwerk von Falun. Münster 1996
– Thomas Kling: Gesammelte Gedichte 1981–2005. Hg. v. Marcel Beyer und Christian Döring. Köln 2006
– Aniela Knoblich: „,The old men’s voices‘. Stimmen in Klings später Lyrik“. – In: Frieder von Ammon / Peer Trilcke / Alena Scharfschwert (Hg.): Das Gellen der Tinte. Zum Werk Thomas Klings. Göttingen 2012, S. 215–237
– Markus May: „Von der ,Flaschenpost‘ zum ,Botenstoff‘. Anmerkungen zu Thomas Klings Celan-Rezeption“. In: Frieder von Ammon / Peer Trilcke / Alena Scharfschwert (Hg.): Das Gellen der Tinte. Zum Werk Thomas Klings. Göttingen 2012, S. 197–214
Maximilian Mengeringhaus, die horen, …immer steigend, kommt ihr auf die Höhen. Zusammengestellt von Andreas Erb und Christof Hamann, Heft 266, 2. Quartal 2017
Klingt’s
… um auf Thomas Klings letztes Buch zurückzukommen. Das Umschlagbild zeigt in einer bukolisch wirkenden, von Efeu und anderm Grünzeug verschatteten Szenerie einen Mann mittleren Alters – man darf ihn für den Autor halten –: wie er, den Kopf ins Laub gereckt, mit zaghaft ausgebreiteten Armen und zusammengepressten Knien auf einem antikischen Säulenstumpf sich um Balance bemüht. Die zweifellos ikarisch motivierte Haltung des Dargestellten wirkt durch und durch unfrei, wirkt in ihrer inszenierten Monumentalität zunächst lächerlich, auf den zweiten Blick aber einigermassen anrührend, da man plötzlich zu erkennen glaubt, dass hier nicht ein Höhenflug imaginiert wird, vielmehr ein Absturz oder jedenfalls das fatale Schwanken zwischen dem Sturz von der Säule und dem Abheben in höhere Sphären.
Auswertung der Flugdaten heisst der Titel zum Buch, der Flug muss demnach bereits stattgefunden haben, die entsprechenden Daten sind erhoben, fragt sich nun – was ist von der Elevation, was ist nach dem Sturz geblieben? Den Umschlag habe ich entsorgt, nun liegt der Band, neutral in weisse Pappe gebunden und ohne Aufdruck von Name und Titel, in auffälliger Unauffälligkeit neben andern Büchern auf dem Gartentisch und ist zu lesen. Kling – der Kalauer hat seine Richtigkeit – klingt bei der Lektüre mit; ich jedenfalls kann seine Stimme, die Art seines Vortrags nicht trennen davon, nicht vergessen dabei:
Farbglut zitternd ins werk zu setzen
Mir mein’ kunst erlaubt.
Und aber wie bringt man ein Gedicht von Kling zum Klingen; er selbst war, wie mir scheint, gerade umgekehrt daran interessiert, jeden Wohllaut abzuschmettern, ihn schon beim Aufkommen untergehn zu lassen in Dissonanzen oder in einem plötzlichen lautlosen Halt!.. Ohnehin war eher der Rhythmus seine Stärke, das Knacken und Knirschen der Verse macht seine spröde Musikalität aus.
Hier zeigt sich, ohne Zagen und Zittern, der Sprachmachthaber auf dem Säulenstumpf; nämlich:
… der doch wie kein anderer der deutschen Dichtung für kolossale Erhabenheit, für erhabene Kolossalität steht.
Steht also da, von den lyrischen Flugdaten wörtlich wie wirklich bestätigt:
erhobenen haupts, die hände ausgebreitet
Von Schwanken oder Zögern kann da keine Rede sein, dieser Autor ist sich seiner Sache sicher und seiner selbst auch. Die Auswertung der Flugdaten erbringt dafür allerdings nur einen einzigen Beleg, das aus vier Terzetten komponierte Gedicht „Amaryllis Belladonna L.“, welches dem Band eine unauffällige, aber starke Mitte gibt und das überhaupt zum Stärksten gehört, was ich kenne von Kling. Belladonna kann als die „Blume des Bösen“ par excellence gelten, horrend schön, wundersam giftig, kurz – ein mörderisches Gewächs; hier ist’s:
doch diese augen leuchten schwarz noch im vergehn.
gross, als ob der garten, ins herbar gepresst, so einfach
zu begreifen wäre wie ein netz. die äderungssystemestehen auf und haben weite: strahl und gift. so rauscht
die blüte, findet sich gedruckt; hat altersfarbe, stockt
und hat das licht um im papier sich selbst zu sehn.ist dies der druck, den die linné’sche lumenuhr –
der zeiger reckt den hals –, ist dies ein platzen, regnen
und verrinnen? ist farbenrast dies, andacht, rasen, kö-pfehängenlassen? und hat die eigene farbenskala,
aufgeschäumtes rot, mit festem blick. der stockfleck
nennt die stunde; blitzen. nachtgesicht lädt auf.
Abgesehn von einem fragwürdigen Anthropomorphismus („der zeiger reckt den hals“) und zweidrei rhythmischen Schwachstellen ist das ein untadelig gebauter Text, der sich – schwarz leuchtend sozusagen – abhebt von den übrigen Beiträgen des Buchs, Gedichten wie Essays, die mehrheitlich in unproduktivem Originalitätskrampf befangen bleiben, Zeugnisse eines pathetischen Siegerwillens, der an seinen eignen Ansprüchen scheitert.
Sicherheit und Selbstgewissheit hat Thomas Kling besonders eindrücklich bei seinen Lesungen, aber auch im Gespräch zum Tragen gebracht. Dabei empfand ich – vorm innern Aug das unwillkürlich sich einstellende Bild eines Feldpredigers an der Front im Feindgebiet – seinen schnarrenden Ton, sein harsches Wortgebell oft als bedrängend und irgendwie ungut. Der Qualität seiner Gedichte war die Dramaturgie der Pausen und des Aufbrausens jedenfalls abträglich, wie sein Sprechen insgesamt, das zwar einen auktorialen Willen durchzusetzen schien, dabei aber dem Wort die Luft entzog, seinen Klang schon bei dessen Aufkommen abschmetterte, ihn scherbeln liess.
Persönlich kannte ich Kling kaum, das Gespräch unter Literaten, nach gemeinsamen Lesungen, dominierte er durch seine ungewöhnliche Geistesgegenwart, die jeden Beteiligten – mich auch – verstummen oder entnervt abwinken liess. Klings Reden war dezidiert monologisch gerichtet, zwar voll von Anspielungen und Assoziationen aller Art, doch immer souverän und effektvoll gebündelt, um ihn selber zur Geltung zu bringen. Irgendwann möchte ich Kling lesen können, ohne ihn dabei hören zu müssen; aber noch ist die Erinnerung an seine provokante Rhetorik bei mir so stark, dass sie jede aktuelle Leseerfahrung über seinen Texten erschwert und verunklärt.
Felix Philipp Ingold, aus Felix Philipp Ingold: Gegengabe, Urs Engeler Editor, 2009
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Hans-Dieter Fronz: Brillante Lyrik zwischen Archaik und Moderne
Mannheimer Morgen, 6.6.2005
Philipp Gut: Der Dichter als Ethnologe
Tages-Anzeiger, 20.6.2005
Michael Eskin: Bits of Answer
The Times Literary Supplement, 14.10.2005
Thomas Kling zum 50. Geburtstag
einige Wochen vor seinem Tod schrieb mir Ute Langanky dasz sie fast immer bei ihm im Krankenhaus ist, er steht auf einer geborstenen Säule mit ausgebreiteten Armen in der Wildnis des Gartens (seines Verlags), er flüchtet ins Blätterdach und ein Ästchen krönt seine Stirn, damals in den Siebzigerjahren wohnte er schon lange in Wien, ehe er sich entschlieszen konnte, mich zu kontaktieren. Ich glaube, wir trafen uns im Café Central, ich schrieb das Nachwort zu seinem ersten Buch, unsere letzte Begegnung war anläszlich einer gemeinsamen Lesung in Berlin, wir lasen auf einer Bühne im Freien, an einem Regentag, ich habe noch öfter mit ihm telefoniert, als er schon krank war, einmal sagte er mir am Telefon, da lernt man beten und : ich glaube es ist ein Wunder geschehen : mir geht es gut, ich war nie in seinem Haus in Hombroich, jetzt wohnen einige Dichter und bildende Künstler dort, einmal gab es in Wien eine Ausstellung der Bilder von Ute Langanky, Ernst Jandl und ich kamen und bewunderten die ausgestellten Werke, ich konnte nicht zu seinem Begräbnis weil ich krank war, einmal, als er in Wien war, begleitete ich ihn ans Grab von Ernst Jandl auf dem Zentralfriedhof, er hatte Ernst Jandl bewundert und wollte ihn unbedingt besuchen, ich widmete ihm einige Gedichte und ich exzerpierte aus seinen Texten, seine Augen voll Schlaf, er hatte ein Bein über das andere geschlagen und eine glimmende Zigarette zwischen den Fingern, Sankt Atlantik, die weiszliche Hügelkette im Fenster, nervöse Anfälle in meinem Kopf
Friederike Mayröcker, 10.2.2007
CALW, KLING !
und jenen, flößern von verflossenem, reichte es nie zu mehr
zu überhaupt was, holzlast bis holland um so
den schwarzwald (tannen) hinabzubringen ans meer
in die calwerstraat geschafft zu amsterdams
sklavenschiffen ihr stämme oben
im stadtwald / stammwald breitgetretene zapfen
schuppig, wie schuppen von panzern, urzeitlich
beigetreten, asselähnliches, haus linkenheil, rauh
putz die häuser, putzige stadt, durch fußgängerzonen
und café demian geflößt, gewinkt
vom hessefinger auf der brück′ (von tassoti) betatscht oder
japanisch ins digitale monokel geklemmt dahinter
stämme schwanken lapidar am geldleuchtenden ufer
heimliche floßfahrten, er steckte sich den
eisernen nagel in den mund
er schrieb ich wird ins irrenhaus gesteckt
war andreä hier (mann der chymischen hochzeit) diese heraus
gezogene seele, schwebte der kelch, voll schwedentrunk
und an gewissen tagen des HErr und der festen in öffentlichen
zusammenkünften und versammlungen, lebten hier noch
10% bewohner als seine nachfahrn anno neunzehn
sechsunddreissig, schrieb threni calvenses, zusamengetragen
und mit skriftmässiger erklärung ausgeführet
schabbes, hier wird geschabt, halbmodisch
von färbereien, gerberein ein geruch
bäckerei pfommer weiss wohlgemuth
kaufland lidl aldicenter metzger franz jourdan blum
ratsstube rössle, alt-calw gutbeleuchteter fleischerläden
sparkassenzeichen, rot in der giebelnacht : „logo
schlägt logos!“ direktor teufel führt durchs haus
sagt ihm, dass es noch viel zeit brauche, wenn sie wollten
aber intakte familien, aber schausonntage im autohaus
monsterwolken, drunter wegschießende wortschaften
da – deckenpfronn!, da – haarschwärze! (ein weg)
in der halle, aber sichthülle das leben : eine sonntagsfrage
in den schächten, in parkhäusern geparkte nähen
ihr vielgebundnen flöße aber auf schwarzwald-tournée
(„klingt irgendwie nach gewürfeltem wanderhemd“, TK)
ganze stapel ausgesonderte, gestapelte emailgedichte
am holzrand tintlinge verschiedene stadien, zerlaufende schon,
aufrecht, matschig im script, haarschwarze skriptol-tinten
dokumentengeächtetes eberumschnuffeltes gepilz, im revier
alter dateien (nichts nie mehr was angesehen), im feuchtbiotop
randständig, den floßschreiber treibt’s, schreibt er
ist das hier irgendwo oder ein nirgendwo
diese stadt liegt im schacht, niedrige nebellager
die wand dringt zu sich selber durch, sodann
sondagen-CD : (in) die calwer kurve (gelegt) gekriegt
aufwärts, vorwärts gedreht, nach manhatten, mundraum
Michael Speier
Unter dem Titel „New York. State of Mind“ richtete der Autor Marcel Beyer auf Einladung von Professorin Dr. Kerstin Stüssel einen Abend zu Thomas Kling aus. Die Lesung/Performance fand statt im Universitätsmuseum, wo parallel eine Ausstellung zu Thomas Klings Werk gezeigt wurde, welche Studierende der Germanistik erarbeitet hatten.
Marcel Beyer und Frieder von Ammon im Gespräch über den Lyriker und Essayisten Thomas Kling.
Hubert Winkels: Die zwei Körper des Dichters. Am Beispiel Thomas Klings und Peter Handkes zeigt sich die Art, wie Schriftsteller sich selbst unsterblich machen wollen.
„Am Anfang war die ‚Menschheitsdämmerung‘“. Interview mit Thomas Kling.
„Ein schnelles Summen‟. Interview mit Thomas Kling.
„Gegen die Lehrer-Lempelhaftigkeit‟. Interview mit Thomas Kling.
„Augensprache, Sprachsehen‟. Interview mit Thomas Kling.
Gespräche mit Thomas Kling:
Thomas Kling VideoClip. Der junge Thomas Kling äußert sich zur Literatur und liest „Oh Nacht“ [aus der aspekte-Produktion 1989, gefunden im VPRO Dode Dichters Almanak]
Detlev F. Neufert: Thomas Kling – brennstabm&rauchmelder. Ein Dichter aus Deutschland
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb + PIA + Hommage + Symposion + Dissertation + DAS&D + Internet Archive + IZA + Kalliope
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + Galerie Foto Gezett + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Thomas Kling: Berliner Zeitung ✝ Der Freitag ✝ Der Tagesspiegel ✝ Die Welt ✝ einseitig ✝ FAZ ✝ FR ✝ KSTA ✝ Neue Rundschau ✝ NZZ ✝ Perlentaucher ✝ text fuer text ✝ Schreibheft ✝ Die Zeit ✝ Grabrede ✝
Weitere Nachrufe:
Julia Schröder: gedicht ist nun einmal: schädelmagie
Stuttgarter Zeitung, 4.4.2005
Thomas Steinfeld: Das Ohr bis an den Rand gefüllt
Süddeutsche Zeitung, 4.4.2005
Jürgen Verdofsky: Unablenkbar
Tages-Anzeiger, 4.4.2005
Norbert Hummelt: Erinnerung an Thomas Kling
Castrum Peregrini, Heft 268–269, 2005
Zum 10jährigen Todestag des Autors:
Hubert Winkels: Sprechberserker
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Tobias Lehmkuhl: Palimpsest mit Pi
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Theo Breuer: „Auswertung der Flugdaten“
fixpoetry.com, 31.3.2015
Tom Schulz: Dichter auf der Raketenstation
Neue Zürcher Zeitung, 13.4.2015
Vertonte Faxabsage zur Vertonung seiner Werke zur Expo 2000 von Thomas Kling.
Thomas Kling liest „ratinger hof, zettbeh (3)“


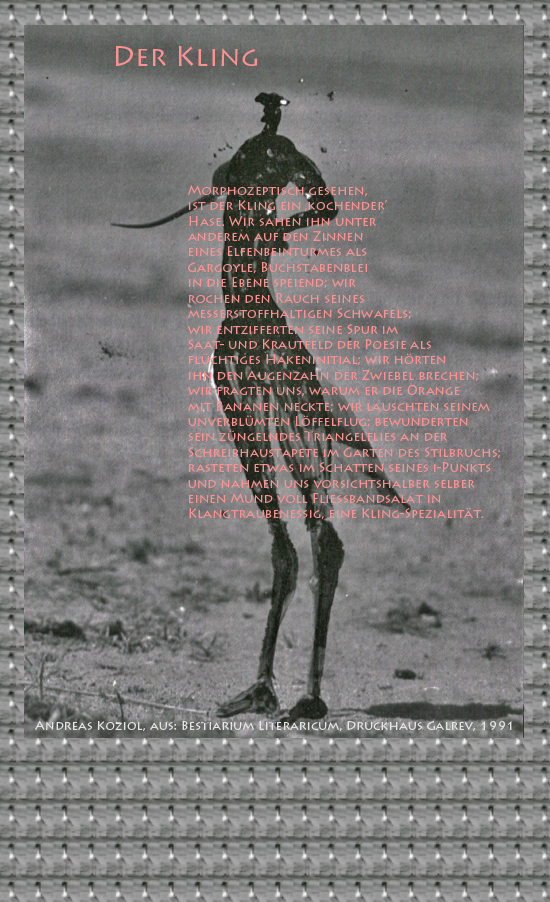












0 Kommentare