Biagio Marin: In Memoria / Der Wind der Ewigkeit wird stärker
Warum stürzen Sterne
und wer verbrennt sie
nimmt sie wohin
die Mädchen sie schluckt welche Ferne?
Ein großes schwarzes Verschwinden
eines so heiteren Himmels;
und es mischt sich die Nacht mit dem Tag.
Geburt und Tod stehen verbunden
seit den Morgenstunden,
auch wir ein Trugbild
oder Spuk
„Biagio Marins Gedichte sind in der Dialektsprache
der Adriainsel Grado geschrieben, in der Großmutter- und Muttersprache, in der Nachtigall- und Amselsprache, Rosmarin- und Rosensprache, Bäche- und Wiesensprache, sie sind geschrieben mit sehr nahen Worten, und handnah ist diese Welt. Es sind Gedichte der Physis. ,Die Wimper hat Schatten‘, aber keine Worte hat diese Sprache für die allgemeineren Ereignisse und Dinge. Zwar gebraucht Marin auch Worte von draußen, aus dem großen Italien, aus den Verhältnissen der Kommunikation, aber dann sind es übersetzte, aus dem großen Italienisch in ein kleines Italienisch übertragene, zurückisolierte, in die Nähe übersetzte und in die Würde, denn die Würde ist winzig; auch sehr leicht, das Leichteste, das Licht. Mit den wenigen hundert Wörtern, auf die Marin schließlich sein Vokabular einschränken kann, schreibt er von der Landschaft, dem Licht, den Sternen, der Lagune, dem Meer, den Bächen, Blumen, Feldern, dem Wind, sinnliche Einzelheiten, Lebendigkeiten, wieder und wieder, nahezu monoton, aber jedes Wort steht im Prozeß der Sublimation, im Prozeß des Leichtwerdens, des Ineinsgehens, also auch des Sterbens.“ (Peter Waterhouse)
Urs Engeler Editor, Ankündigung, 1999
La vita va via
− Die Wiederentdeckung des Dichters Biagio Marin. −
Es ist schon seltsam mit den Neu- und Wiederentdeckungen im Literaturbetrieb. 1991 erschien bei Rowohlt ein Lyrikband von Biagio Marin und fand nur wenig Freunde. Jetzt, fast ein Jahrzehnt später, hat der Verleger Urs Engeler nochmals den Versuch gewagt: In Memoria / Der Wind der Ewigkeit wird stärker heißt das Buch und bringt Gedichte Marins aus den Jahren 1973 bis 1983. Zusätzlich gibt es zwei Texte zu Biagio Marin. Sie stammen von Pier Paolo Pasolini und Andrea Zanzotto. Und plötzlich spricht man über Marins Dichtung.
Das ist schon seltsam, zumal da sich die Bedingungen für Lyrik, wie sie Marin schreibt, nicht gebessert haben. Dem Autor geht es ums Ganze, um Geburt und Tod, Ewigkeit und Wiederkehr, dies alles im Spiel mit dem Meer, der Sonne, dem Abendhimmel, der in die Nacht eintaucht. Pasolini nennt Marins Dichtung „ontologisch“. Etwas Schlimmeres kann einem Autor heute gar nicht bescheinigt werden. Heillos veraltet könnte man Marins Verse nennen, aber genau in diesem Verdikt liegt die Spur zur Faszination.
Denn Marin ist ein Monolith in vielerlei Hinsicht. Er lebte lang und trug mit sich die Last des Jahrhunderts: 1891 in Grado geboren, erlebte er die Stadt als Teil der österreichischen Monarchie und als mondänen Kurort; in den Schulen sprach man Deutsch. Die zwei Kriege, die dann kamen, erschütterten Grenzen und das Bild von der Welt, jedoch nicht die Bestimmung Marins als Dichter: Grado ist es als äußerer wie innerer Ort, der gradesische Dialekt ist die erwählte Sprache im Gedicht. – Marin:
Ich sollte die Stimme meiner Insel, die Stimme Grados sein, und sonst nichts.
Als Marin 1985 starb, hinterließ er an die vierzig Gedichtbände, Prosa und Aufsätze. Das Monolithische an Biagio Marin ist sein Beharren auf elementaren Größen: Im Namen selbst verbürgt sich das Maritime (einer seiner Töchter gab er den Vornamen Marina); durch die sprachliche Enge des Gradesischen kommt es zu einer Reduktion des Vokabulars. Sein „Gesang“, so Marin, sei „aus wenig gemacht“. Es sind Worte wie „Insel“, „Meer“, „Luft“ und „Sonne“. – „Vier Noten / welche Not / und doch das große Gedicht / darin alles spricht.“ Der Verlust sprachlicher Vielfalt ist „Not“ (Not im Angesicht der Historie), aber genau dadurch entgeht Marins „Gesang“ dem Vorwurf, verspätete natursymbolistische Dichtung zu sein. Das „große Gedicht“ entsteht vielmehr, wenn elementare Worte aus der Natur mit den Grundbestimmungen menschlicher Existenz in eins gesetzt werden können. Das ist Marins poetisches Ziel, nicht jenseits aller Metaphorik, aber doch weit entfernt von allen elaborierten und dunklen Metaphern. Das Rätsel des Seins ist nicht enträtselbar, es steht da, eingeschrieben in die Natur, eingeschrieben ins Gedicht.
Doch dies Rätsel kann eben „Gesang“ sein. Von den Dichtern sagt Marin:
Ohne Gesicht
schufen wir den Herrn
wir erfanden Paradies und Infern
einen Gesang voll Licht.
Und im Gradesischen lauten die Zeilen:
Vemo creào
el gran Dio sensa viso,
l’inferno e l’paradiso,
el canto più infiorào.
Alles ist im auslautenden Vokal „o“ eins und zugleich Gesang im Prozess des Schaffens und des Lichtens.
Wenn sich Pasolini und Zanzotto mit der Anwesenheit des Göttlichen in Marins Gedichten Mühe haben, so muss man auch sagen, dass diese Präsenz keineswegs ungebrochen ist. Denn, wenn etwa „Hafen“ die „Ewigkeit“ mitvermeint, was bedeuten dann folgende Zeilen: „überall / bist du ohne Hafen / fahr nicht / in die Tiefe fall“?! Marin möchte den Leser nicht verstoßen, nur auch er muss verstehen, was es heißt, „in der Welt der Gewalt“ Lyrik zu schreiben. Es heißt:
ich habe ein Feuer,
das brennt, aber das weint.
In Marins dichterischer Welt sind allein die Gegensätze von Dauer: Lebendiges Licht und die Nacht der Auslöschung, Gehen und Verwehen, Gott und Immer wieder die glatte Negation im „nichts“. Und nur wer dieses Spannungsverhältnis, aushält, sich darin hält, kann sagen:
Die Sonne, das Leuchten, das Wasser, das Brot
lohnen die Kämpfe und Wunden.
Mit der Übertragung, die Peter Waterhouse maßgeblich gestaltet hat, wird klar, dass es sich bei Biagio Marin um einen Dichter ersten Ranges handelt. In der Gegensätzlichkeit allen Lebens suchen seine Worte „Lichtung“.
Das ist auch ein Wort Heideggers, ein anderes ist „Gerede“. Marin ist ein Dichter jenseits allen Geredes. Seine lyrische Rede hat Wert, gibt Sinn und man hofft, dass weitere Texte Marins übersetzt werden mögen. Denn mit Biagio Marin kann man lesend ein Stück des Weges gehen und sagen „la vita va via“. Es sich sagen und wieder sagen, bis einem der Doppel- und Dreifachsinn der Worte in der eigenen Sprache zufällt: „das Lebendige lichtet.“
Andreas Puff-Trojan, Süddeutsche Zeitung, 8./9.4.2000
Der Wind der Ewigkeit wird stärker
− oder: Verse ohne Innenflächen, ganz dem Licht zugewandt. −
„Biagio Marins Dichtung hat keine Innenflächen: sie ist ganz dem Licht zugewandt“, schrieb Pier Paolo Pasolini über einen der wichtigsten italienischen Dichter des zwanzigsten Jahrhunderts. Zwischen beiden bestand eine lebenslange Freundschaft und unmittelbare Affinität zum Werk des anderen. Der gewaltsame Tod Pasolinis erschütterte Marin, ein Gedichtzyklus „Der Schrei des zerschmetterten Körpers – Litanei zum Gedenken“ hatte er dem Filmregisseur und Autoren gewidmet.
Die besondere Färbung des Lichtes, von der Pasolini spricht, ist der Widerschein des Meeres, das die Laguneninsel Grado, zwischen den Mündungen der Flüsse Isonzo und Tagliamento im Friaul, umspült. Hier wurde Biagio Marin 1891 geboren, hier und in unmittelbarer Nähe, in Görz, lebte er überwiegend, hier starb er 1985. Verläßt man das Festland in Richtung Grado, geschieht eine Wandlung vor den Augen. „Plötzlich aber öffnet sich die blaue Tiefe des Himmels und du beginnst mit dem Herzen zu sprechen, du überläßt dich dem stillen Zauber der Landschaft“, beschreibt sie Marin in seinem gleichnamigen Erzählband „Grado, die von Gott begnadete Insel“. „Aus einem regelmäßigen Wellenspiel tauchte unsere Sandinsel in der Sonne auf. Die Sandkörner sind aber seit zweitausend Jahren mit dem Blut unserer Ahnen vermischt und nur die Knochen unserer Großväter halten sie zusammen.“ Die Insel in der kargen Lagunenlandschaft, auf der sich um das Jahr 500 die Bewohner der nahegelegenen Stadt Aquileia auf der Flucht vor den Hunnen unter ärmlichen Bedingungen angesiedelt hatten, als Fischer und Handwerker, vor allem Bootsbauer, ist bis heute eine eigentümliche Sprachinsel geblieben. Im Gradesisch, einem altvenezianischer Dialekt, denn Grado gehörte bis zum Ende der Republik Venedig 1797 zur Serenissima, leben bis heute Rudimente mittelalterlicher Sprachen.
Einzig in diesem seltenen Dialekt schrieb Biagio Marin sein Werk, zahlreiche Gedichtbände und Prosa. „Ich wußte sehr wohl“, sagte Marin, „was es bedeutete, innerhalb solcher Grenzen zu verbleiben […], doch eine innere Notwendigkeit, meine Liebe, ließ mir keine andere Wahl. Ich sollte die Stimme meiner Insel, die Stimme Grados sein, und sonst nichts, auch um den Preis, nicht gelesen zu werden.“ Marins Werk mußte man erst ins Italienische übersetzen, damit es von vielen entdeckt werden konnte. Noch immer gilt er, wie er es vorausgesehen hatte, als Geheimtip, fehlt er oft in der Nomenklatura bedeutender italienischer Autoren. Pasolini dichtete, zumindest in seinem ersten Band, ebenso in einer fast ausgestorbenen Sprache. „Poesie a Casarsa“ schrieb er 1942 auf Friulanisch, einem nur noch mündlich geprochenen Dialekt; hier war seine Mutter geboren worden, lagen seine Wurzeln. Pasolini gab der Einsamkeit und Kargheit des bäuerlichen Friaul seine alphabetische Signatur zurück.
Die Verse Biagio Marins sind einfach, klar, beinahe karg. Die Worte „Deine Augen erzählen / und Abendlicht ist erzeugt / und Frühling leuchtet / und Wolken stehen“ sprechen genaugenommen nicht, denn sie spiegeln nur eine Welt des beredten Schweigens, archaisch, die sich lautlos in einem ewigen Kreislauf dreht, weil sie eigentlich ohne Sprache auskommt, sich ohne Sprache antreibt. Der Grund für diese Zurückhaltung liegt deutlich sichtbar im blaugrün schimmernden Wasser der Lagune, denn „bin ich nach Welt begehrlich / und Summen und Zahlen, / verlier ich den Namen / des Meeres“. Das Gefühl von Ewigkeit taucht im Zusammenhang mit Marins Dichtung unweigerlich auf, aber nicht als Aromagemisch mit Sehnsucht ins Unvergängliche, Dauer wird in ihr nicht als Fluchtersatz vor der Welt mißbraucht. Auch Romantik ist ohnehin nur ein Wort der Städte.
Die Rede der Menschen auf Grado ist naturgemäß langsam, „… ein Flüstern: / ein leises Segeln / vor tonloser Küste“, sie wurde jahrhundertelang eingefärbt von der Landschaft und der Kultur, „ihr Mund ist eine Monstranz […], zu Ende gebracht das letzte Wort / wie nach dem Sommer die Welt.“ Niemand berechnet hier die Zeit und ihr Antipode Ewigkeit am Weggang und am Fortschritt, sondern im steten, dauernden Maß des Lichts. Der Mandelbaum, der blüht, „der hat nicht damals begonnen / und ist nicht von heut: / er gehört einer nackten Zeit / täglicher Sonnen.“
Marins Verse leben wie die Wellen des Meeres von der monotonen Wiederkehr weniger, sich naher Worte, ähnlich einem Gesang, sie scheinen gleichförmig wie die Horizontlinie zu sprechen, an der sich das Meer vom Himmel trennt. Aber unter der Oberfläche liegt „Besessenheit“, wie Pasolini schreibt, die Gedichte nehmen „Züge der Anapher und Litanei an. Das viele Wiederholen ist wahrhaft verrückt.“
Es wäre falsch, vom Mythos einer untergehenden Kultur zu sprechen, denn diese Kultur findet, wie gesagt, ihr Zeitmaß außerhalb jeglicher Chronologie:
Und nichts stirbt
die Welt geht nicht zugrunde:
ein einziger, wirklicher
Gang der Stunden.
Sterben, Vergehen heißt hier nur „Verwandeln / wie Wasser fließt, Wind weht“. In die Dialoge mittelalterlicher Totenreigen, die zwar ein Zwiegespräch mit dem personifizierten Tod gestatten, blieb dennoch deutliche Furcht vor dem leiblichen Ende gemischt. In Marins Gedichten wird der Tod fürsorglich empfangen, „genährt / hat dich mein Tisch, meine Speise. // Verspäte Dich nicht / in dieser Sterbezeit“, er wird bedauert, „du hast kein Wort / das Gute zu erzählen“, und schließlich selbst bei der Hand genommen und geführt, „meine Seele nimm / nimm als Geschenk, / unser Herz schwimmt / in die Dämmerung“.
Marin besitzt, wie er selbst schreibt, den Tod gleichermaßen wie das Helle, eine Verwandlung zu nichts ist ihm unvorstellbar. Seine Verse stehen „im verbleibenden Licht des Archaischen, welches Tau absondert“, das zumindest sagte der italienische Dichter Andrea Zanzotto über ihn, wenige Verse „würden genügen, um die Insel, auf der sie blühen, notwendig zu machen.“ Mehr als zu würdigen ist es darum, daß der österreichische Dichter Peter Waterhouse gemeinsam mit Maria Fehringer und Riccardo Caldura einzelne Gedichtzyklen Marins erstmals ins Deutsche übertrugen.
Bereits 1991, als posthumes Geschenk zu Marins einhundertstem Geburtstag, erschien im Rowohlt Verlag ein inzwischen vergriffener Band mit Auswahlgedichten. Er wurde Ende vergangenen Jahres im Verlag Urs Engeler Editor unter dem leicht abgewandeltem Titel In Memoria – Der Wind der Ewigkeit wird stärker (In memoria – El vento de l’eternno se fa teso) neu aufgelegt. Erweitert um einen Zyklus und einem Nachwort Marins enthält er auch bislang hier unveröffentlichte Aufsätze von Pasolini und Zanzotto. Dieser Band umfaßt, gemessen am Gesamtwerk Biagio Marins, nur Bruchteile alles Geschriebenen, es bleibt also noch genügend Übersetzer- und Verlegerverdienst. „Mehrere tausend Gedichte hat er veröffentlicht, man könnte meinen: für jeden Bewohner der Insel eines, bis zu seinem Tod, vierundneunzigjährig“, schrieb Waterhouse in einem Nachwort. „Zwar gebraucht Marin auch Worte von draußen, aus dem großen Italien, aus den Verhältnissen der Kommunikation, aber dann sind es übersetzte, aus dem großen Italienisch in ein kleines Italienisch übertragene, zurückisolierte, in die Nähe übersetzte und in die Würde, denn die Würde ist winzig; auch sehr leicht, das Leichteste, Licht.“
Cornelia Jentzsch, Basler Zeitung, 12.5.2000 / DeutschlandRadio, 25.8.2000
„an dem oberen Querbalken der Tür“
Biagio Marins Gedichte sind in der Dialektsprache der Adriainsel Grado geschrieben, in der Großmutter- und Muttersprache, in der Nachtigall- und Amselsprache, Rosmarin- und Rosensprache, Bäche- und Wiesensprache, sie sind geschrieben mit sehr nahen Worten, und handnah ist diese Welt. Es sind Gedichte der Physis. „Die Wimper hat Schatten“, aber keine Worte hat diese Sprache für die allgemeineren Ereignisse und Dinge. Zwar gebraucht Marin auch Worte von draußen, aus dem großen Italien, aus den Verhältnissen der Kommunikation, aber dann sind es übersetzte, aus dem großen Italienisch in ein kleines Italienisch übertragene, zurückisolierte, in die Nähe übersetzte und in die Würde, denn die Würde ist winzig; auch sehr leicht, das Leichteste, das Licht. Die Insel ist wohl die lange Zeit seines Lebens Biagio Marins einziger Ort geblieben; in die damals k.u.k. österreichische Schule ist er nach Gorizia/Görz, ins Friaul, gefahren, ein österreichischer Schüler, der seine ersten Gedichte auch in Deutsch geschrieben hat, Philosophie studiert hat er in Wien und Florenz und zuletzt in Rom abgeschlossen, in den Weltkrieg gezogen ist er als Soldat und Arbeit und Einkommen hat er gefunden in verschiedenen Berufen in Triest und wieder auf Grado. Immer war ihm die Insel die Begleiterin, ihre Sprache hat er fortwährend gedichtet, mehrere tausend Gedichte hat er veröffentlicht, man könnte meinen: für jeden Bewohner der Insel eines, bis zu seinem Tod, vierundneunzigjährig, 1985. Alles in den Gedichten ist Reduktion, Bewegung auf den Tod zu; und wie klar spricht der Dialekt diese Reduktion in seinen zahlreichen gekürzten bis elliptischen Wortbildungen; und wie selbstverständlich werden manche Verbformen nur im Singular gebildet; und wie leicht nimmt er die großen Worte in seine Lautung und begrenzte Geltung, das italienische ondeggiamento in ondesamento, momenti in muminti, und ihrem blauen Farbadjektiv biave gestattet diese Sprache wie leicht die abstrakte Endung und verwandelt es in biavità. So daß wir in der Übersetzung schon nach dem immatriellen Reim suchten, nach dem schwebenden Reim (Marin würde sagen: rime in svolo): „in deinen Schritten kommt Abend / die Wimper hat Schatten“. Marins Wortbildungen sind immer Schöpfungen der Nähe, der Mutternähe, Rosmarin- und Wiesennähe; es sind Aufrufe und Erinnerungen; die Sprache benennt und behauptet nicht, sondern erinnert. Warum aber bleibt für diese Sprache ,so vieles‘ nicht ansprechbar und nicht erinnerbar? Warum spricht sie, im Zweifelsfall, nicht die Fremdsprache, die Staats- und Weltsprache, wie es jeder zu tun gezwungen ist? Das geht nicht! Denn die Seele ist ein Hauch! Mit den wenigen hundert Wörtern, auf die Marin schließlich sein Vokabular einschränken kann, schreibt er von der Landschaft, dem Licht, den Sternen, der Lagune, dem Meer, den Bächen, Blumen, Feldern, dem Wind, sinnliche Einzelheiten, Lebendigkeiten, wieder und wieder, nahezu monoton, aber jedes Wort steht im Prozeß der Sublimation, im Prozeß des Leichtwerdens, des Ineinsgehens, also auch des Sterbens. Sublim, sublimis, das heißt: an dem oberen Querbalken der Tür aufgehängt, und schwebend wird das Wort Frühlicht, schwebend wird das Wort Narzissenfeld und das Wort Mandelbaum – es meint nicht, sondern es sublimiert, es geht über sich hinaus, es feiert. Aber Marin vermag nur in der kleinen, kleinsten Sprache zu sublimieren und zu feiern. Die reiche, große Sprache hat nichts zu feiern. (Größe ist unwirklich.) Die kleine Sprache feiert im kreativen Kern, ihre Sublimation führt nicht ins Jenseits, auch nicht in Staat und Welt, sondern ins Zentrum der Lebendigkeit und Kraft. Ihre Weite ist ganz sinnlich klein; klein, flüchtig, physisch, mandelblütenförmig. Die hier zu lesende Erhabenheit ist augenbrauen- und wimpernförmig. (Nicht Zeus’ Augenbraue, sondern die der Dorfbewohnerin.) Ihre Unendlichkeit liegt in der Annäherung an den Wert Null (Grado-Null). Sie macht alles dialektal winzig, fraktal (auch den Himmel) und insulär und konkret da. (Da und Dauer.) Ihre Unendlichkeit liegt im Mineralischen (A-Methystischen), das Dasein ist nicht Rausch, sondern kristallen. Marin spricht und schreibt den Da-Dialekt. Ein Sandkorn ist der erhabene, hohe Himmel; denn es ist so winzig und offen. „Jedes Ding, das ich besitzen will, wird mir undurchsichtig“, lautet der Satz von André Gide. Hier besitzt einer nichts; und kann sehen.
Peter Waterhouse
Der Wind der Ewigkeit wird stärker von Biagio Marin
Wer sich ins Territorium des Übersetzens begibt, unternimmt eine Reise, bei der ihm keine Maßnahmen helfen können, welche er auch getroffen haben mag. Denn die Sprache, die er verläßt, nachdem er sie mühsam erreicht hat, wird zu schwanken beginnen, und die andere, die sogenannte „eigene“, kann auch kein sicherer Hafen sein. „Die Grenzen meiner Sprache“, meinte, Ludwig Wittgenstein, „bedeuten die Grenzen meiner Welt“ – und der Übersetzer, dieser Reisende zwischen den Welten der Sprachen, stößt täglich daran.
Es war eine Inselsprache, die Sprache, in der Biagio Marin siebzig Jahre lang seinen Gesang vortrug. Nicht, daß seine Poesie dem Dialekt von Grado völlig entspräche. Es handelt sich auch nicht um eine Stimme aus dem Volk, und wer sich einen farbigen Lokalkolorit erwartet, der wird sehr bald enttäuscht sein. Einen „Idiolekt“ nennen die Linguisten solche Erscheinungen und meinen damit die Eigentümlichkeit einer Sprache, die eher einem privaten Gebrauch als der pragmatischen Kommunikation zu genügen scheint. Eine Inselsprache, sage ich, und meine damit, daß aus einer Insel, aus einer privaten Bildkonstellation, ein lyrisches Subjekt wird. Es war der Dichter Gottfried Benn, der in einem frühen Gedicht die Absicht aussprach, „ein Ufer, ein Buch, / ein Hafen schöner Schiffe [zu] werden“. Eine Insel zu sein – das heißt etwas ganz anderes als die Sehnsucht nach einer Insel, die uns alle plagt. Eine kosmische Konstruktion wird heraufbeschworen, in der sich das Ich widerspiegeln kann. Grado: eine Welt, ein ganzer Kosmos, in den das Leben und die Sprache des Dichters eingegangen sind. Und keine Grenzen sind dichter als die, die durch das Meer gezogen werden. „Sie haben recht“, schrieb Biagio Marin an Pier Paolo Pasolini am 2. Januar 1953, „wenn Sie […] behaupten, daß die räumlichen Grenzen meiner poetischen Welt auch innere Grenzen sind.“
Eine Übersetzung der Gedichte Biagio Marins soll eine Reise nach Grado sein. Es sind sonore Klänge, die auf weit offenen Vokalen aufbauen. Es ist das Melos des einfachen Vierzeilers, mit seinen immer wiederkehrenden Reimen. Es ist die kristallklare Syntax, die fast keine Nebensätze kennt, eine syntaktisch-metrische Einheit, die nicht zu durchbrechen ist. Es ist ein Vokabular, das vom Licht geprägt ist. Das Licht stellt einen Hauptbegriff dar, der immer wieder metonymisch variiert wird. Es sind kurze, knappe Formulierungen, die das Entbehrliche ganz ausschließen, denn die Wahrheit ist karg. Zwischen Reduktion und Variation steht diese Sprache und verlangt ein aufmerksames Ohr. Einer solchen Textqualität wird die deutsche Übersetzung von Riccardo Caldura, Maria Fehringer und Peter Waterhouse in höchstem Maße gerecht. Keine „Normalisierung“, keine Abrundung der semantischen Ebene wird verfolgt, wie so oft bei Übersetzungen aus einem italienischen Dialekt, und sei es auch in der Nationalsprache. Vor allem ist ein Rhythmus vorhanden, der die cantabilità des Gedichtes gewährleisten soll. Leicht wird mit Reimen gespielt, deren unreine Art an die Virtuosität der Romantiker erinnert. Unbewußt schließen sich diese Nachdichtungen an eine Tradition deutscher Lieder an, die noch im lyrischen Werk Paul Celans nachklingt. Und wie oft arbeiten die Übersetzer mit dem wehmütigen, romantischen deutschen W-Klang! Doch findet in der deutschen Sprache kaum Platz, was von der Last der Rhetorik beschwert ist. Wesentlichkeit ist leicht. Und nicht selten besteht der deutsche Vers aus einem einzigen Wort, das die Prägnanz des Gradeser Ausdrucks wiedergeben muß. So wird „le rogie canta salmi“ mit dem Kompositum „Wasserpsalmen“ übersetzt und „le saduta di menta“ mit „Minzen-Luft“. Lapidar erscheinen solche elliptischen Konstruktionen, zu denen die Übersetzer immer wieder greifen. Die stilistischen Möglichkeiten der modernen deutschen Lyrik, mit ihren zusammengesetzten Wörtern, der Bruchstückhaftigkeit der Verse, der Gebrauch der infiniten Formen des Verbs, erschließen einen ästhetischen Horizont, in dem die Gedichte Biagio Marins in ihrem strahlenden Licht erscheinen. Es sind „Statische Gedichte“, um wieder auf eine Definition von, Gottfried Benn zurückzugreifen, die zur reinen Aufzählung der Naturelemente tendieren:
alles nur Duft
selbst die Steine:
und die leise, leise, verführende Luft.
Freilich war auch diese Arbeit ein Umweg, wie es gute Übersetzungen sein müssen. Denn nichts ist naiver als die Vorstellung einer Nachdichtung, die sich auf die rein semantische Dimension der einzelnen Wörter beschränkt, als bestünde der Sinn des ganzen Gedichtes nicht in der Beziehung der Worte zur metrisch-rhythmischen Form. Ich finde eine Übertragung höchst gelungen, die den Mut hat, „al mondo a fin de zugno“ mit „ins Juniland“ wiederzugeben und „me infuturo“ mit „ich werde neue Welt“. Erstaunt war ich, als ich merkte, daß sich das wunderschöne Spiel der Alliterationen in dem Schlußvers „la vita va via“ in den nicht minder faszinierenden Satz „das Lebendige lichtet“ verwandelt hatte, wobei der Kreuzreim noch beibehalten wurde.
Eine genauere Untersuchung könnte zeigen, daß Marins Grundbegriffe auf Deutsch genauso ein sprachliches System bilden, wie sie es auf Gradesisch tun, wenn auch „im svolo“ – also „im Flieg“ – verblüffenderweise dem „Leichten“ gleichgestellt ist. Manchen Kritikern mag diese Kunst der Verwandlung – worin auch die Kunst der Über-Setzung besteht – zu kühn erscheinen. Aber es ist schön, daß nun auch deutschsprachige Leser die Insel von Biagio Marin besuchen können.
Luigi Reitani
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Brigitte Espenlaub: Gedichte von Biagio Marin
Das Goetheanum, 10.5.1992
Charitas Jenny-Ebeling: „Denn mein Gesang ist aus wenig gemacht“
Neue Zürcher Zeitung, 18.5.1991
Luigi Reitani: Wesentlichkeit ist leicht. Zur ersten Übersetzung der Gedichte Biagio Marins ins Deutsche
ü wie übersetzten. Nr. 8/1991. – Auch in: Zibaldone, Nr. 14/1992
Anton Thuswaldner: In der Sprache der Insel
Salzburger Nachrichten, 13.7.1991
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + KLG
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Peter Waterhouse liest beim Tanz um das goldene Nilpferd am 10.3.2012 im Klagenfurter Ensemble.
Fakten und Vermutungen zum Autor
Biagio Marin in einem außergewöhnlichen Interview über seine Kindheit in Istria.


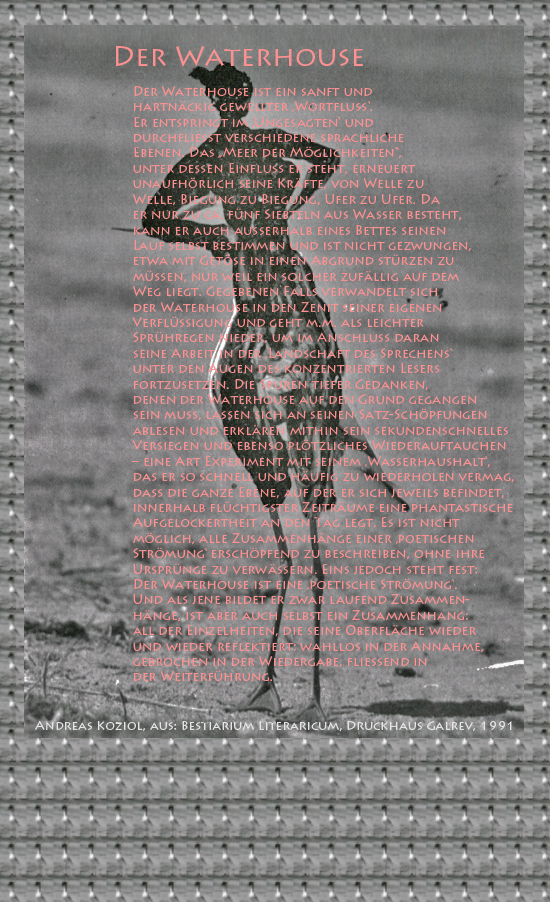













Schreibe einen Kommentar