Laudatio
Ich kenne Albrecht Fabri nicht, bin ihm nie begegnet, habe ihn nie besucht. In der Vergangenheitsform von ihm zu reden, fällt mir schwer. Ich lese ihn, und dabei spricht er im Präsens zu mir, ich kann mich, lesend, besprechen mit ihm; mit ihm als Autor, wohlverstanden, und nicht mit jenem älteren Herrn im grauen Anzug, der er, leicht vornübergebeugt, nach Auskunft seines Nachbarn oder laut Reisepaß ist.
Ist er’s?
Der zu mir spricht, wenn ich seine Sachen lese, ist jedenfalls ein anderer; vielleicht ist’s jedermann; vielleicht bin ich es selbst. Vielleicht auch ist das, was da spricht, genau genommen nichts, und das heißt … nun mit Fabri gesprochen … es ist »nichts anderes als eine Stimme, aus der nicht so sehr er (der Autor), als die Sprache selber redet«. Allerdings bezieht sich dies, im Kontext des Zitats, auf dichterisches Reden, doch gilts für den Autor allgemein, für jenen Autor, den ich im Text … den ich als Text lesen kann und den ich lesend erkenne, auch ohne ihn … in Person, als Person … zu kennen.
Jeder Text, wie jeder Grabspruch auf dem Stein, spricht für den Autor in absentiam.
Hören wir hin auf die Stimme, die hier präsentisch aus den Texten spricht.
Denn die einzige Wahrheit, für die der Autor einstehen kann, einstehen muß, ist die, daß er selbst … nicht als Hervorbringer, sondern als Hervorbringung des Werks … die Wahrheit ist.
Und dazu Fabri, als spräche er nun einfach weiter im Text: »Nicht zwar in dem Sinn, in dem wahr nur das Reale ist, denn eben die Realität ja doch widerspricht ihm. Der Autor, der auf Kongressen erscheint, ist ein anderer als der Autor, der sich als Echo seines Texts definiert.
A propos, kann ein Autor auf Kongressen erscheinen?
Nicht als Autor, möchte ich sagen, nur als die Person des Zivilstandsregisters, die, indem sie den Namen mit ihm teilt, die Quelle aller Verwirrung bildet: als Unterschrift unter einem Text figurierend, bedeutet derselbe Name nämlich ganz etwas anderes: nicht mehr die Person des Zivilstandsregisters, sondern den Autor; das heißt aber: etwas, das nicht weniger Kunstprodukt ist als der Text selbst.
Der Autor als Kunstprodukt?
Das Kunstprodukt des Autors … der Text, das Werk … beginnt mit seinem Namen; oder, noch einmal noch anders gesagt, mit dem ersten Wort des Texts, der zuletzt das Werk ausmacht, beginnt der Autor. Zu leben; und zwar zu leben im Wort, als Werk.
Bevor Fabri für mich zum Autor wurde und also zum Werk … bevor er, in seinem Text, für mich erkennbar wurde als dessen Autor, war er noch nicht einmal ein Name; er war ein Wort wie ein anderes.
Das Wort »Fabri«, Fabri als Wort.
*
An jenem klaren Herbsttag, es war im späten Oktober 1965, als ich den »Roten Faden« am Basler Spalenberg aus einer Bücherkiste zog, fiel mir zu Fabri zunächst mal nur der lateinische faber ein, von dem ich im Gymnasium gelernt hatte, daß er … faber, fabri; masculinum … »ein in harten Stoffen arbeitender Handwerker« sei, und ich erinnerte mich auch an die sprichwörtlich gewordene Wendung des Horaz, wonach tractant fabrilia fabri; etc.
»Der rote Faden«, Essays über Kunst und Literatur, erschienen … ohne Jahr … als Band einhundertneunzehn der List-Bücherei in München; das erste Buch von Albrecht Fabri, das ich zu lesen bekam, ein Zufallsfund unter allerlei gedrucktem Schund und folgenreich wie alle … wie die meisten Zufallsfunde.
Als zugelaufene Hunde hat, wenn ich nicht irre, Danilo Kiš einst die Bücher bezeichnet, die man eigentlich nicht sucht, die man nie gesucht hat, von denen man vielmehr aufgestöbert, gefunden wird. Für mich war »Der rote Faden« damals eine Entdeckung, noch im Stehen … ich sah mich im Schaufenster als schmale Schattengestalt gespiegelt … begann ich zu lesen. Fast so etwas wie eine Erleuchtung muß von dem unscheinbaren Büchlein ausgegangen sein, das ich, unterwegs zur Universität, bei Heiner Koechlin, Anarchist und Antiquar, für fünfzig Rappen dann auch kaufte; als Neupreis war eine Mark neunzig und der Vermerk »… in jeder guten Buchhandlung …« aufgedruckt.
Einhunderteinundsiebzig Seiten, Nachwort des Verfassers inclusive, eine Sammlung, ein Sammelsurium von kleinen Schriften und kurzen Reden, Minima aesthetica mit maximalistischem Anspruch, oft auch mit moralischem Appeal und polemischer Spitze. Nicht eigentlich also ein Buch in monographischem Verständnis, keine summa, vielmehr ein heterogener Strauß von Gelegenheitsarbeiten über Diverses, mehr oder minder chronologisch gebündelt von 1946 bis 1953, Arbeiten, deren präzise Vorläufigkeit und provokante Offenheit durch die Textsorten vorgegeben, auch beglaubigt waren, die Fabris Anlässen, Fabris Intentionen am besten entsprachen. Nämlich Notizen, Scholien, Aperçus, Entwürfe, Paradoxa, Digressionen, Exkurse, Variationen, Rezensionen, Präliminarien, fiktive Dialoge oder einfach »Sätze« und »Gedanken« … über Gott und die Welt, Kunst und Natur, Sprache und Wirklichkeit, über Allgemeinstes mithin, aber nicht, wie üblich, über Allgemeinstes apodiktisch, dabei nebulös oder erhaben sich verbreitend, sondern den Dämon stets im Detail suchend, ihn dingfest machend in einem unbedacht gesetzten Adjektiv, in einer schiefen syntaktischen Konstruktion, in einem verpatzten Pinselhieb, in einer allzu gefälligen, nämlich billigen, weil bloß perfekten Metaphernbildung.
*
Ebenso vielfältig wie die von Fabri eingesetzten Textsorten sind … non multum sed multa … seine Themen und Probleme, sind die Anlässe, die faits divers, aus denen die Gestik seines Schreibens, sein Personalstil, den Initialimpuls gewinnt und von denen her sie sich wohin auch immer entfaltet, nicht selten über den jeweils vorgegebenen Gegenstand hinaus, oft dezidiert von ihm fort, nämlich expandierend ins Eigene. »Denn was lohnt an einem Thema, ist nicht das Thema, vielmehr das, wozu man es bewegt.«
Albrecht Fabris Eigenart, so könnte man vielleicht sagen, ist der Eigensinn, mit dem er an den Dingen … statt auf sie einzugehen … vorbeiredet, sich abstößt von ihnen, um immer wieder, in exakt kalkulierten Sprüngen, bei den paar wenigen Fragen zu landen, auf die es ihm besonders ankommt, die ihn dazu bewegen, die Fragen eben als Fragen zu verstehen und als Fragen sie immer wieder neu zu formulieren. Statt einleuchtende Antworten, Lösungen oder gar Wahrheiten anzubieten, ist Fabri, als der Fragende, bemüht, was weithin klar und wahr zu sein scheint, in seiner Fragwürdigkeit herauszustellen.
Mag sein, daß Fabri gerade aus diesem Grund so selten zitiert wird. Denn im Unterschied zu Meinungen und Wahrheiten sind Fragen als Zitate nicht gefragt; Fragen wie diese: »Einen Drachen kapieren zum Beispiel?« – »Eisberge haben Kontur, aber Getreidefelder, Wiesen?« – »Wo überhaupt genau verliefe die Grenze zwischen uns und den Dingen?« – »Ist eine schlechte Seite nicht immer eine solche, die man ungeduldig oder schielend geschrieben: den Blick nicht auf ihr, sondern woanders? nicht die Mittel bedenkend, sondern den Effekt?« – Oder einfach: »Nötig?«
Der rote Faden, der Fabris »Roten Faden« durchzieht, ist die Frage nach dem Sprachlichen der Sprache, ergo dem Poetischen; die Frage nach der Bildlichkeit des Bilds, nach der Künstlichkeit von Kunst, nach der Autorität des Autors, auch nach der Identität des Werks, das durch den Autor seine Struktur, Gestalt gewinnt, ohne jedoch dessen individuelle Schöpfung ex nihilo zu sein. Durch vielerlei Ösen und Öhre verläuft dieser reißfeste Leitfaden, und so, in seinem mäandrischen Verlauf, verschlauft er … keineswegs logisch, auch chronologisch nicht … manche Namen und Werke und Tage, die damals … wie sagt man so gern? … die damals »aktuell« waren, die aber längst wieder vergessen sind, vorbei. Anlässe und Steingärten; diese bleiben, sie blühen vielleicht mal in der Nacht, jene ändern sich, schwinden.
Tut nichts zur Sache.
Denn keineswegs auf die Anlaufstellen des roten Fadens kam es … kommt es Fabri an, sondern auf die argumentativen Bifurkationen, zu denen ihn dieser oder jener Text, dieses oder jenes Bild verleitet; und er liebt es zu irren, nomadisch: »Irrt, wer zwar geht, aber nirgendwohin. Das Irren dessen, der nur abkommt vom Weg, ist demgegenüber akzidentell und reparabel, denn für ihn gibt es Wege und Orte: für den, der im Irrtum lebt, nicht.«
Fabris Denk-, seine Schreibbewegung ist die des Rhizoms, sie progrediert nicht linear, sie expandiert diskontinuierlich, lebt sich aus, wie es gerade kommt und geht, sie führt, immer der Luftwurzel folgend, ins Extreme, und das heißt … sie führt zurück, zurück aufs Einfache, zum Elementaren, gelegentlich ins Leere, Wie übrigens jede Wurzel, radix.
Und darin eben besteht Fabris Radikalität … daß er zurückgeht zu den Dingen selbst und zu den Wörtern als solchen, wo andere es bloß auf deren Nutzen oder Sinn abgesehen haben. Das Gewöhnliche … das, was nicht der Rede wert ist, weil alle es zu kennen glauben … ist für Fabri das Faszinosum; dazu gehört der Stein genauso wie das Verb, die Kaltnadel, der Gehstock, der Gedankenstrich.
*
Ja … seinem Namen wird Fabri durchaus gerecht; sein spezielles, sein bisweilen stures Interesse gilt weder dem Autor, dem Künstler als Person, noch dem Werk als Produkt, es gilt vielmehr der Entstehung, der Verfertigung, das heißt der »Fabrikation« von Texten, Bildern, Skulpturen, von Gebrauchsgegenständen. Fabrica bezeichnet die Werkstatt, aber auch das Handwerk, den Kunstgriff der homines fabri, und unter fabricatio … zu fabrico und fabricor … ist jede künstliche beziehungsweise kunstfertige Gestaltung zu verstehen, nicht zuletzt auch Kunst schlechthin, etwa fabricatio in verbis, als Wortkunst.
Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Valéry, und immer wieder Benn als deren später Apologet in der luftarmen Deutschlandhalle sind Fabris Referenzautoren, auf sie bezieht er sich gern und oft, sei’s indem er sie mit elementaren poetologischen Kernsätzen zitiert, sei’s daß er solche Kernsätze variiert, sie assoziativ weiterdenkt, polemisch sie zuspitzt oder mit strengem Witz sie ad absurdum führt, um sie … wie beispielsweise Mallarmés dictum, wonach Gedichte nicht aus Ideen, sondern aus Wörtern gemacht seien … endlich als wahr auszuweisen.
Aber zur Sache.
Fabris Texte lassen sich nicht resümieren, auch ist über sie nicht viel gesagt, wenn man ihren Schluß, das worauf sie hinauslaufen, festhält; was sie sagen, ist ebenso wichtig wie die Art und Weise des Sagens, die Bewegung, die Begegnung, die Verzweigung der Sätze, die Intonation, die rhythmischen Verläufe; es sind ja ursprünglich, zu einem guten Teil, gesprochene … zu sprechende Texte, die Fabri niederschreibt, Texte, die vom Hörer, vom Leser fortzuführen, in ein Eigenes zu übersetzen sind.
Wer aber Fabri heute liest, sollte … um die Bedeutung seiner Arbeit damals zu ermessen … die zeitgeschichtlichen Umstände und den literarischen Kontext der unmittelbaren Nachkriegsjahre bis in die späten Fünfziger sich vergegenwärtigen.
*
Entnazifizierung; Währungsreform; Wiederaufbau; Wiederbewaffnung; Aufrüstung der deutschen Literatur nach dem sogenannten Kahlschlag. Maßgebende, primär vergangenheitsbezogene Anthologien wie »De profundis«; »Ergriffenes Dasein« oder »Ewiger Vorrat deutscher Poesie«, dann aber doch auch schon »Transit« und »Movens«. Vormachtstellung via Publikumserfolg von älteren Autoren wie Zuckmayer, Schaper, Bergengruen, Kreuder, Goes, im Osten Deutschlands Brecht und Becher und Konsorten; sehr jung damals noch das Literaten-Trio Enzensberger-Walser-Grass, nicht mehr ganz so jung und also wohl im besten Alter waren Krolow, Nossack, Nonnenmann, Schnurre, Böll, Eich, die Kaschnitz, die Domin und viele andere mehr.
Bei Fabri kommen sie, alle, nicht vor, ebenso wenig wie Paul Celan, Ernst Meister, Ilse Aichinger; und ebenso wenig, wie Fabri … er ist vom Jahrgang neunzehnhundertelf … sich um die literarischen Bemühungen seiner Zeit-, seiner Altersgenossen bemüht zu haben scheint, hat er sich um die universitäre Nachkriegsgermanistik … Martini, Emrich, Staiger, Muschg, von Wiese, Trunz … und die damalige Großkritik, von Sieburg bis Holthusen, gekümmert. Souverän, in kleinsten Schritten und mit minimalem rhetorischem Aufwand, entwarf er so etwas wie eine Universalpoetik, kein Lehrgebäude zwar, eine Art Netzplan vielmehr, einen offenen Grundriß, den er aber wohl eher als Spielvorlage denn als Bauplan verstanden wissen wollte.
Dem doktrinären Pathos der deutschen Literaturverwaiser setzte Fabri, unüberhörbar, ja lästig wie eine Zikade im Spalt am Rand des Parketts, seinen immer gleichen, monoton sägenden Kammerton entgegen; er war, neben Hennecke, Henniger, Hölzer, dann Heissenbüttel, auch Bense und Kurt Leonhard, der, der am eindringlichsten … nicht nur monoton, sondern fast schon als Monoman wie manch ein Liebender, amateur … das Selbstverständliche vortrug, es wiederholte, es wieder und wieder hervorholte aus den Schriften von Mallarmé und Valéry, aus Briefen von Rimbaud, Flaubert, aus zufällig überlieferten jeux de mots und mots d’esprit von Montaigne, Rivarol, Novalis bis hin zu T.S. Eliot und dem noblen Querdenker Alain und vielen andern noch, die anders von sprachlichen, von literarischen, von künstlerischen Dingen handelten, als es deutscher Gepflogenheit gemeinhin und noch heute entspricht.
Auffallend ist demgegenüber, daß Fabri auch jene paar wenigen Autoren … namentlich Benjamin, Kracauer, Bloch … mit konsequentem Schweigen übergeht, die in Deutschland, zwischen den Kriegen, jenes marginale Terrain präpariert hatten, das er selbst, eine Generation später, als Grund und Boden für die Errichtung seines Elfenbeinturms nutzen konnte; auffallend auch, daß er sich an keiner Stelle auf die Arbeiten der russischen Formalisten und der tschechischen Frühstrukturalisten bezieht, deren theoretische Positionen er durchaus, wie der Franzose sagen würde, hätte »heiraten« können.
Aber oft ist das, was man, instinktiv oder bewußt, von sich fernhält, für das eigene Denken weit anregender als die offenen Quellen, aus denen man schöpft und die man, gewissermassen, für sich sprudeln … für sich sprechen läßt.
Seine Aufgabe scheint Fabri, bescheiden und anspruchsvoll zugleich, darin gesehen zu haben, jene andere Weise oder Weisheit des Redens über Kunst und Dichtung durchzusetzen, die germanischem Gemüt so fremd ist, weil sie, statt im Ungefähren zu schwelgen und bevorzugt sich bei Wahrheiten, bei Gehalten aufzuhalten, das Wahre namhaft macht in dem, was schwarz auf weiß, Sprachliches schriftlich, oder als ein Grün, ein Gelb, ein Grau, zum Beispiel Öl auf Leinwand, schlicht gegeben und also wahrzunehmen, das heißt diesseits der Bedeutungs-, der Darstellungsebene zu verstehen ist.
Und aber letztlich … Fabri weiß es und akzeptiert es auch … kann das Verstehen seinen Grund wie sein Ziel allein im Unverständlichen haben; wohingegen alles mit Bedeutungs-, mit Verbindlichkeitsanspruch sich Mitteilende, alles bedeutsam Mitgeteilte generell, wenn es ankommt bei uns, immer schon verständlich, immer schon verstanden ist und folglich keiner individuellen Verstehensleistung, sondern ganz im Gegenteil der intellektuellen und sinnlichen Unbedarftheit eines möglichst breiten Publikums bedarf.
*
Wenn Fabri für den schwierigen Autor, für den opaken Text plädiert, ist dies auch und nicht zuletzt ein Plädoyer, eine Respektbezeugung, ein Vertrauensbeweis an die Adresse des einzelnen Lesers … des Lesers nicht als Publikum, vielmehr des Lesers als Person, und von dem er sich vorstellt, sich wohl auch wünscht, daß er vom Gelesenen sich durchklingen, sich bewegen lasse zu etwas, zu einem Verständnis eben, das ihm nicht vom Autor nahegelegt oder aufgedrängt wird, zu dem er, auf Umwegen vielleicht und dem Autor zuwiderdenkend, von sich aus gelangt.
Doch solcher Eigenwille geht dem kollektiven Leser, der als Publikum umworben wird, weitgehend ab, und er fehlt vor allem auch den kritisch mit Literatur, mit Kunst Befaßten, den Journalisten, Rezensenten, die mit den großen Gesten von Kommunalpolitikern, Naturschützern oder Fleischhackern Autoren belobigen und Autoren aburteilen … je nachdem, ob deren Texte ihnen »verständlich« oder »nicht verständlich« sind; ob sie ihren Erwartungen entsprechen oder nicht entsprechen können.
Verständlichkeit wird honoriert, weil sie dem Leser, dem Kritiker die Schwierigkeit des Verstehens erspart und weil dann Sätze, Einschätzungen möglich sind wie diese … ich habe sie mir, heute beim Frühstück, aus vier verschiedenen Besprechungen in der Rubrik Neue Bücher notiert: »… ein flüssig zu lesendes Zeitgemälde«; »… es gibt Passagen, die hervorragend formuliert sind«; »… der Autor kann seine Figuren gut beschreiben und hat uns viel Bedenkenswertes zu sagen …«; oder ex negativo: »… der Autor führt seine Leser schlicht am Nasenring herum …«
Exzerpte aus dem Feuilleton einer angesehenen deutschsprachigen Tageszeitung mit internationaler Verbreitung … Exzerpte, deren stilistische und analytische Qualität dem guten Durchschnitt gegenwärtiger Literaturkritik entspricht, die aber implizit auch deutlich machen, daß Texte in aller Regel nicht von ihren eigenen Prämissen und Ansprüchen her besprochen werden, sondern ausgehend von diffusen Publikumserwartungen, welche der Kritiker, zum Sprecher der lesenden Mehrheit avanciert, sich kurzerhand zueigen macht.
»Kritik ist aber doch nicht«, so heißt es in Fabris Notizen zu einer Theorie der Kritik von 1951, »Ausdruck von Vorlieben und Abneigungen, sondern Meßkunst eines Gegenstandes an ihm selbst.« Und weiter im Text: »Der einzige Weg für eine Kritik, in bezug auf ihren Gegenstand recht zu haben, ist der, in sich selber recht zu haben.« Wie wahr, wie elementar; doch das Selbstverständliche kann nicht oft genug wiederholt werden.
Fabri tut’s. Und ich möchte ihn, da seine dezidiert-diskrete Lektion jahrzehntelang überhört, ja mißachtet worden ist, in und aus seinen frühen Texten ein wenig noch sprechen lassen, und dies … indem ich nachfolgend ein paar von jenen Sätzen zitiere, die ich 1965 bei der ersten Lektüre von Fabris Reden und Notaten unterstrichen hatte; sie haben Geltung noch jetzt, jetzt wieder.
*
»Am schlechtesten schreiben allemal die, die meinen, daß sie etwas zu sagen haben. Der Grund? Sie sind nicht bei der Sache. Die Sache nämlich ist das Wort, die Sprache, nichts sonst.« Nichts sonst … das ist der Doppelschlag, mit dem Fabri das Selbstverständliche noch einmal akzentuiert, die negative Verallgemeinerung wird hier zum Ausdruck seiner Radikalität. Aber noch eine Selbstverständlichkeit: »Schreiben, nicht um einen Gedanken auszudrücken, den man hat, sondern um dem Gedanken, den man nicht hat, auf die Spur zu kommen …« Und, entsprechend, in einem Dialog zwischen Kopf und Herz die rhetorische Frage des Autors, der hier als Moderator fungiert: »Kann man auch nur einen Satz schreiben, ohne daß sich ein Gefälle ergibt, dem man folgen muß?« Der Kopf, mit dem Herzen im Widerstreit, meint: »… immer aber noch hat sich gezeigt, daß der Einbruch des Gefühls in die Sprache gleichbedeutend mit syntaktischem Zerfall ist.«
Oder, beiläufig, in einer Notiz über Edgar Allan Poe: »Es gehört zum Wesen des Gedichtes, nicht gemacht zu erscheinen, sondern als ob die Sprache von selbst sich zum Vers gefügt hätte.«
Und, kontextfrei zitiert, ein wunderlicher, fast schon poetischer Satz wie dieser: »Der Wert der Pythia ist eine Funktion der blauen Schürze.« Ob das ein Vers ist? eine Definition? eine Behauptung? ein Witz? Der Satz jedenfalls, wie er dasteht, sitzt. Und noch so ein Satz, der, weil er etwas Allgemeines exakt auf den Punkt bringt, souverän für sich steht und zugleich, zwischen andern Sätzen, sitzend sich behauptet: »Der Name dessen in uns, das findet, heißt Müdigkeit.« Dazu ein paar Sätze noch über Sätze; über das Denken des Schriftstellers als sprachliches Handeln: »Ein Schriftsteller, der Gedanken hat, ist keiner; was man den Gedanken des Schriftstellers nennt, ist ein reines Nebenprodukt … Der Gedanke ist nämlich eine Funktion des den Gedanken ausdrückenden Satzes, nicht umgekehrt; er steht nicht als dessen Ausgangspunkt am Anfang, sondern als dessen Resultat am Ende.«
Also Schluß.
*
Aber von Fabri gibt es nicht bloß den »Roten Faden«; die unter diesem Titel gesammelten Texte entstammen zwei früher erschienenen Broschüren … »Der schmutzige Daumen«, neunzehnhundertachtundvierzig, und »Interview mit Sisyphos«, neunzehnhundertzweiundfünfzig. Und neunzehnhundertneunundfünfzig, bald nach dem »Roten Faden«; brachte Fabri seine »Variationen« heraus, bei Limes in Wiesbaden, einen schmalen Band in schwarzem Leinen, den ich mir freilich erst Jahre später für vierzehn Franken fünfundsiebzig, gar nicht billig für die damaligen Verhältnisse, bei Werthmüller in Basel besorgte …
… den ich aber nur ansatz-, auszugsweise las; ich brach die Lektüre ab, als mir plötzlich klar wurde, daß all diese Texte, all diese Sätze Sätze und Texte waren, die eigentlich ich hätte schreiben wollen. Es kam mir vor, als würde ich von Fabri zitiert … zitiert aber aus Arbeiten, die es von mir zu der Zeit noch gar nicht gab.
Die Fabri-Lektüre wurde für mich zur intellektuellen Bedrohung, ich … damals Anfang zwanzig, Student der Kunstgeschichte und Germanistik … fühlte mich von Satz zu Satz ertappt, sogar verraten, immer wieder überrascht und behindert in meinen eigenen Schreibversuchen. Und also mußte ich diesen Autor, um selbst einer zu werden, verdrängen und vergessen.
Kurz. Für nahezu dreißig Jahre gab es in der Folge keinen Fabri mehr für meinen Gebrauch, und soweit ich’s weiß, hat er nach den »Variationen« auch kaum noch Neues veröffentlicht; sein Lebenswerk scheint nicht viel mehr als zweihundert Druckseiten zu umfassen, lauter Texte ad hoc, die allerdings über ihren jeweiligen Vorwurf hinaus lesenswert, bemerkenswert und mehr als dies … nämlich unverzichtbar geblieben sind.
Der desolate Zustand des Literatur- und Kunstbetriebs heute, in Deutschland und anderswo auch, wäre Grund genug, um auf Fabri zurückzukommen.
Aber wie?
Vor mehr als zwanzig Jahren hat der luzide rheinländische Lateiner sich von der Öffentlichkeit verabschiedet; womit er sich seither beschäftigt, ob er weitergeschrieben, wovon er gelebt hat, ist mir unbekannt. Ich könnte ihn mir als jenen anarchistischen Bankier vorstellen, der unter vielen verschiedenen Namen und … aber in stets demselben Straßenanzug ohne Hast, festina lente, zwischen seinem Bürohochhaus und seinem Elfenbeinturm grenzgängerisch sich hin- und herbewegt.
Wie dem auch sei.
Ich selbst bin erst vor wenigen Wochen auf Albrecht Fabri zurückgekommen, als ich in der Bibliothek des Berliner Druckers und Verlegers Rainer Pretzell ganz zufällig, genau auf meiner Augenhöhe, seine Bücher unversehens wieder vor mir hatte, von denen ich vor Zeiten ausgegangen war und die für mich … ich sehe es beim Wiederlesen … kein Ende haben.
Nicht also zu Fabri zurück … wir sollten mit Fabri weitermachen. Aber Fabri braucht keine Fürsprache; durch seine Texte spricht er vernehmlich selbst. Und er kommt, indem wir ihn lesen, zu uns … zu sich. Zu wem sonst?
Denn der Autor sind wir, nämlich alle; weil allein ist kein Autor.
Und der Hof bleibt offen. [Vgl. neuerdings Albrecht Fabri, Divertimenti (Ausgewählte Texte aus fünf Jahrzehnten), Parerga Verlag, Düsseldorf 1996.
aus: Felix Philipp Ingold: Freie Hand
Ein Vademecum durch kritische, poetische und private Wälder


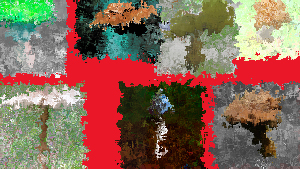






Schreibe einen Kommentar