Hans Magnus Enzensberger: Die Furie des Verschwindens
SPRECHSTUNDE
Wissen Sie, Herr Doktor,
früher war ich verrückt nach ihr.
Was hab ich nicht alles getan,
ihr zuliebe. Hier
ist mein Krankenschein. Mit der Zeit
hab ich dann eingesehn,
daß ich der Dumme war.
Nie wollte sie sich festlegen.
Monatelang la vie en rose, und dann,
auf einmal, Heulen und Zähneknirschen.
Alles Theater, sagte ich mir.
Sie will mir nur Angst einjagen
mit ihren Grimassen. Übrigens,
die Tabletten habe ich weggeschmissen.
Ganz zu schweigen von ihren Launen.
Immer war sie unpünktlich!
Aber bei all ihren Fehlern, Herr Doktor,
ich hatte viel für sie übrig.
Mein Appetit ist wieder normal.
Natürlich, unentbehrlich ist niemand.
Es wird auch ohne sie gehen.
Doch seitdem sie fort ist, verschwunden,
einfach abhandengekommen,
ehrlich gesagt, Herr Doktor,
seitdem fehlt mir was.
Sie werden lachen:
Ich denke gern an die Zukunft zurück.
Die Gedichte in diesem Buch
sind fast alle in den letzten zwei Jahren entstanden. An den Anfang hat der Autor, unter dem Titel „Tränen der Dankbarkeit“, eine Reihe von Idyllen gestellt. Hier sind Momentaufnahmen aus den siebziger Jahren zu besichtigen, Berichte aus dem Inneren des Landes und seiner Bewohner. Ihr Ton ist ratlos, heiter, kurz angebunden, zuweilen sarkastisch; Rechthaberei ist ihnen fremd. Das letzte Kapitel des Bandes dagegen – „Die Furie des Verschwindens“ – besteht aus Wach- und Schlafträumen, Meditationen und Geisterbildern, die sich einer thematischen Festlegung entziehen.
In der Mitte des Buches steht ein langer Psalm, „Die Frösche von Bikini“. Dieses Gedicht bildet das Rückgrat der Sammlung. Man kann es als den Versuch einer Abrechnung lesen. Der Text ist unruhig, brüchig, voller Abweichungen. Rücksicht auf das literarisch und ideologisch Abgemachte wird ebensowenig genommen wie auf das schreibende Ich. Heftige Gefühle und ausschweifende Gedanken – aber die Vermittlung zwischen Geschichte, Natur und Subjekt kann nicht mehr gelingen. Vielleicht ist mit solchen Auskünften schon zuviel gesagt. Um das Gedicht zu verstehen, braucht niemand seine theoretischen Implikationen zu entziffern; ebenso wenig wie der Leser zu wissen braucht, was eine Furie ist; nämlich, mit den Worten eines verstaubten Buches, „ein rächender Geist, der schon bei den ältesten Dichtern vorkommt, und der bald in unbestimmter Mehrheit, bald in der Einzahl erscheint. Die Furien rächen und strafen den Meineid, den Mord, die Vergewaltigung der Natur und tragen überhaupt dafür Sorge, daß Niemand seine Grenzen überschreite; sie gehen zu Werke, indem sie den Sinn des Schuldigen verwirren; übrigens gehören sie der Unterwelt an, womit auch die Fortdauer ihrer Rache nach dem Tode zusammenhängt“.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1980
Die Furie des Verschwindens
– Zu Hans Magnus Enzensbergers Poetik. –
Die Zeitungsmeldung mit der Nachricht, Hans Magnus Enzensberger werde den Literaturpreis der Stadt Köln erhalten, charakterisierte den Preisträger mit einem einzigen Satz:
Der 55 Jahre alte Lyriker, Essayist, Dramatiker und Hörspielautor verdankt seine Bedeutung vor allem seinen Gedichtbänden verteidigung der wölfe, landessprache und blindenschrift.
Kein Titel also aus den letzten zwanzig Jahren erwähnt, nur jene Werke, die den jungen Enzensberger zum „Klassiker für ein Jahrzehnt“ (Alexander Hildebrand) gemacht hatten.
Haben wir es mit einem Fall von Nachruhm zu Lebzeiten zu tun? Erinnerung an einen widerspenstigen Autor, der, wie kein anderer in Deutschland nach dem Kriege, den Begriff der literarischen Intelligenz verkörperte: historisch bewußt, international orientiert, zugleich von beständiger politischer Präsenz? Zeigt dieser Nachruhm die sublime Rache der literarischen Öffentlichkeit an, die nun über die zwei Jahrzehnte, in denen sie die notorische „Leichtfertigkeit“ Enzensbergers, seinen „Wankelmut“ zu beklagen hatte, wortlos hinweg- und zurückschreitet?
Das „linke Establishment“ jedenfalls, so liest man heute, habe „über Enzensberger eine wirksame Strafe verhängt: es schweigt ihn tot“ (Werner Ross). Darin zeigt sich eine Konsequenz, zu der immerhin einst das rechte Establishment, als es seinerseits dafür gute Motive gehabt hätte, nicht gefunden hat. Übrigens leitet ein Artikel über das „Ende der Konsequenz“ Enzensbergers letzten Essayband, Politische Brosamen ein. Nach dessen Erscheinen beklagte der Autor, es sei „schade, daß sich niemand damit auseinandersetzt“.
Ist also die „Furie des Verschwindens“ über dieses Werk gekommen?
Sie sieht zu…
sieht einfach zu, mit ihrem Gesicht,
das nichts sieht; nichtssagend,
kein Sterbenswort;
denkt sich ihr Teil;…
Verhielte es sich so, dann wäre das Wechselverhältnis von Poetik und Zeitbewußtsein stillgestellt. Wir hätten dann ein gleichgültiges Gegenüber von Selbstgewißheiten zu konstatieren, die allenfalls gelegentlich durch politische Gestikulationen aufeinander aufmerksam machen. Dann verschlüge es auch nichts, wenn wir uns bei der Aufregung darüber beruhigten, daß Enzensberger dem Mißverständnis über den Tod der Literatur Vorschub geleistet und wenig später wieder Gedichte veröffentlicht hat.
Dann dürften wir uns mit den vorläufigen Zurechtlegungen bescheiden, wonach Enzensberger einfach mit jedem und allem, und also auch mit Poetik und Zeitbewußtsein, das Spiel „Hase und Igel“ spielt.
So verhält es sich aber nicht. Im folgenden soll gezeigt werden, daß nicht sosehr in der Vorwitzigkeit als vielmehr in der Zurücknahme Beweggrund und Bewegung dieses Werks zu sehen sind. Die „Furie des Verschwindens“ ist nicht nachträglich über es gekommen (womöglich gar, um das Exempel zu statuieren, wie es mit einem enden muß, der das Spiel zu weit treibt). Die „Furie des Verschwindens“ ist von Anfang an in diesem Werk anwesend;
… und sie erscheint
nicht fürchterlich; sie erscheint nicht;
ausdruckslos; sie ist gekommen;
ist immer schon da; vor uns
denkt sie; bleibt;
ohne die Hand auszustrecken
nach dem oder jenem,
fällt ihr, was zunächst unmerklich,
dann schnell, rasend schnell fällt, zu;
sie allein bleibt, ruhig,
die Furie des Verschwindens.
Der Formenkreis des Verschwindens – Eskapismus, Schweigen, Widerruf, Regression, der tägliche „kleine Verrat“: an Enzensbergers Werk ist das ebenso zu studieren wie an seiner Person. Zitate aus einem der jüngsten Porträts (von Ulrich Greiner):
Er ist kein Mann, der es lange an einem Ort aushielte. Er lebte in Kuba und in Moskau, hauste auf einer Insel im Oslo-Fjord und wohnte in Rom, war in Nordamerika und in Mexico, in Australien und Vietnam. Auch jetzt noch liebt er den Wechsel… – Literarisch ist er ebenfalls ruhelos. Er schreibt Gedichte, eine hochgerühmte, erfolgreiche und epigonenbildende Lyrik; er schrieb einen Roman, ein Libretto, ein Drehbuch; er schreibt Theaterstücke, Hörspiele, Essays, Polemiken, Pamphlete, nahezu alle Gattungen scheint er zu beherrschen; er war der Kommentator und Agitator der Studentenbewegung, der scharfzüngige Widersacher der Adenauer-Ära, er ist der unleidliche Kritiker linker Tabus und Bequemlichkeiten, unermüdlich mischt er sich ein, mischt mit, mischt dagegen und verschwindet ebenso schnell wie er kam. … – Der Lyriker Johannes Bobrowski charakterisierte ihn unfreundlich: „Heute am Nordkap und morgen auf Delos, dem russischen Bären / sink ich ans Herz, und wohin sink ich dem Lama Perus? / – Dichte ich nach (aus siebzehn der unverständlichsten Sprachen) / oder dichte ich vor, überall bin ich at first.“ 1961, Enzensberger war 32 Jahre alt und schon berühmt, schrieb der damalige Freund Martin Walser über ihn: „Enzensberger kann sich offensichtlich nicht einrichten. Er verläßt einen Ort um den anderen, kein Wunder, daß er von jedem Gewitter auf offenem Feld getroffen wird.“ – Ja, so ist es: Enzensberger sucht immer das Gewitter, aber bevor der Blitz ihn treffen könnte, ist er auf und davon.
Derlei Befunde ließen sich mühelos vermehren: Eklatante Widersprüche und unerwartete Wandlungen; vor allem aber eine auffällige Vorläufigkeit im doppelten Wortsinn: Enzensberger besetzte immer wieder Positionen, „lange bevor andere darauf kamen, daß sie besetzt werden mußten“; und er hat sie immer schon verlassen, wenn die anderen darin da sind. Christian Linder 1975: „er ist nie operativ geworden mit dem, was er sagt und meint. Das ist alles gut geschrieben und beschrieben, aber dann läßt er alles gesagt sein…“ — „Er tut nie etwas ganz“. Peter Weiss 1978 in seinem Notizbuch: „man weiß nie, wo man ihn hat, aber das ist eben seine Stärke, daß niemand ihn kennt.“ Volker von Törne 1980: „wenn es ernst wurde, (hat er sich) stets aus dem Staub gemacht.“
Enzensberger, hierzu befragt, antwortet „da hat er recht“. Und an anderer Stelle, aber im selben Zusammenhang:
Ich bin ganz gern asynchron, das gebe ich zu.
Somit befinden wir uns an der Stelle, wo zwei naheliegende Möglichkeiten zu verwerfen sind. Weder sollten wir uns an der entfalteten Diskussion über Enzensbergers Charakter beteiligen (es dürfte hierzulande keinen zweiten Gegenwartsautor geben, der das moralische Urteil der Kritik im selben Maße provoziert hat). Noch aber sollten wir aus der Not, zwischen dem Spieler, dem Narren und dem Zyniker Enzensberger nicht entscheiden zu können, eine Tugend machen, und uns allein auf das Werk, auf das einzelne poetische Gebilde gar, konzentrieren. Gerade für die letztgenannte Möglichkeit ließe sich zwar Enzensberger als Gewährsmann vielfach zitieren; aber natürlich auch für das Gegenteil. „Um einen Intellektuellen zu beurteilen, genügt es nicht, seine Gedanken zu prüfen: was den Ausschlag gibt, ist die Beziehung zwischen dem, was er denkt, und dem, was er tut.“ (Womit Enzensberger wiederum Régis Debray zitiert.)
Auch der engere Bereich dessen, was unser Thema bezeichnet: Poetik, ist von diesem Widerspruch betroffen. Enzensbergers Rede über die Entstehung eines Gedichts – sein zugleich persönlichster und sachlichster Beitrag zur Poetik – beginnt mit der Feststellung, er habe „nichts Neues zu sagen“; und er endet:
Ich habe Ihnen versprochen, Ihnen meine Auffassung vom Wesen der Dichtkunst zu ersparen. Dabei möchte ich bleiben…
Es ist höchst bezeichnend, daß Enzensberger nicht nur die Frage offenläßt, „was ein Gedicht eigentlich ist, ob es sich bei dem vorgezeigten Text überhaupt um ein Gedicht handelt“ – eine Frage, die ausdrücklich „nicht der Autor“ zu beantworten hat –; sondern daß auch alle über das, „was sich zeigen läßt“, hinausgehenden Ausführungen anderen überlassen bleiben:
Mögen Sie Ihre eigenen Schlüsse ziehen. Wenn er Ihren Beifall oder Ihren Widerspruch gefunden, Ihr Erstaunen oder Ihren Spott erregt hat, so hat dieser Bericht über die Entstehung eines Gedichts seine Schuldigkeit getan.
Eine gezielte, demonstrative Verweigerung damals: heute gedeckt durch die provozierend-prinzipielle Formulierung, die zum geflügelten Wort werden könnte:
Ich möchte diese Frage, wie die meisten, die mich interessieren, offenlassen.
Das ist gewiß eine Variante des rhetorischen Gestus, der Enzensbergers Äußerungen auffallend häufig begleitet: Wenn er seine Gedichte als Gebrauchsgegenstände bezeichnet; und das Museum der modernen Poesie als Arbeitsplatz; wenn es am Schluß seiner frühen Essaysammlung heißt „Dieses Buch will nicht recht behalten“, und am Ende des letzten Sammelbandes: „Ich wünsche… uns allen ein bißchen mehr Klarheit über die eigene Konfusion,… ein bißchen mehr Aufmerksamkeit, Respekt und Bescheidenheit vor dem Unbekannten.“
Aber dieser rhetorische Gestus ist nicht von Augenzwinkern begleitet; das beglaubigt zumindest Enzensberger selbst im Rückblick, indem er nicht nur manche der frühen Essays heute als besserwisserisch ansieht, als in einer „Tradition der Rechthaberei“ stehend, sondern auch eines seiner ersten Gedichte als Zeugnis für preiswerten Nonkonformismus zitiert. Über einen „Mann in der Trambahn“ hieß es damals: „Dich gibts zu oft“; und heute: „Ich habe nicht die geringste Ahnung, wer sie als erster verflucht hat, die Normalität; aber es sollte mich nicht wundern, wenn es ein Dichter gewesen wäre.“ (Nebenbei bemerkt: man wird schwerlich in unserer Gegenwartsliteratur einen zweiten Fall derart gründlicher Revokation finden.)
Mögen wir nun zwar Enzensbergers Selbstkorrekturen als Bestätigung dafür begreifen, daß der Bescheidenheitstopos tatsächlich einem Bewußtsein der Vorläufigkeit entsprach – und zwar um so mehr, als eben die vormalige Unbescheidenheit Gegenstand der Kritik ist –, so tun wir das doch, gemeinsam mit dem Autor, nur nachträglich. Das allein wäre ein zu grober Erweis; obendrein ist zu bedenken, daß Enzensbergers Selbstkritik, ob nun akzeptiert oder beargwöhnt, moralisch und politisch gegen ihn verwendet wird: nun sagt er es sogar selbst, nun gibt er alles zu.
Man kann aber das Moment der Vorläufigkeit, in jenem zwiefachen Sinne des Wortes, in der doppelten Bewegung von Voraussein und Zurückbleiben, an der Werkentwicklung Enzensbergers und an den theoretischen Grundannahmen seiner Poetik studieren. Das erstere ist an dieser Stelle in der gebotenen Ausführlichkeit nicht möglich. Es sei nur hingewiesen auf die Vorklänge, die das Mausoleum oder der Untergang der Titanic in den Gedichten vor und nach 1968 bereits haben:
Das Übliche – „Das macht nichts. Das ist schlimm. Das macht nichts.“
Auch hier schon bricht der Text ab, „und ruhig rotten die Antworten fort“. „Hommage à Gödel“ weist sogar bis auf die „Politischen Brosamen“ voraus:
In jedem genügend reichhaltigen System,
also auch in diesem Sumpf hier,
lassen sich Sätze formulieren,
die innerhalb des Systems
weder beweis- noch widerlegbar sind.
Eben dieses Gedicht erinnerte Lars Gustafsson daran, daß das poetische Ich „bei Enzensberger immer ein neutrales, ein in den Hintergrund verschobenes Ich“ war; daß seine Gedichte immer die Tendenz „zu einer Art Objektivität“ hatten, daß sie „sich deswegen sehr oft als Theoreme“ verkleideten und in Fällen wie der „Hommage à Gödel“ den „seltenen, objektiven, konkreten Charakter eines festen Dinges“ annehmen. Dies sollte wohl ins Zentrum der Poetik Enzensbergers leiten: es ist ein leeres Zentrum.
In seinem Essay über William Carlos Williams zitiert Enzensberger dessen Maxime:
Ein Gedicht ist eine… Maschine… Nichts an einem Gedicht ist sentimentaler Natur; damit will ich sagen: es darf sowenig wie irgendeine andere Maschine überflüssige Teile enthalten. Seine Bewegung ist eine Erscheinung eher physikalischer als literarischer Art.
Und in Enzensbergers Gedicht „Himmelsmaschine“ (übrigens ein Vorläufer der Mausoleum-Gedichte) finden sich die Zeilen:
Zwecklos und sinnreich
wie ein Gedicht aus Messing.
Das sind aber nicht lauter letzte Worte der Poetik Enzensbergers. In seiner Rede über das Entstehen eines Gedichts wird das Gedicht vielmehr charakterisiert als „gebrechlich, von äußerster Hinfälligkeit…: nichts was sterblicher wäre“.
Dieser Widerspruch ist auflösbar; wenngleich nur in einen anderen Widerspruch.
Ende der 6oer Jahre zitiert Enzensberger André Breton aus dem Jahre 1930: das Denken über Kunst und Literatur könne nur „schwanken“ zwischen dem Bewußtsein „vollkommener Autonomie“ und „strikter Abhängigkeit“. Im Vorwort zum Museum der modernen Poesie 1960 hatte es schon geheißen, „der Gegensatz von Elfenbeinturm und Agitprop“ leiste „der Poesie keine guten Dienste“: „Dieser Wortwechsel gleicht dem Leerlauf zweier weißer Mäuse, die einander in der Tretmühle eines Käfigs jagen.“ In der Auseinandersetzung mit Peter Weiss ist dann von dem „alten Dilemma“ die Rede, vom ungelösten „Zwiespalt zwischen den Forderungen des verblichenen ,Engagements‘ und denen der literarischen Kunst“.
Diese Zitate aus erster und zweiter Hand mögen genügen. Es sei nur noch rasch angefügt, daß sich auch jene Gemeinplätze von 1968 der Belegsammlung einfügen. Ihnen entstammt das soeben angeführte Wort Bretons, und zwar einem Abschnitt mit der Überschrift „Die alten Fragen, die alten Antworten“. Enzensberger hat ja nicht den Tod der Literatur proklamiert – vielmehr hat er diese Formel als eine längst lexikalisierte Metapher der literarischen Moderne gekennzeichnet; und auch sonst hat er nicht nur auf die alten, sondern sogar auf die neuen Fragen alte Antworten gegeben:
Eine revolutionäre Literatur existiert nicht, es wäre denn in einem völlig phrasenhaften Sinn des Wortes. … Für literarische Kunstwerke läßt sich eine wesentliche gesellschaftliche Funktion in unserer Lage nicht angeben. … Wer Literatur als Kunst macht, ist damit nicht widerlegt, kann aber auch nicht mehr gerechtfertigt werden.
Das ist – allgemein poetologisch gesehen – eine defensive Position. Sie zeigt – im Zusammenhang der Entwicklung Enzensbergers gesehen – einen Rückschritt an. Denn in den 5oer und frühen 6oer Jahren waren defensive und offensive Elemente seiner Poetik noch sorgfältig austariert. Der „politische Auftrag des Gedichts“, so hieß es damals, sei es, „sich jedem politischen Auftrag zu verweigern“; und diese Verweigerung wurde ästhetisch und politisch interpretiert als „Widerspruch“, als Infragestellung des Vorhandenen, als Widerstand: „das Gedicht ist eine Anti-Ware schlechthin.“ Zugleich betonte Enzensberger den „konstruktiven Zug“ des poetischen Prozesses im ganzen und im einzelnen:
Wer nicht müde wird, die moderne Poesie kopfschüttelnd nach dem Positiven abzufragen, der übersieht, was auf der Hand liegt: ,negatives‘ Handeln ist poetisch nicht möglich…
Die Revision dieser Position Ende der 6oer Jahre ist gekennzeichnet durch die Preisgabe aller rechtfertigenden Momente; und dabei ist es bis heute geblieben. Enzensberger, der Intellektuelle par excellence, vertritt eine Poetik ohne irgendeinen betont-intellektualistischen Anspruch; derjenige unserer Gegenwartsautoren, der wie kein anderer sich als kritischer Kopf betätigt und auch inszeniert hat, nimmt im Theoretischen eine geradezu hilflose Haltung zu poetologischen Fragen ein. Und zwar aus praktischen Gründen; immer wiederkehrende Argumente: „Die Gesellschaft hat sich eigene Institutionen geschaffen, um die Poesie… zu entschärfen… und… unschädlich zu machen“; oder aber, umgekehrt, um aus dem Gedicht „ein gefährliches Angriffswerkzeug“ zu machen. Die wahre Lektüre hingegen besteht in einem freiwilligen und „anarchischen Akt“.
Andererseits behält, Enzensberger zufolge, „das Gedicht gegen seine Ausleger“ allemal recht.
Der Künstler wiederum, am dritten Punkt dieser kaputten Dreiecksbeziehung von Autor, Text und Leser, weiß nicht, „ob man eine Ästhetik zu haben braucht, um literarisch zu arbeiten. Natürlich hat man immer theoretische Vorstellungen über das Schreiben, wenn man schreibt, aber wieweit sie explizit und wieweit sie systematischer Art sein sollen, müssen, können, das weiß ich nicht.“
Man sieht: es ist kein ungefährlicher Weg, den Enzensberger beschreitet. Wir beobachten hier auf dem Felde literaturtheoretischer Überlegungen ein Phänomen, das uns auf dem Felde der Literatur aus mannigfachen Beispielen vertraut ist: Wie nämlich eine Bewegung der produktiven Zurücknahme, des Entzugs, an den Punkt gerät, wo sie von banausisch-gegenläufigem Interesse leicht sistiert werden kann. (Es ist daher in diesem Zusammenhang an Enzensbergers frühes Theorem zu erinnern, wonach die Angst vor dem Beifall von der falschen Seite ein Indiz totalitären Denkens ist.)
Vergegenwärtigen wir uns noch einmal den Motivhorizont der poetologischen Reflexionen Enzensbergers. Ein durchgehend zu verfolgender pragmatischer Beweggrund – der äußerlichste gewissermaßen, der aber uns hier und das was wir betreiben, im Innersten betrifft – ist Enzensbergers Verdacht gegen jede Form institutionalisierter Befassung mit Poesie – ob im Schulunterricht, in der literarischen Kritik, in der Wissenschaft; unterschiedslos übrigens, denn, was diesen Punkt angeht, ist ihm, wie er sagt, die Frage „ob traditionelle oder progressive Germanistik Jacke wie Hose“. Dieses Motiv könnte ebenso der älteren legitimatorischen Vorstellung vom Gedicht als Anti-Ware, also dem Umkreis der Kritik an der Bewußtseinsindustrie, entspringen, wie es sich mit Enzensbergers neuerer anarcho-traditionalistischer Haltung vereinbaren läßt. Im Kopf des Schreibenden wie im Kopf des Lesenden hallen unzählige „Stimmen und Echos“ durcheinander. „Insofern ist die Literatur eine kollektive Arbeit, in der alle anderen, die an ihr arbeiten, jederzeit gegenwärtig sind; ob sie nun seit zweihundert oder tausend Jahren tot sind oder ob sie im Nebenzimmer sitzen…“
Was damit beschrieben ist, will nicht so sehr als poetischer Prozeß, vielmehr als poetisches Geschehen verstanden sein, welches im Ganzen der literarischen Entwicklung ebenso wirksam ist, wie es die Art und Weise kennzeichnet, in der sich das Werk eines Autors strukturiert, und sogar noch die der „Entstehung eines (einzelnen) Gedichts“.
Für die defensive Haltung der poetologischen Äußerungen Enzensbergers ist dies ein Hauptargument, dessen Problemgehalt man sich nicht verdunkeln lassen sollte durch manche polemisch-invektiven Äußerungen über unsereins, also etwa über die prinzipielle „Fragwürdigkeit allen sekundären Redens“ über die Dichtung, wenn wir uns denn wenigstens, hoffentlich mit Recht, seines Verdachts gegen die „Eselsbrücken“ und die „hochtrabenden Verkündigungen“ enthoben wissen.
Unübersehbar vieles in Enzensbergers Denken widersteht dem systematischen und theoretischen Anspruch einer Poetik.
Ihm fehlt das Selbstbewußtsein des dichterischen Subjekts, des „Originalgenies“, wie er das einmal nennt; ihm fehlt die Bereitschaft, sich irgendeiner expliziten Intention zu verpflichten; schließlich fehlt ihm das Vertrauen in eine vorhersehbare, ja auch nur eine einheitliche Wirkung.
Ihm fehlt aber auch das Vertrauen in die Machbarkeit, in die kontrollierte Verfügung über Material und Mittel; und nicht einmal den Weg einer materialen Poetik will er begehen:
Das Metier wird vorausgesetzt.
Und die Rettungen ins Quasi-Objektive, mit denen die jüngste Moderne das Oszillieren der hundertjährigen Avantgarde zwischen Irrationalismus und Wissenschaftsgläubigkeit stillzustellen versuchte, Statik also und Hermetik, das Experimentelle und das Konkrete, sind ihm völlig fremd.
In poetologischen Fragen steht Enzensberger mit leeren Händen da; genauer gesagt: steht er da und zeigt uns seine leeren Hände.
Das Gedicht behält immer recht, und der Leser hat immer das letzte Wort. In eben diesem Widerspruchsverhältnis stehen Poetik und Zeitbewußtsein, und der Künstler kann es aus der Starrheit der bloßen Entgegensetzung nur erlösen, indem er sich selbst immer wieder, immer weiter zum Verschwinden bringt: dies erst ermöglicht die Entfaltung eines beweglichen Verhältnisses.
In den Einzelheiten klang es noch zweifelnd oder resignativ, wenn Enzensberger meinte:
Auf den Dichter, der die Zwickmühle sprengt, der weder die Dichtung um ihrer Zuhörer willen, noch ihre Zuhörer um der Dichtung willen verrät… werden wir vielleicht vergeblich warten müssen.
Heute sieht Enzensberger von der Alternative einfach ab. Immerhin hat er, in der Zeit, da er so dicht vor ihr stand, wie nie zuvor, eher die These von der grundsätzlichen gesellschaftlichen Harmlosigkeit der Literatur riskiert, als daß er auch nur ein einziges agitatorisches Gedicht geschrieben hätte. Heute sagt er:
Wenn das Schreiben überhaupt einen Sinn haben soll, dann muß es auf Verdacht geschehen.
Wie schon immer, ist er zu allgemeinen poetologischen Aussagen nur zögernd bereit. Wie schon immer hat er für die aktuellen künstlerischen und kunsttheoretischen Trends nur Spott übrig. „,Dieser Roman ist eine Provokation!‘ – ,Diese Inszenierung ist ein radikaler Versuch, mit eingefahrenen Verhaltensmustern zu brechen.‘ – ,Diese Ausstellung ist ein Verstoß gegen die Sehgewohnheiten des Publikums.‘ ,Das Publikum nimmt all diese Provokationen, Brüche und Verstöße mit unerschütterlicher Gelassenheit hin‘…“
Das Publikum, wohlgemerkt, nicht die Bewußtseinsindustrie.
So wenig wie in der Politik sind in der Poesie noch Kritik, Revolte, Subversion gebunden an das ausgearbeitete Programm, an die organisierte Fraktion oder an das pointierte Subjekt. Politik und Poesie sind „hyperkomplexe Systeme“, die von den Störungen leben, von der nicht-pointierten Abweichung, von den Gegenwelten unstrukturierter Kollektivität.
Ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, wenn ich mir ein kleines Experiment erlaube. Ich lese einige Sätze aus den Politischen Brosamen, die dadurch zur poetologischen Aussage werden, daß ich einen einzigen Begriff aus dem Originaltext systematisch durch einen anderen ersetze:
„Die Mannigfaltigkeit, die tausendfach abgestufte Artikulation… begründet auch die Zählebigkeit, die Dynamik und Aggressivität (der Poesie)… In biologischen Systemen gilt der Satz, daß eine Spezies um so schwerer auszurotten ist, je größer ihre Variabilität, ihr genetischer Pool. Eine analoge Faustregel gilt (für die Poesie).“ … „Immer ist sie auf dem laufenden.“… „Stets auf der Flucht vor dem Veralteten, hastet (sie) hinter sich selber her.“… „es ist aber unmöglich, (ihr) die ruhige Überzeugung von der Notwendigkeit ihrer Existenz zu rauben.“ „(Die Poesie) hat ununterbrochen mit dem Gefühl zu kämpfen, daß (sie) überflüssig ist.“… „(Sie) ist auf Rechtfertigung bedacht; sie befindet sich auf einer permanenten Suche nach Sinn.“… „In der Rationalisierung und im Zweifel hat sie es zu einsamer Meisterschaft gebracht.“… „(Sie) zu verunsichern ist ein Kinderspiel. (Sie) von sich abzubringen, ist ein Ding der Unmöglichkeit.“
Wovon ist die Rede? Nicht von der Poesie, sondern von der „kleinen Bourgeoisie“.
Wir dürfen dieses Experiment als Bestätigung der These interpretieren, daß in Enzensbergers Poetik eine anarcho-traditionalistische Haltung die Perspektive gerichteter Kritik ersetzt hat. Als kritische Instanz verschwunden ist das ausgezeichnete Subjekt, nicht aber die extreme Individuation, deren Gegenteil das Kollektiv, deren Pendant die Kollektivität ist. Als Legitimationsfigur verschwunden ist ebenso die Entgegensetzung wie die Vermittlung von Kunst und Gesellschaft; an ihrer Stelle entfaltet Enzensberger die unübersehbaren, von der Theorie stets übersehenen Gegenwelten in Kunst und Gesellschaft, die gerade deshalb kritische Kraft entwickeln, weil sie strategisch unbrauchbar sind.
Gewiß könnte man aus unserem Experiment folgern, daß für Enzensberger die subversiven Kräfte der künstlerischen Moderne abgelöst sind durch die subversiven Kräfte der Gesellschaft. Selbst Jürgen Habermas, dessen Denken dasjenige Enzensbergers vollkommen zuwider sein muß, spricht heute vom „real existierenden Surrealismus“. Nur dürfte man das nicht so interpretieren, wie es (nach Habermas) neo-konservative Theorien tun: nämlich als das gesellschaftliche Virulentwerden der künstlerischen Kräfte, als das Entstehen einer subversiven, „feindseligen Kultur“. Enzensberger sieht die gesellschaftlich virulente Kunst, also die künstlerische Kultur, genauso ins Leere laufen wie die politische Strategie.
Darum äußert er seine politischen ebenso wie seine poetologischen Sätze heute im Modus eines nicht-utopischen Potentialis. Poetologische Brosamen, in Analogie zu den politischen: Es gibt keine Gesetze der Geschichte und keine der Poesie. Die poetische Evolution kennt so wenig wie die gesellschaftliche und die natürliche ein Subjekt und ist deshalb, wie diese, „unvorhersehbar“. Mithin erreicht, wer poetisch handelt, sowenig wie derjenige, der politisch handelt, das, was er sich vorgesetzt hat, sondern „etwas ganz anderes“, das er sich „nicht einmal vorzustellen“ vermag.
Poetische Werke – um vor diesem Hintergrund noch einmal Thema und These zuzuspitzen – entstehen, genauer: sie werden auf Verdacht hervorgebracht und vorangebracht. In dieser Doppelbedeutung, denke ich, versteht Enzensberger den Begriff des „Produzierens“, der daher wie von selbst zum Synonym für den Begriff des „Tradierens“ wird. Es ist diese Gleichzeitigkeit des Hervor- und Voranbringens, die einerseits, was „steinhart“ und „steinalt“ ist an der Poesie, verlebendigt, die andererseits der Hinfälligkeit der Poesie entgegenwirkt, das Unschuldige an ihr verantwortet.
Enzensberger muß freilich die Tendenz, die der Bewegung des Hervor- und Voranbringens, des Produzierens und Tradierens innewohnt, beargwöhnen. Sie suggerieren von sich aus einen Prozeß statt eines Geschehens, suggerieren eine Gerichtetheit vom Dunkeln ins Helle, vom Vorbewußten zum Bewußten, vom Vergangenen ins Zukünftige, alles in allem Gerichtetheiten der Überbietung. Noch der extremste Anarcho-Traditionalismus muß diesen Vektor in sich spüren.
Das ist der tiefste Grund, weshalb in allem, was Enzensberger getan, bedacht und gedichtet hat, die Zurücknahme, das Untertauchen, das Verschwinden forciert gegenwärtig ist. Der Vektor kann nicht umgekehrt werden; er ist auch nicht zu beseitigen; so muß man ihn wieder und wieder verkürzen; und das, was gleichwohl immer von ihm bleibt, „was im Verschwinden begriffen ist, immer schärfer ins Auge fassen, je undeutlicher es wird“. „Am Ende – das… nicht abzusehen ist –“ sind die Geister „unter sich und bewachen das, was verschwunden sein wird.“
Sie werden sich fragen, weshalb ich hier – im Rahmen dieses Kolloquiums – Gedanken über Enzensbergers Poetik vorgetragen habe, ohne auf seine eigene Frankfurter Poetik-Vorlesung aus dem Jahre 1964/65 einzugehen. Der Grund wird Ihnen einleuchten. Nicht nur ist diese Vorlesung niemals gedruckt worden; der Autor selbst verfügt, wie er sagt, nicht mehr über das Manuskript; eine Tonaufzeichnung ist nicht zu finden. Dieser Befund läßt sich in einem Satz zusammenfassen, mit dem ich zugleich meine Ausführungen beschließen möchte: Enzensbergers Poetik-Vorlesung ist verschwunden.
Volker Bohn, Neue Rundschau, Heft 1, 1986
Fassungslos gefasstverfasste Betrachtung
Meine Wörter bücken sich nicht. Sie sind
nicht dazu da, etwas aufzuheben. Sie sind da,
eine Weile lang. Es kann sie ein jeder sagen.
16 Jahre liegen zwischen Die Furie des Verschwindens und dem Gedichtband Blindenschrift, also die halben sechziger und die ganzen siebziger Jahre (an letztere schrieb Enzensberger ein Gedicht, dass das erste dieses Bandes ist; es beginnt: „Also was die siebziger Jahre betrifft, / kann ich mich kurz fassen. / Die Auskunft war immer besetzt.“).
Es ist eine lange Zeit, um an einem Gedichtband zu arbeiten oder keine Gedichte zu schreiben. War Blindenschrift der scheinbare dichterische Neubeginn, das mögliche Startsignal zu einer gesetzteren, ruhigeren, tieferen Lyrik, so setzt Die Furie des Verschwindens eher wieder bei den ersten beiden Gedichtbänden an, obwohl auch noch ein Stück von Blindenschrift geblieben ist. Dies offenbart sich vor allem in dem letzten Abschnitt des dreigeteilten Gedichtbandes, dem Teil der wie der Gedichtband selbst, Die Furie des Verschwindens heißt. Hier finden sich überwiegend geradlinige, nachdenkliche, manchmal sinnende Gedichte, viel um Vergänglichkeit, Vergangenheit, Sinn und Substanz.
Dem Gegenüber steht der erste Teil „Tränen der Dankbarkeit“. Er ist nicht wirklich grundverschieden, zeichnet sich aber durch sein Schwanken zwischen Präzision und ausgekugelter Dynamik aus. Hier zwei Textproben, um zu erklären, was ich in etwas meine:
Tiraden, angeschnallt und erbittert, über Ledersitze,
Alumotoren, Flüche beim Überholen, Erkenntnisse
über Prämien, Ersatzteilprobleme, endlich
der nächtliche Stau, das Blaulicht, die Bahre.
Ding dang dong. Mischmasch. Durchsagen auf Japanisch.
Im Kerosinduft zerfließen die dumpfen Panzer
hinter dem Glas, auf dem heißen Vorfeld. Schlieren
im Auge, Münzen in der schweißnassen Faust.
Immer besetzt. Dann wieder lässt du es läuten
und läuten. Überall Koffer. Erbittert wähle ich
Gleichsam: Es ist auch der kürzeste Gedichtband, den Enzensberger je herausgegeben hat; ein Drittel füllt auch noch das etwas versumpfende Langgedichte, dessen Titel sehr viel mehr verspricht, als er hält „Die Frösche von Bikini“ (Das Bikini-Atoll war eines der „beliebtesten“ Atombombentestgelände der US-Amerikaner; quasi als Wiedergutmachung, wurde dann ein Badeanzug nach der heute noch verseuchten Inselgruppe benannt.)
Auch in diesem Gedichtband gibt es sehr starke Gedichte. Am Anfang, im ersten Teil, zum Beispiel, gibt es 3–4 Gedichte in denen Enzensberger minutiös ein paar Szenerien und Menschen zeichnet; „Die Dreißigjährige“ oder „Die Scheidung“ heißen dieses Gedichte und es gelingt dem Autor diese Titelversprechungen auch in einem eleganten, klug gewählten Wortgemälde zu erfüllen, ja, zu verwirklichen. Große Kunst, konnte ich bei diesen Gedichten nur denken, weil alles so deutlich zueinander passte. Gewiss, dass ist nicht die Aufgabe jedes Gedichts, aber es ist eindeutig ein Vorzug entgegen aller Wortklauberei.
siehe, das Leben liegt vor euch wie ein Dauerauftrag
und ihr könnt durchwählen
sogar nach Brisbane und Osnabrück.
Vielleicht ist dieser Gedichtband ideal, um Enzensberger kennen zu lernen und zu entscheiden, ob man ihn mag oder nicht mag. Von hieraus kann man sowohl in die eine Richtung, zu den gesetzten, stimmigeren Gedichten aus Blindenschrift, als auch in die andere, zu den rabiat-kritisch-totaleren Gedichten aus Verteidigung der Wölfe oder Landessprache gehen, in beidem liegt hier der Konsens. Was wieder nicht heißen soll, dass Enzensberger sich nicht entwickelt hat oder dieser Gedichtband nicht wieder auf gewisse Weise sehr neu wäre. Aber ein Dichter kann schwerlich seine Wurzeln verleugnen, ebenso wenig wie der Leser Empathie oder Verwirrung leugnen kann.
Wenn man den eigenen Worten
eine zeitlang zuhört,
wie sie dröhnen im eigenen Kopf –
man möchte die Augen zudrücken,
wie ein kleines Kind,
sich die Ohren zuhalten
und am liebsten gar nichts mehr sagen.
Aber das wäre falsch.
Vielleicht findet sich in diesen paar Zeilen ein kleines Credo, von dem, was Enzensberger wieder nach 16 Jahren zum Dichten führte. Ich jedenfalls bin froh, dass er weitergemacht hat.
Timo Brandt, amazon.de, 5.3.2012
Anti-Idyllen und Abrechnungen
Seit den mittleren 50er Jahren gehört der Lyriker, Kritiker, literarische Kursbuchmacher Hans Magnus Enzensberger zur Literaturszene der Bundesrepublik. In den fünfziger Jahren hat er als zorniger junger Mann den aggressiven Brechtton ins gesellschaftskritische Gedicht geschleudert. Er war unter den Lyrikern der erste, welcher der bundesdeutschen Wohlstandsgesellschaft den Prozeß gemacht hat. Fasziniert von Adorno und Marcuse, von Marx und Castro, wollte Enzensberger im Herbst 1968 aller Belletristik, der „Literatur der Affirmation und Literatur des Protestes“ den Laufpaß geben zugunsten revolutionärer Taten. Zwischen Gartenbildern lagern in seinen Versen Raubtiermetaphern, neben Zweifeln rauscht die revolutionäre Attitüde, aus dem Elegischen flammt das heroisch Deutsche, zwischen intellektueller Bewußtseinsarbeit der anarchische Trieb. Der Heinesche Weltriß und die Heinesche Sehnsucht gehen durch seine Brust, das Heinesche Leiden an Deutschland und der Heinesche Drang nach effektvoller Rhetorik. Daß es in Enzensberger trotz der erklärten Denunziation weiter gedichtet hat, daß hier ein poetisches „Es“ stärker ist als das intellektuelle „Ich“, beweist den Dichter. Er wollte der „typische“ Deutsche nicht sein. Und doch ist keiner unter den gegenwärtig fünfzigjährigen deutschen Autoren so deutsch wie Hans Magnus Enzensberger. Keiner hat unter seine Zweifel so viele Bekenntnisse eingebracht, keiner so viel Moral und so klare Verhältnisse gewollt. Keiner hat so viele Volten geschlagen. Enzensberger ist zwischen Manifest und Ode immer geblieben, was er war: ein deutscher Poet. Dieses Weiterdichten macht jeden neuen Verband Enzensbergers zu einem Ereignis. Wie er Aufklärung mit poetischem Instinkt, Rhetorik mit lyrischem Primitivsinn, bohrende Fragen mit Feiertagsbewußtsein verbindet, wie er neuerdings den „Dr. Benn“ vor den Politlyrikern und seinem eigenen Essay-Angriff in Schutz nimmt und sogar seine „Vorliebe für alte Häuser“ und „alte Freiheiten“ ins Licht rückt, wie er stets die „neueste Stimmung im Westen“ riecht, wie er eigentlich fortgehen wollte und doch blieb: Das macht ihm keiner nach.
„Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm“ reimte Brecht ironisch in Macheaths „Ballade vom angenehmen Leben“, Enzensberger predigt im Gedichtband Die Furie des Verschwindens satirisch:
… Gehet hin und buchet
in Frieden! Bucht für den ersten Montag im März
und für den darauffolgenden Montag bucht
den Rückflug, dies ist meine Predigt, löffelt
und laßt euch nicht stören, rennt in die Therapie
und spart auf den schlüsselfertigen Schrecken
im Süden, siehe, das Leben liegt vor euch
wie ein Dauerauftrag, und ihr könnt durchwählen…
„Was die siebziger Jahre betrifft“, faßt der Prediger ironisch-satirisch als „Andenken“ zusammen. Der Verlag hat das Eröffnungsgedicht nochmals auf den Rückumschlag gedruckt.
ANDENKEN
Also was die siebziger Jahre betrifft,
kann ich mich kurz fassen.
Die Auskunft war immer besetzt.
Die wundersame Brotvermehrung
beschränkte sich auf Düsseldorf und Umgebung.
Die furchtbare Nachricht lief über den Ticker,
wurde zur Kenntnis genommen und archiviert.
Widerstandslos, im großen und ganzen,
haben sie sich selber verschluckt,
die siebziger Jahre,
ohne Gewähr für Nachgeborene,
Türken und Arbeitslose.
Daß irgendwer ihrer mit Nachsicht gedächte,
wäre zuviel verlangt.
Enzensberger ist ein großer Rhetoriker. Was Walter Jens in der Rede, kann Enzensberger im Vers. Mit neubarockem intellektuellem Pathos schleudert der kosmopolitische (und also untypische) Bayer seine Verdikte gegen die „Bourgeoisie“. Er vermag sich trotz gelegentlicher „Wir“-Rede trefflich über die Minderbewußten zu erheben. Mit wortdifferenziertem Gewissen distanziert er sich von den „Pharisäern“. Aber vielleicht gehört der Diskutant in einem tieferen Sinn, als es die Gedichte aussprechen, in eben diesen wohlstandsbürgerlichen Freiraum, in dem die wirtschaftlichen, die politischen und die literarisch intellektuellen „Oberen“ tatsächlich oben schwimmen und also die Sorgen der „Unteren“ wenig kennen.
In der Mitte zwischen den Anti-Idyllen und den neuen Ortsbeschreibungen des Autors steht, eine Art Achse, das Langgedicht „Die Frösche von Bikini“. Darin schreibt Enzensberger eine Art Abrechnung mit sich selbst, seinem Wohnort, seinen Freunden, seinen Gegnern. Es scheint, als bereite er darin auch seinen Abzug aus Berlin vor. Das Assoziationsfeld ist bereits im Titel mehrschichtig. Im Gebiet des Bikini-Atolls probten die Vereinigten Staaten mit dem „Helium-Flash“ vor „dreißig Jahren“ (1946) die „Apokalypse“. Im Gedicht quaken die Frösche des Atolls und die Frösche der „Evolution“, vor allem die besorgten Frösche des Aristophanes. Sie stellen bohrende Fragen über das Befinden des Dichters in Berlin-Friedenau, über den Zustand der Menschen in der Stadt.
Nein, Enzensberger trägt seine Haut nicht zu Markte. Er identifiziert sich nicht mit den Bewohnern dieser oder jener Stadt. „Im übrigen bin ich Zuschauer. Ja, / ich schaue zu“, – diese dialogische Abwehr eines Bekannten scheint nicht weit von der eigenen Position zu liegen. Unmißverständlich verteidigt „Der Fliegende Robert“ sich im letzten Gedicht:
Eskapismus, ruft ihr mir zu
vorwurfsvoll.
Was denn sonst, antworte ich,
bei diesem Sauwetter! –,
spanne den Regenschirm auf
und erhebe mich in die Lüfte.
Der Bürger rettet sich. Der Poet argumentiert ironisch.
Paul Konrad Kurz, aus Paul Konrad Kurz: Zwischen Widerstand und Wohlstand. Zur Literatur der frühen 80er Jahre, Verlag Josef Knecht, 1986
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Hans-Jürgen Heise: Der Fliegende Robert und die Dialektik
Stuttgarter Zeitung, 7.10.1980
Fritz J. Raddatz: Glück – das letzte Verbrechen?
Die Zeit, 14.11.1980
Hans-Dietrich Sander: Wenn die Worte im Kopf dröhnen
Die Welt, 6.12.1980
Michael Buselmeier: „Spart auf den schlüsselfertigen Schrecken“
Frankfurter Hefte, Heft 2, 1982
Volker Bohn: Es geht auch anders, aber so geht es auch
Neue Rundschau, Heft 3, 1983
Spannende Wandlungen eines Poeten
– Erweiterte Fassung der Laudatio anläßlich der Verleihung des Großen Literaturpreises der Bayerischen Akademie der schönen Künste, München am 22.5.1987. –
Hans Magnus Enzensberger verabscheut seit jeher alles Klebrige und Zähe, das sich zwischen Menschen und ihren Einrichtungen absondert, wenn die armen Erdenbürger nicht klug und ehrlich und erfahrungssüchtig miteinander umgehen. Enzensberger hat sich immer gewehrt gegen den „Schaum“, der steigt und sich töricht bläht, aber auch gegen den Sudelzauber des Sentimentalen. Eigentlich gegen alles, was einem bedeutungsschwanger auf den Leib rückt und nicht intelligent mit sich reden läßt. Seine frühen poetischen und essayistischen Texte kennen wahrlich die Solidarität mit den anonymen Leidenden: aber sie zeigen keine Lust, sich mit der Psychologie der Haifische abzumühen. Dafür äußern sie herrisches Befremden wegen der Feiglinge, die sich nicht trauen. „Fürchtet euch oder fürchtet euch nicht!“ hat Ingeborg Bachmann in ihrer Anrufung des Großen Bären gedichtet: weil es ihr angesichts des universalen Verhängnisses gleichgültig schien, ob die Menschen im Banne des Großen Bären nun Angst haben oder nicht.
Das fiele ihm, Hans Magnus Enzensberger, keineswegs ein: zwar ekelt er sich vor dem Schaum, vor dem Zähen, Klebrigen, Farblos-Rührseligen: aber sein Unmut ist genau das Gegenteil von Mutlosigkeit. Bei ihm heißt’s unzweideutig:
Ich sage euch: Fürchtet euch nicht! Greift in die Tasten. Greift wohin ihr wollt… aber habt keine Angst…
Er war es denn auch, der einstmals die notwendige und wahrlich hilfreiche Formel vom „Gratis-Mut“ ins Gespräch einführte – nämlich vom „Gratis-Mut“ derjenigen, die sich so wunderbar heroisch und märtyrerhaft vorkommen, wenn sie, gottbehüte, irgendeine mächtige Instanz attackieren: eine Partei, einen Minister, eine Mode, einen Mumpitz. Courage, als Objektivation innerer Freiheit, ist für Enzensberger etwas schlicht Selbstverständliches. Darum erfüllt ihn auch nicht das erhebende Selbstwertgefühl, wer weiß wie mutig zu sein, bloß weil er mitteilt, wie ihm zumute ist.
So spannungsvoll sich das, was er anstrebte, was er für zutreffend, nötig, verwerflich hielt, auch geändert haben mag im Lauf der Jahre: als Charakter im Strom der Welt blieb er sich immer und bewunderungswürdig produktiv treu. Noch jüngst hat er auf die Scherzfrage eines Schweizer Magazins gar nicht nur scherzhaft geantwortet. „Was ich mag – was ich nicht mag“ heißt das Spiel. Was mag er also nicht? Zum Beispiel: „Galeristenkunst“, „photographiert werden“. „Sämtliche Werke des Marquis de Sade“. Er mag weiterhin nicht:
Sektierer, alle Arten von Sport. Gäste, die nicht gehen. Personen, die das Bedürfnis haben, andere Personen festzunageln.
Gewisse Avantgarde-Eitelkeiten mag er gar nicht. Er mag also höchstbegreiflicherweise „Theaterrezensenten-Theater“ nicht, „Film-Kritiker-Filme“, „Expressionismus und andere Formen der Kraftmeierei“. „Machterotiker, Städteplaner. Östliche Weisheiten aller Art.“ Letztes Beispiel fürs von ihm Nicht-Gemochte: das sogenannte „gemütliche Beisammensein“. Warum nicht? wir ahnen es zunächst: weil es erfahrungsgemäß so leicht zu klebrigen Unaufrichtigkeiten verleitet.
Erscheint ein Talent, ein literarisches Naturereignis solchen Formates, so wie Enzensberger Mitte der fünfziger Jahre in der Bundesrepublik erschien: in der Gruppe 47, in Zeitungen, Rundfunkanstalten und Diskussionen – dann beginnt nicht tastend-unauffällig eine bescheidene Schriftstellerkarriere. Sondern dann fällt ein Blitz über die literarische Landschaft. Ein Blitz, der Bewunderung, Verblüffung, Respekt hervorruft. Freilich provozieren Könnerschaft, Metier, Parteilichkeit und Einfallsreichtum auch viel säuerliches oder mokantes Mißtrauen. Denn sichere Brillanz deutet auf Leichtfertigkeit hin – so als ob jemand, der mit originell gestellten Aufgaben unverschwitzt und leicht fertig wird, darum auch ein Leichtfertiger sein müsse.
Jetzt ließe sich Enzensbergers Laufbahn, die ihn zum Star internationaler Kongresse machte, zum anthologiereifen Lyriker, zum eminenten Essayisten, zum unternehmungslustigen erschreckend belesenen Herausgeber der Anderen Bibliothek, zum literarischen Markenartikel – jetzt ließe sich diese Karriere als blendende Success-Story ausbreiten.
Das begann spätestens mit der verteidigung der wölfe, seinem ersten Gedichtband, der 1957 herauskam. Enzensberger war damals ganze 28 Jahre alt. Als kritischer Essayist, als Redakteur und Dozent hatte er sich schon längst hervorgetan. Nach der verteidigung der wölfe feierte ihn die literarische Öffentlichkeit. „Endlich haben auch wir einen zornigen jungen Mann“, jubelte Alfred Andersch. Bald kamen weitere Gedichtbände. Enzensbergers große Essays wurden berühmt. Er griff „Die Sprache des Spiegel“, also die effektvolle Magazin-Häme, an, und er ironisierte den beschwichtigenden Eiertanz-Journalismus der Frankfurter Allgemeinen –, wobei er sich übrigens keineswegs die Feuilletons vornahm, sondern die ihm bedeutungsvoller scheinenden politischen Redakteure. Hans Magnus Enzensberger war noch nicht 35 Jahre alt, da hatte er bereits den wichtigsten deutschen Literaturpreis bekommen, den Büchner-Preis, da war er bereits in ganz Europa, in Rußland, Amerika, Mexiko gewesen, da galt er als Institution.
1965 gründete er das Kursbuch, eine undogmatisch linke, aufklärerische Zeitschrift, die das Denken einer ganzen Generation begleitete, prägte, durcheinanderbrachte. Dieses Kursbuch war Zentrum, Kaffeehaus, Tummelplatz und Podium der ehrgeizigen studentisch-politischen Intelligenz Deutschlands, aber keineswegs nur Deutschlands. Wer damals wissen wollte, wohin der Weltgeist unterwegs sei, verschlang Enzensbergers Essays. Ich erinnere an den „Baukasten zu einer Theorie der Medien“, aus dem Kursbuch 20. Ich senke die Stimme zum ernsten Gedenken an das mittlerweile fast rührend historisch gewordene skandalumwitterte Kursbuch 15, wo der „Tod der Literatur“ konstatiert, aber auch als unsterbliche literarische Unmutsmetapher relativiert worden war. Im Kursbuch 30 beschäftigte sich Enzensberger mit dem „Revolutionstourismus“, denn er war ja auch, anfänglich voller idealistisch-guten Willens, in Castros Cuba und Chruschtschows Moskau gewesen, worüber manche entweder ahnungslosen oder verbiesterten Enzensberger-Hasser bis heute noch nicht hinwegkommen konnten. Ein wenig später publizierte er eine hellsichtige Kritik der politischen Ökologie, das war um 1973. 1978 begrub Enzensberger im Kursbuch 52 die linke Heilsgewißheit der revolutionären Utopisten. „Diese akademischen Exorzisten“, schrieb er, „begreifen nicht… daß man Mythen nicht durch Seminararbeiten widerlegen kann… Statt dessen weigern sich unsere Theoretiker bis heute zuzugeben… was jeder Passant längst verstanden hat: daß es keinen Weltgeist gibt; daß wir die Gesetze der Geschichte nicht kennen; daß auch der Klassenkampf ein ,naturwüchsiger‘ Prozeß ist, den keine Avantgarde bewußt planen und leiten kann… daß wir mithin, wenn wir politisch handeln, nie das erreichen, was wir uns vorgesetzt haben, sondern etwas, ganz anderes, das wir uns nicht einmal vorzustellen vermögen; und daß die Krise aller positiven Utopien eben hierin ihren Grund hat…“
Gewiß, er verschmäht die „Pointierung“ nicht, den Effekt, die radikale Formulierung, die sich aus dem offenen Parlando seines Diskurses löst und einen Gedanken auf die Spitze treibt. Das ist wahrlich viel, aber nicht sein Spezifischstes und Bestes. Eigentümlich für ihn scheint etwas anderes zu sein: dieser Schriftsteller klebt nicht am mühsam Zusammengebrachten. Er verteidigt nicht eifernd Positionen. „Er sucht nicht, Investitionen zu retten – sondern er sucht.“ So als hänge er gar nicht am Glanz des eben noch so schön und viel belobt Formulierten. Er läßt sich immer wieder ein, geht zu weit, probiert Hypothesen, kaschiert Rückzüge nicht. Sieht sich gleichsam neugierig zu beim Suchen, beim Herstellen radikaler oder potentiell anarchistischer Versuchsanordnungen. Das schafft natürlich Gegner, Feinde, Kontrahenten. Wir kennen seine noble Auseinandersetzung mit Hannah Arendt; Uwe Johnson wiederum ärgerte sich im Band II der Jahrestage pedantisch-maliziös über des jungen Enzensberger hochmütige Amerika-Schelte; Habermas schrieb Herrn Matthias Kepplinger, der ein dickes Buch gegen Enzensberger verfaßte, er habe mit dem von ihm gescholtenen „Harlekin am Hof der Scheinrevolutionäre“ tatsächlich Enzensberger gemeint, was wiederum besagter Kepplinger auf Seite 306 seiner Anti-Enzensberger-Bibel in einer triumphierenden Fußnote vermerkte. Und so weiter…
Leute, denen das Organ für Enzensbergers anarchische Substanz, für seine Neugier und sein Tempo fehlt, begreifen nicht recht, daß dieser Schriftsteller sozusagen immer wieder Selbstversuche unternahm, daß er offen war und ist für neue Erfahrungen, daß er sich nicht ängstlich hinter seiner Marx/Engels-Ausgabe verkroch, sondern daß er viel und ausführlich reiste – nach Cuba, nach Moskau und anderswohin. Er ließ sich mit Haut und Haar, vor allem aber mit wachen Augen ein auf die Lebensformen, die Mühsal des zu reproduzierenden Daseins sowohl im gnadenlos real existierenden Sozialismus wie auch im gnadenlos funktionierenden Kapitalismus. Und er ließ sich nirgendwo zur Einseitigkeit nötigen – nur weil es anderswo noch schlimmer ist. Mittlerweile ging er so weit, spöttisch zu formulieren, daß die Leute, die immer so dröhnend vom „sozialistischen Lager“ reden, eigentlich mit Recht das schlimme Wort „Lager“ wählen… Doch darum denkt er über Bonn nicht milder.
Nicht einmal die furchterregende Forderung nach „Konsequenz“ vermag ihn zu schrecken! In seinem großen Text vom „Ende der Konsequenz“ schrieb er Anfang der achtziger Jahre, die Liebhaber der Konsequenz wollten auch dort, wo kein Weg weiterführt, ihre Idee in die Tat umsetzen, Das könne mörderische Folgen haben. Und nun wörtlich:
Wo Konsequenz nur um den Preis der Barbarei oder der Selbstverstümmelung zu haben ist, kommt sie mir als ein verabscheuungswürdiger Anachronismus vor… Dabei liegt die Alternative ziemlich-nahe: Wenn euer Denken, liebe Kollegen,
so fährt Hans Magnus Enzensberger fort,
diese Grenze erreicht hat, warum kehrt ihr dann nicht einfach um und probiert den nächsten unerforschten Weg aus… Natürlich müßt ihr mit eurer Sehnsucht nach den heroischen Zeiten fertig werden, in denen es noch so aussah, als könne einer ein für allemal im Recht sein. Natürlich dürft ihr keine Angst haben vor dieser oder jener Partei…
Da haben wir sie wieder, diese Freiheit von Angst, diese Freiheit zur produktiven Inkonsequenz. Sie ist das Gegenteil von bequemem Opportunismus. Hier will jemand immer und unter allen Umständen auf der Höhe dessen leben und schreiben, was er für wahr erkennt. Vor gut 180 Jahren hat Friedrich Schlegel die Tücken des Systems genial erfaßt und zusammengefaßt: „Es ist gleich tödlich für den Geist, ein System zu haben und keins zu haben. Er wird sich also wohl entschließen müssen, beides zu verbinden“, schlug Schlegel konsequent inkonsequent vor. Und Goethe gestand:
Ich für mich kann… nicht an einer Denkweise genug haben; als Dichter und Künstler bin ich Polytheist, Pantheist hingegen als Naturforscher, und eins so entschieden als das andere. Bedarf ich eines Gottes für meine Persönlichkeit als sittlicher Mensch, so ist auch dafür schon gesorgt.
Enzensberger braucht sich also seiner Konsequenzfreiheit nicht zu genieren, Aber macht ihn das alles nicht unheimlich, unberechenbar, unmenschlich? Steckt nicht etwas Ungreifbares hinter alledem? Er reagiert so unsentimental, er lächelt so unangefochten über Nostalgien, die er beschreibt wie exotische Krankheiten. Kurz: er nimmt auf sich, aufs anheimelnde Seelenleben so wenig Rücksicht. „Ein kluges, reptilartiges Geschöpf“ soll ihn Freund Lars Gustafsson voller erschrockener Hochachtung genannt haben…
Es scheint naheliegend, ist aber gleichwohl ein Kurzschluß, in Enzensberger den wohlbekannten Typus, des genialisch unverbindlichen Literaten zu sehen. Wäre er Franzose, ein bißchen Rimbaud, ein Schuß Cocteau, eine Prise André Glucksmann, wir brauchten nicht viel zu rätseln. Aber von modisch-gesellschaftlicher Literaten-Betriebsamkeit kann in seinem Fall nicht, oder längst nicht mehr, die Rede sein! Was seine Analysen, seine meisterhaften Texte über große Forscher und Politiker betrifft, in dem faszinierenden Balladenbuch Mausoleum, wo die Naturwissenschaftler mit ihrer kühlen Erkenntnislust in der Überzahl sind und die Lebensläufe der Poeten kaum eine Rolle spielen – so nehmen typisch literarische, schöngeistige Themen in seinem bewunderungswürdig reichen spirituellen Haushalt einen auffallend kleinen Raum ein. Er ist wirklich kein Cocktailparty-Literat, den nur Kritiker, Kollegen und Neuerscheinungen interessieren. Auch seine Fernsehpersonality ist unterentwickelt, bedürfte lebhafter Pflege. Dieser vermeintliche Hans Dampf entzieht sich allen langweiligen, verregneten Gassen wie seine Lieblingsfigur: der fliegende Robert. Das Pathos gefühlvoller Selbstdarstellung fehlt ihm ganz – nicht weil er’s nicht kann, sondern weil er’s nicht will, weil er sozusagen außerstande ist dazu, was Übrigens mit Bescheidenheit gar nichts zu tun hat. Das Fehlen des sich selbst affirmativ Wichtig-Nehmens, dieser Mangel an gefühlvollem Bedauern für die eigene Person bewirkt einen Nachteil – aber wir wollen diesen Punkt rasch hinter uns bringen –, nämlich den, daß Enzensberger mit der Bühne gewisse Schwierigkeiten hat.
Figuren, die es auf dem Theater zu etwas bringen wollen, müssen sich enorm ernst nehmen – müssen sich so ernst nehmen wie selbst in Becketts Endspiel der Ham, wie selbst beim absurden Ionesco der Behringer, beim kühlen Brecht der Galileo oder der Azdak es tun. Das ist nicht Enzensbergers Stil. Er, Hans Magnus Enzensberger, akzeptierte beispielsweise ohne Spur von Beleidigtheit und Gekränktheit einst in der Gruppe 47 Hildesheimers harsche Kritik an einem von ihm verlesenen dramatischen Versuch, den ich übrigens seltsamerweise bis heute nicht vergessen habe. „Das ist vollständig mißlungen, und ich kann, auch sagen, warum“, begann Hildesheimer temperamentvoll die Diskussion. Hans Magnus zog die Augenbrauen hoch – und das Stück zurück. Sollte er wirklich ein sozusagen staunenswertes Naturereignis sein aus Helle, Freiheit, Heiterkeit? Wirklich nur, um ihn selbst zu zitieren, „unter den Propheten der Katastrophe der Muntersten einer?“
Ja, wenn es seine Gedichte nicht gäbe! Jetzt ist der Augenblick herangerückt, dem bisher entworfenen Bilde vom mutigen, klugen, wandlungsfähigen und brillant unternehmungslustigen Charakter noch die Farben, die Halbschatten und Heimlichkeiten des wahrhaft Lebendigen hinzuzufügen. Die dunklen Töne: nämlich Enzensbergers poetische Sendung, sein lyrisches Vermögen!
Neben diesen Gedichten, die Enzensbergers Existenz wie ein lyrisches Tagebuch begleiten, hat er einen bedeutungsschweren, aus 33 Gesängen bestehenden Zyklus vorgelegt: Der Untergang der Titanic. Das nennt sich, unter nicht unberechtigter, aber koketter Berufung auf Dante „eine Komödie“ und verbindet die tief-symbolische Havarie des Jahres 1912 mit dem Altern unserer Welt und dem Älterwerden unseres Autors. Ein kleines, gewichtiges Meisterwerk „großer Poesie“, wie Nicolas Born bewundernd schrieb.
Manchmal ordnet der Lyriker Enzensberger sprachliche Wendungen mit wunderbar enthüllendem Sinn. Etwa über das, was ein Mund tut, was eine Redensart verschweigt, was man „verliert“. Er wählt aus und macht lebendig. Das Geheimnis der beziehungsvollen Wahl scheint dann in der Tät größer als das der beliebigen Erfindung. Der Lyriker Enzensberger arrangiert dann Sprache, wie er als Epiker Texte und Dokumente zu arrangieren versteht. Aus der von ihm gestifteten Bewegung des Materials werden bewegende Texte. Seinem lyrischen Ich gönnt er übrigens manchmal jenen hymnisch-prophetischen Ton, den er als empirische Person gewiß nicht so ohne weiteres anschlüge: finsterer Zorn gebiert über-private Verse.
Die kritische Phrase, daß Enzensberger auf dem Wege sei von Brechts klarem Wissen zu Benns lakonischem Zweifel, hilft zum Verstehen seiner Gedichte überhaupt nicht. Man muß sich vielmehr immer wieder hineinfühlen in eine beherrschte Flucht gelassener und origineller Bilder.
Wenn man jung und klug ist, kann man fabelhaft eifrig über den „Tod“ reflektieren. Muntere Seminare aufgeschlossener 20jähriger Studenten und Studentinnen diskutieren dann lebhaft über das Todesmotiv bei Thomas Mann, bei Schubert oder bei Heidegger. (Wie engagiert habe ich selbst einst dabei mitgetan!) Das Sterben wird begrifflich seziert, die Referate werden sorgfältig benotet, und unter Aufsicht eines souveränen Professors gelingt es ohne Rest und ganz zweifellos; den Tod „akademisch“ zu erledigen.
Bereits der ganz junge Enzensberger war über solche wichtigtuerischen Seminarspiele hinaus. Er schrieb ein zartes Gedicht, das „Erinnerung an den Tod“ heißt, Lauter verwunderte und verwundete Feststellungen fangen da etwas ein, was so eben doch nur ein Dichter festmachen kann: Jene Wehmut, die sich, falls sie geschmacklos beim Namen genannt würde, in lauter Phrasen auflöste: „Alkibiades, mein Spießgeselle…“.
Dreißig Jahre später, als er schon für sprachlose Kreaturen, ja sogar für tote Substanzen das lyrische Wort ergriffen hatte, gelang ihm eine Metapher für den verlorenen Zukunftsglauben, wie sie eleganter, sinnfälliger, persönlicher und betroffener schwerlich zu denken ist. Dieser kurze Text aus Enzensbergers Gedichtbändchen Die Furie des Verschwindens heißt „Sprechstunde“. Er scheint zunächst die höchst private Klage eines Mannes, dem seine Liebe zu einer ziemlich mühseligen, heißbegehrten Frau abhanden kam. Diese Frau, auf, die so gar kein Verlaß ist, die nie pünktlich sein kann, die sich kokett entzieht – diese Frau war, am Ende stellt es sich überdeutlich heraus, kein Weib, sondern die Zukunft. Wenn man diese Pointe durchschaut, dann weiß man, daß der Verlust der Zukunftsperspektive für ehemals überzeugte Aufklärer eben kein bloß theoretisches Abbuchen irgendeines Irrtums war, sondern das Zuendegehen einer schicksalhaften Beziehung. Insofern gibt Enzensbergers sachliche Romanze viel mehr als nur eine Variation über Valérys berühmten Satz „Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie einmal war.“ In Form einer banalen Szene bietet uns der Poet die Metapher eines fatalen Verlustes.
Enzensbergers Kunst bei alle dem ist: eine Sache, ein Problem ganz und gar zu durchdringen – dabei aber selbst ganz und gar undurchdringlich zu bleiben…
Enzensbergers Gedichte sind gegliederte Meditationen in Form reimloser Verse und Strophen. Beim Lesen – und es ist ein Vergnügen, diese zarten, überraschenden, klugen und manchmal trotz aller Skepsis herrlich verspielten Texte zu lesen – erkennt man, daß es eben nicht nur eine klare lyrische Form gibt. Ob etwas „Lyrik“ sei, ist auch eine Frage der sich gebunden geltend machenden Subjektivität, des metaphern-gebärenden Sprachverhaltens, der wortbündelnden Gestimmtheit – und nicht allein eine Formfrage.
Beim tagebuchartigen, gleichsam „privaten“ Lyrik-Schreiben gibt sich Enzensberger immer skeptischer, zugleich milder und untröstlicher. Früher dichtete er aggressiver, formulierte er haargenau, was recht und unrecht sei, „wer näht denn dem general / den blutstreif an seine hose?“ schrie er allen halbherzigen Mitläufern wütend zu. Jetzt weiß er nicht immer so genau Bescheid, wer schuld ist an „Beschränkungen“, an Melancholie. Der Weltlauf? Die Weisheitslehrer? Oder doch nur zuviel Wodka gestern abend?
Diese Skepsis schafft einen zusammensaugenden Blick, vor dem die dialektisch-historischen Kategorien dahinsinken, als seien sie nur Theoretiker-Schimäre. Unser Lyriker wagt es, ganz privat zu empfinden, den „Ausreden noch und noch“ zu mißtrauen. Er setzt entweder auf subjektive Erkenntnisdaten oder gleich auf die gegebene Undurchschaubarkeit des Großen und Ganzen. Früher war sein suchendes Parlando auffahrend, kritisch. Jetzt klingt es eher abwiegelnd, achselzuckend. „Das, was erscheint, wenn du es gegen das Licht hältst – hält, vielleicht, tausend Jahre, oder noch eine Minute.“
Das lyrische Ich Enzensberger, Sprüche und Bilder lehren es nun, weiß jetzt nicht bloß, daß „man“ sterben muß, sondern daß ich sterbe.
Schmerzloser Sog,
selbstvergessen,
feierlich leichtes
Gleiten, dem
Dunkleren zu.
Dadurch wird besagtes lyrisches Ich nicht etwa apathisch, sondern aufregend daseinsbewußt. Enzensberger sieht immer mehr das Besondere, das Schöne, das Ungeheuerliche – im scheinbar Normalen. „Restlicht“ heißt ein Gedicht, das auf die relative Vitalität des alten Mitteleuropa hinweist. Die „Schlaftablette“, der „Hase im Rechenzentrum“, „Einige Vorzüge der Zivilisation“ werden gefeiert – des Poeten einstiges Engagement hingegen für Castros Cuba erscheint wie ein unendlich ferner Traum.
Unter dem Schutt der ideologischen Systeme liegen nun Enzensbergers lyrische Wahrheiten. Manchmal verdünnt er seine Texte zu kleinen Dialog-Szenen, wo lauter Redensarten oder gar Kürzel in Klammern sich miteinander unterhalten. Das ist dann nur mehr Tagebuch, und kaum mehr Lyrik.
Und wieder scheint sich der Stellenwert des Ästhetischen geändert zu haben. Das einst viel beredete Problem der engagierten Literatur oder Lyrik ist Enzensberger ohnehin immer ein Scheinproblem gewesen. Mittlerweile weiß er, daß nicht gesellschaftliche oder politische Mächte die (unentbehrliche? Lebenssinn stiftende?, tröstliche?) Wirkung der Kunst zum Erliegen bringen können, sondern Kümmerlicheres.
Es braucht weniger, als du denkst:
drei Tage Schluckauf
eine kaputte Heizung
Vertrauensverluste in Tokyo
Haarrisse im, Primärkreislauf
Seekrankheit
Sauerstoffmangel
Zahnweh
Schon zählt das 21. Jahrhundert nicht mehr
Schon wird es dir schwarz vor den Augen
und du bringst es nicht fertig
diese Zeile zu Ende zu lesen.
Joachim Kaiser, aus Rainer Wieland (Hrsg.): Der Zorn altert, die Ironie ist unsterblich. Über Hans Magnus Enzensberger, Suhrkamp Verlag, 1999
Tae-Ho Kang: Poesie als Kritik und Selbstkritik. Hans Magnus Enzensbergers negative Poetik, Dissertation März 2002
Hans Egon Holthusen: Chorführer der Neuen Aufklärung. Über den Lyriker Hans Magnus Enzensberger, Merkur, Heft 388, September 1980
Angelika Brauer: Im Widerspruch zu Hause sein – Porträt des Schriftstellers Hans Magnus Enzensberger
Michael Bauer: Ein Tag im Leben von Hans Magnus Enzensberger
Moritz von Uslar: 99 Fragen an Hans Magnus Enzensberger
Tobias Amslinger: Er hat die Nase stets im Wind aller poetischen Avantgarden
Gespräch mit Hans Magnus Enzensberger (1961)
Hans Herbert Westermann Sonntagsgespräch mit Hans Magnus Enzensberger (1988)
Aleš Šteger spricht mit Hans Magnus Enzensberger (2012)
Steen Bille spricht mit Hans Magnus Enzensberger am 5.9.2012 in der Dänischen Königlichen Bibliothek in Kopenhagen
Hans Magnus Enzensberger wurde von Marc-Christoph Wagner im Zusammenhang mit dem Louisiana Literature Festival im Louisiana Museum of Modern Art im August 2015 interviewt.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Eckhard Ullrich: Von unserem Umgang mit Andersdenkenden
Neue Zeit, 11.11.1989
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Frank Schirrmacher: Eine Legende, ihr Neidhammel!
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.11.1999
Hans-Ulrich Treichel: Startigel und Zieligel
Frankfurter Rundschau, 6.11.1999
Peter von Becker: Der Blick der Katze
Der Tagesspiegel, 11.11.1999
Ralph Dutli: Bestimmt nicht in der Badehose
Die Weltwoche, 11.11.1999
Joachim Kaiser: Übermut und Überschuss
Süddeutsche Zeitung, 11.11.1999
Jörg Lau: Windhund mit Orden
Die Zeit, 11.11.1999
Thomas E. Schmidt: Mehrdeutig aus Lust und Überzeugung
Die Welt, 11.11.1999
Fritz Göttler: homo faber der Sprache
Süddeutsche Zeitung, 12.11.1999
Erhard Schütz: Meine Weisheit ist eine Binse
der Freitag, 12.11.1999
Sebastian Kiefer: 70 Jahre Hans Magnus Enzensberger. Eine Nachlese
Deutsche Bücher, Heft 1, 2000
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Hans-Jürgen Heise: HME, ein Profi des Scharfsinns
die horen, Heft 216, 4. Quartal 2004
Werner Bartens: Der ständige Versuch der Alphabetisierung
Badische Zeitung, 11.11.2004
Frank Dietschreit: Deutscher Diderot und Parade-Intellektueller
Mannheimer Morgen, 11.11.2004
Hans Joachim Müller: Ein intellektueller Wolf
Basler Zeitung, 11.11.2004
Cornelia Niedermeier: Der Kopf ist eine Bibliothek des Anderen
Der Standard, 11.11.2004
Gudrun Norbisrath: Der Verteidiger des Denkens
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 11.11.2004
Peter Rühmkorf: Lieber Hans Magnus
Frankfurter Rundschau, 11.11.2004
Stephan Schlak: Das Leben – ein Schaum
Der Tagesspiegel, 11.11.2004
Hans-Dieter Schütt: Welt ohne Weltgeist
Neues Deutschland, 11.11.2004
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Matthias Matussek: Dichtung und Klarheit
Der Spiegel, 9.11.2009
Michael Braun: Fliegender Robert der Ironie
Basler Zeitung, 11.11.2009
Harald Jähner: Fliegender Seitenwechsel
Berliner Zeitung, 11.11.2009
Joachim Kaiser: Ein poetisches Naturereignis
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2009
Wiebke Porombka: Für immer jung
die tageszeitung, 11.11.2009
Hans-Dieter Schütt: „Ich bin keiner von uns“
Neues Deutschland, 11.11.2009
Markus Schwering: Auf ihn sollte man eher nicht bauen
Kölner Stadt-Anzeiger, 11.11.2009
Rolf Spinnler: Liebhaber der lyrischen Pastorale
Stuttgarter Zeitung, 11.11.2009
Thomas Steinfeld: Schwabinger Verführung
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2009
Armin Thurnher: Ein fröhlicher Provokateur wird frische 80
Falter, 11.11.2009
Arno Widmann: Irrlichternd heiter voran
Frankfurter Rundschau, 11.11.2009
Martin Zingg: Die Wasserzeichen der Poesie
Neue Zürcher Zeitung, 11.11.2009
Michael Braun: Rastloser Denknomade
Rheinischer Merkur, 12.11.2009
Ulla Unseld-Berkéwicz: Das Lächeln der Cellistin
Literarische Welt, 14.11.2009
Hanjo Kesting: Meister der Lüfte
Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Heft 11, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Arno Widmann: Der begeisterte Animateur
Frankfurter Rundschau, 10.11.2014
Heike Mund: Unruhestand: Enzensberger wird 85
Deutsche Welle, 10.11.2014
Scharfzüngiger Spätaufsteher
Bayerischer Rundfunk, 11.11.2014
Gabi Rüth: Ein heiterer Provokateur
WDR 5, 11.11.2014
Jochen Schimmang: Von Hans Magnus Enzensberger lernen
boell.de, 11.11.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Andreas Platthaus: Eine Enzyklopädie namens Enzensberger
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.2019
Andreas Platthaus: Der andere Bibliothekar
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.2019
Peter von Becker: Kein Talent fürs Unglücklichsein
Der Tagesspiegel, 10.11.2019
Lothar Müller: Zeigen, wo’s langgeht
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2019
Florian Illies: Im Zickzack zum 90. Geburtstag
Die Zeit, 6.11.2019
Jörg Später: Hans Magnus Enzensberger wird 90
Badische Zeitung, 8.11.2019
Anna Mertens und Christian Wölfel: Hans Dampf in allen Gassen
domradio.de, 11.11.2019
Ulrike Irrgang: Hans Magnus Enzensberger: ein „katholischer Agnostiker“ wird 90!
feinschwarz.net, 11.11.2019
Richard Kämmerlings: Der universell Inselbegabte
Die Welt, 9.11.2019
Bernd Leukert: Igel und Hasen
faustkultur.de, 7.11.2019
Heike Mund und Verena Greb: Im Unruhestand: Hans Magnus Enzensberger wird 90
dw.com, 10.11.2019
Konrad Hummler: Hans Magnus Enzensberger wird 90: Ein Lob auf den grossen Skeptiker (und lächelnden Tänzer)
Neue Zürcher Zeitung, 11.11.2019
Björn Hayer: Hans Magnus Enzensberger: Lest endlich Fahrpläne!
Wiener Zeitung, 11.11.2019
Wolfgang Hirsch: Enzensberger: „Ich bin keiner von uns“
Thüringer Allgemeine, 11.11.2019
Rudolf Walther: Artistischer Argumentator
taz, 11.11.2019
Kai Köhler: Der Blick von oben
junge Welt, 11.11.2019
Ulf Heise: Geblieben ist der Glaube an die Vernunft
Freie Presse, 10.11.2019
Frank Dietschreit: 90. Geburtstag von Hans Magnus Enzensberger
RBB, 11.11.2019
Anton Thuswaldner: Der Zeitgeist-Jäger und seine Passionen
Die Furche, 13.11.2019
Alexander Kluge und Hans Magnus Enzensberger: „Maulwurf und Storch“
Volltext, Heft 3, 2019
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + Internet Archive +
KLG + IMDb + PIA +
Interviews + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Hans Magnus Enzensberger: FAZ 1, 2, 3, 4, 5 & 6 ✝︎ ZDF ✝︎
Welt 1, 2 & 3 ✝︎ SZ 1, 2 & 3 ✝︎ BZ ✝︎ Berliner Zeitung ✝︎ RND ✝︎ nd ✝︎ FR ✝︎
Tagesspiegel ✝︎ der Freitag 1 & 2 ✝︎ NZZ ✝︎ Zeit 1, 2 & 3 ✝︎ Spiegel 1 & 2 ✝︎
DW ✝︎ SN ✝︎ Die Presse ✝︎ SRF ✝︎ Stuttgarter Zeitung ✝︎ Tagesanzeiger ✝︎
taz ✝︎ Cicero ✝︎ Standart ✝︎ NDR ✝︎ Lyrikzeitung ✝︎ Falter ✝︎ Rheinpfalz ✝︎
Junge Freiheit ✝︎ Aargauer Zeitung ✝︎ junge Welt ✝︎ Aufbau Verlag ✝︎
Hypotheses ✝︎ Furche ✝︎
Gedenkveranstaltung für Hans Magnus Enzensberger:
Andreas Platthaus: Auf ihn mit Gefühl
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.6.2023
Peter Richter: Schiffbruch mit Zuhörern
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2023
Dirk Knipphals: Die verwundete Gitarre
taz, 22.6.2023
Maxim Biller: Bitte mehr Wut
Die Zeit, 29.6.2023
Hans Magnus Enzensberger – Trailer zu Ich bin keiner von uns – Filme, Porträts, Interviews.
Hans Magnus Enzensberger – Der diskrete Charme des Hans Magnus Enzensberger. Dokumentarfilm aus dem Jahre 1999.
Hans Magnus Enzensberger liest auf dem IX. International Poetry Festival von Medellín 1999.


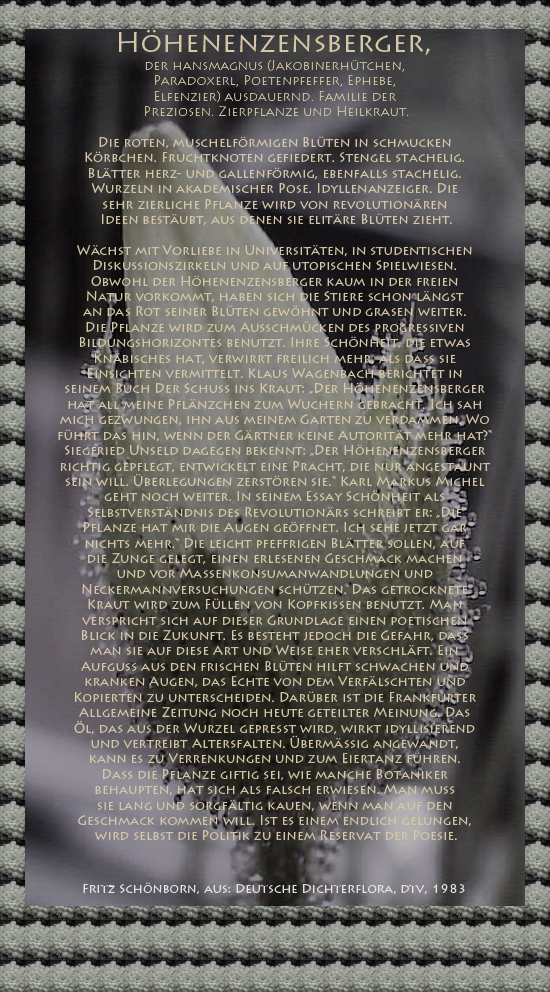
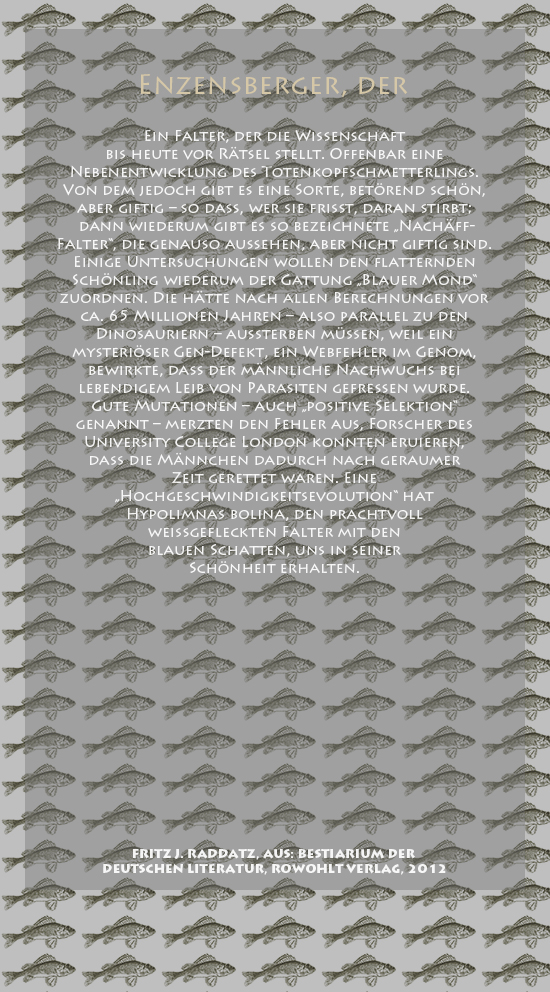












Schreibe einen Kommentar