Sascha Anderson & Elke Erb (Hrsg.): Berührung ist nur eine Randerscheinung
GEDICHTE EINES ALTEN MANNES AUS PRAG
ich fing an über den Sinn meines Lebens
aaaaanachzudenken
erst als ich fünfzig wurde
die Konsequenz davon ist
daß ich viel über das Sterben nachdenke
Epitaph
hier liegt ein Mann dessen Körper feucht war wie der
aaaaaKörper
aaaaader anderen
hier liegt ein Mann dessen Körper in der Trockenzeit
aaaaatrocken war
trocken wie die Körper dieser anderen
hier liegt ein Mann dessen Körper fault wie die Körper aller Menschen in einer ähnlichen
aaaaaSituation
ich habe dank der tagtäglichen Einsamkeit die Wahrheit des Lebens gefunden
es geht um den körperlichen Kontakt zu den Menschen die wir lieben
meine Gesundheit ist eine große Stütze für mein Schreiben
meine unproblematische finanzielle Situation ist eine große Stütze für mein Schreiben
und der glückliche Kern meiner Seele ist auch eine große Stütze für mein Schreiben
und außerdem ist meine Lust nach Selbstzerstörung eine große Stütze für mein Schreiben
und meine Krankheiten
und mein langweiliger Beruf
und meine Einsamkeit
ich habe Lust diesen Satz zu schreiben:
ich bin mit nichts und mit niemandem böse
und diesen Satz:
ich habe mir abgewöhnt zu hassen
ich habe den Drang ein Gedicht zu schreiben
das bestimmt den Gedichten ähneln würde
die alte Dichter schreiben
alle alten Dichter schreiben ungefähr das Gleiche
daß in ihnen Frieden ist
daß sie liebten und daß sie geliebt wurden
daß sie etwas wie Ruhe und Glück empfinden
(wenigstens einmal schreibt es jeder von ihnen)
ich habe Lust auch etwas Ähnliches zu schreiben
aber etwas hindert mich daran
es fällt mir dazu nichts wirklich Originelles ein
das was mir einfällt
ist mir nicht originell genug
unlängst habe ich mir zum Beispiel diesen Satz notiert:
ich bin gücklich daß ich mich mit den Reinigungsanstalten nicht über Flecke streiten muß
und dieser Satz:
Flecke sind mir gleichgültig
ich glaube aber
daß das nicht reicht
ich bin im Grunde ein Anfänger
ich habe Bildungslücken
ich bin naiv
ich weiß aber
mit Sicherheit
daß Kunst auch aus Naivität entstehen kann
daß sie schlicht sein darf
ich weiß das alles schon mindestens zehn Jahre
und jetzt kann ich nur eins hinzufügen
daß ich jetzt ein nichtoriginelles Gedicht mehr habe
auf der Welt gibt es keine ernsteren Probleme
alles verläuft wie erwartet
ich revoltiere gegen nichts
ich warte auf nichts
ich wünsche mir nichts …
Jan Faktor
Vorwort
Die Texte dieses Buches sind im persönlichen Kontakt der Autoren gesammelt worden. Hauptorte der Begegnung und literarischen Lesungen sind Jugendklubs, kirchliche Räume und Privatwohnungen. Außer Uwe Kolbe ist mir kein Autor von publizierten Texten her bekanntgeworden. Seit mehreren Jahren kenne ich die Berliner Döring, Papenfuß-Gorek, Brasch, Rathenow, Rosenthal, Röhler. Anderson und Schleime kamen aus Dresden, Opitz aus Halle. Seit zwei Jahren kenne ich Hübner aus Dresden, G. Kachold aus Erfurt, Manske, Tom di Roes, Lorek und Faktor aus Berlin. Seit Beginn der Arbeit an der Anthologie im Sommer 1983 lernte ich die Dresdener Rom, Bozenhard, Fiedler, Wüstefeld, Palma und Behlert (der jetzt in Berlin lebt) kennen, ebenso Schedlinski, der aus Magdeburg kam, den Berliner Reichenau und den Leipziger B. Igel. Das Geburtsjahr der ältesten von ihnen ist 1951, das des jüngsten 1963. Diese Anthologie jüngerer DDR-Autoren hat gewiß nicht alle Autoren, die hinein gehört hätten, erfaßt, und mit Sicherheit ist ihre Zahl in ein paar Jahren erheblich größer. Die auffällig klar ausgeprägte Individualität, die Unverwechselbarkeit und Vielfalt der Arbeiten bringen in die Literatur ein neues, zumal bei jüngeren Autoren sonst ungewohntes Selbstbewußtsein, das so auffällig ist wie die bemerkenswerte Selbstverständlichkeit, mit der sich hier eine große Zahl junger Menschen literarisch artikuliert. Denn sie schreiben um zu leben und haben nicht etwa, wie man angesichts ihrer ‚Aussteiger‘-Lebensläufe denken könnte, „auf alles verzichtet, weil sie sich der Literatur verschrieben haben.“ Ebensowenig war es aber lediglich so etwas wie eine freie Wahl, die sie dazu gebracht hat, den beruflich-gesellschaftlichen „Aufstiegschancen“ den Rücken zu kehren. Ihnen allen war es unmöglich, die offiziell vorgesehenen Wege zu gehen, sie suchen statt dessen nicht zuletzt mittels der Literatur die Chancen für das, was nicht Aufstieg, sondern Leben heißt. – Kapitulation vor der Realität? Es so zu sehen, diese, die Realität zu personifizierten (so, als sei sie „der Feind“) und gleichzeitig zu übersehen, daß sie von Menschen gemacht ist. Man könnte also ebenso gut oder schlecht sagen, „die Realität“ habe versagt. Sie kapitulieren nicht, sie schreiben, malen, musizieren, sie produzieren ein neues (korrektives, verantwortendes) Denken, eine neue Musik, neue Literatur und bildende Kunst. Fiedler, Palma und Bozenhard sind Musiker, schreiben aber auch, Cornelia Schleime ist Malerin, schreibt und filmt, Anderson malt auch und tritt in Bands auf, Lorek und Papenfuß tragen in Gemeinschaft mit musikalischen Produktionen vor, Palma und Rom entwickeln ein Improvisationstheater, Günther, Rosenthal, Gabi Kachold und viele andere fotografieren oder arbeiten mit Fotografen zusammen, Schedlinski schreibt auch Kunstkritiken usw. Eine Vielseitigkeit wie in der Renaissance, könnte man sagen, stünde sie am Anfang einer neuen Zeit (und Utopie) und nicht am Ende einer alten. Sie leben auch nicht „der Zukunft zugewandt“, sondern der Gegenwart, und sie warten nicht, weil sie die Gegenwart kennen. Vor klaren Grenzen braucht man nicht zu warten. In ihren Systemen muß man nicht verharren. Was das Leben eingerichtet hat, ist für das Leben da.
Ich nehme mir das Recht heraus, Möglichkeiten zu haben, und das Ich als die größte Möglichkeit. (Volker Palma)
Mit dieser Selbstständigkeit geht eine unmittelbare Mündigkeit einher, die auch den Umgang mit der Sprache umfaßt und nicht erst in ihr erreicht werden muß. Sie beginnt dort, wo das Bevormundungswesen und Vormundschaftswesen endet. Wenn auch ein Teil der Autoren die gewohnten Sprach- und Literaturformen bemüht, zum Nutzen anderer Autoren mit großer Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit die in der Sprache gegebenen Möglichkeiten zur Sinn-Erkundung, bei der die Sprache aus ihren erstarrten Formen und Bindungen gelöst wird. In den zierlichen Prosaversen der „Gedichte eines alten Mannes aus Prag“ und in Sinnschüben, so schwerelos, als kämen sie aus dem Computer, spielt Jan Faktor die Ausdrucksmittel einer spannungslosen, minimal beanspruchten Normalsprache durch, während Uwe Kolbe nach Wegen sucht, dem „Wort als Mündel der Begriffe“ (Schedlinski) seine Unschuld wiederzugewinnen. Gabi Kachold setzt sich der Obdachlosigkeit von Klischeebildungen und Allgemeinplätzen aus, Opitz verwandelt den Totengräberzug der Geschichtsdarstellung in einen Mummenschanz der vielgestaltigen Umgangssprache und echter wie erfundener historischer Zitate. Reichenau aber nimmt behutsam den mühsamen, aber dafür in seinen Beziehungen zwischen Meinung und Wort elementaren Text der Spracharmen auf. Karsten Behlert, Thomas Günther, Fritz Hendrick Melle, auch Michael Wüstefeld gebrauchen „novatorische“ Mittel neben konventionellen.
Bei allen ist jeder individuelle Sprachgebrauch existenziell motiviert und bedeutet für die Autoren die Chance, Ihren spezifischen Punkt in der Vielzahl der Stimmen und Diskurse bewußt zu bestimmen. Wahrscheinlich wird ihnen die Aufeinanderbezogenheit der Dispute und Gespräche bewußter werden, wenn sie sie in dieser Anthologie gespiegelt sehen. Ein starker Trend zur Gemeinschaftsarbeit ist bereits seit langem wirksam, ebenso hat sich die Zielorientierung vom Arbeitsresultat auf den Prozeß verschoben. Auch daß sie durchweg die Angaben zur Person für unwichtig erachten, entspricht diese Offenheit und Tendenz zur Objektivität.
Es könnte, allerdings nur bei sehr oberflächlicher Kenntnisnahme, z.B. angesichts der Kleinschreibung, daß ‚&‘ für ‚und‘, der englischsprachigen Stellen und der verschiedenen literarischen Neuerungen die Meinung entstehen: Aha, sie hatten das nicht, holen es jetzt nach. So als ob die DDR-Jugend sich also um eine Fremde Modernität bemühe. Dazu ein paar Bemerkungen: Diese Generation ist bei uns wie überall mit Radio- und Diskomusik aufgewachsen, das Musik-Englisch zumindest ist eine Heimat für sie, und der Gebrauch des Englischen ist dort ganz natürlich, wo es einleuchtender und verständlicher als die Sprache der Väter ist. Schließlich kann es, wie die Anthologie zeigt, auch ein anderes Interesse für ausländische Literatur, z.B. die amerikanische, geben als ein solches, das lediglich vom modischen Auf und Ab des Literaturmarkts bestimmt ist. Das Entscheidende ist: Die Jugend in der DDR hat wie die Jugend westlicher Länder die automatisierten und anonymisierten Vollzüge der gegenwärtigen Zivilisation zu bestehen und steht wie diese in der Tradition der europäischen Moderne. Es ist auch für ihre Autoren keine „Ohrfeige dem öffentlichen Geschmack“ (Titel eines futuristischen Almanachs in Russland 1912) und kein „Avantgardismus“ mehr, wenn sie Stilmittel gebrauchen, die einmal als avantgardistisch gegolten hatten, die Überschreitung der konventionellen Sprachgrenzen ist für sie auch dann „normal“ und selbstverständlich, wenn sie solche Möglichkeiten erst jetzt für sich entdecken.
Es bedeutet ja eigentlich eine Normalisierung, wenn sie die Vielschichtigkeit, die ein Text im gewohnten Sprachgebrauch hintersinnig (im Hintergrund, „zwischen den Zeilen“) aufbaut, im Text Vordergrunds selbst „Zur Sprache bringen“, also Hinter- und Untergründiges veröffentlichen. Als Bert Papenfuß-Gorek seine Sprache entwickelte, wurde er gefragt, ob er sich Jandl zum Vorbild nehmen. (Er kannte Jandl nicht.) Das, was er macht, ist, meine ich, näher mit dem Russen Chlebnikow verwandt als mit Jandl, aber die Fragesteller kannten Chlebnikow noch weniger als Jandl und benutzten Jandls Namen als Begriff für eine „esoterische Andersartigkeit“ überhaupt. Ich frage mich, ob diese „Unverständlichkeit“ vieler Texte, die auch Teil dieser Anthologie sind, nicht nur eine auf den ersten, scheuenden Blick ist. Man sollte doch bedenken, daß mit der „gewohnten“ Sprache auch deren Ungenauigkeit und Oberflächlichkeit gewohnt ist, und erwägen, ob nicht die Hemmschwelle vor ihrer ungewohnten Anwendung Teil eines Verblendungszusammenhangs ist, der der alltäglichen Lüge der Durchschnittssprache entspricht. Wir haben uns mit der Sprache, an deren Regeln und Grenzen wir uns angepaßt haben, identifiziert, so daß sie, die doch bloß ein Instrumentarium ist, uns vertrauter erscheinen kann als ein anderer Mensch. (Einem Ausländer gegenüber werden wir plötzlich beweglich, erfinderisch und eifrig, dort endet ihr Hoheitsgebiet.) Allerdings ist die „experimentelle Literatur“ (diese Bezeichnung setzt ihr einen falschen Fortschrittshut auf) gewöhnlich als aufsässige Literatur aufgetreten, als Provokation, Sport, Sprachkritik, und hat so den Zugang zu ihrem eigenen Leben erschwert.
Die Eigenständigkeit der hier vorgestellte Texte wird offensichtlich, wenn man sich auf den unkonventionellen „Sprachbenutz“ (Lorek) als Leser einläßt und den Sinn solcher Entgrenzungen (und ihre Verschiedenartigkeit von Autor zu Autor) überblickt. Sie sind eine selbstverständliche Anwendung des Möglichen, und selbst Übernahmen aus ihrer speziellen Tradition (etwa der dadaistischen oder der Wiener Gruppe) wären so zu verstehen, nicht etwa als ehrgeiziger Imitation. Uwe Hübner erzählte mir z.B. erfreut, daß er bei Ulrich Becher das richtige Mittel gefunden habe, die Wörter zu dehnen, indem man die einzelnen Buchstaben trennt. Karsten Behlert und Rainer Schedlinski sind von Sascha Andersons Beispiel angeregt worden, Gedichte zu schreiben. Behlert: Seine Entschiedenheit. Schedlinski: Endlich eine Sprache, in der man heute Gedichte schreiben kann. Der Grund der Anregung war nicht Eitelkeit und ihre Folge nicht ein „Schmuck mit fremden Federn“.
Die neue Literatur spiegelt ein neues gesellschaftliches Bewußtsein als Bewußtsein einer Jugend, die nichtmehr Objekt der ererbten Zivilisation sein will und kann. Sie beantwortet jedoch die chaotischen, deformativen, resignativen, nihilistischen Tendenzen, welche die gesamte Geschichte dieser Zivilisation prägen, nicht mehr mit Chaos, Deformation, Resignation, Nihilismus. Sie läßt sich nicht mehr infantilisieren von ihren utopischen Gehalten und widersteht ihren Kompromissen. „Glauben ersetz ich nicht mit weiterem Glauben“ (Uwe Kolbe, 1979). So ist sie auch nicht verführt zu einer folgenlosen Kritik und überhaupt über konfrontative Positionen hinaus. Dieses neue Selbstbewußtsein läßt sich nicht bestimmen und begrenzen von dem System, dessen Erbe es antritt. Seine soziale Reife ist die Konsequenz des Austritts aus dem autoritären System, der Entlassung aus der Vormundschaft eines übergeordneten Sinns. Diese soziale Reife ist von der Entwicklung der Zivilisation in einem Grade vorbereitet, daß sie von einem jugendlichen Bewußtsein erreicht werden kann (und nicht wie früher auf Ausnahmen beschränkt bleiben muß!)
Die allgemeinen Bedingungen dafür sind: Seit dreißig Jahren gibt es keine das Leben materiell gefährdende Not mehr. Daraus folgt ein Motivationsverlust, der die Autorität des zivilisatorischen Apparats erschüttert, denn sie ist auf der Not aufgebaut. Die arbeitsteiligen isolierten und spezialisierten Dienste, die dieser kannibalisch gebliebene Apparat aber fordert, lassen weder Notwendigkeit noch einen anderen menschlichen Sinn erkennen. Er steht zwar im Ganzen, zwischen der Not um den Menschen, zeigt sich aber, statt Mittel zu sein, zum Selbstzweck entfremdet. Die Steigerung dieser Unmenschlichkeit zur tödlichen Bedrohung mobilisiert in den kapitalistischen Ländern den millionenfachen Widerstand der Friedensbewegung, bei welcher eine ähnliche Mündigkeit zutage tritt wie die, die ich hier zu beschreiben versuchen. Nicht von einer unmittelbaren Not motiviert, überschreitet sie das autoritäre System nach der anderen Seite und ist, im deutlichen Unterschied zu früheren Protestaktionen, weder petitionär, noch aggressiv.
Mit dem moralischen Anspruch ihres Selbstverständnisses als sozialistischer Staat als die DDR in das Bewußtsein der Heranwachsenden von deren Kindheit an das Maß für die realen Möglichkeiten der Selbstverwirklichung gesetzt und eine Denkrichtung gegeben, die ebenso wirksam werden mußte wie ihre Parallele, nämlich die Aufklärung über die unmenschlichen Gesetze der geschichtlichen Entwicklung und speziell der kapitalistischen Produktion. Tatsächlich Ist die Jugend in der DDR geschützt vor dem „Wolfsgesetz der kapitalistischen Wirtschaft“ und ihren destruktiven Anpassungszwängen aufgewachsen. Die praktische Unkenntnis der kapitalistischen Außenwelt erlaubte allerdings dem Jugendlichen, Bilder einer idealen Lebensbewältigung jenseits der Grenze für real zu halten. Aufgrund dieser psychischen Projektionen lag ein gut Teil des Elans brach, den das „eigene“ Nein den Jugendlichen abforderte. Die Unmöglichkeit, diese Außenwelt selbst zu sehen, hielt mit Sicherheit auch theoretische Energien wach. Weiter bietet die DDR kaum Spielraum, individuelle Energie an Bemühungen um wirtschaftliche Selbstständigkeit zu vergeuden. Schließlich, und das ist nach diesen verschiedenen stimulierenden und stabilisierenden Voraussetzungen entscheiden, hat die DDR mit ihrer Planwirtschaft und deren spezifischen Schwierigkeiten die Zivilisation am eigenen Beispiel als Menschenwerk durchschaubar gemacht.
Durchschaubar als das Werk von Menschen zudem, die den Autoren bekannt sind, von ihren Eltern her (die meisten von ihnen kommen aus der Arbeiterklasse), von sich selbst, aus den Erfahrungen, die sie mit ihnen gemacht haben, aus der „verstärkten Verbindung von Ausbildung und Praxis“, die die „Richtlinie“ fordert. Unter diesen Voraussetzungen – wo hätte die kapitalistische Entfremdung Platz gehabt (über das hinaus, was sie als Erbe der Vergangenheit kennzeichnet), die heranwachsende Intelligenz mit ihren Schrecken und Verheißungen zu besetzen?
„Es gibt StandPunkte / da den Betrachter wie / dort den immer Falschen / Das könnte ein KinderSpiel sein.“ (Michael Wüstefeld) – Diese Sammlung ein Spiegel des Untergrunds und ihre Autoren als Dissidentin zu vermarkten, hieße einen entscheidenden Entwicklungsschritt zu ignorieren und in die Unreife zurückzugehen. Es widerspräche nicht nur dem Sinn dieses Buches, sondern auch der Wirklichkeit, die es darstellt. Es ist kein Buch über die DDR, sondern ein Buch aus der DDR, und ich meine, es tritt gerade mit den vielstimmigen Positionen zudem über alle Grenzen der zivilisierten Welt reichenden Themen so real und leibhaftig auch über die deutsche Grenze, daß es die nebulöse Vorstellung von der DDR als einer terra incognita zerstreut. Diese Vorstellung wird ja, darüber sollte man sich klar sein, immer wieder erneuert von dem so erfolglosen wie hartnäckigen Versuch, die DDR mit Schlagworten einzufangen. Der Grund des Scheiterns ist nicht die Fremdheit zwischen den beiden deutschen Staaten, sondern eine Art von Unwirklichkeitsstil, zu welchem die deutsche Geschichte erzogen hat. „Die DDR ist ein Land wie jedes andere“ sagte, wie dem TV zu entnehmen war, eine bayerische Schülerin nach einer Erkundungsfahrt, „ich verstehe nicht, warum immer so auf ihr herumgehackt wird.“
Fritz Hendrick Melle setzt die psychologische Formel der Feindschaft auf den Bruchstrich: „begreift das, das wesen ist zwei. läßt keine / mehrheit zu. die anderen seid ihr. immer der euch / gegenüber, / geht los und verteidigt euch. / geht los.“ – und sein Nenner kürzt sie weg:
mit augen ohren zähnen fäusten. das gegeneinander
hält aufrecht.
es fällt immer der andere.
So wie Melle diese Konsequenz nicht aus psychologischen Lehrbüchern gezogen hat, ist die Sequenz von Bert Papenfuß-Gorek „schrei gegen die wand, schreib es an die wand, schreite durch die wand“ keine Regel meditativer Vertiefung oder Losung drogistischer Bewußtseinssteigerung, sondern eine Bilanz- und Bewegungsformel, entworfen aus dem nüchternen und keineswegs vertieften oder gesteigerten Alltag der bewußten Gegenwart. Es ist jene Wand des falschen Bewußtseins, der Lüge, Leugnung, Unterdrückung, der Spaltung, der Infantilisierung und zynischen Paralyse, die Kerkerwand des Hochmuts, der erstarrten Potenz, die Glaswand der Unwirklichkeit und die isolierende Wahnwand der Verzweiflung, die zu durchschreiten ist.
Elke Erb, Februar 1984
DIE ZUSAMMENHÄNGE SIND EINFACH…
− (Anmerkung zu den in einem Bildteil vorgestellten Künstlerbüchern) Anm. der Redaktion. −
vielleicht ist es nur ein idealisiertes abbild? der glanz einer vergangenheit aus ihren bildern, spiegeln die zweidimensionalen räume womöglich mehr die zeit? und ist dies gar ein grund für die ewige wirkung jenes dunkelnden oder gilbenden mediums bild? die form der fragen nach dem puls einer scheinbaren konjunktur. „jede achte welle ist eine große.“ „die zusammenhänge sind einfach & …“? die gründe für das permanente phänomen der schrift im bild sind unzählig wie die gesetzeslücken, die so verschiedenen quellen der schwarzaufweissen bildgewordenen wörter, worte, verschwiegen wie am morgen ein frauenmund voll traum. und all die gründe verlieren sich nicht, existieren im hintergrund auf den gassen wie strohwitwen der zeitgeistigen plätze. nun aber geht man wahrscheinlich nicht mehr ins zentrum, so wie man noch im anfang dieses jahrhunderts kam, um sich zu verbinden mit den anderen komponenten einer kultur, zu der einst auch die wissenschaften zählten, bevor sie sich im untergrund militärpolitischer macht prostituierten, sondern…, nein, das zentrum ist eine fiktion, oder vielmehr meine heimatliche arschbacke dieser zentralen ausdrucksplattform „anti-zeitgeist“. hier stehen sich ja nicht, wie annehmbar, diktatur und demokratie gegenüber, sondern diktatur und pluralismus, ineinander verkrampft, tragödische zwillinge, erwachsen aus den todfeinden demokratie und faschismus. Und jede der seiten beherrscht die mittel der gemeinsamen vergangenheit mehr oder weniger perfekt für das eigene ziel zukunft.
und so beginnt der folgende Bildteil, jedes du ist ein wir, brücke zwischen den sinnen, gedächtnis in bildern, geste der autonomie, ästhetik des ungedruckten, buch im buch, mit dem datum: 10. Mai 1983 (in den kalendern der ddr „tag des freien buches“). auf den seiten … stelle ich etwa einviertel einer gemeinschaftsarbeit von dresdener malern, dichtern und musikern unter dem titel BUCH vor. dieses buch vereint verschiedenste ästhetische konzeptionen und mehrere generationen, und es ist ein einzelexemplar. das unikat, das original, das gebundene einzelstück, das POE SIE ALL BUM in einer textauflage von 20 bis 100 stück. alle umschläge und eingebundenen leporellos sind handgezeichnet. in drei jahren erschienen knapp zwanzig. POE SIE ALL BUM ist eine autorenredaktion im gegensatz zu UND, die zeitschrift UND wird von einem dresdener musiker und dichter monatlich herausgegeben. UND ist ebenfalls gebunden und mit einem handgearbeiteten umschlag und originalen versehen. jeder, der seinen beitrag in einer 15er auflage an den herausgeber schickt, wird veröffentlicht. neben UND erscheinen in ähnlicher art in der ddr noch vier weitere hefte. vor zwei jahren habe ich in leipzig die internationale buchkunst ausstellung besucht. die beiträge der bildenden künstler der ddr setzten sich fast ausnahmslos zu den toten klassikern der literatur ins verhältnis. zur selben zeit, im hintergrund sozusagen, und ohne die mittel der künstlerischen druckwerkstätten vor allem in leipzig, aber auch in dresden und berlin in den kunsthochschulen und verbandsdruckereien, eine vielzahl von gemeinschaftsarbeiten zwischen grafikern und dichtern der generation zwischen 20 und 30, die kaum in öffentlichen räumen ausgestellt werden… auf seite… sind einladungs-plakate, wie sie zu fast allen privaten oder privat organisierten lesungen und veranstaltungen gedruckt werden, zu sehen.
an folgenden buch- und mappeneditionen will ich erklären, wie sich gesetze und verfügungen auch in der ddr auf die realität einstellen und umgekehrt. 1978 haben wir als eines der ersten freien schriftgrafischen bücher KEIN WIND SCHLÄGT DIE FLÜGELFLÜGELTÜREN ZU als künstlerisches experiment in der druckerei des verbandes bildender künstler in dresden gesetzt und gedruckt. etwa gleichzeitig gab die obergrabenpresse, ebenfalls in dresden, die erste mappe einer umfangreich geplanten serie mit satz- und druckgenehmigung heraus. nach dem buch KEIN WIND SCHLÄGT DIE… wurden verfügungen erlassen, die jedes gedruckte wort, das nicht integrierter bestandteil einer grafischen arbeit ist, genehmigungspflichtig machte. auch die obergrabenpresse konnte nur noch eine mappe durch die zensur bringen. die dritte mappe der serie, KNEIPENBILDER UND KNEIPENTEXTE von ralf winkler (a.r. penck), der damals noch in dresden lebte, war in der form schon so wie das eben erschiene buch DIE TAGE SIND GEZÄHLT. die texte wurden von den grafikern in die druckplatte geätzt. die flotte der sinnwracks und formschiffe wird konternd ergänzt von den, im rücken folgenden, sinnschiffen und formwracks. gold. die bekenntnisse der mitte fleddern literaturleichen, verteilen preise und renten über die ganze armada. im kreisverkehr durch die eigene provinz reibt die akademie ihre ellebogen klassenkämpferisch an den grenzen, stellen die etablierten in internationalen ausstellungen die künstlerische rote faust zur schau. und wieder die spiralbewegungen der körper aufs zentrum. und wieder die fliehkraft der sinne. und wieder werden aus brücken lücken. und wieder eine internationale buchkunst ausstellung in leipzig. und wieder mal sind die zusammenhänge einfach & irreal.
s. anderson, 27.2.1984
Vorbemerkung
Der vorliegende Band ist das Ergebnis der verdienstvollen und unermüdlichen Arbeit der Herausgeber Sascha Anderson und Elke Erb, die beide eine wichtige Rolle im heutigen literarischen Leben der DDR spielen. Es ist ihnen nicht nur gelungen, eine große Zahl bisher unbekannter junger Autoren ihres Landes für diese Anthologie zu gewinnen, sondern darüber hinaus das aufsehenerregende Bild eines sich grundlegend wandelnden literarischen Selbstverständnisses zu dokumentieren, das sich bei einem großen Teil der heute zwanzig- bis dreißigjährigen Autoren der DDR vollzogen hat. Auffallend ist eine für bundesdeutsche Verhältnisse heute fast unbekannte Aufmerksamkeit, Sensibilität (und auch Verletzbarkeit) gegenüber dem „Material“ jeder Literatur, der Sprache. Die bei fast allen Autoren erkennbare Tendenz, der Sprache als Form und Gegenstand des literarischen Schreibens selbst eine ganz eigenständige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, besitzt natürlich ihre (oft ungenannte) Tradition, ist aber mit Sicherheit v.a. eine Antwort auf Schädigungen und Verdinglichungen durch eine immer mechanischer funktionierende öffentliche und offizielle Verwaltungs- und Deklamationssprache. Erkennbar löst diese neue Tendenz eine im Vergleich dazu stärker „inhaltlich“ ausgerichtete literarische Kultur ab, die die Generation der heute etablierten und weit über die DDR-Grenze hinaus geachteten DDR-Schriftsteller in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben (Christa Wolf, Hermann Kant, Stefan Hermlin, Ulrich Plenzdorf, Günter de Bruyn, Erwin Strittmatter, Stefan Heym, aber auch Volker Braun oder zum Beispiel erst jüngst Christoph Hein). Ein weiteres Merkmal fast aller in diesem Band versammelten Autoren (die nur eine kleine Auswahl darstellen!) mit all ihren verschiedenen Biographien, ist die große persönliche Entschiedenheit, mit der sich junge ‚Bibliotheksfacharbeiter‘, ‚Schienenfahrzeugschlosser‘ oder Ingenieure von einem bestimmten Punkt ihres Lebens an der Literatur verschrieben haben, einem Gebiet, das für fast keinen der hier veröffentlichten Autoren ein gesichertes Einkommen oder öffentliche Anerkennung mit sich bringt (ein Teil der Autoren hat in der DDR in Sammelbänden, Anthologien, Gedichtbänden usw. eine kleine Öffentlichkeit gefunden, andere Autoren haben bisher – zum Beispiel aus politischen oder kulturpolitischen Gründen – überhaupt noch keine Texte in der DDR veröffentlichen können und tragen ihre Arbeiten lediglich bei kleinen Lesungen in Clubs, privaten Zirkeln oder im kirchlichen Bereich vor). Eine weitere Auffälligkeit ist, daß bei den hier versammelten Autoren häufig eine Verbindung zu anderen künstlerischen Bereichen, speziell zu bildenden Kunst, Malerei und Graphik, und zur Musik, vor allem Jazz, Rockmusik und Punk besteht. Alle Autoren sind nach der Gründung der DDR im Jahre 1949 geboren, Ihre Erfahrung, ihre Kenntnise, ihre Träume und ihre Ängste, ihre Sprache und ihre Themen sind Teil des Landes, in dem sie aufgewachsen sind und das für das bundesdeutsche Bewußtsein immer noch hinter Klischees aller Art verschwimmt (und sei es nur der unsäglich dummen Vorstellung von den Mitläufern/Funktionären hier und den aufrechten ‚Dissidenten‘ dort). Wenn dieser Band, der voller unterschiedlicher Stimmen und Bilder ist, dazu beiträgt, diese Klischees zu unterlaufen, so hat er eine wichtige Aufgabe erfüllt. Dabei muß hinzugefügt werden, daß die Herausgeber selbstverständlich zuerst einmal das Ziel hatten, diese Anthologie auch in der DDR erscheinen zu lassen. Dies kam bisher leider nicht zustande, möglicherweise, weil einige der hier versammelten Autoren nach der Fertigstellung des Manuskripts im Jahre 1984, als die DDR-Behörden einer größeren Zahl von DDR-Bewohnern die Ausreise genehmigten, ihr Land verlassen haben.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, September 1984
Kuchenkrümel Kommunismus
− Heiner Sylvester über die junge Literatur der DDR Unter dem Titel Berührung ist nur eine Randerscheinung haben die Ost-Berliner Autoren Elke Erb und Sascha Anderson eine Anthologie junger Schriftsteller aus der DDR zusammengestellt, die nun nur im Westen erschienen ist. –
Die Geschichte eines Buches ist normalerweise eine Randerscheinung. Vor sieben Jahren initiierte der Schriftsteller Franz Fühmann eine Anthologie unbekannter neuerer DDR-Literatur, um sie zumindest in der literarischen Fachwelt bekanntzumachen. Fühmann hoffte auch, damit den jungen Literaten helfen zu können. Die Sammlung wurde als internes Material in der Akademie der Künste veröffentlicht und wirkte katastrophal. Die Absicht schlug ins Gegenteil um. Die Schriftsteller bekamen Schwierigkeiten, die bis zum Lesungsverbot reichten. Der geschlagene Fühmann konnte sich nur noch bei den Autoren entschuldigen. Unveröffentlichte Manuskripte häuften sich weiter in den Schubladen. Elke Erb, sie interessierte sich besonders für das neue Verhältnis zur Sprache, knüpfte an der Fühmannschen Sammlung an und nahm vor zwei Jahren die Arbeit an einer neuen Anthologie auf. Sascha Anderson, einer der Protagonisten dieser jüngeren DDR-Literatur, stellte dazu weitere Kontakte her. Die Zufälligkeit seines literarischen Bekanntenkreises beeinflußte auch die Auswahl der Autoren. Anderson und Erb boten Anfang 1984 das Manuskript sowohl dem Ost-Berliner Aufbau-Verlag als auch dem Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch an. Aufbau studierte das Manuskript eingehend und zögerte. Auf der Leipziger Buchmesse gab Aufbau-Chef Faber die offizielle Version der Ablehnungsbegründung bekannt: „Gewogen und zu leicht befunden – literarisch nicht akzeptabel.“ Fragt sich, mit welchem Maß gewogen wurde. In die Wagschale gelegt wurden mit Sicherheit die 9 der 29 Schriftsteller der Anthologie, die in der inzwischen vergangenen Zeit die DDR verlassen hatten. Nun haben wir den Band von Kiepenheuer & Witsch, hier im Westen, wo er doch zuallererst in den Osten gehören würde. Ein Fehlstart. Die DDR kommt um diese jüngste Generation nicht mehr herum. Die hier vorgestellten Schriftsteller repräsentieren keinen literarischen Untergrundzirkel. Sie sind längst keine schreibende Minderheit mehr, sie verkörpern durch ihre Lebenshaltung und ihre Literatur eine Entwicklung, die bisher von der Öffentlichkeit der DDR nicht zur Kenntnis genommen wurde. Auch das hat Geschichte: Im Denken der Staatsgründer und ihrer Nachfolgegeneration ist Sozialismus und gerade dessen real existierende Form gleichbedeutend mit einem gültigen Entwurf. Die bestehenden ökonomischen und politischen Strukturen werden mit der Idee, die eigentlich eine Utopie beschreibt, gleichgesetzt. Denken und Handeln werden einer ständigen Dualität unterworfen: sozialistisch oder nichtsozialistisch, für uns oder gegen uns, entweder – oder. Eine Polarität, die sich auch auf Inhalt und Sprache der Kunst auswirkte. Sinn und Wertigkeit einer moralischen und ethischen Begriffswelt nutzten sich mit der Sprache ab, wurden im Widerspruch zur Realität ausgehöhlt, ad absurdum geführt.
Und da liegen auch die großen abgenutzten Worte herum: liebe, zärtlichkeit, frieden, freiheit, gleichheit, brüderlichkeit, gerechtigkeit, en gros die kuchenkrümel kommunismus. (Leonhard Lorek)
Selbst Gegenentwürfe zur herrschenden Ideologie bleiben in ihrer Begriffswelt innerhalb der vorgegebenen Sprache und Zeichensetzung. Ein Reagieren, das die Sprache selbst zum Material jener Kette machte, mit der man sich an die herrschende Realität band. Die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 mit dem darauffolgenden Exodus vieler Künstler und Intellektueller ist eine Manifestation des Scheiterns. Eine neue Generation ist herangewachsen. In der Anthologie ist das Geburtsjahr des Ältesten 1951 und das des Jüngsten 1963; sie wurden in das Staatswesen DDR hineingeboren:
in der Epoche aus Klärung und Trennung (Uwe Kolbe).
Diese Generation stellte man gewissermaßen vor die Wahl, das Vorgegebene anzunehmen und sich einzufügen oder sich im Dauerkonflikt zu verschleißen.
Einer zu sein, der von sich selbst abweicht oder mit seinen Überzeugungen nichts erreicht (Thomas Günther).
Daraus entstand eine andere Haltung. Kein Protest auf der Straße, auch keine Petition, jene Mittel, die nur den Kreislauf von Macht und Ordnung festschreiben. „häng deine wörter an die wand und sie machen ein gesetz, das die wände verbietet“, schreibt Sascha Anderson. Wollten sie nicht Spielball des dualen gesellschaftlichen Mechanismus bleiben, mußten sie ihre Existenz aus den politischen Prinzipien des Staates lösen, Wege aus der Ordnung suchen. Auszüge aus den Biographien der im Buch vertretenen Literaten: … Exmatrikulation … Packer und Buchhändler … Exmatrikuliert … seither asozial … Lehrerin … Gelegenheitsarbeit … Entwicklungsingenieur … seitdem Heizer … Exmatrikulation … Chemielaborantin … ein Jahr Haft. „Ihnen allen war es unmöglich, die offiziell vorgesehenen Wege zu gehen, sie suchten statt dessen nicht zuletzt mittels der Literatur die Chancen für das, was nicht Aufstieg, sondern Leben heißt“, schreibt die Herausgeberin Elke Erb im Vorwort. Leben als Versuch, die gesellschaftliche Vereinnahmung, die Dualität, diesen Zwiespalt nicht nur im Kopf zu überwinden, sondern im Alltag und im Schreiben. Die neugewonnene Identität hat das Ich als Zentrum, selbstbewußt, aber auch verletzlich.
Ich nehme mir das Recht heraus, Möglichkeiten zu haben, und das Ich als die größte Möglichkeit (Volker Palma).
Alltag ist überleben, das Betonen des Ich bedeutet keinen Rückzug in eine Innerlichkeit. Es ist Ausdruck einer bewußten, konzentrierten Sicht auf die Außenwelt, mit aller Körperlichkeit. Schreiben als Aktion, als klärender Prozeß, notwendig:
schrei gegen die wand, schreib es an die wand, schreite durch die wand (Bert Papenfuß-Gorek).
An die Wand schreien. Das ist keine Metapher mehr, es ist ein existentieller Schrei gegen Wände und Grenzen. So scheint es paradox: Die Kraft, die aus den Texten spricht, ist ein Produkt von Mauern und Grenzen, Enttäuschung und Wut. Man will durch die Wand schreiten, braucht sie aber gleichzeitig, um sich zu spüren. Diesem Konflikt, dieser Zerrissenheit, stellen sich die Autoren literarisch unterschiedlich. In gewagter Nähe zur „Kollektivlüge“ der herrschenden Sprache, mit dem Versuch, „den Dingen den Namen wieder zu finden, den Namen sagen zu können“ (Uwe Kolbe), oder weit entfernt davon, die Sprache selbst als Versuchsfeld benutzend, sie aus ihren gesellschaftlich grammatischen Strukturen lösend. Die Texte geben sich tendenziell in dieser Folge die Hand. Das Erfahren von sprachlichen Grenzen, diese Sicht auf das längst zur Lüge gewordene Gitter aus Grammatik und Ideologie, provoziert Grenzüberschreitungen. Die Häufung von experimentellen Texten in der Anthologie verblüfft zunächst. Bei genauerer Betrachtung erweist sich jedoch, daß jeder Autor seinen subjektiven Zugang zur Sprache findet, ein unkonventioneller „Sprachbenutz“ (Lorek) auch im individuellen Gebrauch der Stilmittel, die die europäische Avantgarde geliefert hat. Nur einige der Autoren sind mir persönlich bekannt, vertraut ist mir manche Geographie, in der sie leben und in der die Texte entstanden sind: die langen geradlinigen Straßenzüge des Berliner Stadtbezirks Prenzlauer Berg. Die abbröckelnde, verblichene Schönheit der Gründerzeitfassaden mit ihren Balkonen, auf denen die Alten im Sommer Kontakt zum Leben auf der Straße suchen. Die Kneipen zwischen Metzger Eck und Wee Cee, zwischen Oderkahn und Mosaik. Bier und Schnaps sind billig. Die nächtlichen Treffen auf den Plätzen, nachdem auch das letzte Lokal seine gehunwilligen Gäste ausgespuckt hat. Danach irgendeine Wohnung, Freunde und Fremde auf engstem Raum, großzügige Gastfreundschaft, auch deren Mißbrauch. Sehnsucht nach Gemeinsamkeiten, aber auch Mißtrauen den unbekannten Personen gegenüber. Die letzte, brüderlich geteilte Flasche Wein besagt wenig, „berührung ist nur eine randerscheinung“ (Fritz-Hendrick Melle). Der folgende Tag wirft jeden auf sich selbst zurück. 19 der 29 Autoren leben oder lebten in Berlin. In jenem Berlin, das für mich heute so unerreichbar geworden ist wie früher der andere Teil der Mauerstadt. Einige Autoren leben in Dresden, mit dem internationalen Nahziel Prag, das oft zum Ersatz wurde für die fehlende Welt. Pfingsten Treffen in Prag. Unter den Malern, Schriftstellern und Musikern dieser Generation entwickelten sich ein vielfältiges Beziehungsgeflecht und das Bedürfnis, zusammen produktiv zu werden. Die Schwierigkeit, ihre Manuskripte zu veröffentlichen (außer Uwe Kolbe ist in der DDR meines Wissens von keinem der 29 Autoren ein Buch erschienen), provoziert geradezu einen Wechsel zum anderen Medium. Literatur, die keine Druckgenehmigung erhält, in eine Graphik geritzt, wird so zum bildnerischen Original und steht außerhalb der Gesetze, die ein Buch verbieten. Im Schlußteil des Bandes stellt Sascha Anderson, der auch hier Anfänge markierte, verschiedene solcher Editionen vor. Die Obergraben-Presse in Dresden erhielt über die Grenzen des Landes hinaus Bedeutung. Das Gefühl, daß jeder jedes machen könnte (weil man es mußte, weil man es wollte), ist besonders in Dresden ausgeprägt, wo es in Ralf Winkler (A.R. Penck) auch einen großen Anreger hatte. Die Kommunikation der Künstler und der Künste untereinander ist gleichzeitig notwendige Bedingung geworden, da öffentliche Resonanz fehlt. Die inzwischen faktisch verbotenen privaten Lesungen in überfüllten Wohnungen, in kirchlichen Gemeinderäumen und seltener in Jugendklubs der FDJ können das Vakuum auf lange Sicht nicht ausgleichen, auch nicht die wenigen handgeschriebenen Hefte, die zirkulieren. Es bleibt der Traum. Der ist die Straße, die Kneipe, die Landschaft und eine Fiktion wie Paris. Der Traum schafft neue Bilder, Bilder, die man braucht, um Brücken zu schlagen. Wird die Erschütterung zu stark, das Überleben im Alltag unerträglich, fallen diese Brücken ein. Man hat keine Utopie, das heißt, man hat keine Gegenwart. Da bleibt oft nur die hilflose Alternative, der Ausreiseantrag. Ein solcher Kreislauf ließe sich durchbrechen. Aber, wer will? Die Veröffentlichung der Anthologie im Aufbau-Verlag würde ein Zeichen sein.
Heiner Sylvester, Der Spiegel, 23.9.1985
Sascha Anderson und Elke Erb (Hrsg.):
Berührung ist nur eine Randerscheinung
Herausgeber dieser Anthologie sind der junge Autor Sascha Anderson (1953), (Jeder Satellit hat einen Killersatelliten, 1982, Totenreklame, 1984) und die der sogenannten „mittleren Generation“ angehörende Lyrikerin Elke Erb (1938), (Gutachten 1975, Der Faden der Geduld, 1978). Sie schrieb für diesen Band das informative Vorwort. Ein Vers des Lyrikers F.H. Melle (geb. 1960) gab dem Sammelband seinen Titel. Auswahlprinzip ist die Generationszugehörigkeit der Lyriker: der Älteste ist von 1951 der Jüngste von 1963: „Diese Anthologie jüngerer DDR-Autoren hat gewiß nicht alle Autoren, die hineingehört hätten, erfaßt, und mit Sicherheit ist ihre Zahl in ein paar Jahren erheblich größer.“ In der stattlichen Reihe von Autoren fallen einige bekannte Namen, wie Lutz Rathenow, Uwe Kolbe, Sascha Anderson und Bert Papenfuß-Gorek, auf, doch den meisten wird man zum ersten Mal begegnen. Diese jungen Künstler, die sich hauptsächlich in Jugendklubs, kirchlichen Räumen und in privaten Zirkeln treffen, bewegen sich sowohl innerhalb der in der DDR geltenden Sprach- und Literaturformen als auch jenseits deren Grenzen: durchgehende Kleinschreibung, verfremdende Wirkung von Wort- und Zeilenbrechung, Ersatz des „und“ durch die Type „&“, englische Wörter, Reminiszenzen an Jandl oder Chlebnikow bei z.B. Leonhard Loreks „Auszüge aus dem Sonett tausendundeins“. Alles dies sind Zeichen für ein Bemühen um „Modernität“. Nicht dieser verspätete Avantgardismus ist von Bedeutung, sondern, daß diese Literatur ein neues gesellschaftliches Bewußtsein dieser jungen Autoren spiegelt, „die nicht mehr Objekt der ererbten Zivilisation sein“ wollen oder können. Dies geschieht in einer deutlichen Abhebung von der älteren Generation: „Nicht mehr die Deutschen Brecht und Braun und Kirsch usw.“ (Rüdiger Rosenthal). F.H. Melle über sein Verhältnis zu Volker Braun: „Es ist so, daß der Braun für mich zur Erbmasse gehört. Er hat mir eigentlich nichts mehr zu sagen.“
Im Anhang präsentiert Sascha Anderson Grafiken, Zeichnungen und Gedichte aus Zeitschriften, wie „BUCH“, „POE SIE ALL BUM“ und „UND“. Berührung ist nur eine Randerscheinung ist eine wertvolle Sammlung für diejenigen, die sich interessieren für die moderne literarische Szene der DDR in den 80-er Jahren, denn dokumentiert werden neue künstlerische Produktionen einer jungen, am „Rande“ der Gesellschaft lebenden Generation.
Robert Siebum / Marieluise de Waijer-Wilke, Deutsche Bücher, Heft 1, 1985
Berührung ist nur eine Randerscheinung
− Wirklich neue Literatur aus der DDR: eine andere Generation. −
zwei unterschiedliche Besprechungen dieses Bandes ließen sich denken: eine über die Entstehungsgeschichte der Anthologie und eine über ihre literarischen Qualitäten. Daß beides sich nicht einfach ineinanderfügen läßt, liegt daran, daß die Rede von DDR-Zensur und die Hinweise, daß der Band im Osten nicht erscheinen durfte, den Blick von den Texten ablenkt, hin zu den Vorzeichen , dem Akt der Veröffentlichung im Westen, dem Status der Autoren. Jener Pluspunkt, den verbotene DDR-Literatur hierzulande immer noch erhält, läßt nicht mehr zwischen guter und gutgemeinter Literatur unterscheiden, sondern handelt alles als Kassiber, den es nicht zu lesen, sondern zu entschlüsseln gilt. Dennoch läßt sich, Franz Fühmann wegen, die Vorgeschichte nicht aussparen. Fühmann, dessen Rolle als Mentor der jüngeren DDR-Literatur gar nicht überschätzt werden kann, hatte bis zu seinem Tod im Sommer letzten Jahres versucht, die Veröffentlichung dieser Sammlung in die Wege zu leiten; er wies immer wieder auf die Qualitäten des Materials hin und stand am Ende doch vor einem Scherbenhaufen – als alle Manuskripte, gesammelt von Elke Erb und Sascha Anderson, beisammen waren, wurden sie beschlagnahmt, die Beiträger erfuhren Repressalien. Stephan Hermlin sagte dazu vor einer Westberliner Runde, es gälte eben zwischen ,wirklichen‘ Schriftstellern und Möchtegernschriftstellern zu unterscheiden, wobei letzte Können durch billige Provokation ersetzten. Fühmann sprach er die Fähigkeit ab, zwischen Begabung und Nichtbegabung unterscheiden zu können. So einfach ist das. Liest man in dem Band, ist man nicht nur geneigt, Fühmann vor Hermlin in Schutz zu nehmen, sondern auch der Hinweis auf Provokation erweist sich als denkbar falsch. Das neue Selbstbewußtsein, das diese Anthologie spiegelt, „läßt sich nicht bestimmen und begrenzen von dem System, dessen Erbe es antritt“, schreibt Elke Erb in ihrer klugen Einleitung. Die Provokation besteht einzig darin, daß konfrontative Positionen nicht länger gesucht werden. Selten hat sich ein Untertitel als treffender erwiesen: „NEUE Literatur aus der DDR“ – an Christa Wolf, Günter de Bruyn, Hermann Kant oder Wolf Biermann und Stephan Heym (um kontroverse Autoren zu nennen), erinnern die Texte kaum irgendwo. Statt dessen werden unvermutete Traditionen deutlich, die nicht lautstark verkündet, sondern mit Unbefangenheit und Selbstverständlichkeit benutzt werden; vom Dadaismus bis zur Wiener Gruppe, von der Beat-Generation bis zu den russischen Avantgardisten. Dagegen ist von Brechts ästhetischer Prämisse (und der des ,sozialistischen Realismus‘), „von der Meisterungsmöglichkeit des menschlichen Schicksals unter neuen gesellschaftlichen Voraussetzungen“ (K. Jarmatz) nichts mehr zu spüren. Damit ist auch die gewohnte Funktionszuschreibung der Literatur als Hilfeleistung zur ,Meisterung‘, zur ,Entfaltung der bewußtseinsverändernden Potenzen‘, in Frage gestellt. Die eigene Generation sei „völlig verunsichert“ sagt Uwe Kolbe, einer der Beiträger, man empfinde „weder richtiges Heimischsein hier noch das Vorhandensein von Alternativen anderswo“. Am Gewohnten wird nicht festgehalten, die alten Erwartungen werden düpiert. Eine andere Sprache wird laut, die sich nicht länger um die gegebenen Sprachregelungen kümmert, keinen Slalom mehr fährt zwischen Erlaubtem und Verbotenem, keine Sprache der Fürstenaufklärung, die Franz Fühmann und Stephan Hermlin noch so meisterlich beherrschten. Alle Autoren des vorliegenden Bandes sind in der DDR geboren, das Geburtsjahr der ältesten von ihnen ist 1951, das des jüngsten 1963, und die allermeisten der 29 Beiträger sind kaum Insidern bekannt. Im „Gespräch ohne Ende“ stellt Uwe Kolbe Leser und Schreiber gegeneinander:
Leser: Gib mir mehr Sichres, gib mir Trost in einem Neuen Entwurf
Schreiber: Glauben ersetz ich nicht durch weiteren Glauben
setz du Fuß vor Fuß hör auf
zu loben das Gleiche (September 1979).
Die Chance des Lesens von Anthologien liegt darin, zu erkennen, in welcher Weise die Texte sich untereinander verbinden und aufeinander beziehen. Eines der Resultate liegt in der Vielfalt der Stile, die nirgendwo auf ein voluntaristisches Sprachspiel reduziert sind; von unkonventionellem „Sprachbenutz“ und den herumliegenden – „großen – abgenutzten Worten“ spricht Leonhard Lorek im „Sonett Tausendundeins“ das J.R. Becher gewidmet sein mag, dessen verfemte expressionistische Frühgeschichte in diesem Band lebendiger erscheint als je – eine erstaunliche Renaissance der expressionistischen Sprache, läßt sich beobachten (die sich nicht auf die ostdeutsche Lyrik beschränkt). Ein anderes Resultat der Bezüge (die in den kleingedruckten Kommentaren noch deutlicher werden), hat Elke Erb benannt.
Es ist kein Buch über die DDR, sondern ein Buch aus der DDR, und ich meine, es tritt gerade mit den vielstimmigen Positionen zu den über alle Grenzen der zivilisierten Welt reichenden Themen so real und leibhaftig auch über die deutsche Grenze, daß es die nebulösen Vorstellungen von der DDR als einer terra incognita zerstreut.
Michael Rohrwasser, Frankfurter Rundschau, 17.9.1985
Berührung ist nur eine Randerscheinung
– Die deutsch-deutsche Geschichte einer Anthologie. –
Der Verlag Kiepenheuer & Witsch konnte im Jahr 1985 das Wettrennen westdeutscher Verlage, u.a Luchterhand mit seinen „Jahrbüchern für Lyrik“, Edition Transit, Oberbaum Verlag und Rowohlt1, um eine gültige Sammlung neuer Literatur der achtziger Jahre aus der DDR für sich entscheiden. Mit der Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung erschien bei Kiepenheuer & Witsch der erste umfassende Überblick über die „andere“ oder „zweite“ Literatur der zwischen 1950 und den frühen sechziger Jahren geborenen Autoren, die in der DDR aus ästhetischen, politischen oder sozialen Gründen nicht veröffentlichen konnten und einer größeren Öffentlichkeit in Ost und West bis dato unbekannt waren. Hinweise auf die neue, Biermann, Braun und Kirsch nachfolgende Autorengeneration hatte es zuvor schon viele gegeben, ein umfassendes Bild von ihr aber nicht. Erst die von Elke Erb und Sascha Anderson herausgegebenen Berührungs-Anthologie erlaubte eine so repräsentative wie differenzierte Sicht auf die Literatur außerhalb der offiziellen Strukturen des ostdeutschen Teilstaates und machte mit einem Schlag Autoren bekannt, die wie Jan Faktor, Uwe Kolbe, Katja Lange-Müller, Detlef Opitz, Michael Wüstefeld die Literatur nach 1990 prägen werden.
Helge Malchow, Lektor von Kiepenheuer & Witsch in Köln, hatte Elke Erb 1983 angeregt, einen Roman über die nicht offiziellen Künstlerszenen zu schreiben, insbesondere über die Literatur- und Kunstszene des Ostberliner Prenzlauer Bergs. Erb entschloss sich schließlich zu einer neuen Form von einem Autorenlesebuch, das als Montageroman aus verschiedenartigen Texten und Textfragmenten zusammensetzt war und Interviews, Gedichten, Prosaskizzen, Manifesten und Arbeitsberichte der beteiligten Autoren enthielt. Sie stellte sich damit durchaus in die Tradition von Anthologien wie Menschheitsdämmerung und Kestens 1929 erschienene Vierundzwanzig deutsche Erzähler, im Unterschied zu Überblicksbänden wie Lyrik der DDR und Prosa der DDR sollte Erbs Buch das künstlerische Ergebnis eines kollektiven Arbeitsprozesses verkörpern und zugleich Ausdruck des Lebensgefühls einer Generation sein. Von Anfang an ging es Erb um mehr, als Autoren zur Einsendung von Texten zu bewegen, sondern sie wollte mit ihnen arbeiten, sie verstehen, ihre ästhetischen, politischen und lebensweltlichen Konzepte kennenlernen und dem Leser zugleich ein Gespür für die unterschiedlichen literarischen Ansätze einer neuen Autorengeneration vermitteln. „Ich wollte ein Generationsbuch machen, das hieß Die Ernte muss vom Halm runter“, erinnert sie sich.
Man muss das im Zusammenhang zeigen und die Autoren sollen sich auch gegenseitig in einem Zusammenhangsbuch lesen können und sich miteinander beschäftigen.2
Nicht nur dem Lektor, auch vielen Autoren war dieses Arbeiten neu, zumal es zunächst vom Textmaterial einer inzwischen verbotenen, für die Ostberliner Akademie der Künste als Arbeits- und Diskussionsmaterial geplanten Sammlung intendiert war. Franz Fühmann hatte 1980 Uwe Kolbe und Sascha Anderson beauftragt, Texte jener Autoren zusammenzutragen, die wie Hilbig, Matthies, Maron, Neumann u.a. nicht in der DDR erscheinen konnten. Nach einem vom Zentralkomitee der SED verfügten Verbots (11.11.1981) musste Franz Fühmann das Vorhaben schließlich einstellen, obwohl er sich beispielsweise der Unterstützung des damaligen Akademie-Präsidenten Konrad Wolf versichern konnte.3
Nach der ersten Sichtung des Akademie-Manuskripts Anfang 1983 war Elke Erb bereits klar geworden, dass sie formal neu anzusetzen hatte. Da die Hälfte der Akademie-Autoren inzwischen die DDR verlassen hatte und Teil der gesamtdeutschen Literatur geworden waren, lud Elke Erb Vertreter der jungen und jüngsten, bis Anfang der sechziger Jahre geborenen Autorengeneration auf ihren Sommersitz nach Wuischke in der Lausitz ein. Bereits in ihrem Grundsatzreferat „Von Erich Arendt bis Sascha Anderson. DDR-Lyrik der letzten fünf Jahre“, im Januar 1981 auf einer Tagung der Evangelischen Akademie Berlin-Brandenburg gehalten, hatte sie die jüngere Autorengeneration nicht nur als eine literarische Gruppe vorgestellt, sondern im Ansatz auch deren ästhetisches Programm formuliert:
Erstens: Eine Verschärfung der semantischen Konturen. Zweitens: Eine Entfaltung und Verselbständigung des Spielerischen. Das bedeutet eine Freisetzung und Entgegensetzung nicht integrierter und nicht einzuordnender Realität, des Klangs oder der lexikalischen Assoziationen, des Schriftbildes… Drittens: Die Aufnahme alltäglicher, nicht literarisierter Realität als Zitat oder Thema, mit oder ohne Umgebung von anderem Text, als dunkle Größe, d.h. nicht zur Parabel und zum Dienst als Symbol.4
Dieses poetische Programm war natürlich das ihre, wie der Blick in das August 1981 verfasste Nachwort ihres Bandes Vexierbild zeigt. Von diesem poetischen Programm wurde nicht nur die Auswahl von Texten und Autoren der Anthologie bestimmt, sondern auch das Vorwort, dessen Deutung bis heute den Blick auf die unabhängige Literatur Ostdeutschlands der achtziger Jahre prägt. In seiner großen Faszinationskraft wie starken literarischen Wirkung schien aber zugleich die Grenzen des Konzepts auf. Nicht alle im Band enthaltenen Autoren ließen sich diesem Konzept zuordnen und nicht alle Autoren, die in Ostdeutschland nicht oder nur unter größten Mühen publizierten konnten, fanden Eingang in die Anthologie.5 Elke Erb hatte zunächst die Befürchtung, dass ihre eigene Arbeit, verglichen mit denen der Anthologie-Autoren, nicht standhalten könnte. Dann ging sie davon aus, dass die nachfolgende Generation weitaus politisierter sei.
Und wie ich dann hörte, was die machen, da war es so, als wäre mir der Boden unter den Füßen verlängert. Also durch die ist mehr Land. Das war eine Beruhigung.6
Es darf angenommen werden, dass Elke Erb bei der Festlegung, wer in die Sammlung Eingang finden sollte, auch von Bert Papenfuß beeinflusst wurde, dem sie in diesen Jahren durch ein Arbeitsverhältnis die Möglichkeit der rechtlichen und sozialen Absicherung bot und der den bis Anfang 1985 gültigen Arbeitstitel Leila Anastasia beitrug. Der Einfluss Sascha Andersons beschränkte sich, so Elke Erb, vor allem auf die Zusammenstellung des schriftgrafischen Teils der Anthologie.
Bewusst oder unbewusst – Elke Erb zog mit ihrem Konzept automatisch die Palette all jener Vorurteile auf sich, denen schon Franz Fühmann bei der Zusammenstellung der Akademie-Anthologie ausgesetzt war: Organisation politischer Untergrundtätigkeit, Gruppenbildung und der Verdacht, in dieser Literatur- und Oppositionsszene eine literarische Führungsperson zu werden. Anlass dazu hatte Elke Erb durch ihr Engagement in der unabhängigen Friedensbewegung und durch die Mitarbeit in der Oppositionsgruppe Frauen für den Frieden gegeben, in der u.a. Bärbel Bohley und Ulrike Poppe federführend wirkten.
Die Bandbreite der kultur- und sicherheitspolitischen Anstrengungen, das Erscheinen der Anthologie zu verhindern, ihre Zusammensetzung zu verändern und Autoren zur Absage zu bewegen, bietet ebenso Raum für eine Querschnittsanalyse für die Krise der Kulturpolitik Mitte der achtziger Jahre, wie die Reaktionsmuster der Institutionen und Autorenkollegen. Von zahlreichen Berichten aufgeschreckt, nicht zuletzt von Mitherausgeber Sascha Anderson verfasst, der seit den siebziger Jahren bis zum Ende der DDR auch in MfS-Diensten stand, wurde die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit Berlin mit der Koordinierung all jener Maßnahmen beauftragt, die geeignet schienen, die Anthologie zu verhindern. Erste Manuskriptteile der Anthologie und der Entwurf des Vorwortes wurden u.a. den als Experten für das MfS arbeitenden IME Pergamon bereits Anfang 1984 zur Analyse und Bewertung überlassen. Die Analyse unterstellt, dass durch diese Sammlung die „Tendenz zur Gruppenbildung unverkennbar in ein neues Stadium eingetreten“ sei.
Dies erklärt sich aus dem manifestativen Charakter des Vorworts, welches gewissermaßen eine eigene ‚Ästhetik‘ der passiven Subkultur formuliert. Der Gruppe soll damit eine eigene Theorie und Strategie gegeben werden, die weiter auszubauen ist. […] Dieser Beitrag ist für die künftige Entwicklung der Gruppe nicht zu unterschätzen; sie erhöht deren Effektivität und Mobilität im ideologischen Klassenkampf gegen die Kulturpolitik von Partei und sozialistischem Staat und kann auch nach außen hin den Eindruck erwecken, daß es neben (und gegen) den Schriftstellerverband der DDR eine beachtliche Strömung ‚junger‘, ‚alternativer‘ Literatur gibt.7
In Abstimmung mit dem Ministerium für Kultur wird das Büro für Urheberrechte, der Bezirksverband Berlin des Schriftstellerverbandes der DDR, in dem Elke Erb Mitglied ist, und der Aufbau-Verlag kontaktiert, um Gesprächsstrategien mit Elke Erb festzulegen. Parallel dazu wird das Büro für Urheberrechte damit beauftragt, die im Manuskript vertretenen Autoren persönlich aufzusuchen und sie zu einer Rücknahme der Texte zu veranlassen. Aber auch vom Aufbau-Verlag wird den bereits unter Vertrag genommenen Autoren signalisiert, dass eine Veröffentlichung in der Anthologie einen Abbruch der Verlagsprojekte zur Folge haben werde. Thomas Böhme zieht daraufhin seine Texte zurück, um seinen angekündigten Band Die schamlose Vergeudung des Dunkels (1985) nicht zu gefährden, Michael Wüstefeld, wie Uwe Kolbe oder Thomas Böhme Autor des Aufbau-Verlages, hingegen nicht.
Für den weiteren Umgang mit Elke Erb wurde nun geprüft, ob Anhaltspunkte für die Ausreise bestehen, die für eine Ausbürgerung genutzt werden könnten. Zum anderen wurde die Einleitung strafprozessualer Maßnahmen „unter Abwägung politischer Aspekte“ ebenso erwogen wie Möglichkeiten, weitere Veröffentlichungen in Ost und West zu unterbinden und Reisen zu verwehren. Festgelegt wurde auch, Elke Erbs Ausschluss aus dem Schriftstellerverband zu betreiben. Schließlich sollten Maßnahmen ergriffen werden, um sie ihrer „Mentorenfunktion“ in der ostdeutschen Literaturszene zu berauben.8
Im Frühjahr 1984 meldete Elke Erb die bevorstehende Veröffentlichung an das zuständige Büro für Urheberrechte. Das Büro zeigte sich irritiert, handelte es sich hierbei doch lediglich um eine knappe Information, nicht aber um ein förmliches Antragsverfahren für eine Auslandsveröffentlichung. Zudem wurde eine Privatperson vorstellig, nicht aber ein Verlag der DDR, der einen bereits unter Vertrag stehenden Titel zum Druck im Westen ankündigen wollte. Im Gespräch am 21. März 1984 im Büro für Urheberrechte wurde Elke Erb über die in der DDR geltenden Regularien für die Publikation eines Bandes in einem westlichen Verlag „aufgeklärt“. In einer Zusammenfassung des Gesprächs über die Intentionen der Herausgeberin hielt ein Mitarbeiter des Büros für Urheberrechte fest:
„Elke Erb will allen Autoren die Chance geben, ihre bisher unveröffentlichten Texte innerhalb ihrer Sammlung einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Verlagen in der DDR hat sie das Manuskript nicht angeboten, weil sie weiß, daß kein Verlag diese Sammlung akzeptieren würde – aus folgenden Gründen: 1. Von den Autoren, die mit Beiträgen in der Sammlung vertreten sind, sind 6 in den letzten Wochen aus der DDR ausgereist. 2. Es handelt sich teilweise um kritische Texte von ‚Aussteigern‘ bzw. ‚Außenseitern‘. 3. Sie ist nicht bereit, die Sammlung zu ändern.“ Das Gespräch endete mit einer Rechtsbelehrung, in der Elke Erb die Wahrungsordnung und die devisenrechtlichen Bestimmungen erläutert wurden. Elke Erb „erklärte dazu, daß sie keine Möglichkeit sieht, die Anthologie in der DDR zu veröffentlichen und eine Publikation in der BRD ohne Genehmigung durch das Büro für Urheberrechte in Kauf nehmen wird.“9
Die Frage, „ob es ihr die Mitgliedschaft im Schriftstellerverband nicht gebiete, die Anthologie zurückzuziehen, wenn auch nur die Gefahr bestehe, sie könnte gegen die DDR benutzt werden“ wies Elke Erb mit Entschiedenheit zurück.
Sie werde alles tun, daß es nicht dazu komme und sie hoffe, daß es nicht dazu komme, sollte es aber geschehen, müsse sie das und die sich daraus für sie ergebenden Konsequenzen in Kauf nehmen.10
Es sei wichtig, dass diese Literatur veröffentlicht wird, um das breite Spektrum der nicht veröffentlichten Literatur der DDR aufzuzeigen, um positive Anstöße für das Erscheinen ähnlicher Literatur auch in der DDR zu geben.
Es ist davon auszugehen, dass Elke Erb vom Verlag Kiepenheuer & Witsch geraten wurde, sich an das Büro für Urheberrechte zu wenden, um Komplikationen in den deutsch-deutschen Vertrags- und Lizenzgeschäften, die Kiepenheuer & Witsch u.a. mit dem Aufbau-Verlag unterhielt, von vornherein zu begegnen. Zum anderen ist der Herausgeberin eine gewisse Lust nicht abzusprechen, die Kulturinstitutionen der DDR mit ihren eigenen Regularien der Zensur- und Druckgenehmigungspraxis zu konfrontieren, sie mit Hilfe der Anthologie gewissermaßen einem Legitimationstest zu unterziehen und zu eruieren, was möglich ist und was nicht. In diesem Sinne ist auch ein Schreiben Elke Erbs an Elmar Faber, dem Leiter des Aufbau-Verlages, zu verstehen, in dem sie um Verständnis für die Situation der beteiligten Akademie-Autoren wirbt und mit dem sie, wie vom Büro für Urheberrecht aufgetragen, doch noch Möglichkeiten einer Publikation in der DDR auszuloten versucht.
Drei Monate später, am 10. Juli 1984, wird Elke Erb in den Berliner Schriftstellerverband vorgeladen. Am Tag zuvor war Helmut Küchler, Vorsitzender des Berliner Bezirksverbandes, bereits von dem Stasi-Führungsoffizier über das durchzuführende Gesprächszenario und über die anzudrohenden Konsequenzen instruiert worden, sollte man Elke Erb nicht umstimmen können. Auf den Hinweis, dass der Transfer von Manuskripten zu Kiepenheuer & Witsch nach Köln und die erst danach erfolgte Kontaktierung des Büros für Urheberrechte gegen die Gesetze der DDR verstoßen würde, antwortete Elke Erb:
Ohne diesen Preis hätte diese Anthologie und damit diese Literatur nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken können. Wenn sie dafür bestraft werden sollte, müßte sie das hinnehmen.11
Bereits am 20. Mai 1984 hatte sich das Präsidium des Schriftstellerverbands mit der sogenannten „Aussteiger-Anthologie“ befasst. Als Gäste nahmen Ulrich Franz von der Abteilung Kultur des Zentralkomitees der SED und der Stellvertretende Minister für Kultur, Klaus Höpcke, teil. Ziel der Sitzung war es, das Präsidium über die „getroffene zentrale Entscheidung, die [Elke] Erb im März/April 1985 aus dem Schriftstellerverband auszuschließen12, in Kenntnis zu setzen und die dazu notwendigen Schritte einzuleiten. Hermann Kant blieb dieser Sitzung fern, ein Vorgehen, wie er es so oft in der Mitte der achtziger Jahre praktizierte. „Die Herausgeberin Erb“, so Gerhard Henniger, Erster Sekretär des Verbandes, „sei sich bewußt, daß sie mit dieser Veröffentlichung Gesetze der DDR verletze.13 Günter Görlich weist mit Blick auf die Ausschlüsse des Jahres 1979 auf ein grundsätzliches Problem:
Wir haben selbst als Schriftstellerverband zu solchem Verhalten grundsätzliche Beschlüsse gefaßt und von uns werden natürlich auch Konsequenzen und Schlußfolgerungen verlangt, denn sonst werden wir jede Glaubwürdigkeit verlieren.14
Gerhard Holtz-Baumert, der die Geschäfte des Verbandes während der Abwesenheit von Hermann Kant kommissarisch führt, gab zu bedenken, dass in diesem Fall reagiert werden müsse, wenn der Verband nicht unglaubwürdig werden wolle:
Es sei die Frage zu stellen, „wieviel Kröten sind wir bereit noch zu schlucken“. Schließlich befindet sich Erb ganz klar in der Nachfolgeschaft von Stefan Heym, also sind Konsequenzen erforderlich. Kerndl bezeichnete das Verhalten der Erb als geradezu „teuflisch und widerwärtig“, vor allem, wenn sie sich noch darauf beziehe, das Erbe von Franz Fühmann anzutreten. Gen. Höpcke vertrat die Meinung, „daß in Bezug auf Elke Erb Maßnahmen unvermeidlich“ seien.15
Nur Max Walter Schulz, bis 1983 Direktor des mit der Nachwuchsausbildung von Autoren befassten Literaturinstituts „Johannes R. Becher“ gab zu bedenken, dass man nicht übereilt reagieren und sich eine Bedenkzeit von mindestens drei Monaten einräumen sollte, weil die Anthologie nicht zuletzt auch Defizite der Nachwuchsförderung sichtbar mache. Dieser Einschätzung stimmt Jurij Brězan zu. Die Anthologie mache deutlich, „daß sich das Präsidium intensiver und qualitativer mit den Problemen junger Autoren befassen müsse, um zu verhindern, daß Elemente wie Elke Erb sich an diese jungen Leute heranmachen und sie auf die feindliche Seite ziehen. Das sei auch die Schwäche der Arbeit des Präsidiums und des gesamten Verbandes.“16Zu einer Entscheidung kommt es nicht, auch weil es Franz und Höpcke unterließen, das Präsidium über den bereits festgelegten Ausschluss Elke Erbs zu informieren. Die Causa Elke Erb wurde an den Berliner Bezirksverband delegiert, der wegen interner Querelen letztlich kein Ausschlussverfahren einzuleiten vermochte.
Anfang Mai 1984 weilte Elke Erb zu einer Unterredung mit Verlagschef Faber im Aufbau-Verlag. Es war für die Beteiligten bald klar, dass an eine Veröffentlichung in der DDR ebenso wenig gedacht wie die Publikation bei Kiepenheuer & Witsch verhindert werden konnte. Elmar Faber nimmt das Gespräch zum Anlass, um sich grundsätzlich mit dem Problem fehlender Veröffentlichungsmöglichkeiten junger Autoren auseinanderzusetzen:
Die Autoren, die in der Anthologie zu Wort kommen, haben in ihrer Mehrzahl keine oder nur begrenzte Möglichkeiten zur Veröffentlichung. Unter kulturpolitischen Aspekten erfüllen sie nicht die Kriterien, in eine Debütantenanthologie aufgenommen zu werden. Es wird nicht oder nur unzureichend von den offiziellen Literaturförderern unseres Landes mit ihnen gearbeitet. Vereinzelt geraten diese Stimmen auch dadurch auf Abwege. Ich plädiere deshalb für die Überlegung, die in die Anthologie aufgenommenen Autoren sorgfältig zu unterscheiden und gegebenenfalls einen Weg zu suchen, um einigen davon (gegebenenfalls unter Hinzuführung bisher nicht vertretener junger Autoren) einen Weg in die literarische Öffentlichkeit zu zeigen.17
Elmar Faber war sich der Brisanz der bei Kiepenheuer & Witsch geplanten Anthologie bewusst. Erschien die Anthologie in Köln und schuf einen Präzedenzfall in der deutsch-deutschen Kulturpolitik, drohte der Abbruch der Zusammenarbeit mit Köln. Die Intentionen Fabers zielten zunächst darauf, Möglichkeiten zu eruieren, die Anthologie gleichzeitig in der DDR und im Westen herauszubringen. Die Literaturhistorikerin Birgit Dahlke zitiert aus einem Schreiben Elmar Fabers aus dem Jahr 1995 an Rüdiger Thomas:
Ja, ich wollte die Anthologie in der DDR herausbringen. Ja, ich hatte Einwände gegen Texte, weil sie literarisch nichts taugten und seither auch nicht besser geworden sind. Ja, das habe ich gesagt und auch meinem Kollegen Dr. Neven Dumont bei Kiepenheuer & Witsch weitergegeben, und selbstverständlich habe ich einen Kompromiß gesucht, um die Anthologie in beiden Staaten und gleichzeitig erscheinen zu lassen […].18
Dieser Intention stand aber die Weigerung Elke Erbs entgegen, Autoren, die inzwischen in den Westen ausgereist waren, aus kulturpolitischer Rücksichtnahme aus der Anthologie zu streichen, die Zusammenstellung von Autoren zu überdenken und die Montagekomposition aus Kommentaren, Zitaten, Selbstaussagen, Statements und literarischen Texten aufzugeben.
Die Anthologie erschien 1985 wie vorgesehen bei Kiepenheuer & Witsch, entfachte aber wider Erwarten in Ost und West nicht das Medienecho, das in den kultur- und sicherheitspolitischen Schaltstellen der DDR befürchtet worden war. Die Gründe mögen darin aufzusuchen sein, dass sich die Anthologie schwer rezipierbar erwies und bestimmte Erwartungshaltungen an unangepasste und oppositionelle Literatur der DDR unterlief. Breiten Eingang fand die Anthologie hingegen in die germanistische Forschung. Für Wilfried Barners Literaturgeschichte, die sich, stellvertretend für andere Autoren, auf Fritz Hendrick Melle beruft, fiel die Selbstdarstellung der neuen Autorengeneration scharf und kompromisslos aus. „Die Enttäuschung der Hoffnungen, die Erwartung an die Gesellschaft“ sei eine Voraussetzung der Anthologie gewesen. Ästhetisch gehöre „die Überzogenheit der Abwehrgebärde“ zum literarischen Programm.19 Festgestellt wird, dass in den literarischen Texten wie in den Statements des Bandes kaum mehr aufbauende, helfende oder anklagende Kritik geübt werde, sondern Haltungen der Verweigerung ausgestellt werden, auch gegenüber den Denkmodellen und Ideologemen, an denen sich die Vorgänger gerieben hatten. Die These vom besseren Deutschland sei durch die Autoren der Anthologie nicht zu belegen, eher „deren Verflechtung mit gesellschaftlichen Institutionen, vor allem der Staatssicherheit“.20 Diese These kann weder durch die Anthologie und bis auf drei Ausnahmen auch nicht durch die Erkenntnisse der nach 1990 geführten Debatten verifiziert werden. Wolfgang Emmerich kommt in seiner Kleinen Literaturgeschichte der DDR zu einer anderen Bewertung des ästhetischen Ansatzes dieses Autorenkreises. Er stellt den „radikalisierten Umgang mit Sprache“21 als innovative Leistung und als Motor der Ideologie-, Gesellschafts- und Zivilisationskritik heraus.
Ganz im Sinne der generativen Transformationsgrammatik wurde Sprache als ein regelhaftes und zugleich unausschöpfliches, unbegrenztes, erweiterbares System begriffen, aus dem heraus permanent ‚generiert‘ und das dann Gegebene weiter transformiert werden kann – bis hin zu Neologismen, deren denkbare Anzahl unendlich ist.22
Heute noch lesenswert ist die sowohl informative wie kenntnisreiche Rezension Heiner Sylvesters. „Eine neue Generation ist herangewachsen“, konstatiert Heiner Sylvester im Spiegel vom September 1985.
Diese Generation stellte man gewissermaßen vor die Wahl, das Vorgegebene anzunehmen und sich einzufügen oder sich im Dauerkonflikt zu verschleißen. „Einer zu sein, der von sich selbst abweicht oder mit seinen Überzeugungen nichts erreicht“ (Thomas Günther). Daraus entstand eine andere Haltung. Kein Protest auf der Straße, auch keine Petition, jene Mittel, die nur den Kreislauf von Macht und Ordnung festschreiben. […] Wollten sie nicht Spielball des dualen gesellschaftlichen Mechanismus bleiben, mußten sie ihre Existenz aus den politischen Prinzipien des Staates lösen, Wege aus der Ordnung suchen.23
Deutlich verschnupft reagierte man in der Hauptverwaltung Verlag und Buchhandel des Ministeriums für Kultur auf das Erscheinen der Anthologie, wie sich Elmar Faber erinnert:
Es gab eine große Versammlung in der Clara-Zetkin-Straße, in der diskutiert wurde, dass ab sofort von Kiepenheuer & Witsch in der DDR keine Lizenzausgaben mehr erscheinen sollen. Da bin ich in dieser Versammlung der Einzige gewesen, der aufgetreten ist und gesagt hat: Aber ohne mich. Ich mache nicht mit. Wir hatten ja ganz wesentliche Kiepenheuer-&-Witsch-Autoren in unserem Programm. Ich habe mich auch aus nackter verlegerischer Existenzangst gewehrt. Wir hatten Garcia Marquez im Programm, Joseph Roth bis Günther Walraff, die ganze Palette der Literatur.24
Widerstand regte sich von unerwarteter Seite. Die Anthologie war von den Kollegen der mittleren Generation mit großem Interesse, aber auch mit Argwohn beobachtet worden. „Als ich die Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung zusammenstellte“, so Elke Erb, „bekam ich auch zu hören, ob das denn gut sei. Nicht unbedingt von Literaten, aber im Grunde von meiner Generation, da war Mißtrauen.“25 Es ging nicht zuletzt um Grundsätzliches: Elke Erb, durch die Lyrik-Debatten der sechziger und siebziger Jahren in literarischen Auseinandersetzungen geübt, hatte in ihrem zum Anthologievorwort erweiterten Akademievortrag den Abschied von der literarischen Generation um Rainer Kirsch, Karl Mickel und Volker Braun, von der Generation der in den dreißiger Jahren geborenen Dichter verkündet. Deren Lyrik spiegele „einen Produktionsprozeß, in dem der Zweck (der Mensch) notwendig zum Mittel geworden ist.“ Ausführlich hatte sich Elke Erb in ihrem Vortrag mit Volker Braun auseinandergesetzt:
Die Lyrik des 1939 geborenen Volker Braun begegnet mir als die reinste Ausprägung dieser Determination. Die Angestrengtheit ihrer Sprache, ihre Verschränkungen, ihre maschinelle Dialektik oder dialektische Mechanik zeigt sich als notwendige Handlungsweise, führt herauf eine Poesie der Notwendigkeit, der Richtigkeit, der Weisung, nicht aber der Individualität und Existenz. Sie ist operativ und apperativ, sie ist kooperativ innerhalb des Apparats, in dem sie sich bewegt. Ihre Wahrheiten sind Teilwahrheiten in bleibender Ambivalenz zwischen Aggression und Defension. […] Da er aber nicht selbst aus der Ordnung verstoßen werden will, muß er ständig den nur partikularen sowohl als auch den mit dem Ganzen übereinstimmenden Charakter seiner Wortmeldungen signalisieren und sie unangreifbar machen. Diese Situation, als Gefangenschaft in der Arbeit… erzeugt eine gejagte Mechanik.26
Volker Braun reagierte in seinem 1983 verfassten und 1985 für die Zeitschrift Sinn und Form erweiterten Rimbaud-Essay auf diesen literarischen Generationskonflikt, der auch ein Aufeinanderprallen verschiedener Lebensweisen und Auffassungen von Literatur offenbarte. Er war durch Fritz Hendrick Melle noch verschärft worden, indem er in der Anthologie im Gespräch mit Elke Erb zu Protokoll gegeben hatte:
Volker Braun ‒ Da kann ich nur sagen, der Junge quält sich. Dazu habe ich keine Beziehung mehr.27
Da der Titel der Anthologie – eine Trakl-Adaption – von Fritz Hendrick Melle übernommen worden war, ist die Äußerung von Gewicht, zumal Volker Braun ungewohnt direkt reagiert:
Unsere vermeintlichen Neutöner, Hausbesetzer in den romantischen Quartieren (wo sie sich ordentlich führen) sind wohl gut Anschaffer, die fleißig auf den Putz hauen, Hucker nicht Maurer. Aber in dem bedeutenden Wortmüll sind verschwiegene Gefühle und Gedanken deponiert, die uns, selbstredend, mehr zu sagen haben als die gestanzte Festtagskunst…28
Elke Erb wandte sich daraufhin am 15. Oktober 1985 mit einer sachlichen Zurückweisung an die Redaktion von Sinn und Form, die zwar nicht abgedruckt, aber an Volker Braun weitergeleitet worden war. „Ich habe diese Anfang 1980 verfaßte Arbeit noch einmal nachgelesen“, heißt es darin, „und nichts gefunden, was die Schlußfolgerungen Brauns erlaubt oder auch nur per Verwechslung ermöglichen könnte.29 Volker Braun antwortete Elke Erb in der gewohnten Dialektik:
Nun ja nun, als ich meinen Text vor ein paar Jahren schrieb, war ich, glaube ich, ein wenig verletzt, mich als Apparat-Ritter vorgetragen zu wissen. Deshalb wurde auch ich ausnahmsweise persönlich. Wenn ich jetzt von uns absehe, so hast Du, in der Sache nämlich, recht, und ich, wieder in der Sache, wohl auch.30
Gerhard Wolf greift moderierend in den Konflikt ein im Jahr darauf, 1986, indem er auf das „gegenseitigen Mißverstehen, ja Nichtverstehen-Wollen zwischen den literarischen Bewegungen in der DDR [hinweist]. Vertrackte Situation: denn während sich Volker Braun solidarisch für diese Jungen einsetzt, … wehrt er sich gleichzeitig gegen die ihm natürlich bekannte, von Grund aus andere Erfahrung, aus der sie kommen, gegen den anderen Status, von dem sie zwangsläufig ausgehen.“31
Am 13. Mai desselben Jahres lud Elmar Faber, Leiter des Aufbau-Verlages, neun Autoren aus dem Kreis der Berührungs-Anthologie ein, um über die Bedingungen für künftige Veröffentlichungen in der DDR zu beraten. Das Ansinnen einer erneuten Überblickssammlung für die DDR wurde von den anwesenden Autoren entschieden zurückgewiesen, da es Zeit sei für eigenständige Publikationen. Seit 1987 erschienen Jan Faktor, Gabriele Kachold, Bert Papenfuß, Rainer Schedlinski und andere Autoren der Anthologie in der von Gerhard Wolf herausgegebenen Edition Außer der Reihe des Aufbau-Verlags. Insofern kann die Anthologie heute als wichtige Wegmarke für eine Normalisierung des kulturpolitischen Klimas in der DDR am Ende der DDR und als Impuls für die Einbindung der ausgegrenzten Autoren in die deutsch-deutsche Öffentlichkeit angesehen werden.
Klaus Michael: Berührung ist nur eine Randerscheinung. Die deutsch-deutsche Geschichte einer Anthologie. In Siegfried Lokatis und Ingrid Sonntag: 100 Jahre Kiepenheuer-Verlage. Berlin 2011
„Die Fahnen faulen die Zeichen / sind abgenutzt“
– Zur deutsch-deutschen Geschichte der Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung (1985). –
Ausgangspunkt
Die Zeile „Die Fahnen faulen die Zeichen / sind abgenutzt“ stammt aus einem Dialogtext mit dem Titel „Gespräch ohne Ende“ und war 1985 in der Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung abgedruckt.
Innerhalb der DDR rankten sich um diese nur im Westen erschienene Anthologie wie um den erfolgreichen Jungdichter einige Mythen.
Der anfangzwanzigjährige Lyrikdebütant Uwe Kolbe hatte es nur kurz nach seiner ersten großen Veröffentlichung 1980 im Aufbauverlag geschafft, den Herausgebern einer anderen Anthologie, nämlich Bestandsaufnahme 2, 1981 ein Kuckucksei unterzujubeln:
Elender Untertan Ratloser Einheitlicher
Memme Argwöhner Säufer Schalentier Energieloser
Sachter Insider Nichtsnutz Durchschnittlicher
Eiferer Lügenmaul Einsiedler Nervenkranker Dasitzender […].
In dieser scheinbar assoziativen Substantivkette, überschrieben mit dem anspielungsreichen Titel Kern meines Romans, hatte Kolbe eine politische Botschaft an Funktionäre und Zensoren chiffriert, die erkennbar wird, wenn man die Anfangsbuchstaben nacheinander liest:
Eure Maße sind elend
Euren Forderungen genügen Schleimer
Eure ehmals blutige Fahne bläht sich träge zum Bauch
Eurem Heldentum den Opfern widme ich einen Orgasmus
Euch mächtige Greise zerfetze die tägliche Revolution.
Die verantwortliche Lektorin der Anthologie im Mitteldeutschen Verlag, Brigitte Bötticher, verlor ihren Posten, mehrere Projekte mit jüngeren AutorInnen wurden auf Eis gelegt und ganze Heere von informellen Mitarbeitern der Staatssicherheit auf Uwe Kolbe angesetzt.
Dies war das kulturpolitische Klima, in das die damals junge, in den späten fünfziger Jahren geborene vierte AutorInnengeneration eintrat. Ihr Weg begann nach 1976, nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns. Von der Zerrissenheit zwischen Loyalität zum antifaschistischen Staat und Streben nach politischer und künstlerischer Autonomie, wie sie noch ihre Vorgänger Fühmann, Volker Braun oder Christa Wolf geprägt hatte, war diese Generation weitgehend frei. Natürlich war auch sie nicht homogen.
Zur Vorgeschichte. Die Fühmann-Anthologie oder: Berührungsängste
Vorläufer der Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung war eine Sammlung, die Franz Fühmann als Mitglied der Akademie der Künste 1980 anregte. Fühmann, Mentor, als Redaktionsmitglied der Zeitschrift Sinn und Form bekannter Förderer, oft auch Mäzen vieler junger Schreibender32, unternahm damit den wohl letzten größeren Versuch seines Lebens, zwischen den Generationen und Gruppen der im DDR-Literaturbetrieb Etablierten und den ,Outcasts‘ zu vermitteln. Bereits 1975 hatte Fühmann z.B. versucht, in einer Lesung in der Akademie der Künste auf den jungen Dichter Frank-Wolf Matthies aufmerksam zu machen, 1976 hatte er Matthies und Kolbe in Sinn und Form vorgestellt, 1980 Kolbe zu seinem Meisterschüler gemacht und diesem Lesungen auch im Westen ermöglicht. Zensurmechanismen gerade in Bezug auf ungewohnte neuartige Literatur33 hatten dazu geführt, daß Texte und Namen der ,Neuen‘ nicht nur den LeserInnen, sondern auch den AutorenkollegInnen unbekannt geblieben waren. Statt politischer und ästhetischer Auseinandersetzungen blühten Gerüchte und gegenseitige Vorurteile. Berührungsängste wurden kultiviert und kulturpolitisch befördert. In Fühmanns Briefen von 1976/77 läßt sich nachlesen, wie er immer wieder anmahnte, die wichtigen Debatten um DDR-Autoren nicht weiterhin jenseits der DDR stattfinden zu lassen.
Seit 1979 war er auch im Gespräch mit dem angesehenen Filmemacher Konrad Wolf, dem Sohn Friedrich Wolfs. Fühmann machte Wolf in dessen damaliger Funktion als Präsident der Akademie der Künste auf die restriktive Veröffentlichungspraxis gerade auch in bezug auf junge AutorInnen aufmerksam. Konrad Wolf kannte keinen der von Fühmann als Beispiel genannten Namen und so kamen beide im Sommer 1980 überein, diese Unbekannten in einem Arbeitsheft zunächst einmal den Mitgliedern der Akademie vorzustellen. Fühmann rannte damit bei Konrad Wolf durchaus offene Türen ein34, zumal Wolf den über die Jahre von der eigenen Wirkungslosigkeit deprimierten Dichter vom Austritt aus der Akademie abhalten wollte. Fühmann nahm dieses Angebot noch einmal an, konsequenterweise gab er die Regie der Auswahl in die Hände ihm vertrauter junger Leute: Uwe Kolbe und auf dessen Hinweis hin Sascha Anderson. Beide kannten als Herausgeber der inoffiziell publizierten Kleinstzeitschrift Mikado bzw. der Reihe Poe-sie-all-bum unterschiedliche literarische Kreise. Kolbe und Anderson einigten sich darauf, zunächst einen Überblick über die tatsächlich vorhandenen Stimmen aus der Generation der zwischen 1940 und 1958 Geborenen zu geben.35 Auswahlkriterien waren: die Texte sollten von guter literarischer Qualität, bisher nicht veröffentlicht und in der eigenen Generation akzeptiert sein. Aufgenommen wurden danach Sascha Anderson, Jochen Berg, Peter Brasch, Stefan Döring, Dieter Eue, Thomas Günther, Eberhard Häfner, Wolfgang Hegewald, Wolfgang Hilbig, Uwe Kolbe, Katja Lange, Leonhard Lorek, Monika Maron, Sabine Matthes, Uta Mauersberger, Christa Moog, Gert Neumann, Detlef Opitz, Bert Papenfuß, Lutz Rathenow, Andreas Röhler, Michael Rom, Rüdiger Rosenthal, Dieter Schulze, Sabine Strohschneider, Bernhard Theilmann, Lothar Trolle, Bettina Wegner, Erhard Weinholz und Michael Wüstefeld.36 Das waren Autorinnen und Autoren mit überaus unterschiedlichen literarischen Ansätzen, die einander zu diesem Zeitpunkt nicht kannten.
Im Sommer 1981, lange vor der allgemeinen Einführung der Computer- und Kopiertechnik in der DDR, lag das Manuskript der Auswahl nur in vier maschinengeschriebenen Exemplaren vor, je eines in den Händen der beiden jungen Herausgeber Kolbe und Anderson, eins in Händen Fühmanns, und das vierte wurde dem Leiter der Sektion Dichtkunst und Sprachpflege der Akademie Günther Rücker übergeben.37
Konrad Wolf, dem Fühmann sein eigenes Exemplar ausgehändigt hatte, reagierte völlig geschockt, wie Briefentwürfe an Fühmann vom 17.[?]10.1981 erkennen lassen:
Von einer Anthologie des vorliegenden Umfangs und, insbesondere solcher einseitigen „Repräsentanz“ und Auswahlprinzipien konnte nie die Rede sein. […] Muß dem Statut [der Akademie] entsprechen, Gremien der Akademie entscheiden darüber, nicht der Präsident ….]. Glauben Sie wirklich, lieber Franz Fühmann, daß Ihre Zurückhaltung, wenn Sie wollen – Toleranz, auf die Dauer den Autoren dieser Anthologie hilft, in unserem Lande ihre ,literarische Heimat‘ zu finden? […] Und noch etwas. Ich persönlich halte wirklich rein gar nichts von dem durch Sie akzeptierten Auswahlprinzip der Anthologie: ausschließlich Autoren, die ihr… Unbefriedigtsein am Zustand der Gesellschaft artikulieren, die Kritik, auch Unmut, ja auch Mißmut bezeugen… […] Es entsteht, da es sich um eine Anthologie mit Anspruch handelt, ein verzerrtes Antlitz der gesellschaftlichen Wirklichkeit, der Sicht und Haltung dieser Generation.38
Im Hintergrund dieser Distanzierung Wolfs vom Ergebnis seines Verständigungsversuchs mit Fühmann lief eine unglaubliche Reihe hektischer Verhinderungsversuche von seiten des Ministeriums für Staatssicherheit, des Ministeriums für Kultur, der Kulturabteilung beim ZK der SED und verschiedener Leitungsebenen der Akademie der Künste ab. Bereits am 15. September kam es zu einer Einladung Kolbes, Andersons und Fühmanns in die Akademieleitung. Rücker erklärte die Arbeit an der Anthologie für beendet. Es hätte nie, so hieß es nun, ein Mandat der Akademie für die Sammlung gegeben. Ein für die DDR-Machtmechanismen typischer Vorgang: der Anreger und Mentor, immerhin anerkanntes Mitglied der Akademie, wurde genauso behandelt wie die Jungdichter – respektlos und als Empfänger von Weisungen. Zur Einschüchterung diente nicht zuletzt der vage Hinweis darauf, würde die Arbeit an der Anthologie nicht eingestellt, kämen die Autoren in den Verdacht der „feindlich-negativen Gruppenbildung“. Die Andeutung genügte, um die Möglichkeit der Kriminalisierung der Beteiligten deutlich werden zu lassen. Es folgte eine unendliche Reihe weiterer Einschüchterungsversuche: Da man den anerkannten Fühmann nicht öffentlich bloßstellen konnte, wandte man sich um so hemmungsloser gegen die ungeschützten Jüngeren: Sie wurden zu mehrstündigen Gesprächen vorgeladen, in denen ihnen mit Arbeitsplatzverlust und Exmatrikulation gedroht wurde, falls sie ihre Texte nicht zurückzogen. Es begann die Observierung z.B. Uwe Kolbes durch die Staatssicherheit als „Operativer Vorgang Poet“ (ab 25.9.1981). Daß sein Mitherausgeber Sascha Anderson zugleich observiert und als seit 1975 verpflichteter IM mit der Bespitzelung beauftragt wurde, konnte Kolbe zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. Das Rätsel, wer von den Besitzern der vier Exemplare der Sammlung seines an die Organe der Staatssicherheit weitergegeben haben mochte, wurde erst 1991 gelöst, als sich herausstellte, daß auch Rücker als IM mit seiner vernichtenden Einschätzung für das Ministerium für Staatssicherheit direkt an der Verhinderung der Anthologie beteiligt gewesen war.39 Restriktionen richteten sich auch gegen den 60jährigen Initiator Fühmann, der erneut zum Objekt der Observierung wurde. Bitter beschrieb er in einem der letzten Interviews vor seinem Tod im Mai 1984, daß „das Börsenblatt, Ausgabe Ost keine Notiz“ von seinem 60. Geburtstag genommen habe.40
Nach einer Sitzung des Sekretariats des ZK der SED(!) am 11.11.1981 wurde das definitive Verbot der Sammlung erlassen.
In den Akten der Gauckbehörde ist in Bezug auf die Anthologiebeiträge von „aggressiven, konterrevolutionären Positionen gegenüber dem realen Sozialismus“ die Rede. Offensichtlich waren die Machtorgane besonders davon beunruhigt, daß die jungen Autoren weniger kontrollierbar waren als andere gleichaltrige, in Zirkeln Schreibender Arbeiter, in der FDJ-Poetenbewegung oder im Schriftstellerverband erfaßte. Was Fühmann als neue literarische Tendenzen bekanntmachen wollte, wurde staatlicherseits von Anfang an als Sicherheitsproblem gesehen und behandelt. Erneut wurde der ästhetische Regelverstoß als politische Konfrontation interpretiert. Ein weiterer Aspekt politischer Beunruhigung war folgender, zitiert aus „Informationen“ der Hauptabteilung II/3 der Staatssicherheit vom 6.10.1981 „zu dem Schriftsteller Franz Fühmann“:
Es kann damit gerechnet werden, daß diese Anthologie als Druckmittel verwendet werden soll, um bestimmte Bücher dieser Autoren in der BRD veröffentlichen zu lassen, falls eine Veröffentlichung in der DDR versagt wird.41
Viele beteiligte Autoren sahen jedoch weniger im Westen eine Alternative zu den undurchschaubaren Zensurmechanismen als in selbstverantworteten sogenannten inoffiziellen Publikationen innerhalb der DDR. Seit dem Ende der 70er Jahre wurden diese Zeitschriften in Kleinstauflage mal kriminalisiert42 und verboten, mal geduldet. Das Selbstbewußtsein der jungen Kunstproduzenten war entsprechend gewachsen43, die ängstliche bis gehässige Aufmerksamkeit vieler Kulturverantwortlicher auch. Das engagierte Interesse vieler westdeutscher Literaturkritiker, Journalisten und Sammler stellte nicht nur einen Akt symbolischer Anerkennung dar, sondern einen ganz handfesten ökonomischen Faktor: Schließlich finanzierten nicht wenige der an den Kleinstzeitschriften, Lyrik-Grafik-Mappen und Unikaten Beteiligten ihr ,Boheme‘-Leben in überschaubaren privaten Zirkeln und Künstlerfreundeskreisen der Großstädte über Westhonorare.
Wie Fühmann versuchten auch einige der beteiligten Autoren nochmals zu vermitteln: Es gehe ihnen nicht um die Veröffentlichung der Anthologie, schrieben z.B. Elke Erb, Thomas Günther, Uwe Kolbe, Wolfgang Hegewald und Wolfgang Hilbig am 20.12.1981 in einem Brief an den Kulturminister, sondern um die Schaffung eines internen Studienmaterials, das die Grundlage für Gespräche mit der Akademie der Künste und den Kulturinstitutionen lege. Die Anthologie sei nicht als Ultimatum, sondern als Gesprächsangebot gedacht. Von einer Verbreitung in den Westmedien sehe man auch dann noch ab, wenn der Brief unbeantwortet bleiben sollte. Als kurze Zeit später Konrad Wolf starb, hatten alle einen wichtigen Gesprächspartner unter den hochrangigen Kulturfunktionsträgern verloren. 44 Die Verhängung des Kriegsrechts im Nachbarland Polen trug zur erneuten Vereisung des Klimas bei. Ein Beitrag im Stern vom 14.1.1982, der sich nebenbei auch mit den Vorgängen um die Anthologie befaßt, verhärtete die Fronten zusätzlich.
Berührungsangst
Von den dreißig Autorinnen der verbotenen Akademien-Anthologie waren fünfzehn in der von Sascha Anderson und Elke Erb ab Sommer 1983 zusammengestellten Folgesammlung Berührung ist nur eine Randerscheinung vertreten. Fast die Hälfte der dreißig hatte die DDR inzwischen verlassen. Man kann durchaus konstatieren, daß diese Folge-Anthologie ästhetisch noch konsequenter war. Elke Erb hatte als selbst überaus theoriebewußte ältere Dichterin und Theoretikerin eines prozessualen Schreibens die Jungen dazu angehalten, ihre poetologischen Wege und Interessen zu reflektieren. Daß Elke Erb sozusagen die Mentoren-Nachfolge Fühmanns antrat, war nur folgerichtig, hatte sie doch bereits 1981 auf einer Tagung der Evangelischen Akademie Berlin-Weißensee einen überaus sachkundigen Vortrag über die neuere Lyrik von Papenfuß, Anderson, Kolbe u.a. gehalten, der als Manuskript kursierte.45
Die Fahnen faulen die Zeichen
Sind abgenutzt die Losung
Bleibt gleich Tag für Tag
soll ich das Ende dessen singen? […]
Glauben ersetz ich nicht durch anderen Glauben […].[footnote]In: Anderson, Erb (Hg.): Berührung (Anm. 12) S. 39
Der Zeilenbruch signalisiert, daß Kolbe zu diesem Zeitpunkt sein Material, die sprachlichen Zeichen, nicht nur „abgenutzt“ erschien, sondern gar vom „Faulen“ der „Fahnen“ angesteckt: die Zeichen selbst beginnen zu faulen.
Auch andere junge Autoren, deren Texte die Anthologie versammelt, bezeichnen die von Herrschaftssprache und Doublespeak infizierte Sprache als verfault, verhurt, entleert und instrumentalisiert. Übrigens teilten auch ältere Dichter wie Kito Lorenc, Adolf Endler oder Heinz Czechowski diesen sprachkritischen Befund.46 Hier nahmen die Kollektivmanifeste der „östlichen Sprachheilschule“ (Bernd Wagner) ihren Ausgangspunkt, die zu den Sprachexperimenten und -zertrümmerungen, den Sprachspielen und Parodien in Anknüpfung an Avantgardetraditionen vom Dadaismus bis zur konkreten Poesie führten, welche das letzte Jahrzehnt der DDR-Literaturgeschichte begleiteten. Schuld der Worte hatte Gert Neumanns Debütband im Westen (1981 Fischerverlag) geheißen.
Bereits im Inneneinband der Anthologie war Jan Faktors Parodie der Propagandasprache zu lesen: „das Routinierte wird immer routinierter / das Bornierte immer bornierter / das Kleinkarierte immer kleinkarierter“ […] – die Komparativ- und Superlativketten sind endlos. Sprachlosigkeit, „Dekonstruktion der Herrschaftssprache“, Suche nach einer Gegensprache oder „Grenzüberschreitung in das Land jenseits des Sinns“ lauteten die Leitvokabeln. Im folgenden wird zunehmend der Jargon postmoderner Theorien aufgegriffen werden, um die durchherrschte DDR-Gesellschaft denken zu lehren und ihre dominierenden Denkmuster verlassen zu können. An der Folge-Anthologie Sprache & Antwort von 1988 kann man diesen Prozeß ablesen.
Trotz aller kanonisierten Rhetorik ging es bei den Sprachexperimenten nie nur um Sprache: „Leben ist außerhalb der staatlichen Sprachen“ hieß es bei Kolbe, nicht „Poesie ist außerhalb der staatlichen Sprachen“. Als Adolf Endler, ein ,verdienter Anthologist der ersten Stunde‘47 diese Beobachtung 1986 äußerte, geschah das allerdings nicht am Ort des Geschehens, sondern im Norddeutschen Rundfunk.48
Der Versuch, die Sammlung im Aufbau-Verlag herauszubringen, war von heute aus gesehen von vornherein zum Scheitern verurteilt. Was die Motive des Handelns von Sascha Anderson angeht, so entzieht sich die Schizophrenie seines Handelns als engagierter Aktivist einerseits und eifriger Spitzel andererseits meinem Verständnis. Wenn alle Vermittlungsversuche scheiterten und die Anthologie schließlich 1985 bei Kiepenheuer & Witsch in Köln erschien, so war das in den Augen Elke Erbs eine Notlösung, der letzte Weg, um sich nicht erpressen zu lassen. Erb sprach 1993 rückblickend überaus kritisch auch über die Zusammenarbeit mit dem Westverlag. In der ersten Auflage sei viel fehlerhaft abgedruckt worden:
Dort sind 27 mal Texte aneinandergeschrieben, die gar nicht zusammengehören. Das ist eine Meisterleistung… Und wir hatten doch gedacht, im Westen ist alles okay, dann kann man sich drauf verlassen. Sie haben auch besserwisserisch Texte rausgeschmissen, ohne uns zu fragen, stümperisch, sie haben Tippfehler für innovatorische Dichtung gehalten.49
In den Akten des Büros für Urheberrechte wurden 1990 Thermokopien eines sechsseitigen unsignierten Strategiepapiers vom 7.1.198550 aufgefunden, in dem begründet wurde, daß das Manuskript „auch aus Gründen der Autorenzusammensetzung für eine Veröffentlichung in einem Verlag der DDR nicht in Frage“ käme.
Dies wurde der Herausgeberin Elke Erb vom Direktor des Aufbau-Verlages, dem das Manuskript vorgelegen hat, in mehreren Gesprächen nachdrücklich gesagt; ebenso wurde sie aufgefordert, ihre Aktivitäten zur Veröffentlichung dieser Anthologie in der BRD, die gegen die gesetzlichen Bestimmungen der DDR verstoßen, einzustellen.51
Sollte dies mißlingen, so hieß es in dem Papier, „sind Maßnahmen der Unterbrechung der verlegerischen Beziehungen zwischen Verlagen der DDR und Kiepenheuer & Witsch einzuleiten“.
Wenn in diesen Akten der Eindruck erzeugt wird, Elmar Faber als Leiter des Aufbau-Verlages sei ,beauftragt‘ worden, die Veröffentlichung bei Kiepenheuer & Witsch abzuwenden bzw. den Verlag zu veranlassen, auf bestimmte Texte zu verzichten und durch diejenigen anderer Autoren zu ersetzen, so sagt das mehr über die Allmachtsphantasie ihrer Verfasser aus, als über die tatsächlichen Vorgänge.52 Faber handelte als erfahrener Verlagsleiter durchaus in eigener Regie bzw. entsprechend eigener verlegerischer Interessen. So hatte er sich einerseits, seitdem er vom Exportverlag Edition Leipzig zu Aufbau gekommen war, um Kontakte zu Berliner Autoren und Autorinnen unterschiedlicher Generationen bemüht, andererseits war das Anthologieprojekt Erbs und Andersons für ihn nur eines unter vielen. In einem Brief an Rüdiger Thomas schreibt er 1995 rückblickend:
Ja, ich wollte die Anthologie in der DDR herausbringen. Ja, ich hatte Einwände gegen Texte, weil sie literarisch nichts taugten und seither auch nicht besser geworden sind. Ja, das habe ich gesagt und auch meinem Kollegen Dr. Neven Dumont bei Kiepenheuer & Witsch weitergegeben, und selbstverständlich habe ich einen Kompromiß gesucht, um die Anthologie in beiden Staaten und gleichzeitig erscheinen zu lassen […].53
Auf eben solche Kompromisse jedoch wollten sich weder die beteiligten AutorInnen noch die beiden HerausgeberInnen einlassen, war ihre Sammlung doch gerade in Auseinandersetzung mit den ewigen Kompromissen vielfältigster Art entstanden. Wie Veränderungen an dem Manuskript auch immer begründet wurden, ob ästhetisch oder politisch, spielte für die meisten von ihnen zu diesem Zeitpunkt keine Rolle mehr. Stattdessen ging es um selbstverantwortete Aktionen und Projekte, wie das Anwachsen der Zahl inoffiziell publizierter Kleinstzeitschriften und Künstlerbücher seit 1980 zeigte. Sich mit der Sammlung überhaupt an eine staatliche Institution zu richten, war unter den Beteiligten durchaus umstritten, wie auch die widersprüchliche Geschichte der Veröffentlichung einzelner AutorInnen der unabhängigen Literaturszenen in der von Gerhard Wolf im Aufbau-Verlag betreuten Reihe Außer der Reihe ab 1988 erkennen läßt.
In dem erwähnten Papier des Büros für Urheberrechte wurden Vorschläge für Restriktionen gegenüber Kiepenheuer & Witsch detailliert aufgeführt, sollte dieser die Anthologie gegen den Einspruch des Kulturministeriums dennoch veröffentlichen: DDR-Verlage wie Volk und Welt, Aufbau, Neues Leben und Henschel sollten keine Lizenzen mehr übernehmen, die Zusammenarbeit mit Autoren des Kölner Verlages unterbinden, nicht mehr für Kiepenheuer & Witsch mitdrucken usw. Bis ins einzelne wurden dadurch entstehende Valuta-Einbußen bilanziert.54 Von all diesen Vorschlägen wurden die wenigsten Wirklichkeit, sie wirkten eher als Drohgebärden im Hintergrund und führten allenfalls zur Verzögerung geplanter Projekte.
Nachhaltiger wirkten sich die Bestrebungen aus, Elke Erb aus dem Schriftstellerverband auszuschließen. Ihre Publikationsprojekte im Aufbau-Verlag verzögerten sich. Bereits am 22.12.1981 war Erb erneut zum Objekt eines Operativen Vorgangs der Staatssicherheit geworden. Ihre Arbeit an der Anthologie wird in den Akten der Staatssicherheit als „Organisierung politischer Untergrundtätigkeit“ bewertet.55 Um das Erscheinen der Anthologie zu verhindern, wurden Schriftstellerverband, die Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel und das Büro für Urheberrechte vom Ministerium für Staatssicherheit zum „politisch-operativen Zusammenwirken“ veranlaßt. Zwei leitende Beamte des Büros für Urheberrechte hatten, wie eine Notiz vom 13.11.1984 erkennen läßt, acht der an der Anthologie beteiligten Autoren aufgesucht, um ihnen persönlich mit möglichen rechtlichen Konsequenzen einer Publikation in der BRD zu drohen. Im Januar 1985 hatte außerdem ein Gespräch im Büro für Urheberrechte stattgefunden, zu dem vierzehn Autoren eingeladen worden waren.56
Wie sehr sich die Fronten verhärtet hatten, zeigt ein Gutachten Annemarie Auers, das ich 1989 halblegal im Archiv des Berliner Schriftstellerverbandes einsehen konnte. Allein, daß gerade die aus der Debatte um Christa Wolfs Kindheitsmuster (1977) unrühmlich bekannte Literaturwissenschaftlerin vom Schriftstellerverband mit einem Gutachten beauftragt wurde, war gleichbedeutend mit einer Vorentscheidung. So dient denn dieses ,Gutachten‘ auch eher dazu, im nachhinein zu begründen, warum die Anthologie nur im Westen erscheinen konnte. In dem immerhin dreizehn Seiten umfassenden Gutachten vom 28.10.1985 heißt es:
Damit haben wir das Programm eines extremen Individualismus, ja geradezu eines Solipsismus Stirnerscher Prägung vor uns, der das Band und die Korrespondenz zwischen dem Individuum und der Gesellschaft in Abrede stellt und zerreißt. […] Der Austritt aus der gegebenen Gesellschaft, aus der Gesellschaftlichkeit überhaupt ist daher Grundlage der Erbschen Argumentation sowie sämtlicher Beiträge, die sie in ihrer Anthologie versammelt hat. […] Es ist die Haltung und auch die Poetologie eines konsequenten Nihilismus. […] Daß all das in einem Abseits zustandegekommen ist, läßt sich der beruflichen Situation der Beiträger entnehmen. […] Die Anthologie hätte hier unmöglich erscheinen können; zum einen aus Gründen mangelnder literarischer Qualität, zum anderen aber wegen ihrer ausdrücklichen Abweisung eines ,inhaltlichen‘ realistischen Schreibens, hierunter selbstverständlich auch des sozialistischen Realismus.
Zu diesem Zeitpunkt waren DDR-LiteraturwissenschaftlerInnen von Rang in ihrer ästhetischen Wertung wohl ebenso weit von einer solchen Position entfernt wie die jüngeren LyrikerInnen. Statt sich dem unberechenbaren Machtspiel weiter auszusetzen, hatten sich viele innerlich und äußerlich von der DDR und ihrem Kulturbetrieb verabschiedet. Die ursprünglich beabsichtigte Integration in den DDR-Literaturbetrieb war gescheitert. Dem westlichen Publikum wurde zugleich ein Ausschnitt der jungen Autorengeneration aus der DDR als repräsentativ für die „neue Literatur aus der DDR“, wie der Untertitel der Kiepenheuer & Witsch-Ausgabe lautete, vorgestellt. Damit wurde im Westen wie im Osten ein Kanon der neueren DDR-Gegenwartsliteratur festgeschrieben, der jeweils größere Leerstellen aufwies: Im Osten fehlten weiterhin Namen wie Lange-Müller, Papenfuß, Faktor, Döring oder Kachold, im Westen fehlten lange Hensel, Mensching, Wenzel, Karma, Köhler oder Eckart.
Wie sich die ausschließlich im Westen publizierte Anthologie vermittelt und indirekt auf den literarischen und literaturwissenschaftlichen Kanon innerhalb der DDR auswirkte, ist schwer zu erforschen. Natürlich gab es Mechanismen der negativen Anerkennung. Sowohl das gedruckte Buch, als auch dessen Beachtung und zum Teil begeisterte Rezension in westdeutschen Zeitungen und Zeitschriften drangen über die Mauer hinweg auch in den DDR-Alltag vor, zumal über die westdeutsche Veröffentlichung auch viele internationale DDR-ForscherInnen nun Texte und Kommentare der Anthologie zu Themen von Aufsätzen und akademischen Arbeiten machten. Das Feuilleton und die DDR-Forschung der Bundesrepublik bekamen mit der Veröffentlichung einen Einfluß auch auf das Selbstverständnis „neuester DDR-Literatur“ bzw. der neuen Generation, der für die letzten Jahre der DDR entscheidende Folgen haben sollte. Nicht nur Namen wurden damit auf- bzw. abgewertet, sondern auch Schreibweisen. Wenn das Sprachexperiment nun das „neue literarische Paradigma“ (so Emmerich noch 1996)57 schlechthin bildete, so wurden andere Schreibweisen gleichaltriger AutorInnen wie diejenigen von Thomas Brasch, Peter Brasch, Brigitte Struzyk, Barbara Köhler, Kerstin Hensel, Thomas Rosenlöcher oder Kurt Drawert beinahe zwangsläufig marginalisiert. Drei 1988 erschienene Anthologien verstärkten diese vereinfachenden Frontlinien. Aus der „neuen DDR-Literatur“ wurde die „andere Literatur aus der DDR“58 und die im Aufbau-Verlag erschienene Sammlung Die eigene Stimme gliederte viele Stimmen aus dem Kanon der „Lyrik der DDR“ aus.59
Fazit: Die Geschichte der Anthologie ist trotz ihrer letztlichen Publikation die eines Scheiterns. „Die Schatten warfen ihre Ereignisse voraus“, schrieb Mario Persch in der inoffiziell publizierten Kleinstzeitschrift Liane 3/1988.
Birgit Dahlke, aus Günter Häntzschel: Literatur in der DDR im Spiegel ihrer Anthologien. Ein Symposium. Harrassowitz Verlag, 2005
Dokument der Autonomie:
Berührung ist nur eine Randerscheinung
Aus der Erkenntnis heraus, daß angesichts der unerträglichen Publikationsbedingungen in der DDR und der intellektuellen Agonie des Landes nach der Biermann-Affäre etwas für die jüngere Autorengeneration geschehen müsse, regte Fühmann im Frühjahr 1980 Kolbe und Anderson zum Sammeln von Texten an, für die es bis dahin in der DDR keine Möglichkeiten der Veröffentlichung gegeben hatte. Die Initiatoren der Sammlung faßten es als einen letzten Versuch auf, der jungen Autorengeneration, die zum Teil schon in der Bundesrepublik publizierte, eine Chance innerhalb der DDR zu eröffnen. Fühmanns Idee war, mit Unterstützung des Präsidenten der Akademie der Künste, Konrad Wolf, eine Diskussionsgrundlage für Germanisten, Philosophen, Gesellschaftswissenschaftler u.ä. zu schaffen, die als Arbeitsheft der Akademie der Künste für diesen begrenzten Zweck publiziert werden sollte.60 Vor der Abrundung des Manuskripts schalteten sich 1981 Partei und Staatssicherheit ein und verboten die Sammlung, weil ein von den vertretenen poetischen Positionen ausgehender sozialer Sprengstoff befürchtet wurde. Mit Konrad Wolfs Tod Anfang 1982 war das Unternehmen endgültig gescheitert. Dank Elke Erbs Initiative wurde das Projekt 1983 unter Andersons Mitwirkung neuaufgegriffen, verändert und unter dem von Papenfuß stammenden Arbeitstitel „Leila Anastasia“61 um weitere Texte ergänzt. Nach vergeblichen Verhandlungen mit dem Aufbau-Verlag erschien die Textsammlung unter dem Titel Berührung ist nur eine Randerscheinung schließlich beim Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch 1985. Über die Denkweise der Kulturbehörden bezüglich des Projekts gibt ein internes Strategiepapier des Büro für Urheberrechte der DDR (BfU) Auskunft. „Das Manuskript enthält Texte, in denen die Positionen des ,Außenseiters‘ bzw. des ,Aussteigers‘ aus unserer sozialistischen Gesellschaft zur Schau gestellt werden. Es wird ein Lebensgefühl artikuliert, in dem resignative und nihilistische Züge vorherrschen, Elegisches und Bitteres, Gefühle des Eingesperrtseins kommen zum Ausdruck, Selbstmord und Tod sind bevorzugte Motive.62 Der Direktor des Aufbau-Verlages, Elmar Faber, wurde beauftragt, bei Kiepenheuer & Witsch zu intervenieren. Gegen Erb erwog man ein Strafverfahren.
Elke Erb hat im Vorwort zur Anthologie ihre Eindrücke von dem Neuen an den Texten formuliert. Diese Literatur erschien ihr als prinzipiell anders als die bisherige DDR-Literatur, als „stünde sie am Anfang einer neuen Zeit (und Utopie) und nicht am Ende einer alten“; diese Literatur sei „auch nicht verführt zu einer folgenlosen Kritik und überhaupt über konfrontative Positionen hinaus. Dieses neue Selbstbewußtsein läßt sich nicht bestimmen und begrenzen von dem System, dessen Erbe es antritt. Seine soziale Reife ist die Konsequenz des Austritts aus dem autoritären System, der Entlassung aus der Vormundschaft eines übergeordneten Sinns. Diese soziale Reife ist von der Entwicklung der Zivilisation in einem Grade vorbereitet, daß sie von einem jugendlichen Bewußtsein erreicht werden kann (und nicht wie früher auf Ausnahmen beschränkt bleiben muß!)“.63 Für Erb war also dasjenige entscheidend an der neuen Literatur, was, in systemtheoretischer Terminologie, Ablösung der Literatur vom unifizierenden Sinn eines stratifizierten Sozialsystems genannt werden kann, d.h. auch Loslösung der Literatur aus der kritischen oder konfrontativen Auseinandersetzung mit der Parteiideologie:
Da gab’s ja einen Wechsel, die Jungen waren erst, Anfang der 80er Jahre, auf dem Code der Gegnerschaft und haben ihn dann verlassen. Das weiß ich noch genau, erst haben sie von ,Bullen‘ geredet, nachher war das völlig weg, und das war bewußt geschehen. 64
Wenn man von der Autonomie von Literatur sprechen will, dann ist das aus systemtheoretischer Sicht von einem Zeitpunkt an mit Recht möglich, zu dem sich literarische Kommunikation – d.h. der Diskurs von und über Literatur – an ihrem systemspezifischen Mediencode orientiert und selbstreflexiv auf einen problemspezifischen Sinn bezieht. Als sich Anfang der 80er Jahre die verschiedenen literarischen wie auch künstlerischen Neuansätze nicht nurmehr negierend auf die offizielle Ästhetik und die in der DDR-Literatur gängigen utopielastigen Autorenpoetiken bezogen, sondern aufeinander und miteinander zu kommunizieren begannen, konnten sich die neuen ästhetischen Auffassungen stabilisieren. Diese zum Teil pathetische Selbstausbürgerung aus der ,Literaturgesellschaft‘ hatte sich nach der Biermann-Affäre deutlich beschleunigt, war aber nicht durch ein politisches oder literarisches ,Vorbild‘ Biermann ausgelöst worden 65, sondern soziale Folge der durch die Ausbürgerung veränderten Rahmenbedingungen, auch hinsichtlich des immer stärker spürbar werdenden Mangels an struktureller Modernisierung der Gesellschaft. Die kulturpolitischen Maßnahmen Ende der 70er Jahre lenkten somit die kulturelle Differenzierung in eine Richtung, mit der literarische Selbstreflexivität in einen kommunikativen, kulturellen Untergrund abgedrängt wurde, wo aber auch Selbstorganisation um die Ausgrenzungen des ,Leselandes DDR‘ als symmetrische Negation stattfinden und wo sich Kommunikation selbstreferentiell schließen konnte. Die neuen Ausdrucksweisen und ihre „programmatische Absage an Kunst und Poesie, die oft bei ihren Statements mitschwingt, ist an eine Tradition gerichtet, der man nicht mehr traut, als daß man sie ernsthaft als Anti-Kunst-Demonstration verstehen soll“.66 Spätestens nach der Erarbeitung des Manuskripts und dem Erscheinen der Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung, mit der sich diese Entwicklung erstmalig relativ geschlossen manifestierte, kann deswegen von funktionaler Autonomie des literarischen Untergrundes in der DDR gesprochen werden. In den Texten dominierte die literarische Selbstverständigung und keine Verständigung über und mittels außerliterarischer Belange. Mit der Anthologie wurden verschiedene Gruppierungen und Schriftsteller des Landes, die bis dahin meist nur als Mitarbeiter an Heften und Typoskripten hervorgetreten waren, zusammengeführt und in West und auch Ost und z.T. auch erst miteinander bekanntgemacht. Da Erb dem Band auch Auszüge aus Gesprächen mit den Autoren beigab (aus Furcht vor Repressalien beschränkte sie sich dabei auf Passagen, die ihrer Meinung nach die Autoren nicht gefährden konnten und die biographisch oder poetologisch gegenüber dem BfU noch vertretbar waren), enthielt das Buch programmatische Statements, mit denen die Reflexivität der literarischen Kommunikation im Untergrund eine eigene, interne Referenzbasis erhielt. Der gemeinsame Textkorpus, über den man jetzt verfügte, hatte die Katalysatorwirkung, die Elke Erb von der Sammlung auch erwartete:
Wahrscheinlich wird ihnen [den Autoren, E. M.] die Aufeinanderbezogenheit der Dispute und Gespräche bewußter werden, wenn sie sie in dieser Anthologie gespiegelt sehen.67
Mit der Ausweitung der handgemachten Zeitschriftenszene nach 1984 und der Zusammenarbeit im multimedialen Bereich entstanden nun in den nächsten Jahren gewissermaßen „subkulturelle Institutionen“68, entwickelte sich eine „zweite Kultur“69, d.h., es strukturierte sich im Untergrund ein Funktionssystem Kunst und Literatur. Den Beteiligten und Sympathisanten war klar, daß ein Bruch mit der DDR-Literatur stattfand. Es habe sich um eine „schroffe Abwendung von dem Rest der Literatur in der DDR“ gehandelt70 und um den „Verlust des klassischen intentionalen Bogens“, um „Versuche, die Dinge in anderer Sprache neu zu denken“.71 Diese junge Generation habe, so Endler, „zum ersten Mal in der Geschichte der DDR-Literatur […] halbwegs überzeugend“ Weltbewußtsein und Zeitgeist aus der „einzigartigen Situation“ und den „spezifischen Atmosphärilien in Berlin/DDR“ heraus zu gestalten vermocht.72
Eine halbwegs organisierte Gruppenbildung gelang unter den jungen Literaten jedoch nicht; neben Freundschaften und Arbeitsgemeinschaften gab es interne Ausgrenzungen bis hin zu Intrigen. Thomas Günther:
Rückblickend waren die Jahre 1982/83 die intensivsten Arbeitsjahre der sogenannten Szene, die als einheitliches Phänomen freilich mehr und mehr von Journalisten herbeigeschrieben wurde.
Der Name der Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung sei ein „sinnfälliger Titel“ gewesen.73 Anläßlich des Abschlusses des Manuskripts für die Anthologie organisierten Elke Erb und andere im März 1984 eine einwöchige private Veranstaltungenserie in einer Atelierwohnung im Prenzlauer Berg in Berlin74, bei der u.a. die Autoren der Anthologie lesen sollten. Sie stand unter dem Titel „zersammlung“ (den Papenfuß und Döring erfunden hatten).75 Man wollte unter anderem erörtern, ob eine organisierte Gemeinsamkeit aller offiziell ausgegrenzten Autoren sinnvoll und wünschenswert wäre, etwa in der Form eines „alternativen Schriftstellerverbands“76. Im Laufe der Woche begriffen wohl die meisten Beteiligten, daß eine bestimmte Form der Zusammenarbeit vorüber war. In der Vorbereitung waren Zwistigkeiten entstanden, die zur Ausgrenzung von Lutz Rathenow (Rathenow hatte immerhin gerade die Anthologie einst war ich fänger im schnee für den Westberliner Oberbaumverlag vorbereitet, in der auch einige der Teilnehmer vertreten waren77) und somit zur Abgrenzung von einer Poetologie, die Literatur als metaphorisch verbrämte politische Widerstandshandlung verstand. Uwe Kolbe galt als Grenzfall. Die in der DDR mit FDJ-Preisen dekorierten und geförderten Kabarettisten und Autoren Steffen Mensching und Hans-Eckart Wenzel hingegen wurden ganz der anderen Seite zugeschlagen, was Papenfuß 1987 zu einer polemischen ,Verdichtung‘ veranlaßte: „steffen mensching ist im untergrund / ein arschloch & wenzel der entsprechende / stöpsel“, während „uwe kolbe die scheidung der gemüter trifft“.78
Die „zersammlung“ fiel in Monate, in denen sich das politische Klima in der DDR stark veränderte. Die Behörden hatten 1984 plötzlich begonnen, massenhaft Ausreiseanträge zu genehmigen. Der Staat hoffte wohl, sich auf diesem Wege der Regimegegner des Landes auf einen Schlag zu entledigen. Beunruhigte Künstler und Intellektuelle suchten vergebens nach einem Grundkonsens über die Art und Weise, wie auf diese überraschende und neue Taktik und Situation zu reagieren sei. Auch manche der an der Anthologie Beteiligten hatten selber seit Jahren Ausreiseanträge laufen und durften auf einmal das Land verlassen (beim Erscheinen der Anthologie 1985 lebten bereits 10 der 27 Autoren im Westen). Die Gemeinsamkeit in der Ablehnung der Gesellschaft reichte 1984 als Zusammenhalt nicht mehr aus; das Differente zwischen den Positionen trat nun ungeschminkt zutage: „die – eben doch – Zersammelten [hatten] offenbar neben dem Hang zum schriftlichen Ausdruck kaum etwas gemeinsam“79, was sich während der „zersammlung“ in versteckten Aggressionen und poetologischen Anfeindungen äußerte. Dies und die allgegenwärtige Angst vor der Staatssicherheit erzeugte ein „Gefühl der nicht mehr überbrückbaren Sprachlosigkeit in gesellschaftlicher Isolation.“80 Ungeklärt ist, inwieweit bei der Veranstaltung Anderson als Mitorganisator versuchte, im Auftrag der Staatssicherheit die Teilnehmer gegeneinander auszuspielen und die Ereignisse unter Kontrolle zu bekommen.81 Fest steht heute, daß Anderson in den Monaten nach der „zersammlung“ den von Kolbe ausgehenden Überlegungen, einen „Bund unabhängiger Schriftsteller“ zu gründen, der Autoren und Öffentlichkeit bei staatlichen Übergriffen informieren und seine Mitglieder auf diesem Wege absichern sollte, zumindest entgegenarbeitete.82 Zu einer solchen Gründung kam es nicht.
Der Zusammenhalt in den privaten Nischen war danach weder in alter Form wiederherstellbar, noch schien sich eine neue Form anzubieten. „Das Hauptproblem war […] das fehlende ,Danach‘. […] Weil in der Woche keine funktionierende Struktur entstanden war und die eigentlichen Veranstalter sich (es hätte zum Schluß auch nicht viel genutzt) sehr zurückhielten, war eben alles möglich. Die Zersplitterung hatte sich selbst inszeniert. Elke Erb saß still auf einem der wenigen Stühle und wartete ab.83 Offenkundig genügte das Eingeschlossensein und der begrenzte ästhetische Konsens, genügte kommunikative Negation allein nicht mehr als Basis für persönliches Vertrauen. Gegensätzliche poetologische Vorstellungen, aber auch divergierende berufsständische, politische und individuelle Interessen waren nicht länger auf einen organisierbaren Nenner zu bringen, ein Anzeichen für gewachsene soziale und literaturinterne Komplexität.
Ekkehard Mann, in Ekkehard Mann: Unterground, autonome Literatur und das Ende der DDR. Eine systemtheoretische Analyse, Peter Lang, 1996
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Manfred Jäger: Als losgewordener Ballast unterwegs
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 13.10.1985
Robert Siebum / Marieluise de Waijer-Wilke: Sascha Anderson und Elke Erb: Berührung ist nur eine Randerscheinung
Deutsche Bücher, Heft 1, 1985
Franz Fühmann an Konrad Wolf84
ÜBERS NIEDERTRÄCHTIGE
NIEMAND SICH BEKLAGE;
DENN ES IST DAS MÄCHTIGE,
WAS MAN DIR AUCH SAGE.
J.W. v. Goethe
27.12.81
Lieber Konrad Wolf,
hier wäre denn der Brief an Sie, das Vorwort zu jener Anthologie. Leider muß ich sagen, daß die Repressionen in dieser Sache wachsen; um so wichtiger, daß eine Klarstellung erfolgt.
Darf ich Sie bitten, eine Ablichtung des Briefes dorthin weiterzugeben, woher einst die ersten Warnungen kamen? Ich habe eine Abschrift an Stephan Hermlin gegeben, eine an Uwe Kolbe & Sascha Anderson,85 eine an den Staatssekretär Kurt Löffler, mit der Bitte um Unterrichtung des Ministers.
Die Schilderung der beiden Gespräche stammt natürlich aus meiner Erinnerung und unter meinen Aspekten. Sollten Sie der Meinung sein, daß ich etwas Wesentliches nicht oder unrichtig gesagt oder dargestellt habe, so bitte ich Sie, eine entsprechende Korrektur von Ihrer Seite aus beizufügen. Da dieser Brief ja meinen Standpunkt wiedergibt, schien mir eine vorherige Abstimmung zwischen uns nicht notwendig.
Einer der Autoren dieser Anthologie, Dieter Eue,86 muß das Land verlassen; eine andere, Christa Moog,87 eine der begabtesten (ich kenne großartige stories von ihr) hat den Ausreiseantrag gestellt. Lieber Konrad Wolf, ich schreib jetzt einmal ein paar Namen und Buchtitel auf Wolf Biermann; Sarah Kirsch; Thomas Brasch;88 Günter Kunert; Jurek Becker (Schlaflose Tage; Erzählungen); Hans Joachim Schädlich89 (Versuchte Nähe); Kurt Bartsch;90 Frank Matthies; Klaus Schlesinger („Leben im Winter“); Karl-Heinz Jakobs;91 Erich Loest; Klaus Poche92 – sie leben nicht mehr bei uns, und werden auch nicht mehr zurückkommen; Bettina Wegener93 geht; um Reiner Kunze & Joachim Seyppel traure ich nicht. Nicht erschienen in der DDR sind – ich nenne da nur ganz wesentliche Arbeiten: Gert Neumann:94 Schuld der Worte; Elf Uhr (verdiente den Heinrich-Mann-Preis!!); Monika Maron:95 Flugasche; Stefan Heym: Ahasver; Wolfgang Hilbig: Abwesenheit; ich breche ab. – Die Romane des hochbegabten Wolfgang Hegewald96 werden Jahr um Jahr hinausgezögert. Ich breche hier ab; von meiner Essay-Sammlung will ich nicht reden. Bei Stücken, Filmen und Hörspielen fehlt mir die Übersicht.
Wohin gehn wir; wohin geht das?
Lieber Konrad Wolf, ich wünsche uns allen für das Jahr, das da heraufgraut, Kraft und Gesundheit, und daß wir die Hoffnung nicht verlieren,
herzlich ergeben immer Ihr Franz Fühmann
[Anlage:] Franz Fühmann an Konrad Wolf97
22.12.81
Lieber Konrad Wolf,
ich schicke Ihnen heute in Gestalt dieses Briefes ein Vorwort zu jener „Anthologie junger Dichter der DDR“, die als Entwurf für ein „Arbeitsheft der Akademie der Künste“ dienen sollte. Daß ich Ihnen dieses Vorwort erst nachreiche ist nicht so sehr ein Versäumnis –: ich hatte, als ich Ihnen und Günter Rücker98 je ein Exemplar dieser Anthologie übergab, nicht die Notwendigkeit gesehen, etwas zu erläutern, das wir ja kannten, nämlich die Entstehungsgeschichte wie die Besonderheit dieser Anthologie. Indes haben sich jedoch so viele Mißverständnisse um diese Arbeit gehäuft, daß ich die schlimmsten davon aufklären möchte.
Ich erinnere also die Entstehung. – Es sind nun etwa anderthalb Jahre her, da machten wir beide uns Gedanken, was wir für jene begabten Schriftsteller der jungen und mittleren Generation tun könnten, deren Arbeiten bei uns, aus Mangel an geeigneten Publikationsorganen, auf Veröffentlichungsschwierigkeiten stießen. Ich nannte Ihnen einige Namen, Sie kannten kaum einen davon und äußerten Ihr Interesse, nähere Kenntnisse zu gewinnen, und schließlich machten Sie den Vorschlag, ein „Arbeitsheft der Akademie der Künste“ zu nutzen, diesen Autorenkreis vorzustellen. Ich fand Ihren Vorschlag ausgezeichnet und bat zwei junge Dichter zu mir, Uwe Kolbe99 aus Berlin und Sascha Anderson aus Dresden, zwei außergewöhnlich begabte Vertreter der jungen Generation, die aber in ihrer Poetologie und Praxis des Schaffens einander diametral entgegengesetzt sind. Ich erläuterte ihnen unsre Gedanken und bat sie, die zur Mitarbeit sofort Bereiten, zunächst einmal das Material heranzuschaffen, um uns dreien (U. K., S. A. und F. F.) einen Überblick über die tatsächlich vorhandenen Kräfte der Generation von etwa 1958 bis 1940 zu geben. Die oberste Altersgrenze wurde mit ungefähr vierzig Jahren, also etwa bei Wolfgang Hilbig, angesetzt. Auswahlkriterien waren literarische Qualität sowie der Umstand, in der DDR bislang gar nicht oder unrepräsentativ wenig publiziert worden zu sein, ein Umstand, der indes für zwei der Vertretenen, Uwe Kolbe selbst, und Uta Mauersberger,100 nicht mehr gilt. Diese Sammlung war also von vornherein – und hier gründet das wesentlichste der Mißverständnisse – gar nicht als Repräsentation der jungen Literatur der DDR geplant; sie sollte nicht die Auswahl gültiger Literatur sein, sondern eine Übersicht über die bislang gar nicht oder zu wenig Publizierten ermöglichen. Sie war also, diese Anthologie, von Anfang an notwendigerweise einseitig, und man darf ihr nicht als Ziel unterstellen, was Gegegebenheit der Voraussetzung war.
Wir drei waren uns ferner darüber einig, daß eine solche Anthologie von Vertretern der Generation selbst erarbeitet werden müsse, die sie umfaßte, also nicht von einem Älteren, gar erheblich Älteren wie etwa von mir. Es gehört ja zu meiner Erfahrung, daß mir als Mitglied des Redaktionsbeirates von SINN UND FORM oft Gedichte zugeschickt wurden, hauptsächlich solche experimentellen Charakters, die weder von überragender Begabung noch von eklatanter Unbegabtheit zeugten und mich mehr oder weniger unbeteiligt ließen, in welchem Unbeteiligtsein jedoch immer eine Frage mitschwang, ob sie, diese Gedichte, nicht etwas enthielten, das mir entging und vielleicht für die Angehörigen der Generation der Verfasser von Wichtigkeit war. Man trifft ja in der Literaturgeschichte immer wieder auf generationsbedingte Fehleinschätzungen; ich fühlte mich also nicht kompetent, war unsicher und zog zur endgültigen Beurteilung Berater aus der Generation heran, der jene Dichter angehörten, die mich in solche Zweifel stürzten. – Es gibt zumindest einen Fall, wo es mir mein Berater ermöglicht hat, ein grobes Fehlurteil zu korrigieren, das war bei den Arbeiten Dieter Schulzes.101
Die Herausgeber der Anthologie sollten also selbstständig entscheiden, wen sie von ihren Generationsgefährten für wesentlich hielten (wie gesagt: immer unter dem Gesichtspunkt des zu wenig öffentlichen Bekanntseins); sie machten sich beide sofort an die Arbeit und präsentierten mir schließlich einen Berg von Manuskripten, Arbeiten von etwa 30 Autoren, die mir in der Mehrzahl unbekannt gewesen waren und die endlich kennen und beurteilen zu lernen ich für einen enormen Gewinn halte. Die Begabung dieser Autoren ist gewiß unterschiedlich; ihr Schaffen umfaßt alle Genres und die verschiedensten poetologischen Richtungen – von dem, was man kritischen Realismus nennen könnte bis zur ausgesprochen experimentellen, linguistisch akzentuierten Poesie.
Nun war ein Überblick vorhanden, neue Namen traten hinzu, wie etwa die hochbegabte Eisenacherin Christa Moog, und aus dem Vorhandenen wurde nun von den Herausgebern ausgewählt, wobei ich sie nur um Eines bat: Die einzelnen Dichter zwar durch repräsentative Texte vertreten sein zu lassen, jedoch es nicht darauf anzulegen, zu provozieren, und im Zweifelsfall jene Arbeit zu wählen, die als kleinster Stein möglichen Anstoßes erschien. Daß die Arbeiten Anstoß erregen könnten und würden, war uns klar – das eben war ja gerade der Grund, der diesen Autoren den Weg in die Öffentlichkeit bislang verengte oder völlig zuschloß –: Es waren Texte, die Unbefriedigtsein am Zustand der Gesellschaft artikulierten, die Kritik, auch Unmut, ja auch Mißmut bezeugten, die peinigende Fragen aufwarfen, die Unangenehmes konstatierten, die der Idylle entschieden abhold, der Selbstzufriedenheit unzuträglich und dem Wunschdenken nicht förderlich waren, kurzum, die eben das leisteten, was ihrem Wesen nach Funktion der Literatur auch ist, nicht ausschließlich, doch zumindest auch. Daß hier Ausschließlichkeit erschien, liegt an dem Umstand der begrenzten Auswahl auf den ich schon eingegangen bin.
Ich bescheinige beiden Herausgebern, daß sie ihre Auswahl mit Umsicht und hohem Verantwortungsbewußtsein getroffen haben. Es wurden insgesamt vier Exemplare dieser Anthologie hergestellt, je eines blieb bei den Herausgebern, eine ist bei mir (die gab ich Ihnen weiter), und eine war für G. Rücker, als mögliche Arbeitsgrundlage für das geplante Arbeitsheft gedacht.
Nachdem Günter Rücker sich mit den Texten vertraut gemacht hatte, kam es zu einer Zusammenkunft zwischen uns vieren (G. R., F. F., U. K. und S. A.), in der Günter Rücker etwa folgende Position vertrat: Er könne persönlich mit der Masse des in der Anthologie Enthaltenen wenig oder gar nichts anfangen; einiges halte er für unvertretbar, einiges allerdings beeindrucke ihn auch. Insgesamt halte er es für ausgeschlossen, daß die Sektion Literatur der Akademie der Künste, die einzig als Herausgeber des Arbeitsheftes fungieren könne (was von vornherein durchaus nicht so klar war; ich hatte eine Herausgeberschaft durch den Präsidenten der Akademie, den Sekretär der Sektion Literatur sowie mich für möglich gehalten) – er halte es also für ausgeschlossen, daß die Sektion Literatur per Mehrheitsbeschluß die Gesamtheit der Anthologie billigen könne; er, G. R., schlage daher vor, einzelne der in der Sammlung enthaltenen Dichter gesondert und verschiedenen Orts vorzustellen, etwa im Rahmen von SINN UND FORM. – Der Auffassung Rückers, daß die Mehrheit der Sektion Literatur diese Anthologie ablehnen werde, trat ich bei; ich erinnerte mich an qualvoll lange und qualvoll ergebnislose Debatten; dem Vorschlag Rückers, einzelne Dichter herauszugreifen und die Anthologie als Anthologie auf zugeben, hielten die Herausgeber wie auch ich nicht für akzeptabel und zwar aus dem Grund, daß dies Bemühen um Einzelvorstellungen ja durchaus geschah und weiter geschieht: jeder der in der Anthologie Vertretenen hat Manuskripte den Verlagen oder Literarischen Zeitschriften der DDR angeboten und tut dies weiter, wenn zumeist auch vergebens, einige der Schicksale solchen Bemühens, wie etwa das um die Herausgabe der Prosasammlung Die Schuld der Worte von Gert Neumann oder der Romanmanuskripte Wolfgang Hegewalds sind mir gut bekannt; die Prozeduren schleppen sich beinah schon ein Jahrzehnt hin.
An dieser Stelle sei auf das zweite gravierende Mißverständnis hingewiesen, das der Gruppierung. Die in der Anthologie vertretenen Dichter kannten – und kennen sich – zum Teil nicht persönlich, sie wußten manchmal auch dann nichts voneinander, wenn sie in derselben Stadt wohnten; auch ich kenne einen Teil von ihnen noch nicht von Gesicht zu Gesicht. Daß sie im Prozeß des Werdens dieser Anthologie untereinander bekannter wurden, ist nur natürlich; ich sehe darin nicht den mindesten Grund zur Beunruhigung. Diese Dichter bilden keine Gruppe; die Problematik ihrer Arbeiten wächst aus der unsres Lebens, das Quälende und Beunruhigende ihrer Fragen stammt von dort, aus der Realität, nicht aus irgend einem bösen Willen, und es ist, dies Quälende, nicht durch literaturpolitische Restriktionen aus der Welt zu schaffen, sondern einzig durch Veränderungen im gesellschaftlichen Leben, wozu eben diese Dichtungen ihren unersetzbaren Beitrag leisten könnten. Die Gemeinsamkeit der in der Anthologie Vertretenen ist also ihre Existenz in der DDR, ihre Erfahrung, ihre Begabung und ihre mangelnde Gelegenheit zur Publikation, und aus diesen Gründen dann ihr Zusammengeführtsein in dieser Anthologie. In deren Rahmen allerdings fühlen sie sich zusammengehörend, und Ausdruck davon ist ein Brief, den einige von ihnen an den Minister für Kultur geschrieben haben.
Ich kehre wieder zum Ablauf des Geschehens zurück. – Nach dem Gespräch mit G. Rücker übergab ich Ihnen mein Exemplar der Anthologie; Günter Rücker schickte mir das seine auf meinen Wunsch hin dann später zurück. – Unsere Unterredung, Konrad Wolf, stand schon im Schatten aufgekommener Mißverständnisse; es gab schon Gerüchte, ja es gab schon Repressionen, und Sie sprachen mit Sorge davon. Im Wesentlichen schlossen Sie sich der Meinung Rückers an; auch Sie hielten die Anthologie in ihrer konkreten Gestalt für nicht annehmbar und verwiesen auf eine mögliche Zusammenarbeit mit dem Institut für Literatur in Leipzig; im Übrigen waren auch Sie der Meinung, daß man individuell verfahren, und einige der Autoren, die Sie schätzen gelernt hätten, etwa in SINN UND FORM vorstellen solle, was ja indes etwa bei Detlef Opitz102 geschehen ist. Mit diesem unserem Gespräch war die Möglichkeit der Herausgabe eines Arbeitsheftes vorerst erledigt, und Sie gaben mir Ihr Exemplar zurück.
Abschließend sind wir übereingekommen, daß ich Ihnen diesen Brief als eine Art Vorwort zu der Anthologie schreibe, um die gröbsten Mißverständnisse aus der Welt zu schaffen. Ich wiederhole zusammenfassend: Diese Anthologie kam als der Entwurf, der sie ist, auf Grund unserer Überlegungen, als Gedanke zweier Mitglieder der Akademie der Künste, zustande; sie war von vornherein nicht als Repräsentation der jungen Literatur der DDR, sondern als Vorstellung der bislang zu wenig oder gar nicht Veröffentlichten gedacht; sie wurde für ein Arbeitsheft der Akademie zusammengetragen, hatte also experimentellen, möglicherweise auch exklusiven Charakter, und sie befand sich noch ganz im Stadium des Entstehens, als jene Mißverständnisse auftraten.
Unterdessen sind es ja nicht nur Mißverständnisse geblieben. Es gibt Verdächtigungen böser Natur, es gibt Verwarnungen und Warnungen etwa der Art, „der Dissidenten-Sammlung Franz Fühmanns“ (wörtlich) beizutreten. – Nun könnte ich für meine Person derartige – bleiben wir bei dem Wort „Mißverständnisse“ – gelassen ertragen, wiewohl ich deren Auswirkungen mittlerweilen direkt spüre; ich habe Kraft und Erfahrung, mich zu wehren und werde dies mit den geeigneten Mitteln auch tun. Allein mir geht es um die jüngeren Kollegen; sie sind in Bedrängnis, einige in Not. Es hat sich nun einmal so ergeben, daß diese Anthologie, nachdem die Akademie sie abgewiesen, nur noch mit meiner Person und meinem Namen verbunden ist – gut denn; ich nehme mich ihrer an. Sie ist, auf die geschilderte Art, letztlich durch mich zustande gekommen; und wenn ich mich auch nicht mit jedem Text voll identifiziere, stehe ich doch in ihrer Gesamtheit zu ihr. Ich will jetzt keine Polemik beginnen, mir geht es um Klarstellung und Klärung, und dieser Brief soll ein Beitrag dazu sein.
Einer der in dieser Anthologie Vertretenen, Dieter Eue, wird die DDR in wenigen Tagen verlassen. Ich bedaure sein Fortgehn; es ist ein Verlust. Natürlich, um dies zum Abschluß zu sagen, verkenne ich die Möglichkeit unserer Staatsmacht nicht, Stimmen, die sie als störend oder als Ärgernisse bereitend empfindet, weiter dem öffentlichen Bewußtsein unseres Landes und seines Publikums fernzuhalten, nur sehe ich dabei den Schaden einen auch nur denkbaren Nutzen weit übersteigen. Ich möchte aber andererseits meinen Glauben an eine mögliche Bereitschaft meines Staates nicht aufgeben, sich kritischer Literatur auch dann nicht zu versagen, wenn diese Kritik wehtut und Ärgernis schaffe. – Noch einmal: die Probleme entstammen dem Leben. – Alle die in dieser Anthologie Vertretenen sind begabte Dichter, und das heißt noch allemal: Es sind Hoffnungen und Kräfte. Sie sollten schöpferisch wirken können, anstatt in Verbitterung zu stürzen. Ich gebe meine Hoffnung nicht auf daß diese Dichter, so wie sie sind und mit dem was sie schreiben (also nicht so, wie mancher sie gerne hätte, nämlich als xte Wiederholung von bereits zur Genüge Vorhandenem) – ich gebe meine Hoffnung nicht auf daß sie ihren Platz in unserer Literatur finden, und ich werde weiterhin meine Kraft anstrengen, daß dies geschehe.
(Franz Fühmann)
„Die Anthologie von den jungen Leuten
lässt mich nicht mehr schlafen“103
– Der Mentor Franz Fühmann. –
Franz Fühmann war dafür bekannt, sich für die Sorgen, Probleme und Ängste seiner Zunft, ganz besonders der Nachwuchsschriftsteller einzusetzen. Dieses Engagement stieß bei der SED-Kulturbürokratie, an vorderster Stelle bei dem für Kulturfragen zuständigen ZK-Sekretär Kurt Hager auf tiefstes Unverständnis.
Hager habe ihm nur immer wieder vorgehalten, dass er nicht verstünde, warum die Schriftsteller so kleine Seelen seien, dass sie ihre kleinen Problemchen über das große Ganze stellen und was nützt es dem Sozialismus, wenn da jeder schreiben könne, dass er ein Unbehagen spüre.104
Als sich aber im Herbst 1978 sogar das Präsidium des DDR-Schriftstellerverbandes kritisch mit der Situation der Nachwuchsschriftsteller auseinandersetzte,105 kam die Kulturabteilung des Zentralkomitees der SED nicht mehr umhin, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Zunächst wurde eine Arbeitsgruppe von der Kulturabteilung eingesetzt, die sich mit den „Problemen und Aufgaben des Literaturinstitutes“ in Leipzig befasste. Als sich dann auch noch im Heft 3/1979 der Zeitschrift Sinn und Form und der Nummer 7/1979 der Weimarer Beiträge junge Autoren in einer für die Kulturadministration bedenklichen Weise zu Wort gemeldet hatten, wurde unter anderem die Leitung der Akademie der Künste von der Kulturabteilung des ZK aufgefordert, zu diesen Veröffentlichungen Stellung zu nehmen. Es „wurde die Frage aufgeworfen, ob derartige abweichende und falsche Positionen repräsentativ für die Gesamtheit der jungen Künstler seien“. Man sei davon ausgegangen, dass hier „ein Symptom (…) für einige sehr ernst zu nehmende Schwächen und Probleme in der Entwicklung der Literatur gerade der jungen Generation“ läge, führte das Akademiepräsidium in seiner Stellungnahme aus. Ferner stellte es fest, dass „die belletristischen Publikationen von Uwe Saeger, Uwe Kolbe, Monika Heimecke und anderen eine Entsprechung finden in den theoretischen Äußerungen junger Autoren in den Weimarer Beiträgen, und dass hier wie dort Grundpositionen in der parteilichen Rolle der Künste in der sozialistischen Gesellschaft infrage gestellt werden.“106
In diesem Zusammenhang beschäftigte sich die Sektion Literatur und Sprachpflege der Akademie der Künste auch mit Nachwuchsfragen. Beispielsweise bat sie ihr Mitglied Max Walter Schulz in seiner Funktion als Direktor des Leipziger Literaturinstituts Johannes R. Becher, über die beabsichtigten Änderungen des Lehrplankonzeptes seiner Einrichtung zu berichten. Welche Brisanz inzwischen der amtierende Sektionssekretär Dieter Noll der Nachwuchsproblematik beimaß, geht aus einem Brief an Max Walter Schulz hervor.
Dabei wäre zu beachten, dass sich neben den institutionalisierten Formen, den Nachwuchs zu entwickeln, immer spürbarer eine Förderung junger Autoren durch Verlagskollektive oder auch durch das Patronat einzelner älterer Schriftsteller bemerkbar macht, die sozusagen ,außer Kontrolle‘ vor sich geht und in den verschiedensten Publikationen sowohl gute als auch mitunter problematische Resultate zeitigt. (Bei diesem) Trend junger Autoren, sich der organisierten Förderung zu entziehen, um auf eigene Faust Zugang zur literarischen Szene zu suchen, (handele es sich um eine) gesellschaftlich sehr wesentliche Erscheinung, die wir nicht länger unbeachtet lassen sollten.107
In dieser Konstellation führte der Präsident der Akademie der Künste, der Filmregisseur Konrad Wolf, im Auftrag seiner Partei mehrere Gespräche mit dem Akademiemitglied Franz Fühmann. In diesen Gesprächen trug Fühmann seinem Präsidenten auch die Sorgen und Nöte jener begabten Schriftsteller der jungen und mittleren Generation vor, „deren Arbeiten bei uns, aus Mangel an geeigneten Publikationsorganen, auf Veröffentlichungsschwierigkeiten stießen“.108 Wolf, der sich einerseits nicht nachsagen lassen wollte, dass er nur ein Herz für den Filmnachwuchs hätte, und andererseits darauf bedacht sein musste, den Akademiekollegen Fühmann möglichst in überschaubarer Arbeit zu halten, machte schließlich den Vorschlag, ein Arbeitsheft der Akademie109 zu nutzen, um besagten Autorenkreis, welchen er nicht kannte, einmal vorzustellen. Die Idee einer Anthologie war geboren.110 Nachdem der Präsident Franz Fühmann für das Anthologieprojekt grünes Licht gegeben hatte, beauftragte der in der zweiten Jahreshälfte 1980 offiziell zwei ihm bekannte junge Schriftsteller mit der Textsammlung. Für diese Aufgabe bezahlte er sie aus seiner Privatschatulle. Bei den beiden jungen Lyrikern aus der alternativen Dichterszene handelte es sich mit dem aus Ostberlin stammenden Uwe Kolbe111 und dem aus Dresden kommenden Sascha Anderson112 um zwei „außergewöhnlich begabte Vertreter der jungen Generation, die aber in ihrer Poetologie und Praxis des Schaffens diametral entgegengesetzt“ waren.113 Mit seiner Wahl hatte Franz Fühmann nicht nur zwei junge Männer für ein Gemeinschaftsprojekt zusammengeführt, die in ihren ästhetischen Auffassungen wie auch in ihren Biografien sich stark voneinander unterschieden, mit Sascha Anderson war außerdem auch der IMB114 „David Menzer“ und damit zumindest potenziell die Staatssicherheit von Anfang an in das Projekt involviert. Offensichtlich hatte Sascha Anderson aber zunächst einmal nur ein starkes literarisches Eigeninteresse,115Spiele, Leipzig 1993, S. 214ff. sich an der Entstehung und Verbreitung der geplanten Anthologie zu beteiligen. In den vollständig rekonstruierten MfS-Akten von „David Menzer“ befindet sich kein Auftrag, im Herbst 1980 Verbindung zu Franz Fühmann aufzunehmen beziehungsweise im Sinne des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) gezielt an der Anthologie mitzuarbeiten.116 Welche Auswirkungen das Spannungsfeld von dichterischem Eigensinn und Zusammenarbeit mit dem MfS in der Person Sascha Andersons auf den Fortgang der Anthologie hatte, sollte sich bald zeigen.
Ziel des Anthologieprojektes sollte es nach Franz Fühmanns Auffassung sein, sich „einen Überblick über die tatsächlich vorhandenen Kräfte der Generation von etwa 1940 bis 1958“ zu verschaffen. Auswahlkriterien waren die literarische Qualität sowie der Umstand, in der DDR bislang gar nicht oder wenig publiziert worden zu sein. Außerdem sollte die Akzeptanz der Arbeiten in der eigenen Generation gewährleistet werden. Da sich der Dichter Franz Fühmann über die literarische Qualität der Beiträge keineswegs sicher war – seine Poesieauffassung war eher traditionell –, legte er die Auswahl der Texte ganz in die Hände der beiden jungen Kollegen. Noch 25 Jahre später erinnert sich Uwe Kolbe daran, dass Fühmann die Verantwortung der Bewertung der Texte an Sascha Anderson und ihn mit den Worten „das wisst ihr besser“117 delegiert hatte. Fühmann ging es von Anfang an nicht um eine Repräsentation der Jungen Literatur der DDR, sondern um eine „Übersicht über die bislang gar nicht oder zu wenig Publizierten“.118 Von Fühmann autorisiert, gingen Kolbe und Anderson mit Elan ans Werk, wobei Letzterer von Beginn an der Aktivere war. Gezielt warben sie in Fühmanns Namen junge Autoren und betonten stets, dass diese Texte in einem Arbeitsheft der Akademie und damit ganz legal publiziert werden sollten.
Uns war also aller Arg genommen.119
Unter diesen Voraussetzungen spürten Kolbe und Anderson Texte aus allen Regionen des kleinen Landes auf. Erst im Mai 1981, die Textsammlung war bereits weit vorangeschritten, berichtete „David Menzer“ das erste Mal dem MfS von diesem Projekt. Der Bericht erregte jedoch bei seinem Führungsoffizier keinerlei sichtbares Interesse.
Das vorläufige Manuskript stellten Uwe Kolbe und Sascha Anderson im Sommer 1981 auf dem Grundstück der Lyrikerin Elke Erb zusammen.120 Neben Texten der beiden Herausgeber fanden Arbeiten von Jochen Berg, Peter Brasch, Stefan Döring, Dieter Eue, Thomas Günther, Eberhard Häfner, Wolfgang Hegewald, Wolfgang Hilbig, Katja Lange, Leonhard Lorek, Monika Maron, Sabine Matthes, Uta Mauersberger, Christa Moog, Gert Neumann, Detlef Opitz, Bert Papenfuß, Lutz Rathenow, Andreas Röhler, Michael Rom, Rüdiger Rosenthal, Dieter Schulze, Sabine Strohschneider, Bernhard Theilmann, Lothar Trolle, Bettina Wegner, Erhard Weinholz und Michael Wüstefeld Aufnahme in die beabsichtigte Anthologie. Damit waren Autoren versammelt, die völlig verschiedene ästhetische Konzepte verfolgten und sich auch untereinander kaum kannten.
Als Franz Fühmann diese Materialsammlung las, hat es ihm den Atem verschlagen: „Zum ersten Mal sehe ich wirklich die junge Generation in der Dichtung hier ausgebreitet. (…) Dieses Material wird uns vor große Schwierigkeiten stellen, aber wir sollten sie angehen“, schrieb er Anfang Juli 1981 an den Sekretär der Sektion Dichtkunst und Sprachpflege der Akademie, den Schriftsteller und Drehbuchautor Günther Rücker. Mit jenem Brief informierte er zugleich offiziell seinen Sektionssekretär über den Stand des von Präsident Konrad Wolf und ihm angeregten Vorhabens. Weiterhin fragte er bei Rücker an, ob er in diese „sehr unbequeme Arbeit“121 mit einsteigen wolle. Selbstverständlich konnte Fühmann nicht ahnen, dass er sich damit einen zweiten IM der Staatssicherheit ins Boot holte.
Postwendend erhielt Fühmann von Günther Rücker eine schriftliche Antwort. Der sagte zwar nicht von vornherein Nein, führte aber zugleich diverse Bedenken ins Feld. Seiner Meinung nach sei zunächst einmal das feinfühlige Gespräch mit den jungen Leuten wichtig.
Wie das mit dem Druck wird, ist eine andere Sache. Vielleicht drucken wir die Gedichte (sic!) wie sie ausgewählt vorliegen, vielleicht aber wäre es besser, die Gedichte und die Gespräche zu drucken, die wir mit den jungen Leuten endlich einmal führen. (…) Wir müssen es klug anstellen, und wir müssen unseren Standpunkt dazu zugleich dokumentieren. Versteh mich recht: nicht um zu sagen, die Jungen haben Unrecht oder sie sehen die Welt nicht richtig, sondern um die Richtung zu zeigen, in der wir wünschen, dass solche Veröffentlichungen verstanden werden sollen.122
Das klang sehr nach Verzögerungstaktik. Fühmann wollte Rückers Antwort aber positiv verstehen123 und teilte ihm im gleichen Atemzug mit, dass er den beiden Herausgebern den Vorschlag unterbreitet habe, eine Auswahl vorzubereiten und die Sache nicht weiter publik zu machen. Uwe Kolbe und Sascha Anderson würden das auch vollkommen einsehen, schrieb er Ende Juli an Rücker. Der antwortete umgehend und sah sogleich am Horizont neue Schwierigkeiten aufziehen, gab sich aber offiziell kämpferisch entschlossen. Scheinbar hilfreich und arglos zugleich teilte er Fühmann mit, dass die Texte in der Akademie vervielfältigt werden könnten. Außerdem riet Rücker dem Akademiekollegen Fühmann, eine Notiz an den Akademiepräsidenten Konrad Wolf zu schicken, „weil der ja Initiator sei“.124 Franz Fühmann griff diesen Vorschlag umgehend auf. Er verfasste einen formlosen Brief, adressierte ihn „An den Chef der Akademie“ und teilte ihm mit, dass er mit den beiden jungen Dichtern Kolbe und Anderson ein umfangreiches Material gesichtet habe.
Es ist aufregend, in jeder Hinsicht, auch in der, die Schwierigkeiten bringt.
Fühmann setzte Wolf auch über den vereinbarten Beratungstermin (15. September) mit Sektionssekretär Rücker und den beiden Herausgebern in Kenntnis und warb um Wolfs Anwesenheit bei diesem Gespräch.
Es wäre natürlich sehr nützlich & schön & nützlich, wenn Sie mit reinschauen könnten, wenigstens so auf 1 Sprung.125
Kaum hatte Günther Rücker die Textsammlung in der Hand, begann er auch schon damit, das Projekt im Auftrag der Berliner Hauptabteilung (HA) XX/7 des MfS mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu hintertreiben. Für diese Aufgabe hatte Rücker ein zusätzliches persönliches Motiv. Aus einer MfS-Quelle ist zu erfahren, dass er die Textsammlung „auch als persönlichen Angriff gegen sich selbst empfindet“.126 Als IM „Günther“ teilte er seinem Führungsoffizier mit, dass 80 Prozent der Manuskripte eindeutig feindlich seien und „eine verhärtete feindlich-politisch-ideologische Grundhaltung zur DDR“ erkennen lassen. Er zog daraus den Schluss, dass von vornherein keinerlei Grundlagen für Gespräche mit den Autoren vorhanden seien. Außerdem hielt „Günther“ – im Gegensatz zu Fühmann – „fast alle Beiträge (für) literarisch minderwertig“. Bereits vor dem geplanten Treffen Rückers mit Fühmann und den beiden Herausgebern hatte die HA XX/7 festgelegt, dass von der Akademie durch ihren Sekretär der Sektion Literatur und Sprachpflege höchst offiziell diese Texte zurückgewiesen werden, „da sie keine Literatur darstellen und unserer sozialistischen Gesellschaft wesensfremd sind“. Außerdem geht aus der MfS-Information vom 11. September 1981 hervor, dass der IM in seiner offiziellen Funktion als Sektionssekretär dem „Genossen Wolf nahelegen“ wird, mit Fühmann eine Aussprache zu führen, „in deren Verlauf Fühmann offen gesagt werden sollte, dass die Akademie der Künste der DDR von ihren Mitgliedern mehr politisches Gespür und Engagement für unsere sozialistische Gesellschaft erwartet“.127
Ursprünglich hatte Präsident Wolf im Auftrag seiner Partei das Gespräch mit Franz Fühmann gesucht. Inzwischen hatten diese vertraulichen Gespräche eine Dynamik erreicht, die den Genossen Wolf nun selbst zu überrollen drohte. Schließlich sollte er jetzt wieder etwas richten helfen, was er unter Einsatz seiner ganzen Persönlichkeit mit eingefädelt hatte.128
Mit der Entstehung der Anthologie war eine Entwicklung in Gang gekommen, die ein ganzes Bündel von Schwachstellen im Kulturbereich zutage treten ließ. Die in der Anthologie vertretenen Autoren waren in keine Struktur des offiziellen Literaturbetriebs, wie etwa den Schriftstellerverband, einen Zirkel Schreibender Arbeiter oder die FDJ-Poetenbewegung eingebunden. Dementsprechend waren sie auch den Verlagen beziehungsweise den Kulturfunktionären und ihren Apparaten nicht bekannt. Aus diesem Grund bot zumindest die Staatssicherheit als einziger staatlicher Apparat die Perspektive, sich mittels seiner operativen Möglichkeiten einen Überblick über diese neue Literaturentwicklung zu verschaffen. Zusammen mit der Angst, nach der Biermann-Affäre erneut von Schriftstellern überrascht zu werden, wird erklärlich, warum dieser Autorenkreis von Anfang an als Sicherheitsproblem eingestuft und vom MfS als „Politischer Untergrund“ (PUT) qualifiziert wurde.129
Am 15. September 1981 fand in der Akademie die erste und zugleich letzte Begegnung zwischen Günther Rücker auf der einen Seite und Franz Fühmann mit den beiden Herausgebern auf der anderen Seite statt. Nach Aktenlage hatte Anderson („David Menzer“) seinen Führungsoffizier über den bevorstehenden Gesprächstermin nicht vorab informiert. Das mag mit ein Grund dafür gewesen sein, warum bis zu diesem Zeitpunkt in dieser Angelegenheit auf der Linie XX des MfS keine Abstimmung zwischen der HA XX/7, von der Rücker geführt wurde, und der Abteilung XX/7 der MfS Bezirksverwaltung Dresden, von der Anderson angeleitet wurde, stattgefunden hatte.
Der Sektionssekretär Rücker diskriminierte von vornherein Kolbe und Anderson. Er wollte sich mit den beiden Herausgebern, die „in einem dreckigen, Ekel erregenden, richtiggehend verwahrlosten Zustand zum Gespräch erschienen“130 seien, nicht lange aufhalten. Mit wenigen Worten machte er deutlich, dass das vorliegende Manuskript keinerlei Chancen habe, in der DDR veröffentlicht zu werden, weil es generell gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR gerichtet sei. Für ihn sei die Arbeit an der Anthologie beendet. Für die Textsammlung habe es nie ein Mandat der Akademie der Künste gegeben. Würde die Arbeit nicht eingestellt, kämen die Autoren der Sammlung in den Verdacht einer feindlich-negativen Gruppenbildung, verkündete der Sektionssekretär ohne Umschweife. Damit unternahm Rücker von Anfang an den Versuch, dieses offizielle Projekt zu kriminalisieren.
Franz Fühmann wollte sich jedoch nicht so leicht geschlagen geben. Er unterbreitete den Vorschlag, wenigstens einige dieser Texte in einer „Stunde der Akademie“131 vorzustellen. Er halte es für lebensnotwendig, dass Nachwuchsautoren „bei uns“ ins Gespräch kommen, weil dies „Ausdruck einer Lebenshaltung im Sozialismus ist“. Sie „würden hier ersticken, wenn sie in der DDR kein Echo finden“.132 Dieser Ansicht widersprach Rücker ganz entschieden.
Die beiden Herausgeber beschränkten sich darauf, Rückers generelle Einwände zurückzuweisen. Uwe Kolbe erinnert sich, dass Rücker nur eine einzige Frage an sie gerichtet habe, „ob wir uns als Gruppe verstünden“. Sie hätten darauf geantwortet, dass sie sich nicht als Gruppe verstünden, sie seien aber nicht gewillt, auch „nur irgendeinen Autor aus dieser Sammlung herauszulösen“.133
Sektionssekretär Rücker beendete das Gespräch mit der Mitteilung, dass er den Akademiepräsidenten Konrad Wolf von der Unterredung in Kenntnis setzen werde. Der Präsident habe die endgültige Entscheidung zu treffen.
„Günthers“ Stasibericht ist zu entnehmen, dass er Wolf vorschlagen wolle, sowohl die Veröffentlichung der Anthologie zu verhindern als auch die von Fühmann beabsichtigte Vorstellung von einigen Autoren dieser Anthologie in einer Stunde der Akademie „zu unterbinden“.134 „Günthers“ Bericht ging zur weiteren Verwendung auch an die Kulturabteilung des ZK der SED.
Es spricht einiges dafür, dass zu diesem Zeitpunkt nicht nur das Aus der Anthologie, sondern auch die Linie für das weitere Vorgehen gegenüber den beteiligten Autoren in der MfS HA XX/7 bereits durchgespielt worden war. Der zweite IM, Sascha Anderson alias „David Menzer“, berichtete seinem Führungsoffizier in Dresden zum ersten Mal am 16.135 und dann noch ein zweites Mal am 21. September ausführlich über die Zusammenkunft mit Rücker, Fühmann und Kolbe in der Akademie wie auch den Werdegang der Anthologie und ihr mögliches weiteres Schicksal. Daraufhin versorgte die „David Menzer“ führende Abteilung XX/7 in Dresden ihrerseits erstmalig am 21. September die HA XX in Berlin mit schriftlichen Informationen in Sachen Anthologie. Erst auf der Grundlage dieses Materials gab der Leiter der HA XX, Kienberg, die zentrale Verhaltenslinie für den IMB „David Menzer“ der Abteilung XX/7 der BV Dresden vor.136
An beiden Berichten von „David Menzer“ fällt auf, dass er sowohl die politische Brisanz des Projektes als auch die ihrer Texte herunterzuspielen versuchte. Eine politische Verurteilung und damit zugleich generelle Infragestellung des Projektes findet bei „David Menzer“ nicht statt.
Günther Rücker hatte das Arbeitsheft gelesen, und mein Eindruck war, dass er völlig verständnislos der Literatur, die er gelesen hat, gegenüberstand. Seine Maßstäbe sind da weniger politisch als künstlerisch. Er hat da einfach keine künstlerischen Maßstäbe in Richtung dieser Literatur.137
Aus seinem zweiten Bericht zum „Arbeitsheft der Akademie der Künste“ ist zwar zu erfahren, dass Günther Rücker sich gegen diese Publikation ausgesprochen habe, seine Argumente werden jedoch nicht genannt. „David Menzer“ kann sich in diesem Bericht aber nicht mehr vorstellen, dass Konrad Wolf noch einem Arbeitsheft mit den zusammengestellten Texten zustimmen werde, da das Projekt in der Sektion Literatur mit großer Wahrscheinlichkeit auf massive Ablehnung zu stoßen drohe. Insgesamt spielte „David Menzer“ mehrere Varianten durch, wie und in welcher Form die vorliegende Textsammlung verbreitet werden könnte. Dabei hielt er es für sehr wahrscheinlich, dass Franz Fühmann die Gelegenheit nutzen werde, innerhalb einer „Stunde der Akademie“ zumindest einen Teil der Texte vorzustellen. In seinem Bericht heißt es weiter:
Prinzipiell haben sich Fühmann, Kolbe und Anderson geeinigt, dass die Anthologie, solange hier Möglichkeiten bestehen für diese Sammlung, nicht an Verlage oder andere institutionsgebundene Personen in der BRD gegeben wird. Es wäre jetzt einfach die Aufgabe, mit allen Mitteln zu versuchen, hier wenigstens irgendwas draus zu machen, damit diese letzte Alternative überhaupt nicht ins Gespräch kommt.138
Unverkennbar hatte Sascha Anderson alias „David Menzer“ ein starkes Eigeninteresse daran, dass die Manuskriptsammlung von der Akademie als abgeschlossene Arbeit angenommen und von ihr entsprechend honoriert wird. Des Weiteren schlug er vor, in der Sektion Literatur ein Gespräch über die vorliegenden Texte zu organisieren. Damit könnte die Anthologie zumindest eine Zeit lang einer größeren Öffentlichkeit vorenthalten werden, argumentierte „David Menzer“. Abschließend kündigte er an, sich in nächster Zeit mit den an der Anthologie beteiligten Literaten in einer Analyse zur aktuellen Situation der jungen Schriftsteller in der DDR zu beschäftigen.
Sofort nach dem Treffen mit den beiden Herausgebern und seinem Kollegen Rücker schrieb Fühmann an Konrad Wolf:
Bitte lesen Sie das Manuskript, es hängt sehr viel daran, an Hoffnungen, an Erwartungen, vielleicht eine letzte Möglichkeit. Bitte.139
In der Kulturabteilung des ZK, dem Ministerium für Kultur und dem MfS begannen längst die Alarmglocken zu schrillen. Öffentliches Aufsehen galt es unter allen Umständen zu vermeiden. Das außenpolitische Ansehen der DDR durfte auf keinen Fall erneut aufs Spiel gesetzt werden wie im Falle der Biermann-Ausweisung, den Ausschlüssen von Autoren aus dem Schriftstellerverband im Jahre 1979 und dem Massenexodus von Schriftstellern.
Das MfS, durch seine „Quellen“ gut informiert, aber erst nach erheblichen Anlaufschwierigkeiten gut vernetzt, leitete als erste Institution weitere Maßnahmen ein. Sie sind in einem Operativplan der HA XX vom 1. Oktober 1980 detailliert festgehalten. Grundsätzlich ging es der Staatssicherheit darum, mögliche weitere Aktivitäten der an der Anthologie beteiligten Autoren „offensiv zurückzudrängen und vorbeugend zu verhindern, um die Herausbildung eines fest gefügten feindlichen Blockes und oppositioneller Gruppierungen zu verhindern“. Angestrebt wurde ein „Differenzierungsprozess unter den Beteiligten mit politisch-operativen Mitteln und Möglichkeiten, einschließlich des Zusammenwirkens mit der Partei, staatlichen Organen und gesellschaftlichen Kräften offensiv durchzusetzen“.
Um die beabsichtigten Ziele zu erreichen, wurde eine Koordinierung aller Maßnahmen mit den Abteilungen XX mehrerer Bezirksverwaltungen vorgeschlagen. In dem mehrstufigen Programm ging es, Franz Fühmann betreffend, darum:
1. aufzuklären, ob er das Anthologieprojekt „als bewusst gewollte feindliche Handlung gegen die DDR inspiriert hat, wen er in die Organisierung der Anthologie einbezogen und beauftragt hat und welchen politisch-ideologischen Einfluss er auf die Beteiligten genommen hat“.
2. Durch den Staatssekretär im MfK Löffler und den Akademiepräsidenten Konrad Wolf soll „in geeigneter Weise staatlicher und gesellschaftlicher Einfluss auf Fühmann“ genommen werden.
3. Die IM „Günther“ und „Hans“140 erhalten den Auftrag, Fühmanns Reaktionen auf „die Unterbindung der Veröffentlichung der Anthologie festzustellen“ und möglicherweise ähnliche Vorhaben Fühmanns „unter Nutzung ihrer Schlüsselpositionen zu unterbinden“.141
Da bei dem Herausgeber Uwe Kolbe die Aussprache zum Anthologieprojekt nicht zu der gewünschten Einsicht geführt hatte, wurde am 25. September 1981 gegen ihn von der Staatssicherheit die Operative Personenkontrolle (OPK) „Poet“ eingeleitet und die ursprünglich bereits erteilte Genehmigung für eine vierwöchige Studienreise nach Tübingen wieder zurückgenommen.142 Der IMB „David Menzer“ sollte die vermeintlichen Hintermänner der Anthologie beweiskräftig feststellen, weitere Vorhaben unterbinden helfen und den „Differenzierungsprozess unter den Beteiligten“143 nach Kräften unterstützen, vermerkte noch einmal zusammenfassend der genannte Operativplan vom 1. Oktober.
In einem gesonderten Punkt schlug die HA XX vor, dass die Leitungen des Ministeriums für Kultur, der Akademie der Künste, des Schriftstellerverbandes und anderer künstlerischer Berufsverbände von der SED veranlasst werden sollten, „ihre Aktivitäten zur Auswahl und Förderung von Nachwuchsschriftstellern und Künstlern unter Zugrundelegung vorbildlicher staatsbürgerlicher Verhaltensweisen weiter zu qualifizieren“.144
Zusätzlich versorgte das MfS die SED und die zuständigen staatlichen Organe mit einer sogenannten Einschätzung der Anthologie. Dabei wurden wider besseres Wissen abstruse Zusammenhänge konstruiert:
Die Anthologie stellt den Versuch dar, die neuen Erfahrungen, die die internationale Konterrevolution in Polen sammelt, ideologisch auf die DDR anzuwenden. Das geschieht zum Teil überstürzt und zum Teil mit kümmerlichen literarischen Mitteln. Deutlich ist jedoch die lenkende Hand der imperialistischen Diversionszentralen zu spüren, denn in dem scheinbaren Wirrwarr, der lockeren, alphabetischen Folge der Autoren ist ein durchdachtes konterrevolutionäres Programm enthalten.145
Nach diesem Papier sah sich die Kulturabteilung des ZK unter Handlungsdruck. Am 4. November 1981 wurde das Thema Anthologie in ihren Monatsbericht aufgenommen, der sich ausführlich mit den „Fragen des künstlerischen Nachwuchses“ beschäftigte.146
Am 11. November 1981 befasste sich das Sekretariat des ZK auf seiner regulären Wochensitzung mit dem Problem Akademieanthologie. Es wurde eine „Konzeption zur Arbeit mit jungen Schreibenden und anderen am Schreiben interessierten Bürgern“147 verabschiedet, in deren Folge in allen Bezirken der Republik Literaturzentren entstehen sollten. In einem weiteren Tagungsordnungspunkt wurde im Beisein der Leiterin der Kulturabteilung des ZK und des Ministers für Kultur über das geplante Arbeitsheft der Akademie – „einer Art Anthologie“ – beraten. Das Sekretariat des ZK folgte dabei im Wesentlichen den Empfehlungen der HA XX. Infolgedessen wurde weder die Genehmigung für die Veröffentlichung der Anthologie noch eine Zustimmung zu einer Veranstaltung mit den beteiligten Autoren in der Akademie der Künste („Stunde der Akademie“) gegeben. Ferner erhielt der Akademiepräsident Konrad Wolf einen weiteren Parteiauftrag.
In einem bis zum 15. November 1981 zu führenden Gespräch (ist) Franz Fühmann deutlich zu machen, dass in den Texten jener Autoren, für die er sich einsetzt, politisch-ideologische Positionen vertreten werden, die mit den Zielen und Aufgaben der Akademie der Künste nicht zu vereinbaren sind. Dabei ist F. Fühmann bewusst zu machen, dass er mit seiner Haltung und seinen Aktivitäten an Grenzen stößt, die mit seiner Verantwortung als Akademiemitglied nicht im Einklang stehen.148
Für die Partei unterlief das Anthologieprojekt ganz eindeutig das Prinzip der staatlichen Allmacht und damit zugleich des kulturpolitischen Hoheitsanspruchs von Partei und Regierung. Mit den eingeleiteten beziehungsweise angekündigten Maßnahmen, wie der Gründung von Literaturzentren, einem Differenzierungsprozess unter den beteiligten Autoren149 und einem zukünftigen koordinierten Vorgehen der verantwortlichen Genossen in zahlreichen staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen,150 sollte unter der Anleitung der Kulturabteilung des ZK die Lufthoheit in der Literaturszene wieder zurückgewonnen werden. Die ZK-Vorlage wies, wie das nahezu textidentische MfS-Papier, Fühmann als den Hauptschuldigen der Anthologieidee aus.151
Franz Fühmann selbst, der weder um die Beschlüsse der Partei noch die Maßnahmen des MfS wusste, hatte sich im Oktober erneut an Konrad Wolf gewandt. Er wolle ihn ja nicht bedrängen, doch „die Anthologie von den jungen Leuten lässt mich nicht mehr schlafen“. Er unterbreitete Wolf den Vorschlag, eine „Stunde der Akademie“ mit den Texten der jungen Leute zu veranstalten, und bat den Präsidenten in dieser Sache um seine Meinung.
Weiter schrieb er:
Lieber Konrad Wolf, es schaut bös aus. Große junge Talente, um die ich gerungen habe, dass sie hier publizieren (klingt so pathetisch, ist aber so) drohen jetzt völlig vor den Kopf gedroschen zu werden, schon genehmigte Manuskripte werden wieder inhibiert, schon genehmigte Reisen wieder – und zwar unter scheußlichen Begleitumständen – abgedreht.152 Bitte sagen Sie nicht, die Zeiten sind ernst. Das gilt ja wohl für andere Staaten auch und ist für mich kein, aber wirklich kein Grund, den Kahlschlag à la Prag gegen den kritischen jungen Fundus zu praktizieren.
Wir müssen was tun, ich beschwöre Sie.153
Wolf versicherte Fühmann in einem kurzen handschriftlichen Antwortbrief zwar, dass er auch an einem baldigen Gespräch interessiert sei, wegen eigener Arbeiten aber erst nach dem 9. November mit ihm zusammenkommen könne.154 Zwischenzeitlich studierte Wolf aufmerksam das Anthologiematerial, wie handschriftliche Notizen aus seinem Nachlass belegen. Bei dieser Lektüre gelangte er zu einem differenzierten Urteil. Hinter jeden Autorennamen setzte Wolf ein oder gar mehrere Plus- oder Minuszeichen und ergänzte diese Bewertungen in dem einen oder anderen Fall sowohl durch negative Bemerkungen wie „ödes und dünnes Geschwafel“, „ungenießbare Ergüsse“, „Hass“, „primitiv begabt“ oder auch „amüsant“, „knappe klare Sprache“, „wenigstens noch ein Funken Witz und Geist“.155 In dem verordneten Gespräch des Präsidenten mit Franz Fühmann am 10. November 1981 fiel die offizielle Stellungnahme Wolfs weit weniger differenziert aus. Er bewertete die Texte nicht als Künstler, sondern handelte als Kulturpolitiker. Als solcher hielt er die Anthologie für nicht machbar und gab das Manuskript zurück. Seinerseits erklärte er Fühmann gegenüber die Sache für erledigt, was sie angesichts der getroffenen Parteibeschlüsse längst war. Seinen Auftrag meinte er damit erfüllt zu haben.
Franz Fühmann wollte aber noch nicht an das Ende seiner langen Bemühungen glauben. Zunächst einmal informierte er Uwe Kolbe und Sascha Anderson über den negativen Gesprächsausgang mit dem Präsidenten. Anderson berichtete daraufhin bereits am nächsten Tag gegenüber seinem Führungsoffizier über das Treffen von Fühmann mit Präsident Wolf.156
Fühmann hatte sich seinerseits bereits vor Weihnachten noch einmal persönlich an Konrad Wolf gewandt und schickte ihm „in Gestalt dieses Briefes ein Vorwort zu jener ,Anthologie junger Dichter der DDR‘“.157 Darin wehrte er sich gegen die Vorhaltung der mangelnden Obhutspflicht und vor allem gegen den Verdacht der feindlichen Gruppenbildung.
Diese Anthologie kam als der Entwurf, der sie ist, aufgrund unserer Überlegungen, als Gedanke zweier Mitglieder der Akademie der Künste, zustande.158
Zu dem schwerwiegenden Gruppenvorwurf schrieb er:
Diese Dichter bilden keine Gruppe; die Problematik ihrer Arbeiten wächst aus der unseres Lebens, das Quälende und Beunruhigende ihrer Fragen stammt von dort, aus der Realität, nicht aus irgendeinem bösen Willen, und es ist, dies Quälende, nicht durch literaturpolitische Restriktionen aus der Welt zu schaffen. (…) Die Gemeinsamkeit der in der Anthologie Vertretenen ist also ihre Existenz in der DDR, ihre Erfahrung, ihre Begabung und ihre mangelnde Gelegenheit zur Publikation. Und aus diesen Gründen dann zusammengeführt in die Anthologie.
Fühmann formulierte in dem „Vorwort“ noch einmal sein Verständnis von der Funktion der Literatur in der DDR, wenn er bezogen auf die Texte der Anthologie davon sprach, dass sie „peinigende Fragen aufwarfen, die Unangenehmes konstatieren, die der Idylle entschieden abhold, der Selbstzufriedenheit unzuträglich und dem Wunschdenken nicht förderlich waren, kurzum, die eben das leisten, was ihrem Wesen nach Funktion der Literatur auch ist, nicht ausschließlich, doch zumindest auch“.159
Franz Fühmann hielt Rückers und Wolfs Vorschlag, „einzelne Dichter herauszugreifen und die Anthologie als Anthologie aufzugeben“, für nicht akzeptabel. Seinen Brief beendete er mit der Feststellung, dass er natürlich die Möglichkeiten der Staatsmacht nicht verkenne, „Stimmen, die sie als störend oder Ärgernisse bereitend empfindet, weiter dem öffentlichen Bewusstsein unseres Landes und seines Publikums fernzuhalten, nur sehe ich dabei den Schaden einen auch nur denkbaren Nutzen weit zu übersteigen“.160 Einen Durchschlag dieses „Vorworts“ legte Franz Fühmann einem weiteren Brief an den Minister für Kultur bei. Er übernahm die volle Verantwortung für das Zustandekommen der Anthologie und erklärte sich jederzeit bereit, darüber Rechenschaft abzulegen. Außerdem teilte er dem Minister mit, dass er von seinem ursprünglichen Vorhaben, die jungen Dichter in der Akademie vorzustellen, Abstand nehme, „um weitere Missverständnisse und Verhärtungen zu vermeiden“.161
Einige Tage später informierte Fühmann die beiden Herausgeber Kolbe und Anderson über seinen Entschluss, auch in der Akademie die jungen Dichter nicht mehr vorzustellen. Er war davon überzeugt, „dass dies die einzig richtige und mögliche Form ist, diese Sache abzuschließen“. Wie ihm am Jahresende 1981 ums Herz war, wollte er den beiden nicht verhehlen. Sein Brief endet mit:
Leute, ist das alles beschissen. Händedruck.162
Durch Fühmanns „Vorwort-Brief“ sah sich Konrad Wolf genötigt, seinerseits die Dinge noch einmal grundsätzlich klarzustellen. Er behauptete jetzt plötzlich, dass in den gemeinsamen Gesprächen weder von einem so voluminösen Manuskript noch von einer derart einseitigen Repräsentation und Auswahl jemals die Rede gewesen sei. Der Präsident bestritt auch, dass „die Akademie seit geraumer Zeit die Absicht gehabt hätte, die Anthologie zu publizieren“. Abschließend heißt es bei Wolf:
Glauben Sie wirklich, lieber Franz Fühmann, dass Ihre Zurückhaltung, wenn Sie wollen – Toleranz – auf die Dauer den Autoren dieser Anthologie hilft, in unserem Land ihre ,literarische Heimat‘ zu finden?163
Anfang Januar 1982 leitete der Akademiepräsident Fühmanns Brief vom 22. Dezember 1981 an den ZK-Sekretär Hager und den Kulturminister Hoffmann weiter.164 Beide Sendungen versah er mit unterschiedlichen Begleitbriefen. An Hager berichtete der Genosse Wolf nicht nur über die geführten Gespräche mit Fühmann, er erlaubte sich auch, eine Handlungsempfehlung zu geben. Die Kenntnis von Fühmanns Auffassungen sei wichtig, „um für die nächste Zukunft zu wissen, wie mit Franz Fühmann argumentiert werden muss“, schrieb Präsident Wolf an den obersten SED Kulturfunktionär Hager. Außerdem setzte der Genosse Akademiepräsident seine Parteiführung darüber in Kenntnis, „dass Fühmann durchaus zu weiteren Gesprächen bereit ist, sich sachlichen Argumenten aufgeschlossen zeigt und keinesfalls an einer offenen Konfrontation interessiert ist. Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass er zurzeit von tiefer Skepsis und Depression erfasst ist.“ Wolf verschwieg Hager gegenüber nicht, dass Franz Fühmann ihn über „wachsende Repressionen“165 im Zusammenhang mit dem Anthologieprojekt informiert hatte.
ZK-Sekretär Hager hatte bereits Ende 1981 eine umfangreiche Weisung an den stellvertretenden Kulturminister Höpcke erteilt, wie in Zukunft mit dem Dichter Franz Fühmann verfahren werden sollte. Dabei griff Hager die vom MfS gegebenen Empfehlungen auf.166 Was das MfS mit Zersetzungsmaßnahmen zu erreichen suchte, praktizierte die SED mit einem feingestaffelten System von Privilegien und Sanktionen. Der eine bekam ein Stipendium, der andere durfte in den Westen, der nächste bekam ein Strafverfahren und so weiter.167 In puncto Anthologieprojekt, so der ZK-Sekretär, müsse „durch eine intensivere Einflussnahme auf Fühmann erreicht werden, dass er diese ,Ammen- und Mentorenrolle‘ zukünftig unterlässt“. Weiterhin verfügte das ZK der SED in der Person Hagers abgestimmte Differenzierungsmaßnahmen, um die an der Anthologie beteiligten Autoren „auseinanderzudividieren“.168
Mit der 1985 bei Kiepenheuer & Witsch in Köln erschienenen Textsammlung Berührung ist nur eine Randerscheinung fand das ursprünglich von Franz Fühmann angeregte Anthologieprojekt, wenn auch an einem anderen Ort und mit teilweise anderen Autoren, doch noch seinen Weg in den öffentlichen Literaturbetrieb.169 Fühmann erlebte dies nicht mehr.
Matthias Braun, aus TEXT+KRITIK: Franz Fühmann – Heft 202/203, edition text + kritik, April 2014
„Ankunft ist nur eine Randerscheinung?“
Als ich das Motto der Konferenz las, winkte mir im ersten Moment das Fragezeichen scheinbar auffordernd entgegen, es als Henkel zum Wegwerfen einer schlechten Metapher zu begreifen. Dazu möchte ich gleich einlenken, daß ich den Anthologietitel Berührung ist nur eine Randerscheinung immer schon als etwas fragwürdig empfunden hatte. Seine Anmutung von ebenso radikaler wie flüchtiger Eleganz beim Erfassen des Wesentlichen war mir zwar nie direkt unsympathisch gewesen. Doch sein aufgeklärt tuender Gestus stand mir immer etwas zu deutlich im Widerspruch zu dem semantischen Kurzschluß, dem er seine Entstehung zu verdanken hatte. Es schien ihm nicht zu genügen, daß er auf clevere Art oberflächlich war. Er wollte durchaus auch maßgeblich sein. Seither ist nicht selten erwähnt worden, daß in dieser Anthologie sich damals vor etwa 15 Jahren eine für die Ästhetik des sozialistischen Ankunftsgedankens völlig verlorene Generation zu Wort gemeldet habe. Was jene Generation mit ihrer Verlorenheit anzustellen gedachte, läßt sich, mit ratsamer Zurückhaltung, vielleicht als eine Art von illegalem Wirklichkeitsgewinnspiel beschreiben. Oder als einen spekulativen Versuch, sich in Differenzen zu bewegen, die einem der Anspruch auf die Sprache als Spiegel der Realität schuldig geblieben war. Lakonisch gesagt, waren es eben lyrische Experimente im Zwielicht des untergehenden Zentralismus.
Da es bekanntlich in ihren einstigen Wortspielhöllen keinen einzigen verdammten Personalschatten gab, der nicht vom Stasi bezeichnet worden wäre, ist es wohl kaum noch möglich, die alte Leier von der unabhängigen Literaturszene beim erneuten Einstimmen auf ihre spezielle Untergrundtonart nicht übers Knie zu brechen.
Anthologien als solche nun waren in den teils sprachlosen, teils vergrübelten und teils vom lustigen Dämon der Wortwörtlichkeit besessenen 80er Jahren immer ein freudiges Ereignis, wenn man als sogenannter selber Schreibender – drin war. Blieb man, mit oder ohne Einreichung eines eigenen Beitrags, draußen, fühlte man sich davon eher unangenehm unberührt. Ich selber fühlte mich allerdings auch von Anthologien und Zeitschriften unangenehm berührt, in denen ich vertreten war. Das lag an Versagensängsten und Unwirklichkeitsgefühlen, die ich in der Zwangsvorstellung eines nur innerhalb des Lyrikmediums erbringbar erscheinenden Existenzbeweises auf meine ersten Veröffentlichungen delegierte. Jeder eigene Beitrag hatte etwas von einem Begräbnis bei lebendigem Leibe. Schon in den lesefrohen Jahren vor meinen ersten Eigenveröffentlichungen empfand ich die sogenannte Dimension des Autors als eine Art von bibliothekarischem Jenseits, das, vom gegenwartsverfallenen Standpunkt eines selber Schreibenden aus gesehen, längst überfüllt war. Ich ehrte die Abgötter der Weltliteratur, indem ich sie verschlang und infizierte mich an ihrer Lektüre regelmäßig mit dem Virus des Unsterblichkeitsgedankens. Dieser Gedanke war insofern ein fragwürdiger Luxus, als ich ohnehin zu jung war, um an den Tod zu glauben. Meine Gesichtshaut bildete mit ihrer durch das Lesen erworbenen Blässe ihren obligatorischen Kontrast zu der schwarzen Romantik meiner Lieblingsbücher, und auch der Rest von uns sah nicht gerade aus wie das Leben selbst. Doch an den Tod glaubte ich so wenig, daß noch nicht einmal mir anvertraute Selbstmordabsichten eines engen Freundes den Eindruck einer endgültigen Sache auf mich machten. Die Tatsache, daß ich buchstäblich nichts unternahm, um ihn von seinen Plänen abzubringen, nahm er nach seiner unerwarteten Rückkehr ins Leben als Beweis für meine Unschuld an den Zuständen, die er schlimmer als den Tod empfunden hatte. Meine eigentliche Feigheit vor diesem Freund muß so perfekt mit meiner Billigung seines Motivs getarnt gewesen sein, daß sie nach der Rettung in das Blatt jener Treue umschlug, welcher auch der Tod nichts anhaben kann. Es war, als hätte mir das Schicksal statt einer erwarteten Traueranzeige die Garantieurkunde ewiger Freundschaft zugespielt. So begann zwischen uns eine Wahlverwandtschaft, deren einvernehmliche Chemie erst sehr viel später durch die Einwirkung von Acid und einigen voneinander abweichenden Ansprüchen auf den großen Stoff des Lebens überstimmt wurde.
Vom Prenzlauer Berg hatte ich zu jenen Zeiten nicht einmal den Namen im Gedächtnis. Berlin war mir von Gelegenheitsbesuchen her als ein entschieden zu unmäßig geratener Prüfstein erschienen für meinen mich allmählich aus der Provinz treibenden Überfluß an Anpassungsschwierigkeiten und Entwicklungswünschen. Daß ich dort gelandet und hängengeblieben bin, hat viel weniger mit einer Anhänglichkeit zur Stadt zu tun als mit dem Umstand, daß Murphys Gesetz um so gründlicher zu greifen scheint, je vollkommener einer davon überzeugt ist, auf dem für ihn einzig in Frage kommenden Weg zu sein. Und letztlich hielt ich es schon immer mit jener kosmopolitischen Stilblüte, welcher zufolge es im Grunde genommen egal ist, wo man Wurzeln schlägt, und sei es halt in einer so übernächtigen Gegend wie Prenzlauer Berg, die damals eine bedeutend höhere Dichte an Fluchtträumen aufwies als andere Orte, und wo das Ausreißen und Löcher-Hinterlassen zu einem alternativen Volkssport geworden war, der den Boden der gesellschaftlichen Gewißheiten in eine Kraterlandschaft verwandelte.
Aus den Schatten diverser kleiner Erleuchtungen beim Lesen großer Autoren gingen in den siebziger Jahren gelegentlich Gedichte unter meiner Hand hervor, die viel zu finster waren, um nicht gleich wieder in die existenzielle Dunkelheit zurückzuweisen, aus der sie mich bringen sollten. Damals nannte man so etwas: Pubertätslyrik. Dieses Wort fungierte als ein selber nicht ganz astreiner Totschlagbegriff, der auf in dem seltsamen Verdacht der Onanie stehende Gedichte angewendet wurde, um ihrem Verfasser anzudeuten, daß er sich beim Formulieren seines Anspruchs auf Glück in der Wahl der Mittel vergriffen hätte. Eine noch ganz andere Befürchtung, nämlich jene, mit einer Hinwendung zur Poesie an der falschen Adresse zu sein, ging auf meine Prägung durch ein Milieu zurück, in dem es als unmännlich galt, sich mit Literatur zu befassen.
Infolge der Mühen beim Abarbeiten dieser ersten Milieuprägung war ich später dann für das beliebte Spiel einer großartigen Unterscheidung zwischen männlicher und weiblicher Literatur nie der richtige Mann. Poesie als männlicher Imponierakt stellt mich vor wenigstens ebensoviele offenbleibende Fragen wie die Behauptungen ihrer weiblichen Alternativität. Schon früher, wenn die Frage erhoben wurde, warum es unter den dichterisch gestimmten Kräften am Prenzlauer Berg des letzten DDR-Jahrzehnts so wenige Frauen gegeben habe, fiel mir nie eine vernünftige Antwort ein. Ich bemühte mich dann immer um eine Aufzählung bestimmter Namen und räumte widerstrebend latent vorhandene männerbündnerische Züge ein, die diese Szene wohl irgendwie aufgewiesen hätte. Spätestens solche Einlassungen machten mir eine merkwürdige Undefinierbarkeit bewußt, die trotz des nachgeschobenen Avantgarde-Appeals auch von anderen Interessierten bemerkt und bemängelt wurde. Man fischte im Trüben nach einem literaturhistorisch relevant klingenden Label, um es einer Szene anzuheften, die ihrerseits – so sehr sie auch selber nicht nur Produkt einer kulturpolitischen Verdrängungstrategie gewesen sein mag – einen stillen Krieg gegen die damals so genannte Sprache der offiziellen Verlautbarungen führte. Es ging zunächst einmal um nichts weniger Paradoxes, als sich mit einer sprachlichen Totalität von einer totalitären Sprache zu befreien und hierbei vom Determinismus einer Machtideologie, die alles ausgrenzte oder einsperrte, was sich nicht positiv auf sie selbst beziehen ließ. Der jugendliche Anspruch auf eine nicht von Parteidoktrinen und Staatsgrenzen gesicherte Zukunft begründete, zumindest nach dem, was ich damals von dieser Sache begriffen zu haben glaubte, die Moral des experimentellen Aufwands – darin lag der emanzipatorische Sinn vieler vielen damals formal bedenklich und heute vielleicht naiv erscheinenden Anstrengungen. Die Welt der Sprache als eine Sphäre semantischer Schwingungs- und Kippverhältnisse wurde zum Spiegel neuer Erwartungen und Bewährungsabsichten einer Generation, die bei der Erkundung ihrer Wirklichkeit den dialektischen Zeigestock gegen das Narrenzepter der Herrschaftslosigkeit eintauschte.
Doch was den gemeinsamen Zukunftsanspruch betrifft: Den verheizte man in den synaptischen Feuern eines berauschend neuen Zeitgefühls, das wie ein heimtückisches Gas aus den Rissen der immer mehr zu utopischen Metaphern zu werden scheinenden Häuserzeilen emporstieg.
Heute erstaunt es mich, daß ich mir vor zwanzig Jahren bei dieser pseudokonspirativen Atmosphäre der Einbrüche und Wortspiele in den Ruinen der gesellschaftlichen Perspektiven den Sinn für Offenheit nicht vollkommen ausgeredet habe. Andererseits war die Innerlichkeit der siebziger Jahre ganz unfreiwillig zu einem zynischen Kommentar auf die repressive Toleranz der Staatsbürokratie geworden. Sofern der Offenheitsgedanke jener Innerlichkeit entstammte und daher den Stallgeruch ländlicher Alternativen trug, kollidierte er jetzt mit seiner Verdächtigung als Weltflucht auf Kosten des Anspruchs auf die komplette Wirklichkeit, die sich eine Verlagerung ins Idyllische gar nicht leisten könne. Viele schwankten noch in ihren Lebensvorstellungen zwischen Land und Stadt, doch schon spürte man den Nachtwind der neuen Welle, die herankam wie eine subversive Begründung des alten Spruchs „Wir sitzen doch alle in einem Boot“, und die der Vorbote einer Flut von Bildern und Begriffen war, die es aus ihren hierarchischen Befestigungen gerissen hatte. Nur die Mauer wankte noch nicht und erhob sich weiterhin über den geistigen Horizont wie eine tyrannische Klage der Geschichte gegen die Strömung ihres eigenen Verlaufs.
Vor zwanzig Jahren ging ich in den unerschütterlich vor sich hinbröckelnden Prenzlauer Berg und bewegte mich an den Rändern der Literatur (das waren hauptsächlich: Klappentexte, Dichterlesungen, feuilletonistische Gespräche) wie eine fleischgewordene Lücke innerhalb eines recht verhohlen und unterdrückt vor sich gehenden Wertewandels oder Paradigmenwechsels. Mit vorfühlenden Worten gesagt, verkörperte ich die Voraussetzung für einen Reinfall auf mich selbst. Woraus natürlich nicht ohne weiteres hervorgeht, daß ich die königliche Luftschloßruine der Lyrik, zu der es mich damals trotzdem hinzog, als einen Resonanzraum für dramatisch klingende Aufprallgeräusche angesehen hätte. Viel zuverlässiger erinnere ich mich an mein ursprüngliches Schwindelgefühl während meiner ersten Besuche bei etlichen, vom säkularen Jahrhundertwind der rastlosen Nivellierung sowie potentiellen Umwertung aller Werte besonders angegangenen Köpfen aus dem damaligen Angebot an Generations- wie Sinnesgenossen. Mit diesen war ich mir über drei Häuserecken und ein paar um das jeweils eigene bißchen Einzigartigkeit besorgte Differenzen hinweg darüber einig, daß nichts mehr so weitergehen könne wie bisher und daß der Stillstand des Lebens eine außerordentliche Stellungnahme von uns zu verlangen schien, über deren Stil sich das Schicksal der offenbar von allen guten Geistern verlassenen Landessprache würde entscheiden müssen. Wie so etliche meiner moralisch aufgebrachten und zur Lyrik greifenden Jugendfreunde hegte ich ein paar Sonderwünsche an die Dimension des Autors, die in der Zeit meiner ersten allgemeinen DDR-Literaturbesichtigungen mit stilistischen Nachempfindungen des bürgerlich humanistischen Erbes möbliert war. Mit dem mir zustehenden Kurzschlußbewußtsein der Jugend assoziierte ich Sprachpflege pauschal mit geistiger Schrebergärtnerei und schaffte die Klassiker voreilig wieder ins Antiquariat zurück. Ich wollte nicht auf einem Teppich bleiben, dessen ästhetisches Muster wie weitläufig auch immer in parteiliche Richtlinien verstrickt war. Ich wollte Sirenengesang von den surrealistischen Küsten des Unbewußten, ich wollte orphische Fischzüge im Häusermeer der sozialistischen Alltagshölle, ich wollte nicht das Einfache, das so schwer zu machen ist, sondern das Unmögliche, das der Selbstmord des Realen war. Und ich wollte auf meine Art einer subliterarischen Gemeinschaft angehören, in der das Wort des einen nicht der Ekel des anderen war.
Bekommen habe ich schließlich aber doch nur die Angst und den Prenzlauer Berg mit seinen dekonstruktivistischen Frechheiten der Verzweiflung am System. Das Feld der experimentellen Wortkunst war ja in der bisherigen DDR weitestgehend seinem Schicksal überlassen bzw. ausgeblendet worden, so daß es auf einmal den Anschein hatte, als könnte man eben von dort als ein vorzeitig Abgeschriebener oder Resignierter in die Literatur eindringen und auch insofern aus einer tiefgreifenden Verwahrlosung neue Wahrheit gewinnen, als es ja die maroden Zustände der DDR selbst waren, deren verdecktes Chaos gerade die geeignete Grundlage für den Totentanz der humanistischen Ordnungsbegriffe abzugeben schien. Ehe ich mich dessen versah, rutschte mein Engagement für das Wort auf eine semantische Ebene, die sich als ein Spielplatz für plündernde Nachzügler eines sich langsam selbst zersetzenden Systems herausstellen sollte.
Nur weil sich diese dann tatsächlich in Gang gekommene Formationenvielfalt einer ausgelassenen Schriftbewegung auf ebenso notwendiger wie ungeliebter Grundlage in eine apolitische Attitüde einkleidete, wurde sie von ihren Gegnern zuweilen als unpolitisch bezeichnet. Dies ist ein beinahe zu leicht zu entkräftendes Mißverständnis. Mit der gleichen Berechtigung könnte einer von einem anderen, der ihm zur Mittagszeit auf der Straße gute Nacht sagte, behaupten, er hätte gar nicht gegrüßt. Interessanter als die Unterstellung von sinn- und sittenloser Ungebührlichkeit wäre da immer noch die Frage nach dem Warum gewesen. Zum Beispiel: „Warum sagst du gute Nacht zu mir am hellichten Mittag, willst du eine auf die Zwölf?“ Eine befriedigende Antwort bleibt das Beispiel hier schuldig, Sie dürfte in meiner Vorstellung etwas mit dem uralten Wort von der Vollendung der Zeiten zu tun gehabt haben und müßte formal eine Mischung aus biblischem Pathos und Berliner Schnauze gewesen sein. Oder täusche ich mich mit meiner Erinnerung an diese nur unter Anstrengungen zu ignorierende Atmosphäre aus drohender Agressivität und passiver Panik in vielen Begegnungen teils drolligen, teils grauenvollen und nur selten angenehmen Charakters im Ostberlin der letzten Mauerdekade? Nein, ich bin sicher, daß der große Gott mit dem Namen „Wende“ bereits zehn Jahre vor seiner Offenbarung seit dem Herbst 1989 existiert hat, wenngleich ihn in seiner vormaligen Gestalt heute keiner erkennen würde, er selbst sich wahrscheinlich am wenigsten, Denn er war zu Beginn seiner Karriere nicht groß und überwältigend, sondern klein und unterdrückt, und seine radikalsten Anhänger wurden von den Hütern der alten Ordnung als Punks verfolgt. Und sollte es von den Zeitzeugen als unwahr empfunden werden, die kollektive Gegenwartsstimmung in den Köpfen auf den Schultern der Menschen von damals als eine eschatologische Hysterie in der Nußschale zu bezeichnen, so gab es doch ganz bestimmt das allgemeine Gefühl einer immer unheimlicher werdenden Ruhe vor dem Sturm.
Zurück zu dem ursprünglichen Schwindelgefühl aus den Tagen meiner Entdeckung der Abgründe zwischen dem, was ich mir wünschte und dem, was ich bekam. Zum Beispiel: Ich besuchte jemanden, mit dem ich über irgendein Problem sprechen wollte. Dann sah ich bei ihm ein politisch oder poetisch brisantes Buch aus dem Westen, das ich am liebsten auf der Stelle gelesen hätte. Viele solcher Westbücher waren zu rar, um sie nicht als echte Entdeckungen zu betrachten. In der Regel war für mich damals vor zwanzig und mehr Jahren die erste Gelegenheit auch die einzige, um an den indexverdächtigen Lesestoff heranzukommen. Also widmete ich mich mit Begeisterung auch faden Gesprächen, um meinen Anspruch auf eine Leihgabe nicht durch Sticheleien zu verwirken, Man muß heute vielleicht hinzufügen, daß Bücher aus dem Westen in der damaligen DDR eine Art von schwarzem Kommunikationskapital darstellten, durch dessen Anlegung ein erstaunlicher Mehrwert an stiller Beschäftigung erzielt wurde. Es konnte einem gestohlen werden, dann war das personengebundene Unternehmen Mangelware gescheitert. Manch glücklicher Besitzer saß auch darauf, wie man so sagte. Kam ich an den letzteren, so suchte ich gesprächsweise nach einer Lücke in seinem Prinzip, nicht zu verborgen. Die gastgeberische Verfügbarkeit an geistiger Mangelware war ein Kreuz, an dem sich die Marionette meiner Lesegier überredungskünstlerisch verrenkte. Von einem Gespräch, wie ich es ursprünglich gesucht hatte, konnte unter solchen Umständen, bei denen der Schatten der Mauer noch auf die unschuldigsten Tricks fiel, kaum die Rede sein. Aber zwischen dem Besitz eines seltenen Buches und seinem freien Zugang eröffneten sich noch keine Abgründe, auf die man unbedingt hätte hereinfallen müssen. Ein Westbuch war letztlich nur eine schnell verschlungene Sonderration für meinen mystischen Hunger auf das Buch an sich. Und etwelche Überzeugungsspielchen zur Erlangung dessen, was ich wirklich begehrte oder wenigstens zu begehren glaubte, hatte ich eigentlich schon satt vom bloßen Hörensagen oder Hinsehen.
Das Buch an sich wiederum war in seinem logischen Nichtzuhandensein ein allzu schwieriges Brot für das Loch in meinem kulturellen Verdauungssystem. Verwandlung tat not. Guter Rat war nicht geheuer. Denn der gesunde Menschenverstand hatte die Seiten gewechselt. Er schien zum Dank dafür, daß er mich verlassen hatte, von mir zu verlangen, daß ich ihm trauen sollte. So verrückt wollte ich dann aber doch nicht sein. Wenn das nicht zu bekommen ist, wonach man sich am meisten zu sehnen glaubt, wird man auch nicht begreifen, was es eigentlich ist. Doch wenn die Sehnsucht allzulange den Körper umkreist, in dem sie ausgebrütet wurde, dann fällt sie irgendwann über ihn her, um ihn als ein Ersatzobjekt ihrer selbst zuzurichten. Das Fleisch war dumm genug, aber zum Glück für meinen damaligen Gemütszustand verspürte es keine echte biochemische Veranlagung zum esoterischen Transmutationsexzeß. Und war man denn durch die pure Tatsache, ein blutjunger Literaturfreak zu sein, für diese Welt nicht schon stigmatisiert genug gewesen? Meine trotzdem keines gescheiteren belehrbare Sehnsucht, mich mit möglichst jeder einzelnen Faser der Existenz in einem Buch zu verarbeiten, hat mir im übrigen außer einem krummen Rücken und ein paar schmalbrüstigen Eigenveröffentlichungen keinen sichtbaren Beweis dafür liefern können, daß ihre ganze Richtung nicht nur ein spekulativer Anthropomorphismus auf der Grenze zum mutwillig Makabren war. Daher möchte ich sie (diese Sehnsucht) schlußendlich als Angehörige einer Sorte von Dämonen outen, die zwar keine Ahnung hat, was sie von mir verlangt, doch dafür umso besser zu wissen scheint, wie sie es mir einreden kann.
Und noch einen weiteren, noch kurzsichtigeren Dämon auf der Sprossenleiter meiner himmelschreiend fruchtlosen Obsessionen von früher möchte ich hier endlich einmal denunzieren dürfen. Ich weiß zwar nicht, wie der Kollege heißt, aber er hat mir in den Jahren meines Ein- und Ausgehens in unterschiedlich zu beschreibenden Literatenkreisen immer wieder die zentrale Frage einzuflüstern verstanden, woher ich denn wirklich wüßte, daß die mir gezeigten Gedichte tatsächlich von denen stammten, die sie geschrieben zu haben behaupteten? Ob ich denn auch nur ein einziges von diesen Gedichten jemals vor meinen eigenen Augen habe entstehen sehen? Erst schenkte ich dieser Einflüsterung nicht mehr Beachtung als einem feinen Nadelstich. Sie schien nur kurz die Oberfläche des Bewußtseins anzuritzen und für meine bisherigen Annahmen keine ernsten Folgen zu versprechen. Und doch muß ein Gift darin enthalten gewesen sein, das sich fortan abwechselnd lähmend und hyperaktivierend auf meinen persönlichen Umgang mit solchen unter meinen Generationsgenossen auswirkte, deren lyrische Produkte einen überzeugenden Eindruck auf mich machten. Denn in der Tat: Nie hatte ich im Laufe jener frühen Jahre auch nur ein einziges der sehr zahlreich gewesenen Gedichtblätter, die man mir unter dem von Kritikbefürchtungen leicht lädierten Siegel des Kunstvertrauens zeigte, aus dem schwarzen Walzennichts der Schreibmaschine hervorwachsen gesehen. Noch wohnte ich nicht lange in der Großstadt Ostberlin und war bereits aus meinen provinzielleren Lebzeiten in Thüringen und Sachsen einiges an ganz außerordentlichen Irritationen gewohnt, wie man sie als Erdenbürger im allgemeinen und als DDR-Bewohner im hier speziell abgesonderten schon von Kindesbeinen an erfahren konnte. Erwähnt seien davon nur die kindheitlich fixe Idee, daß man als Baby der eigentlichen Mutter geraubt und zu ganz ungeeigneten Leuten in Pflege gegeben worden wäre, und der Schreck, der einen packte, wenn man sich zum ersten Mal darüber klar wurde, daß man nie wirklich wissen könne, ob das einem im Gespräch gezeigte Vertrauen eines Menschen am Ende nicht nur die Maske eines Stasispitzels wäre. Mit der letzteren Irritation lebte ich mittlerweile zwar sehr schlecht aber trotzdem halbwegs gesellschaftsfähig. Auf dem Auge der Erkennung des Stasi in seinem Nächsten hatte ich mich sogar mehr oder weniger eigenmächtig geblendet. Nicht ohne Bedenken gegen die monströse Mäßigkeit der Metapher müßte ich sagen, daß ich es mit derselben Art von Messer getan habe, mit der ich zuvor meinen Vater aus meinen Moralvorstellungen herausschneiden mußte. Denn mein Vater war während meiner Kindheit und ersten Jugend ein hauptamtlicher Funktionär in diesem weltlichen Judasinstitut namens MfS gewesen. Er war sicher nicht der unappetitlichste Parteigenosse und zumindest insofern ein echter Leninist, als er sein Vertrauen in das menschliche Grundbedürfnis nach dem Kommunismus durch den traurigen Glauben an absolute Kontrolle ersetzte. Ich habe zu seinen Lebzeiten nicht viel von ihm gehabt, und das wenige nahm frühzeitig den Charakter der Erwartung einer Entschuldigung an, die ich in sträflicher Mißachtung der realen Machtverhältnisse von ihm für die ersten systemkräftigen Erschütterungen meines ursprünglichen Weltvertrauens verlangte. Ich weiß nicht von welcher Fee es mir in den Brutkasten gelegt worden sein mag, dieses Weltvertrauen schier vorsintflutlicher Herkunft, das ich seit meiner Kindheit wie ein anthropomorphes Fossil eines nie zum Zuge gekommenen Lebens, wIe ein Steinkind in der Brust herumschleppe. Es scheint aus einer selbstregenerierbaren Substanz zu bestehen, denn sooft es auch von den Nachrichten aus der realen Welt zerschlagen wurde und seine Bruchstücke irrläuferartig durch meine Substanzen spukten, so hat es sich in gewissen Atempausen trotzdem immer wieder als ein sich selbst zusammenlesendes Ganzes angefühlt. Es ist freilich ein altmodischer Begriff, den man sicher mit einem selbstverschuldeten Mangel an Aufgeklärtheit in Verbindung bringen könnte. Schließlich wimmelt die Gegenwart von lauter Aufgeklärten, die mit dem Hinterteil ihres Bewußtseins auf dem Grab Gottes sitzen und jede Form der Gewißheit seiner Wiederkunft ohne weiteres für Selbstverarschung halten. Ich konnte sie an mir selbst am besten beobachten, all jene Materialfetischisten des Zeitgeistes, die ihr persönliches Unglück mit Elendsnachrichten von außerhalb so weit zu relativieren verstehen, bis es anderntags wieder dem Dorn im Auge ihres Nächsten gleicht. So ein Weltvertrauen ist leider auch kein wirklich helfendes Amulett gegen das tägliche Gefühl eines Kaputtgehens an der knallharten Endformatiertheit jeder neuen Seite des Lebens, die man ohne die Hilfe eines Computers altmodischerweise aufschlagen zu können glaubt. Doch ich beschwere mich nicht. Totale Offenheit ist ein ausgestorbenes Buch auf der Welt. Die Schwierigkeiten, die ich mit dem Ausdrücken meines Weltvertrauens habe, werden vielleicht deutlicher, wenn man die Existenz mit einem Bauchredner vergleicht, der in einem Anfall von Identifizierungswahn mit sich selbst sein wichtigstes Arbeitszeug, seine sprechende Puppe, verschluckt hat. Es ist eine Frage der Konstitution, ob es einen zerreißt oder ob es sich wie durch ein Wunder schließlich doch noch in erlösende Scheiße verwandelt. (Man wird einsamer mit jedem hierzu operierenden Wort.)
Aus den linguistischen Mauerspechten des alten DDR-Systems sind im Laufe der Jahre noch seltsamere Vögel geworden. Sie tragen die Federn der Entfremdung von ihren ideologischen Rabeneltern auf den freien Meinungsmarkt und locken damit ein paar Grünschnäbel an, mit denen es das Leben auch nicht gut gemeint hat. Den humanistischen Erziehungsgedanken, dem sie seinerzeit mit knapper Not entschlüpft sind, parodieren sie mit zunehmender Unkenntlichkeit seines Ursprungs, indem sie ihre Gegner aufziehen. Manche fliegen auf die Analyse des Kapitalismus und bilden einen kleinen Flügel ganz links außen vor dem Anfang des bürgerlichen Parteienspektrums, mit dem sie das bißchen Wind machen, das für einen Sturm im Wasserglas vonnöten ist. Andere sind wegen notorischen Singens vor Stasiohren für vogelfrei erklärt und gerupft worden. Dort wo geistige Frackträger die erste Geige im Konzert der Urteile spielen, rümpft man gern die Nase über den mottigen Geruch dieser Gestalten aus dicker Luft und anachronistischer Freiheitsliebe und hält sie fern, weil sie schnell in den Finger hacken, auf den sie sich setzen. Es gab zum Glück für den großmannstümlichen Geschmack an den aufgetischten Wiedervereinigungsgängen eine ganze Menge bedeutend weniger wilde Charaktere, die man für eine verträglichere Zubereitung des Nostalgiekadavers der DDR heranziehen konnte und die auch nicht undankbar werden, wenn ihnen ihr vorgekautes Stück vom großen Nachwendekuchen aus gesinnungshygienischen Gründen hintenrum eingeflößt wird.
Alles in allem existieren an den einmal berühmt gewesenen Rändern der Literatur auch heute noch ein paar zum Original hin tendierende Autoren von Format, die sich freilich nur unter Verlust ihrer relativen Einzigartigkeit für unsere digitalisierte Kommunikationswelt neuformatieren lassen würden. Je ungenierter diese Welt voranschreitet, desto billiger scheint ein Gespräch zu werden. Und der ausgleichenden Hoffnung, wenigstens für sein Schweigen gut bezahlt zu werden, braucht man sich nicht hinzugeben, außer man ist Avantgardist alter Schule oder erpressungswilliger Zeuge eines entsprechenden Verbrechens.
Während ich das verschwommene Gefühl nicht loswerde, daß die entscheidenden Bewährungen gar nicht mehr erst ausgetragen werden können, sehe ich mit erheblich geschwächter Neugier auf das lyrische Veteranentum der ehemaligen Vorkämpfer für den Tanz der Poesie auf allen Hochzeiten des Zeitgeistes. Vom seinerzeit antizipatorischen Gestus der Neutöner sehe ich an den heutigen Wahrnehmungshorizonten nur den Teil eingelöst, den ich schon in seinen Ansätzen abstoßend fand. Er bezieht sich vor allem auf die Sprache der Werbung, die mir im Laufe der letzten zehn Jahre immer wieder wie ein hämischer Gruß an die rhetorischen Verblüffungstaktiker von hier und einst erscheinen wollte. Die Sieger der Geschichte grüßen die Veteranen ihrer fünften Kolonne aus dem ehemaligen Feindesland, oder so ähnlich. Im gleichen Zeitraum habe ich eine Reihe neuer lyrischer Moden kommen sehen, deren Eindrucksfähigkeit nicht mehr vom geschriebenen und gesprochenen Wort herrührte, sondern von computergenerierten Soundkadenzen, die in der Regel ihre semantischen Schützlinge, ich meine die Wörter, so souverän in den Schatten stellten oder mitunter auch so geschickt mit fremden Klangfedern zum äußersten anstachelten, daß ich befürchtete, mein alter Glaube an die schriftbezogene Poesie gehöre einer verdrängten Religion an.
Das Expertentum der Wissenschaftsforschung hat mit Unterstützung durch den gesunden Menschenverstand die höhere Poesie mittlerweile wohl bald endgültig davon überzeugt, daß ihr sprachhygienischer Elfenbeinturm nicht nur ein ausgeleierter Anachronismus, sondern auch noch eine öko-philologische Schande ist. Doch ob sie in Zukunft nun statt ihrer Alltagskleidung oder der Phantasieuniform romantischer Anarchie oder der weißen Weste ihrer Immunität gegen die Sterblichkeit häufiger den Laborkittel der unendlichen Geduld mit dem Unbekannten anziehen wird, hängt sicher nicht vom freien Willen des Einzelnen ab. Was die Poesie auch immer sein mag oder werden will, Schreibmaschine des Lebensstils, Tippfräulein des Zeitgeistes, Laborassistenz Gottes, intelligentes Surfbrett auf dem Malstrom der Fraktale – sie wird schon schreien, wenn sie nicht mehr in ihrem Element sein sollte.
Die Frage, ob die Lyrikmacher meiner Jugend tatsächlich ihre Gedichte selber geschrieben haben, widme ich zum Schluß zur Hälfte meinem treuen Submusentrio Ananke, Tinnitus und Karaoke und zur Hälfte dem Dämon ihrer Einflüsterung, von dem ich annehme, daß er ein fehlgeleitetes Echo auf die Sage von dem einen großen Buch war, in dem alles schon geschrieben steht.
Andreas Koziol, Juni 2000, aus: Roland Berbig, Birgit Dahlke, Michael Kämper-van den Boogart und Uwe Schoor (Hrsg.): Zersammelt. Die inoffizielle Literaturszene der DDR nach 1990. Eine Bestandsaufnahme, Theater der Zeit, 2001
Im Zentrum der Randerscheinungen
Mein erstes Treffen mit Jan Faktor liegt 40 Jahre zurück, 1983. Jan ist Schriftsteller, deswegen erinnert er sich besser als ich:
Du kamst als junger Lektor aus Westdeutschland mit einem Tagesvisum via Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße nach Ostberlin und trafst Dich mit uns, einigen Autoren und Autorinnen der Anthologie – Berührung ist nur eine Randerscheinung –, nahe des Bahnhofs. Ich dachte damals: Im Westen sind die Lektoren jung wie wir und haben Turnschuhe an.
In der Tat war ich als KiWi-Lektor damals häufig in der DDR zu Besuch, offiziell bei den sogenannten Staatsverlagen, aber auch mehrfach in illegaler Mission, in Ostberlin, in Leipzig (DDR-Buchmesse) und in Dresden. Mein Bewegungsprofil konnte ich später anhand der Spitzelberichte über mich in der Behörde für die Stasi-Unterlagen genau nachverfolgen.
Es gab Anfang der 80er plötzlich diese neue Szene von Autoren/Künstlern, vor allem im Berliner Prenzlauer Berg, aber auch in Dresden, die nicht mehr in der Tradition eines erzählerischen Realismus von Christa Wolf bis Christoph Hein oder der politischen Lyrik Wolf Biermanns stand, sondern sich im Feld experimenteller Lyrik und Prosa bewegte, mit vielen Verbindungen zur Musik (Punk/Jazz) und zur bildenden Kunst (Grafikmappen, Fotocollagen, Porzellan-Brennerei, Malerei etc.). Man traf sich klandestin, in Kneipen, in runtergerockten Altbauwohnungen, in Kirchenräumen oder in versteckten Ateliers zu Lesungen, Ausstellungen und Konzerten. Das Ziel war nicht mehr ein verbesserter Sozialismus oder Kritik an den Lebensbedingungen in der DDR (etwa Monika Maron, Flugasche) mit erzählerischen Mitteln, sondern die Thematisierung der Sprache selbst als Material und die Dekonstruktion sprachlicher Konventionen.170
Die erwähnte Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung war wie viele literarische Projekte der DDR entstanden: als der unmögliche Traum einer vom Staat anerkannten oder geduldeten Avantgarde. Der Schriftsteller Franz Fühmann, lange auch von staatlicher Seite gepriesener DDR-Autor der älteren Generation, hatte Texte von jungen Autorinnen und Autoren im Auftrag der Akademie der Künste der DDR zusammengetragen, die nach einer internen Prüfung in der Akademie zu seiner Empörung sofort im Giftschrank verschwunden waren und für viele der Autoren das sofortige Aus bedeuteten: Verfolgung, Bespitzelung, Ausreise aus der DDR.
Dieses „heiße“ Material, eine Mappe hektografierter Texte, wurde dann von Elke Erb und Sascha Anderson durch weitere Autorinnen und Autoren ergänzt, mit programmatischen Einleitungen versehen und in einer raffniert-subversiven Aktion zugleich dem Aufbau-Verlag der DDR und mir als Vertreter des westdeutschen Kiepenheuer & Witsch-Verlages angeboten. (Dieses Projekt lief fast parallel zu einem anderen DDR-Buchprojekt mit kritischen Reportagen und Porträts über die Realität der Arbeitswelt in der DDR in einer Havelobst-LPG von der DDR-Autorin Gabriele Eckart, das 1984 auch bei Kiepenheuer & Witsch unter dem Titel So sehe ick die Sache erschien). Beide Bücher wurden von den DDR-Verlagen auf staatlichen Druck hin nicht nur verboten und abgesagt: In einer slapstickartigen Rückholaktion reiste ein DDR-Verlagsmitarbeiter in Köln an, um die auf abenteuerlichem Wege über die Grenze geschmuggelten Manuskripte wieder einzusammeln. Das Ganze verbunden mit der Drohung, ansonsten jegliche Lizenzgeschäfte zwischen DDR-Verlagen und Kiepenheuer & Witsch einzustellen. Ergänzt durch ein weiteres Druckmittel, dem verzweifelten Hinweis des Emissärs auf sein eigenes Schicksal in der DDR, sollte er mit leeren Händen zurückkommen. Unser Mitleid hielt sich in Grenzen.
Als die Anthologie 1985 bei KiWi erschien, hatten neun von 29 Autorinnen und Autoren die DDR verlassen. Zu den 29 Texten kam noch ein Bildteil hinzu mit Reproduktionen von Text-Bild-Zeitschriften v.a. aus Dresden, die in Kleinstauflagen im DDR-Untergrund zirkulierten (Und, POESIEALBUM etc.).
Die politische Dimension dieser Art von Literatur, wie sie in der Anthologie erkennbar wurde – von Autoren wie Elke Erb und Sascha Anderson, Bert Papenfuß-Gorek, Stefan Döring, Uwe Kolbe oder Uwe Hübner –, war ambivalent. Auf der einen Seite fand hier für Beobachter von außen auch politisch eine radikale Abwendung, ein provozierender Ausstieg aus den vorhandenen kulturellen und damit auch politischen Institutionen und Medien statt. Ich war selbst oft Zeuge des permanenten Katz- und Maus-Spiels mit der Stasi bei geplanten Lesungen, bei kreativen Ausweichmanövern, organisiert durch kodierte Mitteilungen. Der Eindruck von politischer Opposition war bei den staatlichen Stellen allerdings kurioserweise oft heftiger als bei den Protagonisten selbst. (Hinzu kam als Pointe, dass entscheidende Protagonisten der Szene wie Sascha Anderson selbst Stasi-Spitzel waren… möglicherweise der Grund für meine zweitägige Festnahme plus Verhör und Leibesvisitation bei einer Rückreise von der Leipziger Messe). Ein treffendes Bild der komischen Seiten dieser Künstler- und Lebenskünstlerwelt zeigt Leander Haußmanns jüngster Kinofilm Stasi-Komödie.
Auf der anderen Seite ging die Dekonstruktion jeder sprachlichen Kommunikation aber so weit, dass bei vielen Autoren eine Art Abschied von gesellschaftlichem Aktivismus und Politik schlechthin stattfand, hinter dem Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und Sarkasmus zu spüren waren. Der Weg aus den versteinerten Verhältnissen der späten DDR führte in dieser Szene nicht mehr zu politischen Reformen oder Aufständen (obwohl diese ja kurz bevorstanden), sondern in das Reich der Kunst, in die Vielfalt der künstlerischen Ausdrucksmittel. Die realen Orte dieser Utopie waren Künstler-Communities, inoffizielle Wohn- und Lebensgemeinschaften, fließende Gruppierungen ohne gesellschaftliche Aufstiegschancen bzw. -absichten. Die „Berufsbezeichnungen“ der beteiligten Künstler verrieten dies überdeutlich: Friedhofsgärtner, Transportarbeiter, Packer, Turnhallenwart, Kleindarsteller. Eine Drop-out-Welt. In ihrem Vorwort zu der Anthologie weist Elke Erb ausdrücklich darauf hin, dass es hier nicht um Provokationen ging. Diese Literatur „lässt sich nicht mehr infantilisieren von ihren utopischen Gehalten und widersteht ihren Kompromissen… so ist sie auch nicht verführt zu einer folgenlosen Kritik und überhaupt über konfrontative Positionen hinaus“, die bisher „den Zugang zu ihrem Eigenleben erschwert“ haben.
Die herausgehobene Stellung Jan Faktors in dieser Anthologie zeigt sich darin, dass er nicht nur mit einem lyrischen Text vertreten ist („Geschichte eines alten Mannes aus Prag“), sondern die gesamte Anthologie mit einer Art Vorabtext von ihm eingeleitet wird, der sich wie ein programmatischer Auftakt für den Spirit vieler Beiträge der Anthologie liest.171
Der erste Leseeindruck: Hier ist ein Automat am Werk. Heute würde man von einem algorithmen-getriebenen Schreibprogramm sprechen, von einer mathematisch-systematischen Wörterproduktion, deren Logik rein formaler Art ist und einfach Elemente der deutschen Sprache nach grammatischen Kriterien sortiert und grafisch präsentiert. Erkennbar sind Ähnlichkeiten zur langen (vor allem westlichen) Tradition der sogenannten konkreten Poesie, in der Wörter nicht mehr als Bedeutungsträger fungieren, sondern als Elemente, die zu grafisch-ästhetischen Gebilden zusammengesetzt werden. Der häufig spielerische, sogar komische Eindruck dieser Gebilde in der konkreten Poesie jedoch kommt bei Jan Faktors Text erst einmal kaum auf. Hier steht das demonstrativ Serielle, Monotone der Wort-Reihungen so im Vordergrund, dass Ermüdungserscheinungen beim Leser quasi eingepreist sind. Die Systematik erzeugt zudem den Eindruck einer wissenschaftlichen Objektivität, die keinen Raum für subjektive Originalität erlaubt.
Wenn man weiß, dass Jan Faktor ab 1973 in der damaligen Tschechoslowakei, seinem Heimatland, als Systemadministrator und Programmierer arbeitete, ergibt sich vordergründig das schlüssige Bild einer Anti-Literatur, einer KI-Literatur in statu nascendi. Hinzu kommt noch der Eindruck eines systematischen Blicks von außen auf die deutsche Sprache, die für den frischen DDR-Immigranten von damals noch eine Fremdsprache war, der man sich als Neuling ja oft wie ein Ethnologe nähert, der auf eine fremde Welt schaut. Die Sprache erscheint dann erst einmal als eine Summe von Zeichen, Grammatik, Klang, Rhythmus, Melodie, noch nicht als selbstverständliches Kommunikationsmittel.
(…)
Helge Malchow, aus Jan Faktor trifft Wilhelm Raabe. Der Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2022 herausgegeben von Hubert Winkels, Wallstein Verlag, 2023
Was sollte sich daran ändern?
– Anmerkungen zur Debatte um DDR-Literatur und „Underground“-Kultur. –
1: Mein Pech
In der DDR entstandene Literatur hat keine gute Presse. Die sie früher lasen und lobten, schämen sich nun ein bißchen und schweigen oder üben sich im Widerrufen.
Nun wurde ich aber dorthin geboren, weil meine Eltern nicht nach Bayern weiterzogen. Auch bin ich dort geblieben und hab selber Kinder gezeugt, obwohl ich „das System“ nicht liebte (und „es“ mich offenbar auch nicht sonderlich). „Das System“ hatte den Anspruch, alles zu kontrollieren – zum Besten der Kontrollierten, versteht sich. Und ich hatte, Pech für mich, den Wunsch, mich auch außerhalb der Freizeit mit Literatur zu beschäftigen, und konnte es „irgendwie“ durchsetzen. Und dann, Pech!, nicht Walther von der Vogelweide oder Gottfried Keller, sondern Sarah Kirsch oder Volker Braun, Ernst Jandl oder Manfred Peter Hein, Bert Papenfuß-Gorek oder – – Wolf Biermann. Also alles schon unter „normalen“ Umständen weder Mainstream noch zeitlos noch unverfänglich.
Das alles sind heute Gründe, sich permanent zu rechtfertigen. Das festzustellen, ist mir irgendwie peinlich, weil ich mich da in eine Gesellschaft begebe, die mir gar nicht recht ist. Aber man kommt nicht drum herum. Ein jüngerer Kollege aus Occidens felix fragt öffentlich an, ob ich auch schon vor zwei Jahren so geredet hätte. Es kommt nicht darauf an, was ich antworte, ich stecke im Tintenfaß. Ein anderer sehr lieber, freundlicher und hilfsbereiter Kollege ebendort findet mein liebevolles Eingehen auf etwas verschrobene Texte rührend, weil er mir zugesteht, daß ich es unter der Käseglocke des Systems halt zum Überleben brauchte, und wünscht mir, ohne es auszusprechen, ich möge bald in der leider harten Wirklichkeit ankommen – also zum Beispiel über andere Autoren reden. Ein weniger freundlicher, dafür wohlmeinender Herr, aus dem sozialistischen Hochschulwesen wie ich zwar, aber offenbar an der „richtigeren“ Fakultät, Theologe nämlich und nun Ostmitglied einer sonst aus West-Kollegen bestehenden Kommission, die meine Arbeit überprüft, rät mir explizit, mich auf unverfänglichere (also ältere oder zumindest westlichere) Gegenstände zu verlegen. (Was haben die alle gegen Gedichte?) Wolf Biermann (Hamburg) teilt mir per Zeitung mit, daß er mich nicht mehr mag. (Dabei kenne ich ihn nicht einmal persönlich!) Ein bärbeißiger Moderator, der wirklich so aussieht, wie er ist, also bestimmt kein Leser von Gedichten, jedenfalls aber nicht garstigen, zitiert mit sorgenvollen und angewiderten Mundwinkeln eine Gedichtzeile von Anderson, die ich auch schon mal öffentlich vorgelesen habe (nicht im Fernsehen!). Eine junge Journalistin aus einem Hamburger Wochenblatt besucht mein Seminar, ohne sich zu erkennen zu geben, und schreibt dann wirklich wohlwollend und freundlich darüber. Ein gutes Jahr später, nachdem sie den Anderson endlich durchschaut hat (Kunststück!), schwört sie auf zwei Seiten lautstark ab, nein: sagt, sie sei verraten worden, und spuckt drauf. (Was denkt sie nun von mir???!) Wolf Biermann in der Zeit geißelt die literarischen Gartenzwerge vom Prenzlauer Berg (Pech für mich, daß sie mir wichtig sind), und XY in der taz tazzelt Wolf Biermanns „poetisches Gefurze zur Gitarre“: wieder Pech für mich, daß ich mich, verfluchte Sentimentalität, nicht lossagen kann wie alle die anderen, Glücklichen, die fein raus sind. Ich bin noch nicht so gewöhnt an diese kräftige, bildreiche und beliebige Sprache, ich denke immer noch, daß es was bedeutet. Ich bin überhaupt nicht raus, ich bin leider drin.
2: Gleichzeitigkeit
Bei aller Bedingtheit und Abhängigkeit des Schriftstellers von den Wechselbeziehungen der gesellschaftlichen Kräfte bin ich außerdem fest davon überzeugt, daß die moderne Wissenschaft über keinerlei Mittel verfügt, das Erscheinen erwünschter Schriftsteller dieser oder jener Art hervorzurufen. Da sich die Eugenik in einem rudimentären Stadium befindet, könnten kulturelle Kreuzungen und Pfropfungen jeglichen Typus die unerwartetsten Resultate ergeben. Die Bereitstellung von Lesern ist eher möglich; dafür gibt es auch ein direktes Mittel – die Schule.
(Ossip Mandelstam, 1928)172
Wenn ich es recht verstehe, geht es darum, daß die DDR die falschen Autoren hatte. Das kann auch so sein, und Ulbricht oder Hager meinten es wohl auch. Nur gilt eben, daß jede Zeit die Autoren hat, die sie verdient. Der Streitpunkt reduziert sich dann auf die Frage, ob die Literaturen „Ost“ und „West“ gleichzeitig waren. Zur Zeit hat sich die Meinung durchgesetzt, daß allein die „West“-Literatur auf der Höhe der Zeit war (einige bestreiten auch dies; diese kann ich ernster nehmen). Die „Ost“-Literatur dagegen scheint irgendwie mit der DDR den Bach hinuntergegangen zu sein. DDR-Literatur wird einzig und ausschließlich aus den „eigenen“ internen Bedingungen des geschlossenen Systems DDR erklärt. Die von Honecker und Hager inaugurierte Abgrenzungsdoktrin feiert da späten Triumph. Aber war es nicht immer so, daß Literatur gleichzeitig in der Zeit und in den Zeiten sproß? Weil die ehemals hier herrschende Meinung darauf pochte, daß sie allein aus sich selbst heraus erklärt werden könne, fällt es mir schwer, es ihr post festum et mortem aus fremder Hand abzukaufen. Nicht Braun oder Enzensberger, Becher oder Benn, Majakowski oder Marinetti, sondern alle zugleich waren und sind meine Zeit. (Zeit ist doch nicht Zeitgeist!). Was immer Kurt Hager oder XY dazu meint(e): Mein Leben wie mein Lesen gehörten ihm zwar zu einem nicht unerheblichen Teil, so weit nämlich seine Macht reichte; aber es war immer noch etwas übrig. – Wenn dem so ist, dann könnte man damit aufhören, die Literaturgeschichte nachträglich zu korrigieren. Vielleicht schafft es (mit Mandelstams grimmiger Hoffnung) die Schule, dem Leser in Wanne-Eickel oder Greifswald klarzumachen, daß er aus seiner eigenen unteilbaren Zeit nicht aussteigen kann?
3: Produktivität
Jetzt nicht von der Zeit, auch nicht der DDR-Zeit, sondern von jenen Autoren, für die sich das irreführende und mißbrauchte Kürzel Prenzlauer Berg eingebürgert hat. Warum, kann man fragen, sollten sich die Autoren, nachdem sie es geschafft haben, sich dem Anspruch eines anspruchsvollen Systems zu entziehen, nun dem Beweisdruck unterwerfen, der ihnen abverlangen will, sich in der großen Welt, im großen Strom sozusagen der Weltkunst (in dem angeblich zwar nicht die östlichen, wohl aber die westlichen Adepten schwammen), zu behaupten? Die spezifischen, so individualitäts- wie poesie- und theoriefeindlichen Bedingungen haben geholfen, ein einmaliges produktives Klima zu erzeugen – aber sie waren es nicht. Warum sollte es nun mit ihm untergehen? Man sollte es ernst nehmen, was beispielsweise Papenfuß-Gorek und Schedlinski im Frühjahr 1990 behaupteten: daß sich für sie unter den neuen Bedingungen nicht so viel ändern würde. Papenfuß-Gorek:
Irgendwie müssen wir diesen Gedanken der Subversion retten, laß mich überlegen… Das ist gepflanzt wie ein… Boogie-Trap. Vielleicht klappt es irgendwann und erschüttert eine weitere Grundfeste oder Mauer. Dann ist es gut. Wenn nicht, hat es uns selber geholfen.173
Ist es nicht das Hauptverdienst der wie auch immer definierten Szene, in einer Phase von Stillstand und Unproduktivität in geistiger, politischer und materieller Hinsicht produziert zu haben – in einer Weise, die nicht gerade systemstabilisierend wirkte? Produktion, das hieß in der Zeit des Niedergangs eben: Schluß mit dem Sonderweg DDR, der sich als Sackgasse längst erwiesen hatte, wenn man sich hinzusehen traute. Die Kritik (in Ost wie West) muß nicht übersehen, daß diese Dinge in zeitlichem wie räumlichem Sinne in der DDR entstanden, aber sie muß nicht versuchen, sie nachträglich in deren Maß und Rahmen zu pressen. Zu dieser Produktivitätszone gehören nicht nur die Vertreter der Prenzlauer-Berg-Connection (Adolf Endler174). Andere Zentren, Leipzig und Dresden zuerst, wären ebenso zu berücksichtigen wie sogenannte Randfiguren (die das nur sein können, wenn man ein Zentrum annimmt). Mag sein, daß man alle diese Autoren als Randfiguren im kulturellen Leben der DDR bezeichnen kann – aber die tatsächlichen Prenzlauer hatten schließlich keinen Höpcke noch Hager (nicht mal einen Kant). Sprechen wir lieber von einer Gruppe, von der immer noch erstaunlich viel an Gemeinschaft ausgeht, wie die Galrev-Editionen zeigen. Und sprechen wir von den je verschiedenen Autoren und Texten.
4: Doppelcharakter & Ausblick
Diese Autoren gingen von dem sprachlosen Raum aus – in wörtlicher wie übertragener Bedeutung: indem sie ihn analysierten, ausforschten, Feldforschung betrieben – und ihn zugleich verließen und zu sprechen anfingen, es einfach taten, ohne darauf zu warten, daß die Politik ihnen die Rahmenbedingungen schaffen würde. Zu welchem Maß an Souveränität und Draufsicht sie ihre Arbeit führte, könnte, wer den Mut hat, seinen Ekel vor dem Prenzlauer Berg im allgemeinen und seinen Stasi-Verbindungsmännern im besonderen zu überwinden, in dem von Andreas Koziol und Rainer Schedlinski (bei Galrev) herausgegebenen Abriß der Ariadnefabrik nachlesen: zum Beispiel bei Gert Neumann. Unter dem Datum des 20. Oktober 1989 findet sich dort eine präzise und heute noch gültige Analyse des damals (vom Politbüro der SED, aber auch von sogenannten und wirklichen kritischen Intellektuellen) Dialog genannten gesellschaftlichen Zustands am Anfang der schon damals, schon von Krenz und Schabowski so genannten Wende175. – Behält man dies im Blick, sind die „Underground“-Künstler der achtziger Jahre etwa nicht die literarischen Entsprechungen jener jungen Leute, die erst auf den Botschaftsmauern und Grenzzäunen mehrerer Nachbarländer und dann auf den Straßen der Städte im Lande ebenfalls einfach daran gingen, es zu tun? Wir wissen (wissen wir’s?), wie es ausging. Ich sage nicht, daß sie, die Dichter, sie vorbereitet hätten; ich sage Entsprechungen (und gewiß trug die beispiellose und kaum mit den alten Mitteln von Zuckerbrot und Peitsche zu bekämpfende Off-Kultur zur Aushöhlung bei, wie sie im Oktober ’89 manifest und virulent wurde.)
Auf der anderen Seite müssen wir uns erinnern, daß jede Generation, jede neue literarische Bewegung unter ihren jeweiligen historischen Bedingungen dafür stand, verkrustete Möglichkeiten des Sprechens wieder aufzubrechen. Erstarrung der Sprache und entfremdete Handlungsräume sind keine Errungenschaft des realen Sozialismus. Als die Expressionisten um 1910 aufbrachen, fanden sie das ebenso vor wie etwa Jandl und die Wiener Gruppe in den allzuschnell abgesättigten und befriedeten 50er Jahren (der „West“-Hälfte). Ernst Jandl 1969:
kunst heute, also auch dichtkunst, kann als eine fortwährende realisation von freiheit interpretiert werden. eine solche interpretation macht die stelle der kunst im raster der ideologien sichtbar; sie impliziert eine aussage über die funktion der modernen kunst für den einzelnen und die gesellschaft. sie ermöglicht damit eine erklärung, wieso moderne kunst von einzelnen als ein ärgernis empfunden wird und aus bestimmten gesellschaftsformen ganz oder teilweise verbannt bleibt.176
Der da sprach, hatte eben nicht (nur) die DDR im Sinn, sondern auch die eigene Erfahrung über zehnjähriger Dürre, bevor seine Art zu reden eine Chance bekam. Die spezifische Enge und Ängstlichkeit des DDR-Leselandes mögen eine besondere Ästhetik wie ein Netz von gegenseitigen Zitaten und Anspielungen hervorgebracht haben, das es Außenstehenden mitunter schwer macht, den Faden zu finden. Aber das ging zu jeder Zeit darüber hinaus, was denn sonst? Der „kindische“ (Volker Braun / Elke Erb) Aufbruch einer neuen Generation in den 60er Jahren ebenso wie die sich gegen eine Öffentlichkeit des permanenten Ausschlusses in Szene setzende Gegenkultur der 80er waren (muß man da gelebt haben, um es nachzuempfinden?) kultureller Widerstand und zugleich Teil der länder- und zeitenübergreifenden Erneuerungsbewegung, deren einer Name seit etwa 100 Jahren Avantgarde lautet.
Das alles ist „natürlich“ ohne Interesse für die Medien. Oder wo hat man schon gesehen, daß die sich mit Peter Waterhouse oder Thomas Kling beschäftigen würden – von den Jungen in Köln oder Essen zu schweigen) (Papenfuß-Gorek hat übrigens nachdrücklich auf die vergleichbaren Bemühungen von Kling und Waterhouse hingewiesen.) Wir (in Greifswald oder Wanne-Eickel) müßten daran gehen, uns unsere jeweiligen Biographien vorzubuchstabieren. Daß die Medien dazu nicht das passende Instrument sind, wußten wir schon. Neben den verschiedenen mehr oder minder herrschenden Diskursen aber gab es und gibt es diverse Rand- oder Sonderdiskurse. Einer davon: experimentelle, unangepaßte, avantgardistische oder Underground-Poesie. Was sollte sich daran ändern?
Michael Gratz, aus Michael Gratz: „Gestellte Gestalten des Niemandslandes“. Drei Annäherungen an meinen Prenzlauer Berg, Institut für Deutsche Sprache und Literatur der Universität Vaasa, 1992. Vgl. hierzu auch den Beitrag von Michael Gratz „Du siehst, analysieren kann ich das nicht, zu sehr stecke ich selber drin“ in: Karl Deiritz und Hannes Krauss (Hrsg.): Der deutsch-deutsche Literaturstreit oder „Freunde, es spricht sich schlecht mit gebundener Zunge“. Hamburg, Zürich: Luchterhand 1991, S. 17–23.
„Volker Braun? – Da kann ich nur sagen, der Junge quält sich.“
– Neue Stimmen in der DDR-Lyrik der achtziger Jahre. –
RUMPELSTILZ
für braun
heißest du hinz? heißt du kunz? heißest du siegfried?
heißest du etwa volker? – das hat der teufel dir gesagt!
so spricht er und stampft mit dem fuß daß die erde sich spaltet,
mit dem einen bein schon im abgrund, zerfallen mit seiner
besseren hälfte, die verse voll grimm und hölderlin, zerrissen
der autor statt seiner fotografie: das kindergesicht
zur faust geballt (fauste kommt auch vor), losungen gegen
– losungen, nur keine lösung in sicht – ach königin müllers
tochter die frau auf dem plakat muß helfen: stroh zu gold!
WAS LEBENDES WÄRE MIR LIEBER. mir auch. nur nicht das
was uns blüht
wenn leblos ideen gedichte bevölkern: hoffnung
die aussieht wie eine preußischblauende blume.
(Manuskript)
Volker Braun als Figur aus einem Grimmschen Märchen, als Rumpelstilzchen: klein, listig und eigensinnig das Kind der Müllerstochter fordernd, aber dann auch bereit, Zugeständnisse zu machen, jähzornig und schließlich überlistet – die respektlose Konfrontation einer jungen Poetin mit einem der international angesehensten Schriftsteller der DDR, mit einer philosophisch-poetischen Leit- und Kontrastfigur einer ganzen Generation junger Lyriker in der DDR. Ist das märchenhafte Bild, das die junge und praktisch unbekannte Lyrikerin Barbara Köhler in ihrem Gedicht zeichnet, charakteristisch für die Haltung jener, die in den letzten fünf bis zehn Jahren zu schreiben begonnen haben?
Der allgemeine Hintergrund
Seit etwa Mitte der siebziger Jahre wurde die literarische Landschaft der DDR in immer größerem Maße durch junge Autoren und neue Namen geprägt. Dieser Prozeß vollzog sich vornehmlich auf dem Gebiet der Lyrik, einem Genre, das traditionell mit den Vorreitern literarischer Entwicklungsphasen verbunden ist.177 Auffällig ist, daß die Zahl der Lyriker, die in den letzten zehn Jahren in DDR-Verlagen ihr literarisches Debüt gaben, bedeutend höher war als in früheren vergleichbaren Zeitspannen. Seit der Mitte der siebziger Jahre veröffentlichten Autoren wie Uwe Kolbe (*1957), Hans-Eckardt Wenzel (*1955), Steffen Mensching (*1958), Thomas Böhme (*1955), Richard Pietraß (*1946), Thomas Rosenlöcher (*1947), Lothar Walsdorf (*1951) und einige andere zwei oder mehr Lyrikbände, selbstredend in – für DDR-Verhältnisse – relativ kleinen Auflagen. Wenn man bedenkt, daß Druckpapier in der DDR sehr knapp war und die Zensur manches Buch verhinderte, war das eine beachtliche Zahl. Die Möglichkeiten von Lesungen für junge Lyriker waren stark angewachsen; viele Autoren hatten Zugang sowohl zu anerkannten Buchreihen (etwa der Edition Neue Texte des Aufbau-Verlags) als auch zu neuen Publikationsformen – z.B. Poesiealbum (Verlag Neues Leben), Die Schublade (Mitteldeutscher Verlag) und, um das jüngste Beispiel zu nennen, Außer der Reihe (Aufbau-Verlag). Literarische Zeitschriften innerhalb des kulturpolitischen Kanons wie Neue Deutsche Literatur (NDL), Sinn und Form und Temperamente boten regelmäßig Raum für neue Texte.
Parallel schufen etliche junge Schriftsteller und Graphiker – tonangebend waren die Lyriker – Publikationsformen, die nur einem kleinen Leserkreis zugänglich und vom offiziellen Verlags- und Buchmarkt unabhängig und ausgeschlossen waren. Sie veröffentlichten privat und in sehr kleinen Auflagen (25 bis 100 Exemplare) Zeitschriften, die größtenteils auf Schreibmaschinen und Computern hergestellt wurden und eine Vielzahl von Texten, Fotos und Graphiken enthielten.
Die Zeitschriften wurden in verschiedenen Städten der DDR herausgegeben und trugen Titel wie ariadnefabrik, Bizarre Städte, schaden, Mikado, verwendung, Undsoweiter, Anschlag, Zweite Person. In westlichen Ländern ist es völlig normal, daß solche Publikationsformen neben denen der etablierten Verlage existieren; es gibt „Nischenverlage“, man kann auch ohne Verlag sein Buch auf eigene Kosten drucken lassen, eine eigene Zeitschrift oder einen Verlag gründen. In der DDR haben die inoffiziellen Publikationsformen in Bezug auf neue Literatur die Funktion, die Spreu vom Weizen zu trennen, echten Talenten Starthilfe zu geben. Bis dato gab es innerhalb des offiziellen, streng geregelten Literatur- und Verlagssystems in der DDR keine nennenswerte Tradition dieser Art. Schon allein daraus erwuchs der Nimbus des Verbotenen, der diesen Veröffentlichungen anhaftet. Die Autoren und Graphiker erschienen als Teil einer Underground-Bewegung, die von vornherein unter Generalverdacht seitens der „Offiziellen“ des Literaturbetriebs standen. Darüber hinaus wurden die Texte, die in diesen Zeitschriften gedruckt wurden – und wir beziehen uns jetzt auf das Gebiet der Lyrik –, aus verschiedenen Gründen, aber oft wegen ihrer schonungslosen Kritik an den sozialen Defiziten in der DDR, von den offiziellen Verlagen abgelehnt und die Staatssicherheit „beobachtete“ diese unliebsame Szene sehr aufmerksam.
Jedoch kann die Art und Weise des Auftretens dieser jungen Autoren nicht ausschließlich durch den Mangel an oder die Verhinderung von Publikationsmöglichkeiten erklärt werden. Ein weiterer wichtiger Faktor war u.a. das Bedürfnis, die eigene Befindlichkeit und Probleme zunächst in einem kleinen, intimen Kreis von Freunden und Gleichgesinnten, häufig auch in kirchlichen Einrichtungen, zu artikulieren sowie in Formen, die von den in der DDR üblichen abwichen. Ebenso wichtig für ihre Motivation war die Möglichkeit zu experimentieren, sich auszuprobieren und neue Ausdrucksweisen und Öffentlichkeitsformen zu etablieren. Für das politische und poetische Selbstbild einzelner Autoren war es zudem wichtig, sich von allem, was mit dem sozialistischen Literaturbetrieb in Verbindung stand, abzukoppeln und sich der vorherrschenden Ästhetik zu verweigern; Namen wie Bert Papenfuß-Gorek, Stefan Döring und Eberhard Häfner stehen dafür.
Eine Handvoll junger Dichter hat in den vergangenen Jahren Gedichtbände in der Bundesrepublik veröffentlicht oder ist zeitweise oder auf Dauer dorthin gezogen, um ihr Leben und ihre Arbeit außerhalb der DDR fortzusetzen. Die personellen und poetischen Veränderungen in der literarischen Landschaft der DDR seit der Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976 haben auch ihre Spuren in der jüngsten Lyrik hinterlassen. So war es ebenso eine politische wie literarische Entscheidung dieser jungen Lyriker, aus dem „Osten“ in den „Westen“ zu ziehen. War es in den späten siebziger und frühen achtziger Jahren für junge Lyriker relativ leicht, ihre Arbeiten in der Bundesrepublik zu veröffentlichen und durch die Einordnung ihrer Literatur in der DDR als unterdrückt im anderen deutschen Staat gleichsam den Ritterschlag der literarischen „Qualität“ zu erhalten, wurde es für sie Ende der achtziger Jahre viel schwieriger. Innerhalb einer sehr disparaten Landschaft junger Lyrik in diesem Zeitraum müßte die Lage einzelner Autoren natürlich sehr differenziert betrachten werden, spezielle Untersuchungen wären wünschenswert.
In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre erschienen in der Bundesrepublik drei sehr unterschiedliche Anthologien neuester DDR-Literatur, die auf traurige Weise sichtbar machten, welche Folgen es hat, wenn jungen talentierten Autoren in ihrem eigenen Land das Publikum genommen wird oder wenn sie massiv darin eingeschränkt werden, was sie veröffentlichen oder öffentlich vortragen. Es sind die Bände Berührung ist nur eine Randerscheinung. Neue Literatur aus der DDR178 von Sascha Anderson und Elke Erb, Mikado oder Der Kaiser ist nackt. Selbstverlegte Literatur in der DDR179 – eine Anthologie mit Texten aller drei Genres, die von Uwe Kolbe, Lothar Trolle und Bernd Wagner herausgegeben wurde – und Egmont Hesses Anthologie mit Gedichten und Interviews Sprache & Antwort. Stimmen und Texte einer anderen Literatur aus der DDR.180 Diese Anthologien machten auf verschiedene bedeutende neue Entwicklungen in der DDR-Lyrik der letzten Jahre aufmerksam, von denen einige im folgenden diskutiert werden.
Autoren, die ihren literarischen Einstand mit Gedichten geben, sind im allgemeinen viel jünger als Debütanten anderer Genres. Die Lyriker, die hier betrachtet werden, wurden alle in den fünfzigern oder frühen sechziger Jahren geboren. Bei aller Verschiedenartigkeit und Einmaligkeit, die jedem dieser Autoren ein unverwechselbares Profil geben, haben sie einige biographische Koordinaten gemeinsam, die einen Einfluß darauf haben, was für eine Rolle das Schreiben in ihrer individuellen Entwicklung hat, und die auch ihre Auffassung von der Funktion der Literatur in der Gesellschaft formen. Neben der Schule, dem Militärdienst, der Ausbildung oder dem Studium sind es die ersten Arbeitsjahre, die ihre Weltsicht formen. Erste Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht werden thematisiert und geben einen Vorgeschmack dessen, was es heißt, Verantwortung für eine Familie und eigene Kinder zu tragen. Es ist charakteristisch für viele dieser Lyriker, daß sie relativ früh darauf verzichteten, einen „ordentlichen“ Beruf zu erlernen, und lieber „hauptberuflich“ Dichter werden wollten. Probleme waren damit vorprogrammiert. Kaum ein junger Autor, am wenigsten ein Lyriker, konnte seinen Lebensunterhalt ausschließlich durch die Veröffentlichung einzelner Gedichte bzw. im besten Fall eines Lyrikbandes sichern. Dieses Element der – selbst gewählten – sozialen Unsicherheit war neben einem relativ schmalen Horizont praktischer sozialer Erfahrung auf lange Sicht gesehen nicht von Vorteil für eine Reihe von Autoren. In den vergangenen Jahren war es z.B. auffällig, daß eine ganze Anzahl junger Autoren sich selbst zu Außenseitern machte und ein Gefühl kultivierte, in dieser Gesellschaft nicht gebraucht zu werden. Andererseits ist die Härte der Fragen und Ansichten, die in der jüngsten Lyrik artikuliert wurden, genau ein Produkt dieser Bereitschaft, Risiken einzugehen, wie sie die Konzentration auf das Schreiben als die Existenzform für jeden einzelnen Autor mit sich bringt.
Volker Braun als Symbolfigur in Arbeiten von Uwe Kolbe, Steffen Mensching und Hans-Eckardt Wenzel
Betrachtet man literarische Entwicklungen in unterschiedlichen historischen Epochen, läßt sich erkennen, daß die neue Autorengeneration auch durch eine besonders enge und oft polemische Beziehung zur vorangegangenen Generation geformt sein kann. Es ist deshalb nicht überraschend, daß seit den achtziger Jahren der Name Volker Braun wiederholt in vielen lyrischen und theoretischen Äußerungen junger Lyriker erscheint. In einer Beziehung, die sowohl durch Solidarisierung als auch Distanz geprägt war, ist Braun gewissermaßen ein Symbol dieser neuen Lyrikergeneration, deren literarisches Debüt zu Beginn der sechziger Jahre solch eine Aufregung verursachte. Wie kein anderer Lyriker seiner Generation richtete er seine Aufmerksamkeit auf die politische Landschaft der DDR und die, die sich in einer Beziehung zu ihm sahen, mußten sich auch mit der Idee einer Literatur der politischen Einmischung auseinandersetzen. Nicht nur bei Autoren, sondern auch bei Literaturkritikern und in der öffentlichen Diskussion über Lyrik tauchten Vergleiche mit Braun häufig auf. Es ist bezeichnend, daß Braun überall als eine Figur mit unangefochtenem Format präsentiert wurde und seitens der Kulturpolitik gelegentlich den jungen Autoren als ein Modell politischen Engagements vorgehalten wurde, dem sie nachahmen sollten. Was dabei ausgeklammert wurde, ist das Ausmaß, in dem Brauns eigene frühe Lyrik Objekt energischer kritischer Diskussionen war. Das lautstarke lyrische „Wir“ vieler Braunscher Gedichte aus den mittsechziger Jahren war der Ausdruck einer frischen Einstellung zum Leben, einer Annäherung an die Errungenschaften des Sozialismus, die sich in bedeutendem Maße von der der vorangegangenen älteren Lyrikergeneration unterschied. Brauns Appell:
Kommt uns nicht mit Fertigem! Wir brauchen Halbfabrikate! […] Hier wird täglich das alte Leben abgeblasen […]“181 war kennzeichnend für diese neue Einstellung. Bei weitem wurde sie nicht überall wohlwollend aufgenommen. Günther Deicke (*1922) hat später sehr anschaulich beschrieben, wie diese Annäherung der in den sechziger Jahren jungen Autoren oft im Gegensatz zur sozialen Realität der Zeit stand:
Volker Braun und seine Altersgenossen wuchsen bereits in dieser Welt auf – und wo wir uns noch vornehmlich mit der Vergangenheit auseinandersetzten, fanden sie in dieser ihrer Gegenwart bereits ihre Reibungsflächen, entdeckten, wo wir Fortschritt sahen, schon Unvollkommenheiten, sie griffen ein, stritten sich mit ihresgleichen und Gleichgesinnten und demonstrierten in der Praxis, was wir erst mühsam theoretisch begreifen mußten: die Schärfe und Härte und Lösbarkeit der nichtantagonistischen Konflikte.182
Stellen wir nun dieses Zitat zunächst erstmal unkommentiert Äußerungen zweier Angehöriger der jungen Generation von heute gegenüber. Der fast unbekannte Fritz-Hendrik Melle (*1960), der Gedichte für die Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung beisteuerte, schrieb 1985 über Braun:
– Hoffnung, die enttäuscht wird, Erwartung, die von der vorhergehenden Generation übermittelt wird: Uwe Kolbe hat gesagt, wir werden in eine Erwartung geboren. Jeder hat doch sein Kainsmal, das, woran er krankt. Bei Uwe waren viele Gedichte beschäftigt mit diesen getäuschten Erwartungen, mit denen ich nichts mehr zu tun habe.
Nichts mehr? – Da war ich so 14, 16, als das klar wurde.
Volker Braun? – Da kann ich nur sagen, der Junge quält sich. Dazu habe ich keine Beziehung mehr.
Ich bin in einer frustrierten Gesellschaft schon aufgewachsen. Diese Enttäuschung ist für mich kein Erlebnis mehr, sondern eine Voraussetzung.
Es ist so, daß der Braun für mich zur Erbmasse gehört. Er hat mir eigentlich nichts mehr zu sagen.
[…]
Was ist Sagen, wann hätte Braun dir etwas zu sagen? – Wenn er das Nichtbenannte in mir kleiner macht, das Nichtbegrenzte, das, was ja auch bedroht, – das kann er nicht mehr.183
Leonhard Lorek (*1958) erinnert sich:
auf mich haben mal, mit sechzehn, siebzehn, volker braun gedichte sehr suggestiv gewirkt. vor allem wegen dem, scheinbar selbstverständlichen, benutz der vokabel genosse. ein eigentlich gar nicht so wichtiges wort. aber diese gedichte haben dem genossen eine eigenständige existenz, außerhalb des staatsbürgerkunde und blaulicht romansprachengebrauchs ermöglicht. nur steht braun für ne andere generation von poetern.184
Der Titel des ersten Lyrikbandes von Uwe Kolbe, Hineingeboren (1980), gibt uns den Schlüssel, der die Natur der Beziehung der jungen Autorengeneration zum Sozialismus in der DDR charakterisiert: die Tatsache, in eine Gesellschaft hineingeboren worden zu sein, in der die Fundamente für eine sozialistische Entwicklung bereits gegossen sind und deren zukünftiger Pfad bereits entworfen zu sein scheint. Schule und Ausbildung, die ersten Bereiche eigenständiger sozialer Erfahrung, vermittelten das Wissen, das nötig war, um diese Sichtweise zu untermauern, und sollten die ideologische Überzeugung herausbilden sich anzupassen. Aber dieser Prozeß hatte seine Widersprüche und Inkonsequenzen, produzierte verschiedene Herangehensweisen an das Leben und rief – rückblickend – divergierende Antworten junger Autoren hervor. Alle mußten sich mit einem „angelernten Sozialismusbild“ (Jutta Schlott auf dem 9. Schriftstellerkongreß der DDR) arrangieren, das allzu oft im Widerspruch zu den alltäglichen Realitäten des Sozialismus stand. Die Suche nach einem Platz in der Gesellschaft, nach Anerkennung und dem Gefühl, gebraucht zu werden, steckte für viele junge Autoren voller Krisen. Die Folgen für ihre literarische Tätigkeit waren unterschiedlich. Von Anfang an war es unmöglich, die jungen Lyriker auf einen Nenner zu bringen, waren sie doch alles andere als eine homogene Gruppe. Ein grundlegender Unterschied zwischen ihnen und der Generation von Braun, die in den Sechzigern auftrat, war, daß ein Zusammengehörigkeits- oder Gruppengefühl nur periodisch und dann nur in kleinem Rahmen bestand, z.B. im Zusammenhang mit der Arbeit an einer der oben genannten Zeitschriften. Gerade in der Beziehung zu Volker Braun scheinen Polarisierungen auf, die von weitreichender Bedeutung sind. Am Beispiel von Steffen Mensching und Hans-Eckart Wenzel sowie Melle und Lorek wird das zu analysieren sein.
Zunächst jedoch zu Uwe Kolbe, der in gewisser Weise eine Zwischenstellung einnimmt. Das folgende Gedicht stammt aus seiner frühen Schreibphase:
ZWEITE, ÜBERSCHÜSSIGE
LEGITIMATION
Ich bin aufgehetzt worden
Im Verlauf einiger Jahre
meiner eng befristeten Existenz.
Bin aufgestöbert worden
von einer Frau in einem dunklen Zelt,
von einer kleinen Hand in der Schulbank.
Die ersten Wünsche, der erste Begriff
von Unerfüllbarkeit,
brachten mich auf.
Alle Systematik und Rüstung in mir
flimmerte umschauert, rostete
sekundenschnell und brannte durch,
verfiel in Starre und Dunkel.
Ich trauerte, atmete tief, las
und erlauschte uns,
brachte die Schulgenügsamkeit heraus,
vermengt mit Kot und Schleim.
Verkostete Expressionismus, quirlte
formal mein graues Hab
und das Gute durch und um.
Ich band mich fest und zeugte
ein Kind am Rande der Dichtung
– so hart wurde ich, so
begann ich zu reden –
Es pulste Gift durchs Innre mir,
die bürgerliche Dichtung, Trakl,
Benn und Rilke, Whitman und Pessoa,
die stets genannten Schwierigen.
Ich kam zur Stellung Schreibender
zu ebensolchen Irren,
zur Frage des Genies.
Ich wurde aufgehetzt von jedem Atemzug,
von jeder langen Weile, von Blicken
blasser Mädchen hier am Band.
Ich wurde schwatzhaft von dem Vodka
in der Mittagspause, schrieb
die Flüche auf des dicken Herbert
und das Lallen seiner dicken Frau.
Ich bin gehetzt von dieser Zeitansage
durch das neue Telefon,
angekratzt von der Verflachung
meiner Sinne und der Bilder drinnen.
Jeder Weg macht mich wirr,
jeder Schritt erinnert mich
an den größten Anspruch bei Braun
und bei mir.
Ich bin aufgehetzt worden.
Die Geschwindigkeit nimmt zu.
Ich finde unser Bild nicht mehr scharf.
Wir vervielfachen uns
in der Bewegung, unaufhaltsam,
– für mein Auge,
wenn es kreist und aufschreit.185
Während diese ersten Jahre einer „eng befristeten Existenz“ in der Arbeit anderer junger Lyriker in einem ausschließlich negativen Licht, als Zeit der Deformation, präsentiert werden, konfrontiert uns Kolbes Gedicht „Zweite, überschüssige Legitimation“ mit einer etwas anderen Blickrichtung. Von Bedeutung ist hier die Geste der Unruhe, der Verwirrung, einer frühen inneren Unsicherheit, die durch seine ganze folgende Arbeit (zwischenzeitlich veröffentlichte er zwei weitere Lyrikbände: Abschiede und andere Liebesgedichte [1981]186 und Bornholm II [1986])187 in variierter Form ein dominantes Merkmal der lyrischen Stimme sein wird. Die Anrufung Volker Brauns gibt in diesem Kontext einigen Aufschluß. Vergleicht man z.B. Kolbes eigenen „größten Anspruch“ mit dem, der mit Brauns Namen in Verbindung gebracht wird, findet sich durchaus Übereinstimmung: dem Anspruch, ein wichtiger Teil einer Gemeinschaft gleichgesinnter Geister zu sein, in der der Intellekt einen entscheidend herausfordernden philosophischen Beitrag zu leisten hat. Es ist von wesentlicher Bedeutung für die Identifikation mit Braun, daß das „Ich“ des Monologs in der 1. Person an dieser Stelle des Gedichts sich plötzlich zum „Wir“ verstärkt. Kolbe nutzt ein Pathos, das auffällig dem in den frühen Gedichten Brauns ähnelt. Dennoch wird das Pathos bei Kolbe durch sehr widersprüchliche Gefühle gebrochen. Es beherbergt gleichzeitig eine polemische Haltung gegenüber Braun, die nicht auf Anhieb erkennbar ist. Im dritten Gedichtband Brauns Gegen die symmetrische Welt (1974) finden wir ein zweizeiliges Gedicht, das eher einem Aphorismus gleicht:
Jeder Schritt, den ich noch tu,
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaareißt mich auf.188
Der zitierte Satz ist bei Braun Ausdruck einer schmerzhaften aktivistischen Einstellung. Wenn Kolbe darauf Bezug nimmt, ist die Betonung anders. Dort heißt es: „Jeder Weg macht mich wirr“. Sein lyrisches Ich nimmt Gestalt an und sucht nach Orientierung. Es macht seine ersten zögerlichen, suchenden und teilweise schmerzhaften Erfahrungen mit der Welt. Kolbes Gedicht stellt einen Akt der Selbstklärung dar, die in den Spannungen zwischen dem, was er wirklich erlebt hat (und jener Volker Braun der sechziger Jahre ist Teil dieser Erlebnisse), und den hohen Ansprüchen, die das Leben stellt, sowie dem Glück, das es mit sich bringen soll, verwurzelt sind. Alles ist immerfort abhängig von der Desillusionierung, die wiederum unterschiedlich produktiv genutzt werden kann.
Kolbes theoretische Äußerungen offenbaren – im deutlichen Gegensatz zu allen anderen jungen Lyrikern –, daß er seine Beziehung zu Brauns Ton und Stil im Laufe der Jahre gewissermaßen historisiert hat. 1979 bemerkte er in einem Rundtischgespräch mit anderen jungen Lyrikern:
Meine Generation hat die Hände im Schoß, was engagiertes (!) Handeln betrifft. Kein früher Braun heute.189
1985 bekannte er in der Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung seine frühe Affinität zu Braun: „Vermutlich habe ich doch verschiedenen Grammatiken angehört im Laufe der Zeit, z.B. der Volker Brauns […]“, wobei er unter „Grammatik“ eine „Grammatik des Denkens“ versteht, die „sich zwischen bestimmten Begriffen bewegt, die seine Versatzstücke des Denkens“ sind, und an denen man hofft, „Sinn zu pumpen“.190
Während für Kolbe eine Lyrik im Stile des jungen Braun nicht mehr möglich war, offenbaren die Texte zweier anderer Lyriker, die einen beträchtlichen Ruf erlangt und einen eigenen Beitrag zu den Entwicklungen in der jüngsten DDR-Lyrik geleistet haben, eine andere Haltung. Steffen Mensching und Hans-Eckardt Wenzel sind sehr vielseitige Autoren, Schauspieler, Komödianten und Sänger. Als Lyriker sind sie bestrebt, direkt in gesellschaftliche Prozesse einzugreifen, die Aufmerksamkeit auf Konflikte in der Gesellschaft zu lenken und mit ihren spezifischen Mitteln zu deren Lösung beizutragen. Wie in Volker Brauns früher Lyrik bewegt sich das lyrische Ich bzw. das lyrische Wir z.B. in Menschings Gedicht „Vollgas“ zwischen bildhafter Bestandsaufnahme und Appell.
In den historischen Autos,
Mit Kippen, Flaschen, rissigen Fahnen,
So eilig, immer, so haltlos
Schlittern wir über die Autobahnen
Und lassen das Haar wehn,
Verliebt ineinander, einander verhaßt,
Mit Zähnen, Fingern und Zehn
Gekrallt in die knatternde Unrast.
Ach, so laut, ohne Rollgurt,
Singen wir unsre elegischen Lieder,
Doch im Vollgas, im Endspurt
Rolln wir die Jammerkatzen nieder –
Dann platzen die Reifen
Und schleudern die Freunde ums Leben –
Wir treten die Bremsen, sie keifen
Bis schlotternd am Asphalt wir kleben.
Wir müßten uns, so sagen wir,
Verbiegen, verbieten oder erschlagen,
Hätten wir weniger, hier,
Sagen wir, zu leben, oder zu sagen.191
In einem Artikel hat der Autor die Grundhaltung vieler seiner Gedichte beschrieben, und dies würde mit Sicherheit „Vollgas“ einschließen:
Ich appelliere an niemanden, sondern versuche meine Fragen zu formulieren – und auch diese nicht manifestartig-erklärend, sondern durch konkrete, prosaische Vorgänge, die, seltsam skurril gelegentlich, auf etwas verweisen, das nicht als verbal festgemachte Aussage, Botschaft in ihnen steht […] Ich versuche so, Handlungen aufzeigend, Haltungen vorzustellen, zu denen sich der Leser/Hörer in Beziehung setzen kann.192
Die Betonung im Gedicht „Vollgas“ liegt auf einer Dynamik, die vorwärtsdrängt, um einen mächtigen Gemeinschaftssinn zu schmieden. Die Beschreibung einer jugendlich unbekümmerten Fahrt auf der Autobahn bei halsbrecherischer Geschwindigkeit vermittelt in ihren Bildern der Ausschweifung Elemente einer ironischen Selbstkritik: „verliebt ineinander, einander verhaßt“, „singen wir unsere elegischen Lieder“, „Jammerkatzen“ etc. Einerseits entstehen die letzten vier Zeilen aus dem Bild, das in den ersten 16 Zeilen entworfen wurde, andererseits können sie auch für sich selbst stehen:
Wir müßten uns, so sagen wir,
Verbiegen, verbieten oder erschlagen,
Hätten wir weniger, hier,
Sagen wir, zu leben, oder zu sagen
Es ist erstaunlich – insbesondere im Vergleich zu anderen jungen Lyrikern –, wie es Mensching gelingt, eine Haltung zum Leben, die die Grundlage des aktivistischen lyrischen Pathos des Volker Braun zu Beginn der sechziger Jahre ist, praktisch ungebrochen und gewissermaßen ohne jegliche historische Distanz zu vermitteln.
Der Bezug auf die „Freunde“ als einer Gemeinschaft gleichgesinnter Geister, ähnlich ungeduldiger Zeitgenossen, war für einen großen Teil der frühen Lyrik Volker Brauns charakteristisch. In diesem Kontext kommt einem sofort sein berühmtes Gedicht „Ilmtal“ in den Sinn. Bei Mensching und Wenzel finden wir eine ähnliche Art des Appells aus einer – oder an eine – Gruppe, wie z.B. im folgenden Gedicht ohne Titel von Wenzel:
IN MEINEM KOPF, das da, sperrt sich,
Gegen, was es braucht, Strom, also Ufer;
Gegen, das es schlägt, ein Meer, Land.
Mein kreditwürdiges know-how loben Dispatcher.
Fremd gehe ich fremd.
Schmuggler, Ohren und die anderen
Sinne, die mich beliefern, sattfüttern
Mit Staatsgeheimnissen, den alten
Weisen, Bleioxid, machen mich
Gegen mich aufsässig.
Jeder hat Recht. Wie nur ein Mann,
Energisch, stehn viele Männer
Vor dem Infarkt, im Wohngraben,
In der allergischen Epoche. Volker hört
Die Signale. Wer ist Volker? Fragt Volker.
Auf und ab, in historischen Kleidern
Gehn meine Freunde, Sklerosen im Anzug, und hoch
Die gekräuselte Füllung der Köpfe, Aldehydgruppen spalten
Sie hoffnungsgeladen, reden mir
Ein und aus die Entscheidungen.
In meinem Kopf, aber das, gegenwärtig,
Verhornt, verballhornt, das da, das
Schmerzt, dauernd, das sich sperrt,
Gegen, was es braucht, Ufer, also Fluß,
Gegen, das es schlägt, ein Mehr, Land.193
Dieses Gedicht von Wenzel aus dem Band Lied vom wilden Mohn (1984) ist eines aus einer Gruppe von sechs Gedichten für Hölderlin, die „Grenzen“ genannt ist. Zuerst wird man daran erinnert, daß Volker Braun in seinen frühen Gedichten auch eine starke Affinität zu Hölderlin erkennen ließ. Das Objekt in Wenzels Hölderlin-Gedicht ist die widersprüchliche alltägliche Erfahrung in einer Zeit, die – wie Braun und Mensching sagen würden – noch nicht die wirkliche ist. Im dritten Vers verwendet Wenzel eigenschöpferisch den Begriff der „allergische[n] Epoche“ und fährt fort:
Volker hört
die Signale. Wer ist Volker? Fragt Volker.
Der Satz „Volker hört die Signale“ ist aufrüttelnd: Er erinnert an den revolutionären Appell der „Internationale“:
Völker hört die Signale, auf zum letzten Gefecht […].
Anscheinend zufällig, aus Unachtsamkeit, wird „Völker“ zu „Volker“, und ein Appell wird zu einer Feststellung:
Volker hört die Signale.
Jeder, der immer noch nicht bemerkt hat, was für ein subversives Spiel der Autor mit dem veränderten Vokal treibt, wird durch das folgende „Wer ist Volker? Fragt Volker“ völlig irritiert oder aber ins Bild gesetzt. Zwanzig Jahre nach Brauns frühen ungeduldigen und kritischen Signalen aus der täglichen Welt des Sozialismus nimmt Wenzel sie als seine an. Im Gegensatz zu Brauns dröhnendem Ton in den frühen Sechzigern (wir brauchen nur an sein Gedicht „Kommt uns nicht mit Fertigem“ zu denken) nimmt Wenzels Gedicht einen elegischen Ton an. Die „Signale“ – um im Bild zu bleiben – eines Volker Braun wurden kaum gehört; der letzte Kampf, der Aufbau einer wahrhaft sozialistischen Gesellschaft, die dieser Bezeichnung würdig ist, stellte sich als eine längere und viel kompliziertere Aufgabe heraus als gedacht und eingestanden.
Bei dem bislang Diskutierten wurde eine entscheidende Frage nicht beachtet: Brauns charakteristische Sprachverwendung und das Ausmaß, in dem junge Lyriker heute davon beeinflußt werden oder eben nicht. Sowohl Menschings als auch Wenzels Gedicht beinhaltet Elemente in der Behandlung von Sprache, die auf eine direkte und beabsichtigte Beziehung zu Braun verweisen. Das wird in der besonders engen Beziehung zur Alltagssprache und zum gesprochenen Wort deutlich, in der Verwendung von umgangssprachlichen Wendungen, in Menschings Gedicht: „über die Autobahn schlittern“, „schlotternd am Asphalt kleben“ oder bei Wenzel: „Verballhornt“. Mit der Sprache wird gespielt, um die intellektuelle Lethargie zu zerschmettern. „Fremd gehe ich fremd“ lesen wir bei Wenzel, „Und schleudern die Freunde ums Leben“ bei Mensching.
Ein weiterer Punkt ist, daß die Texte von Mensching und Wenzel – womit sie bewußt in der Tradition von Braun stehen – speziell für die Lesung vor Publikum geschrieben wurden. Das bedeutet, daß Sätze und Wendungen durch Interpunktion, die die rhythmische Abfolge der Gedanken zu organisieren hilft, so aufgebrochen werden, daß sich die volle Wirkung eines Gedichts erst entfaltet, wenn es laut gelesen wird. Wir sehen dies in den letzten vier Zeilen des Gedichts von Mensching:
Wir müßten uns, so sagen wir,
Verbiegen, verbieten oder erschlagen,
Hätten wir weniger, hier,
Sagen wir, zu leben, oder zu sagen
Bert Papenfuß-Gorek – Abwendung von Braun?
Die Ausprägung der lyrischen Sprache bei einer Reihe von jungen Dichtern der achtziger Jahre direkt mit deren Haltung Volker Braun gegenüber in Beziehung zu setzen, würde in die Irre führen. Bert Papenfuß-Gorek (*1956) ist einer jener Lyriker, die sich nicht nur von Brauns Dichtung distanzieren oder sie völlig abgelehnen, sondern die auch andere junge Autoren wie Mensching oder Wenzel, die sich selbst in der Schreibtradition von Braun sehen, in konfrontativer, teils verletzender Weise geschmäht haben.
Es muß gesagt werden, daß das traurige Schicksal von Bert Papenfuß-Goreks Gedichten in der literarischen Landschaft der DDR in den achtziger Jahren charakteristisch für zahlreiche Werke von jungen Autoren ist, denen aufgrund von bornierten kulturellen und politischen Vorschriften und Kontrollen eine Öffentlichkeit im eigenen Land weitgehend verweigert wurde. Als 1988 sein dreizehntanz endlich durch Gerhard Wolf im Aufbau-Verlag veröffentlicht werden konnte, hatte Papenfuß-Gorek schon 15 Jahre als Autor hinter sich und sechs Gedichtbände oder -sammlungen fertig, die entweder in der Bundesrepublik erschienen waren oder von ihm im Selbstverlag veröffentlicht wurden. Der in der DDR publizierte Band gibt nur eine ungenaue Ahnung der Entwicklung der verschiedenen intellektuellen und poetischen Phasen, die er durchlaufen bzw. hinter sich gelassen hat.
Um für einen Augenblick zu Volker Brauns Dichtung zurückzukehren: Wir können sehen, daß Papenfuß einige Vergleichspunkte anbietet: Auch er verwendet alltägliche umgangssprachliche Ausdrücke als poetisches Element. Aber während Braun oft alltägliche Ausdrücke aus dem Bereich der politischen und ideologischen Propaganda verwendet, greift Papenfuß oft auf Jargon zurück, auf Schlagwörter niederer Sprachebene, die in einem Gedicht immer das konservative Zartgefühl des Durchschnittslesers verletzen. In ähnlicher Weise wie Braun sorgt sich Papenfuß darum, daß seine Dichtung den gängigen Sprachgebrauch in Frage stellen und kritisieren, platte Ideen und ,glatte‘ Ausdrücke erschüttern soll, die der tägliche Gebrauch in bedeutungslose Klischees poliert hat. Er arbeitet auf eine Weise mit Wörtern, die sie ihre gewohnte Bedeutung verlieren läßt, er verändert sie und gibt ihnen einen frischen begrifflichen Kontext. Während für Braun dieser Prozeß grundsätzlich an die Sprechbarkeit, den Vortrag des Gedichts gebunden ist, findet man bei Papenfuß in der Herangehensweise zwei grundlegende Unterschiede. Einerseits ist er oft mehr am Wie, daran, in welcher Weise ein Gedicht gemacht ist, als am Was, dem Inhalt dessen, was ausgedrückt wird, interessiert. Eine seiner zentralen Thesen lautet:
in normalen zwischenmenschlichen Kommunikationen läuft alles viel diffuser ab, du achtest auf die Gestik, Mimik, daraus erfährt man mehr als aus dem, was gesagt wird. Also aus dem Wie erfährt man eigentlich viel mehr als aus dem Was.194
Der zweite Unterschied liegt in der typographischen Organisation des Textes. Papenfuß glaubt fest daran, daß man sich keinen adäquaten Eindruck von einem lyrischen Text machen kann – er nennt es „sichtbar gemachte Sprachbewegung“ –, bis er wirklich gedruckt wurde. Das Gedicht „jede uhr isn zeitzuender“195 demonstriert, was das praktisch bedeuten kann:
Dieses Gedicht, einer der relativ leicht zu interpretierenden Texte des Autors, ist nur verständlich, wenn man seine visuelle Form auf dem Papier in Betracht zieht. Die Beziehung des Lyrikers zum Standard bzw. zur standardisierten Grammatik, Semantik und Orthographie ist außerordentlich ambivalent. Indem Papenfuß die Wörter und Buchstaben eines Gedichts in einer Weise arrangiert und organisiert, die in der DDR-Lyrik ein Novum ist, versucht er, seinen Gefühlen Ausdruck zu geben. Er bildet sie im wörtlichen Sinne ab, bevor sie in abstrakte, feste Konzepte und Konstruktionen gerinnen können. Die Wörter sind sozusagen beim Wort zu nehmen; es geht – ganz wörtlich – darum zu zeigen, was in ihnen steckt. In seiner Art, die Wörter und den Text zu arrangieren, lauert, wie es Karl Mickel ausdrückte, „um jedes Wort ein mehr oder weniger großes Rudel anderer Bezeichnungen […]“.196 In dieser Beziehung ist Papenfuß der konsequenteste aller jungen Autoren, die diesen Trend in der jüngsten DDR-Lyrik repräsentieren.
Das anfängliche prinzipielle Mißtrauen, das man bei Papenfuß und anderen jungen DDR-Lyrikern findet – weitere Beispiele sind Stefan Döring (*1954), Rainer Schedlinski (*1956) und Eberhard Häfner (*1941) –, gegenüber allem, was ihnen in sprachlich fixierter Form ausgehändigt wurde, wurzelt nicht nur in den weiter oben erwähnten biographischen und ideologischen Faktoren, sondern es entspricht ihren philosophischen Interessen. Die starke und auch theoretisch motivierte Aufmerksamkeit, die die jungen Lyriker der kognitiven und kommunikativen Funktion der Sprache schenken, verbirgt nicht ihren intellektuellen Anknüpfungspunkt an die Diskussionen der modernen bürgerlichen Philosophen wie Habermas, Foucault oder Wittgenstein. Deren philosophische Befunde über das gestörte Verhältnis zwischen Sprache und Realität als Ausdruck einer wachsenden Entfremdung in der modernen Gesellschaft erscheint generell im Kontext zeitgenössischer Lyrik als das philosophische und theoretische Korrelat zur Krisenerfahrung junger Lyriker in der sozialistischen Gesellschaft der DDR. Gerhard Wolf, der ein großes Wissen über die jungen Lyriker heute hat und viel getan hat, um sie zu ermutigen (genau wie im übrigen Franz Fühmann zu seinen Lebzeiten), hat sie und die besonderen Qualitäten ihrer Arbeit treffend beschrieben:
Ihre Psychogramme sind noch nicht geschrieben, aber daß diese Generation der um die Mitte der fünfziger Jahre Geborenen einen Konflikt aufreißt, der oft geleugnet wird, indem sie die Verhältnisse nicht aus ihren Realitäten, sondern aus ihren Äußerungen und Verlautbarungen heraus konstatieren, die geläufigen Wörter für sich neu buchstabieren – es wird an ihren Arbeiten sichtbar. Man mag sie leugnen, mißachten, als Dichtung verwerfen; als Warnung überhören. Ihre Zeichen – sprachlich, graphisch und musikalisch intoniert, oft in seltener Kommunikation miteinander – sind authentisch; mit ihnen kündigt sich eine andere Seh-, Empfindungs- und Denkweise an, um so dringlicher, je weniger sie sich in Lamento oder Larmoyanz verlieren.197
Die in dieser Untersuchung dargestellten Prozesse sind freilich nicht auf die Autoren der jüngeren Generation einzugrenzen. Auch Braun hat in seiner Lyrik in den späten Siebzigern und in den Achtzigern mit verschiedenen lyrischen Techniken, Textstrukturen und lyrischen Ansprachearten experimentiert – wie z.B. in den „Material“-Texten aus Langsamer knirschender Morgen (1987). Bei ihm ist es Ausdruck zunehmender Distanz, der Verabschiedung von früheren Sicherheiten und Haltungen in Bezug auf die DDR und dem durch die Partei- und Staatsführung repräsentierten Konzept des Sozialismus, das er mit wachsender Schärfe kritisierte.
Ingrid Pergande, Vortrag, gehalten auf der Konferenz Socialism and the literary imagination, University of Kent at Canterbury im April 1989.
Aus Ingrid Pergande, Ulrich Kaufmann (Hrsg.): „Gegen das GROSSE UMSONST“. Vierzig Jahre mit dem Dichter Volker Braun, Berlin und Jena, 2009
Peter Böthig: Stasi als Thema in der Literatur – Killersatelliten im Schrebergarten. Dichter, Informanten und Schmetterlinge im Prenzlauer Berg. Vortrag am 19.6.2002 in der Eberhard Karls Universität Tübingen.
Andreas Koziol: Vortrag. Staatsgeheimnis und Sprachgeheimnis. Zur Untergrunddichtung der späten DDR.
„ich fühle mich in grenzen wohl“ – Lyrik aus Berlin-Ost
am 12.3.1987 im LCB
Lesung: Sascha Anderson, Andreas Röhler und Michael Rom
Moderation: Ernest Wichner
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + KLG + IMDb +
Gegner + U. K. + E. E. + noch einmal + Förräderi + Anatomie
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer +
Dirk Skibas Autorenporträts + Robert-Havemann-Gesellschaft +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
Sascha Anderson antwortet auf die Standartfragen von faustkultur.
Fakten und Vermutungen zur Herausgeberin + KLG + IMDb +
Archiv + PIA + weiteres 1, 2 & 3 +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Galerie Foto Gezett 1, 2 & 3 +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Poesie des Untergrunds – Eröffnung der Ausstellung am 21. November 2009.
Bert Papenfuß, einer der damals dabei war und immer noch ein Teil der „Prenzlauer Berg-Connection“ ist, spricht 2009 über die literarische Subkultur der ’80er Jahre in Ostberlin.
Poesie des Untergrunds – Prenzlauer Berg kontrovers – Trailer zum Dokumentarfilm.
Poesie des Untergrunds − Die Literaten- und Künstlerszene Ostberlins 1979 bis 1989. Eine Ausstellung in der Kunstsammlung Jena vom 13. März bis 23. Mai 2010.



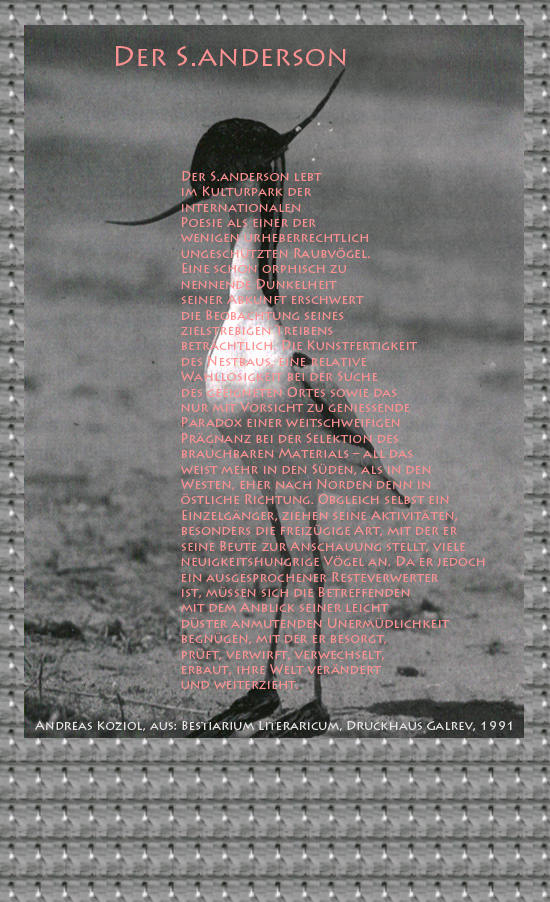

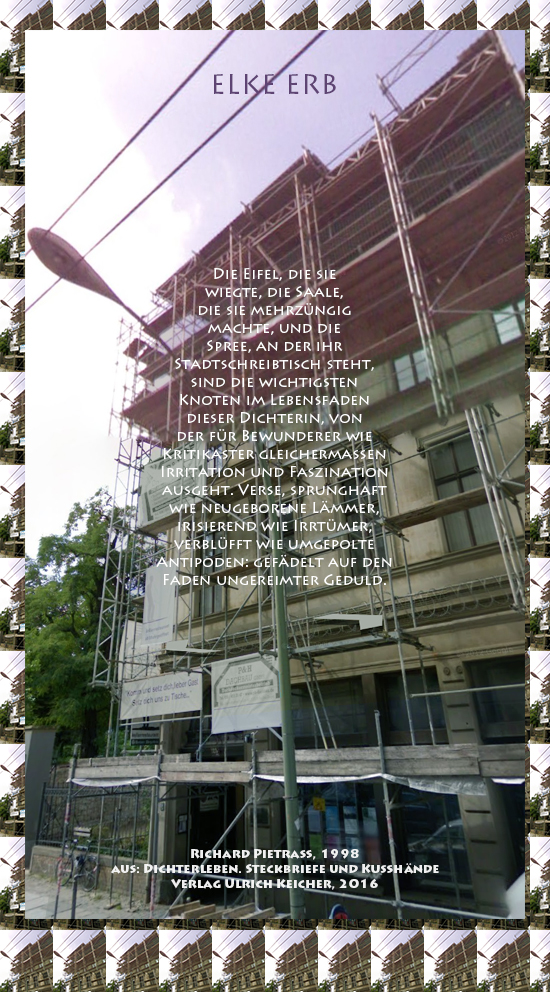












Schreibe einen Kommentar