Stephan Hermlin: Nachdichtungen
KRITIK DER DICHTUNG
Das Feuer erweckt den Wald
Die Stämme die Herzen die Hände die Blätter
Das Glück in einen Strauß gebunden
Verwirrt sehr leicht schmelzend gesüßt
Ein ganzer Wald von Freunden
Der sich versammelt bei den grünen Fontänen
Der guten Sonne des flammenden Waldes
GARCIA LORCA WURDE HINGERICHTET
Haus eines einzigen Wortes
Und Lippen zu leben vereint
Ein ganz kleines Kind ohne Tränen
In seinen Augäpfeln aus verlorenem Wasser
Das Licht des Künftigen
Tropfen für Tropfen erfüllt es den Menschen
Bis an die durchsichtigen Lider
SAINT-POL-ROUX WURDE HINGERICHTET
Seine Tochter hat man gepeinigt
Eisige Stadt aus ähnlichen Ecken
Wo ich träume von blühenden Früchten
Vom ganzen Himmel und von der Erde
Wie von Jungfrauen die sich entblößten
In einem Spiel das niemals endet
Welke Steine echolos Mauern
Ich vermeide euch um ein Lächeln
DECOUR WURDE HINGERICHTET.
Paul Eluard
Gespräch mit Stephan Hermlin
Stephan Suschke: Was bedeutete das Ende der Weimarer Republik für Sie?
Stephan Hermlin: Diese letzten Jahre der Weimarer Republik waren eine Gewissensprüfung für zahllose Deutsche, besonders für die junge Generation. Ich habe ein humanistisches Gymnasium besucht. Der Moment der Politisierung kam etwa mit 14, 15 Jahren. Die Weltbühne hat eine ziemliche Rolle gespielt, als ich ein Junge war. Sie war das Linkeste, was in unserem Haushalt gelesen wurde. Mein Vater, ein konservativer, wenn auch liberaler Mann, begründete das Vorhandensein der Weltbühne bei uns zu Hause mit dem sehr guten Stil, in dem sie geschrieben war. Die aktuelle Politik spielte darin eine große Rolle, sie wurde für mich erklärt und leuchtete mir ein, so wie sie da dargeboten wurde. Die Weltbühne setzte sich für politische Gefangene ein, die ja praktisch nur auf der Linken zu finden waren. Ich kann mich erinnern an den Kampf um das Leben von Sacco und Vanzetti, daß ich auf der Straße in Tränen ausbreche, weil ich die Schlagzeilen der Zeitungen sehe: Sacco und Vanzetti hingerichtet. Ich hatte den naiven Glauben von früh an, und der ist mir auch geblieben, daß man durch sein Eintreten für bestimmte Leute, ihre Verteidigung, viel erreichen kann. Ich bin dahin gedrängt worden, und kurz darauf, also etwa in meinem 15., 16. Lebensjahr, wurde dann der Faschismus zur entscheidenden Frage in Deutschland. Er hatte innerhalb kürzester Zeit einen ungeheuren Aufschwung. Man muß sich vorstellen, daß die Nationalsozialisten nach den Reichstags-Wahlen 1928, also in meinem 13. Lebensjahr, zwölf Abgeordnete hatten, und genau zwei Jahre später waren es 100. Sie waren damit die zweitstärkste Partei in Deutschland, und dann wurden sie zur stärksten. Das war der absolute Dammbruch, und es konnte sie nichts mehr aufhalten. Die Gymnasiasten, mit denen ich tagtäglich die Schule besuchte, waren zum großen Teil Kleinbürgersöhne, Kinder aus jenen gesellschaftlichen Gruppen, die von der Wirtschaftskrise am schwersten geschüttelt wurden und die millionenfach zu Adolf Hitler überliefen. Ich war der einzige kommunistische Schüler in der ganzen Schule. Meine Mitschüler traten scharenweise der Hitlerjugend, aber auch schon der SA bei.
Suschke: Haben Sie von heute aus eine Erklärung, warum Ihre Mitschüler in die SA oder die Hitlerjugend eintraten und nicht in den Kommunistischen Jugendverband wie Sie?
Hermlin: Weil ihre Klassenherkunft aus dem Bürgertum oder auch Kleinbürgertum sie nicht dazu prädestinierte, Gefolgsleute des Kommunismus zu werden. Sie hatten eine nationalistische Erziehung genossen, der Internationalismus der Kommunisten sagte ihnen nicht zu. Zum Teil hatten sie auch einen, ich würde sagen, beinahe natürlichen Haß auf die Kommunisten, weil sie einen natürlichen Haß auf die Arbeiter hatten. Sie empfanden das Proletariat als etwas Feindliches, eine Masse, eine graue, unausdeutbare Masse von Feinden. Dazu kam noch der hausgemachte Antisemitismus. Auch in dieser Hinsicht waren die Kommunisten verdächtig. Sie gaben sich zuviel mit Juden ab, und es waren zu viele Juden in ihren Reihen, genauso wie in den Reihen der Sozialdemokratie, die auch für sie nicht akzeptabel war. Das Ganze wurde verschärft dadurch, daß der politische Kampf ja weniger auf geistige Auseinandersetzung hinauslief als vielmehr auf Brachialgewalt. In Deutschland bekam das alles innerhalb kürzester Zeit einen ganz militanten Aspekt, man trug die Pistole in der Tasche, auch wir, die Schüler.
Suschke: Sie auch?
Hermlin: Ja. Es war eine meiner ersten Handlungen, daß ich mir eine Pistole besorgte, was nicht so schwer war damals.
Suschke: Und?
Hermlin: Ich habe geschossen. Und ich wurde beschossen. Es war ja auch so, merkwürdig, vieldeutig, daß etwa wir politischen Aktivisten auf der Schule – ich war ein Vereinzelter, der einer großen Masse von politischen Aktivisten gegenüberstand – einen durchaus kameradschaftlichen, kollegialen Umgang miteinander hatten. Zum Beispiel hielten wir gegen die Lehrer zusammen. Wir durften keine politischen Abzeichen tragen innerhalb der Schule, aber draußen, nach der Schule, steckten sich alle sofort welche an – die Deutschen haben immer Abzeichen geliebt. Damals war es einfach eine Pest, jeder Mensch auf der Straße trug ein politisches Abzeichen, entweder das Hakenkreuz oder die sogenannte Wolfsangel, das war die germanische Rune, oder eben Hammer und Sichel beziehungsweise die drei Pfeile bei den Sozialdemokraten, die aber praktisch auf unserer Schule gar nicht existierten. Man trug auch Uniform und begegnete sich nachmittags auf irgendeiner belebten Straße in Berlin, und da verteilten meine Kameraden nationalsozialistische Flugblätter, alle drei oder vier in SA-Uniform und ich in der schwarzen Uniform des KJVD. Wir riefen uns gegenseitig zu, hast du schon Mathe, hast du schon Latein gemacht? Und ich verteilte meine Flugblätter und die ihre. Aber es wäre zum Beispiel niemals zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung deshalb gekommen.
Anders wurde es nach Anbruch der Dunkelheit. In allen deutschen Großstäden, aber besonders in Berlin, begann dann der mehr oder weniger lautlose Bürgerkrieg – schon damals, immer nur stundenweise und nur in der Dunkelheit. Dann schoß man auf Leute, die man nur in Umrissen wahrnahm, und wußte nicht, wer das ist. Man wußte, es sind Nazis. Man konnte die Naziuniform erkennen. Aber ich bin nicht sicher, daß ich da nicht auch auf Schulkameraden geschossen habe und daß die auf mich schossen. Das war dann bei Anbruch des Tages vergessen.
Suschke: In Abendlicht beschreiben Sie den 1. Mai 1933:
Ich sah die Berliner Arbeiter zum Tempelhofer Feld ziehen, Hunderttausende. Ihre Parteien waren aufgelöst, ihre gewählten Führer eingekerkert oder tot oder auf der Flucht, ihre Gewerkschaftshäuser geplündert und besetzt, am Straßenrand stehend sah ich sie vorbeiziehen…
Was war für Sie die wesentliche Erfahrung der Machtübernahme der Nationalsozialisten? Sie waren ja damals schon für Sprache sensibilisiert. Welche Veränderungen bemerkten Sie?
Hermlin: Ich ging nicht von Sprache aus in diesem Zusammenhang. Es war etwas viel Schrecklicheres, sich Aufdrängendes. Es war die Atomisierung unserer Bewegung, der sofort einsetzende und äußerst wirkungsvolle Terror des Nationalsozialismus, der natürlich schon lange vorher geplant war, aber mit einer solchen Konsequenz durchgeführt wurde, wie wir es nicht erwartet hatten. Massiver Mord setzte ein, massive Mißhandlungen von Tausenden von Menschen in den Zentralen der einzelnen Bezirke. Natürlich bereitete ich mich auch auf die Verhaftung vor, die nachher nicht stattfand. Es gab bei mir zwei Haussuchungen, von denen die erste absolut harmlos war, weil sie ausgeführt wurde von Leuten, die keine Nationalsozialisten waren, sondern offensichtlich noch sozialdemokratische Kriminalbeamte.
Die Polizei war zunächst dadurch gefährlich, daß die Nazis sofort die SA umbenannten in Hilfspolizei. Die SA war bewaffnet, trug von diesem Moment an offen ihre Waffen, länger als ein Jahr. Das wurde wieder abgeschafft 1934, nach dem sogenannten Röhm-Putsch, den ich auch in Berlin erlebt habe. Natürlich agierte die Hilfspolizei mehr oder weniger unabhängig von der normalen Polizei. Jeden Abend, nach Einbruch der Dunkelheit, wurde die Situation gefährlich. Sie fuhren auf riesigen Mannschaftswagen umher, sie hatten Listen, sie hielten und holten Sozialdemokraten, Kommunisten und Juden aus den Häusern. Viele wurden schon innerhalb der ersten Tage getötet. Auch die Mittel, mit denen das gemacht wurde, waren von einer enormen Brutalität, die man bis dahin nicht gekannt hatte. Es wurde an den Türen geklingelt, wer nicht sofort aufmachte, dem wurde die Tür eingetreten. Dann holte man die Leute raus, natürlich unter Schlägen, manche zog man an den Füßen die Treppen hinunter, so daß sie mit dem Hinterkopf auf die Stufen aufschlugen. Manche kamen schon tot unten an.
Suschke: Können Sie sich das erklären, warum das mit einer so ungeheuren Brutalität geschah?
Hermlin: Ja. Das war ganz kalt geplant und von ihrem Standpunkt aus richtig, weil sie damit sofort einen großen Teil der politischen Gegner absolut lähmten. Die Menschen wurden derartig verschreckt, daß also Tausende und Abertausende, die vorher politisch aktiv gewesen waren, gegen den Faschismus, von diesem Moment an nichts mehr mit dem Antifaschismus zu tun haben wollten, sondern sich vollkommen unterwarfen. „Man kann nichts machen gegen die“, das war so das Wort, das umging. Ich gehörte zu einer Gruppe von etwa 70 Jungkommunisten und lief in den ersten Tagen schon umher, um sie für die illegale Arbeit zu werben, und erlitt vollkommenen Schiffbruch. Das heißt, ich gewann drei, vielleicht vier Leute, aber fast 70 sagten nein. So war etwa unsere Bilanz. Es sind dann vielleicht noch zwei oder drei dazugekommen, später, so daß von meiner Gruppe von 70 Leuten ungefähr zehn Prozent noch politisch aktiv waren. Zehn Prozent, wenn es hoch kommt.
Suschke: Als 18jähriger begann Ihre Arbeit in der Illegalität, ein Leben mit Masken, mit dem Verstecken von Biographien, auch von Trauer, Schmerz und Verzweiflung. Das Leben natürlich auch mit einer Legende. Es gibt aus dieser Zeit ein überliefertes Gedicht über John Schehr, Indiz für einen Schreibimpuls.
Gab es damals und während der folgenden Jahre, in der Sie die Länder wie die Schuhe wechselten, diesen Impuls, oder wie wichtig war die Illegalität, der Druck dieser Erfahrung für das Schreiben? Gab es damals eine Sehnsucht, später diese Erfahrungen zu beschreiben? Oder haben Sie außer Gedichten anderes geschrieben?
Hermlin: Soweit ich mich erinnere, war mein Impuls zu schreiben immer ziemlich schwach entwickelt. Ja, ich sah mich auch nicht als einen künftigen Schriftsteller. Mein Vater versuchte immer mich zu überreden, ich sollte dasselbe werden wie er, dann könnte ich auch Geld verdienen und könnte ganz unabhängig sein, könnte so viel Kunst machen, wie ich wollte. Aber dazu hatte ich keine Lust und auch keine Begabung. Ich wußte natürlich nicht, was ich werden würde. Bis zu dem Tag, wo plötzlich ein Bekannter der Familie zu mir sagte:
Ja, du mußt unbedingt Bibliothekar werden. Und der von dir so geliebte Hölderlin war auch ein Bibliothekar.
Ja, natürlich, Bibliothekar muß ich werden. Dann habe ich Ruhe, mein ganzes Leben lang Ruhe. Im Grunde genommen wollte ich Ruhe haben und gar keine Aktivität auf der Straße. Bis ich ein paar Gedichte geschrieben habe, die ich dann ernster genommen habe als die albernen Gedichte, die ich bis dahin geschrieben hatte. Ich habe dasselbe getan, was manche jungen Leute tun, ich habe also an einige von mir verehrte Dichter einige Kostproben geschickt – an Benn, an Becher, an Herrmann-Neiße, an Oskar Loerke und an Alfred Wolfenstein, die mir alle wahnsinnig nette Briefe schrieben und mich sehr ermutigt haben, bis auf Becher. Von Becher hörte ich dann übrigens nach 1945 – ich war ja nach 1945 erst mal zwei Jahre in Frankfurt am Main, übersiedelte dann nach Berlin –, daß er zu jemandem, den ich gut kannte, gesagt hatte:
Hermlin – bedeutender Dichter? Ach was! Ja, Rudolf Hagelstange, das ist ein bedeutender Dichter.
Also das hat keine Rolle in meinen Überlegungen gespielt. Die meisten Sachen, die ich geschrieben habe, waren für die illegale Presse. Das sind verlorene kleine Dinge. Abgesehen von diesem einen Gedicht, das ich 1934 geschrieben habe, das war in Berlin nach dem Mord an John Schehr und den drei anderen. Die wurden abtransportiert und am Kilometerberg in Potsdam erschossen.
Suschke: Das hat Sie politisch so stark beeindruckt, daß Sie darüber was schreiben wollten oder mußten?
Hermlin: Nein, ich wurde angeregt. Der Mann, der mir Befehle gab, der mir übergeordnet war, sagte:
Hör mal, die haben den John Schehr erschossen, du könntest doch darüber mal ein Gedicht schreiben, das werden wir in unserer Presse veröffentlichen.
Darauf antwortete ich:
Ja gut, ich werde es versuchen.
Ich schrieb mit großer Leichtigkeit. Wenn man ganz jung ist, hat man da gar keine Hemmung. Ich habe dieses Gedicht auch gleich abgeliefert, aber nie erfahren, ob das irgendwo veröffentlicht worden ist.
Suschke: Gab es niemals die Sehnsucht damals, irgendwann beschreib ich diese Erfahrung, diesen ungeheuren Druck?
Hermlin: Nein. Vielleicht dachte ich manchmal an Schreiben, aber wenn ich überhaupt daran dachte, dann mußte es etwas vollkommen anderes sein. Gerade nicht die Wirklichkeit, nicht die politische Wirklichkeit.
Suschke: Gab es eine Sehnsucht nach Schönheit oder nach Harmonie zu jener Zeit?
Hermlin: Ja, immer. Immer. Das ist sehr ausgeprägt, und ich war deshalb immer in einem konstanten, furchtbaren Gegensatz zu meinem Alltag. Im Grunde genommen war bei mir immer sehr stark, von Anfang an, der Wille – auch der Beweggrund, warum ich eingetreten bin in den Kommunistischen Jugendverband –, genau das Gegenteil von dem zu machen, was meiner Natur eigentlich entsprach. Denn in Wirklichkeit wollte ich gar nichts von Straßenkämpfen wissen.
Suschke: In Abendlicht gibt es die Beschreibung des 1. Mai 1933:
Der Gedanke, geschmäht und belogen zu werden, mischte sich in das Bewußtsein der Ohnmacht und Sprachlosigkeit; ein Hauch von Fäulnis wehte über die mit Lautsprechern und Blaskapellen brüllende Stadt. Furchtbar spürte ich einen Augenblick lang diese Fäulnis in mir selbst: wie ein Nordlicht der Zersetzung wogte in mir der Wunsch, unter den Marschierenden zu sein, mich mit ihnen treiben zu lassen, von der gleichen Macht getrieben zu werden, die sie beherrschte.
Sie befanden sich ja als Kommunist im Widerspruch, vielleicht sogar im Kriegszustand zum größten Teil der deutschen Bevölkerung. Was bedeutet die Erfahrung für die Zeit nach 1945?
Hermlin: Dieses Gefühl des Isoliertseins oder einer Minderheit anzugehören, hat verschiedene Etappen durchgemacht. Auch ganz unsinnige, wie, daß man plötzlich glaubte, man wäre ein Vertreter der Mehrheit. Weil man sich Deutschland – obwohl man ja täglich mit dem Gedanken an Deutschland lebte – nicht mehr real vorstellen konnte. Es gab Momente der wahnwitzigen Illusionen, wo sich alles umkehrte: Jetzt haben die Massen erkannt, daß wir recht hatten und Hitler das Verderben Deutschlands ist.
Aber das Gefühl der Vereinzelung oder, sagen wir, das Gefühl der Minderheit, das wandelte sich, aber es blieb erhalten. Das verschärfte sich. Denn ich erkannte nach doch ziemlich kurzer Zeit, daß ich innerhalb meiner eigenen Partei zu einer Minderheit gehörte, die immer mehr Minderheit wurde. Ich habe später darüber nachgedacht, wieso ich niemals ausgeschlossen wurde. Denn ich war reif zum Ausschluß. Ich kann es mir nur so erklären, man schwankte zwischen Nicht-ernst-Nehmen und Sehr-ernst-Nehmen – was sich ja aus bestimmten KGB- und MfS-Akten später ergab, in denen ich als Feind gekennzeichnet war. Aber zugute gehalten wurden mir immer bestimmte mutige Haltungen in bestimmten Momenten. Das wurde mir hoch angerechnet.
Suschke: Haben Sie mit Honecker mal über die Zeit vor 1945 gesprochen? Oder war das weg?
Hermlin: Nein, es hing auch mit dem Charakter unserer Gespräche zusammen. Die hatten schon angefangen vor seiner Machtergreifung, als er noch der zweite Mann in der Partei war. Er hat viel für mich übrig gehabt und war zu mir sehr herzlich, sehr kameradschaftlich. Und daran halte ich auch fest, obwohl mir erst später, erst in den letzten Jahren bekannt wurde, daß manches, was gegen mich geplant wurde und was es an Überwachungen gab, auf seinen Befehl zurückging. Ich kannte zu viele Menschen, auch Nichtkommunisten, und ich kannte sehr viele Leute im westlichen Ausland. Es war bekannt, daß ich ständig, bei allen möglichen Gelegenheiten, in den Botschaften verkehrte, und zwar gerade bei den Amerikanern, bei den Engländern. Und das wurde sicher nicht gerne gesehen. Alle diese Dinge haben dazu geführt, daß er Mielke anwies – das haben wir in einem Dokument gefunden –, mich zu überwachen.
Ich ging immer aus ganz konkreten Anlässen zu ihm: Entweder wollte ich jemanden aus dem Gefängnis holen, oder ich wollte ein Buch aus dem Gefängnis holen. Das waren die zwei Anlässe. Das lief darauf hinaus, daß ich im Jahr ungefähr drei- bis viermal bei ihm war. Und dann hatte ich auch immer ein bißchen ein schlechtes Gewissen, weil ich mir ja vorstellte, der arme Mann ist von früh bis abends mit allen möglichen Leuten beschäftigt. Ich habe mich stets möglichst kurz gefaßt. Ich sagte immer:
So, das ist alles, was ich dir sagen wollte, jetzt will ich dich nicht weiter aufhalten, ich gehe.
Und im allgemeinen nahm er das auch dankbar entgegen und ließ mich gehen, mit einer Ausnahme, wo er mir plötzlich sagte:
Nein, halt, warte. Ich möchte noch etwas mit dir besprechen, und heute habe ich Zeit.
Das war nach dem 21. August 1968. Er wußte, daß ich Partei ergriffen hatte für Dubček. Er wußte ganz sicher, daß ich dem tschechoslowakischen Botschafter einen Brief geschrieben hatte, auch hatte ich der BBC ein Interview gegeben, das sogleich veröffentlicht wurde und in dem ich gegen den Einmarsch in Prag protestierte. Er wollte meine Meinung über die Tschechoslowakei wissen. Meine erste Antwort war:
Die kennst du doch, die haben dir deine jungen Leute doch längst mitgeteilt.
Damals war er noch der Mann für die Sicherheit im Politbüro. Er sagte daraufhin:
Ich möchte es aber von dir hören.
Und dann ergab sich ein Gespräch von zwei bis drei Stunden, das für meinen Begriff katastrophal ausging, weil er als äußerstes Argument gegen mich Dinge sagte, von denen er in aller Ehrlichkeit annahm, daß ich nichts davon wüßte:
Ich sage dir jetzt Sachen, die ich dir eigentlich gar nicht sagen darf. Ich bitte dich, sie für dich zu behalten. Es stehen amerikanische Truppen in Prag, unmittelbar vor der Stadt. Truppen der Bundeswehr sind über die Grenze gekommen. Wir haben geheime Waffenlager gefunden.
All das kannte ich schon längst aus der Presse, auch aus der kommunistischen Presse, zum Beispiel in L’Humanité und Les Lettres françaises von Aragon. Aragon, der ein enger Freund von mir war, nahm von Anfang an einen scharfen Standpunkt gegen die Besetzung der Tschechoslowakei ein. Ich kannte also alle diese Geschichten, diesen Schwindel und wußte, woher er kam. Und in dem Moment, das war – wie man auf englisch sagt – ein crucial point in unseren Beziehungen, begriff ich plötzlich, in welcher aussichtslosen Lage wir waren. Wir waren Politikern ausgeliefert, die an ihre eigenen Hirngespinste glaubten. Und die sie auch durchsetzen konnten. Die sie in Realität verwandeln konnten. Da sagte ich mir, wir sind verloren.
Suschke: In einem Text über Becher zitieren Sie aus seinem Gedicht „Die Heimat“:
Als ich aus Deutschland ging, nahm ich mit mir ein Bild,
Oft sucht mein Auge jetzt festzuhalten sich dort,
Wo inmitten der Hügel Urach liegt.
Hängt Ihre Liebe zu Deutschland, zur deutschen Sprache, nicht auch mit dem Exil zusammen?
Hermlin: Natürlich. Im Exil war es so: Ich las, sooft ich konnte, die Nazipresse. Der Völkische Beobachter oder andere Zeitungen hingen an bestimmten Kiosken, und das kaufte man sich, las das und war entsetzt. Nicht nur über das, was drinstand, sondern auch, wie es formuliert war. Denn wir hatten natürlich das Gefühl der Überlegenheit auf diesem Gebiet. Das heißt, wo wirklich deutsch gesprochen und geschrieben wurde, das war nicht in Deutschland, sondern außerhalb von Deutschland. Wir verwalteten sozusagen das deutsche Erbe in der Emigration.
Suschke: Kommt die Idee der Goethe-Feier, die Sie 1939 in Paris organisiert haben, auch aus diesem Impuls, aus dem Bemühen heraus, die Kultur zu erhalten?
Hermlin: Ja, selbstverständlich. Es war nicht nur die Goethe-Feier, die ja einige andere mit mir zusammen gemacht haben. Anläßlich dieser Goethe-Feier habe ich Joseph Roth getroffen. Der Referent auf dieser Versammlung war Ludwig Marcuse, ein beachtlicher deutscher Schriftsteller, der in Paris lebte und uns politisch ganz feindselig gegenüberstand. Aber da ließ er sich breitschlagen und machte diese Goethe-Veranstaltung mit. Ja, wissen Sie, es ist schwer zu schildern, aber der Zustand gerade in Paris, wo ja nun eine kolossale Masse lebte – es gab 50.000 deutsche Flüchtlinge in Frankreich, die meisten in Paris, darunter sehr viele Intellektuelle und Schriftsteller –, war bitter: Schon nach kurzer Zeit tat sich eine Trennlinie auf, die Kommunisten auf der einen und die Nichtkommunisten auf der anderen Seite. Zu dieser Spaltung haben natürlich die Moskauer Prozesse enorm beigetragen. Da die Kommunisten sich nicht gegen die Sowjetunion erklären wollten und an ihr festhielten, brachen die anderen ihre Verbindungen zu uns ab, und viele bekannte Schriftsteller nahmen gegen uns Stellung, wollten nicht mehr mit uns verkehren.
Suschke: Wie war Ihre erste Reaktion darauf? Hat man die Sprengkraft, die das später haben sollte, schon damals begriffen?
Hermlin: Ich habe zu den Prozessen in Moskau ein positives Verhältnis gehabt. Das heißt, ich habe sie bejaht, obwohl mir manches daran unerklärlich war, wie vielen, oder schwer erklärlich. Aber: Natürlich arbeitete mein Kopf, wie ist das möglich? Man glaubte Antworten auf Fragen zu finden. Man dachte an die Französische Revolution. Jede Revolution hat ihre Gegner, auch im Lager der Revolutionäre. Siehe das Verhältnis Danton – Robespierre, oder man dachte an die Haltung der deutschen Klassiker. Allesamt begrüßen am Anfang die Französische Revolution, und alle, mit einer Ausnahme, wenden sich von ihr ab. Später kommen dann unbehagliche, neue Gedanken hinzu, vor allem hervorgerufen von Büchners Dantons Tod. Ich erinnere mich noch an einen Moment in der DDR. In den fünfziger, sechziger Jahren, als Kuba schon Dramaturg bei Perten war, sagte er mir:
jetzt bereiten wir im Theater Dantons Tod vor. Aber weißt du, wir haben den ganzen konterrevolutionären Schluß gestrichen und einen neuen Schluß geschrieben.
Suschke: Haben Sie in Paris Münzenberg kennengelernt?
Hermlin: Nein, ich habe ihn nicht kennengelernt, gesehen habe ich ihn, und zwar kurz vor seinem Tode. Aber ich habe nie ein Wort mit ihm gesprochen. Es war sehr komisch. Ich bin ja in der französischen Armee gewesen, aber vorher, als die deutsche Mai-Offensive begann, mußte ich mich internieren lassen. Unser Versammlungsplatz war ein großes Stadion in Paris, und ich war einer der letzten, die in das Stadion kamen. Es war überall angeschlagen, wann man sich einfinden sollte. Ich las das und sagte mir, ich habe noch 48 Stunden Zeit, die letzte Frist, wozu soll ich mir noch zwei Tage mehr Internierung aufhalsen, ich gehe im letzten Moment rein. Und kam dann also auch – und alles war voll: 20.000 Deutsche auf den Tribünen und rundherum Gendarmerie. Ich ging über den Rasen, da lief ein Genosse auf mich zu, der schon längere Zeit da war, und sagte zu mir:
Du, in unserem Block sind Willi Münzenberg und Otto Strasser. Die sitzen beide da oben.
Die saßen nebeneinander, und ich saß eine Reihe unter ihnen. Ich trug, weil das fürs Lager das Bequemste war, schwarze Reithosen und Schaftstiefel. Der Genosse erzählte mir, als Strasser mich gesehen hatte, sagte er zu Münzenberg:
Das ist ja nun das Letzte. Ich als Hitlers Feind Nummer 1 sitze schon seit vier Tagen hier auf dieser lächerlichen Tribüne als Gefangener, und jetzt kommt dieser Bursche einfach so über den Rasen geschlendert. Das sieht man ja drei Kilometer gegen den Wind, das ist Leibstandarte.
Suschke: Haben Sie Münzenbergs Zeitschriften gelesen?
Hermlin: Ich las, noch in der Weimarer Republik, vor allem seine Monatsschrift Der rote Aufbau. Es war eine sehr gut gemachte Zeitschrift. Dann las ich natürlich die auch unter seiner Obhut erscheinende AIZ, die Arbeiterillustrierte, eine wunderbar gemachte Illustrierte. Heartfield war ein entscheidender Mann an der Zeitschrift. Die Fotomontagen bestimmten das äußere Bild. Und dann war sie sehr kostspielig gedruckt. Sie war viel schöner als die bürgerlichen Illustrierten und hatte natürlich auch viel weniger Annoncen.
Suschke: Anfang 1936 waren Sie ja kurz in Palästina, für die Juden das gelobte Land. Was bedeutete die jüdische Kultur für Sie damals, welche Bedeutung hatte Ihre Herkunft für Ihre Identität? In Ihrem Werk spielt jüdische Kultur keine herausragende Rolle. Hängt das mit Ihrer großbürgerlichen Erziehung zusammen?
Hermlin: Ich kannte jüdische Kultur praktisch gar nicht. Sie hat bei uns zu Hause keine Rolle gespielt. Bei uns wurden nur christliche Feste gefeiert. Mein Vater hatte eine kurze Zeit hindurch die Angewohnheit, einmal im Jahr in die Synagoge zu gehen, widerstrebend. Das tat er nur, um seine Mutter nicht zu beleidigen. Das war eine Zeit, eine kurze Zeit, in der wir wieder in meiner Geburtsstadt, in Chemnitz, wohnten. Aber sonst überhaupt nichts. Mein Vater hatte – wenn die Rede auf Religion kam – immer nur diesen Heineschen Vers parat:
Es will mich schier bedünken, daß der Rabbi und der Mönch, daß sie alle beide stinken.
Das war die – sagen wir mal – Stellungnahme eines liberalen Juden. Das hat sich für meinen Vater ganz zweifellos geändert im Moment, als Hitler ans Ruder kam. Ich wohnte damals woanders. Als ich ihn besuchte, fand ich zum ersten Mal auf dem Tisch eine Zeitung liegen, die ich bis dahin nicht gekannt hatte, die Jüdische Rundschau. Das war das Blatt der Zionisten in Deutschland. Und dann sagte mir auch mein Vater, der sich wieder mal mit Max Liebermann getroffen hatte, wie Liebermann zu ihm sagte, in einer abgrundtiefen Verzweiflung:
Wir haben alle unser ganzes Leben in einer Lüge zugebracht. Wir sind keine Deutschen. Wir haben geglaubt, wir wären Deutsche, aber wir sind keine.
Aber das habe ich für mich nie akzeptiert. Palästina war für mich nicht ohne Interesse, das ist ein erstaunliches Land. Und ein winziges Land. Man fährt mit dem Omnibus durch eine Stadt, eine kleine Stadt, und da steht dann plötzlich: Nazareth. Und dann fährt man durch eine andere kleine Stadt und da steht: Betlehem. Betlehem – Haus des Brotes. Was an jüdischer Kultur immer für mich hochbedeutsam war und bis heute geblieben ist, das ist und bleibt die Bibel.
Suschke: Aber Sie haben sich nicht als Jude gefühlt?
Hermlin: Nein.
Suschke: Wurde das aufgefangen durch die kommunistische Bewegung?
Hermlin: Ja, wenn man so will. Aber es hat nie – weder ohne Kommunisten noch mit Kommunisten – für mich eine Rolle gespielt. Außer in einem Punkt. Und in dem bin ich – dieses unangenehme modische Wort – sensibel, und nur darin hat mein Judentum eine Einbettung oder eine Wurzel: Das ist mein Haß auf den Antisemitismus. Ich definiere mich nur auf Grund der Antisemiten als jüdisch.
Suschke: Sie haben geäußert, daß Sie das Gefühl hatten, daß in der DDR Antisemitismus in bestimmten Gesprächen, zum Beispiel mit Funktionären, eine Rolle spielte.
Hermlin: Ja, ich hatte das viele Jahre verdrängt. Wie ich überhaupt natürlich immer alles verdrängt habe, was der kommunistischen Bewegung abträglich sein konnte und was ich deshalb einfach nicht wahrhaben wollte. Aber von einem bestimmten Tag an mußte ich mir eingestehen, es ist überhaupt nicht so: Solange ich in der kommunistischen Bewegung bin, solange bin ich auch auf Antisemiten gestoßen und habe mit ihnen zu tun gehabt. In einem bestimmten Moment bin ich einem der schlimmsten von ihnen in die Parade gefahren, und das hat einen Skandal in der Partei gegeben. Das war Otto Gotsche, der Sekretär von Walter Ulbricht. Gotsche war ein überzeugter Antisemit. Er war Mitglied der Akademie der Künste geworden, Ulbricht wollte ihn als Überwacher. Jahre später kam es dann dazu, daß im Dritten Programm des Fernsehens der amerikanische Holocaust-Film gezeigt wurde, der ja eine ungeheure Wirkung in Deutschland hatte, und zwar in beiden Deutschlands. Es kam daraufhin in der Akademie der Künste zu einer großen Diskussion, man müßte den Amerikanern etwas entgegenhalten. Ich schlug vor, man sollte von den Amerikanern den Film kaufen und ihn auch bei uns aufführen, was aber nicht akzeptiert wurde. Also kam man auf was anderes: Man wollte die antifaschistischen Filme vom Beginn der DDR neu im Fernsehen aufführen. Gotsche äußerte: Ja, er sei dafür, aber man solle die Judenfrage nicht zu sehr betonen. Darauf sagte ich:
Niemand kommt um die Notwendigkeit herum, die Judenfrage betonen zu müssen, weil die nämlich das A und O des deutschen Faschismus war.
Er sagte:
Wir haben eben verschiedene Standpunkte.
Ich entgegnete:
Das hat seine Ursachen. Ich bin der Sohn eines jüdischen Vaters und du bist ein Antisemit.
Dieses Wort wurde in der DDR nicht ausgesprochen oder höchst selten. Er versuchte ruhig zu bleiben:
Ich bin kein Antisemit, ich sehe bloß die Judenfrage vom Klassenstandpunkt aus. Allerdings, wenn
– und dabei wandte er sich mir zu –
wenn ich die Liste der observierten Personen sehe und unter zwölf Namen sechs jüdische entdecke, da mache ich mir schon meine Gedanken.
Ich sagte ihm: „Es gibt das römische Wort si tacuisses“, und unter den Akademiemitgliedern gab es in dem Moment einen Aufstand. Das führte zu einer Debatte im Zentralkomitee, und er bekam eine schwere Rüge.
Suschke: Es gab ja doch eine ganze Menge Leute, die in dieser Zeit, in den fünfziger Jahren, die DDR entweder verlassen haben, Kantorowicz zum Beispiel, oder wie Hans Mayer und Ernst Bloch in die Kritik gerieten. So wurde ein Teil der intellektuellen Elite schließlich aus der DDR weggetrieben, eigentlich ein Indiz für einen Einzug der Mittelmäßigkeit? Wie sind Sie denn damit zurechtgekommen?
Hermlin: Schlecht. Zurechtkommen mußte man sowieso.
Suschke: Es gab 1957 den Prozeß gegen Walter Janka, seit 1952 Leiter des Aufbau-Verlages. In diesem Prozeß waren Anna Seghers, Willi Bredel und auch Helene Weigel geladen. Haben diese mit Ihnen befreundeten Schriftsteller jemals über diesen Prozeß erzählt, im internen Kreis?
Hermlin: Gesprochen wurde schon darüber. Ob ich mich mit Anna Seghers darüber unterhalten habe, kann ich mich nicht erinnern, aber mit Bodo Uhse, mit dem ich sehr befreundet war. Das war jedoch ein Gespräch, das in einer Atmosphäre des Unbehagens vor sich ging.
Suschke: 1962 gab es Ihre Veranstaltung in der Akademie, Junge Lyrik, die ja sehr schnell in das öffentliche Kreuzfeuer der Kritik gekommen ist, und die Absetzung von Peter Huchel als Chefredakteur von Sinn und Form. Es gab eine Sitzung im Staatsrat, mit Schriftstellern und etwa 1.000 Kulturfunktionären mit einem großen Auftritt Alexander Abuschs, der alle möglichen Anklagen vorbrachte. Darunter war die Anklage, in der DDR gäbe es einen geheimen Petöfi-Klub. Walter Ulbricht machte eine Zwischenbemerkung:
Ja, aber da gibt es doch einen Kopf bei diesem Petöfi-Klub?
In dem Moment, als Ulbricht das dazwischenrief, ging es wie ein elektrischer Schlag durch Abusch. Er sprach wie unter Hypnose plötzlich den Satz:
Ja, natürlich gibt es einen Kopf, Genosse Ulbricht, und der heißt Stephan Hermlin.
So eine Bemerkung war geeignet, den so bezeichneten abzuschlagen. Was ging in Ihnen in diesem Moment vor?
Hermlin: In dem Moment dachte ich, ich träume. Nur habe ich doch unterschätzt, daß selbst in dieser belogenen und irregeführten Menge von Parteifunktionären es immer noch Menschlichkeit und menschlichen Verstand gab. Das für mich Wichtigste an diesem Vorgang war die Reaktion des Saales auf den Satz von Abusch. Denn es gab sofort eine Reaktion. Die höre ich noch bis heute, nämlich es wurde gezischt. Das Zischen hört man überhaupt selten von einer Menschenmenge. Und hier war es plötzlich da. Und ich sagte mir, da habe ich doch eine ganze Menge Freunde.
Suschke: Zu Peter Huchel: Es gab in Sinn und Form eine Dokumentensammlung…
Hermlin: Huchel wurde nach dem Erscheinen des sechsten Heftes 1962 als Chefredakteur von Sinn und Form abgesetzt. Ich kannte den Inhalt des Heftes schon vor dem Erscheinen, und zwar durch Huchel selbst. Ich war im Spätherbst 1962 in Moskau, wo ich Sartre traf, der eine grandiose Rede zur Verteidigung Kafkas hielt. Ich bat Sartre um eine Kopie der Rede, die ich übersetzte. Ich brachte diese Übersetzung Huchel mit, der sie noch in das erwähnte sechste Heft aufnahm.
In der Akademie gab es drei Leute, die sich für Huchel aussprachen, nämlich Walter Felsenstein, Herbert Ihering und ich und sonst niemand.
Suschke: Waren Sie mit Huchel nach seiner Entlassung noch befreundet?
Hermlin: Ich sah ihn zum letzten Mal an seinem 60. Geburtstag am 3. April 1963. Wir waren nur vier Gäste: Hans Mayer, Erich Arendt, ich und als vierter sein Arzt. Den schmerzlichen Bruch zwischen uns will ich nicht in einem Interview darstellen. Ich habe ihn tief bedauert und, ich glaube, er auch. Huchel war für mich einer der nächsten Freunde und vielleicht der allernächste.
Suschke: Ende der fünfziger Jahre haben Sie aufgehört, Gedichte zu schreiben, und deuteten die Gründe an. Kann dieses Versiegen, dieses Verstummen mit dem Gefühl einer zu Ende gehenden Illusion zu tun haben?
Hermlin: Nein, das würde ich nicht meinen. Sie haben es schon gesagt, es ist einfach ein Ende der Lyrik. Ich kann das nicht erklären. Es hat mich auch nie so wahnsinnig beschäftigt, daß ich von einem bestimmten Tag an lieber Prosa schrieb als Lyrik. Ich habe meine Sachen sowieso immer ziemlich nachlässig behandelt. Ich habe mich nicht so ernst genommen wie andere Schriftsteller, die sich ausschließlich mit sich beschäftigen. Ich interessierte mich weniger für mich als vielmehr für andere Produzenten. Unter denen, die ich gelesen habe, befanden sich ja viele große Schriftsteller. Und wenn ich das so sehe, diese Ichbezogenheit von Mittelmäßigkeiten, obwohl es Ausnahmen gibt, wie Durs Grünbein oder Wolfgang Hilbig…
Suschke: In einem Interview vermuten Sie, daß Trotzki, wenn er an die Macht gekommen wäre, möglicherweise genauso verbrecherisch gehandelt hätte wie Stalin.
Ist der Mensch der Gefangene seiner Natur, seiner Biologie, seines Körpers, und ist die Hülle, die der Prozeß der Zivilisation geschaffen hat, dünner, als wir glaubten? Oder anders gefragt: Ist die Figur des Kriegers, die Jünger immer wieder beschreibt und beschwört, die wirkliche Natur des Menschen?
Hermlin: Ich habe sicher die räuberische Natur des Menschen, die kannibalische Natur des Menschen unterschätzt. Wenn man sich mit sehr hohen Zielen beschäftigt, wie zum Beispiel den Zielen des Kommunismus, vergißt man natürlich diese Erkenntnisse oder will sie nicht wahrhaben, und man ist um so verzweifelter, je mehr man einsehen muß, daß die Ideale, die man vor sich sah, in einem fürchterlichen Widerspruch stehen zu Realitäten, die das System geschaffen hat, das man gerade auf den Schild erhob oder das man für die Zukunft als das Siegreiche sehen wollte.
Die Lager Stalins waren grauenhaft, haben Millionen vernichtet, wenn auch nicht so absichtsvoll, wie die deutschen Faschisten die Juden vernichtet haben. Es ist eine furchtbare Bilanz, mit der wir noch nicht fertig sind, und wir wissen auch nicht, wie der Übergang beschaffen sein muß und wie lange er dauert, der uns zurückführt in eine Periode, in der man auf neue Weise den großen Idealen nachstreben kann, die die Menschheit beseelt haben. Das wissen wir noch nicht.
Suschke: In einem Interview beschreiben Sie eine Nähe zu Ernst Jünger, was im ersten Moment doch etwas überraschend ist, grenzen sich aber gleichzeitig ideologisch von ihm ab, vor allem was sein Verhältnis zum Krieg betrifft. Kann es nicht sein, daß Sie in Ihrem Leben ständig – trotz eines gewissen Harmoniebestrebens – Krieg geführt haben? Zum Beispiel einen mit Worten, der auch gegen den schleichenden Verfall von Sprache und Kultur gerichtet ist?
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang Ernst Jünger und welche die Disziplin? Disziplin, sowohl eine von der Partei wie auch im Krieg vom Soldaten gleichermaßen geforderte Verhaltensweise.
Hermlin: Was Jünger anbelangt, so habe ich eine ganze Reihe seiner Werke gelesen. Marmorklippen habe ich übrigens nur auf französisch gelesen, weil dieses Buch, unter dem Titel Sur les Falaises de Marbre bei Gallimard erschienen, noch während des Krieges in Frankreich in allen Buchhandlungen lag. Ich wußte, daß Jünger in Frankreich war. Was mich natürlich an Jünger zunächst einmal faszinierte, war seine Sprachmeisterschaft, die im Gegensatz zu eigentlich fast allen Vertretern der literarischen Rechten stand. Als ich Schüler war, 15, 16, lief ich ja auch in seine Lesungen. Ich habe ihn ein paarmal lesen gehört, zum Beispiel im Rathaus Steglitz.
Wissen Sie, es ist die Ambivalenz bestimmter Begriffe, bestimmter Ideen, die einen in solchen Jahren wie den letzten der Weimarer Republik beschäftigen. Ich habe Ihnen ja auch geschildert, daß ich mit meinen Kameraden auf der Schule, die überzeugte Nazis waren, manchmal mich durchaus gesittet unterhalten konnte und wir auch in manchem übereinstimmten. Ja, man wollte ein gleichberechtigtes Deutschland. Man wollte den Versailler Vertrag weghaben – darin stimmte man überein. Ich hatte dann immer den Trost im Hinterkopf:
Ja, Lenin war auch dagegen. Und dann – es gab sogar Sehnsucht nach Übereinstimmung. Denn wie bestimmte Nationalsozialisten sagten:
Ihr seid ja die einzigen Revolutionäre außer uns.
Solche grotesken Dinge, die da vor sich gingen, die in Krisenzeiten auftauchten, als die Existenz vieler Menschen bedroht war und sie also auch nach Übereinstimmung suchten. Was mich an Jünger außerdem anzog, war sein Realismus. Es ist ja auch so, Jünger, den man immer als einen Kriegsverherrlicher schildert, der er gelegentlich auch ist, hat zugleich nichts zu tun mit der Herabwürdigung von Gegnern. Das ist auch sehr merkwürdig.
Suschke: Ritterlichkeit?
Hermlin: Also an diese Art von Ritterlichkeit möchte man eigentlich gern glauben. Man glaubt aber nicht daran. Die Zeit der Ritterlichkeit im Krieg ist vorbei. Nein, was mich bei Jünger auch überzeugt hat, ist die Darstellung von Kriegsgreueln, und ich vergesse keinen Moment, daß dieser Mann vierzehnmal verwundet war. Aber in seinem ganzen Werk findet man, jedenfalls ich habe es nicht gefunden, keine Beschimpfung von Engländern oder Franzosen oder Amerikanern, was in der rechten Literatur der Zeit zwischen den Weltkriegen doch sehr verbreitet war. Bei ihm findet sich nichts davon.
Suschke: Und wie ist es mit der Disziplin?
Hermlin: Ich sagte mir, ohne Disziplin läßt sich auf politischem Gebiet nichts erreichen, auf künstlerischem erst recht nicht. Handlungen, die hineinspielen in das Agieren von Kollektiven, von größeren Menschengruppen, verlangen Disziplin. Ohne das kann man nichts erreichen. Und insofern ist das Soldatische ein wichtiger Faktor.
Suschke: Es gibt von Hölderlin den Satz:
Was bleibet, aber stiften die Dichter
Nun aber wird heute durch Fernsehen, Computer, neue Medien Sprache ja auch zerstört. Und was Hölderlin schreibt, meint doch eigentlich nichts anderes, als daß Sprache das letzte Festhalten am Humanen ist. Ist Konservatismus, also der Versuch, bestimmte Dinge zu bewahren, nicht eine wichtige Haltung heute?
Hermlin: Ja, unbedingt. Und wir wissen auch noch nicht, ob sich nicht eines Tages als notwendig herausstellen könnte, die Computer zu zerstören. Daß wir zurückkehren in das Zeitalter der Maschinenstürmer. Das sind ja letzten Endes ganz neue Phänomene, mit denen wir uns befassen müssen, die uns vor zwanzig Jahren noch nicht eingefallen wären. Die Gefahren, die sich auftürmen und die unüberwindlich zu sein scheinen, sind etwas ganz Unerhörtes. Wir haben noch kein Rezept, wie wir diesen Dingen beikommen können. Ich bin an einem computerisierten Kommunismus nicht interessiert.
Suschke: Berlin kommt oft in Ihren Texten vor. Was bedeutet Ihnen die Stadt?
Hermlin: Berlin hat natürlich für mich eine entscheidende Bedeutung, weil ich fast immer in Berlin gelebt habe. Und wissen Sie, eines meiner Lieblingsgedichte ist ein Gedicht von Ringelnatz, das wenig bekannt ist:
Auf den Bänken
An den Kanälen
Sitzen die Menschen,
Die sich zerquälen.
Sausende Lichter,
Tausend Gesichter
blitzen vorbei: Berlin.
Übers Gewässer
nebelt Benzin…
drunten wär’s besser.
Ein wunderbares Gedicht, ganz einzigartig. Das Gedicht endet dann mit den Versen:
Ach, da fällt mir die alte Zeitungsfrau ein –
Vanblix oder Blax soll sie heißen –
Die hat ein so seltsames Schütteln am Bein,
Daß alle Hunde sie beißen. –
Suschke: Ist Berlin für Sie ein mythischer Ort?
Hermlin: Ja. Für mich war es immer der Ort, an dem Luxemburg und Liebknecht ermordet wurden. Ich ging als Kind oft am Landwehrkanal entlang – wir wohnten ja ganz in der Nähe. Das erste, was ich von Luxemburg und Liebknecht erfahren habe, war ein Lied. Wir hatten zu Hause zahlreiches Personal. Außer dem Chauffeur, unserem Kutscher noch einige Dienstmädchen und eine Köchin. Und eine von ihnen hörte ich in der Küche singen:
Es schwimmt eine Leiche im Landwehrkanal, gib sie mir mal her, aber knautsch sie nicht zu sehr.
Ich habe dieses Lied vor über siebzig Jahren als Kind gehört, aber ich habe es noch immer im Ohr…
Sinn und Form, Heft 2, März/April 1995
Hans Richter: Laudatio auf Stephan Hermlin, Sinn und Form, Heft 2, 1985
Klaus Werner: Stephan Hermlin und die literarische Tradition, Sinn und Form, Heft 2, 1975
Hanjo Kesting: Der Worte Wunden bluten heute nur nach innen. Der Lyriker Stephan Hermlin, Merkur, Heft 401, November 1981
Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstler Stephan Hermlin
Gespräch & Interview: Stephan Hermlin und ein unbekannter Gesprächspartner. Sammlung „Verlag Klaus Wagenbach“: Tonkassetten 31 und 32 und Tonband 13.
Gespräch Alexander Reich mit Andrée Leusink über ihren Vater Stephan Hermlin:
Teil 1: „Ein beliebtes Wort war: Lies!“
Teil 2: „Auf einmal war er wie Stein“
Teil 3: „Klein beigeben wäre Verrat gewesen“
Peter Huchel | Stephan Hermlin Zeitzeugen des Jahrhunderts. Literarischer Salonabend im Haus Dacheröden, Erfurt mit Lutz Götze (Manuskript) und Franziska Bronnen (Lesung).
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Archiv + KLG + IMDb +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
Zum 75. Geburtstag von Stephan Hermlin: Sinn und Form 1 + 2 + 3
Nachrufe auf Stephan Hermlin: Der Spiegel ✝ Sinn und Form
Zum 100. Geburtstag von Stephan Hermlin: junge welt + der Freitag +
Kölner Stadt-Anzeiger
Zum 25. Todesstag von Stephan Hermlin: nd
„Welch eine Abendröte“ Stephan Hermlin – zum 100. Geburtstag eines spätbürgerlichen Kommunisten


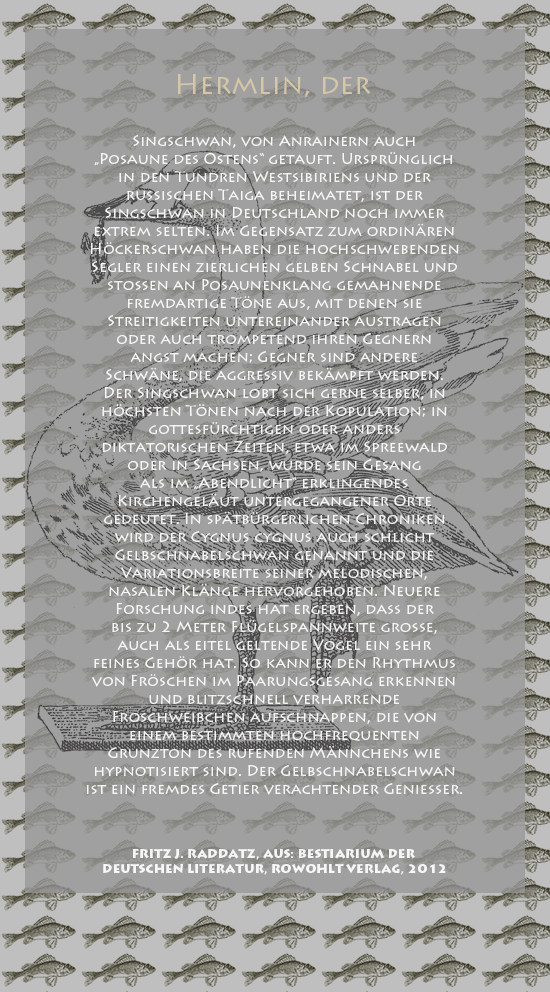












Schreibe einen Kommentar