Andrea Zanzotto: Gli Sguardi i Fatti e Senhal / Signale Senhal
…
— Ich war ein Sternwart des Schauders, weißt du?
Des Kratzers Aufpralls Fröstelns im Schnee-Schicht-
aaaaaRöntgen.
Ich liebte erschaudernd im Schauder
in Graden mutmaßlicher Wahlverwandtschaften
von Holunder und Tannen, die sich in Ästchen
aaaaaverstrickten
— „Meine Wunde hat mich geleckt entdeckt
mich umgerissen und umrissen in in
in Konturen, in reinen und konturierten Tatsachen,
meine Wunde war mein Los mein Lob mein Lohn“
— Lebend wird ich dir Pest tot werde ich dir Tod
— Das Immer ist erstochen Ist in Rage
Ist im heftigen Heftchen Bist du da?
…
Gli sguardi i Fatti e Senhal scheint wie ein Nachwort
zu La Beltà; dieses Langgedicht, zwischen Herbst 1968 und Sommer 1969 geschrieben und in kleiner Auflage als Privatdruck in Zanzottos Heimat Pieve di Soligo publiziert, greift die Frage der Identität, Identifizierung und eroberbaren Wahrheit auf und das Andere der Wahrheit: das Sublime, das ein Feld unbegrenzbarer Potentialität offen hält.
Das Gedicht ist ein Wortwechsel – wie Andrea Zanzotto sagt „an der Grenze zwischen einem Gespräch, das einen gewissen logischen Faden hat, und dem reinen Nonsense“ -, das sich zwischen neunundfünfzig Personen und einer wiederkehrenden anderen Person zuträgt; es ist etwa die Zeit des sogenannten Apollo-Programms und der Saturn 5, die Zeit der ersten touch-downs und Eroberungen des Monds (der Mondin luna). In diesen Expeditionen in den Weltraum wurde ein großer Bereich des Nichtidentischen, ein großes Nichtobjekt, eine enorme Zone des Unverfügbaren, des „ich bin nicht ich und bin-bin“ unter dem Jubel von NASA und unter den Augen der Fernsehzuschauer betreten und identifiziert und entsublimiert, furchtbar eingegrenzt. „ach wie wieder zurück sich krümmen zu einer anderen Keuschheit“.
Andrea Zanzottos Gedichtband von der Nichteroberung der Welt, vom „Diamanten aus nie“, vom sublimen Zugang zur Welt, erschien im September 1969 als unmerklich leichtes Gegenbild zu den zwei allerersten bemannten Landungen im Mare Tranquilitatis und Oceanus Procellarum im Juli und November des Jahres.
Der Übersetzung beigegeben ist eine CD, auf der Andrea Zanzotto sein Gedicht liest.
Urs Engeler Editor / Folio Verlag, Ankündigungsprospekt, 2002
Andrea Zanzotto: Signale Senhal
TEXT: Zanzotto (CD): „NO BASTA, non farlo non scriverlo te ne prego“
Autor: „HÖR AUF, tu´s nicht schreib´s nicht ich bitte dich“
Mit diesem Ausruf, und mit dieser Aufforderung, beginnt Andrea Zanzottos Poem „Signale Senhal“. Doch wer ist es, der hier bittet? Wer spricht? Wessen Stimme fordert auf, es nicht zu tun, es nicht zu schreiben. Vor allem: Was – nicht zu schreiben? Etwa – dieses Gedicht?
Von Anfang an setzt Andrea Zanzotto Signale, und er setzt sie vor die Worte und zwischen sie: Spiegelstriche, Anführungszeichen, senkrechte Zäsuren – wie Schnitte im Text. Und es kann kein Zufall sein, daß Messer und Klinge zu den wiederkehrenden Bildern gehören. „Zeichen und Messerstecherei orgiastisch“ heißt es an einer Stelle: eine Gleichsetzung von Poesie und Gewalt?
Schon dem Schriftbild dieses langen Gedichts, das auf eine ‚normale‘ Interpunktion weitgehend verzichtet, sieht man buchstäblich sein ‚Sendungsbewusstsein‘ an. Der sparsam eingesetzte ‚Strichcode‘ erinnert an Morsezeichen, die räumlichen Trennungen, die Pausen zwischen den Wörtern erwecken den Eindruck, als empfange man eine telegraphische Botschaft. Eine Botschaft allerdings, deren Übermittlung zuweilen empfindlich gestört scheint. Sätze reißen einfach ab, das ein oder andere Wort ist verstümmelt, Passagen wiederholen sich, ja wirken manchmal wie hingestottert, englische Sprachsplitter aus dem Kino und dem Comic schnellen dazwischen: „Bingo-Bingo“ – „Flash Splash Crash“.
Zwei gegensätzliche Modi komponieren diesen Text zu einer Fuge: die mündliche Rede und das Schriftbild. Nur ein Sinn will sich nicht recht einstellen. Wovon redet dieser Text überhaupt? Was bildet dieser Signalcode ab? Und was meint sein rätselhafter Zusatz „Senhal“?
Andrea Zanzotto geht an die Grenze dessen, was man als Leser toleriert. Genauer gesagt: sein Werk – und das gilt für dieses Gedicht in besonders hohem Maße – handelt die ganze Zeit von dieser Toleranz-Grenze der Sprache. Es tänzelt auf der Schwelle zwischen dem Sinn und dem Nicht-Sinn, der etwas voreilig Unsinn genannt wird. Mit Nonsens-Versen hat „Signale Senhal“ wenig zu tun. Eher schon mit sehr ernsthaften Sprachspielen: es vermischen sich darin Diskurse und Dialekte, die Echolalie mit dem schieren Lallen, die Lautmalerei einer Onomatopoetik mit einer Poetik des Sublimen und des Mythos – eines bestimmten Mythos und seiner Entzauberung.
Welcher Mythos? Zanzotto nennt ihn uns in seinem Nachwort, das so lang ist wie der Text selbst und zusammen mit den ausführlichen Anmerkungen eine Art Kometenschweif des Gedichts darstellt. In diesen nachträglich aus dem Gedächtnis zusammengestellten Notizen schreibt Zanzotto:
„Die Gelegenheit zum Diskurs kann auch aus einem eher banalen Ereignis wie der Eroberung des Mondes entstehen. Warum banal? Aus zweierlei Gründen: zunächst, weil es dafür keine Motivation gibt, die nicht banal wäre, und diese liegt vor allem im Wettlauf um Prestige zwischen den beiden Supermächten, die, am Rande eines Raketen-Programms zur gegenseitigen Zerstörung, auch eine Rakete auf die Beine stellen, die zum Mond fliegt. [S] Aber es ist noch mehr dran: mit der Eroberung des Mondes hat man sich, ob eher einfältig oder schlau, wissen wir nicht, vor dem uralten Mythos verneigt, vor dem Mond als Sinnbild des Unerreichbaren, dem Lichtpunkt des Absoluten [S] gleichsam dem Bild der Transzendenz schlechthin. [S] man weiß, dass in der kollektiven Phantasie fast aller Völker das Phantasma der Transzendenz, der Unerreichbarkeit sehr oft gerade durch den Mond, durch die Sinnbildlichkeit des Mondes dargestellt wird.“
Genau hierin besteht für Zanzotto der Schnitt, genau hier setzt er seinen eigenen Schnitt mit dem Messer der Worte an: bei dieser Beschädigung oder Verwundung eines mythischen Fixpunktes am Firmament unseres Weltbildes – durch ein raketengetriebenes ballistisches Messer. Für Zanzotto ein Akt der Zerstörung, ein Schnitt, der die Nabelschnur zwischen der Natur des Menschen und seiner Vorstellung von Transzendenz durchtrennt.
Ist es also der Mond, besser gesagt: la luna, das weibliche Gestirn, das es nicht nur im Italienischen ist, die Mondin also, die spricht? Diana ist der einzige Hinweis, der sich im Gedicht findet, der Umweg über den Mythos: über die Göttin des Mondes, und die Zeile, in der sie aufscheint, klingt wie ein akustisches Echo:
„Diana || ach Senhal“
In den Anmerkungen löst Zanzotto das Rätsel auf: Senhal galt in der Zeit der Troubadure als Ausdruck für einen öffentlichen Namen, der den wirklichen Namen verbarg. Deckname Diana. Ein Symbol. Und ein Signal. 1969, das Jahr in dem wir Kontakt aufnahmen. Indem wir ein jahrtausendealtes Symbol betraten und – dadurch entzauberten. Seitdem ist der Mond anders aufgegangen und es prangen die Sterne in einem anderen Licht. Ein Projektionslicht der Tests und der Raketen-Starts, der Funkempfänger und des Radars, der Sonden und der Satelliten, der verstümmelten Botschaften und ihrer Echos in den Medien und deren körperlose Stimmen.
Das ist die andere Seite des Gedichts: die Abschaffung des Mythischen durch das Mediale. Von Zanzottos lyrischem Echolot eingefangen als Gewirr aus insgesamt 59 Einzelstimmen und Kommentaren zum Ereignis, dialogisch dargestellt und fragmentarisch feilgeboten, wie ein frühes Zappen durch sämtliche Interviews und Statements, durch alle Windungen und Sendungen der sogenannten Massenmedien. Das waren damals vor allem Fernsehen und Kino. Und damals, das war 1968/69. In diese Zeit fällt die Entstehung von Zanzottos lang-kurz-langem Ungetüm „Signale Senhal“.
„Es war fällig: Sie haben dich, die letzten Kitschfilme schreien es die heftigen Heftchen die Acryltricks.“
Die Acryltricks, das sind stellvertretend die visuellen Strategien, die das erste Interregnum einer knallbunten Plastikwelt ankündigen – die Seventies. Bis zum Computerzeitalter ist es noch ein paar Jahre hin. „Durch TVKino schwingt sich unsere Seele auf“ heißt es in Verballhornung des Pseudo Longinus Traktats „Über das Erhabene“. Durch seine Natur strebt empor unser Geist, lautete die Stelle ursprünglich.
Der kulturpessimistische Unterton ist schwerlich zu überlesen. Ein Verlust wird beklagt, und es ist nicht nur an Verlust an Jenseitigem. Sondern auch ein Verlust von Wildheit, von Unbezähmbarkeit, von Unzivilisierbarkeit. Für diese stehen im Gedicht die wilden Kinder, die pueri feri, der Wolfsjunge von Wetterau, der Bärenbub von Litauen. Diejenigen, welche von der Wölfin genährt wurden. Deren Kommunikation für uns unverständlich ist: ein einziges Lallen. Auch sie verschwunden, wie Diana, wie die Wölfin, wie die Mondin.
So wie einst Pier Paolo Pasolini in seinen Freibeuterschriften das Verschwinden der Glühwürmchen beklagte – und die vielfältige Volkskultur meinte – so beklagt Zanzotto nicht nur den Verlust des Lichtpunktes am Himmel als Symbol der unüberwindbaren Ferne. Sondern auch – in einem Nachwort zum Nachwort zwanzig Jahre später geschrieben – den Verlust der Kinos in der Provinz.
Der Mond, die Glühwürmchen, der klassische Filmprojektor – lauter Lichtpunkte, die irgendwann von derselben Einheitskultur einfach abgeschaltet werden.
Die letzten Worte beenden das Gedicht im Stile eines Funkspruchs (Zanzotto-CD): „Passo e chiudo“ In der deutschen Übersetzung heißt es lakonisch: „Over“
Thomas Fechner-Smarsly, Westdeutscher Rundfunk 3, Gutenbergs Welt
Andrea Zanzotto: Signale Senhal
„Ich beugte mich, dich zu betrachten hob den Kopf, dich zu betrachten…“ Als im Juli 1969, vor aller Fernsehaugen, die NASA per bemannten Raumflug den Mond betretbar gemacht hatte – ein Sieg von Machbarkeit und neuer Mythosschöpfung –, saß im norditalienischen Veneto der Dichter Andrea Zanzotto, um sich in den Funksprechverkehr einzuschalten. Überwältigendes Ergebnis ist das vielstimmige und -schichtige Langgedicht Signale Senhal, das, seinerzeit als Privatdruck erschienen, erstmals zweisprachig in Buchform vorliegt (leider ohne Versdurchzählung: Man muss sehr blättern, zur Entschädigung gibt’s aber eine CD). Nun sind Lesern deutscher Sprache Blicke in eine abenteuerliche Raumfahrt zu den Tiefen der Sprachen gestattet. Zanzotto, der Dichter des nicht erwartbaren Perspektivwechsels, hat ein elektrisierend sprachreiches Gedicht über die von ihm keineswegs als Heldentat, vielmehr als Gewalttat, als Notzucht empfundene Mond-Eroberung abgefasst, dem es gelingt (und nur hierin spröde!), ohne den Klarnamen „Mond“ auszukommen.
Ein ebenso raffiniert komponiertes wie auch thematisch hoch komprimiertes Poem, in dem die fast immer knapp gehaltenen Vers-Sequenzen in Raumkapselschnelle schöpferische Ab- und Auflösungsprozesse durchlaufen. So erscheinen offizielle (und inoffizielle) Mythen griechischer und (nach)römischer Provenienz – die Schändung des Diana-Tempels von Ephesos spielt eine Rolle. Zanzotto, der Freund Pasolinis und Montales, betreibt, unter wohltuendem Verzicht auf Prunkzitate, Zeit- und Ortsrausch; Antikenverwaltung und Medienkritik finden in eins, werden miteinander kurzgeschlossen, martialisch und zart verknüpft: und entsprechen plötzlich einander. Dies geschieht mithilfe des inszenierten O-Tons, der die unterschiedlichsten Sprachebenen transportiert. Das reicht von pathosgeladenen TV-Fetzen über die umgangssprachliche Rede und die Comic-Auskoppelung bis in die nüchtern machende Höhe eines Vergil-Tons oder den Einbau eines Dante-Einsprengels.
Im Umfeld der großen Dichtung Pracht entstanden, das den Dichter vor 35 Jahren berühmt gemacht hat (und dem der erste Band der Zanzotto-Werkausgabe gewidmet ist), erweist sich sein paralogisches Instant-Epos als lebendig gebliebener, atemlos-atemspendender dichterischer Funksprechverkehr, dessen anregende Übersetzung durch Peter Waterhouse, der ein hohes Risiko fährt, einmal Signalwirkung haben könnte.
Thomas Kling, Die Zeit, 15.5.2003
Andrea Zanzotto (Gesamtausgabe):
Band I: „La Beltà“ (Pracht) und Band II: „Gli Sguardi i Fatti e Senhal“ (Signale Senhal).
Viel ist über die Dichtung des 1921 geborenen Italieners Andrea Zanzotto, ihrer eigenartigen Mischung aus Sprache und Nonsprache, geschrieben worden. Sein Kollege Claudio Magris sagte, Zanzottos Wort reiche bis unter den Schutt der Jahrhunderte hinab, unter das, was Geschichte, Kultur und Zivilisation angesammelt haben. Pier Paolo Pasolini, in geografischer wie künstlerischer Nähe von Zanzotto beheimatet, meinte, man wisse nie, in welchem semantischen Feld man sich befinde, der Leser geriete in einen beispiellosen Zustand der Entfremdung von seinen Gewohnheiten. Guiseppe Ungaretti fand, wer Zanzotto lese, sehe ein Land leben, sehe es zernutzt, gewaltsam, verfilzt, sehe, wie es sich ständig zersetzt und regeneriert, ein Land idyllischen Zaubers, der von der Tragödie entstellt ist. Und Eugenio Montale bemerkte, Zanzotto sei ein perkussiver, jedoch kein rumoröser Dichter, sein Metronom sei der Schlag des Herzens.
Bislang konnte man im Deutschen vom reichen Werk Andrea Zanzottos, das Gedichtsammlungen, Essays und Erzählungen umfaßt, nur einen winzigen Ausschnitt lesen. Jetzt ändert sich das, in der Edition Urs Engeler wird zur Zeit an einer auf neun Bände angelegten Werkausgabe gearbeitet. Die Übersetzer des mit dem Zuger Übersetzerstipendium geförderten Großprojektes – Donatella Capaldi, Maria Fehringer, Peter Waterhouse und Ludwig Paulmichl – sind seit Jahren mit dem Werk Zanzottos vertraut. Die beiden letzteren sind selbst Dichter; Ludwig Paulmichel darüber hinaus Verleger des Folio-Verlages, welcher wiederum Co-Produzent dieses Unternehmens ist. Zum 80. Geburtstag des Italieners im vergangenen Oktober kam der erste Band, der Gedichtzyklus La Belta (Die Pracht), heraus und soeben ist der zweite Band, Gli Sguardi i Fatti i Senhal (Signale Senhal) fertig geworden.
In Andrea Zanzottos Werk verbindet sich wie wohl in kaum einem anderen die Sprache der Moderne unmittelbar mit archaischen, vorsprachlichen Momenten. Zanzotto beruft sich auf die regionalen, im Verschwinden begriffenen Dialekte, die frühen Kinderlaute, die Melodik von Abzählversen. Sie sind jener Singsang, der weniger über das Konstrukt eines ausgefeilten Sprachmaterials als aus der Bewegung des Körpers und des Mundes heraus entsteht. Steigt man hier noch einen winzigen Schritt weiter hinab, befindet man sich im sogenannten vorsprachlichen Bereich. Die Worte hören dort auf, zu sein, sie zerfallen, aber diese Zerfallsprodukte sind dennoch voll Bedeutung. Auf der anderen Seite steht der Überschwall der Moderne, ein unendliches Palaver, das Sprache durch die Medien regelrecht ausschüttet. Das voller Worte, aber oft ohne Bedeutung ist. Ein brodelnder, ständig überkochender Tiegel, der die Worte oder besser ihre Bedeutungen regelrecht zerschmilzt, verdampft, pulverisiert. Jeder Dichter muß, nimmt er seine Berufung ernst, zur Quelle der Sprache vordringen, dorthin, wo die Sprache zu existieren beginnt, obwohl sie noch nicht sichtbar wird, sondern nur unterirdisch sprudelt. Dieser Weg vorwärts zurück ist nicht ungefährlich, und nicht wenige Dichter bleiben auf halber Strecke mit geringer Beute stehen. Anders Zanzotto, der sich bis in das Schweigen, in die weißen Flecke der Sprachtopografie hinein wagt. Dort, wo vor ihm schon Hölderlin, Mallarmé oder Valery anlangten.
Der soeben erschienene Band Signale Senhal ist ein Text, der sich eigentlich einer Lektüre oder einem Vortrag verweigert, weil er eine Sprache spricht, die in einem magischen Patchwork auf jene Wiederbelebung noch immer anwesender kollektiver archaischer Mythen als auch auf den „maßlosen, sinnlosen und erschreckenden Konsum von Wörtern und Bildern“ der Gegenwart reagiert. Dieses Langgedicht „wäre anzusiedeln an der Grenze zwischen einem Diskurs, der einer bestimmten Logik folgt, und purem Nonsense.“ Kosmische, komische, komatische Sendesignale vom Planet Erde, auf weißen Papierseiten haftbar gemacht. „Senhal“ bedeutet bei den Troubadoren der öffentliche Name, der den wirklichen Namen verbirgt.
Je mehr er in die Sprache hinabsteige, sagt Zanzotto, je mehr er ein Wort suche, das am Ursprung ist, umso mehr merke er, daß dieser Ursprung keiner ist. Auch dort öffne sich ein Abgrund, und er stehe vor einem Schweigen. Dieses Schweigen des Seins existiere leider, aber es sei eines, das ständiger Interpretation bedarf; es ist etwas Wortähnliches, auch wenn es keine Worte im eigentlichen Sinn ausspricht. Als Beispiel nennt Zanzotto den Kosmos, der sich ausdrückt, obwohl wir keine Katastrophengeräusche hören und wir ihn geteilt und von Explosionen zerstückelt wahrnehmen. Er sei sehr schweigsam, überladen mit einem Schweigen von Ausdrucksmöglichkeiten.
Bereits in der ersten Gedichtsammlung „La Beltà“, die verschiedene Zyklen und Gedichte umfaßt und übrigens auch der gesamten Werkausgabe „Planet Beltá“ den Titel lieh, bemerken die Übersetzer in ihrem Nachwort, daß Zanzottos dichterische Sprache, gemäß einer Aufforderung Paul Celans, da Ja nicht vom Nein scheide. Mit seiner Dichtung würde eine Sprache gewonnen, in der ein Erkennen wider möglich ist, ohne dabei das Nichterkennen und Nichtwissen geopfert zu haben. Sie geben dafür etliche verdeutlichende Arbeitsbeispiele. Unter anderem erklären die vier Übersetzer detailliert die Spiegelungen der Wortwiederholung „tutto sommato – tutto sommato“ aus dem Eingangsgedicht. Die von ihnen angewandte Rhetorik liegt dabei fern jeder mit Logik jonglierenden Spitzfindigkeit, sie decken eher im Sinn Zanzottos einen sprachlichen Zustand auf, in dem sich jeder Leser permanent mittendrin befindet. „Alles in allem“ stellt genau besehen eine Tautologie dar, denn das „alles“ kann genausogut ein kleiner Teil sein von „allem“, da es ja in dieses hineinpaßt, ja, es könnte sogar auch fast nichts sein, was dann aber das völlige Gegenteil von „allem“ wäre. „So spricht die Sprache in La Beltà: daß man die Gegenteile hört und deren Verbundenheit und Paradoxien. Eine Form der Wahrheitssuche. Wahrheit als Paradox, als Fehler, als Abweichung, Variante, Kleinigkeit. Wahrheit außerhalb von.“
Zanzotto lebt noch immer in seinem Geburtsort in der Nähe von Treviso im Norden Italiens. Hierher kehren auch immer wieder die Themen vieler seiner Gedichte zurück, aus dieser Region und ihrer Geschichte speist sich unter anderem das Sprachvermögen und die -vielfalt des Dichters. Er schreibe bisweilen Dialekt, sagt Zanzotto, weil er ihn auch benutze. Spräche er ihn nicht, wäre es für ihn eine pathologische Handlung. Es sei eine Geste der Treue sich selbst gegenüber, eine Wiederentdeckung der Kindheit, die im Dialekt weiterbrodelt. So verarbeitete Zanzotto nicht nur gelegentlich Einsprengsel regionaler Sprache in seiner Poesie, er schreibt auch komplette Dialektgedichte wie für den Film „Casanova“ von Federico Fellini. Vielleicht liegt es an Zanzottos Seßhaftigkeit, das Verharren an einem Ort, das seinen Blick in die tieferen Schichten der Landschaften und der Historie, ihre Sedimente hinab, auf eine besondere Weise schärft.
In einem Interview wurde Zanzotto befragt, welche Rolle er heutzutage den Intellektuellen zuspräche. Er antwortete, daß er nicht an irgendeine Rolle glaube, denn die wenigen Intellektuellen, die es gegeben habe, hätten sich in Politiker verwandelt und im selben Moment aufgehört, solche zu sein. Die wirkliche Figur eines Intellektuellen sähe er nur in der des Humanisten, von Petrarca bis zu Erasmus von Rotterdem. Sie stellen als einzige jenen Typus dar, der genau weiß, daß er wenig zähle, aber diesem wenig Zählen Ausdruck verleihe. Die Aufgabe des Humanisten sei es, in der Rede aufzuklären und dort, wo Gewalt ist, die Wogen zu glätten; er müsse aufdecken und vermitteln in einem. Doch heute ähneln die Intellektuellen eher Maschinen, da sie von Tag zu Tag neue Meinungen produzieren und sie auch präsentieren müssen. Dichter wären eher in die Kategorie der Humanisten zu zählen, da sie weniger von der Geste der Behauptung als von der des Suchens und Infragestellens Gebrauch machen. Die Dichtung, schreibt Zanzotto, sei von jeher eine Form der Selbstbefragung und Selbstdefinition, allerdings nur, indem sie sich als unkontrollierbarer Tick äußere, als undeutlicher Umriß, als widersprüchliches Murmeln, das sich nur wenig oberhalb des Nichts bemerkbar mache.
Cornelia Jentzsch, Basler Zeitung, 31.5.2002
Lunare Poesie
− Neues von Andrea Zanzotto. −
In diesen frühen Tagen des 21. Jahrhunderts, da wir eher beiläufig Bilder vom Mars zur Kenntnis nehmen, ist kaum noch der kollektive Eindruck auf die menschliche Psyche vorstellbar, den 1969 die erste Mondlandung eines Menschen – oder besser ihre massenmediale Vervielfältigung, auch und gerade vor dem Hintergrund atomaren Wettrüstens der Supermächte – hinterließ.
Für den Dichter Andrea Zanzotto war diese „funktionalisierte Entweihung“ eines seit Menschengedenken bestehenden mythischen „Sinnbildes des Unerreichbaren“, „der Transzendenz schlechthin“, Anlaß für ein „poetisches Raumfahrtprogramm“, das die Grenzen eines in Auflösung begriffenen Diskurses abzutasten sucht. „Signale Senhal“ erschien im September 1969 und ‚strahlt‘ nun erneut als zweiter Band der Werkausgabe Planet ‚Beltà‘. Dazu stößt er keineswegs vor in galaktische Weiten, sondern kehrt die Bewegungsrichtung vielmehr um ins Innerste. Eine Tafel des psychologischen Rorschach-Testes wird ihm zur Projektionsfläche von Sinn und Un-Sinn, von „Phantasmen“, „Varianten eines Ichs, das es nicht gibt, … oder vielleicht Stimmen von ‚induzierten Psychismen‘“.
Durch einen monatelangen „Denkprozeß“ hindurch ist so ein merkwürdig irritierendes Text- und Stimmengebilde entstanden, welches die eher unauffällige Gattungsbezeichnung ‚Gedicht‘ trägt (gar ist es ein verwirrendes Liebesgedicht an die erhabene und verletzliche Schönheit der Welt.) Und welches dabei in einem so fundamentalen und weitschauenden Sinne Gesellschaftskritik an den „Zelluloid-Exkrementen“ und dem „sinnlosen Gequatsche“ einer Kino- und TV-Welt übt, die, verglichen mit unserer heutigen globalisierten Allgegenwart der Bildmedien, damals noch in den zarten Anfängen steckte.
Gleichwohl bewahrt, über ein bloß literaturhistorisches Interesse hinaus, die in den lyrischen Notaten geronnene Zeitgeschichte eine sprachliche Überzeitlichkeit, Aktualität und Frische und reicht mit ihrer Bildlichkeit und Experimentierfreude tief hinab in die kollektiven und also individuellen (Un)Bewußtseinsschichten jedes Lesers. Denn dieser ist ja stets der Durchlauferhitzer der Sprache. Er lädt sie auf mit Erinnerung. Zum Beispiel an die unendlich ferne, glänzende Frau Luna.
Andreas Kohm, Südkurier, 9.7.2004
L. Paulmichl und P. Waterhouse über ihre Übersetzungen von Andrea Zanzotto
Fakten und Vermutungen zu Donatella Capaldi
Fakten und Vermutungen zu Maria Fehringer
Fakten und Vermutungen zu Ludwig Paulmichl + Kalliope + Facebook
Fakten und Vermutungen zu Peter Waterhouse + KLG
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Peter Waterhouse liest beim Tanz um das goldene Nilpferd am 10.3.2012 im Klagenfurter Ensemble.
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLfG + IMDb + Facebook +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA
Nachrufe auf Andrea Zanzotto: der Standart ✝ NZZ ✝ stol ✝ Die Welt ✝
Chicago Review ✝ Park ✝
Andrea Zanzotto zu seinem 88. Geburtstag.


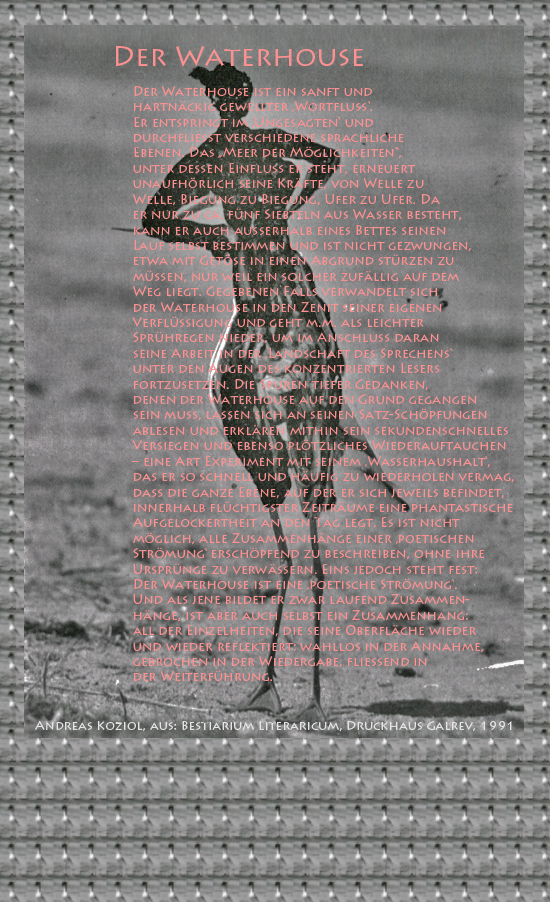













Schreibe einen Kommentar