Kurt Drawert: In dieser Lage
… jedoch die Texte
meinen uns nicht mehr und leer,
denn uns ist gegeben, einen falschen Namen
zu tragen und falsch gerufen zu werden
und am giftigen Grund der Benennung
sich das Herz zu zerstören,
und vielleicht war das Feld
wildernder Rosen
im Umkreis der Sehnsucht
eine Lache von Blut, und vielleicht
hat am Ende der Worte
uns in Wahrheit niemals
jemand erwartet…, und leer
gehen wir hin.
Der lyrische Text ist ein Generator
− Gespräch mit Kurt Drawert. −
Ich traf Kurt Drawert am 8. September 2001 im Dresdner Café Szeged. Ich hatte den Eindruck, daß dieses laute, wuselige Café Drawerts Bedürfnis nach einer Art wachen Anonymität entgegenkam. Er war wacher Beobachter der Szenerie und wacher Gesprächspartner zugleich. Wir sprachen zunächst über sein (bis heute noch nicht abgeschlossenes) Kaspar-Hauser-Roman-Projekt, das einen, wie Dantes Göttliche Komödie, in Höllen und Schuldbezirke gegliederten Handlungsraum beschreibt. Dieser Versuch, über die Chiffre Kaspar Hauser die eigene Geschichte zu erzählen, ist ein gigantischer Sprachentwurf, der alle Themen Drawerts in eine absurde und zugleich intellektuelle Zusammenschau setzt. Heimat, Herkunft und Fremde, Verlangsamung und Beschleunigung, Flucht und Angst sind Stichworte, die auch in unserem Gespräch immer wieder aufflackern. Später seziert Kurt Drawert den deutschen Literaturbetrieb, analysiert den Stand der Literaturkritik und die Sinnfälligkeit der Literaturförderung in Deutschland. Dies alles mit der gewohnt kritischen Distanz des Außenseiters. Schließlich schlagen wir auch den weiten Bogen zur Geschichte, sprechen über die Debatte um Walsers Friedenspreisrede und über die Fragwürdigkeit von Denkmalen, deren Sinn die Gewissensbefreiung ist. Drawert plädiert für ein historisches Gedächtnis, das sich im individuellen Erinnerungsvermögen aktualisiert. In diesem Kontext sieht er das Gedicht als einen Ort des Widerstandes und der Selbstwerdung und damit als das Gegenteil von Staat oder jeder Form von Macht praktizierender Reglementierung.
(…)
Axel Helbig: Sie Schreiben Lyrik, Prosa, aber auch Dramen und Essays. Können Sie ihre Arbeitsweise beschreiben? Wann wissen Sie, ob ein Gedicht, ein Stück Prosa, ein dramatischer Text oder Essay im Entstehen begriffen ist?
Kurt Drawert: Ein bestimmtes Genre zu nutzen ist eine Entscheidung, die ich treffe, ehe ich mit dem Schreiben beginne. Das hängt weitestgehend von dem Gegenstand ab, den ich betrachte. Je klarer er mir ist, umso poetisch unergiebiger wird er. Diskursive Texte sind auf Erkenntnisse aus, literarische auf Infragestellungen. Es gibt ja keinen Sinn, eine im Bewußtsein bereits klare Aussage noch einmal durch den pseudopoetischen Bildgenerator zu jagen, nur damit etwas in der simulierten Weise von Versen entsteht. Das sind dann die gut gemeinten Lehrergedichte, die schon in der Überschrift sagen, daß sie gegen das Waldsterben sind. Völlig überflüssig. Oder positiv gesagt: Literatur wird erst zwingend, wenn die Sprache nicht mehr sprechen und zu sich selbst kommen kann. Wenn ich ein Wissen habe, es aber nicht kenne, dann erst fügt sich ein literarischer Text, in der äußersten Not sozusagen und aus ihr heraus. Für die Entstehung eines Gedichtes als die größte sprachliche Komplexität ist es geradezu zwingend, für mich jedenfalls, daß der Text noch nichts über sich selbst weiß und erst am Ende eines langen Prozesses in der ganzen Selbstverständlichkeit seiner Sprache auftritt. Die Gesetze des Theaters und der Bühne sind wieder sehr andere, weil die Differentiale von Raum, Zeit und Körper anders aufeinander reagieren, materieller und physischer sind. Dann kommt die kollektive Entfremdung des Textes im Moment seiner Darstellung hinzu. Eine sehr neue Erfahrung für mich. Wenn man in größeren Zusammenhängen denkt, führt das ja automatisch zu einem Universalismus, der dann die verschiedenen formalen Möglichkeiten geradezu erzwingt. Die Komplexität der Dinge und der eigenen Anwesenheit bewirkt die komplexe Reaktion. Dabei entsteht ein Essay unter anderen Bedingungen als ein Gedicht, dieses wieder unter anderen Bedingungen als Prosa oder ein Theaterstück. Es ist immer ein Beobachten des Gegenstandes aus einer anderen Perspektive, eine fortwährende Annäherung. Ich kann im Essay Dinge für mich klären, wie ich es in einem anderen Genre so nicht kann. Dies wiederum ermöglicht andere Formen. Ich bin eben ein durch und durch rationaler Autor, der sich selbst dort am meisten mißtraut, wo Emphase ins Kraut schießt und eine dunkle Seite des Sprechens. Gewiß, für die Kritik ist das manchmal ärgerlich, weil ihr nicht mehr sehr viel zu tun bleibt. Sie umarmt ja lieber die, deren Texte interpretationsbedürftig sind und gewissermaßen Geburtshilfe brauchen. Und das schafft ja auch Arbeitsplätze. Dennoch, die höchste Form von literarischer Bewältigung, vielleicht sogar von Wahrheit, ist für mich das Gedicht. Es ist die Summe der Erkenntnisse und zugleich deren Überschreitung auf eine höhere, komplex gewordene und durch eine adäquate Form beglaubigte Aussage. Das Gedicht faßt am Ende alles, was ich in anderen Texten zu sagen versuchte, zusammen, und das kann auch nur ein Bild sein oder ein Satz. Und es gibt mir etwas zurück, das ich vorher nicht wußte. Aber es ist schon auch so, daß ich in einem Genre eine Weile bleibe und dann nicht so leicht wechseln kann. Wenn ich einen längeren Essay schreibe, dann kann ich in dieser Zeit schwer Gedichte schreiben. Weil die Strukturen des Denkens sich unterscheiden. Man denkt stringenter, eindeutiger, wenn man einen Essay schreibt. Eindeutigkeit ist nun aber für das Gedicht, was die Nägel für den Sarg sind. Ein Gedicht mit dem Lehrsatz am Ende und dem kopfnickenden Einverständnis des Lesers: aha, das wollte er sagen, kann man gleich wieder vergessen. Wenn es keine Polyvalenz gibt, keinen unaufgeklärten Rest, der zu einer stets neuen Herausforderung wird, haben wir eine Parole geschrieben oder gelesen, und die kann man dann ja auch billiger haben. Das Gedicht, wo es brauchbar ist, enthält sprachlichen Mehrwert, etwas, daß die Sprache, die es benutzte, wieder verläßt. Das kann man nicht in Serie produzieren, oder ich kann es nicht. Nach vier, fünf oder sechs Gedichten, die alle oft unüberschaubar viele Fassungen haben, bin ich für längere Zeit lyrisch gewissermaßen erschöpft. Und dann ist es sehr richtig und gut, wieder etwas zu schreiben, wo man früh um acht herangehen kann wie ein Metzger an sein abgehängtes Schweinefleisch, um dann abends um acht ein oder zwei brauchbare Seiten zu haben.
Helbig: Sehen Sie sich in erster Linie als Lyriker?
Drawert: Ich weiß nicht, als was ich mich in erster Linie sehe. Das ist ja auch egal. Aber ich denke schon, daß diese absurde, sprachlose Welt, die immer neue Techniken der Bewußtseinszerstörung entwickelt, um einer Transparenz ihrer Nichtigkeit zu entkommen, recht gut in einem Gedicht desavouiert werden kann. Eine Zeile meines toten Freundes Karl Krolow, die mir oft einfällt, heißt: „Der Anzug hält sich aufrecht / für die schöne Blume / im Knopfloch“. Wäre ich Deutschlehrer, würde ich einen Aufsatz nur über diesen Satz schreiben lassen. Allein daran schon sehen Sie, was für ein unglaublich großer sprachlicher Mehrwert in einem Gedicht entsteht. Der lyrische Text ist ein Generator, dessen Effizienz jeden Mechaniker vor Neid nur noch erstarren lassen kann, und vielleicht lesen Techniker deshalb so ungern Gedichte, weil sie es nicht ertragen können, daß es eine Instanz gibt, die die Gesetze der Physik außer Kraft setzt. Und etwas unheimlich ist es ja tatsächlich, wenn mit einem Dutzend ganz alltäglicher, kaum noch zu verwendender Wörter plötzlich etwas mitgeteilt wird, das nicht mehr in den Wörtern selber erscheint, durch sie aber entstanden ist. Während eines öffentlichen Gespräches über Lyrik habe ich kürzlich die Bemerkung gefunden, die daraufhin etwas durch die Zeitungen streunte und vielleicht noch bekannter wird als ich selber: „Das, was ein Gedicht nicht sagt, ist das Gedicht.“ Im Essay „Die Lust zu verschwinden im Körper der Texte“, enthalten in Rückseiten der Herrlichkeit, habe ich versucht, das zu erklären. Und das ist die Großartigkeit wieder, sich mit dem Essay ein Koordinatensystem zu erschaffen, das dem nichtdiskursiven Textversuch einen Halt gibt, eine Referenz. Deshalb, vielleicht, wechsele ich gern die Positionen.
Helbig: Von Autoren der Postmoderne wird der Aufbruch zu neuen Formen gefordert. Matthias Politycki lehnt es ab, „klammheimlich wieder modern zu schreiben, um sich dabei bewährter Techniken bedienen zu können.“ Finden Sie diese Formendebatte verfehlt, weil es ja eigentlich auf die Substanz ankommt?
Drawert: Form und Inhalt lassen sich nicht trennen, das ist immer eine textimmanent praktizierte Korrelation. Ich muß für jeden Inhalt die Form finden, die ihn ästhetisch bestätigt. Stil oder das, was man Stil nennt, ist ja nichts von vornherein Gegebenes, sondern die Art und Weise, wie sich ein Erzähler seinem Gegenstand nähert. Entscheidend ist dann die Beziehung zwischen Stoff und Stil, die Angemessenheit von Ton, Rhythmus, Bild, von Erzählzeit und Zeit des Erzählten und so weiter. Experimente mit der Form an und für sich sind schnell fabriziert und auf längerer Textstrecke ermüdend. Form ist und bleibt ja eine Hülle, ein Gefäß, das seinen Inhalt aufnimmt. Natürlich ist es am Ende die Form, die über das Gelingen eines Textes entscheidet, aber ein ausbaufähiges Konzept ergibt sich allein aus einer reinen Experimentierlust wohl kaum. Das ist einfach zu langweilig. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, daß noch Formen gefunden werden könnten, die nicht schon irgendwie gebraucht worden sind. Schon der Barock ist ja voll von Techniken, die später der Moderne zugeschrieben wurden. Die Form ist demnach etwas Repetitives. Ausgenommen freilich sind Techniken, die aus den modernen Kommunikationsmitteln hervorgehen, da entsteht ja sowieso etwas vollkommen Neues. Interessant ist, ich habe das während der Arbeit an einer Anthologie junger deutscher Lyrik festgestellt, daß es eigentlich keine Herrschaftsdiskurse ästhetischer Art mehr gibt, sondern daß ein souveränes Nebeneinander ganz verschiedener Traditionen existiert. Das ist vielleicht tatsächlich neu. Die jungen Leute scheren sich einen Dreck um Paradigmen, und wenn sie reimen wollen, dann reimen sie eben. Das ist wirklich bemerkenswert. Noch in den 80er Jahren, wo immer auch Trends zu verzeichnen waren, ist das ganz anders gewesen. Jetzt wird alles geschrieben, bis hin zum klassischen Sonett und zur reglementierten Versform oder eben zum sprachexperimentellen Text, zum atomisierenden Text, zum Text, wo Sprache nur noch morphologisch behandelt wird und über sich selbst spricht. Im Grunde ist es völlig gleich, was und wie einer etwas macht. Entscheidend allein ist, ob die Intentionalität eines Textes, also das, was er verspricht, gehalten und ästhetisch eingelöst wird. Das ist mein einziger Maßstab, wenn ich Kritiken schreibe, der Rest ist Geschmack, Vorliebe, Ideologie. Es ist absurd, beispielsweise das lange Gedicht gegen das kurze auszuspielen, das narrative gegen das hermetische oder symbolische, das gereimte gegen das offene und freie, das syntaktisch klassische gegen das experimentelle und so weiter. Dieses plötzliche Auftreten aller Möglichkeiten literarischen Ausdrucks hat vielleicht auch etwas mit dem Ineinanderfallen zweier ehemals getrennter gesellschaftlicher Systeme zu tun, die ja auch eigene ästhetische Referenzen erzeugt haben. Wir erleben heute die Vermischung zweier zeitlich völlig versetzter und damit auch kulturell verschieden entwickelter Systeme. Die Interferenz, die dabei entsteht, ist die Spannung, auch die Kommunikationsstörung in gewisser Weise, gleichzeitig aber auch die Erneuerung von Kommunikation durch radikale Infragestellung ehemaliger Paradigmen. Ein ganz interessanter Aspekt ist dabei die Rolle des Subjektes im Text. Das Subjekt in der westlichen Lyrik ist weitestgehend schon seit Jahrzehnten instabil und dekonstruiert. In den 80er Jahren ging das soweit, daß das Subjekt eigentlich gar nicht mehr sprechen durfte und „ich“ zu sagen als schlichtweg altmodisch galt. Es gab kein Ich, es war alles Objekt. Übrigens ist da Foucault meiner Meinung nach völlig falsch verstanden worden. Die Ostliteratur, und da rede ich jetzt nur von der relevanten und eher subalternen, war zur gleichen Zeit viel subjektorientierter. Sie hatte gerade in einer Gesellschaft der Entindividualisierung und der verordneten Kollektivität das Ich als einen Ort des Widerstandes definiert. Paradoxerweise ist das viel näher bei Foucault, der dem Körper ein Potential von Widerstand zuschreibt, von Rebellion gegen die Praktiken der Züchtigung und Bestrafung durch einen Machtapparat. Das Subjekt hatte damit und auf diesem veralteten historischen Boden eine ganz andere Konsistenz. Vielleicht war der Osten so gesehen die reale Wunde der Theorie, ihr tatsächlicher Schmerz sozusagen. Natürlich muß man das Subjekt vom Autor getrennt betrachten. Das Subjekt im Text ist eine Referenz des Autors, eine Überschreitung der reinen Subjektivität und damit autonom. Die junge Lyrik heute, ich komme auf eben Gesagte zurück, schreibt plötzlich wieder sehr bewußt „ich“. Und das wird gar nicht peinlich, nein. Auch das Zurückgreifen auf sinnliche Erfahrung, auf materielle Welt ist erkennbar, und das in einer Zeit der Virtualisierung und Entmaterialisierung, oder eben gerade deshalb. Die Sehnsucht nach Authentizität und Überprüfbarkeit wächst. Eigentlich alles Eigenschaften, die mit Postmoderne herzlich wenig zu tun haben. Aber was ist eigentlich Postmoderne? Im Grunde doch nichts als eine große Wiederaufbereitungsanlage, die alles Gewesene noch einmal durchmischt unter Beachtung einiger Verbotsschilder, erstens, nie von Wahrheit zu sprechen und zweitens, den Sprechenden zu einem Objekt erstarren zu lassen, zu einer Maske, hinter der am besten nichts ist. Danke auch. Ein Stil jedenfalls ist sie nicht. Am ehesten läßt sich sagen: Die Leere ist schon ihre einzige Substanz. Im Unterschied zur Moderne, die von der Leere in der Substanz spricht. Das Schweigen im Text, das Nichts im Sein, die Störung und der Bildbruch, das sind die Kennzeichen der Moderne. Die evident gewordene Inadäguanz von Zeichen und Bedeutung, die latente Aphrasie – das ist alles Moderne. Die Postmoderne ist reine Oberfläche und von daher eine mir höchst uninteressante Perspektive.
Helbig: Wie stehen Sie zu Thomas Meineckes Theorie des „entsubjektivierten Schreibens“, nach der „die Dinge selbst sprechen“ und der Autor nur ein Medium, eine Art DJ ist, der die literarischen und theoretischen Diskurstracks auf dem Papier lediglich zusammenmischt?
Drawert: Ich glaube, das habe ich schon eben gesagt, Aber ich wiederhole das auch: Ich halte wenig davon, weil ich das wertende und Bedeutung erst schaffende Subjekt nicht aus dem Diskurs herauslösen kann. Die Dinge sind nichts ohne den, der sie benennt und bewertet. Es gibt keine sich selbst Bedeutung verleihende Objektwelt. Ich kann nichts mischen und die Rolle eines destabilisierten Subjekts übernehmen und es dann dem Leser überlassen, sich die Bedeutungseinheiten aus einer Art Würfelspiel der Objektsprache wieder zusammenzusuchen. Dies setzte ja voraus, daß der Rezipient eben das Subjekt einbringt, welches ich gerade zerstört oder verleugnet habe. Das ist unsinnig. Außerdem unterschlägt dieser Wunsch, der Leser möge eine Arbeit übernehmen, die im Grunde zur Arbeit des Autors gehört, daß die Selektion der Zeichen schon die erste Stufe ihrer Bedeutungszusprechung ist. Sprechen heißt erwählen. Wohl verstehe ich die Logik dahinter, auf eine Industrialisierung von Sprache mit industrialisierter Sprache zu reagieren. Aber was soll dabei herauskommen? Ist es nicht gerade die Arbeit eines Schriftstellers und seine Legitimation gewissermaßen, daß er den Entfremdungsvorgang der Sprache entfremdet und damit rückgängig macht? Moderne kontra Postmoderne, da haben wir es wieder. Und ich bin wohl hoffnungslos existentialistisch und modern, ein Dinosaurier im Fachgeschäft für Computer. Andererseits, das will ich noch sagen, halten sich die Werke der Autoren ja nie an deren Theorie. Gott sei Dank. Flaubert wollte das Buch über nichts schreiben, und er hat die Emma Bovary geschrieben. Und Thomas Meinecke schreibt eine etwas eloquente, aber doch gut lesbare Prosa, die natürlich mit Bedeutungen operiert, und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, daß er sich selber da auch mißversteht oder wir ihn, wenn wir darüber reden.
Helbig: Günter Eich, ein Autor, auf den Sie sich häufig bezogen, dem Sie auch Gedichte gewidmet haben, fordert vom Autor innerhalb der Gesellschaft Widerständigkeit und das „Schlachthaus nicht mit Geranien (zu) schmücken“. Sehen Sie in diesem Sinne eine Verantwortung, die Sie wahrnehmen wollen?
Drawert: Es gibt nur ein Gedicht, das ich Günter Eich zugeeignet habe, und das zwangsläufigerweise, da es eine Paraphrase auf dessen berühmtes Gedicht „Inventur“ ist und bei mir „Zweite Inventur“ heißt. Aber zur Verantwortung, was immer das jetzt meint. Kurz: man entkommt ihr ja nicht, als was oder wer immer man auftritt. Natürlich kann ich eine Definition für Individuum geben, die es von Verantwortung frei hält. Aber das nur unter dem Opfer, ihm Verstrickung in Geschichte wie eigene Geschichtlichkeit abzuerkennen, und es ist die Aberkennung all dessen, was wir schließlich Subjekt nennen und worauf sich der einzelne ja notorisch beruft. Die Kehrseite ist, und von daher sind auch die Rechtsforderungen eines einzelnen erst anzuerkennen, daß jeder, der sich seiner Entscheidungs- und Handlungskompetenz bewußt ist, von vornherein auch Verantwortung hat. Verantwortung ist eine Folge der Schuld, da zu sein. Das ist die Urschuld bei Kierkegaard und die Schuld in der Tragödie bei Hebbel. Im Existentialismus vor allem bei Sartre findet das dann gewissermaßen seinen Abschluß in den Begriffen Angst und Freiheitsbewußtsein, und ich habe da nichts Besseres gefunden bis jetzt. Aber die Verantwortung des Autors, das ist ja etwas sehr Spezielles und Sonderbares auch, und ich denke, das kann man gar nicht beantworten, ohne nicht auch die Bedingungen mit in Betracht zu ziehen, unter denen er schreibt und das Geschriebene gesellschaftlich zirkuliert. Denn zunächst einmal hat der Autor ja gar keine Funktion. Er ist überflüssig. Er ist so etwas wie der Faltenwurf einer Gardine, recht hübsch, und wenn man sie glättet, ist er halt weg und niemand erinnert sich daran. Kann man von einem Faltenwurf nun Verantwortung verlangen? Schwer. Hinzu kommt, daß sein Produkt, der irgendwie eigenartige, singuläre Text, etwas höchst Unselbstverständliches ist. Der Autor weiß ja selbst nie so recht, wie ihm geschah und wie er das Zustandegebrachte zustande gebracht hat. Kann man nun also von einem Text, den keiner, nicht einmal sein Verfasser, erwartet hat, Verantwortung verlangen, was ja wohl hieße, daß sich der Text bereits kennt, ehe er da ist? Absurde Vorstellung. Also sage ich jetzt, nein, ein Autor beziehungsweise sein Text kann keine Verantwortung haben, da es keine Verfügungsinstanz gibt, die den Schreibprozeß regelt. Andererseits haben der Autor wie sein Text eine Wirkung, sie haben keine Funktion, aber sie wirken. Und dafür ist man dann schon verantwortlich, wie ein Vater für seine Kinder, die noch nicht achtzehn sind, vielleicht. Literatur hat dort, wo sie sich in den Dienst stellte, längerfristig immer versagt. Es gibt keine Literatur, die ihren Auftrag überlebt hätte. Majakowski gab sich die Kugel aus diesen Gründen. Eine moralische Konsequenz, die ihm heute keiner mehr nachmacht. Das direkte Eingreifen oder besser Eingreifenwollen in Gesellschaft hat die Literatur immer korrumpiert und sie zu einer Ideologieverlängerung gemacht. Der Autor ist nämlich doppelt frei. Er ist frei von seinem Text, weil der Text etwas Unselbstverständliches ist. Und er ist sozial frei, denn niemand hat ihn gerufen und niemand wird ihn vermissen, wenn er verstummt. Außerdem wird er nicht bezahlt, nicht adäquat jedenfalls, und wer nicht bezahlt wird, hat gar nichts zu müssen. Mit dieser doppelten Freiheit in den Stand des Propheten oder Weltverbesserers zu steigen, ist doch wohl sehr komisch. Aber vor diesem Hintergrund einer höchsten Relativierung, ist ein engagiertes Verhältnis eines Autors zur Realität, in der er lebt, mit Sicherheit die produktivere Basis. Und es gibt sicher politische Zustände, in denen das Wort eines einzelnen so viel wert ist, daß dieser einzelne es bewußt und engagiert einsetzen kann und auch sollte. Dann, wenn es wirklich Sinn gibt, sollte sich ein Intellektueller nicht zu schade sein, die Sprache für eine gerade sehr notwendige Sache zu opfern. Aber das sind gewissermaßen vorrevolutionäre Ausnahmezeiten, Sternstunden vielleicht und weit weg von unserer Situation einer allgemeinen Entbehrlichkeit. Und darüber hinaus gilt eigentlich immer: ein Text, der keine Kritik übt, ist höchst langweilig und interessiert mich überhaupt nicht. Literatur ist im Grunde ihres Wesens immer ein Reservoir von Kritik. Oder wie es bei Sartre heißt: „Wenn die Literatur nicht alles ist, ist sie der Mühe nicht wert. Das will ich mit Engagement sagen.“
[…]
Helbig: Welche Erfahrungen haben Sie als Autor (Inventur. Gedichte, Aufbau Verlag, Berlin 1987) und Herausgeber (Die Wärme die Kälte des Körpers des Andern. Liebesgedichte, Aufbau Verlag, Berlin 1988) mit Zensur in der DDR gemacht?
Drawert: Wir kommen jetzt immer weiter auf Friedhofsgelände und sollten besser Schluß machen. Nur angerissen vielleicht. Mein erstes und einziges Buch in der DDR, der Gedichtband Zweite Inventur im Aufbau Verlag, erschien mit großer zeitlicher Verzögerung und nur vor dem Hintergrund, daß sich namhafte Autoren dafür einsetzten. Adolf Endler schrieb damals ein fabelhaftes Gutachten, Heinz Czechowski ein Nachwort. Hinzu kam, daß ich Absolvent des Literaturinstitutes war und zumindest in der Larve eines „anerkannten“ Schriftstellers steckte. Kaum aber war das Buch erschienen, 1987, glaube ich, wurde es laut und kräftig verrissen. In der NDL, damals Monatszeitschrift des Schriftstellerverbandes, im Doppelangebot mit einem Verriß meiner fast zeitgleich erschienenen Anthologie Liebeslyrik, die nachweislich die erste und einzige öffentliche Anthologie war, die alle „Problemautoren“ meiner Generation versammelte. Erst später begriff ich, daß ich da anderen etwas in die Quere gekommen war, die ja gern und gut bezahlt übrigens „underground“ bleiben wollten. Im Grunde war das die nachgereichte Exmatrikulation, die das Literaturinstitut verpaßte. Ich spürte das sofort und kann es heute in diversen Berichten einstiger besonders guter „Freunde“ nachlesen. Andererseits war ich immerhin, und die Politik des „Spalte und herrsche“ hat da gut funktioniert, rein DDR-juristisch „Autor“, was ja nicht selbstverständlich gewesen ist. Das heißt, ich saß zwischen allen Stühlen. Aber das ist ja eine gar nicht so schlechte Position, wenn man schreiben und nicht unbedingt einen Blumentopf gewinnen will.
Helbig: Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ostragehege, Heft 24, 2001
gruß ohne punkt und komma
für kurt von kerstin
über dreißig jahre sind ins / durchs land gezogen und mit uns zieht die neue zeit das frohsinnslied hast du vielleicht auch vor einem halben jahrhundert in der schule singen müssen oder bist wie ich auf so etwas marsch-arschiges gar nicht erst angesprungen obwohl dein vater polizist war (polizeier sagten wir damals) genau wie mein vater jedenfalls geht’s mir in diesem gruß um die ziehenden jahre die zerrenden gewißheiten daß alles auch die neuzeit hierjetztheute ’ne große taubheit an den ohren hat ’ne verholzte zunge im rückblick kann ich die Stationen unserer begegnungen ablaufen startbahnhof leipzig literaturinstitut 1982 da gab’s gelächter gelaber großes gähnen im klassenzimmer da haben wir immer mal über’s gleiche gegrinst siehe zweitstation sammet-straße gohlis die studentenbude mit 8 bewohnern auf 5 zimmern parterre du im einzig schönen zimmer groß prächtig mit parken und einem kachelofen der mit elender kohle durch elend kalte winter geholfen hat bizarre partys mit sowjetgästen italienträumen vietnamschnaps an- und abwesenheiten von freunden frauen chaos kunstmachern aller couleur wildes abarbeiten der zerrzeiten gedichte gedichte rettungen hin und wieder begegnungen im freischwimmerbecken der literatur zwischen leipzig berlin darmstadt an uns zog die neue zeit 1995 rom villa massimo abermals nebeneinander wohnen schreiben trinken lästern mit familie kindern gegennierenschmerzspritzen der besuch im vatikan bei den rock-singenden normen lausige lustige zeit und danach ging alles so fort begegnungen über bücher klatsch&tratsch in den wechselwellen des betriebes jetzt werden herbste besungen die auf der leiter stehen und die blätter anmalen während du blätter beschreibst und ich sage man müßte wieder einmal voneinander hören drawert salute!
Kerstin Hensel, Oktober 2015
AUS DER ALTEN WELT
für Kurt Drawert
Die dünne Haut der Blätter, Gespräche
Mit mir – über das große Wasser,
Die Fotographie, New York. Der Herbst
Ertrinkt in seinen Farben. In den Kneipen
Verweht der Atem. Am Ende
Des Tages versinkt die Seele, die Zeit – im Glas
Rotwein treibt die Liebe und das Blut
Durchs Universum. Die Einsamen
Verschlafen den Flieder, ihre Kinder
Und die Sprache. Mein Kopf spielt
Cello, die Tage sind Noten
Und gezählt, stehen Spalier für den Tod.
Richard Wagner
Joke Frerichs: Deutsche Zustände
Fakten und Vermutungen zum Autor + DAS&D + KLG
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA
Video Porträt: Ute Döring & Kurt Drawert.



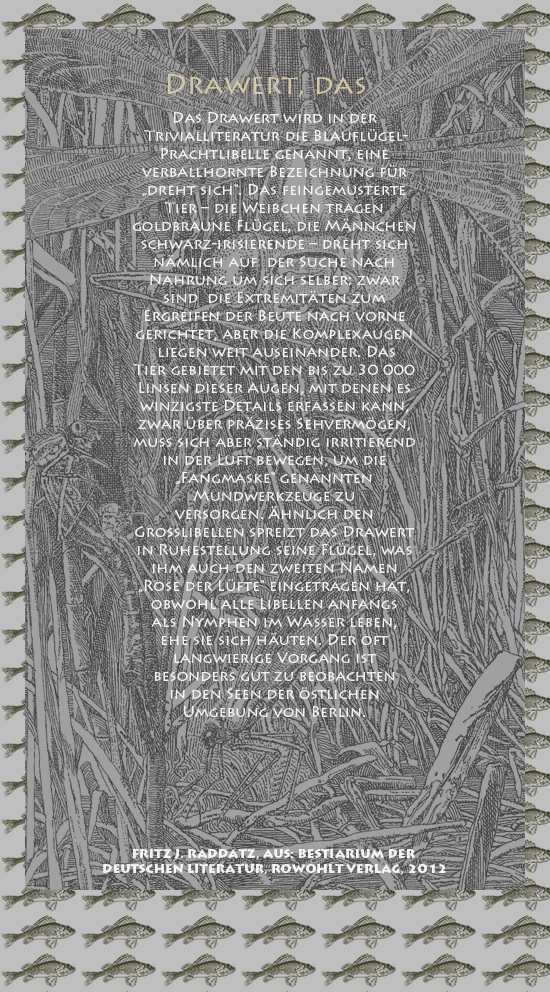












Schreibe einen Kommentar