Peter-Huchel-Preis 1986: Michael Krüger
EIN NATURFORSCHER
1
Nur bei Tageslicht
soll er ihn führen:
der Herr wünscht alles zu sehen.
Jeden Stein am Wegesrand,
jedes Würmchen,
kurz: jede Schweinerei.
2
Der Herr samelte
etwa dreitausend Pflanzen
in seinem Herbarium.
Mein lebendiges Gedächtnis,
pflegte er zu sagen,
das nie verblüht.
3
Den Himmel
betrachtete er selten,
selten das Fenster,
in den Himmel gezeichnet.
Er hielt wenig
von der Mythologie
4
Wir dürfen aber nicht das,
was wir nicht begreifen können,
aus dem Grunde,
weil wir es nicht begreifen können,
leugnen.
5
Gern erzählte er
von einem Kollegen,
der beim Anblick eines Pferdeschädels
wußte, wie die Natur zu ordnen sei.
6
Die Welt wurde heller
unter dem Glas,
doch der Herr schrieb
eine Festschrift
für den Schatten.
Viel traute er
seinem Jahrhundert nicht zu…
Der Weg in die Bilder
Eigentlich müßte ich, bevor ich auch nur anfangen kann, den heutigen Peter-Huchel-Preisträger Michael Krüger zu rühmen, ein großes Tableau vor Ihnen aufbauen: darstellend das Tummel- und Schlachtfeld der Urteile, Warnungen, Gebote und Verbote über das moderne Gedicht. Sie sähen darauf einen Baum, zum Zeichen, daß über ihn nicht mehr geredet werden darf, weil das Reden über Bäume das Schweigen über so viele Untaten einschließt. Dann müßte ich Ihnen den gleichen Baum zeigen, der an der Untat unseres Schweigens gerade eingegangen ist, über den also rechtzeitig hätte geredet werden müssen. Daß es mit Reden nicht getan gewesen wäre, schon gar nicht mit lyrischem Reden, wäre ein anderes, zur Zeit nicht mehr modisches Motiv auf meinem Tableau. Sie müßten die Parolen und Spruchbänder wiederlesen, die gegen jede Literatur und für den Widerstand auf der Straße, in Vietnam, in den Schul- und Schlafzimmern gesprochen haben. Nicht fehlen dürfte dann ein blinder Fleck als Memento für das Unvorstellbare mit Namen Auschwitz, nach dem es keine Gedichte mehr geben darf. Und dann müßte es natürlich ein Bild dafür geben, daß die Sprache des Gedichts, sie allein, ein solches Verbot hinreichend einprägen kann.
Auf die geschichtlichen Apokalypsen des Gedichts müßte folgen: das hausgemachte Elend der Wörter. Auf dem nächsten Bild also wäre mit Händen zu greifen, daß Wörter und Sachen miteinander gar nichts zu schaffen haben. Daß man blind oder verblendet sein muß, um Notwendigkeit zu sehen, wo nur Gewohnheit am Werk ist, Willkür, Manipulation. Sie müßten sehen, daß Sprache immer nur ein Scheingefecht ist, „a tale of sound and fury, signifying nothing“. Daß wir eigentlich von gar nichts anderem reden können als von unserer Selbsttäuschung durch Wörter. Aber – so das nächste Bild – wir wüßten ja nicht einmal etwas vom Fiktiven unserer Verständigung, wenn die Sprache des Gedichts sie nicht gleichsam durch verdoppelte Fiktion bewußt machte, unerbittlich erinnerte an den Riß zwischen Wort und Sache. Und von da wäre nur ein kleiner Schritt zum nächsten Bild, auf dem der verworfene Stein der Sprach-Skeptiker zum Eckstein eines neuen Jerusalem würde. Hier würde das im Geschwätz fallen gelassene Wort das vom Gedicht aufgehobene Wort. Kein Zeichen der Willkür mehr, sondern die Hieroglyphe der Rettung. Da sähen Sie den wahren Dichter das Wort ergreifen und ballen mit reiner Hand, sähen ihn Versöhnung stiften zwischen Wort und Sache, Welt und Ich, Ich und Du. Amen, sagt es auf dem nächsten Bild, nur eine Nummer kleiner, bitte. Machen wir aus der großen Dichternummer eine Demonstration kleiner Freiheit, auch zum Unsinn, und aus der Dichterkrone die verdiente Narrenkappe. Und da können Sie das nächste Bild gleich kommen sehen, auf dem der Hofnarr gesteinigt wird vom Kulturmoralisten. Und das übernächste, wo ihm die Trauergemeinde bescheinigt, er sei doch ein ehrlicher Mann gewesen. Denn wer die Macht zur Gewalt provoziere, habe ihre Ohnmacht am bündigsten bewiesen, und am Ende gebe es keine engagiertere Kunst als die, die jedes Engagements spottend auf ihrer Autonomie bestehe.
Und so weiter. An meinem imaginären Tableau könnte ich immer weiter drehen. Die Lektionen der Geschichte, die mit gleich guten Gründen für und gegen das Dichten sprechen, nehmen kein Ende. Jede ist, für sich allein betrachtet, beherzigenswert. Jede hat das Zeug, einen Dichter exklusiv zu beschäftigen – und ihm seine Arbeit zu verleiden. Michael Krüger gehört zu den Lyrikern, die die Lektionen auf meinem Tableau gelernt haben. Sie sind ihm nicht nur durch den Kopf gegangen (obwohl wir vom Kopf nicht mehr ganz so gering denken wie in den Kinderjahren der sogenannten Selbsterfahrung), sondern an die Haut und unter die Haut. Und natürlich gehört bei ihm, wie bei jedem alphabetisierten Menschen, das Corpus der Weltliteratur zur eigenen Anatomie. Was einer sich wirklich zu eigen gemacht, und worin er eigen wird, hat sehr viel zu tun mit dem Bewußtsein dessen, was er andern verdankt. Auch spontane Erfahrungen sind vermittelt – zum Beispiel durch das kulturelle Leitbild der Spontaneität. Es wird in unserer Zivilisation zu viel aus zweiter Hand gelebt und es wird zu wenig aus erster Hand gelesen. Als Leser Kafkas oder Borges’ kann ich eine einmalige Erfahrung machen; mit meiner ersten Liebe befinde ich mich als Wiederholungstäter in unabsehbar großer Gesellschaft. Daß ich mich dabei so unmittelbar fühle, will nur sagen, daß ich mir von den chemischen und kulturellen Medien dieses Gefühls keine Rechenschaft geben mag. Was mich aber – wenn ich lesen kann – an einem guten Text anrührt, ist eben das Vermittelte daran. Er besteht darauf, daß ich diese Erfahrung mache: er ist aus Zeichen, nicht aus Gefühlen. Er zwingt mich, das Medium der Wörter als solches wahrzunehmen, aber er erlaubt mir, sie zu prüfen und mit ihnen zu spielen.
Gerade bei Krügers Gedichten scheint mir die Erinnerung am Platz: es sei keine völlig verschiedene Kunst, die Zeichen in einem Buch, einem Gedicht, einer Seelandschaft, einer Hausfassade zu lesen. Lernen heißt in einer vermittelten Welt überall: lesen lernen. Erfahrung ist: was ich mir aus dieser Lektüre mache. Michael Krüger hat lesen gelernt. Seine Lektüre verweilt am liebsten vor Texten, die sich nicht als solche zu erkennen geben. Nun heißt richtig Lesen freilich noch lange nicht: verstehen, deuten, Bescheid wissen. Im Gegenteil: gerade das Auge des Lyrikers wird von den Zeichen angezogen, die der Deutung widerstehen. In ihnen vermutet er eine Botschaft, die ihn etwas angeht. Nicht selten geschieht es, daß er der Deutung widersteht, die ihm ein Text gleich mitliefern möchte: der Text einer Landschaft, eines Bildes, einer Liebe. Er ist aber auch geschlagen mit dem Blick für Wiederholungen, wo andere das Einmalige sehen. Gegen nichts ist er so empfindlich wie gegen das Einmalige, das uns immer wieder passiert, auch wenn er seine Erinnerung – die Erinnerung des genauen Lesers – noch so gerne bestechen möchte zugunsten seiner menschlichen Bedürfnisse. Aber wer die Wiederholung nicht beim Namen nennen darf, ist ein schlechter Leser: er verdirbt seine Wahrnehmung für Textstellen, die ohne Beispiel sind. Meist sehen sie unauffällig, ja wie Textlücken aus. Aber sie erst lassen die Lektüre der Welt schöpferisch werden: was bei sorgfältiger Wahrnehmung nicht aufgehen will, läßt die Wahrnehmung selbst aufgehen. An diesem Punkt wird die Lektüre zum Gedicht.
Michael Krüger als Leser: natürlich darf einem dazu sein Beruf einfallen. Er ist Lektor eines belletristischen Verlags, Herausgeber literarischer Zeitschriften. Was einem nicht einfallen darf: aus der Fähigkeit oder Pflicht, Manuskripte anderer zu lesen, Schlüsse zu ziehen, schnelle Schlüsse auf die Arbeit des Lyrikers Krüger. Wahr ist nur: daß das professionelle Lesen Zeit beansprucht, die für das absichtslose Lesen anderer Zeichen – also auch für das Schreiben eigener Gedichte – fehlt. Wahr ist außerdem: der gefräßige Literaturmarkt hindert die Hersteller der Ware, nach der er schreit, schon fast systematisch daran, sie verantwortlich herzustellen; er hindert sie erst recht daran, dieser Arbeit froh zu werden. Ich habe inzwischen von so vielen Seiten gehört, warum Michael Krüger den Huchel-Preis bekommen habe, gegen wen, und mit welcher Absicht, daß ich ihn um das Medium immer weniger beneide, in dem er Literatur zu vertreten hat, die seiner Autoren oder seine eigene. Die Jury war arglos genug, sich von nichts weiter bestechen zu lassen, als von literarischer Qualität – einer Qualität, an der ihr eine im Deutschen freilich nicht eben geläufige Kombination von empfindlicher und sicherer Zeichensetzung auffiel. Mag sein, daß man sich eine so diskrete Meisterschaft im täglichen Umgang mit bedeutender Literatur aller Sprachen eher erwirbt als in einer lyrischen Einsiedelei. Aber was man sich davon überhaupt erwerben kann, ist gerade in der deutschen Literaturtradition – will sagen: jenem genialischen Mangel an Tradition, der das Dichten immer neu zu erfinden zwingt – schwer genug erworben. Und wenn das Schwere daran nicht sauer geworden ist, sondern scheinbar gelassen daherkommt wie bei Krüger, so wird man seine berufliche Vorbelastung durch Literatur nicht anders beurteilen als diejenige der Lektoren Oskar Loerke oder Peter Huchel: als gelungene Arbeit. Sie macht keinerlei Aufhebens davon, daß sie sich gewissermaßen auf dem neuesten Stand der Semiotik befindet. Deutsch oder autobiographisch ist sie in einer durch den Stand der Dinge gebotenen Beiläufigkeit:
Ich bin das vierte Kind
meiner Eltern, in Deutschland
geboren, im letzten Krieg,
das ist lange her oder
war gestern ist heute:
die Schichten
sind nicht mehr zu trennen (…)
Der Vers, den sich einer auf sich selbst macht, ist für Krüger keine großartige Privatsache mehr:
Sah mich die Spuren prüfen
und die Schrift. Wußte nicht,
nach allem, was ich von mir wußte,
warum das Schlüsselwort
sich aus dem Staube machte (…)
Die Konsequenz, die dieser Lyriker daraus zieht, ist nicht das Fabrizieren von Nachschlüsseln, sondern das Interesse für die Zeichen im Staub.
Im Gedichtband Diderots Katze gibt es ein erzählendes Gedicht, das ich als Einstieg in die gezeichnete Welt Michael Krügers lesen möchte. Es heißt: „Der Weg in die Bilder“ und beginnt:
Wir versammelten uns argwöhnisch
im schlecht beleuchteten Museum.
Der Argwohn gilt einem Bild, das Krüger ein „Original“ nennt. Es stellt das Paradies dar, und es ist etwas daran, was alle „uns bekannten Kopien / in Venedig, London und Leningrad“ nicht haben: ein Loch. Fotografisch vergrößern läßt es sich nicht, wohl aber begehen, und zwar von einem Blick, der sich an „einer heute vergessenen / Perspektivenlehre (Padua, 1639)“ geschult hat. Diesem Blick eröffnet sich eine Welt ins Jenseits des Bildes. Das Auge gerät durch eine rauhe und karge Landschaft zu einer Stadt „in einem Raum vollkommener Einsamkeit. // Diese Stadt heißt Am Ende der Fotografie! Sie liegt im Zentrum (…) der Wiederholung“, an einem Punkt also, in dem das notorische Schicksal unserer Beziehungsverhältnisse aufgehoben ist. Diese Stadt am Ende der Fotografie – also auch am Ende des Prinzips Nachahmung, der reproduzierten Natur, der nachgedichteten Ereignisse – diese Stadt ist zugleich der Ursprung der Bilder. Hier ist die Metapher die primäre Wirklichkeit. Was hüben wie Metasprache aussieht, ist drüben der Rohstoff, aus dem der Sinn im Zusammenhang fabriziert werden kann, den unsere Bilder der Welt nur fragmentarisch entnehmen können. In dieser Stadt
(…) erhält jede Geste eine Begründung
zurück, jedes Entsetzen seinen Anlaß
Die unfaßlichsten Metamorphosen
(aus der Geschichte der Täuschung)
treffen hier auf ihre verwegene Biographie.
Wer dieses Zentrum der Entschlüsselung aber mit einem metaphysischen Ideenreich, oder gar einer humanen Utopie verwechseln möchte, lernt das Fürchten vor dieser Stadt. Ihre Ordnung zerstört „unseren Blick, / an unser Jahrhundert gewöhnt“ −. Die einzigen Menschen in den Außenbezirken sind leere Bälge: „sie hingen zum Trocknen an Bäumen / und bewegten sich sanft nach dem Diktat / einer ganz und gar fremden Dramaturgie.“ Jenseits des Originals vom Paradies – aber auch es ist ein Bild – gibt es zwar eine absolute und zeitlose Ordnung, aber es gibt sie nur als absolut vergangene. Sie hat keinen Horizont mehr und ist vom „gleichmäßigen Licht“ einer Folterkammer erhellt. Der Blick des Dichters, den Krüger hier – wie oft – als Auge eines Kunst-Historikers vorführt, erlaubt nur den Schritt aus der Geschichte, die wir nicht verstehen, in die Geschichtslosigkeit, in der wir nicht vorkommen. Wenn wir hinter unser Bild vom Paradies kommen, dahin wo es aufhört, Abbildung zu sein, ist es die Hölle. Sein Sinn wird klar, aber diese Klarheit ist unbewohnbar; sie hat keinen Sinn für uns. Die Aufhebung der Metapher führt ans Ende der Bilder: aber das Ende der Bilder ist ein Bild in der Potenz, die tötet. Die wahre Seite der Bilder ist der Tod; bewohnbar ist nur die sinnlose Seite, die unbegreifliche.
Das hört sich an wie die Prämisse radikaler Verzweiflung eines Künstlers an seiner Kunst. Und in der Tat haben Krügers Gedichte kaum das zu bieten, was man Lebenshilfe nennt. Vor dem Ansinnen der Vertraulichkeit, vor der Zumutung des Glücks bleiben sie lange stumm. Auch die Hintertür des Paradieses scheint zugemauert, die Kleists Marionettenaufsatz denen geöffnet hat, die zum: zweiten Mal vom Apfel der Erkenntnis essen. Es gibt keine Geschichte mehr, die das Heil zu suchen erlaubt, keine sogenannte reale, keine sogenannte erfundene Geschichte. Sie beide sind aus demselben trügerischen Stoff der Zeichen: sie gebieten auch dem Gedicht, gerade dem Gedicht, daran keine Hoffnung festzumachen. Sie wäre Trug – aber sie wird nicht als Betrug eingeklagt. Krügers Gedichte verwenden ihre Einsicht in die Gebrechlichkeit der Welt nicht gegen die Gebrechlichen. Etwas vom Auffälligsten und Anrührenden in Krügers Gedichten ist ihr völliger Mangel an Zynismus: als steckte in diesem noch ein Rest sauer gewordener Eitelkeit und ungebührlichem Pathos, das immer noch mehr zu scheuen ist als der Schmerz der Wahrheit. Dieser gebietet Stille; er stimmt zur Nachsicht und Versöhnlichkeit der Stimmen des Gedichts miteinander. Sie haben einander im Hexenhaus der Zeichen keine unumstößlichen Gefühle zu bieten, aber dafür strafen sie einander nicht. Sie bleiben gewissermaßen miteinander im Wort, auch wenn seine Bildlichkeit zu ihren alltäglichen Erfahrungen gehört. Sie teilen das Schicksal, sinnliche, aber nicht mit einem Sinn begabte Menschen zu sein, oder Wesen zu sein, gütlich miteinander. Alles mag scheinhaft sein – aber an der Nähe, die diese Einsicht vermittelt, ist nicht alles Schein.
Die dichterischen Figuren Krügers sind einander verbunden, weil sie die Grenzen der Verbundenheit so gut kennen. Sie wissen, daß die Forderung nach Mehr immer weniger ist, als sie voneinander brauchen. Groß geschriebene Zeichen tauschen nur noch Ahnungslose: denn sie führen ins Unverbindliche. Resignation, Re-signation aber schließt Verbindlichkeit zwischen Menschen nicht aus: vielleicht gibt es sie nur noch in ihr. Weniger psychologisch und mehr semiologisch gesprochen: hier hat einer Ernst gemacht mit dem mangelhaften Zusammenhang des Bedeutenden mit dem Bedeuteten, mit der Entzauberung der Zeichen, auch der poetischen, gerade der poetischen. Aber er hat diesen Mangel nicht der Fachliteratur entnommen, auch wenn er sie kennt und sich auf sie bezieht. Die Dissoziation von Wort und Sache ist für ihn eine Erfahrung – und zwar eine historische nicht weniger als eine sogenannte private. Die Erfahrungen, die für ihn zählen – und von denen seine Gedichte zeugen −, beginnen überhaupt erst da, wo die Selbsttäuschung lückenhaft wird, und das heißt auch: die Selbstüberschätzung der sprechenden Person. Die Geschichte, auch ihre eigenen Geschichten, haben ihr hinreichende Gründe geliefert, Sinnstifter, Ordnungsmacher, Gesetzgeber abzuschreiben – ihre Maximen dürfen das eigene Leben nicht mehr leiten, auch dann nicht, wenn es selbst nach Gesetz, Sinn, Ordnung, Geborgenheit hungert. Sie können auch den Dichter nicht mehr leiten als Verfahren des Dichtens. Zu umfassend ist das Täuschungspotential der Zeichen, als daß darin auch nur bildlich Raum zu finden wäre für die Erwartung von Glück.
Die Bilder täuschen; und doch führt kein Weg an den Bildern vorbei. Auch die Stadt am Ende der Fotografie war zugänglich nur durch ein Bild – durch eine kaum beachtete, durch kein Verfahren zu vergrößernde und dennoch vom eingeweihten Auge begehbare Aussparung im Bild des Paradieses. Dieses Loch, diese Öffnung, dieses Negativum vermag die Dichtung zu besetzen. In diesem Durchschlupf sind, bildlich gesprochen – wie anders −, Krügers Gedichte angesiedelt; in ihm setzen sie ihr eigenes Zeichen. Sie suchen die Stelle am Bild, wo das Bild aufhört – eine Stelle, die nach fast Nichts aussieht, und die doch nicht nur Oberfläche ist. Das Bild ist nicht nur das Problem von Krügers Lyrik – es ist immer wieder auch sein Thema. Bilder alter und neuer Meister sind Texte, die seine Gedichte nachzulesen, neu zu entziffern suchen. In der Kunstgeschichte wittert er die Geschichte einer verborgenen Erfahrung, die, am Ende der Nachahmung, mit seiner eigenen Erfahrung zusammenstimmt. Die Figuren auf einem Bild führen ein kaum mehr zugängliches und doch dem Zentrum der persönlichen Biographie verwandtes Leben. „Der Weg zurück in die Bilder war schwer / und gefährlich“, so beginnt ein Gedicht aus dem letzten Gedichtband Die Dronte, das, am Leitfaden von Figuren des italienischen Malers Sandro Chia, das Labyrinth der Bilder bis zu seinem Ursprung zurückzugehen sucht. Prometheus, Judith, Sisyphus verkleiden sich, um unerkannt, und eben darum als sie selbst, die Kontrolle des Museums, die Grenze der Leinwand, die Schamschranke des Kunstverstands zu passieren. Und nachdem sie im Bild sind – dem Bild Sandro Chias – liegt ihnen ob
(…) unauffällig zu warten
bis unsere Sprache wieder traf, so lautete
unsere Bestimmung, denn vorläufig
schien uns keiner zu vermissen. Die Dinge
ihres Wissens beraubt, dösten als Zeichen
ohne Bedeutung vor sich hin,
die Erzählung, einst mächtiger machtloser Herrscher
in dieser Stadt der Bilder, hatte den Ort
mit uns verlassen und sich in der Fremde
verbraucht, jetzt herrschte eine Schrift,
die denen alles versprach, die an sie glaubten.
Resignativ, mit verstellten Zeichen, im Zeichen der Verstellung, könnte es – das ist die Utopie dieses Gedichts – für seine Figuren doch ein Ende der Täuschung zu erwarten geben, das zugleich bildlich wäre und mehr als ein Bild. Wenn es aber überhaupt gesucht werden darf, dieses Heil, oder lieber: das Ende der Heillosigkeit, dann nur in der Flucht vor allen falschen Versprechen der Sprache; dann nur im Überwintern der Bilder in den Aussparungen, den Leerstellen der Metapher. Von diesem Bild-Widerstand im Bild, dem U-Topos, dem Nicht-Ort in der Topographie der Zeichen, der Systemlücke handeln, in dieser oder jener Form, in Liebesgedichten, Seestücken, Bildportraits, alle Gedichte Michael Krügers. Einem seiner Bilder – einem Bild in Anführungszeichen – wendet er eine besondere Aufmerksamkeit zu: seinem Fenster. Es ist, zunächst, eine Öffnung in der Mauer, wie jenes Loch in der Leinwand, durch das man in die Stadt am Ende der Fotografie gelangte. Es ist aber auch der Rahmen für ein Bild, dessen Komposition das Fenster festlegt, aber nicht endgültig festlegt; denn sie wechselt mit dem Standort des Betrachters, mit jedem Einfall eines Vogels vom Himmel, dem Durchziehen einer Wolke oder einer Bewegung im Nachbarhaus. Ändert sich das Wetter oder die Tageszeit, beschlägt sich das Glas mit Staub oder bricht die Dämmerung herein, so wird der Durchblick zum Spiegel, erscheint das beobachtende Subjekt selbst in seinem Objektiv: das Ich zeigt sich im Bild; bei zunehmender Dunkelheit draußen, und angedrehter Innenbeleuchtung: nur noch das Ich. Die fensterlose Monade kann sie das gesuchte Bild der Bilder sein?
Unter allen Metaphern, denen Krüger mißtraut, ist das lyrische Ich eine besonders ungeliebte. Er behandelt es gewissermaßen als Bildstörung und hat schon in seinem ersten Gedichtband Reginapoly kein gutes Wort dafür übrig:
(…) Hör doch nicht auf diese
schwitzenden Ich-Sager, glaube doch nicht dieser Rede
in einfachen Aussagesätzen, die ohne Zunge
auskommt, ohne Herz, ohne Kopf und ohne Körper,
die sich verkrochen hat
in der Sprache jenes ,alten berühmten Ich‘,
das den Bach hinunter ist,
endgültig und gleichgültig und unauffindbar.
Lauf diesen Spuren doch nicht nach,
diesen gleichmäßigen ausgewaschenen Abdrücken,
die zu dir zurückführen und
dich kaltlassen; nimm diesen Umweg: am Strand
entlang, gegen die Monotonie der Wellen.
Gegen die Fiktion des authentischen Subjekts bietet Krüger viel Sarkasmus auf: von der „Ich-Pest“, sein Wort, hat die Beziehung, die soziale wie die poetische, nichts zu erwarten. Für Krüger ist das Ich ein Bild, dessen Unnahbarkeit er verteidigt gegen jeden herzhaften, also ahnungslosen Zugriff. Gegen falsche Unmittelbarkeit verschreibt er den Umweg an den leeren Strand, den Bußgang in die Schutthalden des Zeichenmülls. Dort, vielleicht, stößt dem Ich ein verworfener, weggeworfener Gegenstand auf, in dem es seine eigene Verlorenheit erkennt; erst der Name, den es dafür nicht hat, erinnert es an seinen eigenen.
So ist das Fenster, Krügers Bild par excellence, eine Falle: so ist es aber auch ein Fangnetz für das Unvorhergesehene, die Einbruchsstelle für Überraschungen. Sie „bedeutend“ zu nennen, würde ihre Bedeutung verdunkeln: denn sie zeigt sich gerade daran, daß die Deutung offen bleibt. Es will nichts Großes an den Sinnpartikeln sein, die dem Fallensteller unversehens ins Garn gehen; sie eignen sich nicht zum Extrapolieren auf ein sinnvolles Universum; sie haben den Sinn, jeden Hintersinn zu verweigern; darauf, auf ihrer Unbrauchbarkeit für jedes System, beruht ihr Rest von Verheißung. „Rest, Reste“ sind lyrische Hauptwörter Michael Krügers. Was herausfällt, durchgefallen ist, übriggeblieben ist im Raster der Ordnung, sich ihrer Fiktion entzieht, findet seine Aufmerksamkeit; die des Lumpensammlers, nicht des Juweliers; des Hungrigen, nicht des Dekorateurs. Im Müll der Geschichten, im Rest auf dem Teller, im unerledigten Geschäft einer Liebe steckt das Geheimnis unserer Zusammenhänge als verwirktes; und es verbirgt sich so wenig, und macht so wenig her, daß jede Mystifikation daran versagt: so, nur so, ist es zur Liebe geschaffen. Es scheint so wenig, daß es so aussieht, als wäre es wirklich; als wäre es wirklich: der unansehnliche Rohstoff eines Wunders. Etwas wie Sinn kommt in Krügers Gedichten überhaupt nur im Narrenkleid des Zufalls, in den Lumpen des Beiläufigsten daher. Nur Nebensachen haben eine Chance, dem System unserer Erwartungen – und das heißt: dem Mechanismus unserer Katastrophen – zu entschlüpfen. Krüger redet gern von einer „Poetik des Mangels“. Manchmal, selten genug und selten zum Besten des Gedichts, gibt er eine ihrer Maximen preis: „Nichts mehr bedeuten – etwas sein.“ Oder: „Wenn dich der Ausgang nicht kümmert, bist du am Ziel.“ Oder: „Schon war ich mir entgangen, das war der Grund, daß ich blieb.“ Merksätze, die sich hören lassen – und eben so des Guten schon ein wenig viel tun, gelten als Ausdrucksformen der Ungeduld, sind kontra-produktiv für die Poetik des Mangels, oder in Krügers Worten:
Nur die Ungeduld
bewahrt die Konvention
vor einem raschen Ende.
Das Gedicht, an dem Krügers Gedichte schreiben, muß gerade das Bedeutende „sein lassen können“ – und darin hat es allerdings seinen Meister gefunden: in der „Katze“. Sie ist das poetische Prinzip von Krügers Gedichten, weil sie von einem Prinzip nichts weiß. Sie macht kein Ordnungsschema zuschanden, sie führt keins ad absurdum – sie läuft daran vorbei. Dafür findet die gezeichnete, zeichen-geprüfte Sprache Krügers das höchste Lob: „Es gefällt mir, daß die Katze Katze heißt.“ Sie ist der Glücksfall einer semantischen Tautologie: Wort und Sache erscheinen in diesen fünf Buchstaben versöhnt. Die Katze, dieses Bild eines Tiers, ist ein Bild für nichts anderes. Die Katze ist gewissermaßen der lebensfähige, lebensfreudige Rest in Person, der in Krügers Gedichten nicht aufgeht. Die Fallen, die sie dem Sinn gestellt haben, haben ihren Zweck erfüllt, indem ihnen der Sinn entgeht auf leisen Pfoten, sinnlich und unwiderlegbar wie die Katze, nein: als Katze. Sie verkörpert die offene Stelle des Gedichts. Unter allen Zeichen der Negation ist sie dasjenige, das sich am ehesten liest wie: Glück. Krüger hält diesem Wunder die Treue, indem er darauf verzichtet, es auszumalen.
Es wäre vielleicht nicht „ganz“ falsch, Michael Krüger einen gut getarnten Mystiker zu nennen. Oder einen Schriftgelehrten am Ende aller Bücher, wo die Weisheit der Meister beginnt: jene närrische Weisheit, die ihr letztes Wort ins Wasser schreibt. Es wäre auch nicht ganz falsch, Krüger einen Meister des Liebesgedichts zu nennen, einen lyrischen Landschafts- und Wettermaler erster Güte, einen Erneuerer der Römischen Elegie, einen Dichter für Kunstmaler. Aber all das ist er mit einem Rest, der nicht aufgeht, der sich nur ungesucht finden läßt und auf den alles ankommt. Diese Reste aufnehmend, gehen Krügers Gedichte einem Horizont nach, den sie niemals einholen, sammeln sie Strandgüter der wörtlichen Zivilisation als Zeugnisse gegen ihre voreilige Hoffnung, aber auch gegen ihre ungeduldige Verzweiflung. Wer etwas ganz tut, der muß das Ganze offenlassen können. Nur der Trivialkünstler findet auf seinem Weg immer den Schuh, den er sich und dem Leser getrost anziehen möchte. Für den Liebhaber der Ehrlichkeit kommt zuviel dazwischen: zwischen Ursache und Folge, Bild und Bedeutung, Ich und Du, Lüge und Wahrheit, Leben und Tod. Von diesem Zwischen-Raum handeln Krügers Gedichte. Sie widerstehen der Versuchung, dieses trübe Medium zu klären, durchsichtig zu machen für einen Sinn. Das dichterische Wort kann die Dunkelheit unserer Geschichten nicht klären; es kann nur klar machen, wie dunkel sie sind. In besseren Zeiten für die Literatur war es der „farbige Abglanz“, an dem wir das Leben hatten; heute ist es der undurchsichtige Zusammenhang. An ihm ist der Dichter nicht schuld; aber er würde schuldig an der Kultur, wenn er ihn leugnete und einen Durchblick fingierte, in dem die Fiktionen unseres Daseins verschwänden. Krügers Lyrik handelt von den sehr guten Gründen, die der Sinn hat, sich einem unsinnlichen Gebrauch der Welt zu entziehen. Sie redet nicht von der Versöhnung mit dem Unzulänglichen. Sie zeigt die Schwierigkeiten des Zulangens – als Arbeit des Textes an seinen eigenen Zeichen, als Entstellung, Resignation dieser Zeichen bis zur Kenntlichkeit einer möglichen Hoffnung, über die zu reden freilich hoffnungslos wäre. Aber es gibt eine Form davon zu schweigen, die im Bunde ist mit der Humanität. Sie kann am Verwirkten der Wirklichkeit nicht vorübergehen – und läßt sich dann von der Katze überraschen, die es scheinbar doch kann: auf leisen Pfoten, ohne Aufhebens, unbekümmert um ein anderes Ziel als ihren eigenen Weg.
Kleist hat im Bären, der eine Finte des Fechters immer von einem echten Ausfall zu unterscheiden wußte, den unbewußten Meister in der Kunst des Lebens geehrt. Viele Gedichte Rilkes spüren der Witterung des Hundes für das von Krüger einmal „wirklich Wirkliche“ genannte nach – jenem Bereich der Engel, in dem zwischen Leben und Tod nicht mehr zu unterscheiden wäre. Krügers Gedichte aber feiern das Zweck- und Absichtslose am Leben der Tiere als geheime, für den Menschen und vom Menschen so gut wie verwirkte, vorläufig unaussprechliche Utopie. Am unbekümmerten Weg der Fliege über Krügers Gedicht von der Fliege; an der im Tode ausgebreiteten Katze; am Gefieder der ausgestorbenen Dronte ist etwas Bildliches, das sich dem Bilderatlas entzieht. Und dieser Spur folgend, ohne die eigene zu beschweren, gerät Krügers Sprache auf einen Weg, dessen Hoffnung darauf beruht, daß er keinen Namen mehr hat. Die fernöstliche Weisheit sagt von ihm nur so viel: wer darüber rede, kenne ihn nicht; wer ihn kenne, rede nicht darüber.
Gelobt sei Diderot, der die Katze aus seinem Weltbild gehen ließ. Gelobt sei der Dichter Michael Krüger, der uns eine Ahnung davon vermittelt hat, wo sie hingelaufen ist. Und ein Gefühl dafür, daß wir sie nicht weit zu suchen brauchen. Das Beste ist niemals weit her. Und doch gibt es nichts Schwereres, als wirklich dort anzukommen, wo wir schon sind. Michael Krügers Gedichte haben die endlose Mühe dieses kurzen Weges nicht gescheut. Dafür erhält er heute den Peter-Huchel-Preis und unseren Dank.
Adolf Muschg, Laudatio auf Michael Krüger, 1986
Peter Huchel – Weltalte Schrift, weltaltes Zeichen
Ich habe lange überlegt, ob ich hier über den Haß und die Wut und die Aggressivität sprechen soll, die mir und meiner Arbeit, seit die Jury mir den Peter-Huchel-Preis zuerkannt hat, entgegengeschlagen ist. Je zwergenhafter die Literatur auf den Schultern einer riesenhaften, äußerst uninteressierten Gesellschaft ist, je brutaler die Umgangsformen. Auch dafür hätte ich bei Huchel gute Beispiele gefunden. Aber ich möchte auf diesen Vortrag verzichten. Statt dessen will ich Ihnen kurz meine Beziehung zu Peter Huchels Gedichten, zu seinem Werk und – sehr unterirdisch oder sehr vermittelt – zu seiner Person schildern, um für den Preis, der seinen lieben Namen trägt, zu danken. Also muß ich Sie bitten, mir nachzusehen, daß nicht nur von ihm, sondern auch von mir die Rede sein wird, was sich bei einer mehr als zwanzig Jahre andauernden Verehrung ohnehin nicht vermeiden läßt.
1961 habe ich zum ersten Mal bewußt ein Gedicht von Huchel gelesen: „Letzte Fahrt“, in Walter Höllerers Anthologie Transit, die damals schon einige Jahre auflag. Mit drei dicken Bleistiftbalken habe ich damals die Verse angemerkt: „Er sah die toten Träume ziehn / Als Fische auf dem Grund.“ 1932 geschrieben, wie in den Anmerkungen zu lesen ist, zum ersten Mal veröffentlicht 1934/35 im ersten Jahrgang vom Inneren Reich, wie man den schönen Gesammelten Werken entnehmen kann, wird in dieser schwarzen Ballade von der letzten Ausfahrt eines Fischers, des Vaters, eines Vaters – damals lebte Huchels Vater noch – berichtet, der, „der letzte Fang war schwarz und kahl, / das Netz zerriß im Kraut“, schließlich tot am See zurückbleibt, während der Sohn seiner Wege zieht:
Ich lausch dem Hall am Grabgebüsch,
Der Tote sitzt am Steg.
In meiner Kanne springt der Fisch.
Ich geh den Binsenweg.
Den Binsenweg, auf dem der Sohn davonläuft ins Leben, hatte schon der Vater genommen, als er zu seiner letzten Fahrt aufbrach, es sind stets dieselben Wege, die zum Tod wie ins Leben führen: was wir als Labyrinth, als Zufall, als Schicksal oder als nach eigenen Vorstellungen formbare Zeit erleben, ist nichts als ein Kreis. Und: Nichts ist umkehrbar, erzählt uns das Gedicht, auch wenn die Reime uns täuschen mögen.
Wie liest man Gedichte, wie las ich damals dieses Gedicht? War der Reflex, „die toten Träume“ anzustreichen, Ausdruck einer politischen Haltung oder nur eine romantische Geste? Las der achtzehnjährige Abiturient, der Nietzsche studierte und verehrte, und im Banne des Surrealismus Gedichte schrieb, in dem Bild des toten Vaters einen sterbenden Gott, oder sah er in der dunklen Gestalt des Fischers den Charon, den Fährmann der Seelen, der die Toten, eine Münze unter der Zunge, über den Grenzfluß der Unterwelt rudert? Oder war diese düstere Figur ein melancholischer Bruder des Orpheus, bei dessen Gesang der Legende nach die Fische aus dem dunklen Wasser emporsprangen – einer von denen also, wie ich sie zumindest aus einem Gedicht von Ingeborg Bachmann kannte:
Wie Orpheus spiel ich
auf den Saiten des Lebens den Tod
und in die Schönheit der Erde
und deiner Augen, die den Himmel verwalten,
weiß ich nur Dunkles zu sagen.
Vergiß nicht, daß auch du, plötzlich,
an jenem Morgen, als dein Lager
noch naß war von Tau und die Nelke
an deinem Herzen schlief,
den dunklen Fluß sahst,
der an dir vorbeizog.
Ich weiß nicht mehr, wie ich das Gedicht „Letzte Fahrt“ verstand, doch kann ich mich gut daran erinnern, wie der Ton haften blieb, die dunkle Melodie, die zerrende Traurigkeit: „Er sah die toten Träume ziehn. / Als Fische auf dem Grund“ – bis heute werde ich auf eine harte Probe gestellt, wenn ich diese Verse lese.
Im August jenes Jahres meiner ersten Bekanntschaft mit einem Gedicht von Peter Huchel wurde die Mauer gebaut, Charon bekam viel zu tun, und es blieb nicht bei einer Münze unter der Zunge. Die Schilder „You are leaving the American Sector“, die wir bis dahin nicht sonderlich ernst genommen hatten, wenn wir im Glienicker Forst unsere Streifzüge unternahmen, zeigten nun ihren bedrohlichen Charakter: die Welt dahinter, in der ich geboren war, hatte man abgeriegelt. Vorläufig war es also aus mit den Besuchen im Berliner Ensemble oder bei den Buchhändlern und Antiquaren Unter den Linden, wo ich mir, ebenfalls 1961, die zweibändige Ausgabe der Philosophischen Schriften von Diderot gekauft hatte, die mit dem sonderbaren Motto eröffnet: „Quis leget haec? – Wer wird das schon lesen?“, von den Radtouren nach Klein-Machnow, wo es billige Wasserflöhe gab, ganz zu schweigen. Berlin war endgültig geteilt. Zehn Jahre vorher hatte Huchel vor dem Groß-Berliner-Komitee der Kulturschaffenden gesagt: „Den Blick auf das Berlin des Jahres 1952 richten, heißt den Blick auf das gespaltene Deutschland richten. Hier in Berlin klafft die Schnittwunde für ganz Deutschland, ja für ganz Europa. Durch das radikale Zerschneiden der Millionenstadt in zwei Hälften, das mit viel betäubenden Phrasen vorgenommen wurde, durch das Aufzwingen von zweierlei Währungen ist der Blutkreislauf so schwer gestört und geschwächt worden, daß die Wunde sich nicht schließen will. Sie schwärt immer weiter.“ Das war 1952, zehn Jahre später war die Wunde immerhin politisch ausgetrocknet: aber sie schmerzt bis heute.
Nach meinem mit Ach und Krach durchträumten Abitur fuhr ich mit dem Fahrrad über die Brücke zurück nach Hause, unter der die Avus an den Grenzkontrollpunkt Dreilinden führte. Man war dabei, den Kiefernwald, durchsetzt mit Birken, in dem ich, statt zu lernen, die ganze Schulzeit über gespielt und gelesen hatte, abzuholzen, um freiere Sicht zu haben auf Grenzgänger. Meine Straße hieß Potsdamer Chaussee. Sie hätte, an Kleists Grab vorbei, direkt zu Huchel führen können, der damals von einer Gruppe von Schriftstellern und Intellektuellen, die sich – aus was für Gründen der Vernunft auch immer – mit der Staatsmacht verbunden hatte, seines Postens als Chefredakteur von Sinn und Form enthoben worden war. Diese Gotsches, Abuschs, Kurellas oder Bredels, die heute kaum noch einer kennt, fühlten sich sicher im Recht, weil ihr Recht die Macht war. „Ich habe, wie Sie wissen müssen, der Partei niemals angehört, schrieb Huchel später, und wünschte daher nicht, nach ihrem Reglement abgeurteilt zu werden, sondern ich behielt mir das Recht vor, das Maß an persönlicher Freiheit in Anspruch zu nehmen, das, wie ich glaube, jedem Menschen zusteht.“ Noch war das voraufgegangene Kapitel des deutschen Dauer-Dramas Literatur und Macht nicht abgeschlossen, da war das nächste schon aufgeblättert: wenn man die frühen, heute vergilbten Sinn und Form-Hefte in die Hand nimmt – und als Zeitschriftenherausgeber muß man sich auch heute gelegentlich Mut machen -, dann kommt einem die Entsetzung Huchels wie ein logischer Schluß vor: diese Zeitschrift war in ihrer theoretischen Konsequenz der heftigste Einspruch gegen all das, was in dem Kompositum Staatliche Kulturpolitik drohend zusammengezogen ist. Als Huchel 1963 den West-Berliner Fontane-Preis erhalten sollte, entwarf ihm, ungefragt, Kurella, damals Sekretär der Ost-Berliner Akademie, sogar den Brief an Rudolf Hartung von der West-Berliner Akademie, mit dem er den Preis ablehnen sollte: „Deshalb müssen Sie mit dem Ausdruck des Leidwesens gegenüber der Jury Ihre Zustimmung zu dem Preis rückgängig machen.“
Ich begann meine Lehre als Buchhändler und Drucker in einem Verlag am Hohenzollerndamm, hundert Meter von der Berliner Dependence des Fischer-Verlages entfernt, wo dieser Rudolf Hartung, den ich mittags manchmal besuchen durfte, die Neue Rundschau redigierte. Er erzählte mir auch von Peter Huchel, über den er später in seinem Tagebuch notierte: „Nach vielen Jahren habe ich den Lyriker Peter Huchel wiedergesehen, dem man vor einiger Zeit endlich erlaubt hat, die DDR zu verlassen. Gegenwärtig war mir, als ich zu ihm in die Akademie fuhr, noch unsere erste Begegnung 1956 auf einem Schriftstellerkongreß in Ostberlin. Ich war mit einem Freund hinübergefahren, wir gerieten, uneingeladen, in eine Sitzung der ,Sektion Lyrik’, auf der der inzwischen verstorbene Georg Maurer einen Vortrag über westdeutsche Lyrik hielt. Im Anschluß an den Vortrag wurde diskutiert, und während ich, was mir damals noch sinnvoll schien, Positives über die soziologische Betrachtungsweise Maurers sagte und hernach anderes kritisierte, ging ein mir Unbekannter an mir und dem Mikrophon vorbei und sagte leise ,Geben Sie es ihnen nur recht’ zu mir. Das Gesicht des Mannes fiel mir sofort auf, weil es so anders war als die anderen Gesichter: die vielen dunklen Haare verliehen dem Kopf ein nächtliches, ein gleichsam rabenhaftes Aussehen, der Mann wirkte unter den übrigen Schriftstellern, die mir eher wie Techniker oder Funktionäre vorkamen, sehr fremd, und ich glaubte zu spüren, daß auch er sein Fremdsein empfand. Nach Beendigung der Sitzung ging ich zu ihm, es war Huchel.“
Wie gut Rudolf Hartung, der unerhört kurzsichtige Mensch, der so viel von Physiognomie und Literatur verstand, beobachtet hatte, zeigt ein Selbstporträt Huchels aus dem Jahr 1931: „Ob er in Balzik am Schwarzen Meer lebt oder in Bayonne am Atlantischen, da gibt es wenig Unterschied. Denn das europäische Gesicht hat überall die eine Müdigkeit für den, der zwischenzeitig geboren ist und im Jahre neunzehnhunderttraurig. Er ist schon zu spät auf die Welt gekommen: er wird nie zur Zeit kommen.“
In diesem Bekenntnis – etwa um dieselbe Zeit geschrieben wie Letzte Fahrt -, versteckt sich eine Konzeption des Dichters und seiner Arbeit, die ganz im Gegensatz zu jeder offiziellen Kulturpolitik, die auf Zeitgenossenschaft pocht, steht. Sie richtet sich nicht nach dem Kompaß der Meinungen, nicht nach herrschender Zeit und nicht nach herrschender Zeitung. „Wenn Künstler wirklich für ein Bild oder ein Gedicht einstehen können“, sagte Huchel in einem Interview, „spielt die Zeit gar keine Rolle. Sie kommt zu ihnen, jetzt oder später.“
Das erste Buch dieses alles andere als zeitlosen Solitärs kaufte ich mir 1963, den Gedichtband Chausseen Chausseen, und er ist mir bis heute sein liebster geblieben; besonders die Gedichte des fünften und letzten Teils haben es mir angetan, ein von unendlicher Melancholie durchtränkter Abgesang, der mit den bitter-verbitterten, ein wenig an Brecht gemahnenden Worten ausklingt:
Und nicht erforscht wird werden
Ein Geschlecht,
Eifrig bemüht,
Sich zu vernichten.
In meinem Exemplar von Chausseen Chausseen liegt neben einer Besprechung aus der FAZ, die immerhin „fünf oder sechs, vielleicht sieben sehr schöne Gedichte“ ausmacht – so weit habe ich es, wie Sie wissen, in dieser Zeitung noch nicht gebracht −, liegt neben diesem Ausriß von Holthusen auch die Jahresgabe des Fischer-Verlages von 1963 mit Faksimile-Wiedergaben dreier Gedichte Huchels – eine runde, trotzige, selbstbewußte Schrift auch dann noch, wenn sie nichts Gutes verheißt:
Die Öde wird Geschichte.
Termiten schreiben sie
Mit ihren Zangen
In den Sand.
Ich war zwanzig Jahre alt, als ich diese Zeilen aus dem Psalm las. Was faszinierte mich an dieser letzten Botschaft des Bandes, an dieser schwarzen Prophetie der Vergeblichkeit? Was fasziniert mich bis heute daran? „Nicht die Dichter sind es“, heißt es in Platons Ion, „die uns so wunderbare Dinge sagen, sondern es ist die Stimme Gottes, die durch ihren Mund spricht.“ Aber 1963, nach dem Krieg und nach Benn und Brecht, nach der möglich gewordenen Vernichtung des Erdballs, auf die der „Psalm“ auch antwortet – wie konnte da einer immer noch hoffen, Medium einer älteren Erfahrung zu sein? In dieser Poesie, wie in der von Celan und Ingeborg Bachmann, das dämmerte mir damals, ohne daß ich es recht benennen konnte, lebte ein Stück ältester Magie weiter, die sich gegenüber den herrscherlichen Ansprüchen von Aufklärung resistent verhielt: Der Text hatte nicht nur eine eigene Wirklichkeit, die mit meiner Wirklichkeit zunächst einmal nicht viel gemeinsam zu haben schien, sondern sollte – mit metaphorischen Mitteln, dazu sind sie ja da – auch als Zauberspruch nachgesprochen werden, um die andere Wirklichkeit zu verwandeln – und zwar gegen jede Erfahrung. Die Erfahrung – so naiv waren wir ja nicht mehr – sprach gegen das Gedicht, und zwar so mächtig und unerbittlich, daß sowohl ein „vernünftiger“ wie ein „poetischer“ Einspruch gegen sie zum Scheitern verurteilt war: Erfahrung und Geschichte waren eine Zweck-Ehe eingegangen, in der Gefühl und Vernunft, aus deren Vermischung Gedichte hervorgehen, nichts zu suchen hatten. An diesem Tatbestand – dessen ideologische Vorzeichen wechseln – hat sich die Moderne seit der Romantik abgearbeitet: mal redlich, mal verzweifelt, mal in hybrider Selbstüberschätzung, ein selbständiges Universum mit eigener Moral und eigener Metaphysik. Und immer hat sie ihr heilloses Heil bei den älteren Quellen gesucht, die noch nicht vom jeweils zeitgenössischen Herrschaftswissen vergiftet sind: „Sie werden bemerkt haben“, sagte Huchel häufig, „daß die Bibel zu meinen Lieblingsbüchern gehört. Außerdem verehre ich die Mystiker, vor allem Jakob Böhme.“ Die heutigen Literaturpolizisten, die mit gezücktem Messer die Poesie nach Stellen absuchen, mögen schaudern, wenn sie bei ihrer Gepäckuntersuchung auf das Wort Mystik treffen, aber offenbar gehört es zum Paradox des modernen Dichters, zugleich in dieser gegenwärtigen und in einer anderen Welt zu leben, offenbar ist diese für viele Zeitgenossen verwerfliche Lebensform Bedingung dafür, Aussagen jenseits der modernen Gewinn- und Verlust-Ethik zu formulieren. Und Huchel – Insistenz ist allemal heilsam, wie es bei Adorno heißt – hat nicht aufgehört zu betonen, was er von Leuten hält, die versuchen, gleichsam „den metallenen Glanz eines Septembergedichtes mit einem Büchsenöffner aufzureißen, um den vermutlichen Inhalt zu entdecken. Genausogut könnte man versuchen, mit einer Sense die Abendröte aufzuschneiden, um dahinter den Himmel zu entdecken.“
Und er empfand es auch als ganz selbstverständlich, immer wieder und über Jahrzehnte hinweg zu versichern: „Ich raune ja meist meine Verse vor mich hin“ – ganz so, wie man einen magischen Zauberspruch vor sich hinmurmelt, um die bösen Geister zu bannen. Man kann sich vorstellen, daß ein solches Produktionsverfahren im 20. Jahrhundert nicht gerade auf Gegenliebe stößt: „Ein Wortklang, eine Metapher, einige Wörter, die man dann oft monatelang im Munde kaut, tauchen auf – gewissermaßen ein paar Eisenspäne, die noch außerhalb des magnetischen Feldes liegen. Im späteren Prozeß wird das Bild zum Gleichnis, das heißt, der Magnet strukturiert die Eisenspäne. Und wenn sich dort am äußersten Rand Erfahrung mitteilt, dann kann das Gedicht gelingen.“
Die Stille, die dem Wort voraufgeht, ein paar Wörter, Raunen, eine Fügung und ein Gedicht als Resultat. Mit anderen Worten, das Gedicht entspringt einer Haltung gegenüber der Welt, die nicht erlernbar ist und kaum gefördert wird; es ist ein langes Horchen, ein geduldiges Nachsprechen, ein kindliches Wiederholen: es ist ein maßloser Anspruch, der umso maßloser erscheint, je weniger zuhören. Auch wenn es dieselben Wörter benutzt wie jeder andere Text auch, kommt beim Gedicht noch etwas hinzu, das es ausmacht: das tiefe Vertrauen darauf, daß das Wort, trotz aller Niederlagen, Verzerrungen und Zerstörungen, im richtigen Moment, im Moment der Inspiration – wann und wie immer er sich einstellt – die Wahrheit spricht: wer dieses Vertrauen, das in unserer Medienwelt systematisch denunziert wird, verliert, hat als Dichter verloren. Für unsere linguistisch erzogenen Ohren ist die Vorstellung, daß sich in den kleinen Wörtern so große Sachen wie die Wahrheit verbergen sollen, ein starkes Stück – und der Grund dafür, daß andere Text-Sorten, wie der Terminus heißt, stärkere Konjunktur haben als die Poesie. Aber es muß bei diesem Vertrauen, so skeptisch wir auch sein mögen, bleiben, es ist die Substanz, ohne die es keine Dichtung gibt: sie ist Fluch und Freiheit in einem.
Rabbi Mosche von Kobryn lehrte – nach Bubers Erzählungen der Chassidim -: Wenn Du ein Wort vor Gott sprichst, geh Du mit allen Deinen Gliedern in das Wort ein. Ein Hörer fragte: Wie soll das möglich sein, daß der große Mensch in das kleine Wort hineinkomme? Wer sich größer dünkt als das Wort, sagte der Zaddik, von dem reden wir nicht.
Nun sind gewiß die Menschen, die sich größer dünken als das Wort, in der Mehrzahl; und es sieht ganz so aus, als könnte die Mehrzahl bald aufs Wort verzichten, aller gutmeinenden Kommunikationstheorie und Diskursethik zum Trotz – ein Beispiel haben sie ja gegeben. „Klasse, Super, Spitze“, damit hat es sich für viele jetzt schon.
Unter der Wurzel der Distel
Wohnt nun die Sprache,
Nicht abgewandt,
Im steinigen Grund.
Ein Riegel fürs Feuer
War sie immer.
Es fällt heute schwer, den Trotz dieser Zeilen nicht mit nostalgischer Wehmut zu lesen. Das Ganze, von dem die Dichter vergeblich hoffen, es möge sich noch einmal zeigen, hat Risse: unübersehbar. „… im großen Hof meines Gedächtnisses. Daselbst sind mir Himmel, Erde und Meer gegenwärtig“ – dieses Wort von Augustinus hatte Huchel den Chausseen Chausseen vorangestellt, und er hat zehn Jahre später hinzugefügt: „Wir alle wissen, eine Bahn der Verwüstung ist durch diesen Hof gegangen.“
Mit dieser Verwüstung müssen wir leben, es wäre nicht mehr naiv und verzeihlich, sondern nur noch dumm und unverzeihlich, sie zu leugnen. Wir sind ein Teil dieser Verwüstung, die wir selbst mit hervorbringen: keiner, und schon gar nicht die Dichter, kann sich ausnehmen. So laufen wir detachiert, desorientiert über den „Hof des Gedächtnisses, heben, trotz aller Warnung, den Stein auf, den Speicher aller Stille, nehmen hier, in der Mitte der Dinge, die Trauer wahr, fragen uns bang Wer schrieb / die warnende Schrift / kaum zu entziffern“; lesen:
AN TAUBE OHREN DER GESCHLECHTER
Es war ein Land mit hundert Brunnen.
Nehmt für zwei Wochen Wasser mit.
Der Weg ist leer, der Baum verbrannt.
Die Öde saugt den Atem aus.
Die Stimme wird zu Sand
Und wirbelt hoch und stützt den Himmel
Mit einer Säule, die zerstäubt.
Nach Meilen noch ein toter Fluß.
Die Tage schweifen durch das Röhricht
Und reißen Wolle aus den schwarzen Kerzen.
Und eine Haut aus Grünspan schließt
Das Wasserloch,
Als faule Kupfer dort im Schlamm.
Denk an die Lampe
Im golddurchwirkten Zelt des jungen Afrikanus:
Er ließ ihr Öl nicht länger brennen,
Denn Feuer wütete genug,
Die siebzehn Nächte zu erhellen.
Polybios berichtet von den Tränen,
Die Scipio verbarg im Rauch der Stadt.
Dann schnitt der Pflug
Durch Asche, Bein und Schutt.
Und der es aufschrieb, gab die Klage
An taube Ohren der Geschlechter.
Es ist die „weltalte Schrift“, das „weltalte Zeichen“, die Peter Huchel, wie jeder große Dichter, weiter geschrieben und neu entziffert hat. Das war mühselige Arbeit, und sie hat ihn – ein weiteres Paradox, das heute, da die Heiterkeit grassiert, vielen unverständlich ist – glücklich gemacht. Als mir mitgeteilt wurde, daß ich den Peter-Huchel-Preis erhalten solle, mußte ich daran denken, daß ich, mehr als zehn Jahre nach ihm, im selben Zimmer der Villa Massimo, meinen Gedichtband Die Dronte geschrieben habe. Wenn ein Gran seines Glücks und seines Ernstes und – entschuldigen Sie das Wort – seiner Lauterkeit in meiner Arbeit zu finden ist, dann sicherlich durch seine fortwährende Anwesenheit in jenem kalten römischen Winter. Ich habe also auch – sehr unterirdisch und sehr vermittelt – Peter Huchel zu danken, wenn ich mich nun bei der Jury, die mich für diesen Preis vorgeschlagen hat, bei dir, lieber Adolf, für die Begründung dieses Vorschlags, und bei den Stiftern des Preises, die dem Vorschlag gefolgt sind, bedanke.
Michael Krüger, Dankesrede, 1986
Mitschnitt der Preisverleihung vom 3.4.1986
Welche Poeme haben das Leben und Schreiben von Karl Mickel und Volker Braun in der DDR und Michael Krüger in der BRD geprägt? Darüber diskutierten die drei Lyriker und Essayisten 1993.
Das Werk: Michael Krüger am 14.6.2004 im Literarischen Colloquium Berlin
Frank Wierke: Verabredungen mit einem Dichter – Michael Krüger
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Gregor Dotzauer: Das unbändige Leben der Agaven
Der Tagesspiegel, 9.12.2013
Volker Isfort: Er wird noch gebraucht
Abendzeitung München, 8.12.2013
Thomas Steinfeld: Herr K. tritt ab
Süddeutsche Zeitung, 9.12.2013
Charles Simic: Der Regenmantelmann
Neue Zürcher Zeitung, 9.12.2013
Norbert Gstrein: Der leere Raum
Neue Zürcher Zeitung, 9.12.2013
Cees Nooteboom: Der andere Atem
Neue Zürcher Zeitung, 9.12.2013
Peter von Matt: Der Freund auf der Kommandobrücke
Neue Zürcher Zeitung, 9.12.2013
Hans-Dieter Schütt: Warum fallen Sterne nicht herab
neues deutschland, 9.12.2013
Mara Delius: Nach draußen, hinein ins Buch
Die Welt, 9.12.2013
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Britta Schultejans: Michael Krüger wird 75
Abendzeitung, 7.12.2018
Georg Reuchlein: Michael Krüger (75)
BuchMarkt, 9.12.2018
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Gerrit Bartels Interview mit Michael Krüger: „Gott ist ein Melancholiker“
Der Tagesspiegel, 7.12.2023
Willi Winkler Interview mit Michael Krüger: „Ich habe mich der Literatur höflich genähert“
Süddeutsche Zeitung, 7.12.2023
Arno Widmann: Der virtuose Gesang und der Schrei
Frankfurter Rundschau, 9.12.2023
Andrea Köhler: Kaum einer hat so viele Literaturnobelpreisträger in seinem Verlag versammelt wie Michael Krüger
Neue Zürcher Zeitung, 8.12.2023
Hannes Hintermeier: Schwimmer im Meer der Gedichte
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.12.2023
Hans-Dieter Schütt: Wie kommen Sterne an den Himmel?
nd, 8.12.2023
Leander Berger: Lesen als Lebensmittel
Badische Zeitung, 9.12.2023
Quh: Freund der Ziegen
quh-berg.de, 9.12.2023
Martin Schult: „Danke“
Börsenblatt, 8.12.2023
Volker Weidermann: Küsse, Nasenküsse, Ringkämpfe. Abschiedsfest für Michael Krüger.
Ein Abend für Michael Krüger. Michael Krüger ist eine Legende des Literaturbetriebs. Am 16.1.2014 sprach er in der Literaturwerkstatt Berlin mit Harald Hartung über seine Arbeit als Verleger, Herausgeber, Autor und Übersetzer.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Michael Krüger – Lebenselixier Literatur im Gespräch mit Norbert Bischofberger, SRF 22.9.2013.


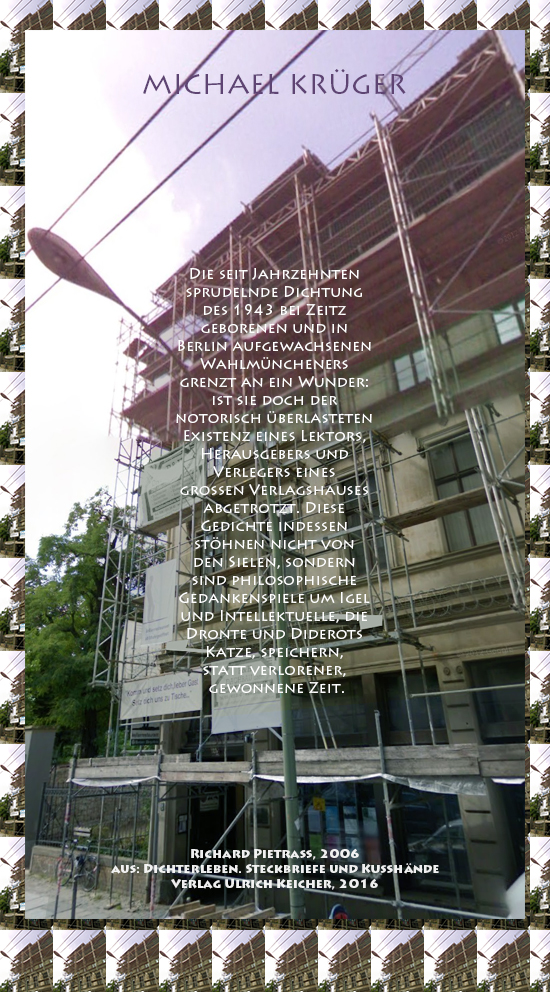












Selbstvorstellung
Anläßlich der Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
Die Verwunderung darüber, von Ihnen in diese Akademie gewählt worden zu sein, ist eine wiederkehrende Figur in den Selbstbeschreibungen, mit denen neue Mitglieder sich hier vorgestellt haben. Ich hoffe, ich enttäusche Sie nicht zu sehr, wenn ich diese Verwunderung ganz ernsthaft für mich in Anspruch nehme: aber das, was ich geschrieben habe, läßt sich beim besten Willen nicht als „Werk“ bezeichnen, nicht einmal als „Bruchstücke zu einem Werk“, also allenfalls als Bruchstücke. Lauter Vorlaute, Vorworte, Vorsätze, deren vorläufiger Charakter in die Augen springt. Ob es zu einer Hauptsache je kommen wird, muß ich bezweifeln: zu umfangreich und disparat sind die Notizen, zu vermessen die Pläne, zu einschüchternd die Bücher in meinem Kopf, als daß ich Hoffnung haben dürfte, dafür je eine angemessene, notwendige Form zu finden. Der einzige Trost, den ich in dieser trostlosen Situation habe, ist der Umstand, daß das Buch, das ich schreiben möchte und nie schreiben werde, auch von anderen Autoren noch nicht geschrieben wurde; also schweige ich besser über meine Absichten.
Ob es überhaupt sinnvoll ist, auf dieses große Werk, Das Buch, zu hoffen, scheint mir fraglich: die Literatur gehört zu den schmählichen und stolzen Verlierern dieses zu Ende gehenden Jahrhunderts, und kein rilkescher Engel weit und breit, diese Niederlage noch einmal in einen ästhetischen Triumph umzuschreiben. Diese Gesellschaft braucht ganz offenbar nicht mehr die Kunst, um an ihrer Wahrheit zugrunde zu gehen. Früher habe ich optimistischer gedacht. Früher – verzeihen Sie, wenn ich mir hier eine regelrechte Biographie zurechtlege -, das waren die sechziger Jahre in Berlin mit Walter Höllerers Literarischem Colloquium, mit Peter Weiss, Ingeborg Bachmann, Nicolas Born und Wolfgang Maier, um nur von den Toten zu sprechen, mit den Stipendiaten der Ford-Foundation, die uns handgreiflich vorführten, was Weltliteratur ist, mit den Vorlesungen Peter Szondis, die ich, wenn sie abends stattfanden, als Gasthörer besuchen durfte: Literatur war so selbstverständlich, daß man gar nicht auf die Idee kam, an ihr zu zweifeln; das sollte sich bald ändern.
Tagsüber mußte ich in eine andere Lehre gehen in einem Verlag und in einer Druckerei, deren Maschinen heute bereits im Museum stehen, ohne noch den wunderbaren Geruch zu verströmen, der zu ihrer Existenz und einige Zeit auch zu meiner gehörte. Ich wusch mir die Hände, zog ein reines Hemd an und ging als Buchhändler nach London, wo ich bei Harrods internationale Literatur verkaufte. Der Bibliothekar der Königin brachte die Two Views von Uwe Johnson und die Romane von Claude Simon und Michel Butor, die ich ihm aufgeschwatzt hatte, am darauffolgenden Tag wieder zurück und weigerte sich empört, stattdessen Cat and Mouse oder die englische Ausgabe der Strudlhofstiege anzunehmen. Nach meinem Weggang, so bilde ich mir wenigstens ein, hatte es die deutsche Literatur nicht nur in Windsor Castle, sondern in ganz England noch schwerer.
In England erfuhr ich zum ersten Mal in meinem Leben von den dort schreibenden Emigranten, was es heißt, ein Emigrant zu sein, und ich erinnere mich noch gut meiner inneren Bewegung, als ich, das war wieder in Berlin, den damaligen Senator Arndt die inständige Bitte an die Emigranten aussprechen hörte, nach Deutschland zurückzukehren; das hatte man bislang offenbar vergessen. Ich las die Bücher der Emigranten, namentlich die der Frankfurter Schule, deren Schüler ich gern gewesen wäre, so wie es vorher mein Wunsch gewesen war, einmal Sekretär von Diderot gewesen zu sein; hoffnungslose Wünsche.
Seit dieser Zeit habe ich in den Büchern anderer Autoren mehr Zeit gewidmet als den eigenen – als Rezensent, der ich durch die freundliche Aufforderung von Karl Heinz Bohrer wurde und der ich durch die freundliche Insistenz von Rolf Michaelis noch bin; als Verlagslektor, dank der Fürsprache von Fritz Arnold und Reinhard Lettau; und aIs Herausgeber einer Literaturzeitschrift, deren Redaktion mir von meinem Freund Hans Bender übertragen wurde. Ohne diese und andere Freunde wäre ich gar nichts geworden.
Warum ich mich so ausgiebig auf ,sekundäre‘ Weise mit Literatur beschäftige, vermag ich nicht zu sagen. Vielleicht aus Skepsis, vielleicht aus Feigheit, vielleicht auch deshalb, weil ich Zeuge wurde des sich beschleunigenden Verfalls der ästhetischen Wahrnehmung, eines Verfalls, den ich gerade als Skeptiker aufhalten wollte. Warum eigentlich? Weil nicht Hegel, nicht Nietzsche, nicht Freud und keine Preisfrage der Akademie bislang restlos geklärt haben, was uns fehlen würde, wenn die Spielart und Erkenntnisweise der Imagination, die wir Literatur nennen, auf einmal verschwände. Verlustängste.
Solange jedenfalls dieses Problem nicht hinreichend geklärt ist und das wird gottlob noch Zeit brauchen -, solange wird mich die Literatur beschäftigen: eine etwas altmodische, spinnwebenhafte Anstrengung vielleicht angesichts der gegenwärtigen Situation, aber offenbar die einzige, die mich reizt.
Ob Sie nun gut beraten waren, einen mit vierzig Jahren – ich bin 1943 in Wittgendorf/Kreis Zeitz geboren – wenig optimistischen, kaum vielversprechenden Autor, der mit fast leeren Händen vor Ihnen steht, in Ihre Akademie zu wählen, wird die Zukunft zeigen, wenn sie sich zeigen sollte. Weil das ungewiß ist, möchte ich mich schon jetzt bei den Mitgliedern, die mich vorgeschlagen haben, und bei allen Mitgliedern, die diesem Vorschlag zugestimmt haben, herzlich bedanken.
Michael Krüger 1983, aus: Michael Assmann (Hrsg.): Wie sie sich selber sehen. Antrittsreden der Mitglieder vor dem Kollegium der Deutschen Akademie, Wallstein Verlag, 1999.