Ursula Krechel: Nach Mainz!
UMSTURZ
Von heut an stell ich meine alten Schuhe
nicht mehr ordentlich neben die Fußnoten
häng den Kopf beim Denken
nicht mehr an den Haken
freß keine Kreide. Hier die Fußstapfen
im Schnee von gestern, vergeßt sie
ich hust nicht mehr mit Schalldämpfer
hab keinen Bock
meine Tinte mit Magermilch zu verwässern
ich hock nicht mehr im Nest, versteck
die Flatterflügel, damit ihr glauben könnt
ihr habt sie mir gestutzt. Den leeren Käfig
stellt mal ins historische Museum
Abteilung Mensch weiblich.
Über das Näherrücken älterer Tische
– Eine Nachbemerkung. –
Als dieser Band im Frühjahr 1977 zum ersten Mal erschien, war er in meiner Vorstellung längst überfällig. Ich hatte die Gedichte in zwei, drei Jahren geschrieben, nicht besonders schnell, nicht besonders langsam, an einem geliehenen Tisch in Berlin, einem übriggebliebenen Tisch in Darmstadt, an einem ertrödelten in Frankfurt, an Fluchttischen, Wandertischen und Klapptischen in Eisenbahnabteilen, Tischen, zu denen ich zurückgekehrt bin und von denen ich wieder aufgebrochen bin, eine unablässige Bewegung, in der allein die Tische auf festem Boden standen. Ich erinnere mich deutlich an die splitternden Furnierstreifen des berliner Tisches, die braunen Kreise, die die Teetasse auf dem hellen darmstädter Tisch zog, die Lücken zwischen den Bohlen des frankfurter Tisches, die so breit waren, daß ein Gedichtband dazwischenpaßte und aufrecht stehenblieb. Tag für Tag sausten vor meinem berliner Tisch Kinder eine Rutschbahn herunter, ihre Rufe drangen in die Gedichte. Vor dem darmstädter Tisch wuchs ein Kirschbaum, der eines Tages wie alle Kirschbäume in der Literatur abgeholzt wurde. Vier Stockwerke unter dem frankfurter Tisch strebten Sanitäter mit Tragbahren im Laufschritt dem Hintereingang eines Krankenhauses zu, Taxifahrer beschimpften ihre Zentrale an der Rufsäule, ich hörte das Martinshorn und die Sirene der amerikanischen Militärpolizei gellen, als sei das IG-Farben-Haus in Brand gesteckt worden, als seien die Kabel des roten Telefons durchgeschmort. Auch das drang in die Gedichte.
Ich hatte mir eng begrenzte Experimentierfelder ausgesucht, vielleicht der Platte eines Tisches vergleichbar, und immer war im Persönlichen das Politische, in der schweifenden Form eine Festigkeit, der ich trauen lernte; in den Gedichten begriff ich, was ich in Begriffen nie begreifen wollte. Oder waren es die falschen Begriffe? Hatte ich die begrenzte Fläche des Tisches vor mir, so waren seine geraden Kanten bald durchlässig, unter dem Tisch war eine Welt, am Rande des Tisches war noch Krieg, die eine Hälfte war in der Hand von Aufständischen, und legte ich mich auf den Boden, was ich gerne tat, wie sollte ich die vormals begrenzte Fläche, die jetzt ein schiefes Dach war, ein Säulenhimmel, beschreiben? Perspektivenwechsel, Ortswechsel. In den Titeln von zwei Gedichten taucht das Problem des perspektivischen Sehens und Schreibens auf. Wo ist der Ort des Schreibens? In jedem Gedicht muß ich mich seiner neu versichern. Wüßte ich ihn, ich schriebe keine Gedichte. Als ich an Nach Mainz! arbeitete, wünschte ich mir Gedichte, die viele begreifen konnten. Wer viele sind und was sie begreifen, darüber wundere ich mich bis jetzt. Ich für mein Teil wollte ja selbst nicht alles begreifen, was ich schrieb und was zu schreiben ich unterließ. Das wäre das blanke Ende aller Gedichte.
Es war eine Ungeduld in mir wie eine Wetterfühligkeit. Diese Ungeduld bezog sich nicht nur auf Gedichte. Was ich begriffen hatte, sollte wirklich sein. Was gerecht und vernünftig war, sollte möglich sein. Auch das Unmögliche sollte möglich sein. In meiner Erinnerung klopfte ständig jemand auf Holz, Hände wurden geschüttelt, Arme ineinandergehakt, Ärmel aufgekrempelt. Machen und Wissen und Schreiben: konnte das eins sein? Ich war so ungeduldig, damit ich die Hoffnung darauf nicht zwischen zwei Kalenderblättern verlor. Ich habe die Gebärde in Erinnerung, ständig Wolken wegschieben zu müssen. Ständig auf Zehenspitzen zu stehen, auf Zehenspitzen einzuschlafen und aufzuwachen, als sei dies das Natürlichste der Welt. Daß auch Gedichte allein auf Zehenspitzen stehen konnten, während ich am Schreibtisch sitzen blieb, das war eine schmerzhafte Erfahrung, die ich ungeduldig vermeiden wollte. Alles sollte hell und licht und durchsichtig sein bis in die Träume. Ich hatte ja meine Wünsche, die nicht nur meine Wünsche waren, begriffen, aber die Wünsche produzieren ihre eigenen Widersprüche und schließlich einen Widerwillen gegen ihre Objekte. Davon später. Die Gedichte, die von wirklichen Menschen handelten, zeigte ich den betreffenden Menschen, zeigte sie ihnen häufig wieder und wieder, bis ein Einverständnis da war zwischen dem Gedicht, den Menschen, von denen es sich losgelöst hatte, und dem Eigensinn der Schreibenden, der manchmal das Gedicht (in einer frühen Fassung) und manchmal die Menschen verletzt hatte. Meistens stritt ich jedoch gegen mich selbst.
Eine beharrliche, unbekümmerte Sucht nach einer vollkommenen Unvollkommenheit. Was hell und licht sein sollte, darüber ergossen sich Blutbäche aus den Spätnachrichten, Nachbarn fielen in Zeilenbrüche und verschwanden für immer, einfache Wörter stülpten sich um und bedeuteten seit gestern ihr Gegenteil. Wer gestorben war, war toter als je zuvor, und wir gewöhnten uns daran. Machen und Wissen und Schreiben brachen in drei Hälften, niemand konnte sie zusammensetzen, immer störte ein Teil. Was unmöglich schien, wurde in Beton gegossen. Was gerecht und vernünftig und schön war, wanderte ins Museum, das wegen Personalmangel im Winter geschlossen blieb. Auch die Beschilderung hatte man vergessen. Wußte ich denn, was gerecht und vernünftig war? Das war noch nicht das blanke Ende. Was hell und licht sein sollte, war nicht immer leicht unter der wachsenden Traurigkeit der siebziger Jahre hervorzukehren. Ehe nur noch der Inhalt einer aus dem Leim gegangenen Milchtüte auf dem Fußboden hell und licht ist, schweige ich lieber. Der Mangel gräbt sich Maulwurfshügel, die vielleicht in einer anderen Zeit wie Gedichte aussehen, und die lange genug ausgehaltene Traurigkeit gräbt sich ans Licht.
An manchen Tagen, während ich diese Gedichte schrieb, lag ich mir selbst in den Ohren mit der Klage um ein Paradies, das ich mir nicht vorstellen konnte. Nicht einmal die begrenzte Fläche eines Tisches konnte ich mir vorstellen, wenn ich an einem anderen saß. Nicht einmal ein anderes Gedicht, solange ich eines schrieb.
Ich habe kein Passepartout, um meine Gedichte aufzuschlüsseln. Der Zugang ist nicht versperrt. Wer sie lesen will, findet wie der glückliche arbeitslose Dieb den Schlüssel unter der Matte. Für Klugheiten gibt es Schachteln und Mottenkugeln für eine gepflegte Zeitlosigkeit und eine chemische Reinigung für die befleckte Empfängnis der Poesie. Ich gebe zu, daß Einfachheit eine Fiktion ist, ein Zufluchtsort vor einer gewalttätigen Wirklichkeit wie ein utopisches Mainz, wie ein Tisch eine Fiktion ist und der Ort des Gedichts auf einer schlingernden Erdkugel. Wer immer schon angekommen ist, für den wurden diese Gedichte nicht geschrieben. Wer sich das Maul mit der eigenen Großhirnrinde stopfen will, erstickt ohnehin. Ich habe den Tischen, an denen ich diese Gedichte schrieb, viel zu danken. Auch den Menschen, die mich an diesen Tischen ruhig schreiben ließen. Auch den Kanten der Tische, von denen vieles herunterfiel, an das ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Einige Fäden habe ich wieder aufgegriffen. Zwölf Gedichte sind in dieser Taschenbuchausgabe hinzugekommen, einige fanden sich in alten Mappen, andere sind neu geschrieben – auf der Grundlage alter Entwürfe. Noch einmal habe ich Menschen herbeigeschrieben, noch einmal bin ich auf Menschen zugegangen, aber ich bin eine andere geworden, die Menschen sind andere.
Sonntagnacht sagte jemand im Traum mit der Stimme einer unangetasteten Autorität: Gedichtbände dürfen nicht zu dick sein. Ehe ich noch erstaunt zur Seite blicken konnte, war ich aufgewacht. Wer immer der Ratgeber war aus dem Puppentheater des Über-Ichs, er hatte recht.
Ursula Krechel, März 1982, Nachwort
Von heut an stell ich meine alten Schuhe
nicht mehr ordentlich neben die Fußnoten
häng den Kopf beim Denken nicht mehr an den Haken
fresse keine Kreide
… ich hock nicht mehr im Nest, versteck
die Flatterflügel, damit ihr glauben könnt
ihr habt sie mir gestutzt. Den leeren Käfig
stellt mal ins historische Museum
Abteilung Mensch weiblich.
Das ist der Ausgangspunkt für Ursula Krechel. Sie will reale und fiktive Grenzen überschreiten, aber nicht um die Flucht zu ergreifen, sondern um sich zu stellen. Wut und Hoffnung, Niederlagen und Siege in der Auseinandersetzung mit einer unvollkommenen Gegenwart sind das Thema, der Glaube an die Erfüllung sozialer Utopien, an eine bessere Welt, der Motor ihrer erzählenden Gedichte.
Deutscher Taschenbuchverlag, Klappentext, April 1983
Die Anfänge
Ursula Krechels Anfänge sollte man kennen, weil einem ansonsten etwas fehlt. Nach Mainz!, ist eine Hommagé an das Ankommen, an das sich auf den Weg machen, und wenn es bedeutet die wichtigsten Flüsse Deutschlands zu durchschwimmen, weil einem das Wasser als junge Frau und Studentin, als innere Revolutionärin bis zum Halse steht. Lass hören, scheinen die Texte in diesem Buch immer noch ganz unverblümt zu rufen. Lesen, auch das ist mit diesem Gedichtband keine Zeitverschwendung.
Hanno Hartwig, amazon.de, 30.5.2013
Ursula Krechel: Nach Mainz!
Bei diesem Taschenbuch handelt es sich um die um zwölf Gedichte sowie eine Nachbemerkung („Über das Näherrücken älterer Tische“) erweiterte Ausgabe desjenigen Gedichtbandes, mit dem Ursula Krechel – heute bereits als vielseitige Autorin bekannt – im Jahr 1977 als Lyrikerin debütierte. Die nunmehr 59 Gedichte, deren Länge zwischen zwei Zeilen und mehreren Seiten differiert, spiegeln die einzelnen Abschnitte der Persönlichkeitsentfaltung der Autorin wider: Inhaltlich wird der Bogen gespannt von dem jungen Mädchen, das im Rheinland-Pfalz der Nachkriegszeit aufwächst (z.B. „Feindesland“, „Die Vertreibung der Vögel aus dem Paradies“), über die Studentin, die sich von zuhause abwendet („Abends zuhaus“), in den Zielsetzungen der Studentenbewegung von 1968 auch ihre eigenen Ideale sieht und deren Scheitern im nachhinein zu verarbeiten sucht (bspw. „Bußtage“, „Immer noch“, „Jetzt ist es nicht mehr so“), bis hin zur engagierten Feministin, die in der Neuen Frauenbewegung – über die Ursula Krechel einen vielbeachteten Erfahrungsbericht (Selbsterfahrung und Fremdbestimmung, 1975; erweiterte Neuausgabe 1983) vorgelegt hat – eine führende Rolle einnimmt („Die Würde der Frau ist tastbar“, „Die Taschenfrauen“, „Keine Tragödie“ etc.).
Gemeinsam ist einem Großteil der Gedichte, daß die Autorin aus ihren eigenen Empfindungen heraus den einfachen Gegenständen des täglichen Lebens eine besondere Bedeutung beimißt und diese stellenweise gar zu einer regelrechten Verherrlichung des Details hochsteigert. Auf den Leser jedoch wirken Anhäufungen von Formulierungen wie „der schöne Tisch“, „der gesegnete Teepott“, „der liebe alte Tisch“, „die bescheiden dampfende Suppe“ oder „dieses liebe anhängliche Papier“, die zudem auch kaum eine Aussagekraft besitzen, außerordentlich ermüdend. – Weitere Kennzeichen von Ursula Krechels Lyrik sind die immer wiederkehrenden Antithesen (z.B. „In viel zu engen Zimmern klebt die Familie / in ihrer Sesselgarnitur und erwartet die Tochter / die gute, die nicht mehr kommt. Ich bin die schlimme / geworden, als ihrs noch nicht geahnt.“; „Jetzt seht ihr meinen leeren Stuhl, Setzt euch. / Eßt von meinem vollen Teller.“ oder auch „Mein Marktwert steigt, sagt sie / und fürchtet nicht, selbst zu fallen.“ sowie der mehrfach benutzte Gestus des Hin- bzw. Verweisens („Hier seht ihr“, „Jetzt seht ihr“, „Hier ist“ etc.), den bspw. auch Günter Eich in seinem bekannten Gedicht „Inventur“ verwendete.
Am gelungensten erscheinen diejenigen Gedichte des Bandes, in denen Ursula Krechel auf die oben angeführte idyllisierend-sentimentale Ausdrucksweise sowie die feministischen Imponierfloskeln (bspw. „Geht uns aus der Sonne / dann reden wir weiter / über unsere Perspektive“) verzichtet und eine Sprache findet, die sich einerseits eindrucksvoller und präziser, andererseits aber auch ironischer Formulierungen bedient (z.B. in den Gedichten „Die alten Freunde“ oder „Hymne auf die Frauen der bürgerlichen Klasse“).
Jörg Lehn, Deutsche Bücher, Heft 4, 1983
Beitrag zu diesem Buch:
Elisabeth Andres: Gedanken zur Lage der neuen deutschen Lyrik
Merkur, Heft 356, Januar 1978
Ein Gedicht und sein Autor: Ursula Krechel und Jan Wagner am 17.7.2013 im Literarischem Colloquium Berlin moderiert von Sabine Küchler.
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Andreas Platthaus: Keine Magermilch, und bloß keine Kreide
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.12.2017
Landesart: Ursula Krechel zum 70.
SWR, 2.12.2017
Fakten und Vermutungen zur Autorin + KLG + IMDb + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Ursula Krechel – Neue Dichter Lieben, Komposition und Klavier: Moritz Eggert, Bariton: Yaron Windmüller, Expo 2000 Hannover.
Keine Antworten : Ursula Krechel: Nach Mainz!”
Trackbacks/Pingbacks
- Ursula Krechel: Nach Mainz! - […] Klick voraus […]


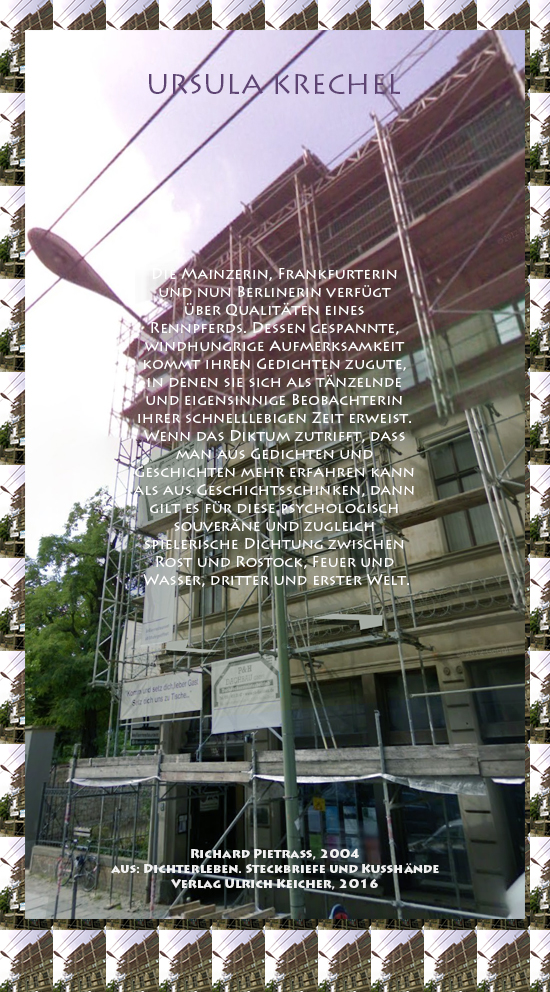












Schreibe einen Kommentar