Gerhard Oberlin: Zu Rainer Maria Rilkes Gedicht „Schluszstück“
– Zu Rainer Maria Rilkes Gedicht „Schluszstück“. –
RAINER MARIA RILKE
Schluszstück
Der Tod ist groß.
Wir sind die Seinen
lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen
mitten in uns.
1900/1901
Kommentar
Tatsächlich ist die Mitte des Menschenlebens, verstanden als vitaler Höhepunkt, auch der Augenblick des scheinbar größten Gegensatzes zum Nichtleben, dem Tod. Es ist dieser Kontrast, der sich im Weinen ausdrückt, während zum gesteigerten Leben das Lachen gehört.
Aber nicht, dass das eine das andere in Frage stellt. Schließlich „meinen“ wir nur, dass der vitale Scheitel der Punkt ist mit dem größten Abstand und Gefälle zum Ende. Das pointierte „mitten in uns“ setzt nämlich einen ganz anderen Akzent, der auch dem Weinen eine „Mitte“ zuordnet, und zwar „in uns“, womit nichts weniger gesagt ist, als dass wir den Tod in uns tragen; ja von ihm wesensbestimmt sind, da wir im Unterschied zu den Tieren davon wissen.
Dass wir ihm gehören, sagt ja bereits die zweite Zeile, aber auch sie setzt einen erstaunlichen Akzent. Denn wenn wir „die Seinen“ sind, dann ist er, wie ein Familienmitglied, der Unsrige, will sagen: wir sind vom gleichen Blut, aus dem gleichen Stoff. Nicht nur Tod und Leben sind damit wesensverwandt, sondern auch jenes Lachen und Weinen, in welchem wir uns in Gefühlen auflösen und den weichen, den hinfälligen Stoff offenbaren, aus dem wir gemacht sind.
Dass es gewagt sein soll, dem Lachen das Weinen zu gesellen, obwohl er doch souverän über uns herrscht, der Tod, versteht sich, denn schließlich nimmt er uns das Leben und hat daher scheinbar Grund sich vorzusehen und für den Widerstreit in uns zu wappnen.
Aber warum und worüber weint der Tod? Gewiss nicht über unsere Hinfälligkeit, die ihm doch – allegorisch personifiziert – gelegen kommen muss. Weint er über unsere Naivität? Aus Mitleid gar?
Nein, in der allegorischen Logik, wie wir sie von Totentanzmotiven kennen, macht dieses Weinen keinen Sinn. Es ist unser Weinen, da wir ja doch „die Seinen“ sind, er damit der Unsrige ist. Das Weinen, das wir dem Lachen gesellen, kommt aus uns selbst, die wir den Tod buchstäblich verkörpern. Wir sind der Tod, wie wir die Materie sind, die den Verfall erleidet und zugleich wissen, dass wir es sind. Eine passende Allegorie muss daher den Sensenmann aus uns selbst modellieren, wie es in der ikonografischen Tradition geschieht.
Wenn solches Lachen und Weinen sich überblenden und miteinander reagieren, dann entsteht daraus ein vitalistisches Lebensgefühl, das die größte Freude aus der größten Trauer schöpft und umgekehrt. Wirkliche Daseinsfreude hat immer einen melancholischen Tiefengrund, der oft nicht sichtbar ist. „Excess of sorrow laughs. Excess of joy weeps“, schrieb William Blake in seiner grafischen Aphorismensammlung von 1790 The Marriage of Heaven and Hell.1
Dass wir im Skalenbereich des (qualitativ) „Großen“ sind, ist mit der „Größe“ des Todes vorgegeben. Daraus das „Kleine“ zu folgern, etwa in der Hinfälligkeit, der Ohnmacht des Sterblichen, mag dem Leser überlassen bleiben, da es ohnehin auf der Hand liegt. Doch ist die vitale Essenz hier nicht durch ungehemmte Lebenslust definiert, sondern durch die dialektische Partnerschaft mit dem Tod.
Erst eingedenk des Todes, angesichts der Hinfälligkeit entspringt die Lebensfreude keiner Feierlaune, sondern steigert sich im Fluss des Vergehens. Es ist die Tatsache, dass Gegenwart in jedem Augenblick Vergangenheit wird, das Momentum der Fahrt also, das die Lebenslust zur -freude erhebt. Der Tod dynamisiert, wenn Gedenken und Gedächtnis in ein memento mori münden und damit das Vergangene ebenso ,memorieren‘, wie sie die weitere Verfallszeit vorwegnehmen.
In einem der Brief-Gedichte an die neunzehnjährige Lyrikerin Erika Mitterer schreibt Rilke am 27. Oktober 1925 aus Muzot, dem Tag, von dem auch sein Testament datiert:
Wir sind ja auch in das, was schreckt und stört,
von Anfang an so grenzenlos verpflichtet.
Das Tötliche hat immer mitgedichtet:
Nur darum war der Sang so unerhört.2
Gerhard Oberlin, aus Gerhard Oberlin: Rilke verstehen. Text + Deutung, Königshausen & Neumann, 2022



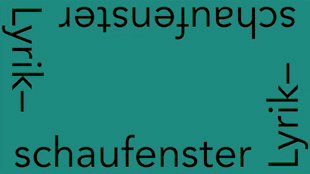
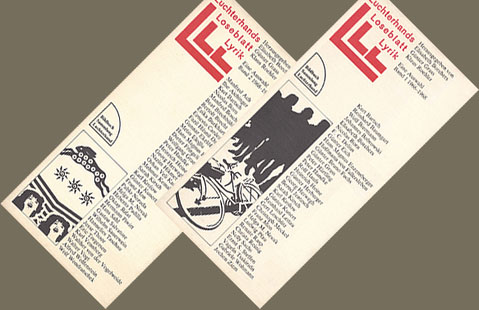



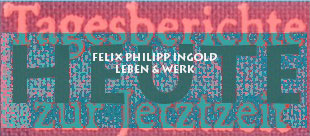
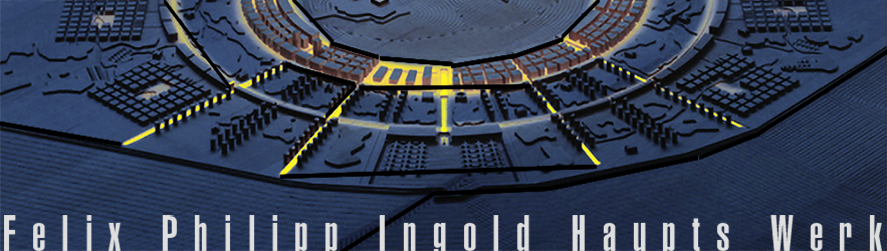
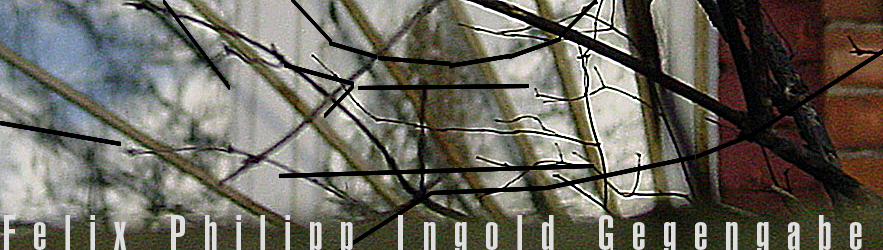
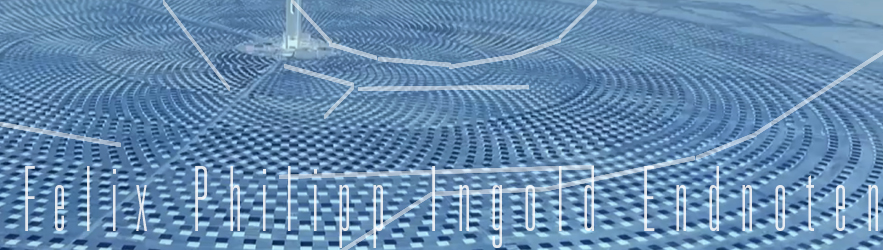

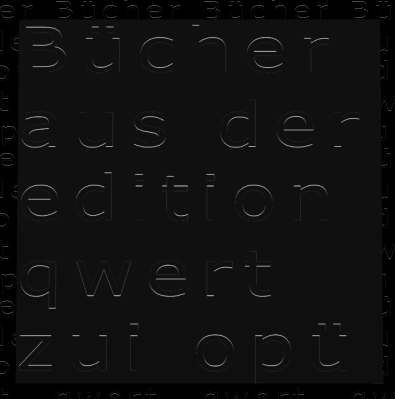
Schreibe einen Kommentar