Theodor Kramer: Der alte Zitherspieler
BEGRÄBNIS DER ALTEN
Von der Kirche zwischen Klee und Hecken
zieht der Zug gemessen aus dem Flecken
auf den Friedhof; das Geläut ist klein
und der Grabgesang fällt ungleich ein.
Wenige folgen, die zu trauern haben,
doch der Zug ist lang; mehr wird begraben
als die alte Häuslerfrau, die karg
liegt im ärmlich aufgebahrten Sarg.
Zittrig halten all die alten Leute,
die mit jeder Leiche gehn, auch heute
in der Hand das eingefaßte Buch,
schleppen sich im schwarzen Fransentuch.
Ihre Finger achten nicht der Nesseln,
die sie streifen; aus dem Silberkessel
steigt der Weihrauch, von den Kerzen tropft
zäh das Wachs und ihre Schläfe klopft.
Ihre Ohren hören nicht die Bienen
im Hollunder; einer unter ihnen
ist vielleicht der nächste, den es trifft,
sei’s im Schlummer, sei’s auf grüner Trifft.
Alle werfen eine Schaufel Erde,
daß der Toten leicht die Ruhe werde,
und sie weinen still und bitterlich,
beten eins für sie und eins für sich.
Vorwort
„Was ist das Leben, wann man’s nicht erzählt!“ läßt Theodor Kramer in einem seiner halbauthentischen Schenkengedichte – ein anderer Omar Khayyam – einen Zecher ausrufen. Und so erzählt er selbst, seit er sich kurz vor seinem dreißigsten Lebensjahr von der „ganz eigenbrödlerischen Gedankenlyrik“, die ihn „fast zur Schizophrenie führte“, gelöst hatte, mit dem geschärften Blick des Geschlagenen und an den Rand Gedrängten von diesem Leben rund um sich her, leiht „denen, die ohne Stimme sind“, die seine und macht sie damit hörbar und für uns sichtbar.
Und er tut dies auf eine innerhalb der deutschsprachigen Literatur einmalige Weise: was immer er wahrnimmt und gestaltet, es wird ihm zum Gedicht. Kein Versuch und kein Ansatz epischer oder dramatischer Gestaltung sind in seinem Nachlaß vorhanden. Für Theodor Kramer ist Lyrik die einzige mögliche Form dichterischen Ausdrucks, er ist der Lyriker schlechthin. Wofür andere mehrere Akte eines Dramas oder zahlreiche Kapitel eines Romans benötigen, dafür genügen ihm wenige Strophen. Kaum jemals sind es mehr als drei oder vier. In wenigen Worten faßt er das Wesen eines Menschen und das Wesentliche seiner Existenz zusammen, zeigt nicht nur einen entscheidenden Wendepunkt seines Lebens, sondern auch die Wege, die zu diesem hin, und jene, die von ihm wieder weg und weiter führen. Mag solch einer Art von lyrischer Gestaltung der Hauch von Weichheit und Lieblichkeit, der diesem Medium überlicherweise anhaftet, mangeln, so gewinnt sie durch komprimierte Darstellung und zielstrebige Kompaktheit eine Intensität, die uns betroffen macht, die uns trifft: so lebt der Mensch! Das ist die Botschaft von Kramers Gedichten.
Daß es nicht die Schicksale der Großen sind, die den Inhalt seiner Verse ausmachen, sondern vorwiegend die jener, die mühsam am Rande der Gesellschaft leben, das mag – darauf ist schon oft hingewiesen worden – Kramers eigener Sozialisation entsprechen, seiner Kindheit als Sohn des jüdischen Dorfarztes. Diese Erfahrungen haben seinem Blick die Richtung gegeben. Fast immer sind es Menschen, die „niedrig stehn im Licht“, über denen die Schatten so dicht liegen, daß ihnen ihr Dunkel die Vollziehung selbst der geringsten Lebensäußerung erschwert. Und auch in den seltenen Fällen, wo er Arrivierte, wie den Vorstand oder den alten Anatom, zu Worte kommen läßt, erfahren wir nichts von Selbstzufriedenheit oder Stolz, sondern nur von Enttäuschung und Einsamkeit.
Aufmerksam schaut er um sich, und sein Blick ist scharf. Doch wo ihm Erlebtes und Geschautes nicht mehr reicht, erschließt er, gelegentliche Versuche des jungen Brecht sich zum Vorbild nehmend, systematisch einen neuen Quellenhorizont: sorgfältig durchsucht er die Gerichtsspalten der Zeitungen. Das tun andere, wie Kästner und Klabund, auch, aber er sucht nicht Themen wie sie, er sucht Schicksale. Darum haben seine so gewonnenen Gedichte nichts Moritatenhaftes oder Kabarettistisches an sich, sondern sind von tiefer Menschlichkeit erfüllt. „Abschaffung“ stammt aus diesem Kreis und aus einer Zeit, da er mit solchen „Zeitungs-Gedichten“ noch einen Band füllen wollte.
Als sich sein Blick von solchen Vorlagen löst, ist Kramer reif geworden, Grundsätzliches zu erkennen. Von hier führt sein Weg zu jenen sozialen Gedichten, die in den späten zwanziger Jahren seinen Ruhm als Chronist der großen Krise begründen und verbreiten. Mit großer Wahrhaftigkeit zeichnet er in ihnen die fortschreitende Zerstörung menschenunwürdigen Seins als Folge wirtschaftlicher Fehlentwicklungen. Und dennoch erfüllt sein starkes Gefühl der Verbundenheit mit allen, die das Leid stumm macht, diese Zeugnisse wachsender Entmenschlichung mit einer Hoffung, die unter der Asche der Vernichtung glimmt, oft nur mehr durch einen wärmeren Fleck im Ödfeld erfühlbar, und doch bereit aufzuflammen, wenn die Zeit gekommen ist.
Die Schicksalsgedichte begleiten Kramer sein Leben lang bis in die Einsamkeit des Exils. Und diese Einsamkeit ist groß. Wenn er ihr, eingesperrt in die Eintönigkeit der Bibliothek und in die Abgeschlossenheit oft gewechselter Untermietzimmer, zu erliegen und die Sicht auf das Leben zu verlieren droht, verlangt er von seinen Briefpartnern Romane und Theaterstücke, um sie nach gestaltbaren Episoden zu durchstöbern und sich auf diese Weise die Verbindung zur äußeren Wirklichkeit zu erhalten. So nähert er sich, dem Zwang eigener Lebensumstände gehorchend, am Ende seines Schaffens wieder einem Weg, den er früh gegangen ist und der ihm den Ausblick über selbst Erlebtes und Erfaßtes hinaus bietet. Gleichzeitig fließt immer stärker eigenes Erleben in die Gestaltung fremder Schicksale ein: Ausgegrenztheit, Krieg, Krankheit, übersteigerte Ängste, die Furcht vor dem Alter, selbst erlitten und in anderen wiedergefunden. Fremdes Geschick findet er als Möglichkeit in sich angelegt, und eigenes vermengt er mit fremdem. So spiegelt sich sein eigenes Bild in den Menschenbildern seiner Gedichte; man muß es nur in ihnen suchen.
Und noch etwas zeigen die Menschenbilder Kramers: hinter der Vielfalt der Schicksale der Kleinen, der Ausgestoßenen, der ins Abseits Gedrängten wird ein Bild des Menschen sichtbar, das lange zuvor gezeichnet wurde – das von der Aufklärung geprägte Menschenbild der deutschen Klassik.
Diese Behauptung mag erstaunen, und sie wird Widerspruch erwecken. Galt doch bislang als einzige Beziehung Kramers zu den Erscheinungsformen dieser Epoche nur eine solche zu ihrer Poetik, und diese wurde negativ bewertet: sein Beharren auf Rhythmus und Reim, das man ihm als epigonenhaftes Anklammern an eine abgelebte Form zum Vorwurf gemacht hat.
Das Bestehen einer positiven geistigen Beziehung Kramers zu den Vorstellungen dieser Zeit aber blieb bisher ungesehen, denn sie kommt von weit her. Ihren Ursprung hat sie in der Atmosphäre eines bezeugterweise humanistisch gestimmten Elternhauses und eines dem Klassischen verpflichteten Schulunterrichts. Wie ein Karstfluß fließt sie unterirdisch, nur zuweilen sichtbar werdend, durch seine Gedichte.
„Ihr laßt den Armen schuldig werden, und überlaßt ihn seiner Pein“: sind diese Worte Goethes nicht aus vielen Gedichten Kramers wie ein Grundton zu hören? Und wie stark mag auf das prägbare Gemüt des Knaben Kramer, in dem das Depressive, das zuletzt mit aller Macht aus ihm hervorbrach, schon angelegt war, ein anderes Wort Goethes gewirkt haben, von diesem ebenfalls seinem „Harfenspieler“ in den Mund gelegt und für uns inzwischen sprichwörtlich, vielseitig benutzbar und abgenützt geworden: „Wer nie sein Brot mit Tränen aß…“. Es würde sich lohnen, dem Laufe dieses Stroms zu folgen.
Mag dieses Erbe auch gering sein, es wirkt bestimmend mit in Kramers Werk und gibt Zeugnis von dem beständigen Bestreben Kramers, das humanistische Bild vom Menschen von den großen Charakteren zu lösen, es zu „demokratisieren“ und den Glanz seines Scheins auch auf den Geringsten zu lenken. Sein Leben lang hat er sich dieser Aufgabe unterzogen.
Wie nahe aber, wenn auch durch Zeit und Stil getrennt, Der alte Zitherspieler Kramers dem „Harfenspieler“ Goethes steht, mag uns, die wir an Harfenisten als Mitglieder namhafter Orchester gewöhnt sind, im ersten Augenblick nicht bewußt werden, weil wir nicht mehr wissen, daß zu Zeiten Goethes auch ein Harfenspieler nicht mehr war als ein Bettler.
An solcher Stelle schließt sich der Kreis. Hier wird sichtbar, in welche Tiefe die Wurzeln von Kramers Humanismus, aus denen sein Werk erwuchs, reichen und auch wie weit sich dessen Krone erstreckt in der Gestaltung des Menschlichen. Weit über alles hinaus, was vor ihm einer in deutschsprachiger Lyrik zum Gegenstand seiner Darstellung gemacht und damit dem Bewußtsein vieler vermittelt hat.
Erwin Chvojka, Vorwort
Lyrische Solidarität
Der alte Zitherspieler. Menschenbilder ist eine Sammlung bisher teilweise unveröffentlichter Gedichte Kramers, in denen er in einer sehr realistischen und gleichzeitig ungemein einfühlsamen Weise Menschenschicksale erzählt. Er gibt Einblick in die Seelen, verschiedenster Charaktere, beschreibt Traditionen, Werte, Stärken, Schwächen, Ängste und Hoffnungen des Individuums. Seine Solidarität gilt dabei vor allem den Außenseitern, den Ausgegrenzten, jenen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Ihnen schenkt er Anerkennung, ihnen zollt er Respekt.
Erwin Pröll und Ernst Scheiber, Club Niederösterreich, Klappentext, 1999
Einwendungen und Hinwendungen zu Kramer
Jeder Kommentar würde sich erübrigen, stünde die jüngste Gesamtdarstellung der österreichischen Literatur, die von Herbert Zeman herausgegebene Literaturgeschichte, mit ihrem Urteil, „den immer wieder genannten und weidlich überschätzten Lyrikern Erich Fried und Theodor Kramer“ (Strelka) sei hinlänglich genug Aufmerksamkeit gewidmet worden, allein auf weiter Flur. Denn Joseph Strelkas Aufsatz – in dem sich diese Invektive findet – ist alles andere als ein Glanzstück der Exilforschung, nimmt deren Erträge, wenn überhaupt, nur selektiv zur Kenntnis, und erweist sich schließlich sogar in der Vermittlung leicht auffindbarer Daten und Fakten als schwer unzuverlässig. Aber Strelka befindet sich mit seinem Urteil keineswegs allein. Was Theodor Kramer angeht, um den nicht weniger verwickelten Fall Fried hier auszublenden, weil Volker Kaukoreit ihn ohnehin mit der denkbar größten Sorgfalt schon behandelt hat, was also Kramers Werk betrifft, so steht bekanntlich einer beeindruckenden Reihe von Würdigungen eine nicht minder stattliche Reihe von Einwendungen gegenüber; und Strelka hätte, wäre es ihm ein Anliegen gewesen, seine Auslassungen zu verdeutlichen, einige prominente Zeugen von Ludwig von Ficker bis Canetti nennen können.
Die lange Reihe von Einwendungen ist nicht zuletzt deshalb bedenkenswert – und nach wie vor ein Problem der Kramer-Forschung −, weil sie das gesamte Werk des Dichters, von seinen Anfängen bis hin zu seinen letzten Gedichten, zäh begleitet und nie abgerissen ist. „Nicht auszuräumen sind auch“, Konstantin Kaiser hat das erst vor einigen Jahren verärgert festgehalten, „die Bedenken mancher Literaten und von Teilen des Lesepublikums gegen die wenig innovativen Formen der Kramer’schen Poesie: gegen sein Festhalten an Reim und Strophe, an der gebundenen Sprache der Verse.“ Es scheint demnach, jedenfalls wenn man davon ausgeht, daß alle diese Vorbehalte gegen die Ästhetik Kramers insgesamt der internen Textkohärenz seiner Gedichte nicht gerecht werden, noch immer unerläßlich, die Äußerungen für und wider Kramer gegeneinander abzuwägen und kritisch mit seinem Werk zu konfrontieren.
An dieser Stelle kann ich zu einem solchen, zu einem neuen Revisionsprozeß nur den Anstoß geben; und ich möchte zuallererst dafür plädieren, einen neuen Ausgangspunkt zu wählen, um von dort aus zu versuchen, die offenbar schwer auszuräumenden Bedenken zu erschüttern. Eine Verteidigung, die nicht anders verfährt als viele der polemischen Ausfälle gegen Kramer – und generell alle seine Texte ins Visier nimmt, als wären darunter nicht auch schlicht mißglückte, vermag ebensowenig zu überzeugen wie umgekehrt etwa Elias Canettis Attacke gegen Kramer, die, den ohnehin unterlegenen Kollegen zu vernichten, vor keiner Injurie zurückschrickt.
Vieles, was hier zu sagen wäre, ist in der Kramer-Monographie von Daniela Strigl längst ausgeführt. Zu Elias Canetti wäre allenfalls noch zu ergänzen, daß er sich ähnlich pauschal wie über Kramer auch über einen anderen österreichischen Heimatdichter, nämlich Franz Nabl, geäußert hat, zu diesem allerdings voll des Lobes. Nabl sei, so Canetti, stets „vom Konkreten ausgegangen“ und „zeit seines Lebens dem Einzelnen und Konkreten verhaftet“ geblieben. Aber die Literaturwissenschaft hat auch diese Darstellung nicht bekräftigt; denn auf das Werk Nabls, insbesondere auf seine Arbeiten aus der NS-Zeit, trifft Canettis Charakterisierung ganz und gar nicht zu.
Weit interessanter als derartige pauschale Verunglimpfungen oder Lobeshymnen, welche sich bestenfalls für Werbetexte eignen, sind die präzisen, an einzelnen Werken festgemachten Urteile, besonders auch im Rückblick auf die Kramer-Rezeption. Die jüngste Geschichte der deutschen Lyrik von Gerhard Kaiser räumt nur einigen ausgewählten Gedichten Kramers, namentlich „Im Burgenland“ und weiteren Titeln aus der Gaunerzinke, einen Platz ein. Im Kapitel „Ich-Restriktion“, keineswegs eingebunden in den Dunstkreis zweit- und drittrangiger Autoren vom Schlag eines Billinger oder Oberkofler, erweisen sich diese wenigen Gedichte dann jedoch als poetische Marksteine, als Marksteine auf einem Gelände, das „abseits von den Leitwegen der Lyrik der Epoche“ liegt. Die rigorose Auswahl gibt zu denken. Aber darüber später mehr.
Denn zuvor will ich den Blick zurück auf die Korrespondenz zwischen Theodor Kramer und Ludwig von Ficker lenken; und zwar auf jenes Absage-Schreiben, das der Brenner-Herausgeber am 20. Jänner 1926 an Kramer schickte, zusammen mit sämtlichen Gedichten, die dieser offensichtlich gerne im Brenner gedruckt gesehen hätte. Von Ficker schreibt, in der ihm eigenen, reichlich verklausulierten, aber nie unverbindlichen Diktion, an den damals noch unbekannten Lyriker das Folgende:
Sehr geehrter Herr!
Leider ist es mir nicht möglich, Ihren Gedichten, so schön und respektabel ich sie finde, eine Tragweite abzufühlen, die sie über den Anschauungs- und Reflexionsbezirk Ihres Eigenpersönlichen hinaus in jene lyrische Verantwortungssphäre emporhübe, in der auch noch ihr Fragwürdiges nicht nur einem alterierten Leidensgesicht des Menschlichen, sondern dem Antlitz einer reinen Leidenschaft des Mitmenschlichen zu entstammen wie auch zu entsprechen vermöchte. Darauf kommt es mir aber heute wesentlich an, und dieser Gesichtspunkt wird für mich entscheidend bleiben, wenn es gilt, Lyrik für den Brenner auszuwählen. Inwieweit diesem meinem persönlichen Standpunkt auch für Sie prinzipielle Bedeutung zukommt, mögen Sie selbst entscheiden und die daraus gewonnene Einsicht, die zu beeinflussen mir nicht zusteht, Ihrem weiteren lyrischen Schaffen zugute kommen lassen. – Die übersandten Gedichte gehen anbei an Sie zurück.
In vorzüglicher Hochachtung
Ludwig Ficker
Fickers Brief verrät, zumal die Gedichte, um die es geht, nicht mehr zu ermitteln sind, mehr über den Verfasser als über die Arbeiten des Empfängers. Aber doch so viel, daß deutlich wird, wie sehr das Lyrikverständnis des Älteren von jenem des Jüngeren sich unterscheidet. Was Ficker in Kramers Gedichten vermißt, was er als „lyrische Verantwortungssphäre“ kennzeichnet, ist ziemlich offensichtlich eine nicht-austauschbare Form, in der jedenfalls mehr zum Ausdruck kommt als ein bloß privater, nur das Ich erregender Erlebnisinhalt. – Es ist jedoch sehr gut möglich, daß Ludwig Ficker einige Gedichte aus Kramers Typoskriptsammlung „Chor der Verlorenen“ erhalten hat; ist doch dort zusammengestellt, was der Autor in dieser Phase als druckreife Poesie empfindet.
Wir waren Verlorene schon seit Beginn;
uns quälte des Lebens ohnmächtiger Sinn.
Wir preßten es nieder und aus bis zum Rand
und halten das Tote nun ganz in der Hand.
So beginnt das Gedicht, das der Sammlung den Titel gegeben hat, „Chor der Verlorenen“. Mit einem anarchischen Gestus, der sich verbissen weigert, jedwede Lebensanschauung, aus welchem Lager auch immer, als Rückhalt anzunehmen. Aber zugleich inkonsequent, weil sich der Paarreim mit diesem Gestus nicht verträgt.
Es hätte dennoch im frühen Brenner, in dem Carl Dallagos Kritik aller Institutionen den Ton angibt, vielleicht noch einen Platz erhalten können. 1926 jedoch – Ficker deutet in seinem Schreiben an Kramer die Kursänderung seiner Zeitschrift ausdrücklich an – prägt längst nicht mehr Nietzsche, sondern Kierkegaard, bzw. die von diesem beeinflußte christliche Existenzphilosophie die Gedankenwelt des Brenner, Haecker und Ferdinand Ebner geben seine Linie vor, und es kommt zum Bruch auch mit Dallago. In diesem Kontext hätte also der „Chor der Verlorenen“ quasi wie ein Relikt aus der Startphase der Zeitschrift wirken müssen.
Darüber hinaus aber fallen Kramers Gedichte aus jenen Jahren weit hinter jene ästhetische Position zurück, die dem Brenner − seit dem Jahrbuch 1915 – seine überregionale Geltung erst gesichert hat; indem sie nachdrücklich an Trakl erinnern, provozieren sie einen Vergleich mit dessen Versen und schreiben sich somit selbst ein schlimmes Urteil.
In „Grodek“, Georg Trakls letztem Gedicht, werden die nur mehr aus den Tiefen der Erinnerung heraufzitierbaren Wunschbilder radikal ausgelöscht und übermalt mit Bildern der Trostlosigkeit, die gar nicht mehr vorgeben, eine faßbare Wirklichkeit nachzuzeichnen, und stattdessen eine eigene Realität konstituieren, die Realität eines Ich, dem die Wirklichkeit unfaßbar geworden ist.
GRODEK
Am Abend tönen die herbstlichen Wälder
von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen
und blauen Seen, darüber die Sonne
düstrer hinrollt; umfängt die Nacht
sterbende Krieger, die wilde Klage
ihrer zerbrochenen Münder.
Doch stille sammelt im Weidengrund
rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt
das vergoßne Blut sich, mondne Kühle;
alle Straßen münden in schwarze Verwesung.
Unter goldnem Gezweig der Nacht und Sternen
es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain,
zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter;
und leise tönen im Rohr die dunkeln Flöten des Herbstes.
O stolzere Trauer! ihr ehernen Altäre
die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz,
die ungebornen Enkel.
So entzieht sich die Grammatik des Gedichts derjenigen der Standard-, der Alltagssprache, so ist die Zerstörung der Welt und des Ich nicht mehr lediglich Thema, das Thema eines Apokalypse-Geredes, sondern im zerstörten Gedichtkörper präsent, so bricht das Gedicht denn auch ab mit einem Hinweis, der die denkbar kälteste Zukunft heraufbeschwört: „die ungebornen Enkel“.
Das Gedicht „Die Toten auf der Morgue“, das Kramer 1925 verfaßt hat, vermittelt unübersehbar Anklänge an „Grodek“. Aber ausschließlich auf der Ebene der lexikalischen Elemente; weil der Gedichtkörper unbeschädigt bleibt, ist an dieser Stelle von „Verwesung“ nur plakativ die Rede.
DIE TOTEN AUF DER MORGUE
Emporgefischt, geschleift, geschah’s zur Rechten,
daß wir hier starren mit geblähtem Wanst,
wir, heimisch schon in jenen feuchten Nächten,
die nicht vom Licht der Gosse ausgefranst?!
Des Todes Strandgut, wie verlorne Sachen
sind wir so jedem Aug zur Schau gestellt.
Und sollten wir, im Starrkrampf nur, erwachen:
Hand hält ein Glöckchen, das um Hilfe schellt.
Doch wär es so: wie wollte man uns laben?!
Der hellen Gaben haben kaum genug,
die uns im Leben hundertmal begraben,
das Brot verweigert und vergällt den Krug.
Nein! Wer wie immer sucht und findet, spüre,
wie ihm Verwesung schwarz entgegenfaucht!
Die Unerkannten aber überführe
man in das Grab, das keine Inschrift braucht!
Die thematisierte Auflösung und Auslöschung jeglicher Ordnung wird hier aufgefangen in einer Textur, deren Strophengliederung, deren Reimschema, deren Syntax auch weiterhin behaupten, wenigstens den Eindruck erwecken, daß Disziplin noch möglich, daß Ordnung ohne weiteres wieder herzustellen sei. Damit wird dem – in der Wir-Perspektive zum Ausdruck gebrachten – Sich-Abfinden mit der Vernichtung ein Pendant entgegengehalten, das der augenfälligen Intention, „dem Antlitz einer reinen Leidenschaft des Mitmenschlichen zu entstammen wie auch zu entsprechen“ (Ficker), in keiner Weise kongruent ist.
Was Kramer später bekanntlich auch selbst eingesehen hat. 1931, in der für den Schlesischen Rundfunk verfaßten Lebensskizze, hält er fest, daß seine frühen Gedichte „formal glatter“ gewesen wären, dem gegenüber aber „inhaltlich immer mehr einem wilden Individualismus zugekehrt“; daß also ihre Widersprüchlichkeit nicht Methode, sondern das Erkennungszeichen einer ästhetischen Unzulänglichkeit gewesen ist.
Es ist, als hätte sich Theodor Kramer den Ratschlag Fickers tatsächlich zugute kommen lassen. Jedenfalls kann die in den 50er Jahren erfolgte Hinwendung des Brenner-Herausgebers zu Kramer, sein Engagement für den von Michael Guttenbrunner besorgten Auswahlband Vom schwarzen Wein nicht als ein Akt der Wiedergutmachung, noch weniger als ein Widerruf der alten Reklamationen gewertet werden; denn es ist unverkennbar, daß Ficker, wenn er 1954 vom „wahren ,bodenständigen‘“ Wert der Gedichte Kramers schwärmt, eine ganz andere Sammlung vor Augen hat als 1926.
Eine gezielte Auswahl, wie sie – das ist hier schon angeklungen – auch Gerhard Kaiser getroffen hat, im Hinblick auf seinen Lyrik-Grundriß. Kramer steht dort im Kontext einer Lyrik, in welcher es um die Selbstzurücknahme des Ich, „die Verwandlung des Ich ins Objekt der Rede“ geht. In diesem Kontext erscheint er nicht mehr als Heimatdichter, obwohl er das, wie Daniela Strigl nachweist, auch gewesen ist, sondern als „Gegenavantgardist“, als ein Einzelgänger, der eine „sehr moderne Gegenbewegung zu den herrschenden Tendenzen der modernen Lyrik“ antreibt; in diesem Bezugsnetz zeigt sich, daß Kramer nicht einer der „weidlich Überschätzten“, viel eher einer der noch immer weithin unterschätzten österreichischen Dichter ist.
Es versteht sich, daß nicht alle seine Gedichte dies bezeugen. Umso mehr, denke ich, wäre es eine lohnende Aufgabe, eine Sammlung von Interpretationen zu ausgewählten Gedichten zu veranstalten, über einzelne Kramer-Gedichte zu reflektieren, die nicht nur einen Vergleich mit Soyfer oder Haringer, Weinheber oder Zernatto unschwer überstehen, sondern auch eine Kollision mit vielen späteren, durchaus herausragenden poetischen Zeugnissen keineswegs zu scheuen brauchen.
(…)
Joachim Holzner, in: Zwischenwelt. Chronist seiner Zeit – Theodor Kramer, 2000, Theodor Kramer Gesellschaft und Drava Verlag
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Kalliope
Zum 25. Todestag des Autors:
Zum 50. Todestag des Autors:
Günther Doliwa: Gewaltig ist das Leben
literaturkritik.de, April 2008
Daniela Strigl: Hieb auf den Kopf, Griff ans Geschlecht
Der Standart, 29./30.3.2008
Cornelius Hell: Für die, die ohne Stimme sind
Die Furche, 27.3.2008
Fakten und Vermutungen zum Autor + ÖM + Archiv 1, 2 & 3 +
Internet Archive + Kalliope
Theodor Kramers Gedicht „Geboren ward ich in die Wende“ gesungen von Wenzel.

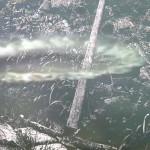












Schreibe einen Kommentar