Mario Luzi: Gedichte
SCHWARZ
Aber dies ist die Stunde der Nacht,
in der aus den Tiefen des Weltraums
das Antlitz der Erde zerzaust und steil
sich hinauslehnt – wir müssen es trösten
mit unseren traurigen Nachtwachen und
mit den matten Lichtern städtischen Firmaments.
Der Wind aus violett-schwarzen Abgründen
erregt die vertrockneten Gärten, er trägt
durch die Straßen das Stöhnen der Katzen,
schlägt heftig die lockeren Läden der Fenster,
und wer sich aus seinen vier Wänden wagt,
sieht Wind, Laternen, Betrunkene.
Sag, was hat dieser Tag mir gebracht?
Nichts? Oder ein wenig mehr als der
offene, wieder geschlossene
Regenvorhang an den siechen beharrlichen Tagen
erscheinen und wieder verschwinden läßt:
Bäume, Bruchstücke der Stadt, beladene Wagen
und Leute und Regen im Regen und Rauch.
Vorwort
Der florentinische Dichter Mario Luzi (geb. 1914) ist in seiner Dichtung einen sehr persönlichen Weg gegangen, der zu einem guten Teil von dem seiner italienischen Zeitgenossen abweicht. Zwar macht er die Erfahrungen seiner Generation, oder streifte sie zumindest (Montales Poetik, Existenzialismus, Krieg etc.), doch folgt er vor allem seiner persönlichen Inspiration. Um eine eindrucksvolle Metapher Franco Fortinis anzuführen: er orientiert sich an seinem eigenen Fixstern, der seine Dichtung beleuchtet und sie zugleich aus dem poetischen Kontext des zwanzigsten Jahrhunderts heraushebt.
Luzi, lange Zeit Universitätsprofessor für französische Literatur, Essayist und einer der geschätztesten Übersetzer in Italien, zeichnet sich schon früh, kaum zwanzigjährig, in dem Bändchen La barca (Das Boot, 1935) und später in Avvento notturno (Anbruch der Nacht, 1940) durch zwei Charakteristika aus, die für seinen gesamten weiteren Schaffensprozeß bestimmend bleiben: Zum einen die beharrliche und minuziöse Suche nach einer auf Mallarmé zurückgehenden poetischen forme pure. Diese ist die einzige Gewißheit in der Leere, die die Auflösung eines objektiven Wirklichkeitsanspruches hinterlassen hat. Zum anderen die – wenn auch verständlichen Schwankungen unterworfene Überzeugung, daß die Weh ein spirituelles Wesen sei. Dabei ist der Einfluß des französischen Katholizismus des achtzehnten und des zwanzigsten Jahrhunderts spürbar. Ebenso waren auch die deutschen Romantiker, an erster Stelle Novalis und Hölderlin, für ihn von Bedeutung.
Diese zwei Grundzüge lassen sich aus Luzis geistigem Werdegang herleiten. Bei ihm findet sich einerseits die Neigung zu einer Richtung der europäischen Tradition, der Dichtung von verfeinerter Intellektualität (Coleridge und Hopkins, Rilke, Hofmannsthal und George, Nerval, Mallarmé und der ganze französische Surrealismus). Andererseits zeigt er von Anfang an auch eine Tendenz zur Abkapselung und Rückwendung (Dante, Cavalcanti. Ein gewisser malerischer Hintergrund erinnert an die Maler des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts), die für die toskanische Kultur in den Jahren um den Zweiten Weltkrieg typisch ist. All das ist auch für den sogenannten florentinischen Hermetismus (oder Neosymbolismus) charakteristisch, als dessen bedeutendster Vertreter Luzi angesehen wird. Was dieser Hermetismus war, läßt sich nicht einfach in wenigen Worten sagen. Die Komplexität der sozialen kulturellen Verflechtungen innerhalb dieser Bewegung, die sich zugleich aus europäischen wie aus regionalen Anregungen nährt, kann hier nur angedeutet werden. Sie ist in einem gewissen Sinn beispielhaft für die Isolierung und das Unbehagen der florentinischen Intelligenz jener Jahre. Diese war nicht geneigt, mit der neuen politischen und wirtschaftlichen Wirklichkeit des Landes Schritt zu halten und der entleerten Identität der eigenen traditionellen Rolle neue Inhalte zu geben. Sie tendierte dazu, ihre eigene poetische und literarische Funktion in einer verzweifelten Geste zu sublimieren, indem sie aristokratischen Mythen nachlief oder sich in esoterische Einsamkeit zurückzog. Daher rührt eine Poetik der Abwesenheit, der Weltferne (die Barke, die der ersten Sammlung Luzis den Titel gibt, ist Symbol der Entfernung von dem „lido del reale“, von den Gestaden des Wirklichen) und der Selbstgenügsamkeit des Wortes gegenüber den Bedeutungen. Sie greift auf die großen Texte der Décadence zurück und bringt die radikalsten Tendenzen des Symbolismus zur Vollendung. Diese Poetik berührt sich mit der toskanischen Wirklichkeit jener Zeit, die Scheu vor Neuem hat. Es kann also nicht verwundern, innerhalb dieser Dichtung widersprüchliche Tendenzen nebeneinander zu finden: europäische Projektionen (vor allem französische und deutsche), Wahl einer stark experimentellen Literatur (französischer Surrealismus) sowie auch mehr traditionell Wohlgefälliges (die toskanischen Stilnovisten), Verfremdungen oder großstädtische Suggestionen (Paris und Berlin sind die Zentren, an denen sich die Hermetiker mit Vorliebe ausrichten) und daneben die typisch toskanische Sehnsucht nach einer katholischen und bäuerlichen, nunmehr im Niedergang befindlichen Zivilisation. Das Nebeneinander solch gegensätzlicher Kräfte führt zum Gefühl der Fremdheit, mehr noch, zum Immobilismus. Als Poesie der Askese, in manchen Fällen „fachiresca“, fakirartig, („Fummo la fissità del movimento“; „Wir waren die Festigkeit in der Bewegung“, vgl. „Invocazione“) wird Luzis Dichtung definiert. Hier werden die musikalische Bewegung, die aristokratische Eleganz, die oft parnassische Exquisitheit der Gegenstände und der sie begleitenden Worte zur formalen Entsprechung einer Immobilität, die sich von der Welt fernhält. (È incredibile ch’io ti cerchi in questo / o in altro luogo della terra dove / è molto se possiamo riconoscerci“; „Es ist unglaublich, daß ich dich suche / an diesem Orte der Erde oder an jenem, wo / es viel ist, wenn wir uns erkennen können“: vgl. „Aprile-amore“). Luzi ist eher ein christlicher als ein katholischer Schriftsteller (sein essayistischer Erstling beschäftigt sich übrigens mit Fransçois Mauriac). Für ihn ist die existentielle Unsicherheit – die zum Beispiel bei Montale zu einer andersartigen, laizistischen Moral führt – ein endloser Prozeß von innerer Vertiefung und Reduzierung auf das Wesentliche. Deshalb folgt er einem Imperativ vor allem ethisch-religiöser Kategorie. Dies wird z.B. in „Ma dove“ aus der Sammlung Nel magma deutlich, die ein Poem in der Art von Kreuzwegstationen ist. Der Dialog zwischen dem Ich und seinem Schatten wirkt hier fast wie ein Bußritus, der sich in Stimmung und Vorhaben mittelalterlichen sakralen Vorstellungen nähert. Dagegen rufen die neuesten Dramen in Versen (Libro di Ipazia, 1978) einige Elemente des Eliot’schen Theaters in Erinnerung. Eliot steht Luzi auch formal nahe in der Art, in der er den Überdruß am täglichen Leben raffiniert interpretiert. Für Luzi ist Dichtung in der Tat durch Intuition erfaßte Wahrheit, die der Welt unter der Voraussetzung absoluter und dramatischer Isolierung mitgeteilt wird („Porto la mano sulla fitta, ascolto“; „Wo es sticht, darauf leg ich die Hand, ich horche“: vgl. „Prima notte di primavera“). Das Privileg des Dichters ist es, ein Weg zur Transzendenz zu sein. Aber er bezahlt dieses Privileg damit, ein luzider und einsamer Zeuge der beharrlichen, täglichen Präsenz des Tragischen und des Leidens zu sein („Sono com’ero in compagnia del fuoco / che avviva e rode la sostanza, veglio / su quel che brucia e quel ch’e fatto cenere, / tengo fede ai pensieri d’una volta“; „Ich bin wie ich war: mich begleitet das Feuer / das die Substanz belebt und zerstört, ich wache / über das Brennende und das zu Asche Gewordene, / Den Gedanken von einst halte ich die Treue“: vgl. „Colpi“).
Es muß sogleich hinzugefügt werden, daß, abgesehen von einer unleugbaren Öffnung in Richtung auf eine „Anerkennung der Welt“, die mehr oder weniger mit Primizie del deserto (Erste Früchte der Wüste, 1952) beginnt, diese tägliche Tragik nie auf die Geschichte verweist (vgl. „Ma dove“). Dichtung ist für Luzi die Enthüllung einer metahistorischen Wahrheit, von Erlebnissen, die noch in der Schwebe oder im Wandel sind. Und so versteht man auch Luzis Vorliebe für die nicht endgültige Kulisse des dantesken Purgatoriums und für die Metapher des wandernden Pilgers. In den letzten Jahren konnte zwar der Eindruck entstehen, als wolle er die anfänglichen Motive seiner Dichtung erweitern, als habe er sich einer Wirklichkeit aufgeschlossen, die er als einigermaßen verschieden von sich erkannte. In Wirklichkeit hält er jedoch an dem fest, was er selbst als die Nach-Zeit (i.e. die Metahistorie) bezeichnet. Und in einem gewissen Sinn entsprechen ihr – fast wie eine ideologische Unterstreichung – die Landschaften der späten Gedichtsammlungen: toskanische oder umbrische Landschaften voll christlicher Symbole, winddurchwehte Dörfer, die fast in den Felsen hängen, wo menschliche Gestalten selten sind und wo die geschichtliche Zeit nicht zu existieren scheint („La tramontana screpola le argille, / stringe, assoda le terre di lavoro, / irrita l’acqua nelle conche; lascia / zappe confitte, aratri inerti / nel campo. Se qualcuno esce per legna, / o si sposta a fatica o si sofferma / rattrappito in cappucci e pellegrine, / serra i denti. Che regna nella stanza è il silenzio del testimone muto / della neve, della pioggia, del fumo, / dell’immobilità del mutamento“, vgl. „Come tu vuoi“). Es handelt sich hier, wie Giovanni Raboni feststellt, eher um ein fast heraklitisches Fließen des Lebens („Ed i giorni rinascono dai giorni / l’uno dall’altro, perdita ed inizio, / cenere e seme, identità nel cielo“; „Und die Tage entspringen den Tagen, / aus dem einen der andre, Verlust und Beginn. / Asche und Same, im Himmel sind sie identisch“, vgl. „Invocazione“).
Seiner Vorstellung zufolge ist der Sinn des Lebens letztlich nicht erkennbar. Die vollkommene Übereinstimmung zwischen der objektiven Landschaft und der subjektiven Befindlichkeit ist vielleicht, für Luzi, das Zeichen der einzig möglichen Versöhnung mit der Welt.
Mario Allegri, Vorwort
Mario Luzi
zählt zu den bedeutendsten Lyrikern der italienischen Moderne. 1914 in Castello bei Florenz geboren, unterrichtete er französische Literatur an der Universität und hat als Kritiker, Übersetzer und Essayist großes Ansehen gewonnen.
Seine frühe Lyrik ist dem florentinischen Hermetismus verpflichtet: Eine Poetik der Abwesenheit, der Weltferne, gekennzeichnet durch eine Rückwendung zur europäischen Tradition (Coleridge, Hofmannsthal, Nerval, Mallarmé) wie auch durch den Einfluß des französischen Katholizismus und des Surrealismus.
Unter dem Eindruck der Kriegsjahre tritt Luzi aus dieser schmerzlichen Isolation heraus. Fragen der menschlichen und kreatürlichen Existenz beschäftigen ihn ebenso wie die für die Ratio undurchdringlichen Bereiche, in denen Unvernunft und Elementares zu herrschen scheinen. Verwandlung erkennt er als eigentliches Prinzip seiner Dichtung in den späteren Jahren, in denen die Tragik unserer Zeit, die Zerstörung als Charakteristikum der Moderne immer stärker in den Mittelpunkt rücken.
Ein Großteil seines umfangreichen dichterischen Werkes ist in den beiden Bänden Il giusto della vita und Nell’opera del mondo gesammelt.
Der vorliegende Band will einen Einblick in die komplexe Entwicklung von Luzis Kunst vermitteln und signifikante Beispiele aus allen Phasen seines dichterischen Schaffens bringen.
Narr Verlag, Klappentext, 1989
Naturalezza / Natürlichkeit
– Der Dichter Maria Luzi. –
„Das Höchste, was wir uns an poetischer, der Dichtung zugesprochener Kraft vorstellen können… ist, in die Lebendigkeit des Schöpfungsprozesses in toto einzutreten und dabei ihren Rhythmus des Werdens und Vergehens, ihren Atemzug zu übernehmen. Im poetischen Moment wirken die Kräfte, die das Universum bewegen, in größtmöglichster Intensität, und deshalb ist die Kondition, die den Dichter hervorhebt, die Natürlichkeit.“
In diesem Zitat gibt uns Luzi selbst das Stichwort, das – bei aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Phasen seines Schaffens von La barca (1935) bis zu Al fuoco della conttoversia (1978) – seinem Werk Kohärenz verleiht und zum Schlüssel des Verständnisses wird: naturalezza, die Natürlichkeit.
Bevor versucht wird, die hier abgedruckten Gedichte unter diesem Aspekt zu erschließen und eine mögliche, poetologische „Vaterschaft“ der romantischen Universalpoesie für Luzis Konzept der „fisica perfetta“ zu erörtern, soll von der literarisch-politischen Situation die Rede sein, in der Luzi als Einundzwanzigjähriger mit La barca debütierte.
Italien ist – kurz vor dem zweiten Weltkrieg – zweigeteilt, in literarischer Hinsicht ebenso wie in politischer. Während faschistische Bewegungen allerorts zunehmen, bilden sich in der Toscana, mit Florenz und Viareggio als ideologischen Hauptstädten, aktiv kämpfende Widerstandsbewegungen; zahlreiche satirische und literarische Zeitschriften mit heute namhaften Mitarbeitern (u.a. Montale, Vittorini, Luzi) beginnen zu erscheinen und vertreten das „andere“ Europa, nehmen polemisch-kritisch Stellung zu dem wortführenden Dreigestirn D’Annunzio-Marinetti-Papini, zur Gefahr einer faschistischen Ästhetik. In diesem Kontext entwickelten sich die „ermetici“, und wurden zur bedeutensten poetischen Schule des zeitgenössischen Italiens. Das zugleich allgemeinste und charakteristischste Moment der hermetischen Poesie erklärt sich so aus der Opposition zu den Stimmen des offiziellen Italiens: es ist die innovatorische Kraft und Absicht. In zweierlei Hinsicht: formal und inhaltlich, denn es galt für neue Inhalte neue Formen zu finden. Die „alten“ Inhalte, die das „falsche“ Europa repräsentierten, waren politisch und moralisch untragbar und hatten die Sprache, die Form desavouiert. Daher vertraten die „ermetici“ eine reine und absolute Poesie. Nur das Wort, das zur reinen Form geronnen war (oder Formlosigkeit, entscheidend war, daß es keinen „Pakt“ mit dem Inhalt einging), das hermetisch abgeschlossen war in der Absolutheit der poetischen Schöpfung, konnte bewahren und bewahrt werden vor allen denkbaren Risiken einer sprachlichen und damit moralischen Korruption. Nur darin schien die Erfüllung der wichtigsten Aufgabe der Poesie gewährleistet zu sein: frei und befreiend zu sein. Wollte man das Verhältnis der hermetischen Lyrik zu ihrem Gelesenwerden beschreiben, so müßte man sagen: die scheinbare Kommunikationsverweigerung ist die Bedingung der Möglichkeit ihrer Rettung. Wie gestaltet sich dieses Experiment der Aufhebung alter und Schaffung neuer „Umgangsformen“ mit der Welt bei Luzi, Montale und Ungaretti (um die maßgeblichsten Vertreter zu nennen)? Gemeinhin unterscheidet man drei Arten des Hermetismus:
– den orphisch-mystischen
– den kritischen
– den autobiographisch-stilistischen
Ersterer ist gekennzeichnet durch den Versuch, das Transzendente in seiner Opposition zur Wirklichkeit durch programmatische Asemantizität zu erringen (Celan könnte man einen deutschsprachigen Vertreter dieser Ausprägung nennen), während die zweite Variante die Dinge, die Objektwelt zum Träger der Wahrheit erklärt. Die dritte Ausprägung schließlich experimentiert mit stilistischen Mitteln, um die prekäre, widersprüchliche Situation des solipsistischen „Ich“ zu markieren. Die autobiographisch-stilistische Variante ist für das Verständnis der Entwicklung des Luzischen Werks weniger entscheidend, kann daher an dieser Stelle vernachlässigt werden, während die Opposition zu Ungaretti (und damit auch zu Quasimodo), als Vertreter der orphischmystischen Richtung, aufschlußreich ist. Luzis Weigerung, sich, wie Ungaretti, dem haltlosen Subjektivismus und der Irrationalität durch einen entsprechenden Gebrauch des Worts zu ergeben, hat ihren Grund in der Überzeugung, daß es potentiell eine Verständigung geben kann, daß die Leugnung dieser Möglichkeit falsch sei. Ungarettis „innocenza“ (Unschuld), wiederfindbar nur im Tod und nur dort zuhause, wird bei Luzi zu einer „innocenza“, die sich mannigfach und überall manifestieren kann: im „Blick der Florentiner Mädchen mit den nachdenklichen Stirnen“, in der „ungebildeten Armut“ der „Waisen“, in der „Angst der Leidenden“. Oft in den Schwachen also, denn Schwäche ist die Kondition, die den Menschen an die Natur bindet, ihn an sie erinnert, während sie bei Ungaretti Schuld und Qual impliziert, ständiges memento mori! Luzi romantisiert damit keineswegs Armut und Leiden, da er die Natur selbst nicht idealisiert. Daher liegt in der behaupteten Nähe, ja, metamorphotischen Identität des Menschlichen und Natürlichen keine erzwungene Harmonie (denn, wie gesagt, die Natur kann durchaus disharmonisch sein), sondern eine rhythmische Übereinstimmung.
Während bei Ungarettis evokativem Hermetismus Verben wie: gridare (schreien), pregare (beten, bitten), evocare (beschwören) vorherrschen, allesamt Verben, die das Verhältnis Mensch-(Um-) Welt als ein irrationales, von Verzweiflung über die Unbekanntheit der Verständigungsbedingungen geprägtes setzen, überwiegen bei Luzi Beschreibungen, die ein organisches Verhältnis von Mensch-Welt-Natur voraussetzen: sospirare (seufzen), testimoniare (bezeugen), palpitare (pochen), sperare (hoffen) und das immer wieder auftauchende Bild des „gleichen Atemzugs“ (lo stesso respiro). Bei Ungaretti ist die Erlösung ein metaphysischer Akt, projiziert in ein Jenseits nach dem Tod: Delira il desiderio / Nel sonno, di non essere mai nati. (Im Schlaf deliriert das Wünschen, niemals geboren zu sein.)
Bei Luzi, sofern der Terminus „Erlösung“ überhaupt noch wirksam sein kann, denn der Dualismus Diesseits/Jenseits ist ja aufgehoben, ist sie ein physischer Akt: fisica perfetta, Auflösung anstelle von Erlösung.
Auch Montales kritischer Hermetismus lehnt den Irrationalismus Ungarettis und Quasimodos ab. Seine Wahrheitssuche – wie die Luzis – verläuft dingbezogen, diskursiv, mündet aber – und hierin unterscheidet er sich wesentlich von Luzis Entwurf – in der Beschwörung eines „Wunders“, das die letzte Harmonie stiften soll, die menschliche – und daher begrenzte – Suche nach Gewißheit besänftigen und erlösen soll. Für Luzi dagegen ist Wahrheit nicht aufgeklärtes, entdecktes oder unentdeckbares, durch ein Wunder nur sich entdeckendes Geheimnis, sondern das Leben in allen seinen Äußerungen, Metamorphose ein und desselben Zeichens, Atems, Rhythmus. Insofern steht er zwischen Montale und Ungaretti, sein „noi“ (wir) ist die Synthese – ohne das Pathos der Aufhebung der Gegensätze allerdings – aus Ungarettis solipsistischem „io“ und Montales fernem, fast unerreichbarem „tu“. Eine Synthese, deren versöhnende Kraft darin besteht: sich nicht zu schämen – non vergognarsi.
Ohne Zweifel hat der Luzische Entwurf einer „fisica perfetta“ Gemeinsamkeiten mit dem Konzept der Romantiker einer „progressiven Universalpoesie“, wie sie Friedrich Schlegel formulierte: „Sie umfaßt alles, was nur poetisch ist, vom größten, wieder mehrere Systeme in sich enthaltenden Systeme der Kunst bis zu dem Seufzer, dem Kuß, den das dichtende Kind aushaucht in kunstlosem Gesang.“ Alles ist demnach Poesie oder emphatische Metapher davon, Poesie „… blüht von selbst aus der unsichtbaren Urkraft der Menschheit hervor…“ An diesem Punkt wird deutlich, worin Luzis „Korrektur“ besteht: er hat keine metaphorische Sicht der Poesie, (der Geschichte usf.), sie ist nicht Zeichen, Chiffre einer nur von ihr enträtselten Wirklichkeit. Daher ist es angebracht, bei Luzi von Metamorphose zu sprechen, denn die „unsichtbare Urkraft“ bringt Verwandlungen, nicht Übertragungen hervor, die zeichenhaft auf die Phänomene verweisen. In der Romantik ist die Poesie der esoterische Verbündete der Natur, teilt mit ihr das Geheimnis des Seins, „verrät“ es; bei Luzi gibt es weder Geheimnis noch Wahrheitsverräter, sondern nur die Bewegung der Wahrheit selbst: naturalezza
„Schändlich stirbt die Republik“ gehört zu dem jüngsten, 1978 erschienen Gedichtband Luzis An das Feuer der Auseinandersetzung (Al fuoco della controversia). Ein unter dem Aspekt der „naturalezza“ gesehen programmatischer Titel: Auseinandersetzung ist wie Feuer zweideutig. Destruktiv insofern sie zerstört (verbrennt), konstruktiv, insofern sie wärmt, „aufheizt“. Ein abstrakter Begriff der Zivilisation wird zu einem der vier Elemente, verwandelt sich in es, hat dessen gleiche Charakteristika – die Ambivalenz – und ist „natürlich“ in beiderlei Sinn: von Natur und Selbstverständlichkeit. Die Metamorphose der Auseinandersetzung in Feuer, der Zerstörung in Entstehung ist ein natürlicher und selbstverständlicher Vorgang, ist Geschichte.
Geschichte ist auch Thema des Zyklus, Geschichte sowohl als Historie, wie auch als atavistisch-natürliche Bewegung alles Organischen. Daß dies nur ein scheinbarer Gegensatz ist, zeigt sich sofort: eine Stimme, wenn auch schiffbrüchig (naufraga), verbindet Mensch und Natur, der „gespannte Faden zur ersten Nesthöhle“ ist noch nicht von den Schwalben „getrennt“, sie sind vereint in der Geschichte, auch wenn das verzagte „ich“ unter den „Trümmern seiner selbst“ voller Angst daran zweifelt. Während – im zweiten Gedicht – der „offizielle Protokollant“ der „Ereignisse“ unbeirrt die Geschichte notiert, ist die „Kiellinie der Enten“, der „herbstliche Glanz der Tauben“ wie immer zu sehen, der Rhythmus der Natur wird zum Atemzug der Geschichte, Geschichte ist wie Natur, Natur wie Geschichte. Diese immer wiederkehrende Feststellung der rhythmischen Übereinstimmung zweier Bewegungen darf nicht als Fatalismus angesehen werden: Aufgabe des Menschen und der Zivilisation ist dennoch, human und verantwortlich zu handeln, („Erhebt sich ein Toter / gegen seinen schändlichen Tod? Nichts dergleichen.“), wer es nicht tut, macht sich moralisch schuldig („Schändlich stirbt die Republik / schändlich bespitzelt in ihren Todesqualen / von ihren zahlreichen Bastarden“). Diesem Entwurf liegt ein christlicher Imperativ zugrunde, der das Konzept der „Natürlichkeit“ erweitert und relativiert: Sowenig wie Natur zwangsläufig harmonisch oder grausam ist, sowenig ist menschliches Handeln zwangsläufig schlecht oder gut. Es ist frei und eben darin liegt seine moralische Verpflichtung. Geschichte ist Leidensgeschichte und Fortschritt („Zerstörung und Entstehung“), sie besteht aus Lebenspendendem („Sporen“) und Totem („Scherben“) und durch beides hindurch muß der Mensch seinen Weg finden, die „Landkarte des menschlichen Schmerzes“ zum Kompaß. Aber auch wenn Geschichte „Leidensgeschichte“ ist, Menschen so unfaßbar wie „Zellen“ sind, so ist doch der Impuls ihres Fortgangs natürlich und positiv: Manhattan, gebirgig-wuchtig, eisig, Inbegriff der Modernität, ist wie eine Sonnenblume, die sich nach dem Licht dreht und zur Wärme hin ausdehnt. Gleichgültig ob „Sieg oder Agonie“, der „Schimmerstrahl“ (des Lebens, der Hoffnung, der Zukunft), „sprudelt“ dennoch „hoch empor“. Wenn die „Kraft der Zeitalter“, die Bewegung der Geschichte, ihre Manifestation in Ereignisse auch zu weit ist für jede Erinnerung und Voraussicht, sich uns in „tiefer Abwesenheit“ entzieht, so bleibt immer noch diese Möglichkeit: im „Halbdunkel der Wälder“, in der „Wassertiefennacht“ dem Atmen, das letztlich das unsere ist, solange zu lauschen, bis man wieder versteht.
Dagmar Leupold, in: Akzente. Zeitschrift für Literatur, Heft 3, Juni 1985
April-Auge
Der subtile und verborgene Reiz der Lyrik Mario Luzis entzieht sich zunächst dem zündenden Identifikationsvorgang, fordert geduldige, schweigsame Teilnahme, ein ihn Begleiten-Wollen in der Strenge der toskanischen Landschaft, durch die labyrinthischen Gänge der Stadt Florenz – zwischen Geschichte und Biographie. Die Atmosphäre nach dem futuristischen Bruch war im Florenz der dreißiger Jahre noch unpolitisch, ein Zwischenreich des Hermetismus: der Zeitschrift Solaria, mit Eugenio Montale, Elio Vittorini, Tommaso Landolfi, waren einige Jahre später Letteratura und Campo di Marte gefolgt, dann Frontespizio, mit der etwas frommen Rhetorik Piero Bargellinis.
Der junge Mario Luzi (1914 geboren), der gerade in französischer Literatur promoviert hat, schreibt Verse von melancholischer Verzauberung, die an Campana und Eluard erinnern, wie Toccata – 1932
April, die Langeweile
des Himmels aus Wasser aus Staub
am Fenster, ein Wind
Hauch, eine Wunde…
Dieser April, mild und grausam zugleich, wird die eigentliche Jahreszeit in Luzis Dichtung bleiben, so anders und so ähnlich dem grausamsten April der europäischen Literatur:
April is the cruellest month… mixing
memory and desire, stirring
dull roots with spring rai
Ein Frühlingsregen, der auch die Liebe dem Verzicht – der Erinnerung – anvertrauen möchte, so wie in dem Canto notturno per le ragazze fiorentine, dem ersten Gedicht des kleinen Lyrik-Bandes mit dem Titel La Barca (1935). Von Titeln geht ein besonderer interpretatorischer Reiz aus, Titel verraten in symbolischer Kürze die poetologische Absicht: Luzis Boot schien sich von jenem Ufer entfernen zu wollen, auf dem noch die klangvollen Manifeste D’Annunzios und Marinettis – in Florenz auch Papinis – seit langem wehten, als Banner einer faschistischen Ästhetik.
Avvento notturno (1940 veröffentlicht, Gedichte zwischen 1936 und 1939 geschrieben) verwandelt in seiner lichtlosen Metaphorik – schon mit onirischer Einblendung – die düstere Bedrohung, die Italien und Europa verdunkeln wird:
Die schwarzen Blumen des Hades schon
pflücken deine langsamen Hände
von Schatten überredet
und vom Schweigen überführt.
Das Schweigen wird zum Antagonisten des Bildes, der Worte; ein Schweigen, das mit seiner Dichtung wächst und ihr die Trauer gibt, stumm über die eigene Verwüstung zu weinen – in einem Land, das weit von Auschwitz war, aber die Vernichtung der eigenen Geschichte erleben mußte.
Nachdem die Erschütterung schrecklicher Ereignisse nachläßt, erscheint eine neue Hemisphäre nach dem langsamen Aufstieg an die Oberfläche des Lebens. Die Titel der neuen Gedichtsammlung (1945) bricht mit den Mustern der hermetischen Dichtung: Quaderno gotico. Eine halluzinierte Liebe, die sich in Schrift verwandelt, das erste Mal eine Gleichsetzung zwischen Erlebnis und sprachlicher Gestaltung:
Figura non ancora conosciuta
noch nicht gekannt, seit so langem ersehnt
jenseits des Schleiers von Jahren und Jahreszeiten…
Jene Figura, aufgehoben in gotischer Schrift, behält die Erinnerung an das stilnovistische Modell, an die flammende Intensität von Dantes Liebesdichtung, meint die lyrische Askese der Figuren; ihre ideale Unerreichbarkeit enthält aber auch jene Andeutung an die Grenzlinie – zwischen Kampf und Befreiung, Vergangenheit und Zukunft –, in deren Nähe Florenz lebte, jenseits der ,Linea gotica‘, die die Stadt zwingt, ihr Tagebuch von Qual und Lebensliebe aufzuschreiben.
„Gotico“ wird Zeichen eines ,Widerstands‘ der Poesie, jenseits der Waffen und der Tränen. In den späten vierziger Jahren, als der faschistischen Suggestion die zornige Ernüchterung folgte, in einer Zeit der Bilanz oder des erhofften Neubeginns, tritt Luzi aus seiner schmerzlichen Isolation heraus, in ein ,Wüsten-Land‘ – Primizie del deserto (1947–1951): der Titel seiner ersten Nachkriegs-Gedichte. April kommt für ihn wieder, ein Aprile-Amore, im Regen, auf den stillen Hügelstraßen von Florenz:
Dieser April:
Zeit die leidet und leiden läßt, Zeit die
im hellen Wirbel Blumen bringt
mit dunklen Erscheinungen vermischt…
ist Metapher tieferer Veränderungen, als derjenigen des Frühlingsanfangs; in ihm mischt sich jetzt das Wissen um die Zukunft, um die kürzer werdenden Tage. April wird Symbol des Beginns und der Verwandlung, die Luzi in seinen theoretischen Reflexionen der siebziger Jahre als das eigentliche Prinzip der Dichtung erkennen wird:
Als poetische Schöpfung müßten wir jene Fähigkeit verstehen, welche die Dichtung in ihren höchsten Augenblicken erreicht und durch sprachliche Sublimierung die Doppelheit der Ereignisse, das Zusammenfallen von Geburt und Tod, Lust und Leben erfaßt.
Ihre Art, in den Schöpfungsprozeß einzugreifen, soll nicht der Glaube an ein autonomes Universum sein, an eine Schöpfung, die sich – fern von jeder Verwesung – der Natur entgegenstellt. Ein Denkmal aus Worten zu errichten, die wahrer als das Wahre sein möchten – dem gemeinsamen Schicksal der Sprache entzogen –, setzt die alte elegische Vision der Zeit als Verlust voraus: Die Natur kennt nur scheinbare Degradierungen, ihr Gesetz ist nicht der Tod, sondern die Verwandlung. Die Kunst, die jene scheinbare Wirkung der Zeit mit ihrem Anspruch auf Unvergänglichkeit bekämpfen will, kann nicht die Dichtung sein, die – im Gegenteil – neben dem ihr vertrauten Element liegen soll; und das ist „Das Werden, die Verwandlung des Lebens“.
Das Höchste, was wir uns an poetischer, der Dichtung zugesprochener Kraft vorstellen können… ist, in die Lebendigkeit des Schöpfungsprozesses in toto einzutreten und dabei ihren Rhythmus des Werdens und Vergehens, ihren Atemzug zu übernehmen.
Luzis Lyrik kennt ihre Atemwende: Mit der 1957 erschienenen Gedichtsammlung A onore del vero liegt ein Teil des Werkes, eine Hälfte jener Reise, die mit La Barca angefangen hatte, abgeschlossen vor, wie ein Teil der Vergangenheit:
Um meinen Rücken erheben sich die Jahre
wie in Schwärmen. Nicht vergebens, dies ist das Werk
das wir vollbringen, jeder für sich und alle zusammen.
Zusammen, die Lebenden und die Toten: die finstere Welt durchdringen auf klaren und dunklen Wegen voller flüchtiger Begegnungen und voller Verluste. Dies wird die Sorge, die Mühe, das Werk der nächsten Jahre sein, das mit dem Gedichtzyklus Dal fondo delle campagne (1960) einen Höhepunkt erreicht. In dieser Sammlung ist ein emblematisches Gedicht enthalten, dessen letzte Verse den beiden Bänden des Gesamtwerkes (bis 1979) ihren Titel geben.
Sei es Gnade hier zu sein,
im Rechten des Lebens,
im Werk der Welt.
Was ist il giusto della vita, was kann es sein? Wie soll man dieses ,giusto‘ verstehen, das so vielen Konnotationen entspricht? Das Rechte, die Mitte des Lebens oder der Gerechte, der mit seinem rechten Urteil über die Dinge der Welt immer noch irren kann? Kritische Leser haben von der wiederentdeckten Idylle gesprochen, von Montales Einfluß. Diese Bitte um Gnade – im Recht des Lebens zu sein – wird zur mutigen, klaren Absage an die Idylle; an das, was immer noch ein Teil dieser Vorstellung ausmacht; eine Verneinung des alten Rollenspiels, das die Welt entzweit. Die Absage an jene Teilung, die dem Mann das „draußen“ zuspricht und der Frau das „drinnen“ befiehlt. In diesem Gedicht, das noch einen Beginn und Frühling beschwört, dem Gesang der jungvermählten Frau zuhört, bleibt der Mann drinnen, bei ihr – nel giusto della vita. Ein Liebender, der den Riten von Fruchtbarkeit und Tod zuschauen möchte, um sich nah an den Wurzeln des Lebens zu glauben? Oder ein Verweigerer auf der Flucht? Hinter der als religiöse Idylle bezeichneten Haltung verbirgt sich die theoretische Aussage Luzis, daß nur in der Aufhebung von Innen und Außen, in dem Zusammenfallen von Subjekt und Objekt, jene Wahrheit zu finden sei, aus der auch die ,Gnade‘, der Schöpfungsprozeß entstehen kann. In dieser tieferen Schicht sind die Unterschiede zwischen Alter und Jugend, Zukunft und Vergangenheit, Toten und Lebenden Anlaß für Analyse und Selbsterkenntnis. Kaum eine eindringlichere Beschwörung als die Bitte – wohl an die tote Mutter –, nicht zu lange bei den Lebenden zu verweilen, damit il giusto della vita nicht von der Macht des Vergangenen überschattet wird:
Geh einmal an unserem Haus vorbei
denk an die Zeit da wir noch alle waren.
Doch weile nicht zu lange dort.
Der Alltag lastet mit der Pflicht, sich selbst, den Zeit- und Weg-Gefährten Rechenschaft zu geben: über die Verantwortung dem eigenen Land gegenüber und über den Dichterauftrag. In der Sammlung Nel magma (1964–1966), jenem ad infinitum ,offenen Buch‘, geschieht das nach dem archetypischen Muster der Befragung wie in Dantes Comedia.
Mit dieser quälenden Gewissensprüfung fängt für Luzi die neue, andere Reise des prophetischen Geistes ins Innere eines verborgenen Reiches an, das Auf unsichtbarem Grund errichtet ist. (Der Gedichtzyklus mit dem Titel Su fondamenti invisibili erschien 1971.) Auf Dantes Hölle wird jene andere Hölle projiziert: Rimbauds Saison à L’Enfer. Die Moderne hatte in der Umkehrung von Dantes Iter ad Deum das Prinzip der Zerstörung als Bedingung für die Reise ins Jenseits erkannt, durch die dunklen Bezirke des Unbewußten bis zur Läuterung der Kunst. In Luzis Lyrik der siebziger Jahre wird das weibliche Prinzip der Zerstörung auf die apokalyptische Bedrohung der Stadt Florenz übertragen: Ihre Überschwemmung (1966) wird zur Allegorie des Untergangs, Abbild des Zerfalls der menschlichen Beziehungen, zum Ende der urbanen Kultur im XX. Jahrhundert. Der Beatrice-Führerin, Projektion der Dichterseele, Bild der Mutter und aller anderen Frauen nach ihr, kann nur die Stimme antworten, die noch an das religiöse Gesetz der ,Metamorfosi‘ glaubt:
Bete – sagt sie – für die versunkene Stadt
indem aus der Vergangenheit
oder aus der Zukunft mir meine verborgene Seele entgegenkommt…
Es gibt keinen Tod der nicht Geburt auch sei
Nur dafür werde ich beten
Die Vorahnung einer Palingenesis, unter dem brennenden Feuer unserer Ruinen, läßt im dunklen Magma der Existenz, in der Folge der Abläufe düsterer Ereignisse das Licht einer Verwandlung aufkommen. Die ist die Lehre der letzten Gedichte Il battesimo dei nostri frammenti (1985). Nach diesem Prinzip der ewigen unterirdischen Veränderung, der Metamorphose, die sich noch einmal in der alten Metapher des Monats April – im occhio aprilino – widerspiegelt, wird die wiederkehrende Jahreszeit eine Weltzeit, in der wir uns wiedererkennen.
Lea Ritter-Santini, in Akzente, Zeitschrift für Literatur, Heft 5, September 1988
Fakten und Vermutungen zur Herausgeberin + Kalliope
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber
Fakten und Vermutungen zum Autor + Internet Archive
Porträtgalerie: Keystone-SDA
Nachrufe auf Mario Luzi: NZZ ✝ Der Spiegel ✝ Berliner Zeitung ✝
Der Tagesspiegel ✝ Hamburger Morgenpost ✝ Schwäbische Zeitung
Zum 100. Geburtstag des Autors:
Thomas Stauder: Ruhelose Religiosität
Neue Zürcher Zeitung, 20.10.2014
Mario Luzi liest in Saronno seine beiden Gedichte Ottobre und Ignominiosamente.

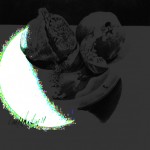












Schreibe einen Kommentar