Peter Gosse: Mundwerk
SCHWIERIGKEITEN: LIEBE / TOD
I
Vor den Preis (nämlich den des Kennens) haben die Götter den Schweiß gesetzt, den des Erkennens – es scheint, als träfe dies nicht allzu beflügelnde geflügelte Wort auf Dichtung in besonderem Maße zu. Was Wunder. Denn das Gedicht – worauf sonst wäre es festgelegt als darauf, Welt auszubreiten in engstem Raume. In so engem, daß das Verb „ausbreiten“ zum Lapsus wird – sagen wir besser: „hereinraffen“. Dieses Hereinraffen im Schreiben, dieses Verdichten braucht eine Energie, die, zu einem Teil jedenfalls, im Lesen, d.h. Ent-Dichten ebenfalls aufgeboten werden will. Freilich: Je unzugänglicher, desto besser – das ist unsere These nicht! Aber was meint denn das: Zugänglichkeit?
„Wanderers Nachtlied“ etwa, obwohl scheinbar so einfach: welch kompliziertes Gebilde! Indem wir nach und nach der Gipfel, Wipfel, Vögelein und des du gewahr werden, hebt sich der Blick aus anorganischer Natur über das Vegetabile und das eigentlich Lebendige des Tierischen zu dessen fragiler Krönung, dem Menschen. Gleichzeitig senkt sich der Blick vom Gebirge, vom Wald herein unters fallende Lid. Und da steht wohl ein Wanderer auf einem thüringischen Hügel, doch gleichzeitig ist es die Menschheit, die erhaben und kurzzeitig auf ihrem schon weit außen im Spiralnebel triftenden Zwergstern siedelt. So daß – wie Wolfgang Heyse im Band Bild und Begriff groß zeigt – das Nachtlied nicht nur den Anbruch einer Nacht vor mittlerweile zweihundert Jahren nachvollzieht, sondern vorvollzieht den der endlosen.
Oder – ein sehr anderes Gedicht Goethes zu besichtigen – wie einfach ist der „Zauberlehrling“? In der Grundschule, die den Text nahezulegen nicht unterläßt, vermutete ich wahrscheinlich: „Sehr einfach“. Vielleicht weil die eingängige Glätte des Gebildes dem eiligen Herunterlesen keinen Stachel entgegenstellte, wurde mir der Hintersinn nicht bewußt, sprich: der Grund so nachdrücklicher Nahelegung. Was aber als einlullendes Walle, walle manche Strecke im Unterbewußtsein plätschert, ist nichts Minderes als eine Standpauke gegen Lehrlinge aller Art. Der Junge soll die Greise, der Plebejer seine Kings bestaunen und, die Hände bieder in den Hosentaschen, diese Obern nicht mit Ungemütlichkeiten wie etwa einer Insurrektion behelligen. „Laß das mal die Chefs machen“, sagt der Text – geschrieben ist er in unmittelbarem Verfolg der großen französischen Revolution.
II
Kommt Schönheit nicht aus ohne die Schwierigkeit des Verdichtens? Denn was ist schwierig an diesen, schönen, Versen Brechts:
Dieses Ziel ist nicht
Mehr als der Weg, so daß, wenn einer fiele
Und ihn der andre fallen ließe, nur erpicht,
Ans Ziel zu kommen, dieses Ziel verschwände.
Man empfindet, denke ich, sofort die Wichtigkeit des Satzes, denn er arbeitet gegen den Willkür rechtfertigenden Satz vom Zweck, der die Mittel heiligt. Aber Wichtigkeit allein schönt nicht, und der Satz beginnt als blasse, nichts beweisende These: Das Ziel ist nicht mehr als der Weg. Doch dann. Indem ein Nebensatz, einen weiteren Nebensatz nach sich ziehend, aufgetürmt ist auf einen Satz, der wiederum nur Nebensatz eines Nebensatzes ist, entsteht ein Erwartungsstau, der die Auflösung zur Erlösung macht. Das Ziel, würde es höher veranschlagt als der Weg zu ihm – es verschwände: Dies ist gewiß ein außerordentliches Argument. Doch seine, schon körperlich spürbare, Wucht (die auch den Dichter elektrisiert haben mag) erfährt es erst, indem es uns aus lastenden hypotaktischen Aufstockungen blitzhaft freischneidet.
Sicherlich hätten wir die Großartigkeit des Satzes auch ohne diese Anmerkung gefühlt. Man kann ja eines durchaus formalen Instrumentariums (in diesem Falle des besonders geeigneten Satzbaus) innewerden, ohne sich dessen bewußt sein zu müssen. Wie aber steht es um die folgende Passage aus einem altindischen Poem (in: Älteste indische Dichtung und Prosa, Reclam Leipzig 1978, hrsg. u. übers. von K. Mylius), in der endlich unser Thema, Liebe/Tod, in Sicht kommt?
Ein Mann, der Ehe überdrüssig, geht in den Krieg, der ihn allerdings – zu seiner Ehre sei es gesagt – gründlicher verdrießt. Reumütig kehrt er, Pururavas mit Namen, an den heimischen Herd zurück, wo nun allerdings die Frau, Urvasi, nicht willens ist, ihm den einstigen Platz einzuräumen. Was wird Pururavas, ein ganzer Kerl und ans Klein-Beigeben nicht gewöhnt, entgegenhalten? Das denkbar Gewichtigste: Selbstmord:
Liefe heute dein Liebling davon, ohne wiederzukehren, um in die entlegenste Ferne zu gehen, läge er hingestreckt im Schoß des Verderbens und fräßen ihn die reißenden Wölfe –
Hier unterbricht ihn die Frau, und durchaus unbeeindruckt. Woher die Reserviertheit der Urvasi? Sie teilt es mit: doch ausschließlich durch das Wie der Entgegnung!
Sie entblößt die Bitte/Drohung, probenhaft in der Er-Form vorgebracht, als Vorspiegelung: durch direkte Anrede; sie denunziert die hochgestapelte Metaphorik des Bittgangs (Schoß des Verderbens): durch Schlichtheit. Und vor allem überführt sie – durch granitne, nur scheinbar flapsige Satzblöcke – die konjuktivisch aufgeladene Nebensatzkonstruktion des Ehegatten der Klügelei, also der Unlauterkeit. Pururavas, du sollst nicht sterben, du sollst nicht weglaufen, die unheilvollen Wölfe sollen dich nicht fressen, sagt Urvasi. Und hätte man nur den Inhalt gehört, schlösse man auf Entgegenkommen. Mitgeteilt aber ist:
Du flunkerst! Man stammelt nicht clever, und hochgestochen, und schon gar nicht hypotaktisch.
Der folgende Satz Urvasis ist denn auch so folgerichtig wie großartig in seiner legeren Tröstlichkeit (er geht gegen etwaige verletzte Eitelkeit): Jedem, nicht nur dir, Pururavas, mißlingt irgendwann die Liebe:
Freundschaften mit Frauen gibt es nicht; sie haben die Herzen von Hyänen.
(Erstaunlich, wie die spannungsgeladene Schachtelung der Artikulation, die Pururavas überführt, Hölderlins Empedokles beglaubigt. Dessen Anspruch auf Freitod, spürt man im folgenden Satz des Stück-Fragments, kommt aus Selbstwertgefühl: sich auch im Ende dem Schalten und Walten der blinden Natur nicht zu unterwerfen. Daß heilig, wenn es geschehen muß, das Gefürchtete, daß es herrlich geschieht!)
III
Daß Georg Maurers Gedicht „Garten“ sich einem öffne, muß man wohl wissen, wer Proteus ist: nämlich jener Gott der antik-griechischen Mythologie, der zwar die Zukunft weiß, wegen seines ständigen Gestaltwechsels allerdings schwer zu packen ist. Auch ist die Kenntnis eben des Empedokles gefordert. Der postulierte die vier Elemente Wasser, Erde, Luft und Feuer als die Konstituanten alles Seienden. Bekannter als durch solcherart Denkergebnisse oder durch Untersuchungen des Regenbogens ist der Mann durch seinen schließlichen Sprung in den Krater des Ätna geworden, den er, nach der Meinung Maurers, tat, um sich mit dem Sein zu vereinigen. Maurer stellt diesem das Sein tilgenden Seiens-Akt sodann einen andersartigen Gang in vulkanische Tiefen gegenüber, den des Pablo Neruda zu den Arbeitenden in den Minen, die es (das Sein) schürfen und an den Tag heben (Essay „Welt in der Lyrik“).
Doch weitere Schwierigkeiten sind unserem Verstehen entgegengestellt. Was hat es mit dem Rokokobett auf sich? Umstehen die Bäume den See wie verschnörkelt-verspielte Bettgiebel? Oder hat sich das Bild eines, vielleicht in früher Kindheit gesehenen, überfälligen Möbels im Zuendegehen des Tages eingestellt? Wer weiß. Und gut möglich, der Dichter selber hätte es nicht zu sagen gewußt.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(…) der See!
auf dem die letzten Strahlen schwimmen
wie im Rokokobett, bis sie wie Greisinnen liegen
im Sterbezimmer der Nacht.
Absonderliche beeindruckende Verse. Die letzten Sonnenstrahlen schwimmen auf dem See wie in besagtem Bett. Aber das schwindet hin. Denn als die Strahlen erliegen, nicht mehr schwimmen, liegen sie wie alte Frauen in der Nacht, und kein Bett scheint mehr vorhanden, kein See. Ist das Enden eines Tages nachgezeichnet, oder vorgezeichnet das aller Tage?
GARTEN
Die Bäume strengen zu Gedanken an.
Der Keim stürzt sich hinauf in Pappeln,
findet im Lindenblatt Vollendung
und seidne Ruhe im geschornen Rasen, drauf
ein Hund im schwarzen Bärenfell sich wälzt
und seine Zunge streckt aus bellendem Grund des Ätna.
Doch die Gedanken drängen zum Keim,
bis meine Adern schwellen: Ist er
der grüne Proteus: Buchshecke jetzt,
dann Birnengelb und Braun. – Doch der See!
auf dem die letzten Strahlen schwimmen
wie im Rokokobett, bis sie wie Greisinnen liegen
im Sterbezimmer der Nacht.
Das Gedicht (obwohl nicht von äußerster Leuchtkraft) geht mir nahe, vielleicht auch, weil es im Petzower Schriftstellerheim am Schwielow-See geschrieben oder ausgelöst ist – Maurer ist dort gestorben.
„Garten“ gibt zunächst nichts als einen Ausblick aus diesem Gebäude: Auf den abendlichen See und die Rasenflächen davor, mit Buschwerk und Blumen, zwischen denen der Hund des Hauses tollt (heute wandelt), ein stattlicher Neufundländer von fürwahr mephistophelischer Schwärze des Fells.
Ein eher mageres Material für ein Gedicht so verpflichtenden Titels – das Garten-Motiv steht, als Mitte zwischen Natur unberührt an sich und Natur robust für uns, für das Einvernehmen nicht nur des Menschen mit der Natur, sondern von Menschheit in sich. Aus dem Topos wächst, Ecksäulen zu nennen, bei Brecht der leuchtende Demokratie-Entwurf („Garden in Progress“), und bei Huchel schießt er auf zur apokalyptischen Warnung („Der Garten des Themistokles“).
Mauers Gedicht sieht, nein, schaut die Gestaltwandlung des Pflanzlichen: Same – Laubwerk – Frucht – Same. Oder: Braun – Grün – (Birnen-)Gelb – Braun. Oder: Wurzel – Gezweig – Wurzel. Oder, in empedoklesschen Begriffen: Erde – Luft – Erde. So sind es nicht etwa die jahreszeitlichen Änderungen von Pflanzlichem, die vorgestellt sind, sondern die unerhörten Metamorphosen des Lebens selber, dessen Stirb-und-Werde! Dem auf den Grund zu kommen, den Proteus zu ergreifen – wenn das gelänge! Das Feuer des Vulkans (das der Schlund des teuflischen Tieres erinnert) erhellt nichts, vielleicht das Faustische der eignen schwellenden Adern? Das Leben wäre ganz kenntlich, alle Zukunft!
Aber ist die es nicht ohnedies? Doch der See! Vor dessen Unrührbarkeit, vorm letztlich Statuarischen des ja eigentlich so quirlig-quecksilbrigen Elements schrumpft das Werden/Vergehen/Werden zu freundlichem Funkeln vor Hohlraum. Und selbst er, der See, schwindet in einer hereinbrechenden Nacht von schmerzhaftester Zeitlosigkeit. Indem der Garten zur belebten Erde sich geweitet hat, wächst sich die Nacht aus zu der von „Wanderers Nachtlied“. Das Begriffspaar Liebe/Tod ist ein höchst ungleiches, Leben exklusive Peripherie. Am Anorganischen tänzelt das Organische: glimmende Arabeske.
IV
Das wahrscheinlich Schwierigste an Gedichten ist, daß sie uns bisweilen ungekannte Gefühle fühlen, ungeahnte Gedanken denken machen. Wir und etwas nicht geahnt haben? fragen wir da, mit stabilem Brustton, und lassen die Verse, eben als schwierig, beiseite.
du liebst sie, liebst, tönt es beseeligt in Erich Arendts Gedicht „Lears letzte Tochter“. Doch Seltsames folgt in der euphorischen Selbstbeteuerung (solche Liebe war wohl, allenfalls von Lear, nicht mehr für möglich gehalten worden):
du liebst sie,
liebst: o
schädelfühlige Nähe,
herzalt! Und –
überfern, in dir, das leis
das Lippenrat leugnet, erd-
graues Erschweigen.
Wie kommt man Arendts Dichtung nahe? Indem man sie – so unbekümmert es geht – beim Wort nimmt. Wenn etwa geschrieben steht (im Gedicht „Napoleon“): „Ich lag / in des Kaisers breitem Bett“, so will das für bare Münze genommen werden. Tatsächlich hat Arendt in Buonapartes Bett genächtigt und dort, oben in den Bergen der Insel Elba im Tyrrhenischen Meer, die Hitze der Asphaltstraße (die Sonne (…) stieg pechschwarz / heiß / in den Himmel der Mitternächte) voll Genugtuung gespürt. Denn Sonne meint nicht schlechthin Sonne und Hitze nicht die tagsüber gespeicherte:
Straßenarbeiter: halbnackt,
hatten die Sonne in den Asphalt gewalzt.
Stellvertretend für sie, die Plebejer, die das Gedicht mit brüderlichem Pathos namhaft macht, nimmt der Dichter den Platz ein, den der Diktator hat räumen müssen. (Dieser Diktator – nicht freilich der Typ Diktator schlechthin. Buonaparte ist dahin, nicht der Buonapartismus – das Gedicht bringt dies vor, bange und verbissen.) Immerhin, welche Hoffnung! Und so nimmt es nicht wunder, das morgendliche, gleißende Meer tief unter uns mit solchen fanfarenhaften Tönen gefeiert zu hören:
ein einziges
Blenden: Meer, zu-
geblendet der Schrei.
Welcher Schrei? Ein Schrei verheißt selten Gutes, der des Neugeborenen ist nicht gemeint. Dennoch wüßte man es gern genauer, und der Vers lautet in der Tat so:
zu-
geblendet der Schrei
der Rippe.
Natürlich schreien Rippen nicht, und es ist nun schwer mit dem Beim-Wort-Nehmen.
Bei Hölderlin – und Arendt kennt seinen Hölderlin – kommt „Rippe“ vor als „Küste“, vielleicht in Kenntnis der Identität dieser Wörter im Französischen (côte). Das Gleißen des Meeres, meint mithin das Gedicht des Brandenburgers, tilgt, wie wir es schon gesehen haben oder doch uns vorstellen können, die Scheidelinie zwischen Wasser und Land, ja den Unterschied. Es ist, als seien die besagten Elemente – Wasser, Erde, Luft und Feuer – nun Eines. Von fernher leuchtet in diesem Zu-Blenden gar Marxens phantasmagorischer Satz von der Sonne der Arbeit (im Gedicht der der Straßenbauer), nach dem die Menschheit, erst wenn sie sich um diese Sonne drehe, ihr Gleichgewicht finde. In der Tat sind es ja nicht nur die, anorganischen, Elemente, die als vereint geschaut werden: Rippe läßt an diejenige Adams denken, der Eva entsprang. Und dieser Sprung scheint durchaus als Zersprung empfunden zu sein, als ein schreienmachendes Zertrennen in Geschlechter und nicht nur Geschlechter: in Rassen, in Klassen.
Zu-Blendung also ist Beendigung jedweder Zerklüftung. Und obwohl dieses Ende als durch die Plebejer gewirkt erscheint, läuft es doch aus in einen Anfang von nachapokalyptischer Helligkeit, zeitlosester metaphysischer Harmonie, von Gnade. Das hölderlinsche Geschichtsbild ist hier übernommen, demzufolge die mythische Heilszeit (die bei Hölderlin mit dem antiken Griechenland und Christus abbricht) nach Bestehen einer Sintflut (E. A.)-Periode (der Verwerfung ins Hierarchische) sich wiederherstellt. Im festlichen Gedicht „Elba“ lehnt die chiliastische Utopie durchaus an Marxens Gedankengut; mittlerweile, so scheint es, ist sie dem Dichter im Diesseits nicht mehr glaubbar. Im späten Gedicht „Nike“ wird die Siegesgöttin betäubt so angeredet: „ich fand deinen Ort / leer- / geschunden von Zeit ohne / Geschichte“, und die Bläue des Meeres – in den sich anschließenden Versen – erhält ihre tröstliche Saugkraft untröstlicherweise aus nur mehr Transzendentem:
aufs Meer blickend
ich sah
seine Gedächtnistiefe die
unbesiegbare Bläue.
(Die Verse entgegnen Hölderlin, der Bleibendes, eben Gedächtnis, gestiftet sah von den Bleibenden, d.h. denen, die sich nicht ins Meer davontreiben lassen.)
V
Zurück zu Arendts Versen aus „Lears letzte Tochter“: die roten Lippen und der (Toten-)Schädel in einem Atemzug!
Diese In-eins-Sprengung ist nicht gänzlich ungewöhnlich. Vor reichlich zweihundertfünfzig Jahren erklärte Johann Christian Günther, als „er der Phillis einen Ring mit einem Totenkopfe überreichte“:
Erschrick nicht vor dem Liebeszeichen,
Es träget unser künftig Bild,
Vor dem nur die allein erbleichen,
Bei welchen die Vernunft nichts gilt.
Nach dieser Feststellung, die wohl zu robust-unbekümmert vorgetragen ist, als daß sie nicht die Jugend des Autors verriete, fragt Günther:
Wie schickt sich aber Eis und Flammen?
Wie reimt sich Lieb und Tod zusammen?
Tatsächlich: wie? Die Antwort des jungen Dichters mag in ihrer Saloppheit wiederum nicht überzeugen; die Begründung, Liebe und Tod würden Wunderwerke (welche übrigens?) von gleicher Stärke zeitigen, wirkt vernünftelnd-unbetroffen:
Es schickt und reimt sich gar zu schön,
Denn beide sind von gleicher Stärke
und spielen ihre Wunderwerke
Mit allen, die auf Erden gehn.
Goethes Prometheus, im dramatischen Fragment, wird von Tochter Pandora gefragt (sie ist deren Schwester):
Ich fühlte wieder ihre Kniee wanken
Und hielt sie, teurer Vater,
Und ihre Küsse, ihre Glut
Hat solch ein neues, unbekanntes
Gefühl durch meine Adern hingegossen,
Daß ich verwirrt, bewegt und weinend
Endlich sie ließ und Wald und Feld. –
Zu dir, mein lieber Vater! Sag,
Was ist das alles, was sie erschüttert
Und mich?
Prometheus antwortet in die Antwort hinein, die uns auf den Lippen liegt, nämlich „Die Liebe“ : „Der Tod“, so beides ineinander gegenfügend. Prometheus verdeutlicht:
Wenn aus dem innerst tiefsten Grunde
Du ganz erschüttert alles fühlst,
(…)
Und alles klingt an dir und bebt und zittert
Und all die Sinne dir vergehn
Und du dir zu vergehen scheinst
Und sinkst
Und alles um dich her versinkt in Nacht
Und du, in inner eigenstem Gefühl,
Umfassest eine Welt,
dann bist du beider als Eines’ inne: Stirb als Werde, Werde als Stirb; Tod liebesbürtig (Arendt, im Gedicht „Hautnackt“) sowie Liebe todesbürtig. Das vielleicht Furioseste, in sadomasochistischem Rasen: Miguel Hernández’ „Der Tod“:
Der Tod, mit Todes Hörnern überfüllt,
mit Todes Löchern, Spuren seiner Wut,
auf Wiesen, leuchtend vor Toreroblut,
äst er, in eine Stierhaut eingehüllt.
Vor Liebe raucht er, ein Vulkan, und brüllt
und schnaubt, und schlägt in seiner Glut
die stillen Hirten tot. Was noch nicht ruht
im Grab, was lebt, was atmet, liebt er wild.
Mein Herzgras tragisch geb ich dir zur Weide
vor Hunger, Tier, vor Gier und Liebe toll,
wenn seine Bitternis, sein bittrer Stoff dir schmeckt.
Dieselbe Folter, Liebe, ist’s, an der ich leide,
wie du, zu allem, und mein Herz ist voll.
Es gibt sich hin, vom Totenhemd bedeckt.
Arendts benehmende Verse sind Stoff von diesem Stoff: „o / schädelfühlige Nähe, / herzalt! und – / überfern, in dir (…) erd- / graues Erschweigen“. Die (im persönlichen Gespräch von E. A. bestätigte) besonders erotisierende Wirkung eines magersten Frauenhaupts ist dessen, dieses Stoffes, äußere Schicht.
VI
Schließlich ein Gedicht Volker Brauns; auch es nicht geeignet, lediglich überflogen zu werden. Nicht der protokollarisch-italienischen Einsprengsel wegen, die ja vornehmlich das Wirklichgewesene der Begebenheit bekräftigen sollen in dieser warmen Nacht im Juni (oder wann immer die Pappeln samen) in Torino, Turin, und uns durchaus nicht zu langwieriger Wörterbuchsuche auffordern. Man braucht ohnehin nicht zu wissen, daß gioia Freude heißt, um granata, die Granate, als durchweg Unkriegerisches zu erahnen, nämlich als Feuerwerkskörper (und Granatapfel, und Besen des Reinemachens), also als Kürzel lustvollen karnevalischen Aus-sich-Herausgehens. Nein, seine Schwierigkeiten hat es eher damit, daß vom Grabtuch des Herrn gesagt wird, es sei präpariert für die Blöden, deren Blicke auf dem Abdruck des Leichnams dann aber durchschaut sind als voll von einer Lust, die zu teilen der Autor nicht umhin kann und nicht umhin will! Das Tuch mit besagtem Abdruck wird geschmäht – und gefeiert wird ein sehr ähnliches Tuch, als es unsere (das Wort ist, am Zeilenende stehend, kräftig hervorgehoben), unsere Abdrücke erhält. Die Feier gerät derart, daß von der Schmähung nichts bleibt. Es macht plötzlich keinen Unterschied, ob die Spuren echt schwärzlich oder gelogen schwarz sind, ob sie herkommen aus den Wunden der Brust oder dem Wunder der Brunst, ob Bettuch – prachtvolle Uneinhelligkeit unserer Sprache! – Bet-Tuch oder Bett-Tuch meint. Das soll Volker Braun gewollt haben: die Blöden mit einemmal nicht blöd? Das Abstoßende anziehend?
ITALIENISCHE NACHT
Pappelschnee auf der Piazza / aus den Straßen Getöse /
Auf das gemietete Bett fallen wir beide zugleich
Nach dem Mahl / TORINO, GRANDE TORINO, die Schreie
Der begeisterten Fans / und das Grabtuch des Herrn
Präpariert für die Blöden / die Suppe unter den Bäumen
Spargel Tomaten und Fisch mit den Genossen / verrückt
Streut sie die Kleider umher, das Bettuch über die Dielen /
Schwarz die gelogene Spur aus den Wunden der Brust /
Und dieser Lärm, I GRANATA SONO CAMPIONI D’ITALIA /
Und erst bei Sinnen vom Wein nackt, in dem Lampenlicht /
Vino Dolcetto / Pappelschnee auf der Pizza / die Dächer
Seh ich plötzlich bewohnt / und diese Blicke voll Lust
Auf den Abdruck des Leichnams, die Küsse / und schwärzlich unsere
Hände und Füße echt zeichnen sich ein in das Tuch /
Pappelschnee auf deinem Schoß / LA GIOIA GRANATA E’ESPLOSA, /
Laß das Fenster auf! sagt sie: damit man uns sieht.
Klopstocks vielleicht letztes Gedicht, „Die höheren Stufen“ (1802), beginnt so: „Oft bin ich schon im Traume dort, wo wir länger nicht träumen:“ außerhalb des Diesseits. Ein zwiespältiger Satz. Denn Traumlosigkeit macht erschrecken (als Erstorbensein) u n d verheißt gesteigertes Leben. Das Noch-Unwirkliche läßt sich nie mehr verwirklichen oder aber verwirklicht sich in einem fort.
Alsbald jedoch tilgt das Gedicht diese Ambivalenz: Tod ist herbeigesehnt. Kein Wunder, da er dem der Seelenwanderung Sicheren schönere Fortexistenz bedeutet. (Sie hatten es gut: Lessing, Klopstock, Goethe, Hölderlin!) Wobei deren Vertrauen in die Palingenesie, zumal bei Lessing und Goethe, aus Anmaßung kommt, nicht aus Selbsttröstungsverlangen wie bei Rousseau („ich habe zu viel in diesem Leben gelitten, um nicht ein anderes zu erwarten! Alle Spitzfindigkeiten der Metaphysik werden mich nicht einen Augenblick an der Unsterblichkeit der Seele (…) zweifeln lassen. Ich fühle sie, ich glaube sie, ich will sie haben, ich hoffe auf sie, ich werde sie noch mit meinem letzten Seufzer verteidigen“ – in einem Brief an Voltaire). Der Grabstein, in nimmersattem Entgrenzungswillen, wird als Schlußstein nicht hingenommen. Das Fragezeichen in Lessings euphorischem Ruf ist reinweg rhetorisch:
Ist nicht die ganze Ewigkeit mein?
Ein faustisch-agiles Selbstwertgefühl meldet sich – aus eben demselben heraus allerdings Herder, als Alleingänger, den Traum von der Seelenwanderung befehdet: weil dieser Traum ruhige Passivität sehr begünstigt.
Er ist (…) ein Opium, das gleichgültig macht. Herder haßt es, denn das größeste Gute wie das größeste Übel geschah den Menschen DURCH MENSCHEN! (Hervorhebung Herder.)
Und so komme es an nicht auf Wandeln immerdar, sondern Wandlung jetzt:
In diesem Leben ist also den Menschen Palingenesie, Metempsychose unentbehrlich; oder sie ist überhaupt mißlich. („Zur Philosophie und Geschichte“ VII, VI: „Ahnungen der eigenen Zukunft“.)
Klopstock, anders als der sozusagen herabkommende Herder, erklimmt die höheren Stufen jener Treppe, die in uranisch-universalische Aufgehobenheit führt. Welch ein Panorama öffnet sich!:
ich sehe lebende Wesen
Sehr verschiedener Gestalt. Jede Gestalt
Wurd oft anders; es schien, daß sie an Schönheit sich
Übertraf, wenn sie änderte:
eben in den Zeit-Punkten der Metamorphose, des lebendigsten Lebens. Ja, jene Gestalten, um diesen Neuungen ganz offen zu sein, waren gar entsprechenden Aggregatzustands, sie glich( en) heiteren Düften, aus denen – höchste Steigerung – ikonisch-erhabenes Eigenlicht ging:
Sanfter Schimmer sich goß.
Die Schönheit dieser Unsterblichen muß unvergleichlich sein, und doch wird ein Vergleich sogleich beigebracht, und welcher!
Der Blick
Des, der Wahres erforscht oder, Erfindung, sich
Deiner seligen Stunde erfreut!
Der dichtende denkende Sterbliche wird dem höchsten Eingebildeten anverglichen, oder umgekehrt. Das Ersehnte ist keinen Deut mehr, es ist keinen Deut anders als der Ersehnende, der denn auch die erhabenen Wesen forschend betrachtet. Der Himmelstraum ist als ins Irdische ziehende Utopie erklärt, deren seliger Stunde sich einer freut: hienieden. Ein Überirdisches, derart gekündigt, ist gewiß auch aufgekündigt. (Was vom Dichter vielleicht nicht allzu gewußt ist). Und so steht der Gedichtschluß „ich / Sah erwachend den Abendstern“ wieder im erregenden Wechsellicht des Beginns: zwischen Sog und Beklemmung.
Von anderer Art das Uneinhellige bei Braun. Das (scheinbar) Trübe zeigt Gären an, das Vorkommnis ist als Vorgang gezeigt (der den Protokollanten als einen Andern, Geänderten entläßt).
Zu Beginn sind die Leute geschieden in Liebespaar, in Fans, in Präparierer, in (erinnerte) Genossen. Hier Schreien, dort Speisen, da Streuen, oder Streunen. Doch dann sieht man die nahe Frau ein Verrücktes tun (das dem derjenigen ähnelt, die, wie sich also zeigt, zu eilfertig als Blöde abgetan worden sind), und der Mann sieht auf verrückte Weise:
erst bei Sinnen vom Wein nackt.
Die Wörter geraten in schöne Wirrnis, und nicht eigentlich Verrückung ist geschehen, sondern Vermischung. (Die Küsse in Vers 13 sind schon nicht mehr zuordenbar: Wer wen?) Und die grenzbrecherische Simultaneität des Wahrnehmens ist hier (anders als bei Pound und Eliot, worauf Maurer weist) purer Realismus. Wenn Pappelschnee, zunächst auf der Piazza, dann auf der Pizza gesehen, schließlich geschaut wird auf deinem Schoß, so ist nicht schlechthin Mögliches und Handgreifliches verschmolzen (die Wand anulliert zwischen Vision und Wirklichem), sondern das Zimmer i s t die Piazza. Ein Gelegenheitsgedicht, das unmißverständlich von Liebe in einer warmen Nacht zu handeln schien, gibt auf die Frage, wie diese Nacht denn sei, nicht mehr zur Antwort: trunken oder warm oder eben italienisch. Sondern mit Brechts Galilei: hell. Wie wohl jedes große Gedicht entzieht das Gebilde sich der Rubrizierung.
Denn der eigentliche Vorgang im Gedicht ist: das Fallen der Schranken. Kein heraklisches Fällen, sondern das wie selbstverständliche Dahinschmelzen. Der schützende vereinsamende Kokon der sprichwörtlichen vier Wände wird überflüssig: im schönen Verfließen aller Dinge, das den Unterschied nimmt zwischen Intimem und Öffentlichem. Übrigens hat sich auch das Ausnehmende, das Unverwechselbare einer Zweierbeziehung verflüchtigt. Genießende, die selbst dem Tod Lust abgewinnen, werden sich erst im Stoffwechsel aller mit allen beruhigen. Mit wem du soeben – dies zu denken ist nahegelegt – die Säfte tauschst, ist gleichgültig. Denn jede(r) ist gleich gültig!
Ein Jeglicher ein Souverän! Dies ist im Gedicht nicht somnambulisch vorgeschäumt, sondern erlebt. Daher der ungrelle kräftige Glanz dieses Mittsommernachtstraums: er ist kein Traum. Der Initialsatz von Klopstocks „Höheren Stufen“ erfährt so jene Vereinhelligung, die ein Transzendieren des Lebenswerten in Überwelten überflüssig macht: sozusagen außer der Welt sein läßt. Auch den Arendtschen Versen antwortet „Italienische Nacht“: in Blicken voll Lust zeigt sich Thanatos in Eros eingesenkt: eben sofern besagte Schranken beseitigt sind. Sie beiseite zu bringen mag kein Einfaches sein, aber es scheint nur auf einfache Art möglich. Denn welche Schwäche zwänge zum Krampf, zum Coup? Der Handstreich, auch wenn er gutgemeint ist, verzerrt bekanntermaßen die Glieder. So zeigt das Gedicht die Gewalt der Lehrlinge, wenn sie, aus jedwedem faulen Zauber, der mit ihnen versucht wird, zaubrisch herausgehen: zu sich.
Anstelle eines Nachworts
– Aus einem Interview. Nach Fragen Dr. Jürgen Englers. –
Jürgen Engler: Zunächst ein paar Worte über dich.
Peter Gosse: Ich bin in Leipzig geboren und lebe hier seither und – hoffentlich – fürderhin. Ausgenommen sind die Jahre 1956 bis 1962, wahrend der ich in der Sowjetunion Hochfrequenztechnik studierte. Ich mag Leipzig, aus tausendundeinem Grund; einer von ihnen ist ein Steinbruch von mittlerweile schon unglaublicher Reinheit des Wassers, die schöne Seite jener Medaille, deren rückwärtige Fläche Völkerschlachtdenkmal heißt. Sympathischerweise wird der hybride Klotz im Volksmund als Völkergeschlechts-Denkmal abgekanzelt; sein Glück immer noch, daß das Monstrum weit weg steht vom Alten Rathaus, einem Gebilde von lichter anheimelnder Grazie, oder den anderen überkommenen Altbauten des Markts, auf dem allerdings Woyzeck geköpft worden ist. Aber ich verfalle ins Baedekern.
Über meine Kindheit weiß ich nichts Nennenswertes. Ich vermute ohnehin, daß ihr Einfluß auf das Erwachsenen-Dasein überschätzt wird. Es kann kein Zufall sein, daß in den Jahren um 1770 oder 1890 die Geburtsdaten großer Leute auffällig dicht beieinander stehen: Hegel, Hölderlin, die Romantik hie, Brecht und der Expressionismus da. Nicht die Wochen oder Jahre nach der Geburt sind offensichtlich prägend gewesen, sondern die im weiten Sinne pubertären Jahre gegen Ende des zweiten Lebensjahrzehnts, deren Brüchigkeit/Aufbruchsfähigkeit mit den sich ankündigenden sozialen Umbrüchen im Vorfeld der Französischen Revolution und des Weltkriegs (und der sich anschließenden Revolutionen) in Deckung kam.
Nach dem Studium habe ich als Diplomingenieur sechs Jahre in der Radarindustrie gearbeitet. Als die einschlägigen Arbeiten, in die ich mich als Entwickler einiger Partien dieser Geräte ziemlich hineingekniet hatte, aus Gründen internationaler Spezialisierung eingestellt wurden, begann ich mich ernsthaft als Schreiber zu versuchen. Seit beinahe neun Jahren versuche ich nach Kräften, im Literaturinstitut in der Tauchnitzstraße interessiertem Nachwuchs etwaiges Förderliche zu Gedichten mitzuteilen. Ich bin in diesem Hause Oberassistent; eine für mich natürlich fürstliche Sache, man wird für ein Hobby bezahlt.
Engler: Das Erlebnis SU war für dich gravierend?
Gosse: Das kann man wohl sagen. Ich beginne mit Peripherem. Im Hochschulinternat wohnte ich zusammen mit einem Russen, einem Polen und einem Vietnamesen in einem Zimmer. Wir waren zusammengezogen, um wechselseitig unsere Sprachen zu erlernen (statt Vietnamesisch allerdings Französisch). Was vor allem herausgekommen ist, ist aber – jedenfalls was mich betrifft – ein Unverständnis fürs Nationelle. Es gibt – woran ich manchmal mit ulkigem Stolz, zunehmend freilich mit Schrecken denke – im uns wahrnehmbaren Kosmos wahrscheinlich nur eine Menschheit, und ich bin ungeeignet, einen Flecken (oder Marktflecken), in den ich zufällig hineingeboren bin, über andere zu stellen oder seine Partikularinteressen zu verinnerlichen.
Mir ist es angenehm, bei Barlach oder der Kollwitz oder bei Kafka nichts Nationelles, im erdweiten Sinn also Provinzielles entdecken zu können.
Ein schriftstellernder Bekannter bedauerte neulich, nicht aus dem Erzgebirge oder der Lausitz zu stammen: man wurzele dann in sehr Eigenem. Sicher: Marquez läßt sich ohne sein mythendurchsättigtes Karibien nur schwer vorstellen, und Aitmatows Weiße Hirschkuh läßt sich nicht erfinden. Simpel gesagt: Das Hemd ist einem allemal näher als die Jacke, und es ist gut, daß Schriftsteller nicht die Jacke zu beschreiben trachten. Die Frage ist nur, wie weit das Hemd ist. Gemessen an der Erde, diesem versehrbaren Zwergstern.
Daß, nebenher gesagt, in Brechts Werk Deutschland eine nicht unbedeutende Rolle spielt, liegt vielleicht daran, daß es Epizentrum gesellschaftlicher Erschütterungen war zu jener Zeit. Und wenn Heiner Müller am Masochismus der Deutschen – sehe ich recht – leidet, so meint er vielleicht nicht nur den der Deutschen? Aber ich bin vom Thema abgekommen. Ich habe in Moskau reichliche fünf Jahre gelebt, von 1956 an: eine erstaunliche Zeit. Vom massigen Majakowski-Denkmal herunter las jeder, der wollte, eigne oder fremde Gedichte. Das ging so jeden Samstagabend, bis gegen Mitternacht (die Metro schloß da), den Herbst 1959 hindurch. Der Lesende wurde von Dutzenden Händen am für derlei nicht vorgesehenen Sockelstein hochgestemmt, es bedurfte einiger Artistik seitens des Rezitierenden. Die vielen Hände leuchteten im Licht der Neonlaternen, und man sah im Frost die Atemwölkchen über den Pelzmützen der mehrtausendköpfigen, dicht bei dicht stehenden Zuhörerschaft steigen. Ich entsinne mich, wie einer Jessenins großes Abschiedsgedicht sprach, und spontan hielt ein anderer Majakowskis große Replik dagegen.
In der Hochschule, an der ich studierte – eine technische, nicht etwa humanwissenschaftliche Schule –, wurden Lesungen von Dichtern (Jewtuschenko, die Achmadulina, Wosnessenski kamen) zu wahren Festen. Die Flügeltüren der Aula wurden gegen sicherlich mancherlei Widerstände aus den Angeln gehoben, und noch die Korridore entlang staute sich die Jugend.
In einem Theater, jenem übrigens, auf das der besagte Bronze-Majakowski blickt, wurde ein Stück gegeben über die Berechtigung des Roten Terrors. Ein Begriff, der in diesem ziemlich dokumentgetreuen Werk unentwegt vorkommt; man nannte das so, damals, auf Lenin war gerade ein Attentat verübt worden. Der Terror wird verworfen auf der das Innere des Mausoleums vorstellenden, musealen Bühne.
Keiner hat am Schluß applaudiert. Etwas anderes geschah, mir ist es heiß den Rücken hinuntergelaufen: Alle erhoben sich und sangen die Internationale. Weiß der Teufel, wen alles wir gemeint haben mögen, als dieses Lied der Lieder Gott, Kaiser und Tribun verwirft.
Aber ich bin ins Reden gekommen. Ich geriet, kurzum, in eine Aufbruchsituation. Während manchen, nur um wenige Jahre Älteren das Weltbild riß nach dem sechsundfünfziger Kongreß, baute sich mir in dessen Gefolge eines auf. Ein ziemlich euphorisches. Für die Botschaft, die man gehört hatte, fehlte nun der Glaube nicht. Eine weltweit brüderliche, im Handumdrehen erlangbare Zukunft malte sich berauschend her. Das Verhältnis Sowjetunion – China schien untrübbar (ich studierte zusammen mit jungen Leuten aus Peking), Lenins später (Ersatz-)Traum von der Weltrevolution aus dem Osten verwirklicht.
Aus diesem Überschwang, und direkt angefacht von Versen Whitmans und wohl auch Eluards, begann ich zu schreiben.
Engler: An Whitman reizte dich auch das Formale?
Gosse: In zweiter Linie. Natürlich war das „umwerfend“: das Kreatürliche und doch Erhabene der Lexik, die herrlich ausufernde Langzeile. Sie, so fand ich, paßte genauer zur allgemeinen Gestimmtheit als die den kanonischen Reim- und Rhythmisierungsvorgaben folgende sowjetische Lyrik, die sich vorm Hintergrund Whitman, Eluard, auch Prévert ein bißchen korsetthaft ausnahm, freilich nur im Formalen.
Das Eigentliche an Whitman aber war seine Welt-Bürgerschaft. Bei allzu Eigenem, Individuiertem hielt er sich nicht auf, ein jeder war ihm der Nächste. Das war durch und durch Anti-Kult. Bis ins Unterbewußte war da einer von Demokratiewillen durchtränkt: dem Gesicht (das er nie Antlitz nennen würde), und darin wieder den Augen, sprach er nicht höheren Rang zu als, sagen wir, der Fußsohle. Staub war vom Range des Blütenstaubs. Im Erotischen gab er sich mit der einen Hälfte der Menschheit nicht zufrieden. Ich weiß außer Rabelais keinen ähnlichen Hymniker der égalité, der Hierarchiegegnerschaft.
Engler: In einem Gedicht ergreifst du Partei für Dädalus. Ikarus scheint dir aber näher zu sein!
Gosse: Meine ersten Versuche sind wohl ziemlich ikarisch gewesen, jedenfalls tüchtig flügelklatschend. Dann mäßigte sich der Eifer in ein erwachseneres Denkangebot: Dädalus. Auch zu dem empfinde ich mittlerweile eine milde Distanz. Wenn wir überhaupt im mythischen Material bleiben wollen (das mir immer fremder wird), wäre zu sagen, daß ich mich von diesen beiden ja durch und durch prometheischen Figuren hin zu Epimetheus driften sehe. Im Unterschied zu Bruder Prometheus, dem kurzschlüssigen Draufgänger, blickt jener am Gottesgeschenk Pandora (Eva) nicht vorbei. Überhaupt verschafft sich der Nachdenkliche (nichts anderes bedeutet sein Name), sozusagen nachdenkend ohne hinterherzudenken, den klaren Über- und Vorblick.
Laß mich zur Illustration eine Geschichte erzählen. Ein altrömischer Philosoph – die Begebenheit handelt in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts – erwirkt die Erlaubnis, ein seines Erachtens ideales Gemeinwesen zu gründen. Obwohl das Philosophenstädtchen für Roms Obrigkeit schon deshalb ganz unbrenzlich sein muß, weil es – wie sein Name, Platonopolis, anzeigt – nach Grundsätzen des ja durchaus obrigkeitsbewußten Platon strukturiert werden soll, wird dem Philosophen, Plotin, eine unwirtliche Halde in Etrurien angeboten.
Longinus, einer von Plotins Gefolgsleuten, ist sich zu schade für solch einen zum Scheitern verurteilten, irgendwie ikarischen Retortenversuch. Er begibt sich in einen real existierenden dabei wandlungsfähigen Kleinstaat, der zudem den Vorteil aufweist, im Machtvakuum zwischen den Weltstaaten Rom und Persien zu liegen. Als unscheinbarer Hauslehrer treibt er seine Schülerin, Zenobia, auf den Thron und die Oase, die Palmyra heißt, in die Weltgeltung. Er macht, dädalisch, ein Platonopolis. Welches Rom natürlich zu bunt wird, und nach drei Jahren ist die Oase verwüstet und Longinus tot.
Das war vorauszusehen. Und wer es voraussieht, zieht sich von Anfang an in einen schönen Weingarten auf Sizilien zurück, nicht aus Faulheit, sondern im Wissen um die derzeitige Uneffizienz von Eingriffsversuchen. (Rimbaud, als die Commune vorüber ist, wird Händler.) Was zu tun lohnt, geht gerade einmal nicht zu tun. Die ciceronische Tirade, die ein vom rein intellektuellen Vermögen her außerordentlicher Leipziger Germanist glaubte vom Stapel lassen zu sollen, macht einen jedenfalls trüb lächeln: Der Betrachterstandpunkt, so läutet der Satz, ist eine atheoretische Mißgeburt, eine Schizophrenie, eine Absurdität. Natürlich kann die Allseitigkeitssucht Epikurs auf den ersten Blick mit Eskapismus verwechselt werden.
Engler: Immerhin stellst du, überraschenderweise, Produktivität in Frage.
Gosse: Arbeit als Menschheitsmacherin, als erstes Bedürfnis, als jene Zentralsonne, um die wir kreisen müssen, um uns wohl zu befinden – all das ist zweifellos richtig. Und Theorien, die Leistungslosigkeit als paradiesisch vorhalten, sind in meinen Augen keine Vorschläge, die auf Entspezialisierung und Entflechtung hinauslaufen (etwa durch Zergliederung der Menschheit in sich selbst versorgende, voneinander abgekoppelte Ensembles), erinnern mich an die hilflosen Angebote des großen Dichters Laudse, durch Zivilisationsverzicht (Verzicht z.B. auf die Kommunikationsmittel Brücke, Boot, ja Sprache) ins Goldene Zeitalter zurückzugelangen.
Wir wollen aber bei alledem die Implikationen nicht übersehen.
Es beginnt schon damit, daß der Urkommunismus untergegangen ist. Eine Katastrophe, von deren Ausmaß das Endzeitgefühl aller Religionen einen Eindruck gibt. Wir können diesen Untergang nicht nur bedauern. Wir säßen hier ohne dieses schöne Tonic und ohne Tonbandgerät, und worauf säßen wir, und was hieße „wir“? Auch wenn wir uns ein Fortschreiten vorstellen können, bei dem der Wein nicht aus den Schädeln der Erschlagenen getrunken wird – was wir uns nicht vorstellen können, ist ein Stehenbleiben. Dessen aber muß sich die Urgemeinschaft – ich verwende ein unpassendes, weil moralisierendes Wort: – schuldig gemacht haben. Litt sie an ihren Errungenschaften? (Ich höre von Theatern, die künstlerisch untergehen, weil ihre Künstler zu gesichert wohlauf sind.) Krisen, wie wir sie aller Dutzend Jahre in näheren Gefilden erleben, weisen auf nichts als sanktioniertes Ver-Halten der Erzeugungslust. Was also sind Siege, was Niederlagen. Gewinn und Verlust sind schwer auseinanderzukennen. Manches, was als im letzten Stadium befindlich und überfällig erscheinen konnte, fällt nicht nur nicht, sondern lebt quicklebendig die Kürzung der notwendigen Arbeitszeit vor. Das Artgemäße stellt sich auf sozusagen ungemäße Art her, unartig. Es ist sichtlich kein absurdes tiefenpsychologisches Phänomen, daß straffe Leitungen von Massen gemocht, ja gemacht werden. Hart angefaßt, fassen sie, die Massen, härter zu: auch zu ihrem Nutzen. Nicht Masochismus also – es ist der Hunger. Die mittleren Breiten (in denen die äquatorialen Brotfrüchte nicht in den Mund wachsen) sind es, die den Menschen die vollste Entfaltung ihres kreativen Nisus abgenötigt haben. (Die Nötigung dieses Interviews erst setzt mich in jenen an sich nicht angenehmen Spannungszustand, in dem allein aber ich zu annehmbaren Formulierungen – hoffe ich – komme.) All das macht es, daß subordinierende Verhältnisse ziemlich stabil sind, während herrliche Anläufe, wie die der Albigenser oder Mazdakiten oder – ich sage es leiser, aber im gleichen Satz – Großfamilien, sich erschöpfen. Die europäischen Utopisten, die Anfang der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts im Maisland Illinois daran gingen, ihre Vorstellungen zu verwirklichen, wurden alsbald aus den Anwesen geprügelt. Weiß nicht auch der großartige Wilhelm Weitling davon ein Lied zu singen?
Das heißt übrigens nicht, daß alles Seiende, nur weil es ist, zu heiligen sei. Leibniz’ Satz von dieser Welt als der besten möglichen mußte gekontert werden. Aber Voltaires Antwort, der „Candide“, zeigt eben auch nicht, was die Welt zusammenhält. Übrigens hätte Leibniz, unter Voltaires Verhältnissen, zu Voltaires Zeit, möglicherweise anderes gesagt. (Auch zwischen dem vorhin erwähnten Rabelais, dem sein Ich zu belangarm ist, um des langen und breiten untersucht zu werden, und Montaigne, dem allein das Ich Stätte gesicherter Aussagen sein kann in unsicherster Sozietät, liegen dreißig Jahre: in die hinein allerdings die Bartholomäusnacht fällt.)
Engler: Welche Konsequenzen hat das für deine Auffassung von Literatur?
Gosse: Als erstrebenswert empfinde ich eine Literatur, die Überblick und Betroffenheit vereint. Goethe und Kleist unter einen Hut, knapp und zu burschikos gesagt. Nützlich insofern, als sie (ich zitiere näherungsweise Raabe) jetziger Zeit ermöglicht, in der Ewigkeit sich zu spiegeln. Eine nicht nur (das schillernde Wort zu gebrauchen:) geistesgegenwärtige Literatur; eine, die für sich jenes Non omnis confundar geltend macht: So ganz werde ich nicht aus den Fugen geraten. Eine Literatur der haßfreien weisen Ganzheit, der das Komische natürlich nicht nur komisch und auch das Tragische nicht nur tragisch ist. Brecht (den ich für den größten Künstler des Jahrhunderts halte, neben ihm vielleicht Schostakowitsch) und Hölderlin in ihren letzten Jahrzehnten, Bach, Tolstoj im „Hadshi Murat“ (dem verhangenen Bericht von der Niederzwingung eines widerspenstigen Bergvölkchens), auch Mandelstam geben Glanzpunkte.
Engler: Betroffenheit und Überschau…
Gosse: Nun, der Tod etwa. Er ist nicht nur eine Normalität, sondern eine Notwendigkeit. Wir wüßten nicht wo leben, lebten die vorangegangenen Generationen. Leben wäre an seinen ersten Hervorbringungen, umherwuchernden Algen oder was weiß ich, erstickt. Kein Leben ohne dessen Vergänglichkeit. Das ist gut so, es gäbe uns ja sonst nicht.
Und doch: welcher Alb.
Und das Beängstigendere: wenn die Angst nachläßt.
Engler: Das hast du früher anders gesehen, denke ich. Gerade was die Kategorie „Nutzen“ angeht.
Gosse: Die zurückliegende Wegstrecke ist, glaub ich, so markiert: Aufschwung, dann Enttäuschung, nun Sichten des Geschehens. (Hegels Vorschlag, den – wie er sagt – Avanceriesen Zeit, der unmerklich und unwiderstehlich durch dick und dünn schreitet, fest im Auge zu behalten, akzeptiere ich mittlerweile sehr.) Interessant, welche sozusagen seelischen Nippfluten das Zusammenkommen von individuellem Altern und ähnlich gelagerten sozialen Vorgängen auch in geringeren Talenten, zu denen ich gehöre, hervorgerufen haben wird.
Es ist klar, daß ich zu Anfang Petöfi. regelrecht beneidete: dessen „Nationallied“ hatte die ungarische 48er Revolution ausgelöst. Oder Majakowski, dessen Verse „Iß Ananas, friß Fasan / dein letzter Tag, Bourgeois, bricht an!“ beim Sturm des Winterpalasts auf Vieler Lippen gewesen sein soll.
Als Entwürfe für das zu errichtende Leipziger Opernhaus (die mir als unzureichend erschienen und erscheinen) unterbreitet wurden und die Bevölkerung zu Stellungnahmen aufgerufen war, nahm ich, wie ich nicht ohne mitleidige Rührung erinnere, die Sache vollkommen ernst: Ich schrieb einen um Verlockung bemühten versifizierten Aufruf, der sich an oben wie unten richtete. Für die edelste Funktion der Literatur hielt ich überhaupt die Vermittlung: die sogenannte Fürstenbelehrung einerseits, und andererseits Massenmobilisierung. Der Spalt erschien als eine kleine, eher individuellen Unzulänglichkeiten geschuldete Scharte, die Literatur und insbesondere operative Sprechdichtung leicht auswetzen konnte – mit zupackenden eingängigen Fügungen, auf einen Springpunkt hintrommelnd, ohne Changieren im Semantischen.
Allmählich bin ich mir dann wohl etwas kindlich vorgekommen, und in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre schwang das Befinden überhaupt in ein Gegenteil über. Das heißt nicht, daß sich nun völlig andere Bezüge zur Dichtung hergestellt hätten. Das Symbolistische ist mir fremd geblieben. Verlaine und selbstredend George, auch Yeats. Auch Trakl. Zu leicht folgt er seinen flüchtigen Inspirationen, die Wörter meinen von Gedicht zu Gedicht anderes und büßen so ihre Verbindlichkeit ein. Ein auf Zierlichkeit bedachter Satz wie „Silbern zerschellt an kahler Mauer ein kindlich Gerippe“ wird möglich (im Gedicht „Föhn“), zu glaubhaft verwandelt sich ihm Schmerz in purpurne Träume. Wüstestes Malmen ist silbern und purpurn übertüncht. (Wie anders der hart benennende Heym!)
Engler: Die sowjetischen Dichter: Wer von ihnen beeinflußt dich?
Gosse: Ich kann zumindest sagen, wer mich beeindruckt. Neben bekannten Namen: Sabolozki und Chodassejwitsch. Ersterer durch das – kahl gesagt – Prozessuale in seinen letzten Texten. Ein Gedicht beispielsweise, das den Abschied von den toten Freunden besiegeln will, kommt bei ihnen an. Abschied findet statt, doch vom bisherigen panegyrischen Leben. So bewußt dieses Gebilde gearbeitet sein muß – es ist von nahegehender Innigkeit. Der 1886 in Moskau geborene Chodassejwitsch, dem Akmeismus nahestehend, gibt gestochen scharfe Alltagsbilder aus den Jahren um 1920; ich hatte das Glück, einiges von Trifonow, der eine starke Hinneigung zu dem Mann empfand, vorgelesen zu bekommen. Erwähnen möchte ich noch Michail Swetlow, dem es nicht vergönnt war, die benehmende Aura seiner Freundlichkeit auch dem Werk mitzuteilen. Er war, glaube ich, das Herz der Moskauer Dichtung Ende der fünfziger Jahre. (Eine zentrierende Gestalt braucht ja selber nicht erster Größe zu sein, wie sich in der DDR-Dichtung an Maurer zeigt.) Es war ergreifend, mit welch zärtlicher Demut der schon greise Swetlow im „Klub der Enthusiasten“, den Studenten um S. Gleser 1957 gegründet hatten und in dem Ehrenburg und Hikmet unerhörte Dinge von der Rampe sprachen, erstmals Wosnessenski einer breiteren Öffentlichkeit vorstellte.
Aber noch etwas anderes, Näherliegendes. Wir neigen, glaube ich, dazu, die Leistungen der DDR-Literatur zu unterschätzen. Sicher wird man dereinst bewundernd auf das zurückschauen, was dieses kleine Gefilde in nur wenigen Jahrzehnten gezeitigt hat. Was Wunder angesichts des Stark-Stroms der Zeit, jener außerordentlichen Hoffnungen und der ebenso außerordentlichen Verzagtheiten. (Vermutlich wird es die jetzt junge Literatur schwer haben, Schritt zu halten. Ihr müssen die unerhörten Gewinne/Verluste fehlen.) Übrigens meine ich Literatur hier in ihrer ganzen Weitläufigkeit. Ohne nun gleich erregende Ökonomielektüre einzubeziehen, möchte ich doch Bloch hinzurechnen, der wieder stärker öffentlich gemacht werden sollte, und – in nicht ganz demselben Atemzug – Fraenger, durch dessen erstaunliche Analysen bildender Kunst man nebenher Gedichte neu sieht.
Engler: Deine neueren Gedichte sind manchmal von formaler Strenge, manchmal fast Prosa…
Gosse: Mich drängt es, mit der Sprache bis an jene Schwelle heran zu arbeiten, wo sie, die Mittlerin, Gefahr läuft, Zweck zu werden. Ihre Schönheiten sind verführerisch, die filigraneren etwa des Zeilensprungs (schleppen schlägt kostbar um in gebären in ich trage / aus) ebenso wie die deftigen Neubildungen der Umgangssprache. Gegen Verarmungen wie die Kleinschreibung will vorgegangen sein. (Das ist alles bedeutet mehr, wenn auch hätte stehen können Das ist Alles, worin des Alls mitschwingt.)
Strenge Gedichtformen nun ermöglichen/erfordern strenge Verdichtung, d.h. Anreicherung des Materials. Sonette etwa, zumal sie Antithetisches verschränken und durch die Terzette wie durch eine Düse pressen, gelingen entweder, sie sind dann prall wie Kiesel, oder sie taugen gar nichts.
Andererseits jedoch gibt es Inhalte, die durch bewußtes Sprechen unwahr werden. Ein gereimtes Gnadengesuch, das also die Lust am Spielen belegte, ironisierte sich. Wer mit letztendlicher Dringlichkeit um ein Beilager nachsucht, deklamiert nicht. Inständigkeit ist, im Sinne poetischen Instrumentariums formlos, ungeschlacht wie Gebirge. Ihre, formale, Notdürftigkeit kommt aus unabweislicher Nötigkeit.
Ich sehe mich also, wie auch du, in zwei Richtungen arbeiten. Und ich kann sie nicht auf einen Nenner bringen.
Engler: Ein Wort zum Übersetzen. Du weist deine Nachdichtungen mitunter als Adaptionen aus. Warum adaptierst du? Was reizt dich am Nachdichten?
Gosse: Alle Nachdichtungen, die ich gearbeitet habe, empfinde ich als unadaptiert, also originalgetreu. Freilich, was ist das? Übersetzt man ein geflügeltes Wort wie „Da liegt der Hund begraben“ wörtlich, so wird, sagen wir, ein Eskimo suchend im Gelände umherblicken. Gedichte sind, in den leichteren Fällen, geflügelte Worte. Wenn ein Nomade ein Zelt betritt, betritt er, im Unterschied zu uns, sein castle. Wie übersetzt man also bei den herrlichen alten Persern Zelt?
Hier setzt das Überlegen ein, und manches Ergebnis kann sich einstellen. Stellen sich freilich Ergebnisse ein, wie sie etwa das Puschkin-Poesiealbum streckenweise anträgt, halte ich das für bedauerlich. Im mit fliegendem Puls geschriebenen Aufruhr-Gedicht „An Tschaadajew“ heißt es (und in wildem Staccato!):
unter dem Dach der verhängnisvollen Macht vernehmen wir mit ungeduldiger Seele des Vaterlands Ruf.
Das Album bietet:
Wir stehn getreulich auf der Wacht
Des Vaterlands im Brüderbunde.
Nicht schlechthin biedere, hohle Wörter, sondern solche aus dem Vokabular der verhängnisvollen Macht! In einem anderen Gedicht daselbst, „Geliebte…“, ist religiöse Jenseitssehnsucht unterstellt. Für das beneidenswerte Los, das im Original erträumt wird, steht ein Los, wie keins hienieden.
Reizvoll am Nachdichten ist vieles. Da ist das aufklärerische Moment, darin bestehend, daß man großer Dichtung zu größerem Publikum verhilft und so beiden dient. Wichtig ist auch die materielle Sicherstellung durch diese Arbeit. Besonders verlockend die Gelegenheit, im höchst anhörenswerten Orchester der DDR-Nachdichtung mitzugeigen. Von den Jüngeren haben Endler, Mickel, Rennert oder Czechowski Glänzendes beigesteuert, Kirsch hat mit dem Buch Das Wort und seine Strahlung die gültige Fundierung geliefert. Nachteilig freilich ist der Zeitaufwand. Ich als langsamer Arbeiter halte Tage für durchaus produktiv, an denen ich 8 Verse übersetzt habe.
Nachwort
Vom Hildebrandslied über Hölderlin
bis zu Brecht und Mickel, vom Irrweg des Arno Holz bis zu den besonderen lyrischen Mitteln Nerudas und Ungarettis und Cesaires reichen die Notate Peter Gosses, die er in einer höchst eigenständigen, plastischen Sprache anzubieten weiß. Das analytische Einbringen von Weltpoesie in unser Literaturgeschehen, in der Nachfolge der Essayistik Maurers und Hermlins, ist ein besonderes Verdienst dieses Buches, in dem gleichermaßen Lesehilfen, z.B. wie man sich Gedichten nähern kann, und differenzierte dialektische Untersuchungen vertreten sind. Diese Sammlung wird ergänzt durch einige Aufsätze über Leipziger Maler, in denen uns der Autor Wege auch zu dieser Nachbarkunst lebendig und kenntnisreich eröffnet.
Mitteldeutscher Verlag, Klappentext, 1983
Laudatio auf Peter Gosse zum Heinrich-Heine-Preis
„Es ist“, schreibt Heine im Pariser Sommer 1836,
eine eigne Sache um die Schriftstellerei. Der eine hat Glück in der Ausübung derselben, der andere hat Unglück. Das schlimmste Mißgeschick trifft vielleicht meinen armen Freund Heinrich Kitzler, Magister artium zu Göttingen. Keiner dort ist so gelehrt, keiner so ideenreich, keiner so fleißig wie dieser Freund, und dennoch ist bis auf diese Stunde noch kein Buch von ihm auf der Leipziger Messe zum Vorschein gekommen. Der alte Stiefel auf der Bibliothek lächelte immer, wenn Heinrich Kitzler ihn um ein Buch bat, dessen er sehr bedürftig sei für ein Werk, welches er eben unter der Feder habe. „Es wird noch lange unter der Feder bleiben!“ murmelte dann der alte Stiefel, während er die Bücherleiter hinaufstieg. Sogar die Köchinnen lächelten, wenn sie auf der Bibliothek die Bücher abholten: „Für den Kitzler“. Der Marin galt allgemein für einen Esel, und im Grunde war er nur ein ehrlicher Mann. Keiner kannte die wahre Ursache, warum nie ein Buch von ihm herauskam, und nur durch Zufall entdeckte ich sie, als ich ihn einst um Mitternacht besuchte, um mein Licht bei ihm anzuzünden; denn er war mein Stubennachbar. Er hatte eben sein großes Werk über die Vortrefflichkeit des Christentums vollendet; aber er schien sich darob keineswegs zu freuen und betrachtete mit Wehmut sein Manuskript. „Nun wird dein Name doch endlich“, sprach ich zu ihm, „im Leipziger Meßkatalog unter den fertig gewordenen Büchern prangen!“ – „Ach nein“, seufzte er aus tiefster Brust, „auch dieses Werk werde ich ins Feuer werfen müssen, wie die vorigen…“ Und nun vertraute er mir sein schreckliches Geheimnis. Den armen Magister traf wirklich das schlimmste Mißgeschick, jedesmal wenn er ein Buch schrieb. Nachdem er nämlich für das Thema, das er beweisen wollte, alle seine Gründe entwickelt, glaubte er sich verpflichtet, die Einwürfe, die etwa ein Gegner anführen könnte, ebenfalls mitzuteilen; er ergrübelte alsdann vom entgegengesetzten Standpunkte aus die scharfsinnigsten Argumente, und indem diese unbewußt in seinem Gemüte Wurzel faßten, geschah es immer, daß, wenn das Buch fertig war, die Meinungen des armen Verfassers sich allmählich umgewandelt hatten und eine dem Buche ganz entgegengesetzte Überzeugung in seinem Geiste erwachte. Er war alsdann auch ehrlich genug (wie ein französischer Schriftsteller ebenfalls handeln würde), den Lorbeer des literarischen Ruhmes auf dem Altare der Wahrheit zu opfern, d.h. sein Manuskript ins Feuer zu werfen. Darum seufzte er aus so tiefster Brust, als er die Vortrefflichkeit des Christentums bewiesen hatte. „Da habe ich nun“, sprach er traurig, „zwanzig Körbe Kirchenväter exzerpiert; da habe ich nun ganze Nächte am Studiertische gehockt und Acta Sanctorum gelesen, während auf deiner Stube Punsch getrunken und der Landesvater gesungen wurde; da habe ich nun für theologische Novitäten, deren ich zu meinem Werke bedurfte, achtunddreißig sauer erworbene Taler an Vandenhoeck et Ruprecht bezahlt, statt mir für das Geld einen Pfeifenkopf zu kaufen; da habe ich nun gearbeitet wie ein Hund seit zwei Jahren, zwei kostbaren Lebensjahren… und alles, um mich lächerlich zu machen, um wie ein ertappter Prahler die Augen niederzuschlagen, wenn die Frau Kirchenrätin Planck mich fragt: „Wann wird Ihre Vortrefflichkeit des Christentums herauskommen?“ – „Ach! das Buch ist fertig“, fuhr der arme Mann fort, „und würde auch dem Publikum gefallen; denn ich habe den Sieg des Christentums über das Heidentum darin verherrlicht, und ich habe bewiesen, daß dadurch auch die Wahrheit und die Vernunft über Heuchelei und Wahnsinn gesiegt. Aber, ich Unglückseligster, in tiefster Brust fühle ich, daß…“
II
Wenn ich nun hier, verehrte Anwesende, und ausgerechnet an dieser Stelle Heines Sätze unterbreche, Sätze, die den zweiten Teil seiner Elementargeister eröffnen, steht mir die Barbarei jedweden Wortabschneidens groß vor Augen. Diesmal freilich in eigener Gestalt. Allein der heutige Zweck heiligt auch mir alle, gestrigen Mittel. Gilt es doch, Ihnen, lieber Peter Gosse – die intime Distanzierung in der Anredeform wirst Du mir leicht verzeihen –, einen Preis auf Leben und Tod anzusagen. Einen Preis, der in Ihren und meinen Augen wohl der schönste ist, den unsere arme und zugleich wohlständige Republik alljährlich an Dichter und Publizisten zu vergeben hat. „Schönst“ ganz im Sinne der Brechtschen Definition, die – geflügelt über Stock und Stein der Elementarlogik sich hinweghebend – das ungesteigerte Adjektiv ins Verb überführt:
Schön ist, wenn man Schwierigkeiten löst. Schön ist also ein Tun.
Unser Preis brennt – das sage ich aus Eigenem – verzehrend auf der schmalen Brust. Denn auf der Kehrseite der Silbermedaille, deren Überreichung an Sie ich mich durch das Verbreiten geistreicher Überflüssigkeiten hinauszuzögern befleißigen werde, steht unentrinnbar und platterdings ins Weltrund hineinfordernd: ICH BIN DAS SCHWERT / ICH BIN DIE FLAMME. Erster und letzter Satz des „Hymnus“ überschriebenen Textes, jenes ebenso dunklen wie lichten Credos, das unsereinen klein- oder demütig macht. Hätte ich Heine nicht soeben oben unterbrochen und ihn noch vier, fünf Sätze fortfahren lassen, wir wären auch da an Vergleichbares gelangt. „Das morsche Heidentum“, entgegnet Heine seinem Kitzlerschen Alter ego, „erbebte und krachte bei dem Worte dieser fremden Männer und Frauen, die ein neues Himmelreich ankündigten und nichts fürchteten auf der alten Erde, nicht die Tatzen der wilden Tiere, nicht den Grimm der noch wilderen Menschen, nicht das Schwert, nicht die Flamme… denn sie selber waren Schwert und Flamme, Flamme und Schwert Gottes!“ Und es macht nichts – außer: mir den Text noch bedeutsamer, weil irdischer –, daß Heine einige Sätze weiter unten freimütig bekennt:
Ich sprach diese Worte mit desto würdigerem Ausdruck, da ich an jenem Abend sehr viel Einbecker Bier zu mir genommen hatte, und meine Stimme desto volltönender erscholl.
ICH BIN DAS SCHWERT / ICH BIN DIE FLAMME. Das schmerzt und brennt in allen Nuancen. Vor allem aber im Blick auf die eigene Küche, in der es, wenn’s hochkommt, nicht schneidet, sondern zerrt und reißt; nicht kocht und brodelt, sondern glimmt und köchelt. Postrevolutionär heißen wir das. Und assoziieren im einsilbigen „post“ nicht so sehr das richtungsweisend Adverbiale, als vielmehr das Triviale unserer Erfahrungen mit der gleichnamigen Einrichtung zur Beförderung unserer Korrespondenzen: Kommst du heut nicht, kommst du morgen, oder aber übermorgen, oder überhaupt nicht mehr…
Freilich von Überhauptnichtmehr kann und will bei Heine, Ihnen und mir letzten Endes keine Rede sein. Denn das Feuer, das unser Wünschen und Denken erhellt, unser zu Buche geschlagenes Fabulieren, brennt außerhalb unsrer und, wo es uns nicht ergreift, auch ohne uns. Es ist das unstillbar sehnsüchtige Verlangen einer immer heftiger nach sich selbst und ihren schier grenzenlos, besseren Möglichkeiten entbrannten Menschheit.
Trotz SDI und alledem.
III
Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten verfügt Ihr vornehmlich dichterisches und essayistisches Werk hierzulande über Öffentlichkeit. Eine Öffentlichkeit, die – es wäre schändlich selbstvergessen, wenn ich’s gerade hier verschwiege – allerdings zu großen Teilen sich des Gedichts entwöhnt hat. Nun will ich’s mit der Publikumsschelte, wo doch hier endlich das Lob vor dem Publikum anzuheben hätte, nicht allzuweit treiben: Lassen Sie mich nur, da die Frage nach der Öffentlichkeit des Gedichts zumindest für jeden Dichter von wahrhaft existentieller, nicht bloß materieller Bedeutung ist, erneut feststellen: Daß das Gespräch über Gedichte und die Gedichtinterpretation in unseren öffentlichen Medien – der erschrockene Blick der uns unverzichtbaren Luise Köpp läßt mich den Hörfunk hier dankbar ausnehmen – keinen Platz haben, schadet nicht so sehr den Gedichten als vielmehr der Öffentlichkeit. Sie hat – ob sie es weiß und wünscht oder nicht – darauf Anspruch, angesprochen zu werden, auch in der Form des Gedichts.
Ihre Gedichte, lieber Peter Gosse, erreichten mich erstmals vor ungefähr zwanzig Jahren. Der besondere Eindruck, den sie mir damals machten und der mir, nach Wirkungsart der Spurenelemente, half, mich selbst welt- und umweltbezogener zu verstehen und auszudrücken, rührte mir her aus einer die Texte imponierend durchstrahlenden Anstrengung. Sie waren, hochfrequent und ingenieurdiplomiert, auf nichts Geringeres aus, als dem gerade eben auch in unserem Bewußtsein aufdämmernden Zeitalter der wissenschaftlich-technischen Revolution Ihr Gedicht und Ihr – wie unser aller vorindustriell schlagendes – Herz zu öffnen. Solch Offenhalten, solch Offensein erscheint mir bis auf den heutigen Tag belangvoller als der im einzelnen schlüssige oder unschlüssige Vers. Nicht, daß Sie und ich nicht wüßten, wie gerecht und rechtens Cocteau den dichterischen Schreibvorgang auf den Nenner vom „Senkblei als Mittel der Fortbewegung“ gebracht hat. Ich unterstelle Ihnen, wie ich hoffe, gleichfalls nicht zuviel, wenn ich – da nun einmal das Wort von der Fortbewegung schon im Raume steht – Ihr Weltbild als ein wohltuend aufklärerisches, als ein in all seinen Dimensionen der Aufklärung verhaftetes ausrufe.
Dies mag dem einen oder anderen wie Rufmord klingen, zu einem Zeitpunkt, wo in Ecken des hier und andernorts prosperierenden Kunstmarktes gegenwärtig einzig den zukunftleugnenden Tendenzen müder Ver- und Abklärung Zukunft attestiert wird. Verrät’s auch Kunstsinn, hat es doch Methode…
IV
Da ich nun schon, wie ich mit einigem Entsetzen bemerke, vom Amt des Laudators abgeglitten bin ins Ausrufergewerbe, will ich wenigstens versuchen, dem ganz gerecht zu werden und etwas von der Ware selbst herzugeben und vorzuzeigen. Ich beginne bei frühen Stücken, relativ gesprochen. Kredenze Happen aus dem 1968 erschienen Band Antiherbstzeitloses. Lese Ihnen mein mir liebstes Gedicht in dieser Sammlung, „Fuge Schostakowitschs“:
Die Linde teilt die Horizontgerade
und spannt fontänegleich der Erde Schwarz,
fast unsichtbar zerfeinert, daß es atme
und trinke von dem weißen Licht des Tags.
In sich symmetrisch und zur Schwester Linde,
verästelt unverwundbar leicht der Schacht
mit einer Hand, wie sie vielleicht Jorinde
besaß, das Weiß als Geiser an der Nacht.
Ich seh mich drüben an der Linde lehnen
und rauche, fühl den weißen Rauch wie Wild,
das äst, hin zu den Lungenflügeln strähnen
und lächle mir hinüber in das Bild.
Ist mir das Gedicht immer noch das liebste? Es ist. Und teilt sich ungeniert den Platz mit einem zweiten, das sich, „Steine“ überschrieben, vom Jahre 1917 aus an uns erinnert, sich unserer im dringlichen Zuruf erbarmt:
… Ich rufe dich an, Kommender, unter einem Himmel vor,
der noch ohne Tauben ist,
der farblos scheint nach wieviel Nächten ohne Schlaf,
aus dieser Straße heraus ohne Liebespaare, und im Ladenfenster keine Brote geschichtet,
rufe dich an durch die uferlosen warmen, diese Bilder der Zukunft,
die sich drängen, drängen
brülle dir zu durch den Staub an meinen Zähnen,
durch unser heiseres leises Lied von der zweiten Menschwerdung –
und das Blut außer Atem lacht den Takt bis in die Fingerspitzen! –,
ich brüll dir zu in die neuen Jahre, Kommender:
Jeden Meter Straßenpflaster, den wir vorwärts,
jeden Schritt, jede Handbreit
Pflasterstein um Pflasterstein!…
Ich habe EINE Angst:
Die Steine, die könnten Euch nichts als Steine sein.
Euch könnten sie einfach Steine sein.
Nichts sein als einfach Steine.
Einfach Steine sein.
Selten, sage ich, ist mir im Gedicht so überzeugend aufgeschimmert und aufgegangen wie hier in der letzten Strophe, die von der allein notwehrenden Notwendigkeit historischen, das heißt verlebendigenden Erinnerns spricht. Hinter dem vermeintlich Artifiziellen des mehrfachen Satzwendens atmet unüberhörbar nichts als die kreatürliche Angst eines sich wohl geschichtlich sehenden und verstehenden, nicht aber blind und dumpf auf Geschichte bauenden und vertrauenden Menschens.
Frömmelei, verehrter Gosse, ist nicht Ihre Stärke. Sie wissen zuviel. Ihr Verhältnis zur Sowjetunion, zum Tragischen und zum Komödiantischen, zum Optimistischen und zum Bedenklichen im Lauf ihrer immer wieder auch von außen bestrittenen und beschnittenen Geschichte, ist handfest und intim. Biographisch notorisch. Ich kenne keinen, freilich will das nicht viel sagen, der aus seinem Studienaufenthalt in Moskau, in Ihrem Falle mehr als fünf Jahre, soviel bittersüßen Honig gezogen hätte. Daß der Honig, dessen Heilkraft Antibiotika zu ersetzen vermag, nichts verkleistert, tritt allenthalben in Ihrem Werk zutage. Wer irgend zweifelt, lese in Ihrem 1982 erschienenen Gedichtband Ausfahrt aus Byzanz die Seiten 78 und 79 nach. Im Aufgreifen einer in Berlin 1922 erschienenen Prosa von Tarassow-Rodionow entwickeln Sie die Schokolade bis zum „Schok“: „… die Erschießung“, heißt es da nachzeichnend bei Ihnen, „werde verlautbart, die Feinde zu täuschen. In Wahrheit / riefe ihn die unaufhaltsame Revolution / dringend in ein ferneres Land“. Die sprachliche Möglichkeitsform im Futur denunziert die Unmöglichkeit momentaner Präsenz. Derlei, Sie und ich wissen es, kam und kommt vor. Wird auch noch vorkommen. Unentschuldbar. Bei dieser Feststellung müssen wir es vorerst wohl oder übel belassen. Wehe, wir fügten ihr jetzt oder später ein „unvermeidlich“ hinzu. Sie, Peter Gosse, haben diese Warnung weniger nötig als ich, mit dem die verletzte Leidenschaft häufiger durchgeht.
Aber auch Sie, meine Damen und Herren, werden mit vielleicht nachsehen, daß ich in diesem 85er Jahr, dem vierzigsten nach unserer Befreiung vom Faschismus, mich bei Peter Gosse – für mich selbst unvorhergesehen – gerade da aufhalte, wo er mir überzeugend Mitteilung macht von der Inspiration sowjetrussischen Verhaltens und sowjetischer Verhältnisse. Lassen Sie mich die höchst unvollkommene Ausstellung und Ausrufung preiswertester, preiswürdigster Gossescher Artikel mit folgendem beenden. In seinem sein hohes Handwerk beleuchtenden und hinterspiegelnden Essayband Mundwerk, Halle 1983, läßt er sich von Jürgen Engler nachworterübrigend ausfragen. Auf die Frage „Das Erlebnis SU war für dich gravierend?“ antwortet Gosse erst einmal prinzipiell. Und dann kommt sympathischerweise heraus: sein in unmittelbarer Nachbarschaft mit einem Russen, einem Polen und einem Vietnamesen erworbenes „Unverständnis fürs Nationelle“. Und eine Seite später lese ich in dichter Prosa, was ich doch schon besser weiß und kenne: aus seinem Gedichtband Ausfahrt in Byzanz, wie ich mich, mühselig ihn und mich, auseinanderhaltend, erinnere. Doch hören Sie selbst. Vielleicht geht dem einen oder anderen unter Ihnen, der die Unersetzbarkeit des Gedichts immer noch hartnäckig bezweifelt, ein Licht auf.
Prosaisch liest sich’s bei Gosse so:
Ich habe in Moskau reichliche fünf Jahre gelebt, von 1956 an: eine erstaunliche Zeit. Vom massigen Majakowski-Denkmal herunter las jeder, der wollte, eigne oder fremde Gedichte. Das ging so jeden Samstagabend, bis gegen Mitternacht (die Metro schloß da), den Herbst 1959 hindurch. Der Lesende wurde von Dutzenden Händen am für derlei nicht vorgesehenen Sockelstein hochgestemmt, es bedurfte einiger Artistik seitens des Rezitierenden. Die vielen Hände leuchteten im Licht der Neonlaternen, und man sah im Frost die Atemwölkchen über den Pelzmützen der mehrtausendköpfigen, dicht bei dicht stehenden Zuhörerschaft steigen. Ich entsinne mich, wie einer Jessenins großes Abschiedsgedicht sprach, und spontan hielt ein anderer Majakowskis große Replik dagegen…
Und nun, ihm ganz zu eigen und eigentlich, sich uns übereignend, das Gedicht „Zu Abend essen in Moskau Herbst 59“:
Als jene Samstagsnächte wer wollte
aufklomm rücklings an Majakowskis Sockelfels
(dutzende weißliche Hände hielten dess’ Knie), der Mund
ging schmallippig vor des bronzenen Bruders Kniekehle,
als, gelb von Lindenlaub, der Asphalt verschwand
unterm sanften Geschiebe der Schapkas und graublau
an Laternenstengeln der Atemdampf auftrieb und Verse
(welche er wollte) trichterlos irgendwer einsprach,
schlug ein ich die Zahnreihn mit tropischer Lust
(alle Nervwurzeln hießen Papille, jedweder Muskel
fußte im Kiefer, mein Leib war federnd gewachsen
aus der Mundhöhle aus), zerlegt ich
die Pirogge (war sie mit Hackfleisch gefüllt,
Marmelade?), ich aß (oder Brötchen?)
mir aus der Hand. Hielt die
Eßbars?
V
… Eßbares? Proviant?
Ich ahne, Peter Gosse, das Ausmaß Ihrer Enttäuschung an mir. Nichts von dem Neueren, dem, was allein – ich weiß – unsereinem noch jeweils etwas bedeutet (alles Frühere ist Flugasche und vergangener Schnee) habe ich hier in perspektivischer Verlängerung betrachtet. So, als hätte ich Ihren Essay zu H.s „Essais“ im Juni nicht gelesen, in welchem Sie das Kunststück fertigbringen, dem in seiner ihm neidlos zuzugestehenden heiteren Klassizität Logierenden ganz unklassifizierend, mitmenschlich zuzureden, nicht alles vor die Fische gehen und in ihnen aufgehen zu lassen. Ihn rührend an die Grundintention seines Werkes, die „Verteidigung der menschlichen Rasse“, zu erinnern. Eines allerdings werden Sie, wie ich hoffe, zu Ihrer Freude doch herausgehört haben, daß ich mit meinem Griff zu Heines Elementargeistern, einem Musterbeispiel für Transigenz, etlichen Intentionen Ihres im vorletzten Heft von Sinn und Form veröffentlichten Aufsatzes „Transigierender Heine“ gefolgt bin. Transigierend, ich hatte – gosselob! – Mühe, es mir, bevor ich an die aufklärende Seite kam, mit „vermischend, ausmittelnd, vermittelnd, durchtreibend“ zu übersetzen, ist wirklich kein schlechtes Wort für eine noch und immerfort zu entwickelnde, unseren Naturellen angemessene Haltung. In Ihrem Band Ortungen, 1975 erschienen, sprechen Sie bereits, den Worten ihr Unehrenhaftes abklopfend, vom „Lavieren“ und „Taktieren“ zwischen „Selbstaufgabe“ und „Selbstmord“. Mir liest sich das heute wie die prophetische Vorwegnahme jener Ratio, auf die vor kürzestem in Genf zurückgekommen wurde. Sie und ich wissen, daß dies im Rahmen unserer Endlichkeit unendlich viel ist.
Ich gratuliere Ihnen zu diesem Staatswesen, das Sie gründlich erkannt hat, wie mir die Zuerkennung des Heinrich-Heine-Preises an Sie gerade in diesem denkwürdigen Jahre beweist. Und ich gratuliere uns zu Ihnen.
Bleiben Sie gesund, halten Sie durch und aus. Schreiben Sie weiter, lehren Sie fort, transigierender, insistierender Gosse, der Sie uns sind, der Du mir bist.
Jürgen Rennert, neue deutsche literatur, Heft 399, März 1986
GRAUHIMMELTAG
für Peter Gosse
grauer tag, wolkenverhangen,
keiner jahreszeit zugehörig,
eigens ausgestattet sparsam
mit tageslicht, generös gespendet
von feldmarschall Hindenburg
als weltbaumeister von notlichtern,
unverhohlen ist an mir der tag
verstohlen vorbeigeschlichen,
ich bin ihm tunlichst ausgewichen,
wir wollten voneinander
nichts wissen, wie nicht
zu verkennen, was zu benennen
nachdrücklichst angefügt sei,
winterschlaf wieder einzuführen
wie bei siebenschläfern immer
noch usus sieben monate lang,
was abstrusus, wäre nicht
zu verachten, warum nicht gleich
einen verein gründen mit verkrachten
existenzen von über achtzig lenzen,
die dieses urtümliche gebaren
sich auf ihre fahnen schreiben,
zurück in die Buchfarter höhlen,
fehlte es nicht gar zu entschieden
an filzstiefeln samt bärenfellen hienieden
und weiteren Neandertaler quellen,
während ich schreibe, ist schon
der graue tag zur neige gegangen,
ausdauernd wolkenverhangen, verheißen wird
einem jeden sein grauhimmelquantum,
quod erat demonstrandum.
Wulf Kirsten
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Hans-Dieter Schütt: Neuwortfrech und zwirbelgierig
nd, 5.10.2023
Fakten und Vermutungen zum Autor + Kalliope
Porträtgalerie: deutsche FOTOTHEK


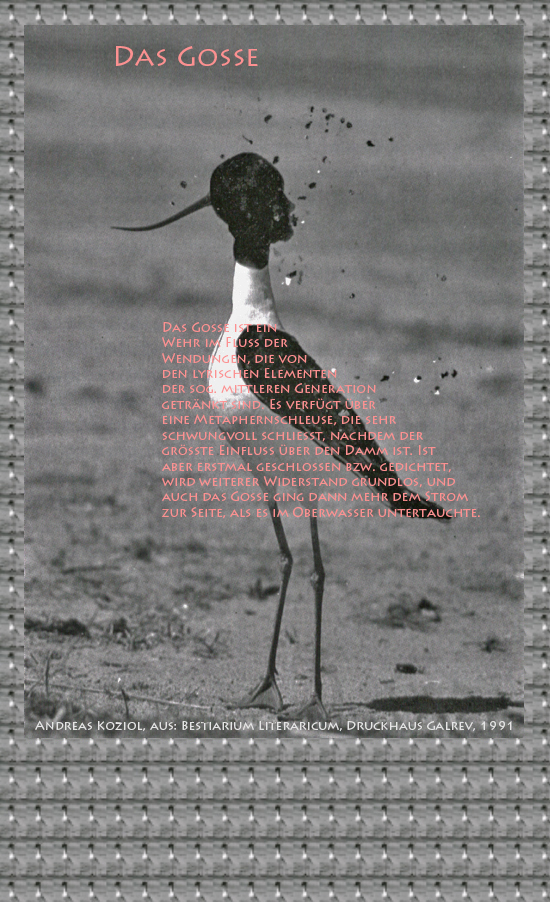
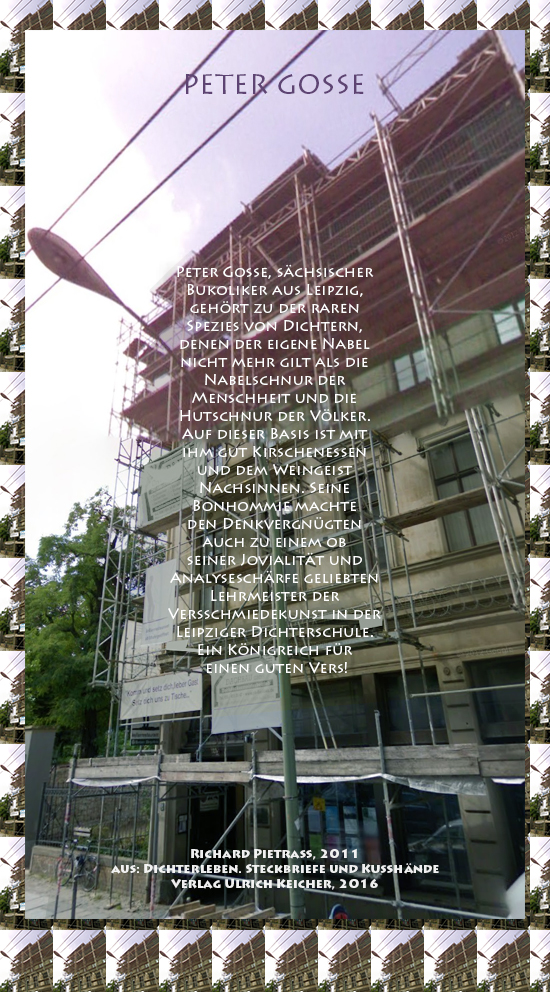












Schreibe einen Kommentar