Durs Grünbein: Falten und Fallen
ENTFERNTE INSCHRIFT
Solange ging ich mit dem Rücken an der Wand,
Daß meine Rippen schmerzten. Ein Jahrhundert
aaaaaspäter
Fand man den Abdruck im Gestein, ein
aaaaaFischgrätenmuster.
Wie andre in den Ohren Meeresrauschen, hatte ich
Landeinwärts unterm Schritt den Wellengang
Unruhiger Schläfer in der Erde, ihre tollen Späße.
Denn ich war Geisel. „In den Händen welcher Macht?“
Es war Langweile von Geburt an. „Asiens Stärke…“
Wer fragt mich, ob ich lebte. „Tot seit wann?“
Nachts lag ich lange wach, sah violette Himmel,
Gedunsen vom Gebrauch der Städte, schwarze Wasser.
Den Archäologen blieb die Stätte rätselhaft.
Zu Durs Grünbeins Gedichtband; Falten und Fallen
Durs Grünbein, 1962 geboren, hat nach Grauzone Morgens (1988) und Schädelbasislektionen (1991) im Herbst 1993 seinen dritten Gedichtband Falten und Fallen veröffentlicht, um den es in dieser Rezension geht.
1
Dass sich jeder Schriftsteller, der den Anspruch erhebt, Literatur hervorzubringen, mitten in der Geschichte der Literatur wiederfindet und sich damit, ob er nun davon weiss oder nicht, dieser Geschichte sowohl zu bemächtigen als auch zu unterwerfen hat, ist mit dem Begriff der Literatur mitgegeben. Die Qualität einer Literatur zeigt sich wesentlich darin, ob und wenn ja in welcher Weise sich in ihr jener Geschichte bemächtigt oder unterworfen wird.
Nicht nur die Geschichte ist, wie James Joyce will, ein Alptraum, aus dem wir zu erwachen suchen, sondern auch die Literaturgeschichte. Und dieses Erwachen, das ein Bewältigen bedeuten soll, kann nur in einer Literatur geschehen, die ihre eigene Geschichte so umfasst, dass sie diese auch hervorrufen könnte. Und das eben damit, dass jene Bemächtigung und jene Unterwerfung miteinander auf ein Spiel gesetzt werden, auf dem alles steht, was Literatur in einem bestimmten literaturgeschichtlichen Augenblick sein kann.
Selbstverständlich reichen die meisten jener Bemächtigungen oder Unterwerfungen nicht weit oder tief genug. Das kann für verschiedene literaturgeschichtliche Momente verschiedenes bedeuten. Ist es einmal, etwa im Zusammenhang von Aufbruchsstimmungen (wie sie sich zum Beispiel im frühen Expressionismus oder im Dadaismus zeigen), eine bedenkenlose oder gewalttätige (und insofern oberflächliche) Bemächtigung, so ist es in anderen, sagen wir restaurativen Momenten eine unbedachte und widerstandslose Unterwerfung unter bestimmte als ein für alle Male vorhanden gedachte Eigenschaften der Literatur, eine Unterwerfung, die wiederum die Züge von (allerdings unwillkürlich exorzierter) Gewalttätigkeit gegen die eigentümliche und nichtreduzierbare Qualität jenes literaturgeschichtlichen Moments enthält, in dem man sich gerade selbst befindet.
Diese Charakteristik ist idealtypisch und bezeichnet die beiden Extreme. Der Normalfall besteht in ihrer einigermassen heillosen Vermengung, in halbherzigen und inkonsequenten Explorationen in Richtung sowohl des einen als auch des anderen Extrems, deren Resultante jenes Grau in Grau malt, das nicht das der Abstraktion oder Reflexion ist, sondern das eines ubiquitären Durchschnitts, aus dem wahrscheinlich die Literatur jedes Zeitalters vor allem besteht.
*
Dass die Vorstellungen, die man von einem literaturgeschichtlichen Moment hat, in welch geringem Ausmaß auch immer, diesen Moment mitformen, macht jeden Befund über einen solchen Moment, wenn nicht selbst zweifelhaft, so doch seine sprachliche Darstellung, und das gilt um so mehr, wenn die Vorstellung sich auf den augenblicklichen Stand literaturgeschichtlicher Dinge beziehen soll. Befunde über diesen augenblicklichen Stand sind selbst Teil dieses Standes und schon insofern selbst Literatur. Sie haben damit den Wert eines Bildes, das zu dem, was es sagen will, bestenfalls in einer fruchtbaren, erhellenden, nämlich übertragbaren Beziehung steht. Wie sehr aber eine solche Übertragung einleuchtet, das hängt von Dingen ab, die eben nicht allein an der sprachlichen Darstellung jenes Befunds aufweisbar sind. Dieser Schuss vor den eigenen Bug und vielleicht auch vor den Bug des Lesers soll nicht die Verbindlichkeit des Befunds selbst in Frage stellen (denn der Anspruch auf diese Verbindlichkeit ist Voraussetzung des Unternehmens Literaturkritik), sondern auf das fragwürdige, nämlich bildhaft-rhetorische Verhältnis zwischen ihm und seiner Darstellung.
Ich befinde also: heute, in einem vielleicht vor allem restaurativen Moment, besteht eine der charakteristischen Weisen jener halbherzigen und auch heillosen Vermischung der Extreme darin, die Traditionen des jeweiligen Schreibens auf bestimmte Verfahren, bestimmte Formen des Sprachgebrauchs zu reduzieren. Diese verkürzende und vereinfachende Form, sich der Literaturgeschichte zu bemächtigen, bedeutet aber auch eine unwillkürliche Unterwerfung unter sie, eine Unterwerfung, die nahelegt, dass die Literaturgeschichte im Grossen und Ganzen abgeschlossen sei.
Ein solches Schreiben tut einerseits so, als könnte man diese Verfahren aus den ihnen eigenen, inner- und ausserliterarischen Zusammenhängen extrahieren und ohne weiteres für sich nutzbar machen. Es versucht nicht ernstlich, sich die Konsequenzen eines solchen Gebrauchs unter den eigenen (auch den eigenen literaturhistorischen) Umständen klarzumachen. Andererseits unterwirft sich ein solches Schreiben damit selbstverständlich dem Vertrauten eines bestimmten, traditionellen Begriffs des Poetischen, ohne den Wert dieses Vertrauens als Wert, den es selbst setzt, in den Blick zu bekommen.
2
In seinem Gedichtband Falten und Fallen gebraucht Durs Grünbein eine ganze Reihe traditioneller Verfahren in dem skizzierten Sinn.
Eine althergebrachtes und wohl jedermann bekanntes Verfahren (und es ist so heruntergekommen, dass man Anfänger vor ihm warnt) besteht darin, ein Wort, das etwas sinnlich Wahrnehmbares bezeichnet, mit Hilfe eines Genetivs (Genitivus explicativus) mit etwas metaphorisch gleichzusetzen, das normalerweise nichts sinnlich Wahrnehmbares bezeichnet. So ist in einem von Grünbeins Gedichten von den Masken des Wissens die Rede, das Wissen, etwas, das man nicht sinnlich wahrnehmen kann, soll eine Maske sein, also etwas, das man sehr wohl sinnlich wahrnehmen kann. In dem Gedichtband findet man auch das Hirngewölbe des Jahrhunderts, den Panzer der Sprache, das Zischeln der Polytheismen, die Inseln der Philharmonie, den Schatten des Eigenen, das Gefälle der Jahre, das Wühlen der Erinnerung, die Tiefen der Zeit; man findet einen Novizen der Melancholie, das Arkadien des Unbewussten, den Drachen der Industrie, den Glamour des Verborgnen usw., usw.
Ganz ähnlich funktionieren bei Grünbein metaphorische Formeln wie Pizza aus Stunden, Spur von Vergessen, Wald aus Begierden, Wolken von Hysterie, Flora von Allusionen, die man in Genetiv-Metaphern des skizzierten Typus verwandeln könnte, ohne ihren Sinn wesentlich zu verändern. Jene metaphorische Übertragung von sinnlich Wahrnehmbarem auf nicht sinnlich Wahrnehmbares findet sich in Grünbeins Gedichtband auch in anderen grammatikalischen Formen, besonders häufig dann, wenn von der Zeit die Rede ist: da ist etwas zeitkrank, da gibt es eine Zeit, die in die innersten Höhlen geritzt ist, da fliesst Zeit ab, da ist Zeit mit Händen zu greifen, und da ist Zeit ins Gedächtnis geätzt. Aber auch von gebunkertem Denken, von verrosteter Illusion ist die Rede, von einem Echolot ins Verborgene und davon, dass die Reduktion im Zähneknirschen steckt.
Das Gedicht, in dem die Formel Masken des Wissens vorkommt, spricht auch von zynischen Uhren: Eine Eigenschaft, die man normalerweise nur Menschen zuspricht, wird auf leblose Dinge übertragen. Auch diese poetische Technik des Anthropomorphisierens ist althergebracht und wohlbekannt, und auch für sie finden sich in Grünbeins Buch zahlreiche Beispiele: da bricht den Mauern der Schweiss aus; da ist ein Röcheln im Ausguss, da gibt es raunende Koffer, ein armes Klavier, die Umarmung der Erde oder eine Vase, die sich ausschweigt; da wird von der Sicht des Stuhlbeins geschrieben oder davon, was den Möbeln die Wette gilt; da erzählt auf dem Bügel die Hose etwas, da legen die Eingeweide ein Veto ein, da gibt es eine Tautologie, die in ihr vielfaches „wie gesagt…“ verliebt ist, ein Datum, das einen anglotzt und einen Mond, der die Erde ironisiert.
Manchmal wachsen sich die Metaphern von Grünbeins Gedichten gar ins Allegorische aus, nämlich dann, wenn es menschliche Eigenschaften oder Zustände sind, die sich selbständig machen. Da gibt es dann dein Lächeln, das mich einfing, da stieg Gewalt aus brütenden Schächten, und da kann dein Erschrecken auch die Strassenseite wechseln, womöglich damit der Schmerz wo unterkriechen kann, vielleicht dort, wo es Blicke gibt, die anhänglich wurden.
Ich halte fest: auf der Ebene begrifflicher, speziell: metaphorischer, Operationen wird in Grünbeins Gedichten eine bestimmte, althergebrachte poetische Maschinerie in Anspruch genommen.
Doch nirgends lässt sich in den Texten auch nur die Spur eines Hinweises dafür finden, dass der literaturgeschichtliche Ort dieser Maschinerie mitbedacht wird. Diese Maschinierie wird so verwendet, als hätten die letzten hundert Jahre der Geschichte der Lyrik die Möglichkeiten ihrer Funktion beziehungsweise ihren Wert nicht wesentlich verändert; so zum Beispiel, als ob man in Gedichten ohne weiteres eine fundamentale Ebene wörtlichen, nicht-übertragenen Sprechens behaupten könnte, von der sich dann eine zweite Ebene aus punktuellen Übertragungen, als sekundäre selbstverständlich unterscheiden lässt. Grünbein operiert also mit Metaphern so, dass die gewohnte Vorstellung davon, welche Ausdrücke metaphorisch gebraucht werden und welche wörtlich, überhaupt nicht angetastet wird. Und damit auf einer fundamentalen Ebene, nämlich auf der Ebene seines Sprachgebrauchs, auch nicht die gewohnte Vorstellung davon, was als Wirklichkeit vorausgesetzt werden kann. (Ich komme darauf zurück.)
Grünbein tut also so, als ob man mit ähnlicher Wirksamkeit und Überzeugungskraft wie etwa Goethe in seinem berühmten Gedicht „Willkommen und Abschied“ ohne weiteres voraussetzen könnte, dass die hundert schwarzen Augen, mit denen die Finsternis aus dem Gesträuche sah, vor dem Hintergrund der wörtlich zu verstehenden Schilderung eines Geschehens eine Metapher für irgendetwas anderes seien, in diesem Fall vielleicht dafür, dass das übervolle Herz eines Liebenden sich so anders anfühlt als die nächtliche Natur, durch die er auf dem Weg zu seiner Geliebten reitet, oder eben zugleich andererseits vielleicht doch wiederum ganz ähnlich.
Kann man aber mit ästhetischem Recht in diesem Punkt so verfahren, als ob (um mich auf die deutschsprachige Literatur zu beschränken) weder Trakl oder George, noch Arp oder Schwitters geschrieben hätten, ohne auch die avantgardistischen oder modernisten Arbeiten der letzten dreissig Jahren verarbeitet zu haben? Kann man mit ästhetischem Recht so schreiben, dass eine der Fragen lyrischen Schreibens der letzten hundert Jahre kaum eine Spur hinterlässt?
(Ich behaupte übrigens nicht, dass man Genetiv-Metaphern der zitierten Form oder Metaphern, die Dinge, die nicht wahrnehmbar sind, anschaulich machen sollen, und dass man anthropomorphisierende Vergleiche oder Allegorien überhaupt nicht gebrauchen kann. Ich behaupte nur: so wie sie Grünbein in diesem Gedichtband gebraucht, sollte man sie nicht gebrauchen. Gerade die Tatsache, dass etwa die Genetiv-Metapher ein so klischeehaftes poetisches Mittel ist, könnte als Herausforderung dazu verstanden werden, ihren Gebrauch dennoch ästhetisch überzeugend zu machen, ihren Gebrauch zu bewältigen. Dass und wie das möglich ist, zeigen zum Beispiel Dieter Roths Gedichte.)
3
Ein Schriftsteller, der die Extreme seiner Bemächtigung der Literaturgeschichte und der Unterwerfung unter sie in einer Weise vermischt, die vor allem das Reden jener Geister verstärkt, die heute besonders vernehmlich in der Luft liegen und für eine bezeichnende Atmosphäre sorgen, der ist nicht nur dazu verurteilt, bestimmte althergebrachte Traditionen der jeweiligen literarischen Gattung, auf bestimmte Verfahren oder Formen des Sprachgebrauchs zu reduzieren und damit das Vertraute eines bestimmten Begriffs des Poetischen blindlings in Anspruch zu nehmen. Sondern ein solcher Schriftsteller hat auch, wie er, allen restaurativen Tendenzen zum Trotz, oft zu hören bekommt oder zu verstehen gibt, auf der Höhe der Zeit zu sein. Wenn er auch vielleicht nicht gerade Traditionen zu stiften hat, so haben sich in seiner Literatur doch auch diejenigen Verfahren zu zeigen, die erst seit vergleichsweise kurzer Zeit existieren, die in diesem Sinn des Wortes modern oder zeitgenössisch sind.
Da Grünbein nun seine traditionelle, rhetorische Maschinerie nicht hinreichend als solche begreifen kann und also auch ihren Wert beziehungsweise ihre Wirkung nicht nüchtern einzuschätzen vermag, da ihm die Möglichkeit so fern liegt, sie als Zeichen des Vergangenen oder als Zeichen eines zum Trivialen Heruntergekommenen, jedenfalls also im Zeichen ihrer Distanz zu verstehen, kann er sie auch nicht anderen, sagen wir, modernen oder zeitgenössischen Maschinerien wirksam entgegengesetzen, kann er den Kampf zwischen verschiedenen, womöglich widerstrebenden Kräften oder Tendenzen, nicht aufnehmen. Und also bleibt ihm vielleicht tatsächlich nichts anderes übrig, als jene traditionelle, rhetorische Maschinerie zu tarnen oder zu verstecken.
In Grünbeins Gedichten besteht ein wesentliches Moment dieses Tarnens oder Versteckens darin, dass viele von ihnen mit Wörtern versetzt sind, die zeitgenössische Alltäglichkeit konnotieren lassen: Kofferraum, der Lackglanz von Kühlerhauben, Schweinwerferlicht, Elektronik, Abgaß, Sauna, Baggerseen, Rostige Rohre, Bulldozer, Abfangjäger usw., usw. Das ein oder andere Mal geht Grünbein noch einen Schritt weiter, um seine Gedichte ihrer Zeitgenossenschaft zu versichern. Er gebraucht dann Wörter, die nicht nur tatsächlich auf die letzten Jahre oder Jahrfünfte datierbar sind, sondern auch aus der Umgangssprache stammen, aus subkulturellen Jargons oder der Sprache der Medien: Dauer-High, Quickie, Zoff, the bungee jump, CDs, Psychokomfort usw.
So verbinden sich die Metapher, die als Pars pro toto für jene vertraute poetische Maschinerie steht, und als solche nicht angetastet wird, weil der übliche Sprachgebrauch für die Wirklichkeit selbst steht, und die sogenannte moderne Lebenswelt – in der Literatur kann das nur heissen: eine bestimmte Kulisse – zu Sätzen, die nur noch des Reimes bedürften, um aus einem Schlager stammen zu können:
Und immer das Warten auf den Transport
Zwischen den Orten, wo Ankunft
Portal ist im Regen, ein weisser Flugplatz
Der sofort Abschied meint (…)
Ankunft ist ein Portal im Regen und der weisse Flugplatz meint Abschied. Oder, noch näher zu allzu bekannter Schlager- oder Chanson-Sentimentalität, das schon zitierte: Der Mond ironisiert schweigend die Erde, ein gelber Clown… (Und wäre das nicht tatsächlich das brauchbare Element einer Definition von Schlagertexten: traditionelle poetische Verfahren werden aus ihrer Geschichte beziehungsweise ihrem Kontext extrahiert und in den Kulissen zeitgenössischer Lebenswelt verborgen, die für die Wirklichkeit selbst genommen werden?)
Genauso unreflektiert wie sich Grünbein auf das Gefühl der Vertrautheit verlässt, das durch jene traditionelle poetische Maschinerie hervorgerufen wird, verlässt er sich nicht nur darauf, dass die Wörter, die er dazu benützt, um das, was er als zeitgenössische Realität voraussetzt, zu bezeichnen, Zeitgenossenschaft oder Modernität garantieren, sondern auch darauf, dass diese Wörter tatsächlich jene vorausgesetzte Realität so, wie sie angeblich ist, erfahren lassen. Und dieser Mangel an Reflexion, dieses blinde Vertrauen ist ja auch nur konsequent: Der Glaube an die Möglichkeit einer selbstverständlichen Unterscheidung zwischen wörtlicher und übertragener Rede zieht den Glauben an die Möglichkeit nach sich, dass die nach allgtäglichem Masstab wörtliche Rede über zeitgenössische Realität oder Wirklichkeit, diese tatsächlich erfahren lässt. So als ob die Tatsache, dass die Sprache literarisch gebraucht wird, schon von selbst garantieren könnte, dass das, was in diesen Gedichten gesagt wird, in ihnen auch getan wird. Wenn an dem Aphorismus etwas Wahres ist, dass nicht nur die Geschichte ein Alptraum ist, aus dem wir zu erwachen suchen, sondern auch die Literaturgeschichte, dann ist die selbstverständliche Unterscheidung zwischen wörtlicher und übertragener Rede im Zusammenhang mit dem Glauben daran, die Tatsache, dass Sprache beansprucht, literarisch gebraucht zu werden, enthalte schon, dass das wörtlich Benannte auch erfahren wird, die beste Garantie dafür, dass man sein Erwachen hier nur träumen kann, dass dieses Erwachen nur die Fortsetzung des (Alp)Träumens ist.
4
Doch auch Grünbein weiss, dass, was er als zeitgenössische Alltäglichkeit voraussetzt und in ihrer Begrifflichkeit nicht zu reflektieren vermag, dazu führen könnte, die Texte, in denen diese Alltäglichkeit als Garant für Modernität oder Zeitgenossenschaft evoziert wird, selbst für alltäglich zu halten: für flach, für vordergründig-realistisch oder oberflächlich-deskriptiv. Und da ihm sowohl sein Gebrauch von Elementen einer traditionellen poetischen Maschinerie unterläuft als auch (und im Zusammenhang damit) sein Begriff von Realität, da er beides nicht hinreichend zu durchdringen versteht, ist er wiederum dazu verurteilt, die Auseinandersetzung mit anderen, widerstrebenden Kräften nicht ernstlich aufnehmen zu können. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als dem anscheinend Flachen und vordergründig Realistischen durch einen anderen Aspekt seines Rückgriffs auf traditionelle poetische Verfahren den Anschein von Tiefe und Bedeutsamkeit zu verleihen.
Dieser Aspekt von Grünbeins unreflektiertem Traditionalismus besteht darin, dass er eine überkommene, aber vor allem auch übernommene Gestik bzw. Satzrhetorik beansprucht, eine Gestik oder Satz-Rhetorik, in der er bestimmte vergangene Epochen oder auch Schriftsteller anklingen lässt, eine Gestik oder Satz- Rhetorik, die jene Realien von einem Strom des weihevoll Stilisierten getragen erscheinen lässt:
Sieh, wie oft du zurückzuckst, gespiegelt
Im Lackglanz von Kühlerhauben,
In metallischen Sonnenbrillen, dir selbst
Widerfahrend in einer Drehtür, (…)
Diese Form der Anrede, mit der eine Reihe seiner Gedichte beginnt, hat etwas Feierliches, Zeremonielles und Distanzierendes, aber zugleich ist sie dennoch eine intime Form der Anrede. Sie ist monologisch, eine Form der Selbst-Anrede, eine Zwiesprache mit sich selbst, und auch einigermassen pathetisch inszenierte Selbstvergewisserung. Bei Grünbein scheint sie, auch dazu dienen zu sollen, bestimmte Erinnerungen zu vergegenwärtigen:
Mannsdicke Rohre, in die du als Kind Dich
Im Versteckspiel verkrochst.
Eine ähnliche Rolle spielt in Grünbeins Gedichten auch die rhetorische Frage, die häufig am Anfang seiner Gedichte steht und ähnlich zeremoniell und feierlich ist wie jene Du-Anrede:
Wer hätte gedacht, dass es so einfach ist, schliesslich?
− Oder:
Wussten wir, was den Reigen in Gang hält?
Während die rhetorischen Auftaktfragen als romantisches, subjektiviertes Echo jener in barocken Gedichten erscheinen mögen (Was ist die Lust der Welt? – Hofmann von Hofmannswaldau), lässt eine Aufforderung wie „Sieh, wie oft du zurückzuckst“, gespiegelt überhaupt die halbe Literaturgeschichte anklingen, bis in die jüngere Vergangenheit herauf, bis zu Georges berühmtem Gedichtanfang „Komm in den totgesagten Park und schau“, und noch weiter herauf, bis zu bestimmten Tonfällen der Dichtung der fünfziger Jahre, insbesondere jenen in Gedichten Ingeborg Bachmanns oder Gottfried Benns. (Dessen Einfluss ist noch in manchen anderen Hinsichten fühlbar. Ich komme darauf zurück.) Am deutlichsten erinnert die Satz-Gestik vieler Gedichte Grünbeins aber an den Ton von Rilkes Duineser Elegien (der sich ja seinerseits schon in vielerlei Beziehung Hölderlins Elegien und Hymnen verdankt), etwa an Rilkes
Ja, die Frühlinge brauchten dich wohl. Es muteten manche Sterne dir zu, dass du sie spürtest (…)
Eine ganze Reihe seiner Gedichte wirken geradezu wie ein Palimpsest des Rilkeschen Hymnen- oder Prophetentons. Es ist aber – und das ist der entscheidende Punkt – eine subkutane, unausgetragene Feierlichkeit, gleichsam ein untergründiger Sound, der vergeblich versucht, die Trivialität des Deskriptiven, aber auch der eingestreuten Reflexionen oder Philosopheme zu konterkarieren. So auch in dem Gedicht „Falten und Fallen“, das dem Band den Titel gibt:
Leute mit besseren Nerven als jedes Tier, flüchtiger, unbewusster
Waren sie’s endlich gewohnt, den Tag zu erlegen. Die Pizza
Aus Stunden aßen sie häppchenweise, meist kühl, und nebenbei
Hörten sie plappernd CDs oder fönten das Meerschwein,
Schrieben noch Briefe und gingen am Bildschirm auf Virusjagd.
(…)
Manchmal wirkt die unvermittelte Kollision des Hymnisch-Prophetischen, des Pontifikalen (Brecht) mit dem Trivialen und dem zeitgenössisch-Alltäglichen geradezu unfreiwillig komisch, etwa in dieser Prophetie der Empfindung von Hitze und Schweissfluss als Wirkung schneller oder panischer Bewegung:
Auch der kälteste Raum wird zur Sauna,
Solange du irrläufst (…)
Oder auch in dieser Passage, in der nicht nur die Duineser Elegien zu hören sind, sondern die, in ihrem Häufen von Nomina, zugleich auch eine Mimikry von Bennschen Manierismen darstellt:
Stumpf, wie der Blick durch mehrere Autofenster in Richtung
Stau, reibt sich im Unbewussten Gemurmel, der tägliche
Durchschnitt an Panik, Erleuchtung und Apropos… Egos eigenstes UKW.
In hymnischem und prophetischem Ton über Bulldozer oder Autoreifen oder über mannsdicke Rohre zu sprechen, über Staus und UKW, das könnte parodistischen Wert annehmen. Aber bei Grünbein wird das unwillkürlich zu einer Art Verschleierungsmanöver, das die Aura von Bedeutsamkeit hervorzurufen soll. Und sein von manchen Rezensenten so hochgelobtes Talent besteht vor allem darin, um jener Aura willen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, Geschicklichkeit und Geschmeidigkeit Tonfälle, Gesten, lyrische Sprechweisen nachzuahmen, und sie, um im Jargon seiner Gedichte zu sprechen, zu mixen.
Sowohl zu diesem gestohlenen oder geliehenen Pathos, dieser aufgesetzten Feierlichkeit als auch zu Grünbeins traditionellem Begriff des Metaphorischen passen auf lexikalischen Ebene die häufigen Bezeugungen humanistischer Bildung oder Gelehrsamkeit: Da gibt es jede Menge von Mythologemen wie Orpheus, die Parzen, den Sänger von Theben, die stygische Spülung und, unter dem beziehungsvollen Titel „Nach den Fragmenten“, Lesbias Käfig und Aphrodites Geleitzug. Natürlich dürfen auch weder Odysseus noch Sisyphos fehlen.
Und da gibt es auch lateinische Gedichttitel wie „Homo sapiens correctus“ oder „Damnatio memoriae“ oder „In utero“; da werden Philosophennamen genannt wie Aristoteles, Descartes, der Hedonist Hegesias, der Sophist Claudius Aelianus, da wird von Pythagoras’ Schweigen oder von Zenons Pfeil gesprochen, und schon das Motto des Buchs ist ein Satz Wittgensteins aus Über Gewissheit und das Motto eines Gedichts ein Satz Immanuel Kants. Dazu kommt noch eine Reihe von mehr oder weniger gut versteckten Zitaten oder auch von Anspielungen auf Bildungstopoi, aber auch von Fremdwörtern und Einsprengseln in fremden Sprachen (englisch, italienisch, französisch). (Auch das ist ja schon bei Benn ein manchmal aufdringliches Zeichen angeblicher Weltläufigkeit.) All das verdankt sich Grünbeins Bemühen, der in Anspruch genommenen Alltäglichkeit den Anschein der ganzen Tiefe des abendländischen Bildungsraums zu geben. Es ist wohl eine Art Ulysses– oder Waste-Land-Effekt, den Grünbein zu erzeugen sucht. Doch abgesehen davon, dass humanistische Bildung vor achtzig Jahren etwas ganz anderes war, als sie heute ist (nämlich ein viel selbstverständlicheres Mittel), haben diese Topoi in seinen Texten, anders als in den Werken von Joyce und Eliot, keinerlei nachvollziehbare strukturierende Funktion.
So bezeichnen sie nur die in diesem Fall ästhetisch scheiternden Versuche, abendländische Tradition oder Geschichte im Zeitgenössischen zu finden oder herzustellen. So wie Grünbein über dies Topoi verfügt, sind sie vor allem Dekoration oder Ornament, und, natürlich, ein wenig auch Angeberei oder Einschüchterungsmittel.
5
Auf der einen Seite das In-Anspruch-Nehmen einer bestimmten traditionellen poetischen Maschinerie, sowohl, was den Begriff und den Gebrauch metaphorischer Operationen, als auch, was bestimmte Momente der Satzrhetorik oder der Satz-Gestik angeht, und dazu der massive Einsatz humanistischer Bildungstopoi. Stünde auf der anderen Seite nur das vertraute Lexikon des modernen Alltags, dann würde das nicht ausreichen, um den Anschein eines Gleichgewichts zwischen dem Gegenwärtigen oder Modernen und dem Überbrachten oder Traditionellen herzustellen. Also gibt es bei bei Grünbein noch einige andere, wenn nicht ausschliesslich zeitgenössische, so doch vorgeblich moderne Gegengewichte. Auf lexikalischer Ebene das auffälligste: der geradezu exzessive Gebrauch von Termini, die aus wissenschaftlichen Fachsprachen stammen, insbesonders aus den Sprachen der Biologie und der Medizin bzw. der Physiologie, dazu kommen vor allem noch Termini aus den Computer- und Kommunikationswissenschaften. Und also wimmelt es in seinen Gedichten von Wörtern wie Hormone, Serotonin, Hygiene, Brownsche Bewegung, Elektroden, Formaldehyd, Stetoskop, Magnetfeld, Biotop, Liquor, Teleskop, Nebelkammern, Diagramm, Silicium, Skinner-Box, EEG, IQ, Aphasie, Endlosschleifen usw., usw. Der Gebrauch wissenschaftlicher Termini in Gedichten ist spätestens seit dem frühen Benn, ein angeblich bewährtes Verfahren, das Poetische vom altmodischen Kopf auf moderne Füsse zu stellen. Eine Wirkung dieses Verfahrens soll darin bestehen, eine ironische, kühle Haltung zu bezeugen; die Haltung des Desillusionierten, der sich die sprachlichen Elemente einer Naturwissenschaft vorsagt, um sich oder anderen einerseits den Idealismus auszutreiben und andererseits (als einen Angelpunkt dieses Idealismus) das Subjekt. Es ist eine Haltung, die (was den deutschen Sprachraum betrifft) vielleicht in Heines ironischer Auseinandersetzung mit der Romantik präformiert ist, ja überhaupt in der nachromantischen Reaktion auf die Romantik; eine Haltung, die sich dann in all die Ernüchterungs- und Desillusionierungsräusche (wie man paradoxerweise sagen kann) der Moderne weiterentwicklt hat, und so gegensätzliche Formen wie naturalistische und dadaistische angenommen hat. Es ist eine Haltung, die ihre Spuren in vielen bedeutenden Dichtungen dieses Jahrhunderts hinterlassen hat, ob nun etwa in dem schonungslosen Verismus der Werke Arno Schmidts, der analytischen Vivisektion des Schöngeistigen bei Robert Musil oder aber etwa in den Versuchen, die Sprache dabei zu ertappen, wie sie aus dem, was ein Tropfen Sprachlehre sein könnte, Wolken aus Metaphysik macht, also in den Werken einer sprach- bzw. metaphysikkritschen Tradition, wie sie sich etwa in den Texten der Dichter der Wiener Gruppe zeigt. Es ist eine Haltung, die wahrscheinlich den grössten Teil der zeitgenössischen Literatur wesentlich mitbestimmt, die sogar eine womöglich allzu selbstverständliche ästhetische Grundlage vieler zeitgenössischer Werke darstellt, wie sich in dem häufig unreflektierten Ressentiment gegen das Pathetische, das Erhabene und das Sublime zeigt.
Auch Grünbeins Gedichte haben an jener Haltung Teil, auch sie sind Ausdruck einer (natürlich an und für sich legitimen) speculation á la baisse, wie Musil sie nennt. Die falsche Selbstverständlichkeit dieser Spekulation in Grünbeins Gedichten zeigt sich darin, dass sie im Widerspruch zu anderern ihrer Züge steht (etwa zu ihrer subkutanen Feierlichkeit), diese Widersprüchlichkeit aber nicht als solche erkannt wird und deshalb nicht ausgetragen. Es ist eine speculation á la baisse, die bei Grünbein den paradoxen Pferdefuss hat, von einem sehr hohen und unbehelligten Ross aus ausgesprochen zu werden, tatsächlich von einer Art Pegasus aus, von einem unbehelligten, Souveränität beanspruchenden Subjekt, dessen Vivisezieren, Desillusionieren viel weniger gezeigt als behauptet wird, viel mehr Attitüde als Methode ist, und insofern selbst etwas Rauschhaftes hat und vielleicht für manche auch deshalb hypnotische Wirkung. (Ich komme darauf zurück.)
Grünbein jedenfalls scheint dem Gebrauch wissenschaftlicher Termini in Gedichten noch immer ohne weiteres die Funktion zuzutrauen, die Wirkung des Zeitgenössischen oder Modernen hervorzurufen und vielleicht des skandalös Anti-Poetischen, Prosaischen oder Ernüchternden. Und so heisst eines seiner Gedichte „Im Museum der Mißbildungen“, und dieses Gedicht ist tatsächlich eine Beschreibung, wie es im Gedicht selbst heisst, im Licht der Medizin, eine Aufzählung von Monströsitäten:
Aus einem Kasten schielt ein Zwilling, siamesisch,
Daneben ein verwachsenes Lämmerpaar, ganz Agnus Dei.
Um einen marinierten Stierkopf samt Tumor im Glas
Spinnweben, eine tote Spinne und auf Vorrat Fliegen (…)
Unversehens ist die Poesie des Anti-Poetischen in unverhüllte Stoffhuberei umgeschlagen, in das im Zusammenhang von Dichtung nicht gerechtfertigte, naive Vertrauen auf starke, in diesem Fall wahrscheinlich starken Abscheu erweckende Reize, auf die angeblich direkte Wiedergabe des Schrecklichen oder Entsetzlichen, die nur mit einigen Metaphern ausstaffiert wird und durch eine Art Reflexion in Form einer halb pathetischen, halb ironischen Frage eingerahmt – Aber ein Mensch ohne Großhirn, wo führt das hin? −, einer Frage, mit der das Gedicht beginnt und mit der es auch endet. Das ist so, wie wenn jemand in einen Fleischerladen, ein Leichenschauhaus oder eben in ein Monströsitätenkabinett blickt und sich sagt: Wie poetisch das ist, gerade insofern als es eine Art Negation jeglicher Poesie ist, und sich dann beeilt, diese Dinge zu beschreiben, so als ob die Beschreibung solcher Dinge nicht schon dadurch, dass sie Beschreibung zu sein beansprucht, alle diese Dinge und die Verhältnisse zu ihnen grundlegend verändern würde. Und diese Haltung ist auch nichts anderes als die unverstandene Kehrseite einer historischen Vorstellung des Poetischen, nämlich jener von ausserordentlichen, besonders poetischen Gegenständen, deren als vorgegeben unterstellte Schönheit garantieren soll, dass auch ihre Darstellung in einem Kunstwerk schön ist. So scheint sich gerade dieses Gedicht Grünbeins einer Art Umkehrung jenes Verfahrens zu verdanken, das Edgar Allen Poe in seinem berühmten Aufsatz „Philosophy of Composition“ entwickelt. Wenn Poe schreibt: „Welcher ist unter allen melancholischen Gegenständen nach dem allgemeinen menschlichen Verständnis der melancholischste?“, und sich antwortet: der Tod, und sich dann fragt: „Und wann ist dieser melancholischste Gegenstand am dichterischsten?“, und sich darauf antwortet: „Wenn er sich aufs Innigste mit der Schönheit verbindet“, dann sagt sich auch Grünbein (aber ich fürchte, ohne die Poesche Ironie), dass der Tod unter allen melancholischen Gegenständen der melancholischste ist, aber auf die Frage, wann dieser melancholischste Gegenstand am dichterischsten sei, scheint er sich eine andere Antwort zu geben, nämlich: wenn er sich aufs innigste mit dem nach allgemein menschlichen Verständnis Abstossendsten verbindet. Und also schliesst er messerscharf darauf, dass nicht, wie bei Poe, der Tod einer schönen Frau der dichterischste Gegenstand sei, sondern eben das Museum menschlicher Mißbildungen. (Und etwas von dieser simplen Umkehrung eines alten und allzu simplen Rezepts durchweht eine Reihe von Grünbeins Gedichten.) Zugleich und im Zusammenhang mit diesem Desillusionismus und dieser Stoffhuberei hat Grünbeins Einsatz wissenschaftlicher Termini noch einen anderen Aspekt. Sie sollen bezeugen, dass man die Dinge, so wie sie sind, scharf und unbestechlich beobachtet und diese Beobachtungen genau und nüchtern wiedergibt. Diese Termini sollen Präzision suggerieren (das kann allerdings nur gelingen, wenn man einen allzu äusserlichen Begriff davon hat, was Präzision in der Wissenschaft tatsächlich bedeutet), genaues und sachliches Umgehen mit den seelischen oder körperlichen Erscheinungen, mit dem für Grünbein offenbar selbstverständlichen Resultat ihrer Reduktion auf das Mechanische oder Maschinenhafte.
Und es ist sehr bezeichnend für die künstlerische Schwäche von Grünbeins Gedichten, dass diese Vorstellung des Maschinenhaften sich nirgends in der Art und Weise zeigt, wie gedichtet wird, dass diese Vorstellung nirgends in der oder durch die Sprache der Dichtung selbst heraufbeschworen wird, sondern dass es einzig und allein der Jargon bestimmter Elemente der Beschreibung von Maschinenhaftem ist, der in diese Gedichte eindringt, während sie selbst so geschrieben sind, als läge es ganz fern, die Idee des Maschinenhaften auf die Sprache und auf die Dichtung selbst zu übertragen. Das Arbeiten der Sprache selbst, zum Beispiel das Arbeiten der metaphorisch-begrifflichen Maschinerie, die Grünbein so selbstverständlich in Anspruch nimmt, das diesbezüglich determinierte Produzieren von Sinn liegt ausserhalb des Blickfelds, welches die Gedichte Grünbeins zeigen.
So also bleibt die Idee des Maschinenhaften bei Grünbein ganz äusserlich, ja dekorativ. Durch die folgenlose Weise, in der das Maschinenartige als Thema oder als Stoff vorkommt, nimmt er dieser Idee allen Ernst und jegliche Überzeugungskraft. Ob man sich selbst oder andere oder die ganze Welt mit einer Blume, einem Engel oder mit einer Maschine vergleicht, das macht doch in einem Gedicht keinen wesentlichen Unterschied, solange nicht jeder dieser Vergleiche auch Folgen für die nicht-referentiellen Aspekte der Sprache hat, also für den Klang und das Schriftliche, aber auch für die Grammatik und die Behandlung des Bereichs der Bedeutungen!
*
Die traditionelle Metaphorik, die den selbstverständlich vorausgesetzten Unterschied zwischen eigentlicher und übertragener Bedeutung nicht anzweifelt, der feierlich-hymnische Duktus und das wissenschaftliche Vokabular als angebliches Instrument angeblicher Genauigkeit und Nüchternheit führen dann zwangsläufig zu einer grauenvollen und für Grünbeins Gedichte so bezeichnenden Mischung aus Allegorisierung und Neurologisierung:
Wach unterm Sprechzwang rekelt sich Aphasie. (…)
Da Grünbeins Anleihen an die Sprache der Wissenschaft nicht von seinem Bemühen zu trennen ist, up to date zu sein, kann oder will er auch nicht auf populärwissenschaftliche Modebegriffe wie Fraktal oder Code verzichten. Und also kommen in seinen Gedichten auch solche Blüten eines szientistischen Lyrismus zustande:
Jeder Tag brachte, am Abend berechnet, ein anderes Diagramm fraktaler Gelassenheit. (…)
Oder es kommt, wiederum in deutlichem Anklang an Rilke, zu dieser Formel:
Totcodiert der enorme Raum. (…)
In solchen Formeln packt, kann man Walter Benjamin paraphrasierend sagen, nicht die Ewigkeit die Mode beim Genick, sondern vor allem die Mode die Mode. (Ja, auch alle Mode will Ewigkeit.)
Nimmt man nun die Ingredienzien Feierlichkeit, lexikalische Bezeugung humanistischer Bildung und die naturwissenschaftlichen Termini zusammen, dann entsteht daraus eine Mixtur, die auch für den späteren, nach-expressionistischen Benn charakteristisch ist (und auch schon bei Benn zu zweifelhaften lyrischen Blüten geführt hat, etwa zu den Blutgerinnsel des zwanzigsten Jahrhunderts, Grünbein spricht einmal vom alten Hirngewölbe des Jahrhunderts). So heisst es denn auch bei Grünbein, in sehr an Benn erinnernder assonierender und alliterierender Häufung von Nomina:
…Rosen…Kondome…Sappho…Serotonin. (…)
Und in dieser Aufzählung zeigt sich noch ein anderes Moment von Grünbeins Gebrauch moderner Verfahren (eines modernen Rezepts): Es ist jenes des assoziativen Aufzählens. Dinge, die nach alltäglichen Begriffen keine oder wenig Verbindung miteinander haben, werden nebeneinander gesetzt, und häufig wird die Verschiedenartigkeit der nebeneinandergesetzten Dinge durch das Assonieren oder Alliterieren der Wörter zugedeckt, sozusagen unter eine Decke gesteckt:
Cattleya, Cannabis, Clit…mit den Wurzeln nach oben
Saugt ein Wort (…)
– Oder, ohne jene auffälligen klanglichen Ähnlichkeiten:
Es regierte die Dürre, ein Prozess aus gekreuzten Rassen,
Elektronik und der Diät einer Tautologie, verliebt in ihr
vielfaches „Wie gesagt…“ (…)
Dieses Rezept ist nicht zufällig mittlerweile das allervertrauteste und allergewöhnlichste. Was vor hundert Jahren, vor Surrealismus, Dadaismus, experimenteller Literatur eine womöglich erkenntnistiftende Überraschung war – alle die Lautréamontschen Kollisionen von Nähmaschinen und Regenschirmen auf Operationstischen – das ist inzwischen zu einer poetischen Lizenz geworden, die beinahe jedermann und beinahe gedanken- und widerstandslos für sich beansprucht. Eine Lizenz, die natürlich das ideale Mittel ist, um den Verdacht zu zerstreuen, dass es an notwendigen Verbindungen zwischen den Elementen eines literarischen Texts mangelt. Ob als angebliche Wiedergabe inneren Monologisierens, ob als Inventar, als Registration von Dingen oder Ideen, oder als Montage vorgefundener, gegeneinander gestellter Zitate: die Assimilation dieses Prinzips bereitet zumeist (und auch in Grünbeins Gedichten) keine fruchtbaren Schwierigkeiten mehr.
Um es fruchtbar gebrauchen zu können, müsste die Geschichte dieses Prinzips präsent sein, seine inneren Widersprüchlichkeiten und seine Konsequenzen verarbeitet. Im Zusammenhang von Grünbeins Gedichten jedenfalls haben Konstellationen wie von Nähmaschinen und Regenschirmen auf Operationstischen in etwa die Wirkung eines geschickten Schaufensterarrangements, in dem diejenigen, die die Geschichte einer Kunst tatsächlich verarbeitet haben, die späte Anwendung einstmals revolutionärer Konfrontationen erkennen können, während die anderen glauben, etwas Neues und Kühnes und zugleich Hübsches oder sogar Schickes geniessen zu dürfen.
Die derjenigen des Assoziativen ähnliche Verwandlung eines modernistischen Stilmittels ins, wenn nicht Dekorative, so doch ins Unverbindliche zeigt auch Grünbeins Umgang sowohl mit dem, was in der Verslehre freier Rhythmus genannt wird, als auch (und im Zusammenhang damit) mit der Zeile als rhythmisch-metrischer Einheit.
Während manche der vergleichsweise kurzzeiligen Gedichte, wie diejenigen, die unter dem Titel „Variation auf kein Thema“ gesammelt sind, tatsächlich noch so etwas wie einen rhythmisch- metrisch fühlbare Ordnung zeigen, die durch das Wechselspiel zwischen Enjambement und der Übereinstimmung zwischen Satz- und Zeilenende so etwas wie rhythmisch variantenreiche Eleganz verwirklichen (deren Wert allerdings wiederum vor allem dekorativ ist), so wird in vielen längeren Gedichten Grünbeins (manche ziehen sich über mehrere Seiten) dieses Mittel zu einer nicht nur funktionslosen, sondern auch wirkungslosen und also leeren Konvention. Wie in so vielen zeitgenössischen Gedichten, die nicht darauf schliessen lassen, dass ihre Verfasser begreifen, dass die Freiheit vom Metrum und damit von dem Fall und der Anzahl von Silben pro Zeile aus einer bestimmten Notwendigkeit zu stammen hat, die womöglich Kompensation durch andere Ordnungsschemata verlangt, ist da überhaupt nicht mehr einzusehen, warum die Zeilen gebrochen werden und noch viel weniger, warum sie dort gebrochen werden, wo sie gebrochen werden. Auch Grünbein gibt der Verführung zur Formlosigkeit, von der Brecht in diesem Zusammenhang spricht, ohne nennenswerten Widerstand nach.
Und es scheint mir sehr bezeichnend zu sein, dass Grünbein das rein Konventionelle seiner modernen Behandlung von Metrum, Ryhthmus und Zeile wiederum durch eine andere Konvention aufzuwiegen sucht, die ihrerseits genauso leer und äusserlich bleibt: Obwohl das heute gar nicht mehr selbstverständlich ist und also als ein bedeutungsvolles Zeichen ins Gewicht fallen sollte, beginnt in Grünbeins Gedichten jedes Wort am Anfang einer Zeile mit einem Grossbuchstaben, so als ob dieses Hervorheben des Zeilenanfangs dessen Zufälligkeit verdecken können sollte.
Vielleicht aber deutet gerade diese mangelnde Funktionalisierung der spezifisch lyrischen Mittel, im Zusammenhang sowohl mit den Deskriptiven als auch mit den reflexiven Ansprüchen von Grünbeins Texten, auf bestimmte literarische Möglichkeiten hin, die Grünbein dann nützen könnte, wenn er seine Texte aus den Traditionen bzw. den Gesetzen lyrischen Sprechens befreien und im Rahmen der Traditionen bzw. Gesetze einer Prosa zu entfalten versuchte. Es mag sehr gut sein, dass das, was innerhalb der literarischen Form Gedicht sowohl so wenig überzeugend Wiedergabe von Beobachtungen zu sein beansprucht als auch genau so wenig überzeugend als Analyse, Vivisektion auftritt, ja schliesslich auch das, was Verbindungen zu philosophischen, wissenschaftlichen oder anderen kulturellen Topoi zu ziehen unternimmt, innerhalb von prosaischen literarischen Formen eine andere, höhere Qualität annehmen würde; es mag sein, dass mögliche und manchmal erahnbare Qualitäten des Grünbeinschen Schreibens auf dem Stern seiner Prosa einzuleuchten beginnen könnten.
Dafür sprechen nicht nur jene Passagen in seinen Gedichten, welche auf die Fähigkeit differenzierter Wiedergabe von Beobachtungen schliessen lassen, sondern überhaupt Grünbeins Versuch, Analyse, Reflexion und Beobachtung in seinem Schreiben zu verbinden.
6
In den Gedichten Grünbeins wimmelt es geradezu vor grossen Worten wie Sterben, Angst, Freude, Überdruss, Wissen, Lust, Ekel usw. Diese grossen Worte stehen vielleicht zwischen den angedeuteten retrospektiven Momenten seiner Gedichte und jenen, mit denen er versucht, sich des Modernen oder Zeitgenössischen zu versichern, oder sie bilden die Klammer, die beide Momente umfassen soll.
Den Wörtern, die in diese Kategorie fallen, merkt man – sieht man in einigen Fällen von der Rechtschreibung ab – jedenfallls nicht an, aus welchem der neuhochdeutschen Jahrhunderte sie stammen. Zudem bezeichnen diese Wörter Begriffe, die wohl zu jeder Zeit und in vielen Sprachen allgemeines und selbstverständliches Gut sind. Sie scheinen unendlich übersetzbar oder paraphrasierbar und damit das für alle schlechthin Verbindliche und auch Wesentliche zu sein. Gebraucht man sie in der Literatur, dann können sie als konvertible Währung erscheinen, die sowohl das Überzeitliche als auch das Allgemeinmenschliche signalisieren können soll.
Kann aber literarisches Schreiben oder Lesen nicht erst dann ernsthaft beginnen, wenn man diese Übersetzbarkeit oder Paraphrasierbarkeit, nicht nur zwischen verschiedenen Sprachen, sondern auch innerhalb einer einzigen Sprache, zu befragen beginnt und damit auch den Schluss von dieser Art von Verbindlichkeit auf das Wesentliche nicht mehr selbstverständlich zieht?
Grosse Worte nenne ich hier also solche Wörter, die sehr allgemein bezeichnen, unter die sehr viel Verschiedenes und Verschiedenartiges fällt. Grosse Worte sind konventionelle Etiketten, die eine Unzahl von verschiedenen und verschiedenartigen Phänomenen durch sich zusammenzufassen beanspruchen. (Was kann unter Liebe oder unter Angst nicht alles verstanden werden!).
Gerade deshalb haben grosse Worte in der Literatur oder wenigstens in der lyrischen Dichtung zumeist die Wirkung, mit dem einzigen Schlag ihres jeweiligen Gebrauchs, allzu viele Fliegen so zu erschlagen, dass sowohl der Schlag als auch das, was dabei mit den Fliegen geschieht, unerkennbar bleibt. Anders: das, was unter diese grossen Worte fällt, fällt zumeist nicht damit oder dadurch unter sie, dass sie gerade gebraucht werden, es fällt nicht auf eine dar- oder herstellbare Weise. Diese grossen Worte, deren Gebrauch in Gedichten so schwierig ist, lösen zumeist zu viele sinnliche Vorstellungen zugleich aus, um jede von ihnen auf eine Weise deutlich werden zu lassen, die sie erfahrbar werden lässt.
So enthält der Gebrauch von grossen Worten unter den meisten Umständen, dass, was durch diese Wörter evoziert wird, diffus ist, blass und konturlos. Es hängt damit zusammen, dass diese Wörter vor allem der Sphäre der Reflexion angehören, einer Sphäre, deren Evokation in Gedichten nur mit Hilfe diffiziler Maßnamen möglich ist. Die Ansprüche, die, wie ich glaube, im Zusammenhang von Gedichten zu Recht gestellt werden, nämlich auch das dar- oder herzustellen, was man mit einem berühmtem Philosophen das Leben des Begriffs nennen könnte (wenn mit diesem Leben auch der Weg zu jenen allgemeinen Begriffen oder auch der Weg von ihnen weg mitgemeint ist), können durch diese grossen Worte fast niemals erfüllt werden. (Grundsätzlich anders liegt der Fall nur dann, wenn man es gerade unternimmt, das Blasse oder Konturlose selbst dar- oder herzustellen.) Um etwa in einem Gedicht Wörter wie Leben, Tod, Liebe überzeugend gebrauchen zu können, bedarf es bestimmter Vorkehrungen oder auch (literaturhistorischer) Umstände, müssen diese Wörter in Kontexten vorkommen, die ihren Gebrauch ästhetisch rechtfertigen. (Eine häufig in Anspruch genommene Möglichkeit dazu bietet die Figur der Ironie.)
Fast niemals kann man, und fast keiner kann wie August von Platen in „Wer die Schönheit angeschaut mit Augen“ das allgemein übliche Wort für den Begriff der Schönheit ernsthaft gebrauchen, und dennoch dabei Schönheit erzeugen oder, um es platonistisch auszudrücken, die Idee der Schönheit hinreichend verwirklichen. Die konventionelle, abgekartete Benennung oder der allgemeine Begriff sind also zumeist und auch in Grünbeins Gedichten nicht imstande, die Darstellung zu ersetzen, den Prozess der Entfaltung dessen, was mit jenen grossen Worten scheinbar so umstandslos benannt werden soll. In diesem Prozess, dessen Entfaltung ein Element der Definition von Literatur wäre, wäre das begriffliche Fixieren nur ein, wenn auch wesentliches Moment. So wie grosse Worte in Grünbeins Gedichten (aber keineswegs nur in seinen) gebraucht werden, sind sie Kennzeichen künstlerischer Schwäche. Gemäss der skizzierten Unfähigkeit, die übliche Unterscheidung zwischen wörtlicher und übertragener Rede anzutasten, wird hier das übliche grosse Wort für etwas sowohl als Garantie dafür genommen, dass dieses Etwas damit dar- oder hergestellt werden kann als auch dafür, dass mit der konventionellen Bezeichnung der angenommene Wert, die angenommene „Größe“, ja jenes Etwas selbst, gegenwärtig und erfahrbar ist. Die Bedeutungstiefe des Gedichts soll damit garantiert sein, dass Worte gebraucht werden, die Dinge bezeichnen sollen, die angeblich alle grundlegend und überall und jederzeit angehen. Die direkte, konventionelle Benennung soll die Mühe des Herstellens einer Gestalt ersetzen. So produziert der bedenkenlose und inflationäre Gebrauch grosser Worte in Grünbeins Gedichten eine Währung, die durch keine Realie, kein Gold poetischer Darstellung aufgewogen werden kann. Wenn Grünbein sowohl die althergebrachte poetische Maschinerie als auch die Verfahren modernen oder zeitgenösssischen Schreibens nur scheinbar (und nicht tatsächlich in ihren Voraussetzungen und Implikationen) zur gleichsam überzeitlichen Verfügung stehen, dann gilt das genauso für jene grossen Worte. In Grünbeins Gedichten kommen nicht nur immer wieder die Wörter Sterben, Panik, Angst, Freude, Überdruss, Zeit, Wissen, Irrsinn, Lust, Ekel oder Leben, Tod, Liebe vor, sondern auch Affekte, Schock, Horror, Entsetzen, Glück, Traum, Schlaf, Hass usw; da ist auch die Rede vom Sinnlosen, vom Unerhörten, das verstört, vom Unbewusstem, vom Unwirklichen und dem Irrealen. Dieser bedenkenlose Einsatz so ungeheuerer Summen führt dann zu zugleich prätentiösen wie hochtrabenden und leeren Formeln:
Das Leben erkaltet, Zeit sich zuerst an Lebendiges hält, die
Verstecke diskreter Leben, die Tage
Gezählt, wird das Leben zum Intervall.
Und gerade der unbedachte Einsatz solcher grossen Worte führt eben auch zu den notwendig ohnmächtigen Versuchen, das Allgemeine und Unanschauliche jener grossen Worte durch Metaphern zu konkretisieren. Die schon erwähnten Masken des Wissens, aber auch die Formeln Arkadien des Unbewußten oder reibt sich im Unbewußten. Gemurmel sind die sauren Früchte des Mangels an Reflexion der Bedingungen des eigenen Schreibens, des Kontexts Gedicht.
7
Auf der einen Seite das unreflektierte Verfügen über eine bestimmte traditionelle poetische Maschinerie, sowohl, was den Begriff und den Gebrauch metaphorischer Operationen, als auch, was bestimmte Momente der Satzrhetorik oder der Satz-Gestik angeht, in ihrem Nachempfinden anderer literarischer Zeitalter oder einzelner ihrer Repräsentanten (Rilke, Benn), dazu der massive Einsatz humanistischer Bildungstopoi, so als ob diese ohne weiteres zur Verfügung stünden.
Auf der anderen Seite die vertraute Sprache des zeitgenösssischen Alltags bis in subkulturelle Jargons, aber auch die unvertrauten, jedoch Modernität signalisierenden, Termini aus wissenschaftlichen Fachsprachen. Dazu, wenn auch in gemässigter, allgemein verträglicher Form, die modernistischen Verfahren der Assoziation, der Juxtaposition von Verschiedenartigem, zwischen dem Extrem der Registration oder Aufzählung von Dingen oder Ideen, dem Extrem des inneren Monologisierens, und dem Extrem der Montage vorgefundener, gegeneinander gestellter Zitate.
Und schliesslich das, was jene beiden Seiten des Grünbeinschen Schreibens, die retrospektive und die zeitgenössische im Innersten zusammenhalten soll, aber doch nur ganz äusserlich verbindet: die grossen, zeitlosen Wörter, die allgemeinen Bezeichnungen für die allgemeinen Dinge, für das Leben, Sterben, Lieben, Hass, Glück usw., usw. …
Alles das zusammen bedeutet: Durs Grünbein geht mit seinen Gedichten aufs Ganze. Ich behaupte: wie jeder, der Literatur schreibt, aufs Ganze gehen muss, denn dieser Anspruch ist wenigstens dann im Begriff der Literatur enthalten, wenn man die Tätigkeit Literatur ernstnimmt.
Wie jedem von uns, der Literatur ernsthaft zu schreiben oder zu lesen versucht, geht es also auch Grünbein darum, einen Standpunkt zu gewinnen, von dem aus die verschiedenen Kräfte, denen wir ausgesetzt sind oder denen wir uns aussetzen, absehbar, erforschbar, darstellbar oder auch herstellbar gemacht werden.
Doch die Art und Weise, wie Grünbein die verschiedenen Momente seines Schreibens auffasst, und die Art und Weise, wie er diese verschiedenen Momente miteinander zu vermitteln sucht, das ist es, was ihn, wie ich glaube, in seinem Anspruch scheitern lässt.
Die verschiedenen Aspekte des Grünbeinschen Schreibens, die ich in dieser Kritik zu skizzieren versucht habe, sollen deutlich machen, warum die Resultante dieses Schreibens nicht jenes gesuchte Integral sein kann, jene tatsächliche Verwirklichung eines Ganzen oder eines pars, das tatsächlich zu Recht pro toto steht, also dieses Ganze aus sich gleichsam entlässt, es hervorbringt oder es bedeuten kann.
Grünbeins oberflächlicher und inkosequenter Umgang mit den verschiedenen Seiten seines Schreibens bringt etwas hervor, das man bestenfalls als Karikatur oder Parodie jenes Ganzen ansehen könnte; aus einer tatsächlichen schöpferischen Ermächtigung oder einer schöpferischen Preisgabe, aus der Möglichkeit objektiver Dar- oder Herstellung wird etwas, das gerade damit jener Möglichkeit spottet, dass es ihre Verwirklichung zu sein, so sehr beansprucht, während es doch diesen Anspruch eklatant verfehlt.
Statt jenes Ganze tatsächlich zu verwirklichen, statt sich der eigentlichen poetischen Arbeit zu unterziehen, bringen es Grünbeins Gedichte nur zu einer Art Vogelperspektive, zu einer angemaßten Totalen:
Triebwerke, Wolken
Und Passagiere, das alles entzog sich
In Pythagoras’ Schweigen. Von den zahllosen Mythen,
Verbrannt, war nur Asche geblieben (…)
Über diesen Wolken, von diesem Dach der Welt aus, scheint die Freiheit grenzenlos zu sein, aber gerade auch insofern eine Art Schlager-Text. Unten flutet das Leben, die Jargons ziehen vorüber, oder wie es bei Grünbein so oft heisst: die Codes; dort, weit unten, wimmeln die Traditionen, funkelt die Moderne, leuchten so verschiedenartige Sterne wie das Abendland, die Steinzeit, die Jahrtausende, der Kosmos selbst, aber auch die rostige Autotür, die Räderspur im Wegschlamm, der Drahtzaun, dann aber auch die Wissenschaften, die Philosophie, die Dichtung und, natürlich, das Leben, das Lieben, das Sterben, der Tod. So ist da etwas, ein poetisches Ich, das die Attitüde hat, das sich in der Pose ergeht, all diese so verschiedenartigen Dinge von oben herab zu einer poetischen Gegenwart und auf eine Fläche zu bringen und gerade damit das Ganze absehbar zu machen. Es ist ein poetisches Ich, das über subkulturelle Jargons so wie über wissenschaftliche Fachtermini verfügt, über morgen- oder abendländische Jahrhunderte so wie über subkulturelle Jargons, über philosophische Probleme so wie über die Methoden der Wissenschaften, über poetische Traditionen und Verfahren so wie über subkulturelle Jargons und die Methoden der Wissenschaften und über alles das und noch viel mehr genauso wie über Leben, Liebe und Tod:
Steinheim, Neandertal, Cro-Magnon, dieser Singsang
Der Gattung… Namen für Hirnschalen,
für Kiefer und Kinnladen, real wie Reste
Versenkt in den Müllgruben Moskaus, den Plastiksäcken
Manhattens (…)
In den Büros und Apartments, das hierarchische Schnarchen,
Das Zischeln der Polytheismen (…)
Es ist ein poetisches Ich, das es unternimmt, alles auf einmal zu sehen, aus einer Totalen, es ist ein poetisches Ich, das zu viele verschiedene poetische Lizenzen als zu seiner selbstverständlichen Verfügung behauptet, und diese Verfügung als einen Beweis für verwirklichte Totalität missversteht. Der fundamentale Mangel an tatsächlicher poetischer Kraft zu einer solchen Verwirklichung macht aus der Anmassung von Totalität eine Form objektiven Selbst-Betrugs, eine Form einer für sich selbst undurchsichtigen Prätention.
Und gerade die Tatsache, dass das, was da spricht, seinen eigenen Anspruch über den Dingen zu schweben, durch die Weise, in der es spricht, so krass verfehlt, gerade diese Tatsache bringt es mit sich, dass diese Stimme unversehens bestimmte seelische und soziale Eigenschaften annimmt; dass dieses poetische Ich selbst zu einer Figur wird, deren Umriss, also deren Möglichkeiten und Grenzen, man allzu leicht erahnen kann. Unversehens verwandelt sich damit der Anspruch, von einem ausserirdischen Punkt auf das Gewimmel hinunterzusehen, zu einem Teil des Gewimmels: Die Haltung des Sprechenden und die Gedichte selbst werden psychologisch, soziologisch, historisch, ästhetisch allzu mühelos oder widerstandslos einordenbar, offenbar Kräften unterworfen, deren Wirkung sie nicht einzuschätzen und einzukalkulieren bzw. darzustellen vermögen. So sieht und hört man jemanden, dem offenbar viel daran gelegen ist, um beinahe jeden poetischen Preis den mit Bildung prunkenden Weltläufigen vorzustellen, genauso wie den über jede Menge letzter Schreie verfügenden subkulturell geeichten Grosstadt-Jugendlichen; man sieht und hört auch den blasierten Dandy, den feinnervigen Eleganten, das antimetaphysische und postnietzeanische Zünglein einer Nervenwaage, den Abgeklärten, den Desillusionierten, den kalten oder coolen, manchmal zynischen Vivisekteur, der, wie er glaubt, grossen Gefühlen oder den humanistischen Ideen mit den synthetischen Begriffen von Wissenschaften wie Neurologie, Chemie oder der Computer- und Kommunikationswissenschaften auf den Grund geht (während er doch nur eine Stimmung durch eine andere ersetzt); man sieht und hört auch jemanden, der den Beobachtenden, den Durchschauenden nur schauspielern kann, weil ihm so viel daran liegt, sich in seinem Fin de siecle-Blick selbst zu bespiegeln.
Man sieht und hört zugleich, wie sich diese Gedichte, wie sich ihr poetisches Ich in die Metapher für eine bestimmte, billige Vorstellung von sogenannter Postmoderne verwandeln, man sieht und hört die Kräfte eines halbgebildeten Feuilletons am Werk, das sein Raunen, Unken und Eingeweideschauen, sein Deuten all der kulturellen Vogelflüge durch etwas bewiesen zu sehen glaubt, das selbst nichts anderes ist als ein ganz äusserlicher oder willkürlicher Teil dieses Deutens.
Man sieht und hört aber auch, und als Kehrseite dieser Gebärden der Distanzierung, des Desillusionierten und des Desillusionierens in manchen Gedichten Grünbeins peinliche Sentimentalität; aufdringlich zuweilen in den Gedichten, in denen Erinnerungen an eine Kindheit oder einen kindlichen Zustand heraufbeschworen werden sollen, am aufdringlichsten aber in dem langen, siebenteiligen Liebesgedicht mit dem unsäglich kalauernden Titel „Im Zweieck“. Es ist ein Gedicht, das die Ausstrahlung von Hochglanz-Erotik, schicker Jugend-Kultur, eines auf das modische, auf das Zeitgeist-Magazin heruntergekommenen Existentialismus pflegt, veredelt durch preziöse und pretentiöse Metaphern (die diaphanen Einsamkeiten von Stadt zu Stadt, Regen war die zerflederte Partitur, auf der sie ausgleitet); es ist ein Gedicht, das so von dem ersten gemeinsamen Besuch eines Cafés zu (wie Karl Valentin einmal sagt) allem anderen auch kommt:
Schneller als sonst wirkten die Drinks, und bald war es bittersüß
Nur von spitzer Berührung, von Worten wie Seitenstechen im Gehn
Auf dem Heimweg (…)
Nachthimmel sanken, Sterne zuhauf. Impfnarben glänzten, entblösst.
Schweigen verbarg Ironie, das Gefälle der Jahre, oben du, unten ich.
Man sieht und hört als eine andere Kehrseite dieser Gebärden der Distanzierung, des Desillusionierten und des Desillusionierens auch dann und wann eine (an den Hauptintentionen Grünbeins gemessen) inkonsequente, aber wohlfeile Gesellschafts- oder Bewusstseins- oder auch Medienkritik. Auch diese Kritik ist allzu mondän, allzusehr eine Kritik aus einem Grand Hotel Abgrund (bei Grünbein ist das allerdings eher die Kritik aus einer Nobel-Disco Decadence), um überzeugend zu wirken.
Im Schaufenster, Brillen für Liebe,
Für schärferes Fernsehn, Särge
Und Möbel zum schnelleren Wohnen (…)
– Oder:
alles codiert
Wie seit langem im voraus, ein Leben
Auf Abruf, (…)
Grünbeins Gedichte lesend hört und sieht man das alles, und man beginnt zu begreifen, dass diese Gedichte den, wie ich glaube, berechtigten, ja notwendigen Anspruch auf das Ganze für die Suggestion einer Stimmung, eines Lebensgefühls verkaufen, man begreift, dass diese Gedichte Surrogate sind, wenn man so will, eine Art Designer-Droge, intelligent und geschickt gemacht insofern, als sie eine bestimmte Palette von Bedürfnissen perfekt zu bedienen geeignet sind; man begreift, dass sie insofern Zeugnis eines Talents sind, als diese Bedürfnisse natürlich nicht jedermanns Bedürfnisse sind, sondern diejenigen einer bestimmten Schicht von Literaturinteressierten, und dass man Grünbein so etwas wie eine, wenn auch ephemere, Form von Intuition und vor allem eine Form von Professionalität nicht absprechen kann. Diese Intuition und diese Professionalität ermöglichen ihm, diese Bedürfnisse so zu bedienen, dass offenbar vielen seiner Leser die simplen Muster sowohl jener Bedürfnisse als auch ihrer Befriedigung entgehen.
8
Für diese Rezension habe ich vor allem zwei Motive. Zum einen ein literarisches: Literaturkritik ist selbst Literatur und auch Teil meines eigenen literarischen Schreibens, und die kritische Auseinandersetzung mit Literatur, die man selbst nicht geschrieben hat, ist mancherlei Hinsicht einfach ein Versuch der Selbstkorrektur oder auch der Versuch einer ihrem Wert gemässen Integration bestimmter Kräfte oder Zeit-Geister. (Es ist ja nicht so, und es soll ja wohl auch nicht sein, dass ich in dem, was ich als das Scheitern von Grünbeins Gedichten ansehe, nicht auch mein eigenes Schreiben von Gedichten wiederfinde.)
Das andere Motiv, ich gebe es zu, ist der Zustand des überwiegenden Teils der deutschsprachigen Literaturkritik, der sich am Beispiel der Rezeption von Grünbeins Gedichten wieder einmal offenbart. Nachdem man uns jahrzehntelang treuherzige Sentenzen, biedere humanistische Aphorismen, korrektes Politisieren (den braven Stammtisch) oder auch die angeblich authentische oder genuin subjektive Wiedergabe von Empfindungen und Gefühlen als bedeutende Gedichte einzureden versucht hat, ist jetzt, seit einigen Jahren, das Gegenteil wenigstens in einigem Schwange:
Viele unserer Feuilletonisten oder Literaturprofessoren (häufig sind sie ja beides in Personalunion) multiplizieren alle diese Faktoren wieder einmal mit minus 1, gefallen sich im Lob von amoralisch-verwegenen Sentenzen, von antihumanistischen Aphorismen, von inkorrektem Politisieren (der wüste Stammtisch), wertschätzen zugleich das, was sie für artistisches Raffinement halten und verdinglichen, kurzum: sie favorisieren jetzt statt den Epigonen Brechts wieder einmal die Epigonen Benns.
Wenn das Dialektik ist oder auch ihre Negation, wie fruchtlos ist dann beides! Wie sehr bleibt doch der gemeinsame Hintergrund vor der bewusstlosen Mechanik des Austausches solcher Antithesen siegreich. Und dieser gemeinsame Hintergrund heisst: mühelose Abbildbarkeit der Dichtung auf bestimmte Weltanschauungen beziehungsweise auf deren Darstellungen in den Feuilletons; das Gedicht als Illustration oder wohlfeile Ergänzung des mehr oder weniger schöngeistigen gehobenen Journalismus.
Das alles bedeutet, dass jene journalistische Literaturkritik und ihre Gegenstände sich dazu zu verurteilen, einander so in die Hände zu spielen, dass sie viel mehr Symptom sind als Symbol, viel mehr unwillkürlicher Reflex, Luftspiegelung eines Zeitgeists als dessen tatsächliche Durchdringung, täuschende Bemächtigung oder illusionäre Unterwerfung: So geht, wie kann es anders sein, der Alptraum der Literaturgeschichte weiter, und nicht nur der Alptraum der Literaturgeschichte.
Wie schreibt Brecht 1954 so richtig (aber hätte das nicht auch Benn schreiben können?): „Unsere Gedichte sind vielfach mehr oder minder mühsame Versifizierungen von Artikeln oder Feuilletons oder eine Verkopplung halber Empfindungen, die noch zu keinem Gedanken geworden sind.“
Franz Josef Czernin, Schreibheft, Heft 45, Mai 1995
Feldpost
Wenn ein Autor so etwas über einen anderen Autor schreibt, dann kommt er entweder aus Österreich oder er hat ein Problem. In diesem seltenen Fall liegt wohl beides vor, und ich muß damit rechnen, daß es ernst gemeint ist. Muß ich? Was fängt man an mit einem Artikel wie diesem, einem ebenso monotonen wie insinuierenden Pamphlet, das sich aufdrängt als ungebetene Rezension? Daß es sich um ein Dokument der Täuschung handelt, wird nach der ablenkenden Einleitung schnell klar. Die Täuschung geht in zwei Richtungen: sie ist Selbsttäuschung (über das Vermögen zur Reflexion) und vorgetäuschte Analyse (in Wirklichkeit steht das Handlungsziel, nämlich Abrechnung, von Anfang an fest). Was hat es auf sich mit der ungeheuren Einfalt des Autors, seinem Glauben an die gesetzgeberische Macht der Frühen Moderne?
Von aller Aspektblindheit abgesehn, ist mir in den paar Jahren bewußten Wahrnehmens immer die Vermischung von Altem und Neuem als bislang unauflösliche erschienen. Gleich neben dem Bauhaus lag der Schrebergarten, zu jedem Wittgenstein war ein Heidegger in die Mönchszelle gesperrt. Es war also nicht so, daß es irgendwie eine einhellige normative Kraft, etabliert aus Vernunftsgründen, gegeben hätte. Es war auch nicht so, daß sich die Geister auf nurmehr einen Entwurf (der Gesellschaft, der Architektur, der Dichtung usw.) geeinigt hätten. Vielmehr war der Alptraum Geschichte, aus dem es zu erwachen gilt, beschaffen wie jenes Unbewußte, in dem alles gleichzeitig, alles durcheinander sich drängte. Und erst im Bewußtsein einer überwundenen Moderne fand es für Augenblicke zusammen. Indem das Gedicht solche Augenblicke als ein Innehalten inszenierte, hielt es die Sehnsucht nach der Erlösung aus diesem Alptraum wach. Indem es sich nicht länger an den tödlichen Strategien von Reinigung und sprachlicher Hygiene beteiligte, sondern, alleingelassen, auf die Trümmerfelder zurücksah, trat es heraus aus dem Kriegszustand. So wurde der Blick frei für die bizarren Reste, das Eingeschmolzene, die Palimpseste und den vermischten Hausrat. Das von Geschichte Zusammengefügte, aus Katastrophen und Utopien herausgerettet, lag da als neue Legierung, mit der es zu arbeiten galt.
Um auf die analytisch getarnte Rempelei einzugehen… Ich glaube, das Dilemma der Schmähschrift ist der ästhetische Durchhaltewillen ihres Verfassers. Er mündet direkt in ein verranntes Weltbild. Aus der heroischen Selbstanfeuerung in der allgemeinen Erschöpfung des Kritisierens spricht unversehens das Ressentiment. Die Stellung ist nurmehr durch Pedanterie und peinliche Programmatik zu halten. Dabei ist gerade das Festhalten an der Konstruktion („… mit weiß hervortretenden Knochen“) selbst restaurativ. Der Preis sind die Öden der Abstraktion, begrenzt vom Tabu; du sollst keine Genitivmetaphern haben, du sollst keine Großen Worte benutzen, du sollst die poetischen Werkzeuge zerbrechen, du sollst keine Schlager hören und dich von den Zeitungen fernhalten, du sollst deine billigen Träume verleugnen… Es ist die gute alte herrschsüchtige Moderne, die hier zur Ordnung ruft.
Aber der Einwand aus den Schützengräben der Sprachanalytik trifft mich nicht. Vorgetragen wie mit dem Maschinengewehr, in repetitiver Diktion, soll er wohl einschüchtern wie der endlose Vortrag der immergleichen Dekrete. Da ich mich plötzlich wiederfinde als jemand, der aus dem Nichts heraus angegriffen wird, bleibt mir nur, auf den zentralen Trick der Anklageschrift hinzuweisen. Es wirft kein günstiges Licht auf den Verfasser, wenn er die eigenen Schreibverfahren in polemischer Absicht zu übertragen (und gleichzeitig zu verhehlen) versucht. Während ein Czerninsches Konzept-Gedicht, weil es den Willen, etwas zu sagen, verbirgt, leicht in Einzelteile zu zerlegen ist (es finden sich stets homologe Stücke), läßt sich ein Gebilde, das sich Erlebnis und körperlichem Reflex verdankt, nur wie lebendiges Gewebe sezieren. Der Schnitt geht in die Eingeweide, das Blut, das herausfließt, ist nicht zu stillen. Nur wer nach dem Prinzip einer Autonomie der Teile das Gedicht als Junggesellenmaschine entwirft, entgeht solcher Gefahr.
Seminaristisch gesprochen, lassen sich synthetische Gedichte prinzipiell gar nicht analytisch auflösen, weil sie realen Bewegungen und niemals nur nominalen folgen, sie sind darin immer schon neben jedem System. Gegen den nächsten Atemzug ist noch kein Theorem aufgestanden. Wie immer doppeldeutig hat Wittgenstein die Gefahr bezeichnet, als er die Verhexung unsres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache beklagte. (Mir jedenfalls scheint Mimesie, indem sie dem Anpassungsverhalten der Tiere folgt, wenigstens für den Augenblick die interessantere Strategie.)
Dagegen kommt das Ideal des Maschinen-Gedichts aus der Abneigung gegen das vegetative, immer zufällige, oftmals betäubende Leben. Um wirklich allen unliebsamen Folgen der Leidenschaft zu entgehen, sucht es die saubere Kastration. Natürlich hört der Gesang nach der lyrischen Kastration sich anders an als davor. Doch hat nicht die Experimentelle Kastratenlyrik, in ihrer Reinheit unübertroffen, mittlerweile den Todpunkt erreicht? Narzißmus vor dem blinden Spiegel, das wäre die Formel für eine in die Jahre gekommene modernistische Literatur-Literatur, die sich nurmehr als elitäre Geste behaupten kann. Alles das Permutieren und Syntaktieren, wo es sich rein auf die Wortbewegung konzentriert, ist bestenfalls Regression, Sehnsucht nach der Kinderzeit der Moderne. Einer wie Reinhard Priessnitz hat zuletzt in genau vierundvierzig gedichten alle wesentlichen Nachträge dazu geliefert.
So lohnt es sich eigentlich nur, die Unvereinbarkeit der Positionen festzuhalten. Die Redaktion vom Schreibheft hätte gut daran getan, wenn sie in ihrer bewährten Art ein wenig Material zu den Vorgeschichten zweier schwer vereinbarer Schreibtraditionen geliefert hätte. Kommentarlos abgedruckt, bleibt der zoologische Leichtsinn, der hier am Werk war, dem Blick verborgen. Ein Dompteur hätte alle Hände voll zu tun, wenn er zwischen so verschiedenen Tierarten vermitteln müßte. Rilkes Panther und Jandls Mops hätten sich einiges zu sagen, wenn sie nur miteinander reden könnten. Am Ende, fürchte ich, läuft jedoch alles auf ein paar böse Szenen hinaus.
„Related by antithesis…“, so nannte W.H. Auden das Verhältnis der Dichter zueinander. Eine kürzere Formel ist nie gefunden worden. Ich habe herausgehört, daß Czernin mit seiner Schrift auch sich selbst treffen wollte. Ich vermute, es ist ihm gelungen. „A compromise between us is / Impossible…“, setzt Auden seine Ansprache fort. Sein Schluß:
Respect perhaps but friendship never:
Falstaff the fool confronts forever
The prig Prince Hal.
Der Weg in die Emigration der abstrakten Moderne ist schmerzhaft und voller Verluste. Wer ihn gegangen ist bis dorthin, wo keiner ihm mehr zuhören mag, soll nicht wehleidig zurückblicken auf der Suche nach dem verlorenen Witz.
Durs Grünbein, Mai 1995, Schreibheft, Heft 46, November 1995
Kleine, verwunderte Fußnote zu einer Polemik von Franz Josef Czernin
Es ist das Schicksal aller „Götterlieblinge“, daß sie irgendwann in Ungnade fallen. Die Nobilitierung zum lyrischen Junggenie, wie sie Durs Grünbein durch das FAZ-Feuilleton widerfuhr, hat nun auch in Wien und Umgebung den branchenüblichen Futterneid provoziert. Franz Josef Czernin, Dichter aus Österreich, hat sich zu einem Totalverriß von Grünbeins Falten und Fallen entschlossen. Das ist sein gutes Recht. Es ist ebenfalls sein gutes Recht, den eigenen Futterneid als klammheimliches Motiv für seine Grünbein-Attacke zu verdrängen und durch ehrenwertere Gründe zu ersetzen. Wir wollen uns damit zufriedengeben, wenn die Eifersucht produktiv wird, d.h. die Gestalt von Argumenten annimmt. Es ist schließlich schon eine mittlere Sensation, wenn eine Lyrik-Diskussion, deren Ausbleiben unisono bejammert wird, tatsächlich stattfindet.
„Der Zustand des überwiegenden Teils der deutschsprachigen Literaturkritik“, glaubt Czernin, muß erbärmlich sein, bricht sie doch vor einem lyrischen Grünschnabel in die Knie und goutiert dessen literarische „Designer-Drogen“ als lyrische Höchstleistungen. Die Welt ist schlecht, die Welt der Literaturkritik zumal, die noch nicht einmal weiß, daß man „die avantgardistischen oder modernistischen Arbeiten der letzten dreißig Jahre“ gefälligst zu „verarbeiten“ hat, um als avancierter Dichter zu gelten.
Durs Grünbein, so insinuiert Czernins Polemik, schreibt so abgrundtief naiv, „als ob weder Trakl oder George, noch Arp oder Schwitters geschrieben hätten“. Als Skandalon soll gelten, daß der Autor von Falten und Fallen offenbar ohne schlechtes Gewissen Genitivmetaphern benützt! Hier wittert Czernin die Beleidigung jeder literarischen Progressivität. Ein Dichter setzt seine Sprache mittels Genitivmetaphern in Bewegung, ohne sich um avantgardistische Literaturdoktrinen zu kümmern?
Czernin merkt nicht, wie altbacken und spießig doktrinär sein eigenes Dekret gegen die Genitivmetapher daherkommt, huldigt es doch einer sehr eindimensionalen Vorstellung von literarischer Evolution. Muß sich, um nur ein Beispiel zu nennen, Peter Rühmkorf den ironischen Rekurs auf den Reim verbieten, nur weil ihn Arno Holz hundert Jahre zuvor für obsolet erklärt hat? Dagegen ist festzuhalten: Keine Form, kein Motiv, keine Metapher, keine metaphorische oder rhythmische Fügung wird hinfällig, nur weil sie irgendwelche literarischen Rebellen für anachronistisch erklärt haben.
Aber Czernin ist vorsichtig. Um sich nicht dem Dogmatismus-Verdacht auszusetzen, erklärt er die anthromorphisierenden und metaphorischen Techniken prinzipiell für zulässig. Nur Grünbeins Verwendungsweise zeuge nun mal von poetischer Bewußtlosigkeit. Es kann nicht ausbleiben, daß Czernin dadurch in Beweisnot gerät. Mit seinen abstrakten Verdikten gegen eine „althergebrachte poetische Maschinerie“ ist nichts gewonnen. Daß man sich der poetischen Tradition „sowohl zu bemächtigen als auch zu unterwerfen hat“, klingt nach Gemeinplatz, ist aber noch weniger als das, nämlich ungenau. In keinem Fall ist es nämlich zu akzeptieren, wenn sich ein Dichter der Gegenwart der Literaturgeschichte zu „unterwerfen“ anschickt. Ein solches Kapitulantenverhältnis ist wohl kaum ein Qualitätsprädikat.
Auf Bertolt Brechts Diktum könnte ich mich mit Czernin vermutlich einigen: „Wer die Tradition nicht beherrscht, fällt hinter sie zurück.“ Und ich kenne wenige Dichter, die ihr Spiel mit der Tradition so artistisch vorführen wie Durs Grünbein. Hier werden eben nicht die romantischen Volksliedstrophen, die klassischen Sonette und antiken Hexameter bieder nachgesungen (wie es etwa bei Ulla Hahn oder mitunter bei Sarah Kirsch der Fall ist), hier werden die alten metrischen Muster, die Alexandriner oder jambischen Trimeter, diskret anverwandelt, um sie immer wieder ironisch oder verfremdend zu unterlaufen. Es kommt eben immer auf die konkrete Verwendungsweise des tradierten lyrischen Materials an – und hier kann man Grünbein wohl kaum irgendeiner Unbewußtheit oder Naivität bezichtigen. Das bloße Vorhandensein von Metaphern wie „Pizza aus Stunden“, „Masken des Wissens“, „das Zischeln der Polytheismen“, wie sie Czernin fleißig auflistet, beweist gar nichts.
Auch sehe ich nicht, was am forcierten Spiel mit vertrauten Anklängen und Satz-Gesten, am Heraufrufen feierlicher Tonfälle (Rilke, Benn etc.) so verwerflich sein soll. Grünbein wirft sich ja diesem ganzen Traditionalismus nicht unreflektiert in die Arme, sondern streut immer ausreichend ironische Konterbande ein, um seine traditionalistischen Gebärden nachhaltig zu dementieren.
Czernin versucht jedoch unablässig Grünbein auf frischer traditionalistischer Untat zu ertappen und sammelt mit großem Entlarvungseifer Gedicht-Bruchstücke, die er für Indizien nimmt. Er hat die Gedichte Grünbeins so genau gelesen und anschließend mit chirurgischer Präzision so detailliert zerlegt, daß er sie als Gedichte, als lebende Sprachorganismen, gar nicht mehr wahrnimmt, sondern nur noch als eine Art Steckbrief, auf dem die besonderen Kennzeichen ästhetischer Defizite verzeichnet sind. Was er in seiner ausdauernden Total-Demontage von Grünbeins Lyrik an Einwänden gesammelt hat, ist ja nicht alles neu: zum Beispiel sind die „häufigen Bezeugungen humanistischer Bildung oder Gelehrsamkeit“, die Czernins Zorn erregen, fast durchweg in der Grünbein-Kritik moniert worden. Auch die Beobachtung, daß durch Nominalstil, assoziative Verknüpfung wissenschaftlicher Vokabularien und sarkastischen Sound gewisse Anklänge an „den späteren, nach-expressionistischen Benn“ geweckt werden, ist kritisches Gemeingut der Grünbein-Rezepion.
Aber sind denn intertextuelle Bezüge und Verwandtschaft der Sprechhaltungen gleich ein untrügliches Anzeichen von Epigonalität? Czernin kann und will nicht verwinden, daß sich Grünbeins Gedichte auf einem anderen Terrain und in einem anderen Diskurs bewegen, einem Diskurs, der sich um Wiener Sprachskrupel nicht schert:
Das Arbeiten der Sprache selbst… liegt außerhalb des Blickfelds, welches die Gedichte Grünbeins zeigen.
An experimentellen Prozeduren mit dem Sprachmaterial ist Grünbein in der Tat nicht interessiert. Seine Sprachskepsis geht nicht so weit, daß er das Verhältnis von Signifikant und Signifikat im Gedicht einer ständigen Zerreißprobe unterziehen würde.
Stattdessen zieht er es in seinen Gedichten vor, nicht durch serielle oder permutative Prozeduren zu langweilen, sondern in rhythmisch genau kalkulierten Versen von den anthropologischen Bedingtheiten des (post)modernen Subjekts am Ende des 20. Jahrhunderts zu sprechen. Sein kalter Blick auf gattungstypische Phänomene: auf „die biologische Blöße des Einzelnen“, auf den „Mensch ohne Großhirn“, auf die Konstitution des prähistorischen „Höhlenmenschen“ ist es, der jeden neugierigen Leser, hat er sich nicht durch (post)avantgardistische Literaturverordnungen selbst lahmgelegt, sofort elektrisiert. Was Czernins Bildungs-Prahlerei und geborgte Weltläufigkeit enttarnen will, nenne ich poetische Zeitgenossenschaft.
Zu dieser poetischen Zeitgenossenschaft gehört es in diesem Fall, sich die Sprachen der Neurologie, Quantenphysik, Kommunikationstechnologie oder Medizin poetisch einzuverleiben. Gewiß waltet bei Grünbein nicht überall enzyklopädische Brillanz, sondern es klafft mitunter ein schwarzes Loch der Diffusion. (Auf Negativ-Beispiele, die Czernin in Überfülle anführt, verzichte ich hier.) Aber, um mit Enzensberger zu sprechen, es gehört nicht zu den Pflichten eines Dichters, dumm zu sein.
Und warum sollte sich Grünbein seine anatomische und anthropologische Neugier durch Czernin ausreden lassen? Wo Czernin nur „große Worte“, „unreflektierten Traditionalismus“ und „unverhüllte Stoffhuberei“ sieht, da sehe ich artistische „Nervenkunst“ am Werk. In ihr werden alle Tonlagen, vom hymnischen „Pontifikal-Ton“, ironisch gebrochener Feierlichkeit bis hin zum illusionslosen Sarkasmus durchprobiert, um ein Ich im Kreuzfeuer der Bewußtseinsreize vorzuführen. Das Credo des Lyrikers Grünbein ist „das Rundumoffensein, triebhafte Wachsamkeit inmitten einer Dingwelt, in der das Ich millionenfach zerlegt und aufgelöst wird in ein Vielerlei von Reizen.“ So steht es im Essay „Transit Berlin“, der Grünbeins eklektizistisches Konzept prägnant zusammenfaßt:
Der neue Künstler hat kein Programm mehr, sondern nur noch Nerven und einen feinen Spürsinn für Koordinaten. Tropismen an den Rändern alter Formen, indifferente Sprünge, Luftsprünge ins Immaterielle sind seine liebsten Züge in einem Spiel, das seine Regeln immer wieder aufgibt und aufs neue prägt. Stil ist allenfalls noch ironisch spielerische Tarnung oder Mimikry… Alles, was einst die Exklusivität verbürgte – Stil, Thema, große Geste, Ausdruck –, ist in den Augen dieser Streunenden verpönt, ein nekrophiles, ältliches Vergnügen.
Im Unterschied zu Czernin hat Grünbein „kein Programm mehr“, sondern verläßt sich auf seine Beobachtungen und Reizbarkeiten. Das Bekenntnis zur Lyrik als „Nervenkunst“, deren Akteur mit „triebhafter Wachsamkeit“ die auf ihn einstürzenden Bewußtseinsreize protokolliert, kann auch am Titelgedicht des Bandes Falten und Fallen entziffert werden. An diesem Text lassen sich die ästhetische Eigenart, das Weltaneignungsgeschick, vielleicht auch die Anfechtbarkeit der Grünbeinschen Dichtung sichtbar machen.
Im Zentrum des Gedichts findet sich eine ebenso bizarre wie problematische Metapher:
Jeder Tag brachte, am Abend berechnet, ein anderes Diagramm
Fraktaler Gelassenheit, später in traumlosem Kurzschlaf gelöscht.
Es ist zweifellos das Verdienst von Czernins Polemik (oh doch, das muß man zugeben), daß sie den Blick auf die Problematik solcher metaphorischen Fügungen geschärft hat. Denn wird hier der terminus technicus „fraktal“, der in diesem Fall der Chaostheorie entstammt, wirklich überzeugend in einen metaphorischen Kontext gebracht? Oder wird er nur als Modernität suggerierender Oberflächenreiz eingeschmuggelt? Was haben wir uns unter „Fraktaler Gelassenheit“ vorzustellen? Das sind die Fragen, die uns Grünbein-Leser noch häufig dazu zwingen werden, uns über Falten und Fallen den Kopf zu zerbrechen.
Kaum tangiert werden wir allerdings von Czernins Vorwurf, Grünbein bediene sich „modernistischer Verfahren“ nur in „allgemein verträglicher Form“. Die Modernität und Radikalität eines Textes bemißt sich wohl kaum an seiner Fähigkeit zur Erzeugung einer allgemein unverträglichen Form. Formales Destruktionspotential verbürgt noch keinen Avantgardismus – und das dröhnende Überbieten „allgemein verträglicher Modernismen“ hat selten große Sprachereignisse hervorgebracht.
An einer Stelle seiner Polemik hat Czernin eine aufschlußreiche Erleuchtung: Grünbeins Gedichte, so urteilt er mit der ganzen Wucht seiner Geringschätzung, glichen formal doch eher sentimentalen „Schlagertexten“. Czernin mag das für einen vernichtenden Vergleich halten. Ich halte es hier ganz unavantgardistisch mit Gottfried Benn: Ein „lyrisches Ich“ von heute, so behauptete Benn vor vier Jahrzehnten, ist jemand, „der mehr aus Zeitungen lernt als aus Philosophien, der dem Journalismus näher steht als der Bibel, dem ein Schlager von Klasse mehr Jahrhundert enthält als eine Motette.“
Durs Grünbein, glaube ich, hat sowohl aus Zeitungen und Schlagertexten als auch aus Philosophien und den mit ihr verbündeten Wissenschaften gelernt. Seinen Schlagern von Klasse“ will ich weiter zuhören.
Mai 1995
Post Skriptum
Manche Texte haben eine eigenartige Wirkungsgeschichte. Der Grünbein-Verriß von Franz Josef Czernin hat viel Getuschel provoziert, einige Dutzend Telefoneinheiten, vollmundige Ankündigungen, aber keine einzige öffentliche Replik. Soll man daraus schließen, daß die emphatischen Lobredner des „Götterlieblings“ mit leeren Händen dastehen? Der literarische Wanderzirkus ist einfach zum Darmstädter Olymp weitergezogen – zur nächsten Huldigung. Nur Fritz Raddatz hat sich als Czernin-Echo betätigt und rechtzeitig zur Darmstädter Krönungszeremonie in der ZEIT (22.9.1995) einen Mahnbescheid an Grünbein losgeschickt.
Dabei handelt es sich zuallererst um eine umfangreiche Grünbein-Zitatensammlung, der Raddatz in der Art eines stirnrunzelnden Literaturpädagogen kritische Kommentare beifügt. Den Bedenkenträger plagt die Sorge, der hochbegabte Dichter werde „rasch lässig“, gar „fahrlässig“ und „disziplinlos“, die „Sprachkraft“ könne ihm entgleiten in „viele falsche Bilder“, „peinliche Klischees“ und unzumutbare „Wie-Vergleiche“.
Fahrlässig ist zunächst mal Raddatz selbst, wenn er sich gleich in der vierten Zeile seines Artikels den Fauxpas gestattet, den Titel des ersten Grünbein Bandes (Grauzone morgens, 1988) falsch zu zitieren. Das stärkt nicht unbedingt das Vertrauen in die Solidität seiner kritischen Einwände. Tatsächlich sind dann die Beispiele, die er als Beweismaterial für Grünbeins Schwächen heranziehen will, ziemlich läppisch. So meint er Grünbein bei der „Vielfachverwertung“ ertappt zu haben, weil der Suhrkamp-Verlag 1994 den Auswahlband Von der üblen Seite herausgebracht hat.
Außerdem fällt ihm auf, daß der Dichter einige Motive und Bilder gleich zwei- oder dreimal in verschiedenen Kon-Texten benutzt! Sowas aber auch! Da veröffentlicht ein Dichter ein und dasselbe Gedicht gleich zweimal – und leistet sich sogar wiederkehrende Motive: Hat es so etwas in der Literaturgeschichte jemals gegeben?
Nicht genug damit, Raddatz entlehnt aus Peter Wapnewskis schlauem Pamphlet „Gedichte sind genaue Form“ (1977) die polemische Übung, Gedichte in kritischer Absicht in Prosazeilen zu verwandeln – und umgekehrt. Das kann man übrigens nicht nur bei Grünbein, sondern auch bei Jürgen Becker, Friederike Mayröcker oder meinetwegen Arno Holz – und bei all den anderen, die die Gattungsgrenzen zwischen Lyrik und Prosa auflösen.
Aber ist dadurch etwas bewiesen? Raddatz’ Resümee-Satz zu Grünbein ist übrigens auch ein schöner Bumerang:
Geschminkte Aktualität, die ,handy‘ sagt, statt zeitgenössisch zu sein.
Fehlten mir nicht die finanziellen Mittel, ich würde gerne einen Preis aussetzen für den Entdecker jener Textstelle, an der Grünbein tatsächlich die Vokabel „handy“ affirmativ benutzt.
Liest man also Raddatz, sehnt man sich plötzlich nach Czernins Akribie zurück. (Oder man grübelt über Hermann Kortes KLG-Artikel zu Grünbein nach, der Falten und Fallen – ganz im Gegensatz zu Raddatz, aber im Einklang mit Czernin – als offenkundiges Exempel eines lyrischen „Akademismus“ dekouvrieren will.)
Die beunruhigendsten Zweifel an der Könnerschaft des Poeten Grünbein, die selbst an einem beharrlichen Verteidiger des Autors nagen, verdanken wir aber nicht Czernin, Raddatz oder Korte, sondern Grünbein selbst. Als mich Bert Papenfuß in einer erwiesenermaßen heiteren Nacht im Rahmen des Münsteraner Lyriker-Treffens auf ein Wochenpost-Interview Grünbeins hinwies (Nr. 18, 27.4.1995), glaubte ich zunächst eine Parodie vor mir zu haben. Jeder zweite oder dritte Satz des „großen deutschen Dichters“ las sich wie eine infame Imitatio Grünbeinscher Weltläufigkeiten. Leider erwiesen sich diese Sentenzen über Literatur und Tiefseetauchen als deprimierend echt.
Der Interviewte porträtierte sich als „open-waterdiver“ in der Tradition Kapitän Nemos, der in sieben Tauchgängen nicht nur der Tiefsee, sondern gewissermaßen der gesamten Geistesgeschichte die Geheimnisse entreißt: „Ich habe inzwischen die ersten Moränen und Tintenfische besucht.“ Wer im ersten Befremden glaubt, das Abenteuer des Tauchens sei bei Hans Hass besser aufgehoben, wird in der Folge von Grünbein mit noch waghalsigeren Abenteuern bedacht:
Ich bin sozusagen schon vor Jahrhunderten mit Odysseus durchs Mittelmeer unterwegs gewesen oder auf Dantes Höllenreise, an der Seite Vergils.
Man sieht, der Mann hat schon was erlebt. Aber auch gute Dichter haben das Recht, beim beschleunigten Überfliegen von geistigen Gebrauchsgegenständen mitunter abzustürzen.
Michael Braun, Oktober 1995, Schreibheft, Heft 46, November 1995
Falten und Fallen III
Seit Mai letzten Jahres gibt es eine fast sensationell zu nennende Lyrik-Debatte, ausgefochten auf den hintersten Seiten zweier Ausgaben des Schreibhefts, die seltsamerweise in den Feuilletons ohne Resonanz blieb. Und zwar geht es um den vielerorts als ,Götterliebling‘ und ,lyrisches Junggenie‘ gefeierten Durs Grünbein. Noch bevor der mit Preisen und Stipendien Überhäufte als Krönung den Büchner-Preis erhielt, veröffentlichte der Wiener Franz Josef Czernin, ein strenger Experimentallyriker, im Schreibheft Nr. 45 einen umfangreichen Totalverriß von Grünbeins vermutlich bestem Gedichtband Falten und Fallen. Was immer Czernin zu dieser Attacke bewogen haben mag – Ärger über den Opportunismus der Literaturkritik oder trivialer Futterneid –, seine Polemik ist scharfsinnig aufgebaut, detailgenau und nicht so einfach beiseite zu wischen. (…)
Im jüngsten Schreibheft (Nr. 46) reagiert der Götterliebling verschnupft und wirft seinem Verfolger ein „verranntes Weltbild“ vor, restauratives Festhalten an den „Öden der Abstraktion“ und modernistische Selbstkastration. (…)
Es ist das Verdienst von Czernins Polemik, uns den Blick für Grünbeins modisch-weltläufigen Gebrauch komplizierter Fachtermini und metaphorische Fügungen geschärft zu haben.
Michael Buselmeier, Frankfurter Rundschau
Ein Dichter schreibt in einer renommierten Literaturzeitschrift einen Aufsatz über die Texte eines anderen, in dem er zu beweisen sucht, daß diese keine gute Lyrik seien. In der nächsten Nummer der Zeitschrift sind dann die Repliken des gescholtenen Dichters und eines Literaturkritikers abgedruckt.
Eigentlich ein Grund zum Jubeln in einer Zeit, in der auch das literarische Leben nach dem Motto des ,anything goes‘ funktioniert: Endlich einmal eine Diskussion über Literatur, so hofft man, in der es um spezifisch literarische Fragen geht, um literarische Vorgehensweisen, Programme und Qualitäten. (…)
Doch der Freudenschrei bleibt einem beim Lesen der Repliken auf Franz Josef Czernins Schreibheft-Aufsatz über Durs Grünbein im Halse stecken: Anstatt zu argumentieren, mischen sich hier Schläge unter die Gürtellinie mit Mißverständnissen, die aus einem Unwillen gegen genaues Lesen resultieren.
Schade, denn Czernins Text wäre eine ausgezeichnete Basis für einen Diskurs gewesen. Denn wie auch immer man zu seinen Urteilen stehen mag, und ob man nun ihn oder Grünbein für den besseren Dichter hält: Czernins Aufsatz hat die unübliche und unschätzbare Qualität, die poetologische Basis mitzuliefern, auf der er argumentiert. Er legt offen, welche Voraussetzunqen gute Lyrik seiner Ansicht nach erfüllen sollte, und kritisiert auf genau dieser Grundlage die Gedichte von Durs Grünbein. Sein Text ist damit vor allem auch ein Angebot, über diese Grundlagen und Voraussetzungen von Lyrik zu diskutieren – ein Angebot, das leider nicht angenommen wurde.
Über Grünbeins Antwort an Czernin ist nicht viel zu sagen; er hat ein gewisses Recht, beleidigt zu sein, und man darf ihm vielleicht deshalb die Unschärfe seiner Argumentation verzeihen. Nur eine seiner Formulierungen könnte einem sauer aufstoßen: Er bezeichnet Czernins Text als „ungebetene Rezension“.
Ja, waren denn bislang alle anderen Grünbein-Rezensionen „erbetene“? Vom Autor „erbetene“? Sollte es etwa ein Komplott des Lobhudelns zwischen Grünbein und beispielsweise den Rezensenten der FAZ geben, die ja bekanntlich maßgeblich an der Installation Grünbeins als Dichter des Jahres beteiligt waren? Ganz sicher nicht, denke ich, denn wenn man so etwas annehmen würde, müßte man ja den letzten Rest des Glaubens an die Literaturkritik verlieren. Vermutlich ist Grünbeins Formulierung eine Art „Freudscher Verschreiber“ – vielleicht wollte er einfach nur sagen, daß Czernins Kritik unerwünscht sei, und daraus ist ihm „ungebeten“ geworden.
Schwerer als Grünbeins immerhin verständliche Reaktion auf einen Verriß wiegt der Versuch des Literaturkritikers Michael Braun, den gerade aufkeimenden Diskurs wieder abzuwürgen – abzuwürgen nicht, weil er sich auf die Seite Grünbeins stellt, sondern weil er implizit Czernin die Berechtigung abspricht, einen solchen Diskurs überhaupt zu eröffnen.
Auch Braun gibt zwar vor, sich darüber zu freuen, daß es endlich wieder einmal eine Lyrik-Diskussion gebe. Doch schon in seinem zweiten Satz unterstellt er Czernins Grünbein-Kritik mit einem wahren Killer-Argument niedere Motive: Die „Nobilitierung“ Grünbeins zum Junggenie, so schreibt er, habe nun auch „in Wien und Umgebung den branchenüblichen Futterneid provoziert“.
So kann man natürlich jeden Kritiker zum Schweigen bringen: Man behauptet einfach, der Grund für die Kritik seien die zu hoch gehängten Trauben. Und mit dem Wort „Futterneid“ läßt Michael Braun auch erkennen, welche Art von Trauben er meint: Er nimmt – vermutlich zu Recht – an, daß die Alimentation Czernins durch Verlagshonorare und Preisgelder um einiges geringer ausfällt als die Grünbeins. Er unterstellt damit Czernins Kritik letztlich ein ökonomisches Interesse: Der auf dem Literaturmarkt weniger Erfolgreiche will dem Branchenführer an den Karren fahren. Unausgesprochen steckt dahinter das ökonomische Postulat: Gut ist, was Erfolg auf dem Markt hat.
Sicherlich hätten Brauns Einleitungssätze anders klingen müssen, wäre der Grünbein-Kritiker nicht Czernin, sondern ein von Literaturpreisen verwöhnter Großdichter gewesen. Was dieses Argument allerdings mit Literaturkritik zu tun haben soll, bleibt unklar – und unklar bleibt auch, wieso Michael Braun es benutzt. Völlig unverständlich schließlich ist nach dieser Einleitung, weshalb sich Braun noch auf zwei weiteren Seiten mit Czernins Text auseinandersetzt, wenn dieser nur das eifersüchtige Pamphlet eines Neidhammels ist.
Kein Wunder, daß nach einer solchen Einführung auch die weiteren Ausführungen des Kritikers Braun an der Argumentation des Dichters Czernin vorbeigehen. Einer von Czernins Haupteinwänden gegen die Grünbeinsche Lyrik ist, daß dessen Texte traditionelle lyrische Formen naiv benutzen, ohne daß man eine Auseinandersetzung mit dieser Tradition erkennen könne. Als Beispiel führt er die Häufung von Genitiv-Metaphern an, Formulierungen wie „Masken des Wissens“, „Panzer der Sprache“, „Tiefen der Zeit“ und so weiter.
Braun kontert auf dieses Argument, es sei lächerlich, Genitivmetaphern zu verbieten. Czernin jedoch hatte nichts dergleichen im Sinn – er sagt nur, man könne Genitivmetaphern nicht so benutzen, wie Grünbein dies tue. Ganz sicher scheint sich allerdings auch Braun nicht zu sein, ob man diese Metaphern benutzen dürfe; zur Sicherheit postuliert er, sie seien bei Grünbein „ironisch gebrochen“ – eine Leerformel der Literaturkritik, die sehr beliebt ist – was immer sie auch bedeuten mag.
Schließlich findet Braun noch heraus, was der Hauptunterschied zwischen Czernin und Grünbein sei: Gestützt auf eine Selbstaussage Grünbeins behauptet er, dieser habe im Gegensatz zu Czernin eben kein ,Programm‘. Nun ist es zwar das gute Recht eines Dichters, kein Programm haben zu wollen, aber als Literaturkritiker, also als einer, der über Literatur nachdenken sollte, müßte Braun wissen, daß kein Programm haben zu wollen, auch ein Programm ist – und zwar ein sehr naives.
Doch nicht nur, daß Czernin ein Programm hat – erschwerend kommt für Braun offenbar hinzu, daß es auf „Wiener Sprachskrupeln“ beruht. Braun meint damit, so darf man vermuten, die Tradition der für ihn altmodischen Wiener Gruppe und ihrer Nachfolger. Etwas lächerlich zu machen, ist eben auch ein probates Mittel, Auseinandersetzung zu vermeiden.
Gegen Ende seines Textes versucht Michael Braun dann noch schnell, seine Objektivität zu beweisen: Einige von Grünbeins Stilmerkmalen hätten auch bei ihm schon hinsichtlich ihrer Qualität Kopfzerbrechen ausgelöst. Ob dieses Kopfzerbrechen irgendwelche Ergebnisse hervorgebracht hat, darüber läßt er den Leser allerdings im Dunklen.
Genug der Beispiele. Ärgerlich ist nicht so sehr, daß Braun dem argumentativen Niveau Czernins nicht gewachsen ist. Ärgerlich ist, daß er durch die Art seiner Argumentation nicht nur diese aktuelle Lyrik-Diskussion brachial abzubrechen versucht, sondern in der logischen Konsequenz auch jeden weiteren inhaltlichen Literaturdiskurs unmöglich macht. Denn wollte man ihm folgen, könnte man fast jedem Dichter, der über Grundlagen und Qualitäten von Literatur nachzudenken beginnt und dabei zwangsläufig Negativ-Beispiele von Kollegen benutzt, Futterneid vorwerfen. Und greift dies nicht, dann findet man schon die verstaubte Schublade, in die man den aufmüpfigen Dichter stecken kann und die seine Äußerungen obsolet macht.
Die Diskussion ist damit bequem beendet, und man braucht nicht länger mühsam nachzudenken über Literatur. Die Dichter dichten wieder, die Kritiker loben oder tadeln, die Leser lesen, was die Kritiker loben, und es herrscht wieder Ruhe in der literarischen Provinz.
Michael Müller, Deutschlandfunk
Schreibheft, Heft 47, Mai 1996
Fritz Gimpl: Quem Jucat. Anmerkung zu F. J. Czernins Essay- und Dichtkünsten.
Christina Rossi: Czernin vs. Grünbein (1995) = Schiller vs. Bürger (1791)
Mit besseren Nerven als jedes Tier
− Das neue kommt über Nacht: Der Dichter Durs Grünbein, der naturgeschichtliche Blick und der Berliner Weltalltag. −
Am 12. November 1989 schrieb der damals siebenundzwanzig Jahre alte Ost-Berliner Dichter Durs Grünbein ein paar Zeilen, die, wie man jetzt sieht, eine neue Epoche in der deutschen Literatur eröffneten:
Komm zu dir Gedicht, Berlins Mauer ist
offen jetzt.
Wehleid des Wartens, Langweile in
Hegels Schmalland
Vorbei wie das stählerne Schweigen…
Heil Stalin.
Letzter Monstranzen Glanz, hinter Panzern
verschanzt.
Langsam kommen die Uhren auf Touren, jede
geht anders…
Hier ist sie wieder, die in Ernüchterung, Sorgen und Zank fast vergessene Nacht, in der kaum einer schlief. Man kann diesen Versen ihre grellen Effekte, das heftige Stabreimen, die Überschmückung durch Binnenreime nicht übelnehmen. Das Gedicht hat die Eingängigkeit eines Rocksongs, die Frechheit des Beat, und in der klirrenden, etwas albernen Zeile „Letzter Monstranzen Glanz, hinter Panzern verschanzt“ zersplittert ein Weltsystem fröhlich.
Das Gedicht von 1989 zeigt schon das ganze Geheimnis von Durs Grünbeins Erfolg in den Jahren seither. Dieser Erfolg ist nicht gerade beispiellos, doch muß man zu hohen Vergleichen greifen, um ihn zu beschreiben. Seit den Tagen des jungen Enzensberger, ja, vielleicht seit dem ersten Auftreten Hugo von Hofmannsthals hat es in der deutschsprachigen Lyrik einen solchen alle Interessierten hinreißenden Götterliebling nicht mehr gegeben. Wo immer Grünbein liest, begeistert er sein Publikum. Die Kritik hat seine ersten Bände, die Grauzone morgens von 1988 und die Schädelbasislektion von 1991 (aus ihr stammt das Gedicht zum Mauerfall), mit wachsender Zustimmung aufgenommen. Überrascht entdeckte sie den souveränen Rückgriff auf die klassische Moderne, auf den hohen Anspruch von T.S. Eliot, Pound und Williams. Die anspruchvollsten Literaturzeitschriften drucken ihn, Preise, Stipendien, Einladungen an die German Departments in aller Welt ließen nicht auf sich warten.
Es gebe, so erklärte Hans Magnus Enzensberger vor fünf Jahren an dieser Stelle, in jeder Gesellschaft eine konstante Zahl von Lesern anspruchsvoller Lyrik; sie belaufe sich in der Regel auf 1354 Individuen. Dies wird auch im Falle Grünbeins nicht anders sein. Doch wenn die Begeisterung der 1354 Leser einhellig ist, pflegt der Name selbst eines schwierigen Dichters über diesen Kreis hinaus in die Öffentlichkeit zu dringen. An der Schwelle zu solchem Ruhm steht, wenn nicht alles täuscht, Durs Grünbein.
Die äußere Konstellation dieses Erfolges ist leicht zu beschreiben. Grünbein ist der erste Dichter, der die Spaltung der deutschen Literatur überwindet. Jetzt, wo er da ist, erkennt man sofort, daß dies nur einem jungen Autor aus dem Osten gelingen konnte. Das ist keine Frage nationaler Gefühle oder politischer Einstellungen, keine der Ideologien oder gar des muffigen Identitätsdiskurses, mit dem eine ideenlose Politik eine phantasielose Literatur infiziert; es ist eine Frage der Erfahrungen und der daran geknüpften Sprache. Nur ein Schriftsteller aus dem Osten ist gezwungen, mit beiden Erfahrungen zu Rande zu kommen: der östlichen seiner Herkunft, der westlichen seiner Zukunft. Für die jungen Autoren des Westens sind der alte Osten und sein Untergang bestenfalls ein politisches Thema. Auch ältere Schriftsteller aus beiden Teilen des Landes, die – wie Heiner Müller, Christa Wolf oder Martin Walser – auf die Wiedervereinigung literarisch reagierten, behandeln sie vor allem historisch und politisch. Der Zusammenbruch des Ostblocks beeinflußte in dieser Generation eher die Weltbilder als die Sprache.
Ganz anders liegt der Fall bei Durs Grünbein. Man tut ihm geradezu Unrecht, wenn man ihn allzu eng mit der literarischen Situation im neu vereinten Land verbindet. Sie ist gewiß das Bedingende, das seiner Erscheinung die Kontur gibt. Der Kern seines dichterischen Strebens ist darauf aber keineswegs festzulegen. Politik und Geschichte sind nicht eigentlich Grünbeins Themen; die historische Sphäre steht nur im Zentrum seiner viel weiter gespannten Erfahrungen. Er reagiert auf die neue Situation des Landes ästhetisch und anthropologisch. Sein Iyrisches Ich ist nicht öffentlich. Schon das ist eine Wohltat nach den langweiligen Stellvertreteranmaßungen vieler Schreibender.
Das Gedicht zur Maueröffnung zeigt es: Es ist nicht die Beschreibung eines politischen Vorgangs, sondern die Feier eines Moments, in dem sich die Zeitmaße ändern. Seine Form zeigt das Zusammenfließen: Das Vokabular ist östlich, der Gestus ist westlich, schon halb ironisch. Grünbein ist der erste östliche Dichter, der sich dem Westen mit vorbehaltloser Neugier zuwendet, mit einem Erfahrungshunger, der hier kein Gegengift zur Langeweile des Posthistoire ist, sondern die Lebensgier des der Provinz Entflohenen. Dieser Dichter ist in der Metropole angekommen.
In einem kurzen Essay „Transit Berlin“ hat Grünbein die neue Metropolenerfahrung umrissen:
Gegen die nostalgischen Monologe, süchtig über leere Plätze irrend, gegen den Phantomschmerz angesichts von ausradierten Straßenzügen, plattgemachten Lebenswelten, verschütteten Friedhöfen macht sich das Okay der Jungen geltend, ihre frische Zuversicht, ihr Appetit auf Moden, Techniken, Konzepte, und steht fast zynisch da. Ihr insgeheimes Credo ist das Rundumoffensein, triebhafte Wachsamkeit inmitten einer Dingwelt, in der das Ich millionenfach zerlegt und aufgelöst wird in ein Vielerlei von Reizen. Der neue Künstler hat kein Programm mehr, sondern nur noch Nerven. Stil ist allenfalls noch ironisch spielerische Tarnung oder Mimikry, insektenhafter Bewegungablauf im Zwielicht von Gewächshausnachmittagen. Zwischen Nekrophilie und Neurologie führt ihn sein Weg im Zickzack durch die urbanen Gefahrenzonen, nicht anders als der von Kinderbanden, die ihre Zeit mit Autojagden, S-Bahn-Surfing oder Kaufhaus-Piraterie verbringen.
Solche Neuauflage von D’Annunzios Maxime „Lebe gefährlich“ mag naiv berühren. Doch der Impetus ist ernst, und die Wahrnehmung wirkt glaubwürdig. Hier beginnt wirklich etwas Neues, und Grünbeins Erfolg zeigt, daß wenigstens ein Teil des Publikums eine Literatur satt hat, deren wichtigster Inhalt das Hadern und Beleidigtsein über die deutschen Dinge ist. Die neue Ausrufung einer spätzeitlichen Nervenkunst ist, hundert Jahre nach dem letzten Fin de siecle, eine ernstzunehmende Absage an alle Ideologie. Grünbein ist der erste junge Autor aus dem Osten, den auch Westleser nicht pflichtschuldigst gepeinigt in der deutsch-deutschen Sprechstunde zuhören, sondern als einen der Ihren wahrnehmen können. Dabei ist es nicht so, daß Grünbein die Welt seiner Herkunft vergäße oder verleugnete. Gerade der neue Band Falten und Fallen beschwört sie noch einmal mit suggestiven Bildern. Doch er behandelt sie eben nicht global und geschichtsphilosophisch, sondern übersetzt sie in Kindheit, Abenteuer und Autobiographie:
Undenkbar daß ein Kind, beim
Ausflug auf seinem neuen Fahrrad,
Hinter dem Drahtzaun dem fernen
Kirgisen im Wachturm
Dem sibirischen Posten nicht winken
sollte, so nah.
Überall gab es Tatorte, graue Regionen.
Ein kalter Atlas
Wuchs mit der Kopfhaut über Nacken und Stirn,
Mit jedem Gesichtsnerv, vom Regen,
erregt,
bis man das Rauschen von innen erkannte:
den Osten,
Die bleiernen Flüsse, die Ebenen,
diese Erde im Dauerfrost,
Alles was groß war, verloren und weit
bis nach Wladiwostok.
jeder Schuß zog einen Strich durch den
offenen Raum, eine Naht,
An der entlang man sich trennen lernte,
jedesmal etwas leichter,
Von den verwilderten Gärten, den
entdeckten Verstecken im Wald.
Diese melodisch weit ausschwingenden Verse sind Teil eines „Trigeminus“ überschriebenen Zyklus. In diesem „Gesichtsnerv“, nicht in den Formeln der Politik sucht und findet Grünbein seine Geschichte, die seiner Generation, und solcher Nervenwahrnehmung, will er sie mitteilen.
Die äußere Bedingung von Grünbeins singulärer Stellung ist der Erfahrungssynkretismus der zusammengeschlossenen Landesteile. Doch die innere Berechtigung und damit die Wirksamkeit seines Erfolges muß natürlich in seinem Talent liegen und in seinem poetischen Ansatz. Sein Talent ist jetzt, nach drei Gedichtbänden, kaum noch bezweifelbar. Grünbein produziert mit fast beunruhigender Geläufigkeit. Er verfügt über eine reiche Tonskala vom leicht Gesprochenen bis zum ganz Feierlichen. Er ist belesen in hohen und niederen Sphären, er kennt das Schräge und beherrscht auch das Komische. Wenn von seinen bisher dreihundert Seiten nur dreißig absolut gut sind, ist der jetzt zweiunddreißig Jahre alte Grünbein ein beachtlicher Autor. Es spricht alles dafür, daß er diese Hürde spielend nimmt.
Sein Talent ist groß, sein Ansatz fast mathematisch überzeugend. Grünbein sieht unsere Welt mit dem Blick der Naturgeschichte, den Menschen als unglückliches Tier, die Zivilisation als Wucherung der Erde. Sein lyrisches Ich, das nicht öffentliche, soll das kindliche Gattungs-Ich dieses unglücklichen Tieres sein, also etwas ganz Allgemeines und zugleich ganz Intimes. Er bewegt sich, wie er sagt, durch den anthropologischen Alltag wie durch einen „phantastischen, zoologischen, vegetativen Raum, in dem jeder allein war, mit sich, der Zeit und den Zeichen. Es war derselbe Raum, in dem sich Tiere bewegten.“
Dieser Wahrnehmungspunkt überzeugt, weil er zwei Gefahren meidet, eine westliche und eine östliche. Er verarbeitet die westliche Reizüberflutung und relativiert die östlichen Unglückserfahrungen. Grünbein sieht aus der Ferne, wo die Dinge vielleicht schrecklich erscheinen, aber immer auch schön. Und er mikroskopiert in der Nähe, wo der augenblickliche Weltalltag sich in gerade noch mitteilbare körperliche Erfahrung übersetzt. Schön ist zum Beispiel die indirekte Konfrontation der biographischen Lebenszeit mit dem möglichen Alter einer Landschaft und den Zeitmaßen der Gattungsgeschichte beim Baden in einem Baggersee:
In der Haltung von Fröschen, faulenzend, zogen wir Kreise
Zwischen Ufern kaum älter als wir.
Das eigentlich Neue an Grünbeins Lyrik ist aber, daß der naturgeschichtlich-körperliche Blickpunkt in seinen Gedichten nicht nur zu Bildern der Spaltung führt. Zwar ist der Verlust tierhafter Sicherheit und naturhafter Einheit bei ihm so scharf gesehen wie nur je in moderner, nachidealistischer Dichtung. Der neue Band enthält Tiergedichte, deren Trauer mit den Vorläufern bei Baudelaire und Rilke wetteifert. Selbst die Geborgenheit im Mutterleib gerät unter Verdacht. Das Gedicht „In utero“ beginnt so:
Niemand berichtet vom Anfang der Reise,
vom frühen Horror
Betäubt in den Wassern zu schaukeln,
vom Druck
In der Kapsel, vom Augenblick, der sie
sprengt.
Wochenlang blutig, und das Fleisch
wächst amphibisch
Zuckend wie die Frösche Galvanis
in Folie eingeschweißt.
Weit überraschender aber sind Momente einer höheren Unbewußtheit, deren Quelle Beiläufigkeit ist, die Erfahrung einer körperlichen Routine, die normalerweise der bewußten Erfahrung entzogen ist. Daher muß auch der Ton des Gedichts sowohl harmonisch wie zurückhaltend sein. Grünbein schafft das Kunststück:
Ein Nichts an Körper und ganz
allgemeiner Atem,
Gehörte ich den andern eher als mir selbst,
Erwacht zu Alltagsseligkeit. In solcher
Frühe
Ein unbekanntes Tier, vergaß ich meinen
Weg.
Der Preis solcher Harmonie ist nicht nur das Vergessen, sondern überhaupt der Verzicht auf Ich-Kontinuität. Eines der überzeugendsten Gedichte in Grünbeins neuem Band ist das titelgebende, das solche zweite Tierhaftigkeit als zeitgenössische Existenzform entwirft:
Leute mit besseren Nerven als jedes Tier,
flüchtiger, unbewußter
Waren sie’s endlich gewohnt, den Tag
zu zerlegen. Die Pizza
Aus Stunden aßen sie häppchenweise,
meist kühl, und nebenbei
Hörten sie plappernd CDs oder föhnten das
Meerschwein,
Schrieben noch Briefe und gingen am
Bildschirm auf Virusjagd.
Zwischen Stapeln Papier auf dem
Schreibtisch, Verträgen, Kopien,
Baute der Origami-Kranich sein Nest, eine
raschelnde Falle.
Jeder Tag brachte, am Abend berechnet
ein anderes Diagramm
Fraktaler Gelassenheit…
Es gibt kein anderes Gedicht, das ein bestimmtes, in den westlichen Großstädten gewachsenes und noch nie beschriebenes Lebensgefühl so in Klänge und Bilder brächte wie dieses. Es zeigt, auch in seinen leise komischen und prätentiösen Zügen, den poetischen Gewinn von Grünbeins Wahrnehmung rein; ebenso rein wie seine Kindheitsphantasmagorie vom offenen Raum des Ostens. Er überprüft die beiden Erfahrungen an einem dritten Ort: in seinem Körper. Nur im Vorbeigehen ist darauf hinzuweisen, daß ein paar der schönsten, aber auch privatesten Gedichte seines neuen Bandes Liebesgedichte sind.
Grünbeins größte Gefahr ist, daß ihm seine Wahrnehmung zum Programm wird. Er hat eine fatale Neigung zum technoiden und pseudowissenschaftlichen Vokabular, und gelegentlich wird die Nervenkunst zur Neurologie. Bloße Worte müssen dann für eine Sache einstehen, die sich nicht mehr mitteilen läßt. Der Kurzschluß vom Mythos zur Naturwissenschaft, das nur zitierte „mathematische Mandala“ bleibt Lautgeklingel. Prunk mit dem Wissen und eine leichte Großmäuligkeit führen zu unfreiwillig komischen Effekten: „Röntgen strahlt Bering ins Stirnbein / Rorschach erstellt das Psychogramm Magellans. / Columbus’ IQ hält den Staat in Schach.“ So etwas sollte nicht schreiben, wer Ekstase mit x buchstabiert und nicht das Herrenparfüm meint. Man möchte Grünbein an solchen Stellen einen lauten „Pfiff ums Eck“ geben, da er vor einem solchen an anderer Stelle heftig erschrickt.
Am besten ist er, wo er sich fast unauffällig macht, in Momenten der Verstörung, die den Angstgrund, der auch unter dieser Dichtung liegt, hörbar machen. Der neue Band enthält eine „Alba“, ein Tagelied, das einen fahlen, unglücklichen Morgen – die Stunde schmerzhaftester Empfindlichkeit, in deren Grauzone Poesie erwächst – in eine tonlose Musik bringt, einfach und rätselvoll:
Endlich sind all die Wanderer tot
Und zur Ruhe gekommen die Lieder
Der Verstörten, der Landschaftskranken
In ihren langen Schatten, am Horizont.
(…)
Und das Neue, gefährlich und über Nacht
Ist es Welt geworden. So komm heraus
Aus zerwühlten Laken, sieh sie dir an,
Himmel, noch unbehelligt; und unten
Aus dem Hinterhalt aufgebrochen,
Giftige Gräser und Elstern im Staub,
Mit bösem Flügelschlag, Diebe
In der Mitte des Lebensweges wie du.
Gustav Seibt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.3.1994
Lyrischer Landesmeister
− Balanceakt zwischen tönender Rhetorik und Großer Poesie. −
Literarisch, so kündet ein verbreiteter Mißmut, habe die deutsche Zusammenlegung vorerst nicht viel gebracht. Nichts außer Enttäuschungen und Anklagen, Streit, Abrechnungen und jeder Menge kleinmütigem Gemaule. Das ist natürlich keine Kunst, doch auch nicht unbedingt ihr Gegenteil. Orientierungsschwierigkeiten eben, und die sollten erlaubt sein. Staatsaktionen finden nicht in Musentempeln statt, und wenn sie auch an den Nerven der feinen Geister zerren, so heißt das nicht, daß dabei etwas poetisch Nennenswertes herauskommen muß. Die deutschen Dichter sehen gegenwärtig nicht viel mehr als ihre Kritiker, was ihnen letztere mitunter heftig übelnehmen. Von dieser Stimmung profitiert Durs Grünbein (geboren 1962 in Dresden, ansässig im östlichen Berlin). Was nicht heißen soll, daß seinem großen Talent nicht jede Lesergunst zu gönnen wäre. Doch vor dem matten Hintergrund erstrahlt sein Licht besonders hell. Götterliebling wurde er jüngst genannt und mit dem jungen Enzensberger verglichen, der sich die Götter seinerzeit bestimmt verbeten hätte. Trotzdem: Man muß nicht gleich mit Epochenbewußtsein rezensieren, um Grünbein dennoch für die wohl wichtigste deutsche Lyrik Entdeckung seit 1989 zu halten. Als 1991 sein zweiter Gedichtband Schädelbasislektion erschien (nach Grauzone morgens, 1988), hatte er alle Aufmerksamkeit für sich. Es wurde sogleich deutlich, daß er deutsch deutsche Themen nicht auf dem Reißbrett vorgefertigter Fragen und Antworten verhandelte. Er ließ sich nicht ein auf die, wie streitbar oder subversiv auch immer angelegten, Dialekte der abgezirkelten Konfrontation. Dagegen hielten seine Bilder und Metaphern mit erstaunlicher Entschiedenheit und kühler Präzision die Waage zwischen Empfindung und Befund, lebhaftem Aufbegehren und wissenschaftlich inspirierter Phantasie.
Grünbein rechnete nicht ab mit DDR Verhältnissen, er rechnete sie hoch auf anthropologische Gegebenheiten. Das zerfallene Regime lieferte ihm zwar manchen Stoff, nicht aber die Bedingungen seiner Sichtweise. Das bekräftigt sein neuer Gedichtband mit allem Nachdruck. Schon der Titel Falten und Fallen kündigt das mit unverblümter Bissigkeit an (wobei es sich bei den Falten um jene rückschlägigen Biegungen des Zeitpfeils handelt, die alle frohgemute Fortschrittslaune düpieren). Wer als historischer Siegertyp die grauschwarzen Farben in der Rede des Dichters nur auf die Verhältnisse jenseits der abgeräumten Mauer beziehen wollte, der kann mit seiner poetischen Tagespolitik nun einpacken. Die Pawlowschen Hunde kläffen auch vor den nach Westen geöffneten Horizonten. Als Wappentiere der Indoktrination, als Wächter der dressierten Herde bleiben sie für Grünbein nach wie vor die treuen Begleiter des konditionierten Menschen. Und auch die gewonnene Bewegungsfreiheit (über Längen und Breiten) findet bei ihm nur statt im größeren, besser sortierten Supermarkt der Oberflächenreize. Gleich das erste Gedicht hebt an mit der Frage „Fortfahren wohin?“ und gibt die Ausstattung des gewonnenen Terrains bekannt:
Zug um Zug einer neuen Erregung entgegen, einem Gesicht
Zwischen den Zifferblättern Im Schaufenster, Brillen für Liebe,
Für schärferes Fernsehn, Särge und Möbel zum schnelleren Wohnen
Zwar ist das die alte, nicht sonderlich überraschende Grundmelodie von der Entfremdung in der Warenwelt. Doch sei das dem Autor verziehen, da er sich dessen sehr bewußt zu sein scheint, wenn er die ganze, von diesem Gedicht eingeleitete Reihe mit „Variation auf kein Thema“ überschreibt. Es sind Bestandsaufnahmen und Erkundungen, Neueinstellung des Blicks in veränderter Situation. Die ganz andere und womöglich bessere Welt ist nicht mehr das Versprechen jenseits der Mauer; die systemspezifische Illusion ist mit der Grenze gefallen. Kein Thema. Nirgends. Kein Rat, keine Dialektik, kein Durchblick. Aber freiliegende Nerven als Fremdenführer durch die fremde Welt. Die Kenntlichkeit der Widersprüche hat sich verflüchtigt. Zu verstehen gibt es wenig. Klügeleien helfen nicht weiter. Doch findet sich alles eingezeichnet in die Nervenbahnen, wie das Urteil in den Körper des Delinquenten aus Kafkas Strafkolonie.
Unübersehbar ist allerdings zugleich: Hier liegen auch im Hinterhalt Gefahren, denen der Dichter nicht selten mit Karacho in die Arme rennt. Denn vieles, wie auch diese beispielhaften Verse, präsentiert sich allzu selbstsicher zwischen abgefeimter Manier und hohem Orgelton, als wolle da ein lyrischer Landesmeister so richtig auf die Pauke hauen.
Da Grünbein gleich unsere ganze Zivilisation ins Auge faßt, versteigt er sich oft allzu leichtsinnig – „Fröstelnd unter den Masken des Wissens“ – in tönende Rhetorik, der man dann doch kein Wort so richtig glauben mag. Sein Talent zeigt sich am sichersten in der Form, in Rhythmus und Pointierung, und dort, wo nicht Gedanken, sondern Beobachtungen, Erfahrungen durchscheinen.
Ein bißchen rhetorisch klang schon jenes Aufatmen in Schädelbasislektion:
Komm zu dir Gedicht, Berlins Mauer ist offen jetzt
Warum solche Agitprop Parolen, konnte man damals fragen, doch hat im Fortschreiben dieser Satz immerhin an Sinn hinzugewonnen. Das Gedicht ist heraus aus dem Schatten der Grenzen befreit von den latent wirksamen Dissidentenfantasmen des Systems. Was es nun zu formen gilt kann seine Brisanz auch ohne solchen Gegendruck beweisen. Da ist das lyrische Ich voller Fragen: „Was?“, „Wohin?“ „Ohne Auftrag und unter niemands Vaterblick“ teilt die Conditio humana sich dem Neuankömmling als die alte, der Westwelt vertraute Misere mit: „Das Gefühl, daß nichts fehlt, ohne dich“. Eine veränderte Funktion kommt dem Gedicht zu, und von fern tönt das Echo der Kunstreligion aus den Zeiten, da die transzendentale Obdachlosigkeit noch eine Entdeckung war: „Lächelnd und kaum entsetzt / Suchst du in alphabetischen Gebeten Halt“
Den Halt liefert die strenge, genau bemessene Formensprache, in der diese Gedichte Rechenschaft über diffuse Erfahrungen ablegen. Doch mit dem Vermessen der neuen, neonbestrahlten Welten erschließt sich zugleich die Einsicht, daß es auch dort an Zwängen nicht mangelt, wo die Freiheit oft bloß ein Reklamewort ist. Denn der emotional nur mäßig beheizte Raum des Subjekts zwischen dem blutig zerkratzten Selbstportrait im Rasierspiegel und den gleichgültig drüber hinziehenden Wolken – vor ihrer Trägheit „wird alles absurd“, das ist nur die eine Sphäre dieser Gedichte.
Die andere wird dominiert vom Maschinencharakter der Welt, von den Kodierungen, den Apparaturen, in denen zappelnd das Subjekt bemerkt, daß es mit seinem – und sei es verzweifelten – Eigenwillen nicht weit her ist: Die Körper exponieren ihre „biologische Blöße“, sie wimmeln in „Brownscher Bewegung“ (der Moleküle), es singt der „genetische Chor“. Damit zieht Grünbein seiner Poesie einen zeitanalytischen, quasi theoretischen Boden ein. Konditionierte Reflexe, Gefangenschaft im „Panzer der Sprache“, Daseinsprogramme, graviert in die Großhirnrinde. So wird der Körper selbst zum Apparat, im Rhythmus der Verhältnisse zuckend, und der Dichter lauscht, wie es schon Nietzsche empfahl, der physiologischen Botschaft.
Gewiß: Diese objektivistischen Konstruktionen haben zuweilen etwas Spekulatives, verwechseln die metaphorische Radikalisierung manchmal mit scientifischer Orakelei. Und die Verabsolutierung der damit einhergehenden Befunde scheint die vitale Einsichtsfähigkeit hin und wieder an die gewollte Methode zu verraten. Die versierte Gelassenheit, mit der Grünbein seine Diagnosen ausstellt, macht mißtrauisch, gerade weil sie manchmal in so klirrenden Wortrüstungen daherkommen.
Dennoch mangelt es nicht an geglückten Versen und vor allem nicht an der Evidenz, daß Grünbeins schwieriger Balanceakt zwischen Formelhaftigkeit und großer Poesie hauptsächlich aus jener Auseinandersetzung resultiert, an die er sich herangewagt hat. Die Mauergrenze kaum hinter sich, schreitet er nämlich schon eine andere Grenzlinie ab, an der das zentrale Zeitproblem mit aller Schärfe hervortritt: die Frage, ob es gelingen kann, ein humanistisches Menschenbild zu bewahren, oder ob wir uns mit der Verwandlung zu technisch kompatiblen Mutanten abfinden müssen.
„Ein ästhetischer Idiot, ein politischer Mutant und ein geographischer Alien“ – so nennt Grünbein sich selbst. Hin und her gerissen zwischen den Kodierungen virtueller Maschinenwelten und der Körpersprache der Empfindungen, versteht er es jedenfalls, diesen Konflikt auf außerordentlich vielschichtige und bewegende Weise nicht nur zu instrumentalisieren, sondern auch zu beglaubigen. Bedarf es noch mehr, ihm einen Platz unter den wichtigsten jungen Poeten dieses Landes einzuräumen?
Eberhard Falcke, Die Zeit, 1.4.1994
Falten und Fallen
Heute wollen wir uns mit den neunziger Jahren beschäftigen, dem letzten Jahrzehnt jenes glorreichen Säkulums, in dem die Poesie von den Neurotikern in die Arme geschlossen und so lange nicht mehr freigegeben wurde, bis sie in deren Umhalsung schon zu röcheln begann. Als sie anfingen, die desillusionierenden Neunziger, dachte Ihr vielfach verdienter Prüfer vom Lyrik-TÜV noch, die Deutschen stünden mehrheitlich auf passablem Fuß mit ihrer Muttersprache, wenn auch mit unterschiedlicher Trittsicherheit und auf verschiedenen Ebenen der Befähigung. Am Ende des fraglichen Jahrzehnts hat er einsehen müssen, daß die einzige Ebene, auf der sich offenbar alle Mitglieder der deutschen Sprachgemeinschaft treffen, diejenige ist, auf der man kreischend und grunzend nach unten rutscht. (…)
*
Nun könnte manch einer natürlich glauben, der Lyriker Durs Grünbein sei die grünende Hoffnung für alle, die sich in diesen Jahren zweifelhafter Rechtschreibreformen und zunehmender Sprachverlotterung nach der guten alten Zeit sehnen. Und tatsächlich: In seiner Generation schreibt sonst keiner Verse von solch lindem Klassizismus wie die folgenden. Was natürlich auch daran liegt, daß es technisch gar nicht so einfach ist, fünf Strophen in dieser fein abgezirkelten Manier hinzukriegen.
Alter Erzengel, was nun?
Müde geworden? Dein Flammenschwert
Steht zur Auktion und die Flügel ruhn
Im Theaterfundus. Was ist er wert,
Dein heiliger Zorn, – ohne die Schranken,
Die der Hybris gesetzt sind. So leicht
Kommt hier nichts mehr ins Wanken.
Wen dein Arm nicht erreicht,
Soll der Strahlblick ihn strafen?
Lächerlich bist du, vergeßlich geworden.
Folter hast du, Geschäfte, verschlafen,
Das zeugenlose belustigte Morden.
Alzheimer: heißt so das Ende der Schrecken?
Kranker Engel, du weißt, was geschieht
Ist Geschichte, – danach. Laß sie stecken,
Deinen Bann, deinen Fluch. Wer dich sieht,
Lebt im Glück der Vertreibung. Das Böse
Gibt sich politisch. Es hat kein Gesicht.
Arbeitslos stehst du, taub im Getöse
Des Zeitvertreibs vor dem Jüngsten Gericht.
„Alzheimer Engel“ heißt das Gedicht aus dem 1999 erschienenen Band Nach den Satiren, bei dem sich Lyrikfreunde alter Schule scheinbar bedenkenlos unterhaken können. Das unsichere Neue wird hier mit Reminiszenzen an das gesicherte Alte umkreist. Schon die Mischung aus Dinggedicht und Engelskunde läßt unweigerlich an Rilke denken. Anders als bei Rilke macht das himmlische Wesen hier jedoch einen ziemlich irdischen, nachgerade ramponierten Eindruck. Die Idee, Gestalten aus der antiken Mythologie und der christlichen Glaubenswelt in zeitgenössische Zusammenhänge zu stellen, ist nicht neu. Vor Grünbein haben sich bereits ganze Kohorten von Lyrikern dieses Kunstgriffs bedient, mit sehr amüsantem Effekt zum Beispiel Peter Maiwald:
Es ist alles in Ordnung:
Nessos Hemd ist von Lacoste.
Kain sitzt im Resozialisierungskurs römisch vier.
Prokrustes ist eine Hotelkette.
Keine Erinnye darf wegen ihres Geschlechts
oder ihres Motivs benachteiligt oder verfolgt werden.
Die Trompeten von Jericho sind das Erkennungszeichen
von Abbruchunternehmern.
Midas ist ein Bankangestellter (…)
Durs Grünbein strebt eine weniger erheiternde Wirkung an. Schon der Titel deutet es an: „Alzheimer Engel“, das klingt ein bißchen nach „Isenheimer Altar“, wie ein Stück intakter Engelsmythologie also, nur daß „Alzheimer“ keinen realen, sondern einen geistigen Ort bezeichnet. Besser gesagt: einen Unort des Vergessens und der Weltferne, vor allem aber des schmerzlichen Traditionsverlustes. Entsprechend deutlich sind die kulturkritischen Akzente gesetzt. Mit zwei Zeilen steckt Grünbein das geistige Terrain so unmißverständlich ab, daß selbst ein Erstsemester verstehend nickt: Aha, Posthistoire.
Kranker Engel, du weißt, was geschieht
Ist Geschichte, – danach.
Was diese Nachgeschichte im einzelnen auszeichnet, haben wir anderswo schon in ähnlicher Diktion gehört:
(…) Das Böse
Gibt sich politisch. Es hat kein Gesicht.
Das klingt nun nicht mehr nach Lyrik für Erstsemester, sondern nach Lyrik von Erstsemestern – jener begabten Sorte, die mehr gelesen als erlebt hat. Gleiches gilt für das „Getöse des Zeitvertreibs“, das „zeugenlose belustigte Morden“ und einige ähnlich altkluge und gut abgehangene Formulierungen lyrifizierter Kulturkritik. Und noch eine Spezialität dieses Dichters läßt sich in „Alzheimer Engel“ besichtigen: DIE RHETORISCHE DONNERFRAGE. Wie heißt es gleich zu Beginn der vierten Strophe?
Alzheimer: heißt so das Ende der Schrecken?
Wer genau hinhört, merkt schnell: Die unschöne Realität einer Alzheimer-Erkrankung ist das letzte, worauf Grünbein sich jetzt ernsthaft einlassen möchte. Es geht ihm um den Effekt, der sich mit einer scheinbar so weitreichenden Frage erzielen läßt. Entsprechend ungerührt fährt das Gedicht fort. Die erwünschte Reaktion auf die DIE RHETORISCHE DONNERFRAGE lautet folglich nicht „ja“, „nein“ oder „vielleicht“. Sie besteht vielmehr im inneren Erröten eines imaginierten Ideallesers, der sich geschmeichelt fühlt, daß man ihn solcher Fragen für würdig befindet. Wer sich nicht blenden läßt, denkt vielleicht eher an einen prahlenden Youngster als an einen reifen Lyriker.
Unser Dichter freilich ist zum Zeitpunkt des Erscheinens nicht zwanzig, sondern siebenunddreißig Jahre alt, Büchner-Preisträger, Mitglied der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung und hochgefeiert als das herausragende lyrische Talent seiner Generation. Dürfen wir von ihm nicht etwas mehr erwarten als ein paar schmissig in Versform gebrachte Feuilletonphrasen „aus dem Theaterfundus“? Wir dürfen. Und deshalb will Ihr dienstbarer Lyrikprüfer kurz vor dem finalen Abschmieren rasch noch ein paar Kreuz- und Querzüge durch das Werk dieses Durs Grünbein unternehmen: um zu schauen, ob und wo dieser Dichter den hohen Erwartungen, die in ihn gesetzt werden, gerecht wird und wie es zu diesen Erwartungen überhaupt kam. Sozusagen das Epizentrum unserer Nachforschungen bildet der 1994 erschienene Band Falten und Fallen, mit dem Grünbein seinen Durchbruch erzielte. Doch auch was vorher war und was nachher kam, soll uns – wie immer beim Lyrik-TÜV – hinreichend beschäftigen.
*
Etliche Gedichte des Bandes Nach den Satiren schwanken, ähnlich wie der „Alzheimer Engel“, zwischen altkluger und altväterlicher Attitüde. In dem Gedicht „Club of Rome“ präsentiert Grünbein in knarzigem Altphilologen-Jargon Schmankerl von Anno dunnemals.
Tote Carthagos im Rücken, vor den Augen schneeweiß,
Die Alpen, ein Friedhof für Elefanten.
War nicht der Römer ein Überlebender, dem die Zeit
Ostwärts davonlief?
Tja, das ist nun auch wieder so eine fragwürdige Frage. Erneut setzt Grünbein auf das einverständige Kopfnicken humanistisch vorgebildeter Menschen, denen ein paar nostalgische Reminiszenzen wichtiger sind als ein eigenständiger Gedanke. Auch sonst stört, daß den Dingen immer die nächstbeste Bildungsassoziation angeheftet wird, so als säße man im Auffrischungskurs „Römische Geschichte I“. Wo die Alpen sogleich an Hannibals Elefanten denken lassen, stellt sich zu Rom unweigerlich die Katakomben-Assoziation ein. Ziemlich unterirdisch mutet auch die gewundene Sprache an, mit der die Geschichte jenes überlebenden Römers fortgesponnen wird. Schwerer aber wiegt, daß hinter alldem kein emotionaler Gehalt spürbar wird, keine Tragik, keine Dramatik, keine Bestimmung, keine Heiterkeit, nicht einmal die Simulation solcher Gefühle.
Unterm Fuß Katakomben, in deren tropfenden Gängen
Fanatiker wohnten, Verdammung kochend
Mit dem täglichen Mahl, war die Angst vor Barbaren
Sein letzter Zauber.
Natürlich ist gegen Motive der Antike in zeitgenössischen Gedichten nicht das geringste einzuwenden. Alles zwischen Himmel und Erde kann, darf und soll zum Gegenstand von Gedichten werden. Joseph Brodsky und Zbigniew Herbert haben vorgemacht, wie man Altes aufgreift, ohne ältlich zu wirken. Aber dahinter steht bei diesen wahrhaft klugen Dichtern, mit einem Gedichttitel Herberts zu sprechen, immer die Frage: „Warum Klassiker.“ Und wo der unselige Zauberlehrling Grünbein keine andere Antwort weiß als: „Weil’s so schön bedeutsam wirkt“, hebt Meister Herbert zu einem meisterhaft verknappten Dreiteiler an, von dem hier zumindest das elegante Oberteil präsentiert sei:
Im vierten Buch des Peloponnesischen Krieges
erzählt Thukydides unter anderem
die Geschichte seines mißlungenen Feldzugs
Neben den langen Reden der Führer
Schlachten Belagerungen Seuchen
dichten Netzen von Intrigen
diplomatischen Schritten
ist diese Episode wie eine Nadel
im Wald
Die griechische Kolonie Amphipolis
fiel in die Hände des feindlichen Führers Brasidas
weil Thukydides mit dem Entsatz zu spät kam
Er zahlte der Heimatstadt dafür
mit lebenslänglicher Verbannung
Die Exilierten aller Zeiten
kennen den Preis
Da gibt es nun allerdings eine Menge zu lernen, nicht zuletzt über das Hantieren mit dem Antiken in den Ländern des früheren Ostblocks. Dort bot das Überstreifen der Toga eine probate Verkleidung, mit der man dem Zugriff des schurkischen Zensors entkommen konnte. Schon Brechts „Das Verhör des Lukullus“ bediente sich 1950 dieses simplen Kniffs aus der Verwechslungskomödie. Die hohe Wertschätzung für klassische Bildung, wie sie etwa noch in Christa Wolfs Kassandra- und Medea-Variationen spürbar wird, war nicht zuletzt ein aus der totalitären Not geborenes Kostümspiel.
Ein Problem des literarischen Kassibers besteht darin, daß er nach Gebrauch poetisch quasi nutzlos wird. Ein Meister wie Herbert wußte deshalb allzu enge Zuschreibungen zu vermeiden. Für den sehr viel jüngeren Durs Grünbein spielen die literarischen Kassiberstrategien der totalitären Ära von Anfang an eine untergeordnete Rolle. Dennoch mag er auf das schöne mythologische Geklingel auch nach der Wende nicht verzichten. Das hat vermutlich weniger mit Schiller als mit der DDR der sechziger, siebziger Jahre zu tun: Grünbein hofft auf die gespannte Aufmerksamkeit eines entschlüsselungswilligen Publikums. Doch seine Kassiber sind schon vor ihrer Entschlüsselung nutzlos, weil es in ihnen gar nichts mehr zu entschlüsseln gibt.
Vielleicht fallen dem Dichter zur westlichen Welt unserer Tage zündendere Formulierungen als zu Carthago und Co. ein? Hören wir sein Gedicht „Avenue of the Americas“, wiederum aus dem Band Nach den Satiren.
Dort an den Kistenholzständen, wo die Verkäufer
Mit hageren Händen Spielzeug und Elektronik,
Asiatischen Tand in die Menge hielten:
Erschien dir zum ersten Mal diesseits des Traums,
Gesenkt den Kopf, wie auf den Bildern des Botticelli,
Der schweigende Dante.
aaaaaaaaaaaaaaaaaSarkasmus, das war sein Hund,
An den Tanksäulen schnüffelnd, an einem Preisschild,
Bevor er das Bein hob, erregt vom Benzingeruch.
Man mag bezweifeln, daß ein umständliches Kompositum wie „Kistenholzstände“ wirklich Platz hat in einem so kurzen Gedicht. Immerhin ist es genau diese Kürze, die am meisten für „Avenue of the Americas“ spricht. Welche äußere Realität aber wäre es, die in dem Gedicht geschildert wird? Avenue of the Americas wird die sechste Avenue genannt, eine der großen Längsachsen Manhattans. Wie ihre berühmtere Nachbarin, die Fifth Avenue, durchquert sie verschiedene Milieus und Bezirke: Im Süden in Soho beginnend, führt sie durch das West Village, streift Chelsea, führt am Rockefeller Center vorbei durch Midtown und endet schließlich im Norden am Central Park. Mit anderen Worten: Es gibt viel zu sehen auf dieser Straße. Dante „wie auf den Bildern des Botticelli“, noch dazu mit einem Hund namens „Sarkasmus“ an seiner Seite, gehört nicht unbedingt dazu.
Auch diesmal vertraut Durs Grünbein nicht seinen Wahrnehmungen, sondern spickt sie mit Vergleichen aus dem abendländischen Kulturkreis. In diesem Fall könnte die dreiunddreißigste Zeichnung aus Sandro Botticellis Dante-Zyklus „Inferno“ als Vorbild gedient haben. Sie zeigt Dante mit gebeugtem Kopf zwischen den nackten, gepeinigten Leibern von Vaterlandsverrätern. Die Straßenhändler auf der Avenue of the Americas sind dem Gedicht hingegen nicht mehr als einen Nebensatz wert. Im Hauptsatz aber macht sich wieder einmal jener prahlende Held der geschwollenen Rede breit, der bereits in „Club of Rome“ und „Alzheimer Engel“ die Strippen seiner Holzfiguren zog. Dieses Subjekt, das sollen wir allen Ernstes glauben, hat „Erscheinungen“ und tauscht sich im Traum regelmäßig mit Dante aus (Hervorhebung v.m.):
Dort an den Kistenholzständen, wo die Verkäufer
Mit hageren Händen Spielzeug und Elektronik,
Asiatischen Tand in die Menge hielten:
Erschien dir zum ersten Mal diesseits des Traums,
Gesenkt den Kopf, wie auf den Bildern des Botticelli,
Der schweigende Dante.
Das Pathos des „Erscheinens“, das bedeutsam bebende „zum ersten Mal“, das zum „dir“ übersteigerte lyrische Ich – all diese Reiz- und Wallungswörter beschwören eine höchst bedeutsame Erfahrung, wenn nicht gar ein Erweckungserlebnis. Doch das Gedicht mit seiner verknäulten Syntax und seiner geborgten Symbolik erfüllt die hochgesteckten Erwartungen nicht. Es bleibt, wie vieles bei Grünbein, ein uneingelöstes Versprechen. Oder, um es mit Grünbeins Vorliebe für knotige Gerundivkonstruktionen zu sagen:
Avenue of the Americas, das war sein Gedicht,
im Buch Nach den Satiren stehend, mehr
behauptend als zeigend:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaSo fand es sich nicht.
Finden Sie nicht auch, daß sich dieser Satz liest, als hätte ihn Goethes Hausmaus namens Schicksal auf einem Gemälde von Tischbein gepiepst?
*
Als der Band Nach den Satiren im Jahr 1999 erschien, zählte die Wahrnehmung der Außenwelt offenkundig nicht mehr zu Durs Grünbeins Stärken. Angestrengt mußte unser Dichter durch den dichten Nebel seiner Selbstfixierung blicken, um überhaupt etwas wahrzunehmen. Das war nicht immer so. Sechsundzwanzig Jahre alt ist Durs Grünbein, als 1988 sein erster Gedichtband bei Suhrkamp herauskommt. Die Gedichte in Grauzone morgens sind in den letzten Jahren der DDR entstanden. Sie lassen sich als Lebenszeichen eines jungen Mannes lesen, den nichts so sehr umtreibt wie die Befürchtung, ein grauer Staat könnte ihm Gegenwart und Zukunft rauben.
DEN GANZEN MORGEN GING dieses Geräusch gleich
förmig und offenbar unterirdisch dieses
Geräusch so unablässig daß kaum jemand es hörte
Dieses Geräusch tausender Reißwölfe einer un
sichtbaren Institution die jeden lebendigen
Augenblick frisch vom Körper weg wie Papier
kram verschlangen.
Befreiung aus dem niederdrückenden Einheitsgrau der DDR verspricht schon damals ein fernes Land namens Amerika. „Grund, vorübergehend in New York zu sein“ heißt eines der Gedichte, und es handelt keineswegs von der Sehnsucht, auf der Sixth Avenue kunsthistorische Kenntnisse unter Beweis zu stellen. Es ist das innige Verlangen nach einem ideologisch unbelasteten Alltag, das aus Zeilen wie diesen spricht:
aaaaaaaaaaaaaaa(…) In New York
aaaaaaaaaahättest du todsicher jetzt den
Fernseher angestellt, dich zurückgelehnt
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaablinzelnd
vom Guten-Morgen-Flimmern belebt.
„Guten-Morgen-Flimmern“ statt „Grauzone morgens“ das ist das einfache, aber einleuchtende Programm, dem Durs Grünbein als Mittzwanziger mit aller mitreißenden Kraft eines ungestillten Verlangens folgt.
Die Amerika-Connection durchzieht das Buch recht deutlich. „Glimpses & Glances“ ist eines der Kapitel in Grauzone morgens betitelt, dessen Miniaturen sich als simple, aber einleuchtende Kontrafakturen auf W.C. Williams’ berühmtes Gedicht von den Pflaumen im Eisschrank lesen lassen. Am deutlichsten wird das Vorbild in dem Gedicht „Verdorbene Fische“ nachbuchstabiert:
Erschrick nicht, wenn du die Krusten
aaaaaBrots, die Kartoffelschalen weg
wirfst, am Boden der Futtertonne
liegt wohl ein Halbdutzend verdorbener
aaaaaFische (Makrelen) mit steif
aufgerichteten Schwänzen und starren
Augenringen, die Bäuche geschlitzt, nein
aaaaaerschrick nicht, es ist ein
so sinnloser Anblick, verzeih…
Während freilich Williams’ Miniaturen das Leben in allen unwiderstehlichen Erscheinungsformen feiern, benutzt Grünbein die vorgeprägte Form vorzugsweise, um Ekel an seiner Umwelt zu artikulieren. Die angebliche Kälte angesichts einer „Wärmeplastik nach Beuys“ verdankt ihre Attitüde nicht nur Williams, sondern auch den „Morgue“-Gedichten des jungen Benn:
Erst als der geile Fliegenschwarm
aaaaaaufstob in äußerster Panik
aaaaaaaaaaaaaaaaaum seine Beute tanzte wie
aaaaaaaaaaaaaeine Wolke von Elektronen mit
hohem Spin, sah man die beiden
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaJungvögel nackt.
Es war Zwölf Uhr mittags und dieser
aaaaaaaaaaaaaböse Zufall nichts
aaaals eine Gleichgewichtsformel
aaaaaaaafür zwei gedunsene Madennester
aaaaaaaaaaaaaaaaaaawie Spiegeleier
leicht angebraten im Straßentiegel
aaaaaaus Teer und Asphalt.
„Gleichgewichtsformel“, „Elektronen mit hohem Spin“ in solchen verbalen Auspolsterungen läßt sich bereits die spätere Masche Grünbeins vorausahnen. Aber das abschließende Bild von den „Spiegeleiern… im Straßentiegel“ ist präzise ausgemalt. Grünbein begeht nicht den Fehler, seine Alltagswahrnehmung durch möglichst edle und entlegene Assoziationen nobilitieren zu wollen.
In Grünbeins frühen Gedichten sind viele typische Merkmale talentierter Anfängerschaft versammelt, gute wie schlechte. Vorbilder werden im Stil eher nachgeahmt als anverwandelt; ein adoleszent wirkender Narzißmus äußert sich teils weltschmerzverzerrt, teils hochtrabend; auch ein Hang zu schwerfälligen Metaphern, die gerne mit den Wörtern „Wie“ und „Als ob“ eingeführt werden, zeigt sich allerorten. Doch all das läßt sich hier, im Erstling, noch als Kinderkrankheit abtun. In seinen besten Momenten gelingen dem jungen Lyriker ebenso schwungvolle wie einprägsame Zeilen. Ein frischer Blick auf die Welt macht wett, was den Gedichten manchmal an gedanklicher Tiefe fehlen mag, gelegentliche Laxheit schlägt als Lässigkeit zu Buche, und selbst die Lücken im Versbau lassen Licht und frische Luft herein.
Das gilt insbesondere für das vielleicht originellste Gedicht des Bandes, das den Titel „Badewannen“ trägt. Klar, es gibt einen schlechten Kalauer darin – Badewannen werden ihrer Unbeweglichkeit wegen als „typische Immobilien“ bezeichnet −, und es gibt ein schiefes, wenngleich nicht unwitziges Bild in Gestalt einer „Oase voller nostalgischen Schaums“. Aber es findet sich auch manches Gute in dieser Wanne: gußeiserne alte Ladies, jede Menge Dreck, und sogar „ein einzelnes vögelndes Paar“.
Was für liebliche klare Objekte doch
aaaaaaaaaaBadewannen sind makellos
aaaaaaaaaaaaaaaemailliert ganz unnahbar mit dem
heroischen Schwung rundum gußeiserner
aaaaaaaaaaAlter Ladies nach ihren
aaaaaaaaaaaaaaaWechseljahren noch immer frisch.
Typische Immobilien (wann hätte jemals
aaaaaaaaaasich eine vom Fleck
aaaaaaaaaaaaaaagerührt) sind sie doch immer
wieder von neuem gefüllt, aller Dreck
aaaaaaaaaaaufgelöst in die Kanalisation
aaaaaaaaaaaaaaafortgespült muß unfehlbar
durch dieses enge Abflußloch auf dem
aaaaaaaaaaWannengrund. Wahre Selbst-
aaaaaaaaaaaaaaamordmaschinen auf ihren
stummeligen Beinen, Warmwasserbetten mit
aaaaaaaaaaPlatz genug für ein ein-
aaaaaaaaaaaaaazelnes vögelndes Paar in
sovielen Wohnungen etwas wie eine Oase
aaaaaaaaaavoller nostalgischen
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaSchaums.
*
Heute steht Durs Grünbein seinem Frühwerk denkbar kritisch gegenüber. Kürzlich hat er Grauzone morgens einer „Revision“ unterzogen, und er ist dabei zu einem wenig schmeichelhaften Ergebnis gekommen:
Dieses erste Buch liegt so lange zurück, daß es mir wirklich leid tut: daran, wie es zustande kam, kann ich mich kaum noch erinnern. Unvorstellbar der Gedanke, ich sollte bei einer der üblichen öffentlichen Lesungen daraus vortragen. Seit Jahren lasse ich, wenn ich auf Lesereise gehe, das kleine Debüt-Büchlein mit dem Titel Grauzone morgens zuhause. Dieser zitronengelbe Broschurband mit seiner zerrauften Typographie erinnert mich an das häßliche junge Entlein aus Andersens Märchen, von dem gesagt wird, es hätte zu lange im Ei gelegen und darum sei es etwas mißraten. (…) Nichts um alles in der Welt kann den Autor dazu bringen, dieses Dokument seiner Unmündigkeit noch einmal in Betrachtung zu ziehen.
So spricht einer, der glaubt, Besseres im Angebot zu haben und den Besuchern „einer der üblichen öffentlichen Lesungen“, wie es etwas herablassend heißt, keine häßlichen zitronengelben Entlein, sondern majestätische Schwäne vorführen zu können. Die weitere Rezeptionsgeschichte scheint ihm recht zu geben. Nicht Grauzone morgens markiert den Durchbruch Grünbeins, auch nicht der Folgeband, Schädelbasislektion, sondern der 1994 erschienene dritte Gedichtband, Falten und Fallen. Schon ein Jahr später wird Grünbein der Büchner-Preis zuerkannt; mit dreiunddreißig Jahren ist er einer der jüngsten Preisträger in der Geschichte dieser Auszeichnung.
Den Erfolg von Falten und Fallen bezeichnet maßgeblich eine einzelne Besprechung von beträchtlicher Signalwirkung: Im März 1994 eröffnet die Frühjahrs-Literaturbeilage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit einer ebenso umfangreichen wie euphorischen Rezension des Bandes. Verfasser ist der damals leitende Literaturredakteur des Blattes, Gustav Seibt. Seibt hat seinen Posten erst kurz zuvor angetreten; der seitenfüllende Artikel über Falten und Fallen ist also nicht nur für den Rezensierten, sondern auch für den Rezensenten von karrieretechnischer Bedeutung. Entsprechend auftrumpfend präsentiert der Kritiker seinen Fund:
Am 12. November 1989 schrieb der damals siebenundzwanzig Jahre alte Ost-Berliner Dichter Durs Grünbein ein paar Zeilen, die, wie man jetzt sieht, eine neue Epoche in der deutschen Literatur eröffneten.
Nähme man Seibt beim Wort, wäre nicht etwa mit dem Mauerfall eine neue Epoche in der deutschen Geschichte und Literatur angebrochen, sondern mit Zeilen wie diesen:
Komm zu dir Gedicht, Berlins Mauer ist offen jetzt.
Nein, sie ist nicht jetzt offen, die Berliner Mauer, sie ist „offen jetzt“, weil, das ist ja so dichterisch. Schade nur, daß der sächsische Genitiv „Berlins Mauer“ der poetisierenden Inversion einen ziemlich provinziellen Riegel vorschiebt. Aber es kommt noch schöner:
Wehleid des Wartens, Langweile in Hegels Schmalland
Vorbei wie das stählerne Schweigen… Heil Stalin.
Im Grunde ist Seibts hochtönende Eröffnungsfanfare für den, der zu lesen versteht, jetzt bereits als schrille Karnevalströte erkennbar. Heil Stalin, Helau Grünbein – auf die sprachlichen und historischen Feinheiten kommt es offenbar nicht mehr an, wenn sich in „Hegels Schmalland“, was immer das sei, geschichtliche Umwälzungen vollziehen. Wer glaubt, daß neue Epochen der Literatur mit spätpubertären Sprachklingeleien eingeläutet werden, sollte freilich unbedingt weiterlesen:
Letzter Monstranzen Glanz, hinter Panzern verschanzt.
Langsam kommen die Uhren auf Touren, jede geht anders…
Der Rezensent räumt munter ein, daß das „etwas albern“ ist, meint aber seltsamerweise, man könne „diesen Versen ihre grellen Effekte (…) nicht übelnehmen“. Lieber greift er, nach eigenem Bekenntnis, „zu hohen Vergleichen“. Und, bei Zeus und Wotan, das tut er:
Seit den Tagen des jungen Enzensberger, ja, vielleicht seit dem ersten Auftreten Hugo von Hofmannsthals hat es in der deutschsprachigen Lyrik einen solchen alle Interessierten hinreißenden Götterliebling nicht mehr gegeben. (…) Die Kritik hat seine ersten Bände (…) mit wachsender Zustimmung aufgenommen. Überrascht entdeckte sie den souveränen Rückgriff auf die klassische Moderne, auf den hohen Anspruch von T.S. Eliot, Pound und Williams. Die anspruchsvollsten Literaturzeitschriften drucken ihn, Preise, Stipendien, Einladungen an die German Departments in aller Welt ließen nicht auf sich warten.
Gewährsmann um Gewährsmann wird in den Zeugenstand gerufen und mit keiner einzigen Silbe um Auskunft befragt. Enzensberger, Hofmannsthal, Eliot und Pound soviel namedropping läßt stutzen. Mißtraut da einer dem eigenen Urteil? In Wahrheit hat es mit dem vollmundig behaupteten „souveränen Rückgriff“ nicht viel auf sich. Gewiß, Grünbein übt seine Skalen, spielt fleißig seine Etüden und hat manche schöne Eigenkomposition im Repertoire. Vieles von dem, was er macht, zeichnet sich durch Charme aus, und manches durch einen Anhauch potentieller künftiger Größe. Aber für eine Grünbein-Eloge dieses Ausmaßes mit anschließender Ernennung zum inoffiziellen Staatsdichter ist es bei Erscheinen von Falten und Fallen schlichtweg verfrüht.
Und seitdem ist es zu spät für sie. Denn das frühe Lob hat Grünbeins weitere Entwicklung bis auf weiteres verdorben. Weil ihm nicht die Stärken, sondern die Schwächen seines Schreibens den größten Erfolg bescherten, hat er fortan ebendiese Schwächen in Serie reproduziert: die Bildungshuberei, die sprachliche Überorchestrierung, die intellektualistische Dünnbrettbohrerei. So ist neben allen Mißlichkeiten der Lektüre auch eine verpaßte Chance zu beklagen. Denn daß Grünbein ein beachtliches Talent einzubringen hat, das steht ganz außer Zweifel.
*
Falten und Fallen hat auch seine guten Seiten, die ersten achtundvierzig zum Beispiel. Auf ihnen findet sich ein Zyklus in vierzig Teilen, „Variation auf kein Thema“ benannt. Dies sind gewissermaßen Gelegenheitsgedichte ohne besonderen Anlaß; sie umkreisen eine Wahrnehmung oder einen Gedanken, und sie sind mit ihren jeweils dreizehn Zeilen kurz genug, um nicht langweilig zu werden. Auf Seite dreiundvierzig charakterisiert Grünbein seinen nervösen Helden wie folgt:
Die Nerven blank wie unter Flügeldecken,
aaaaaGenügt ein kreischender Baukran
Am Mittag, dich zu erschrecken, ein Pfiff
aaaaaUms Eck, eine zischende Dose.
In diesem jüngsten Himmel-Hölle-Spiel
aaaaaBricht etwas auf, sprengt Risse
Ins alte Hirngewölbe des Jahrhunderts.
aaaaaDer Boden dröhnt. Sixtinisch
Hallt es von musealen Stunden, tickend
aaaaaIm Zentrum, über leere Plätze.
Derselbe Kalk, der die Schlagadern engt,
aaaaaDrängt die Straßen ins Weite,
Teilt die Geister vor einer Hochhauswand.
Die ersten vier Zeilen etablieren einen angespannt-erregten Zustand, und sie tun dies recht wirkungsvoll. Der Rhythmus stimmt, und der Binnenreim von „erschrecken“ auf „Flügeldecken“ wirkt nicht übertrieben, sondern unterstreicht das beschleunigte Tempo:
Die Nerven blank wie unter Flügeldecken,
aaaaaGenügt ein kreischender Baukran
Am Mittag, dich zu erschrecken, ein Pfiff
aaaaaUms Eck, eine zischende Dose.
Dann allerdings wird die Beschleunigung an einige verrenkte Verse verschenkt:
In diesem jüngsten Himmel-Hölle-Spiel
aaaaaBricht etwas auf, sprengt Risse
Ins alte Hirngewölbe des Jahrhunderts.
Was das beschworene „etwas“ ist, bleibt unklar. Das „alte Hirngewölbe des Jahrhunderts“ immerhin bildet mit seiner Vermischung architektonischer und medizinischer Ausdruckswelten ein eindrucksvoll oszillierendes Sprachbild.
Solche Biologismen tauchen seit dem zweiten Band Schädelbasislektion vermehrt in Grünbeins Arbeiten auf. Manchmal erfüllen sie eine Funktion, oft sind sie auch nur wichtigtuerisch. Die Vorstellung, daß avancierte Poesie sich mit dem Fortschritt in den Naturwissenschaften zu beschäftigen habe, gehört zu den Lieblingsmarotten im Lyrikbetrieb der neunziger Jahre. Warum nur niemand auf die Idee gekommen ist, die Naturwissenschaften ihrerseits sollten ein wenig poetischer werden?
Die letzten drei Verse unseres Testgedichtes führen sprachrhythmisch zu einem präzisen Schlußpunkt des Gedichts.
Derselbe Kalk, der die Schlagadern engt,
aaaaaDrängt die Straßen ins Weite,
Teilt die Geister vor einer Hochhauswand.
Die beiden unmittelbar aufeinanderfolgenden Reimwörter „engt“ und „drängt“ fungieren wie ein Scharnier, mit dem sich das Gedicht in die auch semantisch beschworene Weite öffnet, um es dann „vor einer Hochhauswand“ geteilten Geistes verharren zu lassen. Das ist sehr schön gelöst, solange man nicht allzu beharrlich nachfragt, was Grünbein eigentlich sagen will. Ich jedenfalls habe nicht kapiert, was es mit dem Kalk, den Straßen und der Hochhauswand auf sich hat.
Auf Seite fünfundvierzig sucht unser nervöser Held die Toilette auf. Für die meisten Menschen ist das ein klar umrissener Vorgang, nicht so für den Protagonisten dieses Gedichts:
Auch der kälteste Raum wird zur Sauna,
aaaaaSolange du irrläufst. Wie steil
Führt ins Endreich die Treppe, wie streng
aaaaaDer Geruch ist, die Trennung
In Damen und Herren… Die falsche Tür,
aaaaaKaum berührt, lockt ins Abseits,
In verbotne Zonen, vor Wände, markiert
aaaaaMit den Zoten der Gegenseite.
Nichts macht so einsam wie das Geschlecht.
aaaaaIn Kabinen gesperrt, lauschend
Der stygischen Spülung, den Eingeweiden,
aaaaaAllein mit dem Ekel, der Lust,
Klebt an den Fliesen der Körper und träumt.
Der freie Rhythmus wird mit Schwung gehandhabt, und das Schlußbild des „an den Fliesen“ klebenden, träumenden Körpers ist aussagekräftig und einprägsam. In solchen Momenten hat das Gedicht die Eindrücklichkeit eines Albtraumes. Aber der Rest? Wieder sind da diese unbelegten Behauptungen, die keinen Widerspruch zu dulden scheinen, obwohl sie keineswegs über jeden Zweifel erhaben sind: „Auch der kälteste Raum wird zur Sauna, / Solange du irrläufst.“ Wirklich? Wird nicht vielmehr der kälteste Raum erst dann zur Sauna, wenn man ordentlich Holz nachlegt?
„Nichts macht so einsam wie das Geschlecht.“ Auch das ist so ein Aufschneidersatz, wie man ihn einem Anfangszwanziger verzeihen muß, einem Anfangsdreißiger aber nicht mehr verzeihen darf. Mancher meint, Fragen zu stellen sei die Aufgabe der Kunst. Durs Grünbein gibt Scheinantworten auf Fragen, die keiner gestellt hat. Ähnlich unklar bleibt die Stillage des Gedichtes. Ist wirklich alles so ernst gemeint, wie der dröhnende Proklamationston befürchten läßt? Die „Trennung in Damen und Herren“ kann man eigentlich nur mit einem Grinsen quittieren, nachdem Grünbein die schnöde Toilettenszene mit erheblichem Pathos etabliert hat:
(…) Wie steil
Führt ins Endreich die Treppe, wie streng
aaaaaDer Geruch ist, die Trennung
In Damen und Herren…
Und was, bitte schön, ist ein „Endreich“? Es stimmt schon, daß sich in vielen Lokalen die Toiletten im Untergeschoß befinden, also gewissermaßen im „Erdreich“. Aber ob Grünbein die Implikationen dieser seltsamen Hochzeit aus unterirdischer Notdurft und Führers „Endsieg“ wirklich bis in alle Konsequenzen bedacht und mitgemeint hat?
Das unmittelbare Nebeneinander von Ge- und Mißlungenem findet sich in vielen Gedichten von Falten und Fallen wieder. Ist Durs Grünbein also eher ein Dichter starker Einzelzeilen als starker Gedichte? Nicht nur, zum Glück. Im hinteren Teil des Buches stößt der gebeutelte Leser auf mehrere Stücke, die wirklich aus einem Guß sind. Das erste dieser Gedichte heißt so wie die Tagelieder der alten französischen Troubadoure: „Alba“.
Endlich sind all die Wanderer tot
Und zur Ruhe gekommen die Lieder
Der Verstörten, der Landschaftskranken
In ihren langen Schatten, am Horizont.
Kleine Koseworte und Grausamkeiten
Treiben gelöst in der Luft. Wie immer
Sind die Sonnenbänke besetzt, lächeln
Kinder und Alte aneinander vorbei.
In den Zweigen hängen Erinnerungen,
Genaue Szenen aus einem künftigen Tag.
Überall Atem und Sprünge rückwärts
Durchs Dunkel von Urne zu Uterus.
Und das Neue, gefährlich und über Nacht
ist es Welt geworden. So komm heraus
Aus zerwühlten Laken, sieh sie dir an,
Himmel, noch unbehelligt, und unten
Aus dem Hinterhalt aufgebrochen,
Giftige Gräser und Elstern im Staub,
Mit bösem Flügelschlag, Diebe
In der Mitte des Lebensweges wie du.
An diesen fünf Vierzeilern stimmt eigentlich alles: der von einer Beobachtung zu einer Aufforderung führende Spannungsbogen; der freie, aber stimmige Rhythmus; die nicht zu knalligen Enjambements – lediglich an der etwas Überinstrumentiert wirkenden Zeile „Durchs Dunkel von Urne zu Uterus“ könnte man sich stören. Aber man muß ja nicht. (Sie ergibt sogar einen ganz wundersamen Sinn, wenn man sie als versteckte Selbstmitteilung liest. Man muß nur zwei Buchstaben streichen, um von „Durchs“ auf „Durs“ zu kommen. Schon wird aus Falten und Fallen ein Superheldencomic und eine präzise Grünbein-Poetologie obendrein: „Durs Dunkel: Von Urne zu Uterus“.)
Im Zentrum des Gedichts steht eine Zeitenwende: Neue Sänger braucht das Land, und die sollen, so Durs Grünbein, wie „Elstern im Staub“ sein, „Diebe in der Mitte des Lebensweges“, noch dazu „mit bösem Flügelschlag“. Ach, hätte er sich nur selbst in seinen anderen Gedichten immer daran gehalten, unser Dichter. Man hört nämlich selten, daß Elstern durch antike Referenzen zu imponieren versuchen, und ist ihr Gesang auch nicht geschmeidig, so wird er doch selten durch Gefallsucht getrübt.
Vielleicht aber ist Durs Grünbein insgeheim ein weicher Charakter, der weniger durch bösen Flügelschlag als durch freundliches Zwitschern zu überzeugen weiß? Das würde zumindest erklären, warum das wohl schönste Gedicht in Falten und Fallen allem Hang zur Übersteigerung zum Trotz weniger mit dem mehrfach beschworenen „Europa“ zu tun hat als mit einem – Igel. Da mag der Titel auch noch so sehr abgeklärten Sarkasmus à la Benn signalisieren, es bleibt doch ein ungeklärter Rest Melancholie, wenn nicht gar Sympathie in diesem Gedicht namens „Pech für den zweiten Wurf“. Das also wäre unser happyend, oder doch der glücklichste Ausgang, den wir für die letzte Folge in unserem Lyrik-TÜV anbieten können. Und nun: Gute Nacht, Europa! Und Ihnen, liebe Leser, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse.
Zwei Uhr nachts, Zeit des Igels der
Bei den Mülltonnen stöbert
aaaaaaaaaaWährend du zögernd
aaaaaaaaaaaaWie auf Stacheln vorbeigehst
Irgendwo in Europa, im selben
aaaMondflutlicht heimisch
aaaaaaaaaaUnd wie dieser Igel
aaaaaaaaaaaaaaaRaschelnd im Rinnstein
Irgendwo in Europa, nichtsahnend
aaaErfrischt von Novemberkälte
aaaaaaUnd wie dieser Igel
aaaaaaaaaaaaaAllzu mager für einen langen
aaaaaaaaaaaWinterschlaf, allzu naiv
Sich nicht doch noch mit Äpfeln
aaaVollzustopfen um zwei Uhr nachts
aaaaaaaIrgendwo in Europa
aaaaaaaaaaaaaaUnd wie dieser Igel
Eine so leichte Beute der Zeit.
Steffen Jacobs, in Steffen Jacobs: DER LYRIK TÜV, Eichborn Verlag, 2007
Codiert bis in die Zehenspitzen
− Durs Grünbeins dritter Lyrikband Falten und Fallen als Resultat einer Gegenbewegung zum modernen Zersetzungsprozeß der Wahrnehmungen. −
Daß er den Zustand der Spezies Mensch im Blick hat und nicht wie so viele seiner Landsleute das deutsch-deutsche Lamento, entzückte die Kritiker bislang über alle Maßen. Vom „Götterliebling“ ist die Rede, dessen Gedichte eine neue Epoche in der Literatur eröffnen (F.A.Z.) und vom „großen Talent“, der „wohl wichtigsten deutschen Lyrik-Entdeckung seit 1989“ (Die Zeit). Literaturbeobachter aller Couleur sind sich einig: Der 1962 in Dresden geborene und seit 1986 im Berliner Prenzlauer Berg beheimatete Durs Grünbein steht an der Schwelle zum Ruhm. Mit ihm beginne etwas Einzigartiges und Neues, raunt es, aber was? Ist es die „Ausrufung einer spätzeitlichen Nervenkunst“, wie Gustav Seibt meint, ist es der Balanceakt zwischen „Formelhaftigkeit“ und „großer Poesie“ eines „lyrischen Landesmeisters“, wie Eberhard Falcke verkündet, oder tritt gar ein zweiter Gottfried Benn ins Rampenlicht, der nach Michael Braun (Freitag) all den „metaphysischen Schutt hinwegfegt, den sich die Menschheit in Form von identitätsstiftenden Weltbildern geschaffen hat“?
„Du lieber Himmel, wie schwer sich das sagt, wie leicht mir dabei zumute ist…“, lesen wir in Durs Grünbeins drittem, in diesem Jahr erschienenem Buch Falten und Fallen, genauer: im poetologischen Prosatext „Aus einem alten Fahrtenbuch“.
Dieses fiktive Fahrtenbuch enthält – getarnt als zufälliger Dokumentenfund aus dem untergegangenen „Sozialistischen Reich“ – recht genau Grünbeins literarisches Konzept. Da wird kein wie auch immer gearteter geistiger Schutt hinweggefegt, sondern in einem Puzzle aus optischen Ausschnitten (gesehen wie durch ein Zielfernrohr oder die Sehschlitze eines Panzers) ein ganz eigenes Weltbild entworfen.
Die Bildausschnitte setzt Grünbein zu einem merkwürdigen Film zusammen, den er entsprechend langsamer, in Zeitlupe, oder schneller, in Zeitraffer, ablaufen läßt. Fundstücke aus Jahrhunderten, gar Jahrtausenden, werden collagenhaft neu zusammengesetzt zu einer „privaten Pornographie des Erd- und sonstigen Geschehens“. Dabei ist der herkömmliche Begriff der Collage nicht ganz zutreffend, denn Grünbeins Gebilde sind nicht festgefügt und starr, sondern beweglich. Seine Lyrik scheint das Resultat einer Gegenbewegung zum modernen Zersetzungsprozeß der Wahrnehmungen zu sein. Sie zieht ihre künstlerische Methode aus den Videoclips und Werbespots mit ihren rasanten Wechseln der Bildeinstellungen in Sekundenbruchteilen. Mit der filmischen Methode sprengt Grünbein den Rahmen herkömmlicher Lyrik, erreicht eine Dichte, die tatsächlich eine neue lyrische Qualität ist. Trotz der kompliziert anmutenden Schreibweise des Autors sind seine Gedichte dem Leser relativ leicht zugänglich. Das mag daran liegen, daß der Bezugs- und Ruhepunkt immer wieder der Körper ist: Der „Körper aalt sich im Psychokomfort der Geschwindigkeit“, heißt es im „Fahrtenbuch“. Die Sinnlichkeit der Gedichte, ihre Grundierung mit optischen, akustischen und Gefühlsreizen, resultiert aus der allgegenwärtigen Bezugnahme auf die Körperlichkeit des Menschen. Beschreibt Grünbein Bewegung, ist es die Bewegung des Körpers durch einen Raum, erinnert er Kindheit, ist es die Vergegenwärtigung des „Komplotts großer Körper, die dich fütternd erdrückten“. Arme und Beine, Haut und Nabel, Auge, Ohr und Geschlecht sind Sensorien in Versen aufgehobener Erfahrung. Die Welt außerhalb des menschlichen Körpers wird durch ihre Wirkung auf ihn definiert: die Ameise zum Beispiel über die brennende Spur, die sie auf dem Handrücken hinterläßt. Eine besondere sinnliche Intensität strahlen die Liebesgedichte aus. In dem Zyklus „Variationen auf kein Thema“ werden in dem Text „Um von vorn zu beginnen“ widersprüchliche Prozesse einer Paarbeziehung über physiologische Vorgänge sinnfällig gemacht; der Zyklus „Im Zweieck“ beschreibt Anfang, Entwicklung und Ende einer Liebe als sinnlich-erotische Konstellationen „zweier Blößen / Einander zugewandt“. Es bleibt Grünbeins Geheimnis, wie es ihm gelingt, bei aller Deutlichkeit niemals ins Triviale oder in provinzielle Enge abzugleiten.
Dennoch: Ohne die in der DDR erfahrene Enge gäbe es die Spezifik der Grünbeinschen Lyrik nicht. Das beginnt bei den Metaphern, die aus scheinbar gegensätzlichen Komponenten gearbeitet sind.
Die Metapher „Panzer der Sprache“ aus dem „Fahrtenbuch“ ist eine dieser Neuschöpfungen Grünbeins, die zwei Worte zusammenfügt, deren Aura bislang als gegensätzlich und daher unvereinbar galt: der Panzer als Kriegsgerät und die Sprache als Mittel zwischenmenschlicher Verständigung und als Medium der Dichtung, als offener Raum der Phantasie. Mit der verblüffenden Metapher „Panzer der Sprache“ entwirft Grünbein eine Ausgangssituation, die die einstige Lage des Individuums in der DDR verfremdet und damit schlagartig erhellt: die Einengung auf kleinstem Raum als vermeintlicher Schutz vor der „feindlichen“ Außenwelt („Sperren und Hinterhalte“), dazu das Einverständnis des Eingesperrten mit seiner Gefangenschaft: „… ich bleibe im Panzer der Sprache, hier bin ich geschützt,…“. „Heimat heißt dieser Abstand von einer Bodenwelle zur nächsten“ steht im „Fahrtenbuch“, dem die Ironie als einer von mehreren Böden unterlegt ist. Es spricht ein Ich, dessen Bewußtsein („Es geht mir gut“) im Gegensatz zu seiner tatsächlichen Situation steht, dessen Empfinden („Keine Panik, keine Platzangst, kein Gefühl von Eingesperrtsein, ich habe mich früh hier eingewöhnt.“) paradox ist. Bis hierher korrespondiert das „Fahrtenbuch“ mit den ersten beiden Gedichtbänden des Autors, dem 1988 – nach Empfehlung Heiner Müllers bei Suhrkamp verlegten Buch grauzone morgens und der 1991, ebenfalls von Siegfried Unseld protegierten Schädelbasislektion mit DDR-Thematik und Protokollen der Wendezeit. Anders als das Selbstbildnis vom Dichter als „junger Grenzhund“, als „Kind Hitlers und Stalins“ geht die Metapher vom Ich im Panzer der Sprache über das Zeitgeschichtliche weit hinaus.
War es als Flaneur in der Berliner U-Bahn noch Repräsentant der Generation um die Dreißig, die westliches Terrain nach dem Mauerfall als Neuland erkundete, ist es „im Panzer der Sprache“ nicht nur der ehemalige DDR-Bürger, sondern ein Subjekt mit den Problemen des modernen Menschen schlechthin. DDR-Lebenserfahrung ist nur Ausgangspunkt für die Betrachtung menschheitsgeschichtlicher Entwicklung.
Scheinbar mit dem kühlen Blick des Wissenschaftlers, vor allem des Biologen und Mediziners, wird der Mensch in diesen Gedichten als anthropologische Spezies betrachtet: „Die Körper in Einzelgliedern, tranchiert“ „die feinen Risse im Schädeldach“. Die heutigen umstrittenen Möglichkeiten, „den Tod auf halbem Wege zu unterbrechen“, selbst die Genetik mit ihren Eingriffen in die Erbsubstanz, reflektiert Grünbein in seinem jüngsten Buch. Das eigentliche Thema aber ist philosophischer Art: die Gattung Mensch als ein besonderes Tier, seine Herkunft und gegenwärtige Bewegungsrichtung, veranschaulicht in „Biologischer Walzer“. Was da alles nicht mehr stimmt, erfahren die Ich- und Er-Figuren der Texte über ihre Nervenbahnen: Gefühle und Bedürfnisse als physikalisch meßbare Größen. Das Leben ist codiert bis in die Zehenspitzen, und dennoch bleibt der Mensch ein Torso in einer gefährlich wie nie gewordenen Umarmung der Erde. Voller Sarkasmus beschreibt Durs Grünbein Momente der Verstörung und die geheimen Vulkanausbrüche, wenn beim Experimentieren mit dem Leben nicht der „neue Mensch“, sondern nur ein Monster entsteht.
Dorothea von Törne, Neue Zeit, 4.6.1994
Nicht heimisch
(…)
Durs Grünbeins Rückblick auf den Realsozialismus ist schonungslos.
In Verrat geschult, gaben sich Greise den Bruderkuß
Vor Potemkinschen Dörfern, Gouverneure, die ihr Jagdwild
Von Scheinwerfern geblendet, beim Füttern erledigten.
(„Damnatio memoriae“) Eine Episode in der mit kaltem Blick wahrgenommenen menschlichen Gattungsgeschichte „zwischen Nekro und Neuro“. Der Vorstellung Heimat, Bloch hat ausgeträumt, gilt die marginale Bemerkung: Sie ist der „Abstand von einer Bodenwelle zur nächsten“. So zu lesen im langen Prosagedicht „Aus einem alten Fahrtenbuch“: Das Ich bahnt sich im Panzer der Sprache – einem „Gehäuse von Eigenschaften, banal und symbolisch“ – den Weg durchs „unermeßliche Sichtfeld“, die „fürchterliche zerebrale Landschaft“. Gefahr droht überall – aber: „Erst das Gefahrenwerden bringt das Gehirn voll in Schwung…“ Der Sprachpanzer schützt ebenso, wie er gefangenhält. Das Sprechen – ein „Mißverständnis, zwischen allen vereinbart“ – wird zum Versprechen: ein „Alpha-Gebet“. Der Text ist der anthropologische Gegenentwurf zu Brauns „Eisenwagen“ mit seinen gesellschaftstheoretischen Implikationen einer Dialektik von Erstarrung und Befreiung. Grünbeins Sprachskepsis artikuliert sich sprachmächtig und erfindungsreich, oft mit Komik und Ironie: „Gehirn bei Fuß“. Inwieweit die Bildlogik der poetisch-philosophischen Großmetapher durchgehend stimmig ist, wäre eine nähere Untersuchung wert. Aber solange Geschichte nicht zu Ende ist, ist es auch Literaturgeschichte nicht, will sagen: Man muß kein Prophet sein, um in Grünbeins Texten „würdige Gegenstände“ für sie auszumachen.
Der Mensch als seltsames Tier mit seinem Gehirn voller Falten und Fallen, das Ich als „bedingter Reflex“ ist – in Fortsetzung der Schädelbasislektion (1991) – der Gegenstand dieser Lyrik.
Denk von den Wundrändern her, vom Veto
Der Eingeweide, vom Schweigen
Der Schädelnähte
ihr Programm. Der Blick des „mikroskopischen Auges“ fällt auf eine sinnentleerte, grundlose Welt. Unterscheidet sich der Mensch vom Spatzen – „wie immer zur Stelle / Nur ohne Auftrag, dem Tod / Um ein kurzes Flügelschlagen voraus“? Leben ist „Variation auf kein Thema“ – so lautet der Titel des Zyklus, mit dem der Band beginnt: eine Folge präziser, das Vokabular von Medizin und Technik souverän nutzender Bilder moderner Zivilisation: Banalität und Epiphanie. Er ist ein Ganzes ebenso wie ein Stück-Werk, kalkulierte Fügung nahe am Zerfall in Reize, Wahrnehmungen und Empfindungen. „Skeptisch, belesen und gereizt“ ist diese Lyrik neuester Sachlichkeit (oder Empfindlichkeit?) eines „Ariel / Ohne Auftrag und unter niemands Vaterblick“. Sie weist jegliches „Versprechen der Wiederkehr der vertrauten Dinge“, wie sie in der Kindheit erfahren wurden, illusionslos zurück. Eine lyrische Phänomenologie:
Stimmen und Staub, schwirrend
Durch die Tiefen der Zeit
In seinem Essay „Transit Berlin“ umriß Grünbein das Programm der Jungen:
Ihr insgeheimes Credo ist das Rundumoffensein, triebhafte Wachsamkeit inmitten einer Dingwelt, in der das Ich millionenfach zerlegt und aufgelöst wird in ein Vielerlei von Reizen. (Freibeuter, Heft 54)
Doch bietet Grünbein mehr als Fin-de-siècle-Nervenkunst; Denklust und Formkraft bilden das Gegengewicht zur Zerfaserung. Da er immer wieder in die Nachfolge Benns gestellt wird, ist es vielleicht angebracht, anzumerken, daß er mit dem sentimentalen Spätestromantiker, der Benn auch ist, nichts gemein hat. Viel eher sind es Eliot und Auden, die zum Vergleich taugen: mit ihrem Blick auf das „Weltalter der Angst“ und das „alte Drecksgeschäft“ Geschichte, mit ihren kunstvollen Variationen überlieferter Form- und Sprachmuster und der Überblendung von antikem Mythos und moderner Erlebniswelt. Zum anderen sind es Rilkes Elegien mit ihrem weitgespannten Zeit-Raum-Empfinden, die Grünbeins Welt-Bilder inspirierten („Das Ohr in der Uhr“, „Späte Erklärung“, „Requiem für einen Höhlenmenschen“). „Hier waren wir sterblich, hier / Sind wir sterblich, hier werden wir sterblich gewesen sein.“ Auch die Zoo-Gedichte, reimlose Sonette, stellen sich der Herausforderung Rilke – und bestehen sie. Da das Wort vom „kalten Blick“ zum Klischee zu werden droht, sei zum Schluß auf das Liebesgedicht „Im Zweieck“ hingewiesen, das – eher lieblosem als lieblichem Vokabular vertrauend – durchaus Momente gelösten Daseins kennt.
Jürgen Engler, neue deutsche literatur, Heft 496, Juli/August 1994
S-Bahn-Surfing oder stilles Betrachten?
– Von Zeit zu Zeit gibt es einen Paradigmenwechsel in der Art lyrischen Sprechens. Die Heraufkunft von etwas völlig Neuartigem scheint sich anzubahnen. Doch bei genauerem Hinsehen und relativierendem Vergleich zeigt sich gewöhnlich, daß auch das scheinbar Beispiellose nur eine Variante von etwas Vorausgegangenem ist, sozusagen: die Wiederkehr eines Archetypus, lediglich zeitgemäß ausgestattet, bereichert um die Erfahrungen und Valeurs einer späteren Epoche. –
Auch Durs Grünbein, der junge erfolgreiche Lyriker aus der ehemaligen DDR und letztjährige Büchner-Preisträger, bildet da keine Ausnahme – ungeachtet der Faszination, die von ihm ausgeht und die ihn, jedenfalls bei den Kritikern und Lesern seiner Generation, zu einer Kultfigur hat werden lassen.
Das Zerebrale, das seine Dichtung besitzt, hat es zuvor bereits bei anderen Poeten gegeben, im deutschen Sprachbereich vor allem bei Benn, der sich selber bekanntlich einen „armen Hirnhund“ nannte, „schwer mit Gott behangen“.
Was Grünbein von Benn unterscheidet, ist – außer der Abwesenheit von (negativer) Religiosität – der Umstand, daß er seinem Denken keinerlei Richtung mehr gibt, sondern es quasi um sich selbst kreisen läßt: hypertroph und solitär. Seine „Hirnmaschine“ läuft ohne bestimmte Inhalte. Und Descartes’ „Ich denke, also bin ich“ wurde schon in dem Gedichtband Schädelbasislektion ersetzt durch die ironische Festschreibung, daß „,Ich denke‘ nur ein Bluterguß“ sei.
In Falten und Fallen, Grünbeins dritter Verssammlung, wird das Maß an Kopflastigkeit zwar deutlich verringert, es gibt aber nach wie vor keine Ausbalancierung von Denken und Fühlen, sondern weiterhin ein bloßes Flattern von Nerven, enden, die sich hie und da mit einem Stück sinnlicher Welt und konkreter Erfahrung verknüpfen.
Das Ganze bleibt sonderbar orts- und beziehungslos – entsprechend dem, was Gustav Seibt „Metropolenerfahrung“ nennt, ein Wort, das durchaus greift bei der Beschreibung dieses dissonanten Dichters, der in einem der Texte des Zyklus „Variationen auf kein Thema“ von sich selber sagt:
Skeptisch, belesen, gereizt… ganz im Stil
Der Annoncen, unendlich fern
Jeder Landschaft…
Durs Grünbein ist ein von der Natur abgenabelter Poet, der sein mit großer Perfektion betriebenes lyrisches Agieren erklärtermaßen dem Treiben auto-rasender Jugendbanden und dem S-Bahn-Surfing gleichsetzt, den nervenaufpeitschenden Kicks von Kids, denen er nur eines voraus haben will: sein Faible für die Wortkunst.
Hier freilich liegt der entscheidende Unterschied. Grünbein ist kein sprach-ohnmächtiger Stadtnomade, sondern ein hochreflektierter Intellektueller, der sein – mit Fremdworten und medizinischen Termini durchsetztes – Vokabular zu Kompositionen fügt, die in ihrem Raffinement bisweilen an die Wortmagie eines Wallace Stevens erinnern:
Seltsam, wie Klänge sich ändern. Im Jahrhundert der Violinen
War das Zertrümmern der Schneckenhäuser Musik.
Von völlig anderem Naturell als der 1962 in Dresden gebürtige Grünbein ist Rainer Malkowski, der 1939 in Berlin geboren wurde und längst zu den verläßlichen Größen der (west)deutschen Gegenwartsdichtung gehört. Im Gegensatz zu Grünbein, der – wie nicht wenige Intellektuelle in unserer Zeit – „das Ich millionenfach zerlegt und aufgelöst“ wissen will, geht es Malkowski um die Rettung und Stabilisierung des Ich, eine, wie mir scheint, plausible Daseinsstrategie, denn: was, wenn nicht das menschliche Subjekt, kann der Kristallisationspunkt dessen sein, was wir als Wirklichkeit erleben?
Malkowski, jeder großen Geste und allem Theoretisieren und Philosophieren abhold, versichert sich der Welt durch enge, geradezu freundschaftliche Kontaktaufnahme mit dem Detail. So hat er seinen neuen Lyrikband denn auch nicht von ungefähr Ein Tag für Impressionisten betitelt, nach einem Gedicht, in dem es heißt:
Auch nach drei Wochen
noch keine Spur von Langeweile
beim Anblick des Sees.
Malkowski gehört nicht zu jenen Dichtern, die, wie etwa der Däne Klaus Rifbjerg meinen: „New York und Timbuktu / liegen um die Ecke.“ Für ihn gibt es immer noch Orte mit Ambiente, noch Landschaften, Ereignisse und Stimmungen, die nicht ihresgleichen haben und deretwegen es sich lohnt, aufmerksam zu sein.
Was bei Grünbein atomisiert, zu urbanen Sensationspartikeln zerrieben wird: die Sekunden und die Ewigkeiten, aus denen das Zeitgefüge besteht – bei Malkowski besitzt es zentrale Bedeutung, stets in spürbarer Nähe zur empirisch erfahrenen und psychisch vertieften Alltagswelt: „Ein Druck auf die Taste / beendet die Hamlet-Situation.“ So lapidar beginnt ein Gedicht über das „Staubsaugen“, ein Text, in dem sich wenige Verse weiter zwei Zeilen finden, die keine schlechte Maxime für Menschen sind, die sich in den großen Städten weder anonymisieren, noch von der Wissenschaft zu einer nichtigen Kollektion von Genen und physiologischen Reflexen herabwürdigen lassen wollen:
Rette sich wer kann
ins Überschaubare.
Durs Grünbein löst das Bewußtsein auf „in ein Vielerlei von Reizen“; Rainer Malkowski sammelt einige ihm wesentliche Bruchstücke der Realität in der Erfahrungslinse seines Egos. Wer macht es nun richtig: der postmoderne Sophist, der, „overnewsed and underinformed“ wie wir alle, die Wissenschaft mit (pseudo)wissenschaftlichen Mitteln ad absurdum führen will? oder der subtile Sensualist, der instinktiv Abstand hält zur Posthistoire, die die gesamte Natur und die bisherige Menschheitsgeschichte als nostalgische Altlast verabschieden möchte?
Hans-Jürgen Heise, die horen, Heft 183, 3. Quartal 1996
Durs Grünbein: Falten und Fallen
„Variation auf kein Thema“ – so beginnt Durs Grünbein eine Reihe von 39 formal straff komponierten Gedichten, die das erste Drittel seines neuen Bandes Falten und Fallen eröffnen. Wer bereits die Gedichtbände Grauzone morgens (1988) und Schädelbasislektion (1991) kennt, ahnt, daß auch diesmal ein Balanceakt unternommen wird, der das Gedicht zwischen die Stühle Empfindung und ,Befindlichkeit‘ setzt. Es zieht sich auf rhythmische Muster zurück, um sich von hier aus in den Nuancierungen umso stärker der Konfrontation zu stellen. So vermag Grünbein mit seinen formelhaften Versen sich distanziert und mit Sympathie zugleich der wissenschaftlich-technologischen Seite der Welt zu nähern und die eigene Gefühlswelt skeptisch – und mit einer gewissen Kühle – dagegenzuhalten. Die Dissoziierung des lyrischen Ich wird nicht nur in Kauf genommen, sondern geradezu zur poetologischen Grundregel erhoben. Sie bewahrt auf diese strenge und auch listige Weise einfache Verse, Bilder und Metaphern davor, achtlos in Klischeekisten abgelegt zu werden und versetzt das Gedicht in eine neue Lage: im weiten Überblick führt die bei Grünbein scheinbar ungebrochene Lust am Schreiben zu einer Nachdenklichkeit, die keine engen Grenzen kennt: Es geht nicht um ein inflationäres sauertöpfisches Lamento einer deutsch-deutschen Vereinigungsmisere, es geht schlicht darum, ob ein Ich den vereinnahmenden Kräften der ungezügelten Warenwelt, der Wissenschaft und der Technik noch etwas entgegenzusetzen hat:
Sieh, wie oft du zurückzuckst, gespiegelt
Im Lackglanz von Kühlerhauben,
In metallischen Sonnenbrillen, dir selbst
Widerfahrend in einer Drehtür,
Die dich hineinzieht. So schnell vervielfacht,
Warst du immer schon vor dir da
Wie der Igel im Märchen, lästiges Visavis
Der tastende Ton seiner lyrischen Sprache weicht in den weiteren Teilen des Bandes („Menschen ohne Großhirn“, „Aus einem alten Fahrtenbuch“, „Falten und Fallen“ und „Hälfte des Ohres“) einem gestrafften, pointierteren Duktus mit Bildern und Metaphern. In gleichsam anatomischen Schnitten werden Landschaften ebenso wie Lebewesen und Körperteile seziert und in einer auch an Benn erinnernden Weise neu und schaurig-irritierend komponiert. Daneben stehen unvermittelt Anleihen aus der Antike oder auch in eingeworfenen Brocken Anspielungen auf Philosophen und deren Sichten: Findlinge, die bestaunt und in das Bild eingefügt werden sollen. In diesen Irritationen mag der Leser sich dem „homo sapiens correctus“ nähern, wie ihn das wohl interessanteste lyrische Talent der letzten Jahre zeichnet.
Lutz Roggemann, Deutsche Bücher, Heft 1, 1994
2.3 Falten und Fallen
2.3.1 Der traurige Körper der Konsistenzlosigkeit im Regime der Zeichen.
Zur Variation auf kein Thema
Die Texte sind „unprätentiös, manchmal leicht zynisch, manchmal aber auch belanglos.“1 Was Stefan Sprang auf einige Gedichte der Schädelbasislektion angewandt haben wollte, lässt sich mühelos auf die Textreihe der Variation auf kein Thema übertragen. Die Kritik, die in dem Urteil steckt, kann nur bedingt von dem Argument aufgehoben werden, dass die Belanglosigkeiten dem Sujet entsprächen.
Exemplarisch für die 39 Variationen ein beliebiger Text:
Grundlos, wie Leben entsteht, ist es bereit
Zu vergehn in den Kehlen,
Durch die Finger zu rinnen, die Wand hinab.
Was sich nie ausging, war Angst.
In jeder Kneipe zu haben, am rechten Fleck
War es der Dampf an der Theke,
Der Geruch von geschlachteten Hühnern
Aus Küchen, das ranzige Öl,
Das Zerkochen von Meeresfrüchten zu Müll.
Schaudernd siehst du den Krebs
Mit verbundenen Scheren, Forelle und Aal
Unterm Schlammbauch des Karpfen.
Im Kofferraum schreit eine Katze nach Luft.2
Variation auf kein Thema. Also mit der Sprache ins Nichts dringen, also Modifikation des immer Gleichen, des immer wieder Spröden und eigentlich Erzählensunwerten. Durs Grünbein setzt keine Exotik, sondern einen Grauraum in Szene – was (eigentlich) kein Thema sei, sind die täglichen Routinen, inklusive der Verläufe am Rand der Wahrnehmung und des Denkens.
Das, was Grünbein zu thematisieren versucht, erhält seinen einzigen Reiz aus der Suche, aus dem Sich-Bemühen um die Reste, die die Welt bilden. Mit dem „Fortfahren… wohin?“3 des ersten Gedichts empfängt die Suche bereits ihre Namenlosigkeit. Es gibt keine positiven Optionen, suggeriert der Text kaum noch versteckt; das Fortfahren ist „nur der fällige Ausdruck / Für Flucht […]“4
Die trotzdem angestrengte Fluchtbewegung, die Ungeordnetheit des Autors schlägt sich in den ,Variationen‘ nieder. Variation auf kein Thema ist eine Matrix von Notaten unbestimmter Prägung. Die Bilder verharren in sich, sind rudimentär, ohne im Kontrast Reibungen zu erzeugen und bleiben seltsam konsequenzlos und solitär.
Man kann dieser Lyrik Kommunikationsverweigerung zuordnen – die einzelne Szene auf dem Teppich der Variationen bietet wenig mehr als Ansätze und idealiter Stimmungskongruenz: „Kein Rat, keine Dialektik, kein Durchblick. Aber freiliegende Nerven als Fremdenführer durch die fremde Welt“5, schreibt Eberhard Falcke.
Welche Konsequenz hat das Leben? Die innere Frage wird schweigend nach Draußen weiter gegeben:
Mit den Hormonen im Fluß,
Ein anatomischer Torso vorm Spiegel,
Die Arme im Anschlag, Augen
Weit aufgerissen… um was zu sehen?6
Ähnlich treibt es den Dichter in einer anderen Variation um:
Mit dem Innern im Zwielicht, warst du.
O diese Zartheit der Lungen…
Das Xylophon aus verborgenen Knochen
Vom Schädel bis zum Kleinen Zeh.
Und daß die Körper schwer finden, was
Ihr Begehren sucht, daß Gewalt
Sie in Schlingen zwingt, bis sie hastig,
Aufgezehrt vom Geschwätz,
Zum Ausgang drängeln, – wohin damit?7
Durch die Lyrik werden die Erfahrungen isolierter Momente und Bilder kanalisiert. Grünbein selbst gebraucht folgende Metapher, die besonders auch auf die stilistisch eher besinnlichen Texte der Variation auf kein Thema zutreffen: „Dichter sind Dornauszieher, Ihr Sinnbild ist nicht der Mann mit der Lyra, sondern der laufbehinderte Bursche, der am Wegrand sitzt, über den eigenen Fuß gebeugt.“8 (Ergo könnten die Variationen Versuche des Dornausziehers sein, den ,Schmerz‘ mit der Formulierung erträglicher Bilder zu kaschieren.)
Durs Grünbein folgt dem Alltag in dessen Schattenseiten und Druckstellen, die nicht frappant genug sind, um das Ich zu motivieren:
Kein Dorn im Handtuch, kein Blut
An den Fliesen – das Röcheln im Ausguß
Heißt Hygiene, nicht Tod.
Und ob Seife noch immer aus Knochen
Gemacht wird, der Schaum
Auf den Handlinien trocknend, sagt nichts.
Ängstlich belebt, an den Haaren
Herbeigezerrt, stirbt ein kurzer Verdacht.9
Die Gedichte formulieren eine Unaufgehobenheit des lyrischen Subjekts. Die Anonymität, die strikte Trennung des Ichs zur Bezugswelt, ist integral. Straßen sind auf Durchgang gestellt, das Zimmer ist unwirklich, der Horizont geschlossen10 – die Texte replizieren Erfahrungen der Unanpassbarkeit.
Der Blick ist schon kalt
Bevor das Leben erkaltet.11
Ein einziger wirklicher Fluchtpunkt scheint das klandestine, sich einigelnde Spiel mit dem Selbst.
Unsichtbar sein, sich geräuschlos im Raum
Bewegend, ein Körper aus Luft,
[…]
Wie an Spinnweb-Flaschenzügen sich leicht
Durch Fenster hangelnde, ein Ariel
Ohne Auftrag und unter niemands Vaterblick.12
Grünbein scheint hier das Ich zum Schatten machen wollen, zum geheimobservierenden Teilhaber, der nicht so tief in die „chaotisch flottierende Dingwelt“13 eindringt, dass er von ihr festgehalten wird.
Im Ton dieser Lyrik breitet sich Blasiertheit oder „eine Gelassenheit in der Verzweiflung“14 aus, wie sie Peter Hamm in Bezug auf die Poesie Grünbeins bemerkt. Die Texte treffen sich nicht in der Chronologie, sondern in den Fragestellungen, Beobachtungen, Selbsteinschätzungen. Die „wache Weltaneignungsgeschicklichkeit“15, wie sie Hamm Grünbein zueignet, entwirft dichte Landschaften, die in ihren Andeutungen relativ offen sind. Es geht um die Bewältigung der ernüchternden Tristesse wiederkehrender Abläufe, deren – wenn überhaupt vorhanden – Kolorit sich nur an der Oberfläche unterscheidet. Burkhard Lindner interpretiert die Variation (wie den gesamten Gedichtband) als eine fortwährende Phänomenologie des gespenstisch entfremdeten Lebens im Stil autistischer Projektion.16
Was dem einzelnen Gedicht an epischem Atem konsequenterweise fehlen muss, ersetzt der Gesamtkomplex, die immer weiter betriebene Ableitung eines Themas in Variationen. Das lyrische Ich manövriert durch den „Verkehr der Indizien“17 und variiert die Stimme dabei zwischen einem sanften Bei-Sich-Sein und geringschätziger Geste.
„Er produziert“, schreibt Michael Braun „,Images of a final world‘18, in der eine kümmerliche Spezies Mensch sichtbar wird, entblößt von aller Metaphysik, aller Hoffnung auf Zukunft beraubt.“19 Auch in der Variation auf kein Thema ist jede Idylle von Düsternis infiltriert, ist das Leid immer ein schon früh gewesenes. Bildlich und unschuldig gesprochen:
Was heißt schon Kindheit, […] der Geruch
Erbrochener Milch, das Komplott
Großer Körper, die dich fütternd erdrückten20.
Oder etwas essentieller:
Die Zerreißlust der Parzen von Anfang an.21
Ob Retrospektive, Blick in den Spiegel der Gegenwart oder Vision – es gibt für den Dichter keine Resonanz. Ihn bewegt die Angst vor der Gewöhnung an das Gewöhnliche und die Furcht vor der Fähigkeit zur Reflexion. Angesichts der pathogenen Umstände ist die Konsequenz fast zwingend:
Fröstelnd unter den Masken des Wissens,
Von Unerhörtem verstört,
Traumlos am Tag unter zynischen Uhren,
Fahrplänen, Skalen, beraten
Von fröhlichen Mördern, vorm Monitor, –
So wird man Sarkast.22
Doch der Sarkasmus allein trägt die „anthropologischen Erkundungsfahrten durch die Eingeweide der modernen Metropolen und ihrer Bewohner“23 nicht. Die Reihung verschiedener Metaphern, die Kreuzung der Stimmen und der hochkontemplative Duktus machen die Lyrik der Variation zu einer ziemlich flüchtigen Erscheinung. Durch die Überreizung mit brach liegenden und verstiegenen sprachlichen Schöpfungen verliert der Text an Evidenz.
Das „Konzept eines Schreibens am Schnittpunkt sehr vieler Stimmen“24, welches Grünbein für die Schädelbasislektion postulierte und in Falten und Fallen fortsetzt, führt – bei konsequenter Umsetzung – zu einer babylonischen Sprachmelange. Die Leerstellen (zwischen den Stimmen), von denen Lyrik ja ansonsten lebt, sind zwar mit Klang aufgefüllt, markieren auch Unruhe, führen aber phasenweise nur ins Ungewisse. Manches Gedicht ist lose Sequenz, traumartiger Vergewisserungsversuch, aphoristische Formulierungskette – nahe am urbanen Gemurmel25, das Durs Grünbein eigentlich souverän replizieren will.
Man muss den Angriffen Fritz J. Raddatz’ nicht unbedingt folgen, welcher meint:
Fast ausnahmslos alle Arbeiten von Durs Grünbein verraten eine Unsicherheit der Bildsprache, mal disziplinlos, mal peinliche Klischees bedienend.26
Aber der kritische Einwand von Jörg Lau, dass sich metaphorische Geschwätzigkeit und lautliche Prahlerei in die Zeilen stiehlt, „wo eben noch die poetischste Sachlichkeit waltete“27, ist plausibel. Der Vorwurf des Überbordenden, immer wieder aus den Reaktionen der Interpreten heraus zu lesen, lässt sich schlechterdings von der Hand weisen. Das metaphorisch Strömende geht bei Grünbein leicht in ein Reißen über, dem nicht eben einfach zu folgen ist.
Dem Zyklus der Variation auf kein Thema sind weitere Gedichte zugeordnet, die mit den anderen Texten den Charakter unabgeschlossener Meditationen teilen. Sie scheinen weiterhin wie Übersetzungen von Augenblicken unterschiedlicher Sprachen und Zeit, aneinander gereiht; in ihren Falten lauern eingestreute Existentialismen wie Fallen für gängige Chiliasmen („Mit den Tagen kommen die Tode, das ,Ich bin der ich bin‘“28). Nach den Fragmenten29 heißt In den Fragmenten – „Eine Flora aus Allusionen / Überwuchert die Oberflächen“30, kann man mit Grünbein gegen ihn sagen, oder Stimmenschotter31 mit Wulf Kirsten. Die Lyrik changiert zwischen und in den Elementen. Disparate Texte mit phänomenalen Sprachvarianzen wechseln sich mit im Grund sehr beschaulichen Gedichten ab. Hin und wieder sind diese Erinnerungsstücke fast episch (Trigeminus32), dann wieder- wie in den Ostrakoi Hedo, Geo und Xeno33 – kaum einmal narrativ aufgebrochen, nur Spuren von ,Stimmen‘ verfolgend. Es strapaziert die Lyrik beinahe, wo das Parlando Grünbeins den bemühten Distanzton eines über den Dingen Stehenden anschlägt:
Ihr Aschermittwochspatzen…
Hungrig, zerzaust, fast erstickt
Im Mief einer Sex-Kabine, in Peepshow-Einsamkeit
(Klick!)
Jeder Aufflug ein Quickie, ein Zank um Speisereste,
Schrill zwitschernd, ein Münzenregen aus einem Automatenloch.
Ehemals Gardeflieger auf Zypern, heute Maskottchen
Nervöser Großstadtlieben, sich rempelnd im Zoff,
Sind sie, wie immer zur Stelle,
Nur ohne Auftrag, dem Tod
Um ein kurzes Flügelschlagen voraus.34
Eines der durchgängigen Motive ist die kontrollierte Depression, der Verweis auf Ernüchterung und Desorientiertheit. „Überall gab es Tatorte, graue Regionen. Ein kalter Atlas / Wuchs mit der Kopfhaut über Nacken und Stirn“35 weiß Grünbein im ,trigeminischen‘ Blick in den Mikrokosmos der eigenen Kindheit. Oder, in postcartesianischer Verunsicherung:
Zwischen den Armen
In Klammem gesetzt, war der Kopf ein gesichertes Ziel
Für den göttlichen Anschlag, den kosmischen Staub
Landschaft und Denken und Ich, alles lief auseinander.36
Am Rand der Befunde aber herrscht Schweigen, die Texte enden als anradierte Szenen. Das Erzählte ist (selbstgefällige) Rhetorik, kalkuliert mit dem Ich als verlorenem, konsistenzlosem Körper, und verfällt ins Charmante. Oft sind die Texte komplexe Aufbauten, deren intentionale Struktur sich nicht entdecken lässt. Die Polyphonie steht zu sehr unter dem ,Regime der Zeichen‘.
Die Nonchalance der Semantik, das Spielerisch-Andeutungshafte und der Drang zur metaphorischen Chiffre verschließt die Dichtung – und bedient durch die Öffnung zu spekulativer Analyse der Texte die unterschiedlichsten Rezeptionsverhalten. Im Zweieck37 beispielsweise, ein thematisches Intermezzo im großen Sakral der umfassend organisierten Distanzierung gilt Iso Camartin als eines „der schönsten Liebesgedichte unseres Zeitalters“38, während Franz Josef Czernin den siebenteiligen Text ins Misslungenste deutet:
Es ist ein Gedicht, das die Ausstrahlung von Hochglanz-Erotik, schicker Jugend-Kultur, einen auf das Modische, auf das Zeitgeist-Magazin herunter gekommenen Existentialismus pflegt, veredelt durch preziöse und prätentiöse Metaphern […]39
An dieser Stelle zwar etwas überzogen und in der Polemik leicht verirrt, aber im Kontext der die Kritik beherrschenden Goutierungen erfrischend – Czernin weist der Lyrik Grünbeins punktuell „Schlager- oder Chanson-Sentimentalität“40 zu – und allgemein relevant für eine kritische Betrachtung der Texte. Grünbeins ,Liebesgedichte‘ befinden sich weitgehend, was bis zu einem gewissen Grad auch Methode ist, in einem Leerlauf, der nicht nur aus der möglichen Enttäuschung eines auf Pointierung und Prägnanz eingestellten Lesers resultiert.
Im Zweieck ist in Lyrik aufgebrochene Beobachtung, die Bedeutsamkeit transportieren will. Grünbein richtet sich in einem trägen Fluss von inneren Bildern ein. Die emotionalen Filigrane, unbestimmt in die Zeilen gehaucht, wirken wie Atem ohne Lunge. Die versucht prosaische Sensibilität, die klangvollen Reflexionen zwischenmenschlicher Konstellationen sind vielleicht sprachlich gelungener Ausdruck diaphaner Einsamkeiten41, lassen aber kaum mehr als komprimierte Dekompression durchscheinen und fallen insgesamt hinter die poetische Technik zurück.
Weniger als in der Schädelbasislektion wird Durs Grünbein seinem poetischen Gebot gerecht, das er in Variation auf kein Thema doch so radikal formulierte:
Denk von den Wundrändern her, vom Veto
Der Eingeweide, vom Schweigen der Schädelnähte.42
2.3.2 Zur Semantik eines Titels: Falten, Fallen und die Kongruenz von Leitmotiv und Text
Über jede neue Falte sollte man sich freuen, weil sie die Glätte nimmt..
Hugo von Hofmannsthal
„Wo sieht Grünbein Falten?“, fragt Iso Camartin bei der Verleihung des Peter-Huchel-Preises und antwortet weitläufig:
Im Papier, im plissierten Flanell, in urzeitlichen Gebirgsfaltungen, am Körper, im Gesicht, in der grauen Hirnmasse, oder vielleicht sogar im Uterus.43
Eberhard Falcke meint, es handele sich bei den Falten „um jene rückschlägigen Biegungen des Zeitpfeils, die alle frohgemute Fortschrittslaune düpieren“44.
Falten und Fallen können sowohl Substantive sein (die Falten, die Fallen) als auch als abstrahierte Verben auf ein haltlos-stupides Sein autistischer Tätigkeit verweisen (das Falten, das Fallen). Im titelgebenden Gedicht heißt es leicht übersetzbar:
Zwischen Stapeln Papier auf dem Schreibtisch, Verträgen, Kopien,
Baute der Origami-Kranich sein Nest, eine raschelnde Falle.
Jeder Tag brachte, am Abend berechnet, ein anderes Diagramm
Fraktaler Gelassenheit, später in traumlosem Kurzschlaf gelöscht.45
Der Mensch steht hier unter dem Dominat des Alltäglichen, Scharen unbedeutender Relikte hinterlassend, ein Lebewesen in regulierten Zyklen.
Leute mit besseren Nerven als jedes Tier, flüchtiger, unbewußter
Waren sie’s endlich gewohnt, den Tag zu zerlegen. Die Pizza
Aus Stunden aßen sie häppchenweise, meist kühl, und nebenbei
Hörten sie plappernd CDs oder fönten das Meerschwein,
Schrieben noch Briefe und gingen am Bildschirm auf Virusjagd.46
Das in Falten gelegte Leben gleicht einer sinnentleerten Grauzone – Fallen sind die Falten immer.
Insgesamt sind die Falten und Fallen jedoch ,Widmungen an das Hirn‘47 – Versuche, über das Bild der zerebralen Struktur zu einer Metapher für Verschlungenheit und Konfusion zu finden.48 Das Gehirn ist Grünbein Spiegel für das Ephemer Menschliche. Falten und Fallen realisiert metaphorisch die Zielrichtung der Neurologie, die Grünbein stets verfolgt:
Jeder spricht über das Internet, ich würde gern mehr über das Gehirn sprechen. Alles ist nur im Hirn: Es ist für jeden von uns der eigentliche Schauplatz, fundamental wie Raum und Zeit.49
Die Zerebral-Lektion, welche Durs Grünbein in Falten und Fallen50 vertont, meint die Vergänglichkeit51, sentimental besungen. Ein „seltsam, wie Klänge sich ändern“52, spricht fast immer aus den Gedichten. „Das Ohr in der Uhr“53, rekrutieren sich die Texte gleich einem Gespinst aus dem Spiel mit den Zeiten. Es sind Variationen über Variationen des Seins, die nach den oft rasanten Texten der Schädelbasislektion sehr ins besonnene Fach neigen. „Ein Nichts an Körper“ konstituiert sich, „ein unbekanntes Tier“54, mehr anderen als sich selbst gehörend.55
Grünbeins Gedichte sind Prophetien des Paradoxen. Der Mensch ist eine Marionette am zynischen Band der Decuma56:
In fünfhundert Jahren nichts als das Verschlüsseln der Gleichung
Vom Homo sapiens aufrecht in Leonardos Kreis und in Agrippas
Magischem Pentagramm – in dieses X über der Tür zum WC.57
Im Zuge der Virtualisierung der Umwelt wird der Mensch unter Menschen zum icon unter icons.
„Alles Verheißungsvolle bleibt draußen, drinnen spielt die Musik / Reibungslos ihre Absenzen“, heißt es im gleichen Text. Eine Paraphrase für die meisten Arbeiten Grünbeins, in denen sich das Innere als Kreuzung vieler Fremdbestimmungen präsentiert. Deutlich genau so wie der topisch gebrauchte Verlust von Welt durch Wissen („Der Blick, fixiert, / Verliert an Facetten, was er an Tiefenschärfe gewinnt.“58). Die Facetten des lyrischen Blicks, welcher – stellvertretend sei hier Burkhard Lindner zitiert – auf einer anatomischen Optik fußt, bewegt sich (weiterhin) zwischen Prähistorie und großstädtischer Gegenwart59, immer den Menschen als biologischen Anthropos bilanzierend.60 Dessen permanentes Leiden findet sich als Periphrase auch beim lyrischen Subjekt:
Das Gehirn, beinahe täglich stößt es sich, Wort für Wort
Am factum brutum der Nöte […].61
Letzteres öffnet nur gelegentlich – wenn auch tendenziell lädierte – Notausgänge, nämlich in Lyrik gefasste Dignitäten des Augenblicks, die Durs Grünbein beispielsweise in Schlaflosigkeit entdeckt:
Und einmal sah ich die Störche von oben, ihre schäbigen
Flügel, gehoben, gesenkt in die Ruhe ziehender Wolken.
Drinnen im Flugzeug war es ein Motortraum,
Technischer Schlaf, der durch Zeitzonen mithielt
Auf den Routen der Tiere. Triebwerke, Wolken
Und Passagiere, das alles entzog sich
In Pythagoras’ Schweigen. Von den zahllosen Mythen,
Verbrannt, war nur Asche geblieben, eine endliche Weiße,
Zermahlen zu etwas das den Tenor des Lebens gab,
Angst vor der Zeit. Auch die Erde, für Stunden,
War unauffindbar geworden wie die wandernden Lager
Der Reiterhorden, das Grab Dschingis Khans.
Nichts verriet, wohin ihre Toten dort unten, die Mumien
Aus Pech, wenn die Städte erobert waren, verschwanden.
Auch das Epos von Meerfahrt, vom glücklichen Wilden,
Mit Stahläxten zum Christen verwandelt, lag weit
Im Dunkel zurück, schon homerisch.
Den Störchen im Keilflug
Sah man den Rückzug an Afrikas Flüsse nicht an.
Es sind Dignitäten insofern, als das Träumerische die Konsternation leicht überwiegt. Wenngleich der Text deutlich macht, dass die Trance ohne Schlaflosigkeit, ohne das Einbrechen fataler Komponenten nicht zu haben ist. In jedem Panorama Grünbeins lastet so etwas wie eine Geschichts-Erosion.
Im „Requiem für einen Höhlenmenschen“ ist der Blick auf den zum musealen Interieur gewordenen Homo sapiens der Blick in den traumatischen Bereich zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das Requiem scheint das dunkel brütende Totenlied zur Gesellschaft, ein Song auf das Letale. Der Höhlenmensch ist für Grünbein nicht in der Urzeit oder hinter Panzerglas geblieben, sondern er ist immer noch und stetig. Grünbein begibt sich mit dem Text erneut in Platons Höhle, um das Dominat der medialen Welt zu konterkarieren:
Das Übel, elektrisch verteilt, war den meisten vertraut
Wie die sichere Höhle.62
Im Requiem findet ein kontemplativerer Umgang mit der Grauzone der urbanen Lebenswelt (oder eines ,urbanen‘ Lebensgefühls) statt – mit der sich von den ersten Texten Grünbeins nicht unterscheidenden Konsequenz:
Hier waren wir sterblich, hier
Sind wir sterblich, hier werden wir sterblich gewesen sein.63
Alle Erfahrung ist kaum mehr als der dust am Rand der Wahrnehmung („nurmehr Komik blieb, makaberes Tanzen“64). Die Lyrik dazu ist allerdings auch von „banalem Analogisieren“ erfüllt, in der die „Zivilisationskritik zum bloßen Kritikgestus“65 verkümmert, wie Hermann Korte treffend bemerkt hat.
Neben dem „Anblick des Schädels, in der Vitrine rotierend / Auf rotem Samt“66 dient Grünbein ein weiterer zoologischer Wegrand67 als Fokus auf den Gesamtzustand. „Einem Schimpansen im Londoner Zoo“, „Einem Okapi im Münchner Zoo“ und „Einem Pinguin im New Yorker Aquarium“68 sind Gedichte, die Parallelen zwischen menschlichem und tierischem Dasein zulassen.
Was für ein Sprung, was für ein Riesensatz aus dem Dickicht,
Von diesem Schimpansen zu Buster Keatons traurigem Blick
Über die Reling, dem Hut nach, unerreichbar im Wasser
Und die Entfernung nimmt zu! Mit jedem neuen Unfall
Wird die Wirbelsäule ein wenig steifer, halten die Hände
Das Steuer fester inmitten der Trümmerhaufen aus Rädern
Und Blech, zerquetscht. Schon damals dasselbe Missgeschick,
Derselbe hektische slapstick. Mit nacktem Arsch voran
Zurück in die kleinen Paradiese zu friedensstiftendem Sex.69
O weh, diese Trauer, geboren zu sein und nicht als Tier,
Die böse Vergeblichkeit, hingenommen mit unbewegtem Gesicht.70
Grünbeins Zoo-Gedichte sind Sentenzen an diese Vergeblichkeit, wo die Außenwelt (Novemberkälte71) keiner befreienden Wirkung gleichkommt. Er katalogisiert letzte Mohikaner, zur Besichtigung freigegeben. Im Gegensatz zu Rilkes „Panther“ ist dem biologischen Subjekt aus der Feder Grünbeins die Freiheit nicht mehr zu wünschen.72
Das Okapi ist „Wiederkäuer verlorener Zeiten“, mit „der Exotik von Hinterbliebenen, einsam in ihrer Art“73; das Symbol ,Pinguin‘ ist „den Stufen preisgegeben, der windschiefen Welt / […] / wie elend, / Vollendet sein Nichtstun“74. Und der Mensch ist, heißt es einen Text später, wie ein „Igel / Eine so leichte Beute der Zeit.“75
Kaserniert ist das Tier eine Virtualität, mit der man sich einen idyllischen Urzustand vorgaukelt. Zoologische und botanische Gärten sind Einrichtungen, die das Leben vorführen, bevor der Mensch mit sich allein ist76. Grünbein ist der Zoo ein masochistisches Reservat:
Heute macht jeder Gang durch einen Zoo mich traurig, und es ist vermutlich längst der Genuß dieser Trauer, der mich vor die Käfige führt, wider besseres Wissen. Aus Schwäche kehre ich jedesmal zurück, aus alter Anhänglichkeit an ein verkommenes Paradies, in dem die Bewohner zwischen den Fütterungszeiten gelangweilt ihren Instinkten folgen. Nirgendwo wie hier verdichtet sich beschäftigungslose Existenz so sehr mit einem Bild der Verlorenheit, fern jeden Ursprungs und jeder Landschaft.77
Dekontextualisiert lässt sich die Aussage wie ein Statement zur Perspektive der eigenen Lyrik lesen, die die Gesellschaft ins Auge nimmt. Der ,zoologische‘ Blick ist ein dauerhafter Zynismus angesichts hospitalisierter Tiere78.
2.3.3 Hälfte des Ohres79
Wie ein Fazit der Falten und Fallen, ein Panorama der offenbaren Undurchschaubarkeiten mutet Hälfte des Ohres an. Grünbein formt Interferenzen, Signifikantenströme und wogende Wellen von angedeuteten Bezügen zu einer Anamnese der Fatalität, die kühl und süffisant intoniert ist, sich aber auf der Wortebene zu absurden Metaphern hinreißen lässt – „alles Chaos wird integriert“80, steht beinahe reflexiv im Gedicht.
Ein Ausschnitt aus dem längeren Text soll zur Verdeutlichung genügen:
Kleine psychische Illusion, sei ganz Ohr:
Ich eröffne ein Selbstgespräch.
Schwebend im siebten Neuronen-Himmel
Wo die Stimmen Erinnerung feuern,
Engramme stammelnd, ein neues Sternbild,
Punkte die auf der Hirnrinde glimmen
Wie Bordgerät nachts, leuchtende Skalen
Bin ich nach außen hin ruhige See,
Im monsunen Hormonstrom geborgen.
Alles wird zählbar, diskret, seit die Schädel
Der Mörder vermessen werden, die Abenteurer
Zum Bluttest müssen vor Reiseantritt.
Pawlow erhöht den Speichelfluß Livingstones.
In der Enge der Skinner-Box wütet Scott.
Arktische Winde wehen durchs EEG.
Röntgen strahlt Bering ins Stirnbein.
Rorschach erstellt das Psychogramm Magellans.
Columbus’ IQ hält den Staat in Schach.81
Nach der To(rt)ur durch Unfälle, Suchscheinwerfer, Begierden, Mikro- und Makrowelt, gutturales Getöse und die Bio-Savanne steht die Pointe wie das Eingeständnis einer produktiven (und im Text verifizierten) unbewussten Sprachführung:
… Kleine psychische Illusion, sei ganz Ohr:
Komm heraus aus Geräusch und urbaner Trance.
Wach unterm Sprechzwang rekelt sich Aphasie.82
Hälfte des Ohres scheint die praktizierte Erweiterung des Inhalts um die Kategorie des Rauschhaften. Dem Text liegt die Intention eines aphasischen Schreibens zugrunde, einer inhaltlich geleiteten, weitgehend aber auch unkontrollierten Sprachkomposition. Ein Programm (der Existenz) liegt vor, aber es ist im „Ping-Pong / Lichtschneller Sinnesdaten“83 fragmentiert worden.
Damit ist Hälfte des Ohres so etwas wie eine zur Imagination einladende, den Grundtenor des Befindens aber schon mitgebendes metaphorisches Reservoir. Das Gedicht, quasi der Schlusschor zu Falten und Fallen, kultiviert die Aphasie als notwendige ,Ingredienz‘ intuitiven Schreibens. Eindeutigkeiten sind von dem ,Falten werfenden‘ Text nicht zu erwarten.
Ihn reize „jene scheinbare Klarheit, die plötzlich in Stottern ausbricht, das Wetterleuchten der Aphasie“84, bekundet Durs Grünbein bereits 1991, also in der Zeit vor Falten und Fallen.
Wenn die Sätze konträr zueinander stehen, dann tut sich auf einmal was, die Logik fängt an zu schielen.85
Der Text hat idealiter – mit flapsig-jugendlichem Jargon gesagt – einen Knick in der Optik, einen Riss in der Pupille.
Hälfte des Ohres realisiert andeutungsweise das, was Grünbein von einer Idealliteratur fordert: „Sehr viel stärker mit dem Missverständnis, mit dem Nicht-Verstehen, mit der Durchkreuzung von Verstehen“86
2.3.4 Nachtrag: Aus einem alten Fahrtenbuch[footnote]Grünbein: Falten und Fallen. S. 82–91
Durs Grünbein und ein Versuch über die Falle Sprache
Wenn das Ideal der Literatur87 eine durch Verständnislücken, also semantische und strukturelle ,Fallen‘ progressiv gebrochene Literatur ist, dann muss das für den gegenwärtigen Zustand bedeuten, dass es an kontrollierten Missverständnissen mangelt, dass die literarische Sprache zu wenig Mehrdeutigkeiten bietet, zu wenig mit lnhärenzen spielt. Durs Grünbein betrachtet mithin die Literatur im Allgemeinen und die eigenen Texte im Besonderen als durch die Logik des Sprechens gefesselt, als zu sehr durch Begriffe festgelegt.
Auf die Bedingtheit der Kommunikation durch Sprache rekurriert der zwischen die Lyrik der Falten und Fallen geschobene Text „Aus einem alten Fahrtenbuch“, für den Grünbein ein interessantes Bild wählt:
… sitzend im Panzer der Sprache, […] nehme ich entweder nur die Umgebung wahr oder den Panzer oder beide zugleich, aber niemals den Raum, diesen ungeheuren Raum um mich her. […] was immer mir in den Weg kommt, ich bleibe im Panzer der Sprache, hier bin ich geschützt, einzigartig bewehrt. 88
Sprache breche sich an den Knochen,89 hatte es in Schädelbasislektion geheißen, sie sei „Rache des Fleischs / Durch den Kehlkopf“.90 Die beiden Formulierungen lassen Nietzsche erkennen, der seine eigenen Reflexionen zu Erkenntnis und Sprache folgendermaßen festhielt:
Was ist ein Wort? Die Abbildung eines Nervenreizes in Lauten.91
Der Panzer, als umfassenderer Knochen, bildet ohne Umschweife die Kasernierung des Bewusstseins durch die Sprache ab. Er verkörpert einerseits die Starrheit des Materials, ein Manko an Flexibilität, andererseits steht er auch für eine Gebundenheit in Korrelation zum Kontext. Wittgenstein postulierte:
Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.92
Panzer aber legen im Alleingang keine neuen Grenzen fest, trotz der Schlagkraft, dem Überwindungswillen.
Grünbein legt den Text in den geografischen Boden seiner eigenen Biografie:
Nach dem Untergang des Sozialistischen Reiches fand sich, in einem Blechkasten, vergraben im Sand eines militärischen Übungsgeländes in Sachsen, ein Manuskript. Die einzelnen Blätter lagen, an den Rändern verkohlt, zwischen den Seiten eines Fahrtenbuchs, vermischt mit technischen und anatomischen Zeichnungen, einer Maschinenabschrift der Achten Duineser Elegie Rilkes und dem Apotheksrezept für ein schmerzlinderndes Mittel.93
Der eigene literarische Essay, der der Einleitung folgt, erhält somit den Charakter einer fremden Idee. Es wurde etwas vergraben, also verdrängt, wie auch immer beseitigt, ad acta gelegt. Das Rezept mag Zeugnis eines inneren Kampfes sein – mit einer oder gegen eine neue Erkenntnis. Die besteht im Wesentlichen aus dem Wissen, dass Sprache nur bedingt mit der Intention kongruiert und dass sie von der eigenen Stimme ablenkt.
Niemand kennt mich und niemand soll mich erkennen, bis ich zu sprechen beginne. Spreche ich erst, ist es vorbei, unaufhaltsam verschwinde ich. […] das Fahrzeug hat seinen eigenen Antrieb. […] Was du nie sagen würdest, sagt schon ein einziges Wort, ausgelost, eine der Nieten wie Schwerkraft oder Bewußtsein, Erinnerung oder Traum.94
Die Existenz in, mit und durch Sprache ist zwar kommunikationsproduktiv, aber letztlich auch hemmend. Die Ich-Wiedergabe ist durch die „Borniertheit Sprache“95, die Kraft des Begrifflichen begrenzt.
Bereits in der Schädelbasislektion taucht jene Begrenztheit – Grünbein nennt sie „peinliche Immanenz“96 – an exponierter Stelle motivisch auf. Das System der Sprache ist die Barrikade zur Transzendenz. Erst im Verlust des Bewusstseins an das Unbewusstsein wird diese Falle aufgelöst, „erst ein Blindflug macht frei“97, heißt es in diesem Entwurf.
Für Grünbein gibt, so Burkhard Lindner, die Sprache „keine poetologische Botschaft mehr her. Sie ist hybrid wie das Vokabular, das im Gedicht als Kauderwelsch zusammenfindet und in der Körperlichkeit einen Fluchtpunkt jenseits der Sprache sucht.“98 Aus einem alten Fahrtenbuch, bemerkt Christine Hohmeyer, „ist eine ergreifende Analyse der menschlichen Zurichtung durch Sprache. […] Zunächst erscheint Sprache wie ein Schutzschild, hinter dem sich Identität versteckt und in deren Schatten die Seele ihre Füße baumeln lassen kann. Doch die Schutzfunktion schlägt um. Aus dem Versteck wird eine Bastion, ein Hinterhalt, aus der rationalisierten Sprache ein Instrument der Herrschaft, das schließlich zur Gewalt wird.“99
Der Essay selbst scheint nicht mehr als nur inhaltlich dagegen angehen zu wollen. Er leidet durchaus an Präzisionsmangel und endet beinahe in Beiläufigkeit. Die Allegorie wird von Grünbein bis aufs Äußerste bemüht und ist besonders dort metaphorisch übertrieben, wo er die Idee in weitläufige Appositionen übersetzt:
Kurzum, mein Panzer ist auch ein wohltemperiertes Klavier, Instrument für eine andere Art von… ach was. Nach außen hin sieht er eher unscheinbar, fast trist aus, ein Gehäuse von Eigenschaften, banal und symbolisch, wie alles, was wirklichem Schutz dient. Man denke an Bunker, gebunkertes Denken, an Zwischendecken, fleckige Wände mit Winkeln für Heckenschützen, […] an Teleskope auf Mondfahrzeugen, Arbeiter über Funk verbunden, Geometrische Ballette, Intrigen und Mimikry, was für ein Wort. Man denke an Birnhams Wald, wie er auf Dunsinan zu marschiert, an Effekte m Nebelkammern, Modelle, Attrappen und jede Art Täuschung, vom Schicksal zu schweigen oder, was schwerer wiegt, Glück. Denn zu sehen ist nichts.100
Et cetera, et cetera.
Grünbeins Text ist monologisch-introvertiert und weniger drastisch als der Aufschrei etwa Nicolas Borns, der gegen „verstümmeltes Sprechen“ und ein „Krücken- und Prothesenangebot zur Selbstverlautbarung“ 101 aufbegehrt, das als Folge einer unkontrollierbar gewordenen ,Megamaschine‘ den Potenzen von Körper und Geist die Möglichkeiten abzieht. Im Vergleich zu Born, dem der oktroyierte, zwanghafte, konventionelle Slogan aufstieß, gründet Grünbeins Text, obwohl er auf die Konditioniertheit der Welt abzielt, eher auf einem intellektualisierenden Metaphernspiel.
In der beständigen Reflexion über das Reflektierte erreicht das Fahrtenbuch nicht die überraschende Schärfe entsprechender Passagen im Korpus der Lyrik Grünbeins, wo es absolutistisch heißen konnte: Sprache sei „Falle für alles.“102
Erklärungsmuster für die Problematik, die das Fahrtenbuch behandelt, finden sich in Reflex und Exegese. Grünbein spricht dort von Kokons aus Worten, von Eigenwelten der Sprache, die immer wieder zu Missverständnissen führten.103 Auch dafür steht der Panzer, für eine Vereinzelung des Sprechens durch private Semantik.
Die Sprache, ergibt sich in der Summe, ist das eigentliche Agens; ein Motor, der im Leerlauf funktioniert. Das Sprechen steht unter Artikulationszwang. Schweigen sei die einzig wirkliche Waffe,104 spricht das Ich105 aus dem Panzer. Aber es wird kaum je zugelassen. Die Sprache ist eigentlich Domizil ihrer selbst – eine der größten Fallen, die von Grünbein gespiegelt wird.
Ron Winkler, in Ron Winkler: Dichtung zwischen Großstadt und Großhirn. Annäherungen an das lyrische Werk Durs Grünbeins, Verlag Dr. Kovač, 2000
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Burkhardt Lindner: Kryptische Sehnsucht, von Heimweh zerfressen
Frankfurter Rundschau, 16.3.1994
Jörg Lau: Der Dichter als grausamer kleiner Junge
die tageszeitung, 17.3.1994
Michael Braun: Fröstelnd unter den Masken des Wissens. Der Lyriker als Sarkast
der Freitag, 18.3.1994
Michael Braun: Kleine, verwunderte Fußnote zu einer Polemik von Franz Josef Czernin
Schreibheft. Zeitschrift für Literatur, Nr. 46, November 1995
Alexander von Bormann: Schwierige Tiere
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.10.1995
Michael Basse: Augen auf – und durch!
Süddeutsche Zeitung, 30.3.1994
Rüdiger Görner: Ausflug in die Quere
Die Presse, 9.4.1994
Helmut Böttiger: Das Ich als Chirurgenwitz
Frankfurter Rundschau, 16.4.1994
Stefan Sprang: Fröhliche Mörder vorm Monitor
Rheinischer Merkur, 29.4.1994
Anke Scholl: Das Hirn ist ein metamorphosiertes Rückenmark
Einführung in die Lesung von Durs Grünbein
im Hölderlinturm in Tübingen am 26. Januar 1996
Lieber Durs Grünbein, ich darf Sie, stellvertretend für die Geschäftsführerin der Hölderlingesellschaft, Frau Valerie Lawitschka, sowie im Namen unseres Seminars „Besprechung zeitgenössischer Lyrik“ sehr herzlich begrüßen.
Großen Dank dafür, daß Sie ungeachtet des Ansturms der Einladungen von überall dennoch Zeit fanden, zu Lesung und Gespräch zu uns nach Tübingen zu kommen. Als Einladender bekommt man leicht ein schlechtes Gewissen, wenn man an den Schlußsatz der Laudatio von Heiner Müller denkt, der dem Büchnerpreisträger Durs Grünbein „ein Jahr ohne Kritiker, Lobredner und Leser“ wünscht. Wünscht also, daß man ihn allein läßt, ohne unser Dazwischenreden. Doch Ihre Zusage war besonders freundlich.
Es war nicht Platz für alle, die kommen wollten. Und es war nicht nur der Medienruhm („Ruhm: – die Summe aller Mißverständnisse, die sich um einen Namen sammelt“, das Rilke-Zitat bewahrheitet sich bei Durs Grünbein in aller Schärfe). Es gibt hier ernste und eifrige Leser Ihrer Gedichte. Ein größerer festlicher Saal war nicht verfügbar. Ein kommuner Hörsaal schien nicht passend. Auch wollten wir nicht dem genius loci ausweichen und uns vom Standort unserer Seminarvorbereitung entfernen. Darum, wie immer, der Hölderlinturm als der lyrikgemäße Schallraum – Zimmerlautstärke. Heute abend freilich platzt er aus allen Nähten, hartnäckige Einlaßbegehrende füllen den Korridor, wohin die Lesung übertragen wird.
Von Durs Grünbeins Lyrik geht eine Schockwirkung aus, die das Potential starker Lyrik durchaus bereithält. Kafkas „Axt für das gefrorene Meer in uns“ als Auftrag und Legitimation von Kunst. Es sind keine gemüthaften, gemütlichen Gedichte. Keine der traditionellen lyrischen Sujets. Die Titel der Bände schon weisen darauf hin: Grauzone morgens, Schädelbasislektion, Falten und Fallen.
In seiner Rede zur Preisverleihung „Porträt des Künstlers als junger Grenzhund“ riß Heiner Müller den zeitgeschichtlichen Horizont von Durs Grünbeins Dichtung auf: schonungslos und voll tiefen Verstehens, bewundernd und liebevoll, ergreifend, schon vom nahen Tod gezeichnet, sein letzter Text:
In Grünbeins Gedicht ist eine Generationserfahrung Form geworden, die sich bislang eher als Verweigerung von Form artikuliert hat. Es ist die Generation der Untoten des kalten Kriegs, die Geschichte nicht mehr als Sinngebung des Sinnlosen durch Ideologie, sondern nur noch als sinnlos begreifen kann.
„Was ist das Ungemütliche an den Texten von Durs Grünbein, das seine Lobredner blendet und seine Kritiker verstört?“, fragt Heiner Müller und antwortet: „Seine Bilder sind Röntgenbilder, seine Gedichte Schatten von Gedichten, aufs Papier geworfen wie vom Atomblitz.“
In seiner eigenen Ansprache (mit der Kafka-Konnotation „Kurzer Bericht an eine Akademie“ im Titel), zeichnet Durs Grünbein berichtend und verschweigend den Umriß seiner Vita, auf der dunklen tragischen Grundierung einer Existenzerfahrung (im Zeichen des ,Angelus Novus‘) der „Gewißheit […], daß in die ausgestreckten Arme, die das Leben umfassen wollen, sofort der Wind fährt und einen weitertreibt, mit dem Rücken zur Zukunft“. Gegen die Folie dieses allgegenwärtigen Hintergrunds schreibt er gelassen, spielerisch leicht, ohne Pathos. „Die Provinz hieß übrigens Sachsen, eine alte Kulturlandschaft, aschgrau geworden, darin ein Brandherd von städtischem Ausmaß.“
Heinz Czechowski, geboren 1935, blieb von dem Inferno der Zerstörung Dresdens, die er als Kind mit ansehen mußte, traumatisiert. Durs Grünbein, Jahrgang 1962, sah die Stadt in einem Abschiedsgedicht als ein „Barockwrack an der Elbe“. Es ist ein Gedicht von großer Eloquenz in elegantem metrischem Parlando, in der Manier Benns.
Da war der frühe „Wunsch, Indianer zu werden“, „eine Anfälligkeit für das Nomadische, die schon so viele Sachsen verbunden hat“. Dann der Traum, als Tierarzt nach Afrika zu gehen. Daraus wurde nichts:
die Serengeti mußte ohne mich sterben. […] Und eines Tages, urplötzlich und unangekündigt, begann ich Gedichte zu schreiben. Novalis und Hölderlin sind die ersten Ahnen gewesen […] Mit siebzehn lieh mir ein Freund ein zerfleddertes Taschenbuch der Cantos von Ezra Pound. […] Seither schreibe ich in einer Erwartung, die gleichzeitig rückwärts- und vorwärts gewandt ist, und dieser unmögliche Zustand, einige Atemlängen zwischen Antike und X, läßt sich nur aushalten, indem ich mich langsam und zeilenweise meiner Stimme vergewissere, dieses Körpers und dessen, was sich im Innenohr fing.
Von Benn war zu lernen. Eine Affinität bestand zu den schockierenden medizinischen Sujets der Expressionisten. Als deutscher Repräsentant der ,klassischen Moderne‘, die vergessenen Errungenschaften der ,Weltsprache der Poesie‘ rekapitulierend, wirkte Benn durch seinen hohen Anspruch an die Form, insbesondere durch das Vorbild des metrischen und freirhythmischen Parlando in seinem Assoziationsreichtum, durch die Ökonomie des Zitats, das Benn für die deutsche Lyrik gewann (Pound und Eliot als Pioniere und unerreichte Meister). Grundsätzlich und vor allem: die Differenz zwischen der Poesie und der übrigen Literatur, auf der Gottfried Benn insistierte. Es gibt Sätze zur Poetik von Durs Grünbein, die sich meinem Gedächtnis eingeschrieben haben mit starker innerer Resonanz, wie dieser zur Wirksamkeit poetischen Schreibens:
Wirksam aber heißt, daß es zu einer Übertragung kommt, daß sich, wie im magnetischen Feld, Energien vermitteln […]. Nur so läßt sich die unwahrscheinliche, an Geisterbeschwörung und Telepathie erinnernde Intensität lebender und toter Dichter erklären.
In dieser These darf ich meine eigene fundamentale Erfahrung mit Gedichten wiedererkennen, bekräftigt und bereichert: das Geheimnis ihrer Sagekraft, ihrer Bannkraft über den Zeitenabgrund hinweg: Gedichte der Sappho, über zweieinhalb tausend Jahre alt und noch heute taufrisch! Sie sind unter ganz verschiedenen geschichtlichen Bedingungen und Umständen entstanden, die mir nie ganz verständlich, aus Erfahrungen, die mir so nie nachvollziehbar sein werden: Sie sprechen dennoch unmittelbar zu mir. Erst im nachhinein erschließt sich durch Studium der geschichtliche Kontext. Gemäß T.S. Eliots Dictum: „The superior poem communicates, before it is understood.“
An der Sprache der Poesie ist der Körper entscheidend beteiligt, in ihrer Produktion und in der Mittätigkeit des Lesers, des Hörers. Poesie wird generiert in den Nervenbahnen, in Reflexen, in Spannung und Entspannung. Systole und Diastole, in der Führung des Atems. Der Körper, der psychosomatische Komplex und was seine Grenzen transzendiert: Telepathie, Seelenkräfte von einst, heute höchstens rudimentär und als Desiderat spürbar in der Poesie.
Die tiefste Schicht des Gedichts, vor den Bildern und der Semantik, ist die Körperlichkeit des Rhythmus. Das Wie der Sprache birgt einen Erkenntnisgehalt, der das Was der Wortsemantik transzendiert. „Der lyrische Text ist ein Protokoll der inneren Blicke“, statuiert Grünbein. Und:
Der Körper bestimmt, was die Methode ist. Hinter der semantischen Ordnung zeigt sich die anatomische. […] Denn das Gedicht führt das Denken in einer Folge physiologischer Kurzschlüsse vor. Immer unterwegs auf seiner Reise durch die Zeiten (des eigenen Körpers wie jener der Gattung, Geschichte) findet es im Gedicht einen Ort zum Innehalten, einen Aufenthalt unter den flatternden Reden
[…] dieses leise Stimmchen Dichtung
irrlichternd im Getöse aller anderen Medien.
Die Sehrinde berührt […] das Sprachzentrum, das Hörareal grenzt an die Leitstellen für Motorik und Rhythmik, und alles zusammen wurzelt […] in den präkognitiven animalischen Regionen.
Janushaft ist das moderne Gedicht. Es bewahrt etwas von der Erbschaft urtümlicher Magie und es ist zugleich Schrittmacher des avanciertesten Bewußtseins.
Durs Grünbein ist ein Dichter von überragender Intelligenz und hohem Reflexionsvermögen. Auf der Höhe des zeitgenössischen Bewußtseins ist er ein kritischer Exponent seiner Zeit. Doch sein Bewußtsein transzendiert den gewohnten zeitgenössischen Diskurs, indem ihm die Dimension der Geschichte und Vorgeschichte immer präsent ist. Ihre Katastrophen und Kataklysmen haben sich ihm eingeprägt im Anschauungsunterricht der archäologischen Funde. Von seinem Besuch der Ausgrabungsstätten von Herculaneum und Pompeji spricht er als einem Schlüsselerlebnis:
Erst dort sah ich die Wirkung dieser gewaltigen Detonation Zeit, sah das verzögerte Niederregnen der zivilisatorischen Splitter und in der berühmten Katastrophe, in Gegenwart des Vulkans, den Beweis für eine Art gedächtnisloses Gedächtnis […]. Dichtung, das hatte ich lange geahnt, würde ihm auf die Spur kommen, wozu sonst war sie da.
Und Heiner Müller sagte in seiner Rede:
[…] es ist keine Koketterie, wenn Grünbein behauptet, daß Juvenal ihm näher steht, der Autor einer andern Endzeit mit dem kalten Blick auf einen barbarischen Neubeginn.
Über den Bereich des Menschen und seiner Geschichte hinaus nähert sich das janushafte Bewußtsein dieses Dichters mit tiefem Ernst der Welt der Tiere. Durs Grünbein ist nicht nur der poeta doctus, der, abseits vom Lektürekanon, auf Seitenpfaden das ihm Gemäße aufspürt. Er ist aber nicht nur in Bibliotheken zuhause, sondern auch in zoologischen Gärten als genauer und teilnahmsvoller Beobachter der Tiere. Er ist darüber hinaus, wie kein anderer mir bekannter Dichter, von der biologischen Wissenschaft tief beeindruckt und in ihr bewandert, fasziniert von den Erkenntnissen der Neurobiologie, die zu Denkanstößen seines Dichtens wurden.
Doch keine noch so verfeinerte Kenntnis der Nervenbahnen vermag den Übergang der meßbaren objektiven Daten in die Subjektivität des Bewußtseins zu erklären, die (…). Unerklärlich bleibt die nicht deskriptive Sprache der Poesie, die den Bereich des Möglichen und Denkbaren eröffnet. Durch alle Wissenserweiterung hindurch besteht das Geheimnis der Poesie, für das der Dichter Durs Grünbein einsteht: „ein Salto mortale ins Ungesagte“.
Das Sujet besagt dabei wenig, was sich einschreibt mit allem Nachdruck, ist eine nie zuvor so zum Ausdruck gebrachte Einsicht, ein Durchstoßen der Dimensionen, in denen gedacht und gefühlt wird, ein Salto mortale ins Ungesagte. Das kann beiläufig geschehen, mit der Unbekümmertheit eines musikalischen Kindes, fern von Alter und Tod, oder […] in der Haltung des Hasardeurs, der sein eigenes Scheitern mit letztem Worteinsatz aufwiegt.
Heines Gedichte aus der Matratzengruft, Rilkes letztes Gedicht auf dem Sterbebett. Für mich die ergreifendsten Beispiele für die unerschöpfliche Kraft des Geistes, die in aller nur zu begründeten Verzweiflung ein absurdes sperare contra spem aufblitzen läßt. Ein Hoffnungsfunke, der von der Evidenz der unvorhersehbar wandlungsfähigen, schöpferischen Kraft Ihrer Jugend, lieber Herr Grünbein, auf mich überspringt. Wenn Sie mir das als einem alten Mann, dessen Möglichkeitshorizont empfindlich schrumpft, zu sagen gestatten.
Ich möchte mit einigen Sätzen von Durs Grünbein schließen, die mir die eigene Erfahrung beim Hersagen von Gedichten, über die Jahre hin, in den verschiedensten Lebenslagen, etwa beim Traktorfahren oder Ginsterroden auf einer neuseeländischen Farm, vor Augen stellt, als das Existenzial, das es war und ist. Dieses gemeinsamen, tragenden Grundes vergewissert zu sein, unbeschadet des trennenden ,generation gap‘, buche ich als Glück. Durs Grünbein schreibt:
Soweit ich zurückdenken kann, habe ich das Lesen von Gedichten immer als eine besondere Übung zur Konzentration im Realen erlebt. Eine bloße Wortfolge konnte die ungeheuerlichste Wirkung haben: sie riß mich aus einem Zustand, der erst in diesem Moment kenntlich wurde als der eines großen solipsistischen Dauerschlafs. […] Erst in Gedichtzeilen fand das Erwachen statt. Nur dort hatte jedes Wort (auch das gewöhnlichste) den Signalcharakter eines Stop-Schilds, eines fremdartigen Emblems, bei dessen Anblick man kurzzeitig aufschrak.
Paul Hoffmann, aus Paul Hoffmann: Das erneute Gedicht, Suhrkamp Verlag, 2001
Mitschnitt der Preisverleihung des Peter-Huchel-Preises vom 3.4.1995
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb + ÖM +
Facebook + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Orden Pour le mérite + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein–Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


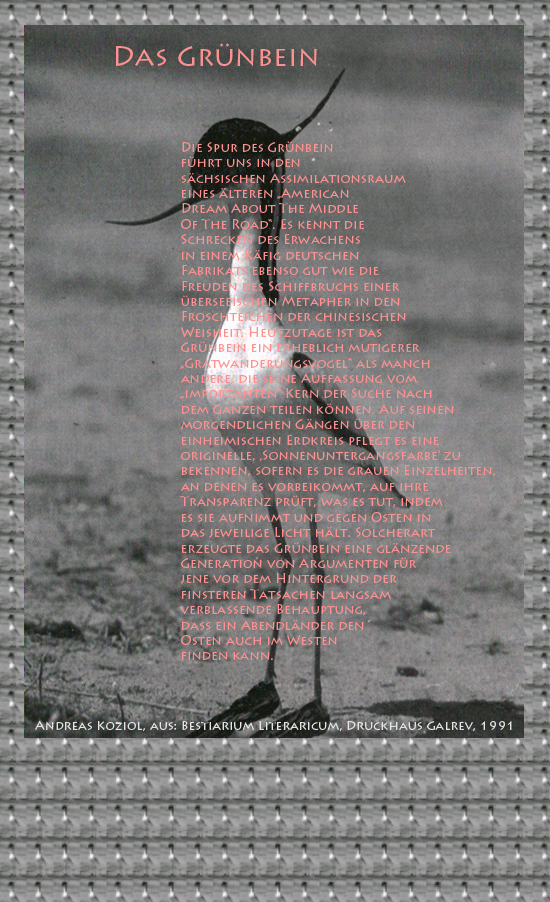
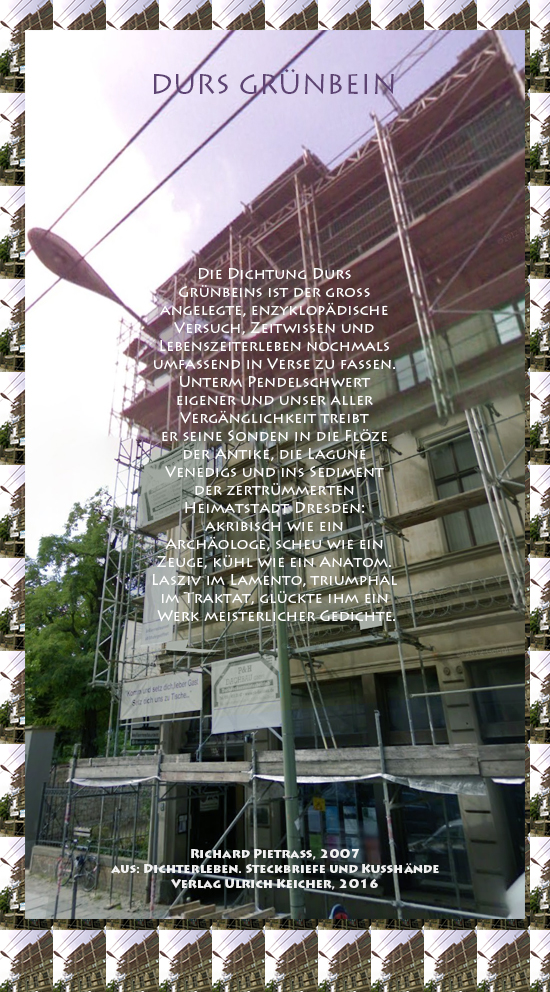












Schreibe einen Kommentar