Durs Grünbein: Strophen für übermorgen
PETRARCA
Sein Sarkophag in Arquà, eine Barke
Aus rotem Marmor, auf dem Bergkamm abgesetzt.
In diesem Adlernest hat er zuletzt gehaust. Hier starb er,
In seinem Reich, dem Reich der Sprache, Patriarch.
Frater Petrarca in der kargen Kluft, so karg
Wie keiner seiner Verse je: Aus solchem Felsgestein
Entsprang der Quell, sein steiler Sturzbach aus Canzonen.
Man sieht die Kammer noch, in der er sich verbarg.
Kein Katarakt wie dieser, und darunter, nackt
Seziert vor aller Welt: kein Herz wie seins. Da am Altar
In Arquà damals in Gedanken an die kalte Asche
Blieb auf der Zunge, salzig-süß, ein Nachgeschmack.
Inhalt
Durs Grünbeins neues Gedichtbuch ist ein poetisches Erinnerungswerk, zugleich ein Buch der Übergänge und Verwandlungen. In sieben Abteilungen und einer Vielzahl von Versformen entfaltet sich hier ein Bilderbogen zum Weltbild. Gedichte zur Herkunft stehen am Anfang, bevor sich, just im Reisegedicht, die Unheimlichkeit moderner Mobilität erweist. Ein Interludium, Strophen für übermorgen, führt zu jenem zentralen Ort, an dem der Dichter seit einem Vierteljahrhundert zu Hause ist: Transit Berlin. Genau in der Mitte der Metropole (und des Buches) findet sich auf der Museumsinsel die konzentrierte Durchdringung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Doch erneut übt die Ferne ihre Magie. Eine Folge seltsam irreal angelegter ,Charakterstücke‘ von liedhaftem Sprechgestus begleitet die Überquerung der Alpen in Richtung einer imaginären Antike und führt zur eigentlichen Frage dieser Lyrik: Was ist Imagination? Eine persönliche Bilanz in einer der strengsten lyrischen Formen, im Sonett, zieht der Dichter am Schluß des Bandes: Liebesgedichte und Lebensstudien.
„Tempus fugit“ heißt es in einem von Grünbeins suggestiven Antikegedichten über eine römische Siedlung an der Adria, heute ein Badeort. Dabei vertraut dieses Buch auf einige der haltbarsten musikalischen Bauformen; es verankert sich in den Fugen der Zeiten, setzt die Zentrifuge des Erinnerns und damit den Prozeß der Dichtung aufs neue in Gang.
Suhrkamp Verlag, Ankündigung
Die Maske wächst in das Gesicht
− Durs Grünbein spielt virtuos mit antiken Formen und neigt dabei zur Selbstbespiegelung. −
Fast schon hat man es vergessen: Anfang der neunziger Jahre war Durs Grünbein der Autor der Stunde. Er verkörperte das, was in der Luft lag, und mischte die Szene mit nervösen, zwischen Naturwissenschaft und Erkenntnistheorie schillernden Texten auf. Die Verleihung des Büchner-Preises im Jahr 1995 bildete den Abschluss dieser Sturm-und-Drang-Phase, und sie war auch ein großer Einschnitt für das Werk des damals 33-Jährigen. Heute ist das Image Grünbeins genau das Gegenteil von damals. Die Jüngeren stoßen sich an seiner Rolle des Klassikers, in die er virtuos hineinschlüpfte, die der Literaturbetrieb ihm aber auch regelgerecht maßschneiderte. Mittlerweile scheint Grünbein sehr weit von dem entfernt zu sein, was „in der Luft liegt“, er hat mit den aktuellen Lyrikwellen überhaupt nichts zu tun. Sein großer Rivale Thomas Kling wurde jahrelang als Gegenfigur aufgebaut, als Vertreter des neuen, rhythmischen, mündlichen Performancecharakters der Lyrik, als schneidender Neomodernist. In einem seiner letzten Texte brachte Kling derlei Stimmungsdifferenzen auf den Punkt, er bezeichnete die Rezeption der Antike, die bei dem jungen Büchner-Preisträger unübersehbar in den Mittelpunkt rückte, als „Sandalenfilme aus den Grünbein-Studios“.
Grünbeins neuester Gedichtband ist sehr umfangreich und wirkt wie eine vorläufige Conclusio, eine Zwischenbilanz. Doch erscheint vieles disparat. Der Titel Strophen für übermorgen zeigt in seiner Vieldeutigkeit bereits, dass man sich auf etliche doppelte Böden gefasst machen muss. Natürlich wird dabei mit dem Klassikerstatus gespielt, mit der Zeitlosigkeit der Antike – wenn auch der Rekurs auf die Stoffe der alten Griechen und Römer in diesem Band gar keinen großen Raum einnimmt. Grünbein versammelt seine charakteristischen Themen. Die Herkunft aus dem Osten oder allgemeiner: der Osten als existenzielle Größe wird als eine widersprüchliche und sinnliche Ausgangssituation beschworen; Gedichte aus diesem Kontext gehen über in die Reflexion des zeitgenössischen Berlins, der Metropole in ihrem immerwährenden „Transit“-Zustand. Auffällig ist aber auch ein Typus von Gelegenheitsgedichten, den Grünbein mittlerweile kultiviert und der im Duktus der alten Meister Reiseerlebnisse, Alltagsmomente und private Mythologien thematisiert.
Der titelgebende Zyklus Strophen für übermorgen operiert aus einer ungewohnten Perspektive mit Momenten der Zeitlosigkeit: Er tarnt sich als Science-Fiction. Die Rede ist von einem „40. April“, das Geschehen ist in eine apokalyptisch anmutende Zukunft verlagert, die aber so haarscharf an die unmittelbare Gegenwart anschließt, dass die Grenzen nicht genau zu bestimmen sind. Die Zersetzungsprozesse der Zivilisation, die immer gravierender zu spürenden Umweltveränderungen werden im Alltagston festgehalten: „Am Grund des Meeres sammeln sie Mangan in schwarzen Knollen“; es ist ein ironisches, ja bisweilen sarkastisches Spiel mit den Ängsten und Erwartungen, das ein eigenes poetisches Reservoir schafft. Eine Amsel beispielsweise ruft „Kindheitsnachmittage“ zurück, „die lang sich dehnten, zähflüssig wie Öl“ – die Bilder setzen sich aus sinnfälligen Einzelmomenten, der diffusen Bedrängung und verqueren Sehnsüchten zusammen, aus den Ergebnissen der Wissenschaft und den flackernden Bewegungen des Ich. Dieser „40. April“, der unvermittelt in einen selbstverständlich-beiläufigen Mai übergeht, ist eine stupende Diagnose von Augenblicksstimmungen.
Grünbeins Spiel mit der Zeitlosigkeit ist jedoch im Normalfall in einer nicht mehr recht fassbaren Vergangenheit verortet. Seine antike Wendung hatte Mitte der neunziger Jahre viel mit dem Büchner-Preis zu tun. Nach dem frühen Ruhm wartete er damals lange, bis er etwas Neues veröffentlichte, und es ist ein von den Exegeten noch längst nicht völlig ausgelotetes Manöver, mit dem er seinen raschen Aufstieg zum Olymp begleitete. Die Hinwendung zu den antiken Mythen, zu den Stoffen der alten Griechen und Römer, war auch ein selbstironischer, autobiografischer Kommentar. Er führte zu einer neuen Standortbestimmung, und womöglich ist dies eine anspielungsreiche Variation zu dem beliebten Motiv bei seinem Mentor Heiner Müller: Die Maske wächst in das Gesicht.
Verblüffend ist der Witz, der Grünbeins Verse oft auszeichnet, das Spiel auch mit der niederen, der Umgangs- und der Pathos-Sprache, der Wechsel zwischen hochfahrender philosophischer Reflexion und dem Wissen um die Winzigkeit des Einzelnen. Die äußere Form des modernen Gedichts – die freien Rhythmen und der freie Zeilenfall, die Akzentuierung der Sinneinheiten und die schnellen Brüche – hat Grünbein allerdings hinter sich gelassen, und darin liegt eine bewusste Provokation. Grünbein schließt nahtlos an das antike Versmaß an. Seine Gedichte bewegen sich in den Hebungen und Senkungen des althergebrachten Distichons, sein Vers zitiert augenzwinkernd die klassische Form mit Hexameter und Pentameter, das Grundmuster ist die Elegie.
Wenn neuzeitliche Beckmesser ihm Unreinheiten und Abweichungen nachweisen, ist das zu billig. Seit je gab es Rhythmuswechsel und Leerstellen in den klassischen Poemen, zumal in der deutschsprachigen Aneignung des 18. Jahrhunderts, die undefinierten Freiräume innerhalb der geschlossenen Form bargen zu allen Zeiten ein unerschöpfliches Potenzial. Und Grünbein schließt das überlieferte Versmaß immer wieder kurz mit dem zeitgenössischen Bewusstsein. Schon Goethe genoss den Effekt, das Wechselspiel zwischen Hebung und Senkung aufzuheben, indem er etwa unversehens zwei gleich starke Betonungen aufeinanderprallen ließ. Bei Grünbein kann man sogar davon sprechen, dass er die Unreinheiten, auch in den Assonanzen des Reims, bewusst ausspielt. Seine Gedichte leben von den Blue Notes, von den Abweichungen wie in der Jazzimprovisation. Vielleicht sind diese Blue Notes geradezu die eigentliche Aussage im Gedicht, wo der Abstand zwischen den vorgegebenen Formen und der Erfahrungswelt des Heute die Hauptrolle spielt.
Der Rückgriff auf die Antike birgt noch etwas, was provokativ, vielleicht auch anstößig wirken kann: nämlich die Zurschaustellung einer heiteren Gelassenheit, einer stoischen Ruhe. Es ist merkwürdig, wie die klar gegliederte Form, der Rückgriff auf die alten Bannformeln zu einer Haltung führt, die die aktuellen Diskurse und die gerade akuten Lyriktheorien gar nicht erst zur Kenntnis zu nehmen scheint.
Grünbeins Gottfried-Benn-Gedicht Bayerischer Platz überführt die Antike wie die Bennsche Lakonie, die völlig unterschiedliche Voraussetzungen haben, in etwas Neues: Da gibt es Kalauer, die in sexuellen Anspielungen den Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten genauso vor Augen führen wie den Liebhaber von Schnittblumen und kleinbürgerlichen Bequemlichkeiten. Der „Huskie“, der zum Schluss durchs Bild läuft, verdichtet unspektakulär, aber doch sehr präzise das gesamte Szenario.
„Ich bin nicht der, für den mich mancher hält“: Manchmal gibt es in fast tagebuchartigen Gelegenheitsskizzen ein Innehalten, ein Nachfragen, welches Spiel der Lyriker hier eigentlich spielt. Viele dieser Texte sind keine große Lyrik, sondern Zeugnisse einer Selbstbefragung, in denen etwas Paradigmatisches deutlich wird. Vor der reinen Anakreontik, die Grünbein mittlerweile gern unterstellt wird, schützen ihn sein untrügliches Geschichtsbewusstsein und sein Instinkt, die Form immer wieder zu brechen. Das vielschichtige Gedicht über seinen Großvater, einen alten proletarischen Recken, der redlich und schlau seine Geschicke meistert, mündet in der Schlusswendung: „Einer von vielen Deutschen, seit Luthers Zeiten frustriert.“ Ironie, Analyse und der Gestus des Abwinkens, der einen auch selber betrifft: Das in eine Zeile zu packen muss erst einmal gelingen.
Helmut Böttiger, Die Zeit, 7.12.2007
Durs Grünbeins Liebesgeflüster der Antike
− Der Schriftsteller und Büchnerpreisträger Durs Grünbein legt mit Strophen für übermorgen ein neues Werk vor. Darin greift er die Daseinsfragen auf. Er lässt Momentaufnahmen in surreale Szenen übergehen – und bleibt trotzdem ein unaufgeregter Augenzeuge.
Mutiert der „Götterliebling“ zum antiken Nippessammler? Was der Literaturbetrieb gestern in den Olymp hob, stampft er heute gerne in die Kitschtonne, vor allem wenn das vermeintliche Genie einen Fauxpas begangen hat. −
Der ostdeutsche Lyriker und Preisträger des Georg-Büchner-Preises 1995, Durs Grünbein, hat ein neues Werk vorgelegt. Es heißt Strophen für übermorgen.
Sicherlich, vor zwei Jahren zerschlug der Büchnerpreisträger des Jahres 1995 mit klingelnden Kreuzreimen, kecken Jamben und saloppen Sprüchen angesichts der Vernichtung menschlichen Lebens im Dresdner Feuersturm reichlich Porzellan. Nun aber legt er mit Strophen für übermorgen einen Lyrikband vor, der sein dichterisches Können bestätigt.
Alles riecht und schmeckt
Verse Durs Grünbeins lesen, heißt einem Körpertier mit rationalem Kalkül in seine sinnlichen Erfahrungen zu folgen. Wir erkennen Mächte und Imperien am Klang von Knochen und Stein und dem Rattern eines Maschinengewehrs. Das auf mehr als 200 Seiten in sieben motivisch gruppierten Kapiteln durch Räume und Zeiten reisende Ich hat den Chor des Aischylos, die „Klagen der Frauen Thebens“ ebenso im Ohr wie das Knacken eines gefrorenen Ahornblatts unterm Schuh oder eine aggressive Alltagspöbelei auf der Straße.
Mühelos geht ein Liebesgeflüster aus dem alten Rom in dissonantes Alltagsgequake über. Nicht in erhabenen Gefilden wandelt das lyrische Ich, sondern ganz in der profanen Gegenwart, wo ein Reifenquietschen signalisiert, dass der Flaneur noch lebt.
Was sind wir? Woher kommen wir, und wohin gehen wir? Was ist Leben, Liebe, Einsamkeit, und was ist Zeit? Kaum ein anderer zeitgenössischer Poet der mittleren Generation versteht es so wie der 1962 in Dresden geborene Durs Grünbein, sein Nachdenken über Weltzusammenhänge durch ein Ich darzustellen, das hört, sieht, fühlt, riecht und schmeckt. Diese Gedichte riechen nach Benzin und Pheromonen. Sie schmecken nach Fischmarkt, Maschinenöl und Fäulnis. Sie malen Bilder vom „Museum Zeit“, vom „Schlamm der Geschichte“ und vom „Paradies der Mäuse“.
Embryonen in Serie
Dabei reicht der erkundete Raum von Achillesverse, Jochbein und Hirn bis zum Universum. Alexandriner und Blankvers erkunden die Sprache von Haar und Haut im Zeitalter globaler Betriebsamkeit. Die wohl geformten Sonette und Oden, Elegien und freien Versen erspüren die Atmosphäre im „fragilen Monstrum Gesellschaft“.
Kannibalen geben Interviews, Embryonen werden in Serie produziert, jedes Stadtviertel, jeder Winkel der Welt ist dem Satellitenblick erreichbar. Wie gleichen sich die Metropolen („groß wie Wüsten“), durch die, wie im Gedicht „Drei Vokalisten aus der Krisenzeit“ die Karawanen ziehen.
Das Ich saugt die Eindrücke in postmoderner Manier auf wie ein Schwamm, seziert sie in Metren, betrachtet Weltgeschehen mit Abstand und kann sich oft nur unreine Reime darauf machen. Was den Klassikern die Sicht vom Turme war, ist dem Nachgeborenen der Blick vom Dach des Wolkenkratzers in Manhattan.
Ein Paradies der Metaphern
Europa, Asien und Amerika überfliegend hat Grünbein viele Bücher im Gepäck: die griechischen Klassiker, Äsop und die Sappho, dann Catull und Petrarca, von den Deutschen nicht Goethe, dafür Schiller – aber nur wegen eines Ausflugs zur Akropolis – Gottfried Benn wegen des Makabren, Ingeborg Bachmann wegen des Irrealen, das Sinn stiftet: „Böhmen am Meer“, Marcel Proust wegen der unaufhörlich zu Ende gehenden und sich dennoch ausdehnenden Zeit. Momentaufnahmen gehen in surreale Szenerien über, wenn das Ich gar aus der Zeit zu fallen scheint, der Kalender den 40. April zeigt – wie im 12. Teil des dritten Kapitels.
Grünbeins „Versspuren“ beginnen mit der Kindheitschronik, die ein ostdeutsches Lebensgefühl aus großer Distanz betrachtet, führen über Paris, Turin, Venedig, Kopenhagen und New York in asiatische Metropolen und von da zurück nach Berlin. „Europas Mitte“ ist das gesamte vierte Kapitel gewidmet. Da wimmelt es von einprägsamen Metaphern und bildhaften Vergleichen.
Die Gegenwart, weiß der Dichter, hat einen Nachgeschmack. Unheimlich und rätselhaft wirkt in den Reisegedichten „Die Logik von Nova Saxonia“. Trotz neu sich eröffnender Möglichkeit raschen globalen Austauschs wirkt die Welt in Grünbeins Versen kalt und leer.
Autofriedhöfe, Schrottplätze mitten im Wald oder ein „Nest aus Schrauben, Zigarettenkippen, Müll“ beschreiben Morbides. Schlamassel, Bankrott und Schrott sind die Signalworte im titelgebenden Gedichtzyklus „Strophen für übermorgen“. Absurd der Verdacht, dass der Verfasser mit diesem Titel einen „Ewigkeitsanspruch“ für seine Verse proklamieren wolle. Das lyrische Ich spricht hier – wie in allen anderen Versen – als Augenzeuge von Ritualen und Prozessen am Ende des vergangenen Jahrtausends und der Gegenwart.
Der Homo sapiens, den er aus der Menge filtert, macht einen gruseln:
Ein Menschentyp,
Der nichts und niemandem fortan vertraut.
Ist Grünbein ein Mahner und Warner geworden? Nein, als unaufgeregter Augenzeuge tritt er auf.
Dorothea von Törne, welt.de, 19.11.2008
Durs Grünbeins neuer Gedichtzyklus
Strophen für übermorgen nennt der Verlag ein Buch des Übergangs und der Verwandlungen, eine Anverwandlung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sehr wandlungsfähig sind Grünbeins Metrik und Strophenformen. Er findet sehr viele Ausdrucksformen und Kombinationen dafür aus der reichen Geschichte der Poetik und sucht sie in einer modernen Sagweise dem zeitgenössischen Bedürfnis nach einer lyrischen Sprache in schnelllebiger Zeit anzupassen. Auch ungewöhnliche Reimungen sind dabei , Reimformen, die modern anmuten, es vielleicht sind, aber dem, der sie liest, der sie lyrisch sprechen oder singen will, ungewöhnlich und schwer von den Lippen gehend oder einfach nur ungewöhnlich bleibend (z.B.: Wiege – Fliegen; u.a.).
Aber das Buch ist in den Bildern und Geschichten, den Gemälden und Ereignissen, die es in lyrischer Sprache ausbreitet, vor allem ein Buch des Erinnerns. Es erinnert an eigene, konkrete Erfahrungen von des Autors Berliner Zeit, seiner Wahrnehmung von Trennung und Gemeinsamkeit, vom gesellschaftlichen Stillstand und vom politischen Wandel; bis hin zur Sehnsucht nach dem anderen und nach der Überquerung der Alpen, immer auf der Suche, einer tragischen Selbstversicherung in der Ahnung einer neu entdeckbaren Antike, einer neu anzuverwandelnden Liebes- und Lebensstudie _ bildlich, ja sinnbildlich beschworen in einer versprochenen Symbiose der drei Zeitdimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Insgesamt scheint mir, dass der Verlag viel verspricht, sehr viel, was der Lyriker kaum einlösen kann: der Reichtum der Bilder, der Disparatheit der Metrik, des Sprachgestus, der offenen und geöffneten Formen macht es schwer, all diese Erwartungen zu bedienen. Ich hatte manchmal den Eindruck, weniger könne mehr sein; dass die Beschränkung den Reichtum ausgemacht hätte. Aber in einer Zeit, in der Lyrik sowieso beim Leser einen schweren Stand hat, wird man auch in der Lyrik mehr Vielfalt anbieten müssen als sprachlich-bildliche Bescheidenheit zu pflegen. Also ist das Buch und sein Autor wohl doch auf dem richtigen Weg.
buechermaxe, amazon.de, 30.11.2007
Ich, der Mythologe, glotze nur
− Durs Grünbein schützt sich mit Strophen für übermorgen gegen die Furien. −
Wenn Dichter in den Pantheon des Ruhms aufsteigen, fürchten sie offenbar den Angriff der Furien. Daher wappnen sie sich präventiv mit Ironie, um die wütenden Angreiferinnen abzuwehren. Auch der Ausnahmedichter Durs Grünbein, der wegen seiner gelegentlich allzu schwärmerischen Antike-Verehrung längst nicht mehr jedermanns Götterliebling ist, hat nun eine solche programmatische Verteidigungsposition bezogen. An einer Stelle seines neuen Gedichtbuchs hat sein lyrisches Ego unter einer aggressiven Redakteurin zu leiden. Sie tritt ihm als unbarmherziger Racheengel entgegen, eine magersüchtige Dogmatikerin, die kein gutes Haar an den mythologischen Neigungen des Dichters lässt. Sie fordert von dem verblüfften Verskünstler „Fakten statt Orakel“ und statt Mythen „blutige, brutale Vorstadtdramen“. Der Dichter ist konsterniert:
Und ich, der Mythologe, glotzte nur.
Vom Mythologisieren im Geiste seiner römischen Vorbilder hat sich Grünbein indes nicht abbringen lassen. Sein neuer Gedichtband, über 200 Seiten stark, ist ein Exerzitium in lyrischem Beharrungstrotz. In 100 Gedichten, nach Motivgruppen in sieben Kapitel gegliedert, übt sich Grünbein in poetischer Selbstbehauptung gegen den Ansturm verbissener Aktualitätspostulate. Strophen für übermorgen: Das markiert den fortdauernden Anspruch des Dichters nicht nur auf poetische Zeitgenossenschaft, sondern auch auf die Fähigkeit zur Antizipation. Und tatsächlich überwindet der titelgebende Zyklus, der im Zentrum des Bandes steht, die antikisierenden Reflexe, die sich in seinen vorangegangenen Gedichtbüchern in den Vordergrund drängten. Ein sehr heutiges Ich, apostrophiert als „der Zeuge, nach dem keiner fragt“, bewegt sich im Auto durch eine menschenleere, von Technikschrott verheerte Welt, in der alles Leben erloschen scheint. Dieses Ich befindet sich im traditionell „grausamsten Monat“, verirrt in den imaginären „vierzigsten April“. Das einsame Subjekt ist aus der Zeit heraus gefallen, die kurz zuvor noch vertraute Lebenswelt scheint in ihr apokalyptisches Stadium eingetreten zu sein. Doch am Ende löst sich der Albtraum auf, aus dem Finalitäts-Schwindel kehrt das zutiefst erschütterte Ich in die Routinen des Alltags zurück.
Schade nur, dass Grünbeins „müder Philosoph“, der hier durch die mitteleuropäische Gegenwart nomadisiert, viel zu selten „den Faden verliert“. Das Problem dieses Buches liegt nämlich nicht in der Unsicherheit, sondern eher in der Gewissheitsseligkeit des lyrischen Protagonisten. In den handwerklich tadellos geformten Oden und Elegien, lockeren Alexandrinern und Blankversen spricht ein Subjekt, das in seiner kontemplativen Behaglichkeit kaum zu erschüttern ist. Mit recht gefälligen Metaphern und Denkbildern bringt Grünbein sein lyrisches Subjekt in einen Zustand klassizistischer Abgeklärtheit, der von Selbstgenügsamkeit kaum zu unterscheiden ist. In einem Aufsatz des Bandes „Antike Dispositionen“ (2005) ist dieses Dilemma unfreiwillig benannt: Der bewunderte Horaz, so steht da zu lesen, sei in seiner poetischen Darstellung des römischen Gesellschaftslebens „überlegen heiter“ und „allseits aufgeräumt“. Diese Überlegenheit und Aufgeräumtheit hat Grünbein auch in seine eigenen Verse implantiert.
In den Strophen für übermorgen finden sich denn auch wieder zahlreiche Reisegedichte, die geschichtsträchtige Orte im geliebten Italien oder Frankreich umkreisen. Hier hält sich der Dichter allzu oft an das Nächstliegende und winkt mit bildungstouristischen Standards. Etwa in der Nietzsche-Reminiszenz des Gedichts „Warum wir in Turin sind“:
Den Philosophen,
Der hier zusammenbrach, wird man verstohlen grüßen
…
Es ist sein Geist, der uns im Nacken sitzt, gewitzt,
Hier in Turin.
Das wirkt poetisch ebenso flau wie die kumpelhafte Annäherung an Bismarck:
Er traf sie noch, er konnte viel erzählen,
Der alte Schnauzbart mit der Pickelhaube.
Bildungs-Smalltalk dieser Art schrumpft in einigen Gedichten zur fahrlässigen Stereotypie. So werden in einer Satire auf Adolf Hitler um des Reimes willen auch banalitätsverdächtige Einsichten nicht verschmäht:
Er hatte Prinzipien, tödlich die meisten, zumindest für andre.
Choleriker – auf seine Wutausbrüche war immer Verlaß.
Rücksichtslos war er. Sein Trumpf: er verstand keinen Spaß.
Wie viel lebendiger und anrührender sind doch die poetischen Kindheitsbilder, die Grünbein im ersten Kapitel seiner „Strophen“ gesammelt hat. Hier ist das Gedicht keine antike Flaniermeile, sondern ein Erinnerungspanorama von sinnlicher Bildkraft. Die Gedichte, die dem Großvater und der Großmutter gewidmet sind, weiten sich zu einem großen Porträt des Jahrhunderts der Extreme:
Einer von vielen Deutschen, seit Luthers Zeiten frustriert.
Hier ist der formsichere Bewusstseinspoet Grünbein auf der Höhe seiner Kunst.
Das schönste Gedicht des Bandes zeigt den Dichter als jungen Museumsbesucher, der traumverloren vor einem Diaroma die dargestellten Tiere, Höhlenmenschen und Weltwunder der Vorzeit anstarrt. Eine poetische Grundtugend hat Durs Grünbein hier zurückerobert: das Staunen.
Michael Braun, Frankfurter Rundschau, 9.10.2007
Wenn einem so viel Schönes wird beschert
− Nymphen, Cognac und Amphoren – der neue Gedichtband von Durs Grünbein verspricht zwar Strophen für übermorgen, enthält aber eher geformte Kurzprosa von gestern. −
Der Dichter Peter Rühmkorf stellte einmal die maliziöse rhetorische Frage, ob und wenn: welche Durs-Grünbein-Gedichte denn ein moderner Bildungsbürger auswendig könne. Antwort: keine. Ganz so düster sieht es mit dem meistgelobten deutschen Lyriker, der im Alter von 33 Jahren schon den ehrenvollsten Literaturpreis, den Büchnerpreis, zugesprochen bekam, dann doch nicht aus. Viele seiner Gedichte haben es in Anthologien, einige sogar in Schulbücher geschafft. Die Voraussetzungen zum Auswendigwissen sind also gegeben. Aber Rühmkorf hat einen wunden Punkt berührt. Grünbeins aktuelle Texturen – und das zeigt auch sein neuer Gedichtband Strophen für übermorgen, der genau hundert Gedichte und kurze Gedichtzyklen aus der jüngsten Produktion versammelt – muss man eher als geformte Kurzprosa verstehen. Warum?
Grünbeins Assoziationen, seine Metaphern, lassen sich meist schnell aufschlüsseln, sie haben gewissermaßen nur zwei Dimensionen, wo Klassiker der modernen Lyrik wie Trakl oder Benn semantisch dreidimensionale Konstrukte herstellen. Für die mythologischen Anspielungen – Grünbeins angebliches Markenzeichen – kann ein einschlägiges Lexikon verwendet werden: über den Assoziationswert hinaus haben sie meist keine weitergehende Bedeutung, sie wirken oft wie aufgesetzt. So überzeugen die kurzen Texte, die Beobachtungsminiaturen wie das Gedicht „Winterfliege“ am ehesten:
Spät im Jahr noch setzt sie sich aufs Buch
Müde, müde ihres Fliegenlebens.
(…)
Unverständlich wird, was sie berührt, aschgrau.
Schrift, auf die ein Fliegenschatten fällt
Die weitschweifigen Reisebeobachtungen wie der Zyklus „Venezianische Sarkasmen“ schüren den Verdacht, dass man hier mit entsprechend verdichteter Prosa, einem knackigen Essay, besser bedient worden wäre.
Überhaupt: wie kann man einen Gedichtband Strophen für übermorgen nennen? Das ist sowohl ein Klischee, das an die muffige Werbung von Stromkonzernen erinnert (Energie für übermorgen), oder es ist unangenehm arrogant, denn der heutige Leser ist nun mal von heute, und die Gedichte sind beim besten Willen nicht so hermetisch, dass sie erst übermorgen ihren Sinn preisgeben würden. Ob der Anspruch, vor Ewigkeitswert nur so zu strotzen, wirklich von den Texten eingelöst wird, ist (für den Dichter) eine ausgesprochen heikle Frage.
Grünbeins Texte sind da am stärksten, wo Welt erzählt wird, auch wenn man sich mehr poetische Reflexion wünschte, wo nur mythologische Folien aufgelegt werden. Durch die Aufrufung der Antike oder der Katastrophen des vergangenen Jahrhunderts entsteht eine Art temporaler Erhabenheitseffekt, der, allzu oft angewendet, leider Kitsch erzeugt, Erhabenheitskitsch – Texte wie das Memento mori mit der Winterfliege mal ausgenommen. Der Blick auf die Berliner Heimat des Dichters ist fixiert auf den Straßenkampf im Zweiten Weltkrieg, was an sich kein Schade wäre, bliebe es nicht immer der gleiche Assoziationsraum, den wir schon aus den vorangegangenen Grünbein-Bänden kennen.
Oft begegnen unfreiwillig komische Lyrismen:
In den Parks schlug es dreizehn an jeder Blumenuhr
Weißgraue Nymphen schlangen den Marmorarm
Um Amphoren, mit Cognac gefüllt
Das erinnert, mit Verlaub, an die poetische Qualität einer Asbach-Uralt-Werbung.
In sieben Kapitel gliedert Grünbein seine Texte. Viele Reisebeschreibungen, Italien, Paris, Tokio, Kopenhagen, lassen einen dennoch unbefriedigt. Zufrieden macht einen nur, dass ein Ossi die Reisefreiheit produktiv nutzt. Der Vergleich von Notre Dame mit einem Urfisch-Skelett ist ja noch ausgesprochen naheliegend, wenngleich deshalb kaum poetisch wertvoller. Wenn es dann aber heißt „Strahlend weiß, was dem schwärzesten Mittelalter entkam“, dann zweifelt man am Geschichtsbild des Autors – hatte hier doch das Mittelalter seine lichtesten Momente.
Der Autor begreift sich offenbar als Herr der Zeiten. Man könnte seine Sprecherposition etwas abgegriffen als postmodern bezeichnen, also als jenseits der Geschichte, womit allerdings ein Übermorgen sich erledigt hätte. Aus Grünbeins Lyrik spricht ein Zustand von leider gar nicht frecher, sondern fast schon phlegmatischer Hybris.
Marius Meller, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.10.2007
Ein Snob in seinem letzten Hemd
− Vom Risiko, sich selbst zu begegnen – und vom poetischen Gelingen: Durs Grünbeins Strophen für übermorgen. −
Bedeutet es etwas, dass dieser Band das Wort „Gedichte“ nur als Untertitel führt und dagegen Strophen für übermorgen verspricht? Strophen erheben nicht den Anspruch, etwas Ganzes zu sein und treten gewöhnlich zu mehreren auf. So auch diese dreizehn „Strophen für übermorgen“ aus dem dritten Teil, die dem Buch seinen Titel gegeben haben. Sie schreiten alle im klassischen Jambenschritt vorbei, in Versen mit fünf Hebungen (es können auch einmal mehr oder weniger sein), regelmäßig alternierend mit ganz seltenen und sofort einleuchtenden Holperstellen. Aber sie bilden kein Gedicht, vielleicht einen Zyklus. Es sind Einzelstrophen, alle verschieden lang. Seit Walther von der Vogelweide sind in der deutschen Lyrik Einzelstrophen zum Ausdruck von Reflexionen und Meditationen benutzt worden, in denen sich das lyrische Ich mehr mit der Welt und ihrem Zustand als mit sich selbst beschäftigt. Das gilt auch noch für diese Strophen von Durs Grünbein: Sie sind der besorgte Reflex eines Zeitgenossen, der die Welt in Gefahr sieht – und sich selber gleichzeitig alle Autorität abspricht, die rechthaberische Kassandra zu spielen:
Ich friere, schwitze, doch in seinem letzten Hemd
Geht da kein Büßer, nur ein Snob.
Wie fast alle Dichter des vergangenen Jahrhunderts hat Durs Grünbein anfangs alle traditionellen Formen (Verse, Strophen, Reime) mit tiefem Misstrauen betrachtet, dann aber sehr schnell gerade dieses poetische Erbe zu seinem ureigenen Experimentierfeld gemacht. Wie kein anderes poetisches Kunstmittel war der Reim ein Zauberstab, mit dem man jahrhundertelang den Sinn nicht nur enthüllen und unterstreichen, sondern auch schlicht erschwindeln konnte. Wenn die Dichter schon einmal im 18. Jahrhundert und dann vor allem im 20. auf den Reim ganz verzichtet haben, dann eben, weil er immer noch etwas zu sagen hat, das nicht gemeint war: hundertmal gehörte Reime machen jede Aussage fade, nie gehörte erregen ungebührliches Aufsehen und taugen oft gerade noch für Ironie, Sarkasmus und Parodie. Durs Grünbein ist seit langem das Risiko eingegangen, sowohl die Formen des Reims als auch seinen Gebrauch zu manipulieren: Neben reinen Reimen (abgebaut : Gänsehaut) begegnen bei ihm bloße Assonanzen, bei denen nur die Vokale am Ende zweier Verse übereinstimmen (Sklave : Schlaf), ja sogar die Betonung kann sich verschieben (Interrégnum : verstúmmt). Traditionellerweise folgt auch die Ordnung der Reime etablierten Mustern, und wenn diese Muster auch nie so stabil waren wie die Regeln zur Reinheit des Reims, schaffen sie doch eine starke Erwartungshaltung. Um diese Erwartung nicht automatisch zu bedienen, hat Durs Grünbein anstelle von Reimpaaren oder Kreuzreimen gern Dreier-Reime benutzt (abc abc), besonders am Anfang der Strophen. So merkt der Leser drei Verse lang zunächst gar nicht, dass hier eine Reim-Form entsteht:
Es ist der vierzigste April, ein Donnerstag.
Das Wetter spielt verrückt, und heiß
läufts, kalt dir übern Rücken, Kamerad.
Erst die weitere Lektüre zeigt, dass hier ein besonderer Formwille herrscht:
Ich bin der Zeuge, nach dem keiner fragt.
Ums Eck die Tankstelle, sie steht verwaist,
Ein Mausoleum für das letzte Emirat.
Die Assonanz war im Zeitalter des reinen Reims als dessen primitive und unreine Vorläuferin verpönt. Durs Grünbein hat sein Publikum langsam dazu erzogen, ihre ästhetischen Qualitäten neu zu erkennen. Nicht nur hier in den Strophen für übermorgen ist sie kunstvoll und überzeugend gehandhabt. Ihre wichtigste Eigenschaft ist, jedenfalls heute, ihr gespanntes Verhältnis zum Reim. Auch Reime assonieren ja! In der zitierten Strophe reimen „Kamerad“ und „Emirat“, aber beide assonieren auch miteinander und mit „Donnerstag“ und „fragt“. Durs Grünbeins Reime könnte man überdeterminierte Assonanzen nennen. Das ist weniger ein technisches Kunststück als ein subtiles Mittel, den Leser mit hineinzunehmen in den poetischen Prozess. Dass auch die offensichtlich gewollte Form (abc abc) sich nicht einfach einstellt und beim Lesen oder Hören fast notwendig unklar bleibt, gehört zur Aussage der Strophe. Zwei Verse beschließen sie hör- und sichtbar. Sie bringen etwas Neues, und das liegt vor allem daran, dass sie ein perfektes Reimpaar bilden:
Die Autos rosten, Busse, Räder abgebaut,
Entlang der Straßen. Ich hab Gänsehaut.
Man braucht nicht unbedingt zu wissen, dass dies zum Formgesetz der Stanze oder Ottaverime gehört, um die tönende Abschlussgeste wirklich zu hören. Aber als Formzitat sagt diese Wendung doch auch, dass hier wieder, wenn auch weniger feierlich als bei Goethe in seiner „Zueignung“ „der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit“ wehen soll! Aber eine richtige Stanze will diese Strophe nicht sein. Mit ihren Dreier-Assonanzen ist sie so manipuliert, so überpoetisch wie der vierzigste April überwirklich, surrealistisch ist. Überwirklich ist auch das Ich, das hier spricht, das sich die Rolle des Zeugen von übermorgen vorphantasiert, aber die Gänsehaut hat es doch schon heute! So gibt die Formel einen schmalen Durchblick frei auf einen wirklichen Menschen. Manchmal wird er sichtbar, ohne ich zu sagen:
Einmal beim Tanken die Erleuchtung: Keiner
Springt je zur Lebzeit ab vom Karussell.
Er spricht zu sich mit einem Du: „Dein erstes Fahrrad, wie lang ist das her“, und meint sich selber, wenn er sich als dritte Person, als „man“ verallgemeinert:
… ein Stück Kork, und plötzlich Blei,
sinkt man hinab.
Was er vermittelt, ist nicht einfach eine Idee von Vergeblichkeit, Vergangenheit, Vergänglichkeit, sondern die ungute Überzeugung, selber zum Verhängnis zu gehören. In diesem poetischen Experiment trifft der Durchblick nie nur den Autor, sondern auch seinen Leser, unsereinen. Dass man sich dem, selbst widerstrebend, nicht leicht entziehen kann, ist ein Prüfstein des Gelungenen.
Und doch kommen manche Motive nicht sehr treffend oder gar ein wenig läppisch daher:
Man tschilpt,
Ein Sperling, vor sich hin, und das tut gut.
Ein paar Seiten weiter ist der Sperling schon wieder da: Er hat eine Botschaft, deren Einfalt wohl nur noch durch den poetischen Trick des Dichters überboten wird, die Vogelsprache zu übersetzen:
Grüß dich, Sperling in der Pfütze, guter Geist.
…
Ich übersetze:
Tschilp, tschilp, wie fragil ist dies fossile,
Euer Monstrum, tschilp, Gesellschaft doch.
Die Überschrift der Strophe heißt „Noch eine Regung“. Eine Regung? Das war doch vor nunmehr über zwanzig Jahren (in Grauzone morgens) noch vor der Wende die Überschrift zu einem kurzen Gedicht über einen anderen Sperling:
Dieser flüchtige kleine Windstoß, Luft-
wirbelsekunde, als ein
verschreckter Sperling kurz
vor mir aufflog, schon
außer Sicht war und eins der
leichtesten Blätter folgte zer-
rissen in seinem Sog.
„Noch eine Regung“ ist geschwätziger als ihr genaues und eindrückliches Vorbild, aber beide gehören nun zusammen, als Erinnerung an eine Erinnerung.
Das ist überhaupt ein Kernmotiv des ganzen Buchs: Durs Grünbein, der mit viel Belesenheit die Rollenpoesie gepflegt hat, die dem poetischen Ich eine fiktive, aber wohlumschriebene und beherrschbare Position einräumt, stellt sich hier den vielfältigen und kaum durchschaubaren Rollen, welche seine eigenen Erinnerungen ihm aufdrängen. Er lässt sich als Autor nie dazu hinreißen, diese Fragmente der eigenen realen Vergangenheit mit seinem gegenwärtigen Bewusstsein gleichzuschalten. Ihre Sperrigkeit und natürlich die Kunst, sie uns spüren zu lassen, machen so manchen Vers, so manche Strophe des neuen Buchs unvergesslich. Die jetzige Erinnerung überbrückt nicht einfach die Zeit bis damals, zum Beispiel bis zum „Russischen Sektor“, sie ist eine Summe von Erinnerungen. Der Autor von heute greift unwillkürlich oder bewusst auf seine eigenen Gedichte als Quelle zurück. Er macht niemandem vor, vor allem nicht sich selbst, dass er sich authentisch und direkt erinnert, wenn er in sein Gedicht den Titel seines allerersten Bändchens hineinmontiert:
Und der Traum restaurierte, was draußen fehlte.
Solche Ferne auf engstem Raum. Grauzone morgens.
Das fing auf der Netzhaut an, im vernebelten Denken.
Diese poetische Offenlegung der Problematik von Quellen, Formen, Reimen macht die Aussagen der Gedichte immun gegen ihre eigenen Schwächen. Wer selber in das Alter kommt, sich an seine Erinnerungen, geschönte oder verschüttete, zu erinnern, wird mit der Zeit verstehen, dass die Erinnerung poetisch werden muss, wenn sie nicht ganz verschwinden soll und „als letzter der Zeugen das Gedächtnis verstummt“.
Packend und riskant sind die Zeugen-Gedichte. Eindrücke aus Welten, die der ungefragte Zeuge nicht absichtlich gesucht hat, Geister die er nicht rief, und die doch ebenso bedrohlich aus der eigenen Vergangenheit wie aus der verdunkelten Zukunft hereinbrechen. Mit Ironie und Sarkasmus müssten sie sich doch abwehren lassen! Und bringt nicht wenigstens die Liebe sie kurz zum Schweigen? „Venezianische Sarkasmen“ versuchen es wohl, aber sie machen die elegische Enttäuschung nur umso schmerzlicher.
Hans-Herbert Räkel, Süddeutsche Zeitung, 29.11.2007
Berlins treuester Dichter
− Mit seinen Strophen für übermorgen (2007) entführt der Lyriker Durs Grünbein auf die Museumsinsel. −
Die Museumsinsel ist nicht nur in der Mitte Berlins, sie ist auch sein Mittelpunkt: Und der Lyriker Durs Grünbein ist wohl ihr treuester Dichter. Eines Tages sah er sie sich aus einem Fenster des Palastes der Republik genau an und wenige Monate später schrieb er für den Fotoband Museumsinsel von Thomas Florschütz seine berühmten 13 Berlin-Gedichte. Ein Jahr danach erschien auch sein neues Buch Strophen für übermorgen (2007), in dem er uns erneut auf die Museumsinsel mitnimmt, an jenen Ort, an dem sich die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Transit-Metropole, wie Grünbein Berlin nennt, treffen sollten:
Dies ist der Ort, wo die Jahre sich gleichen, magere, fette
Wo man ruhig wird vorm Pergamonaltar wie in Abrahams Schoß
Wie lang ist das her, die Hochzeit von Musen und Militär?
Durs Grünbein, gewiss der bedeutendste Dichter der neuen deutschen Lyrikergeneration, ist wie ein Asylsuchender, ein Mann der Grenze: Hier geht er hinein, sieht sich um, ob dieser oder jener Ort der seinige ist, und dann verlässt er schon diesen Augenblick, um sich anderswo umzuschauen. In seinem neuen Gedichtband wechselt er wie ein Flaneur die Schauplätze seiner Erinnerung: Er sammelt sie am Anfang in seiner eigenen Herkunft auf, in Dresden, dann prüft er die Gedanken in seiner Gegenwart, in Berlin-Mitte, wo er seit einem Vierteljahrhundert zu Hause ist, und schließlich verlässt er sie in einer imaginären antiken Welt.
Grünbeins neuer Gedichtband ist ein poetisches Erinnerungswerk und zugleich ein Versuch der Suche nach dem geeigneten Ort und nach der eigenen, nur für den Dichter allein bestimmten Zeit. Und in diesem Fall ist er ebenso ein Mann der Grenze. Er ist ein Dresdner aus der Zeit davor und ein klassischer Berliner aus der Zeit danach: Aus der Zeit nach der Mauer, nach der DDR. In Dresden aufgewachsen, ist der 45-Jährige, wie Bertolt Brecht es nennen würde, ein ewig Nachgeborener. „Um von vorn zu beginnen / der Anfang / Liegt in den Tagen danach“, kündete Grünbein bereits in einem seiner früheren Gedichte an.
Ende der Achtziger nach Berlin gezogen, macht der spätere Georg-Büchner-Preisträger (1995) genau die Zeit danach – nach der Wiedervereinigung – zu einem der wichtigsten seiner Themen. Auch im zentralen Gedicht Strophen für übermorgen des gleichnamigen Zyklus betont er die Beständigkeit dieser Tage für die Zukunft:
Heute ist der vierzigste April. Ein Deserteur
Legt sich ins Gras, befreit von jeder Gegenwart
Was Leben ausmacht, ist der Tag danach, sein Bestes
Wie schwer das fiel bis gestern…
Grünbeins lyrische Suche nach einem Ort für sich selbst wird in seinem neuen Gedichtband nicht beendet – lediglich fortgesetzt. Wie immer sucht er, sich schrittweise im Alltäglichen verlierend, in der Menge und in der Zeit danach. Und auch in diesem Fall bleibt er ein Mann der Grenze: Stilistisch sucht er in der Wechselbeziehung von Sprache und Musik. Nicht umsonst wurden einige seiner Gedichte aus dem Zyklus Strophen für übermorgen von Georg Katzer als Lieder vertont und bereits im Vorjahr beim Kunstfest Weimar vom Publikum gefeiert.
Marina Neubert, Berliner Morgenpost, 1.2.2008
Gedichte als Essays
− Man hat es fast schon vergessen: Durs Grünbein war Anfang der neunziger Jahre der junge Star der Lyrik, der die Szene mit nervösen, zwischen Naturwissenschaft und Erkenntnistheorie schillernden Texten aufmischte; er war der Autor der Stunde. Die Verleihung des Büchner-Preises im Jahr 1995 bildete den Abschluss dieser Sturm und Drang-Phase, und das war auch ein großer Einschnitt für das Werk des damals 33-jährigen Dichters. −
Wenn Grünbein jetzt einen Band mit dem Titel Strophen für übermorgen vorlegt, dann ist das in vielerlei Hinsicht eine Reaktion auf diesen frühen Ruhm, auch wenn das nicht einmal in Ansätzen thematisiert wird.
Grünbein hat nach dem Büchner-Preis lange gewartet, bis er wieder etwas Neues veröffentlichte, und man war dann ziemlich verblüfft: Er hatte sich zum Olympier gewandelt. Den Büchner-Preis, den raschen Aufstieg zum Olymp, thematisierte Grünbein durch die Hinwendung zu antiken Mythen, zu den Stoffen der alten Griechen und Römer, und das war gleichzeitig ein selbstironischer Kommentar zu seiner biographischen Situation. Doch die Zeitlosigkeit der antiken Dichter verhalf ihm auch zu einer neuen Standortbestimmung für sein eigenes Schaffen.
Grünbein ist seit einigen Jahren ein virtuoser Exeget und Übersetzer der alten Stoffe. In seinem neuen Band ist diesem Themenkreis wieder ein eigenes Unterkapitel gewidmet. Strophen für übermorgen hat dabei bereits im Titel wieder einen ironischen Impetus, auch wenn der direkte Indikator wie immer fehlt: die Zeitlosigkeit bezieht sich nicht nur auf einen Fixpunkt in der Vergangenheit, sondern genauso auch auf die Zukunft – sie verliert sich in einem nicht genau zu bestimmenden Feld.
Eines ist jedenfalls klar: die Moden der unmittelbaren Gegenwart, der rasch wechselnde Zeitgeist ist Grünbeins Sache nicht. Seine Haltung ist aber nicht, wie man auf dem ersten Blick meinen könnte, elitär. Verblüffend ist der Witz, der seine Verse oft auszeichnet, das Spiel auch mit der niederen und der Umgangssprache, der Wechsel zwischen hochfahrender philosophischer Reflexion und dem Wissen um die Winzigkeit des einzelnen.
Grünbein ist kein romantischer Dichter, er ist ein poeta doctus im klassischen Sinne. Seine Gedichte sind oft Zuspitzungen des Gedankens, gleichzeitig aber arbeiten sie mit der spezifischen Musikalität der Lyrik, der klassischen Metrik, dem Rhythmus der alten Schulen. Es gibt Reminiszenzen an die DDR, es gibt Reisegedichte – Paris, Turin, Midtown. Und natürlich die ewig sich verändernde Stadt Berlin, Grünbeins Lebensmittelpunkt: „Transit Berlin“ heißt ein zentraler Zyklus.
Grünbeins Texte sind immer auch Gedankenspiele, sie bewegen sich wie Freibeuter innerhalb der rasch anwachsenden Informationsspeicher, es sind Gedichte als Essays. Grünbein ist beileibe kein Hofmannsthal, er ist kein Bildermaler und kein Schwelger. Viel eher verkörpert er den wendigen Typus à la Enzensberger, allerdings ohne dessen Hase- und Igel-Taktik. Vielleicht liegt es an seiner Sozialisation in der DDR, dass bei Grünbein ein tiefes Bewusstsein für geschichtliche Dimensionen mitschwingt.
Helmut Böttiger, Deutschlandradio Kultur, 11.10.2007
Ein Hinken, schon nicht mehr auf sich bezogen
− Muttersprachlos: Der Dichter Durs Grünbein entdeckt sein Schöpfungsprinzip im Wortunfall. −
Er singt nicht, wie der Vogel singt, und auch nicht wie Walter von der Vogelweide. Damit Durs Grünbein auf den Gedanken kommt, sich nach dem Verbleib seiner verflossenen Lebenszeit zu erkundigen, muss erst ein Unfall passieren, der Dichter aus der Bahn geworfen werden, etwas in seinem Körper reißen. Unter dem Titel „Achillessehne“ berichtet ein Gedicht seines neuesten Bandes über die Folgen eines Sportunfalls: Ein „Ausfallschritt beim Federball“, und
noch am selben Abend wird man aufgeschnitten,
Liegt da mit Schlauch im Mund und weiß nicht mehr,
Wo all die Jahre hin sind bis hierher.
Vom Schmerz des Verletzten ist im Gedicht nicht die Rede. Erst im vorletzten Vers taucht die Erinnerung daran auf, wie es „plötzlich weh tat“, als der junge Sportler aufschnappte, dass die Erwachsenen von seiner „Rückreise“ redeten. Das Gedicht rekapituliert das Unglück als vollendetes Ereignis:
Und plötzlich war dein Fuß, der linke Fuß
Versunken wie in einer Moosschicht, die gab nach.
Zum Leidensbild der medizinischen Fachliteratur gehört ein Ton: An einen Peitschenknall lässt das Geräusch denken, das die Sehne beim Reißen macht. Hat der Dichter diesen Befehl überhört? Der Moment nach dem Ereignis, das durch das erste Wort des Gedichts, das „Und“, nur markiert, nicht erzählt wird, erscheint in der Erinnerung als Zustand. Der ungenannte Schmerz soll die Leidenslosigkeit herbeigeführt haben, das Glück gemäß dem Ideal der stoischen Philosophen:
Das war der langersehnte Frieden, apátheia,
Den sich die Sappho wünschte nach der Liebe,
Ein Fallenlassen bis hinab zur Kindheit.
Schon bevor er zum Dichter wurde, agierte der Dichter also als Selbstversuchstier im Auftrag der Gattung. Denn auch wenn wir uns den Federballspieler als puer senex vorstellen, hat nicht er sich den ewigen Frieden des ruhiggestellten Gemüts herbeigewünscht, sondern die leidgeprüfte Menschheit.
In der Verallgemeinerbarkeit des Dichterlebenslaufes steckt ein Risiko des Strauchelns. „Die kleine Weile, die ein Fluch braucht, bis er wirkt“: Der sentenziöse Schlussvers verschiebt die Aussage des Gedichts leider ins Besinnliche, so dass der verfluchte Humpler auch als Doppelgänger des plötzlich Verlassenen taugen könnte, den gerade der Abschiedskurzbrief auf dem Handtelefon erreicht hat. Dabei handelt dieses Gedicht in Wahrheit von etwas höchst Speziellem: dem Augenblick des Gedichts. Das Gedicht zerreißt den Zeitstrang: Indem es den Schmerz erinnernd vergegenwärtigt, schiebt es ihn einen Moment lang hinaus. Der Leser, von der Gewalt des Gedichts ergriffen, lässt sich fallen: Aktives und passives Verhalten sind in dieser Bewegung so wenig zu trennen wie Schmerz und Lust in jenem Reich, das, wie Grünbein in der Maske der Sappho versichert, auf dem Grund der poetischen Erfahrung konserviert ist.
Kindheitserinnerungen, Bilder aus Dresden, der Stadt, in der Durs Grünbein 1962 geboren wurde, entfaltet der erste und stärkste der sieben Abschnitte seiner jüngsten Gedichtsammlung. Buchstäblich handelt er dort von der Herkunft seiner Begabung: Er legt den genealogischen Nachweis seiner Befähigung zum Dichteramt vor. Der eine Großvater, Arbeiter im Schlachthof, wird vorgestellt als „der Sippe Balladenton, der genetische Kehrreim“. Der andere Großvater, der unter Hitler die grüne Polizistenuniform trug, war „der Herr der schwarzen Sprüche, der Sarkast“, also das Modell jener Rolle, die der Enkel in den Juvenal-Paraphrasen des Bandes Nach den Satiren gespielt hat. Der neue Band enthält unter den italienischen Reisebildern zwölf ausladende „Venezianische Sarkasmen“ zu je sechzehn Versen.
Ein Gedicht über die Großmutter heißt „Die Wachtel“, weil sie eine geborene Wachtel war. Dass in ihrem Hause der gleichnamige Vogel nicht auf den Tisch kam und der Enkel noch heute zusammenzuckt, wenn Feinschmecker die Eier der Wachtel rühmen, illustriert eine idiosynkratische Empfindlichkeit, ein unübersetzbares Element jeder Dichtersprache. Im Namen Wachtel eingeschlossen ist das Urwort, mit dem das Gedicht anhebt: „Ach Großmutter“. Wenn der Dichter sich anwehen lässt durch „eine brüchige Silbe, / Die einen schwach macht, weil sie so vieles enthält“, schreibt er, wie man hört, im Stadium der Schwachheit, denn in „schwach“ und „macht“ erklingt dasselbe Echo der Sprache der Großmutter.
Dieses Ach aber, überhaupt jede Art Seufzer,
Wurde in ihren Kreisen geradezu kultiviert.
Dagegen sagte sie über die Rotarmisten, ihre „Befreier“ in der „Stunde Null“, ihren Lebtag lang kein „Sterbenswörtchen“. Wie die Stadt Dresden „nah am Wasser gebaut“, ist die Großmutter in den Gehörgängen des Dichters anwesend durch ihre kultivierten Seufzer, „behutsam eingeschlagen / Wie in Seidenpapier zwischen zwei kleinen Lachern“. Mit diesem Bild von den Leidensäußerungen als zerbrechlicher Kostbarkeit antwortet Grünbein so diskret wie souverän den Kritikern, die Porzellan, seinem „Poem vom Untergang“ seiner Stadt, preziöse Sentimentalität vorgeworfen haben. Über den Seufzer schlagen Lacher eine Brücke: Auch das letzte Wort des Wachtelgedichts ist Nachklang des „Ach“.
Im achten der „Venezianischen Sarkasmen“ wird der Dichter aus einem Andenkenladen an einen anderen Ort versetzt, „in Gedanken an einen köstlichen frühen / Morgen in Großmutters Eisenbett, versunken in ihren Baedeker“. Die poetische Versenkung ist Nachempfindung dieser doppelten, literarischen wie physischen Versunkenheit, des Hinüberträumens in die Stadt, die versinkt. Schon die kindliche Entrückung wird zum bewussten, reflexiven Erlebnis stilisiert. Das als anthropologisches Requisit warm und weich zu denkende Großmutterbett ist aus Eisen, also im vorliegenden Einzelfall zugleich hart und kühl. Die Stangen gliedern den Exzess der Phantasie wie die Hebungen den Vers.
Die poetische Erinnerung findet ihr Bild im massenhaft produzierten Souvenir. Als Pawlowschen Hund hat sich Grünbein vor Zeiten porträtiert, und so genügt dem Dichter „irgendein Andenkennichts“, um die Gedächtnisbilderflut zu entbinden. Unnötigerweise wird diese gut materialistische Theorie der Inspiration mit kulturkritischem Nippes ausgeschmückt.
Und immer ist es ihr Kinderspielzeug, das ihnen einfällt hier –
Den stillen Besuchern.
Der Kontrast zwischen den lärmenden Pauschaltouristen und den Stillen im Auslande zeugt nicht von Geschmackssicherheit. Zugunsten des Dichters wollen wir sein Geständnis, dass seine Phantasie zu ihren besten Teilen Regression, Sehnsucht nach mütterlicher Überfütterung, ist, auch auf seine soziologische Genremalerei beziehen:
Infantil, wie gesagt, ein Bild, sich früh satt zu saugen daran.
Wenn die Besiedlung Amerikas als „Reise in eine Wildnis, in der nichts familiär“ war, charakterisiert wird, ist man versucht, eine Tautologie zu rügen. Aber der Dichter beschreibt anderenorts seine Kindheitswelt als eine Landschaft, in der das Wilde das Vertraute war. In einer Stadt aus Baulücken bildete sich im Studium der Umrisse „ein familiäres Formgefühl“. Nicht Mutterliebe war das Natürliche.
Von Kindesbeinen an war man vertraut
Mit einer Welt, der Haß galt als Naturkonstante.
Alles Nährende dieser Heimat musste imaginiert werden, da man nichts anderes kannte als „diesen Mutterboden, ausgeschabt“. Dass die unwirtliche Umwelt sich als ökologische Nische für den Dichter erwies, ist Anlass für eine „Kleine Ode zum Dank“.
Der Dichter, der in den Gedichten spricht, ist mutterlos aufgewachsen. Grünbeins Strophen wirken seit jeher so, als wären sie aus einer anderen Sprache, mutmaßlich dem Lateinischen, übersetzt worden. Die Reime sind sehr häufig unrein, als hätte der Übersetzer der Genauigkeit des Sinns den Vorzug geben wollen. Der Versfuß holpert absichtsvoll, wie notdürftig geflickt: Beim ersten Auftreten muss die Sehne gerissen sein. Durs Grünbein ist in der deutschen Literaturgeschichte der wohl singuläre Fall eines lyrischen Genies, dem keine Sprachmusikalität in die Wiege gelegt scheint. „Die Wachtel“ mit dem lustvoll imitierten Seufzermotiv ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt, dass Grünbein auf lautmalerische Effekte verzichtet. Dieser Dichter erlernte das Dichten nicht, indem er Mutter Natur ihr Lied nachsang. Die Großmutter trat an die Stelle der Mutter: Eine Wachtel, die nur so hieß, sprang für die Vögel ein. Erst im letzten Moment wird er womöglich die Muttersprache noch lernen, wie Kaiser Hadrian im Gedicht „Von der Seelenwanderung“:
Auf seinem Sterbebett, als ihm die Parze an die Kehle sprang,
Hat er gesungen wie ein Vögelchen: von seiner Seele. Fünf Zeilen lang, in Kindersprache.
Patrick Bahners, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.10.2007
Durs Grünbein, ein Dichter auf der Flucht nach oben
− Durs Grünbeins Strophen für übermorgen zeigen den Dichter als Überflieger, der gern abhebt. Mit vielsagenden und nichtssagenden Ergebnissen. −
Er war der poetische Hauptgewinn der deutschen Vereinigung. Kaum war der Eiserne Vorhang demontiert, entpuppte sich vor den neuen Horizonten ein lyrischer Wunderknabe aus der „Grauzone“ DDR und setzte das Publikum in Erstaunen. Da dachte und dichtete einer exakt auf der Höhe des historischen Augenblicks:
Komm zu dir Gedicht, Berlins Mauer ist offen jetzt.
1995 erhielt Durs Grünbein mit dreiunddreissig Jahren den Büchner-Preis, so jung wie zuvor nur Hans Magnus Enzensberger und Peter Handke. Schnell erklomm er höchste Höhen.
Strophen für übermorgen heisst Durs Grünbeins neuer Gedichtband. Zunächst blickt er darin zurück auf das Dresden seiner frühen, der Sechziger- und Siebzigerjahre:
Barfüssig war man da zu Hause, sah die Schienen
Der Strassenbahn geschmolzen in der Sommerhitze.
Die Knie brannten nachts von Goldruten, Lupinen.
Das war die Kindheitschronik, in die Haut geritzt.
Nun sammelt der Dichter Erinnerungen an jene Zeit, als Stoff für die „limbischen Archive“. Der aparte Materialismus naturwissenschaftlicher, vornehmlich neurologischer Begriffe gehört nach wie vor zu Grünbeins liebsten lyrischen Würzmitteln.
In einer „Kleinen Ode zum Dank“ wird des zerstörten Nachkriegs-Dresden gedacht, der Ruinenflächen, der ungesäumten Strassen, so leer und breit, „dass mancher Schulweg zur Sibirien-Exkursion geriet“. Die Grossmutter bekommt ihr Porträt. Ihr war Schlimmes von den russischen Befreiern widerfahren, später hat sie ihre Seufzer „geradezu kultiviert“. Die historische Katastrophengeografie des zwanzigsten Jahrhunderts ist stets gegenwärtig. Der Grossvater war Polizist im Dritten Reich, doch widerspenstig und für den Enkel ein frühes Stilvorbild: „Ich hatte ihn gern, seinen trockenen Witz.“
Grossmutters Seufzer
Bei Grünbein wurde daraus die Passion für einen souverän die Welt- und Daseinslage überblickenden Sarkasmus. Aber auch die Seufzer der Grossmutter über den unbarmherzigen Weltenlauf finden ihre Fortsetzung – auf höchstem Niveau: „Irrealis“ heisst ein Klagegedicht über die Gegenwart, ein Seufzer in Strophen, der anhebt: „Ja, auch das ist nun üblich.“
Daneben öffnen sich die grossen, für diesen Autor charakteristischen Perspektiven auf unser aller Kreuchen und Fleuchen in den kosmischen Weiten. „Bevölkert der Erdkreis, keins lebt allein.“ Wer hätte das gedacht? Ein gewisser Pessimismus wird hier manchmal auch spürbar, mal ist er scharfkantig, mal gelinde melancholisch. „Wie schön das war, Leben, als noch alles im Argen lag.“ Da stand die Zukunft noch bevor, da hatte die Hoffnung noch reichlich Arbeit: „Und der Traum restaurierte, was draussen fehlte.“
Wahrlich, die Zeiten sind nicht mehr das, was sie mal waren, nicht für das vereinigte Deutschland und nicht für Grünbeins Poesie-Konzept. Der Dichter wird nicht mehr bejubelt, er wird bestenfalls bewundert, meistens jedoch mit erheblichen Einschränkungen, und häufig wird er verlästert. Manches von dem, was er einst kühn für sich erfunden oder aufgegriffen hat, erscheint verfestigt zur Manier oder gar Marotte.
Grünbeins Verse drängen auf gelegentlich fatale Weise zur Verallgemeinerung, zum Gesamtbild. Der Hüpfer vom Individuellen zur Stammesgeschichte, vom Kleinen ins ganz Grosse – nichts geht diesem Autor leichter von der Hand als das. Trotzdem entsteht daraus in vielen Fällen nicht mehr als bleierne Bedeutungsschwere. Wenn ein Grünbein über den Schlaf dichtet, dann braucht es nicht viele Distichen, und schon ist er ganz oben:
Im Schlaf, wie viele Positionen nimmt man ein?
Den Fötus, den Gekreuzigten, Laokoon, Gott Shiva.
Kein Zweifel: Hier ist ein Virtuose der kosmischen Überfliegerpoesie am Werk. Wenn der „Von den Flughäfen“ dichtet, dann geht es sogleich auch um das „Tor zum Himmelreich“. Glücklicherweise kommt zwischen Pathos und Banalität trotzdem noch ein ganz amüsantes, hochwertig beladenes Gedicht zu Stande, dem sogar ein burlesker Unterton abzulauschen ist. Sicherheitskontrolle:
Da waren Schleusen, und man gab den Schlüssel ab, die Uhr.
Die Seele litt, denn jemand fummelte an der Statur.
Wie ist die Welt im Grunde beschaffen? Grünbein lässt es sich nicht nehmen, diese Frage stets im Auge zu behalten. Dabei gelingt ihm mitunter Grosses, gross Gedachtes, gross Formuliertes, ein grosser Sound. Andererseits aber bringt die ständige Flucht nach oben in den abstrakten universalen Überblick auch hochgestochene Plattheiten hervor. Das ist der Zwiespalt, in dem Grünbeins poetische Arbeit derzeit festhängt.
Immerhin wird in dieser Poesie viel geboten, noch dazu gut lesbar, ohne hermetische Schikanen. Grünbein pflastert den Aufstieg auf seinen poetischen Feldherrenhügel mit hochkarätigem Material, mit Bildung, Geschichte und Mythen, literarischen und wissenschaftlichen Modellen oder Verweisen. Die auf diesem Weg entstandenen Gedichte bereiten oft genug ein vielseitiges, erhellendes Vergnügen. Es gibt zahlreiche Reiseimpressionen, New York, East Anglia, Paris, Venedig, Comer See, es finden sich scharfe Zeitkritik und hellwache Reflexionen über dies und das, etwa (à la Enzensberger) über Gegenstände, die noch nicht bedichtet wurden.
Und die Strophen für übermorgen? Sie malen eine schwarze Zukunft:
Die eigne Zeit, die billige, das Interregnum
Der Kleinen Leute. Jetzt ist sie vorbei.
Für alle reicht es nicht, verkündet kühl
Im Nachtprogramm die Elfe und verstummt.
Urknall, freier Fall
Nach wie vor strebt Grünbein danach, ganz auf der Höhe der Zeit zu sein, transzendierende Ausblicke inklusive. Ein ehrgeiziger Souveränitätsgestus ist Teil seines Stils. Die Leserschaft erlebt also dreierlei: einerseits exzellente, vielfach glänzende Gedichte, andererseits verstiegene und dennoch unterhaltsame; und dazu kommt noch das atemberaubende Drama eines Lyrikers, dessen Höhenflüge zwischen vielsagend und nichtssagend gefährlich schlingern. Doch sage keiner, Grünbein würde die Risiken nicht kaltblütig benennen: „Es beginnt mit dem Urknall – Leben, und endet im freien Fall.“
Eberhard Falcke, Tages Anzeiger, 12.12.2007
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Jürgen P. Wallmann: Nicht immer gut gereimt
Am Erker, Heft 55, 2008
Konrad Leistikow: Post von Onkel Mommsen
literaturkritik.de, November 2008
Am 16.11.2007 diskutieren Norbert Miller und Arno Widmann im LCB mit Durs Grünbein über seine Arbeit und die Widerstandsfähigkeit lyrischer Formen.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb + ÖM +
Facebook + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Orden Pour le mérite + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein–Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


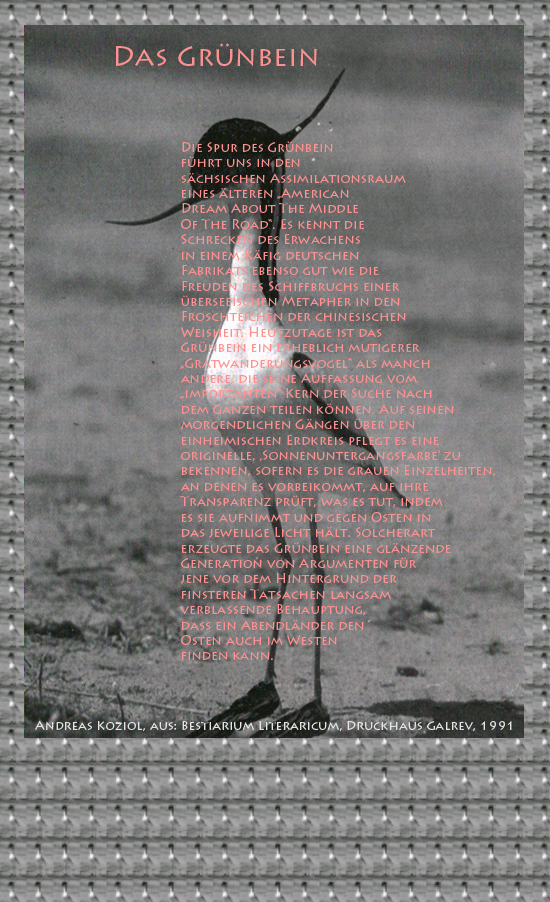
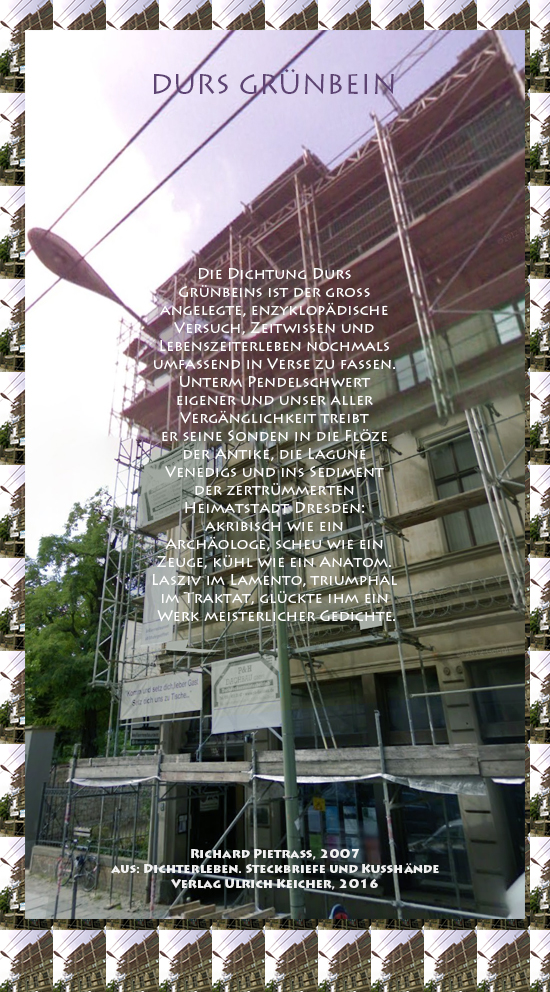












Schreibe einen Kommentar