Ernst Jandl: dingfest
AN REGNENDEN SCHATTEN
„ich lehne
gewisse dinge instinktiv
ab“
ist das grab
mancher unserer debatten.
dabei dehne
ich die auseinandersetzung über themen wie
sind die kommunisten menschen, will
der mensch veränderung, oder empfiehlt
sich freundschaft mit dem geschiedenen gatten
unermüdlich in die länge, bis die themen
einschneidend sind wie der telegrafendraht
mit dem henri rousseau den himbeergeschmack
der idyllischen landschaft neutralisierte.
meist lehne
ich am ende solcher debatten
wie ein vergeblicher strahl durch wolken
schief an regnenden schatten.
die sonne hat keinen instinkt.
ich sehne
mich nach klaren tagen.
Nachwort
Daß diese Gedichte keines Nachworts bedürfen, ist offensichtlich. Sie sind evident wie die Dinge selbst, von denen hier berichtet wird. Es sind alltägliche Dinge, da ist kein bürgerliches Heldenleben. Kinder und alte Leute; eine Reise nach England; ein Besuch kommt aus England; der hinter sachlichen Fragen durchgeführte fight zwischen dem Ausländer und Schalterbeamten auf der Victoria Station in London; Abendgesellschaft und ein paar lustlose Bettgeschichten. Der Krieg mit den sieben Schwaben, nämlich den sieben Söhnen eines deutschen Mannes, der mitsamt seinen Jungen vom Trommler geholt wurde und dabei umkam. Nur der siebente kam davon, zeugte neue Schwaben und hat sich ein Häuschen gebaut, ein bißchen Wohlstand dazu, und wartet worauf?
Gedichte aus zwanzig Jahren. Sie lesen sich wie ein lyrisches Tagebuch, aber man muß bei diesem Autor sehr genau aufpassen, sonst versteht man alles falsch. Erlebnislyrik ist das nämlich im mindesten nicht. Die holt sich ihre Dinge ins Innere und verwandelt sie, als erlebte, in Sprache. So wird das Gedicht zum fruchtbaren Augenblick: aber gemeint ist der Moment des Erlebens. Subjektivität wird zur Sprache gebracht; die Dinge erscheinen bloß in vermittelter Form. Bei Jandl dürften die Proportionen eher umgekehrt sein.
Also Dingdichtung!, wird der gebildete Literaturfreund sogleich diagnostizieren. Auch wieder nicht. Mit seinem entfernten kakanischen Landsmann Rilke hat Ernst Jandl nicht eben viel im Sinn. Dessen Dinggedichte waren dem Überdruß an nachgemachter Erlebnislyrik entsprungen, allein sie verkamen rasch beim Versuch, die Dinge durch Sprache und geprägte Form noch einmal machen zu wollen. Ein gedichteter Panther neben jenem im Käfig; das Karussell mit dem weißen Elefanten dreht sich jetzt auch im Gedicht, welches auf ebenso ausgedachte wie abwegige Art versucht, das Drehen im Raum durch Sprache nachzuäffen. Ernst Jandl unternimmt, wenn man genau liest, nirgendwo eigentlich den Versuch einer solchen Repetition der Dinge durch Sprache. Bei Rilke war eine programmatische Askese verkündet worden: das lyrische Ich hatte sich drauszuhalten, nur die Dinge selbst müßten zur Sprache kommen. Berechtigter Mißmut nach allzu viel Subjektivität, aber man machte sich dabei etwas vor. Das Subjekt konnte nicht wegamputiert werden. Sonst gelang die heikle Nachschöpfung aus Sprache nun einmal nicht.
In dem Gedichtbuch dingfest wird die Subjekt-Objekt-Relation genau respektiert, denn ohne sie sind weder Kunstschaffen noch wissenschaftliche Erkenntnis möglich. Diese Gedichte hier aber haben insgeheim alle gleichfalls einen Erkenntnischarakter. Sie möchten Wahrheit aussagen, indem sie jene Dinge, um die es hier geht, – leider läßt sich Hegels Terminologie diesmal nicht vermeiden – verwandeln in Dinge „an und für sich“: durch lyrische Dichtung.
Das ist eine sonderbare These, denn zunächst einmal wird jeder Leser dieser Texte den Eindruck haben, er sei unablässig mit „statischen Gedichten“ im Sinne von Gottfried Benn konfrontiert. Es sind überall die Kausalitäten ausgespart; Geschichtliches wird ausdrücklich nicht erinnert, sondern möglichst beschwiegen. Gelegentlich hat sich Jandl einige Rezepte der Expressionisten zunutze gemacht und schwelgt dann in Parataxen, worin die Dinge hart, unverbunden, unerklärt nebeneinander gestellt werden. Allerdings nicht ungereimt. Denn diese Dichtung arbeitet gern mit den alten Reizwerten der Reime, wobei der Anglist Ernst Jandl bisweilen auch nach angelsächsischer Art die Korrespondenz der Vokale und Konsonanten herstellt. Aber das sind bloß benutzte Rezepte, die ein moderner Lyriker anwendet, ohne dadurch gleich zum Expressionisten zu werden. Jandl arbeitet an anderer Stelle mit Reihentechnik und wäre dennoch nicht darauf festzulegen. Immer wieder Knüttelreime und Volksliedhaftes; dennoch ist Jandls Lyrik durchaus nicht volkstümlich im trivialen Sinn. Die Statik aber, die immer wieder zu entdecken bleibt, ist nicht, wie bei Benn, die begeisterte Programmatik eines Lyrikers, der mit Nietzsche von der ewigen Wiederkehr des Gleichen überzeugt ist. Es ist bei Jandl eine erschrockene und erbitterte Statik: darüber nämlich, daß sich die Dinge nicht ändern. Womit er sowohl die gesellschaftliche Statik meint, wie die immer wieder bestürzende Statik eines Menschenlebens zwischen Geburt und Tod. Gegen den Schluß des Bandes hin, also seit den 60er Jahren, häufen sich diese Korrespondenzen, aber man findet sie schon im „sommerlied“ aus dem Jahr 1954:
wir sind die menschen auf den wiesen
bald sind wir menschen unter den wiesen
und werden wiesen, und werden wald
das wird ein heiterer landaufenthalt
Mit diesen vier Zeilen – mit dem windschief dazu stehenden Titel – ist ein genauer Einklang vollzogen zwischen Subjektivität und Objektivität. Um größere Worte zu gebrauchen: Humanlyrik und Naturlyrik in einem, aber gebrochen. Vier Jahre später (1958) entsteht jenes Gedicht, das dem Band den Titel gab: „dingfest“.
auf einem stuhl
liegt ein hut.
beide
wissen voneinander
nichts.
beide
sind
so dingfest.
Dies Titelwort hätte auch Hegel geliebt, um ihn abermals zu zitieren, denn er schätzte solche Wörter, die vielerlei zur Sprache bringen können. Auch Karl Kraus in Wien, ein Kantianer und kein Hegelianer, hätte Freude daran gehabt. Etwas wird dingfest gemacht. In diesen Texten hier: durch Sprache. Die Dinge selbst sind fest, in einem doppelten Sinne verstanden: durch ihre Räumlichkeit und dadurch, daß sie sich so schwer verändern lassen. Schließlich jedoch wird in diesem Band gleichzeitig auch ein Fest der Dinge gefeiert; hinter der scheinbaren Statik bricht immer wieder Jandls Lebenskraft und Daseinsfreudigkeit aus. Auch Zorn und Trauer, wovon hier viel zu spüren ist, sind Äußerungen einer gleichsam programmatischen Lebendigkeit.
Es ist nur scheinbar paradox: Jandls Texte entweichen immer wieder den Schmetterlingsnetzen der Poetologen, obwohl sie durchaus nicht mit Schmetterlingen verwechselt werden sollten. Keine Erlebnislyrik und keine Dinggedichte und keine statischen Gedichte. Hinter diesen Negationen wird, ganz folgerichtigerweise, die Eigenart dieser Lyrik und ihres Lyrikers deutlich. Übrigens auch keine konkrete Poesie. Der mit dem Verfasser dieses Bandes identische Verfasser der Gedichtbände Laut und Luise, Sprechblasen oder Der künstliche Baum geht hier nur gelegentlich um, aber auch da wird nur die konkrete Poesie zu einem Element, mit dessen Hilfe einiges an Realität dingfest gemacht werden kann.
MOTORRADFAHRER
griff und griff mit ellbogen und ellbogen haltend
der motorradfahrer bedient seine maschine
hände unterarme und beine spreu sind
geschieden vom weizen bedient er seine maschine
fragen möchte wie kamen abhanden diese
abhanden hände beine unterarme wie kamen
aber nicht gestattet ist noch aktuell gefrage
sind doch spezialausführung maschine und krüppel
Für Kinder waren die konkreten Gedichte Ernst Jandls stets unmittelbar evident. Man liebte Ottos Mops, der trotzte und kotzte. Wenn Jandl selbst vorträgt, so machen es die Kinder hinterher nach, etwa das Gedicht mit der Oberlippe und der Unterlippe. Wir hatten damals auf der Schule die „Galgenlieder“ entdeckt. Einer aus der Klasse konnte „Fisches Nachtgesang“ mit seinem breiten Maul vortragen. Er wurde sehr bewundert und imitiert. Die Texte des Buches dingfest sind nichts für Kinder. Vielleicht doch? Eine plebejische Tradition nämlich geht darin um, nicht bloß durch die gern gewählte Form einfacher und klingender Reime. Oder durch viel Märchensubstanz, die aus den Dingen durch den Dichtenden herausgezerrt wird. In dem Text „ach, wie gut“ geht das Rumpelstilzchen um. Es sind sehr einfache Gedichte, die mit allen Wassern gewaschen wurden. Weshalb sie keines Nachwortes bedurften, und doch vielleicht eines brauchen konnten.
Hans Mayer, Nachwort
Ernst Jandl Dingfest
Dieses Buch enthält 159 von Ernst Jandl ausgewählte und chronologisch gereihte Gedichte aus den Jahren 1952–1971. Ihre Sprache bleibt der Sprache des Alltags genähert. Wie diese zeigt sie nicht auf sich selbst, sondern verhält sich dienstbar. Sie teilt Zustände, Vorgänge, Umstände mit. Sie teilt außerdem mit, was der, der mitteilt, bei dem, was er mitteilt, denkt und fühlt. Siel teilt Meinungen mit, Meinungen eines einzelnen, der denkt und fühlt wie die meisten. – Von diesen 159 Gedichten schrieb Jandl die ersten 63 früher als das früheste Gedicht in seinen Büchern Laut und Luise, Sprechblasen und Der künstliche Baum. Die anderen 96 Gedichte schrieb er von dem Punkt an, an dem er die Gedichte jener drei Bücher zu schreiben begann. Er habe immer etwas zu sagen gehabt, behauptet er, und er habe immer gewußt, daß man es so und so sagen könne; und so habe er sich nie darum bemühen müssen, etwas zu sagen, wohl aber um die Art und Weise dieses Sagens. Denn in dem, was man zu sagen hat, gibt es keine Alternative, aber für die Art und Weise, es zu sagen, gibt es eine unbestimmte Zahl von Möglichkeiten. Es gibt Dichter, die alles Mögliche sagen, und dies immer auf die gleiche Weise. Solches zu tun, habe ihn nie gereizt, behauptet er; denn zu sagen gäbe es schließlich nur eines; dieses aber immer wieder und auf immer neue Weise.
Luchterhand, Klappentext, 1973
Poetisches und Dingfestes
– Zu Lyrikbänden von Johannes Poethen und Ernst Jandl. –
Zwei Lyriker sind hier vorzustellen, deren gegensätzliches Selbstverständnis und deren Gedichte gewiß nicht auf einen Nenner zu bringen sind: Johannes Poethen und Ernst Jandl. Beide veröffentlichen seit den fünfziger Jahren (Poethen seit 1952 mit Lorbeer über gestirntem Haupt, Jandl seit 1956 mit Andere Augen), allerdings ohne in der Aufnahme und Anerkennung kontinuierlich Erfolg zu finden. Die Erstlingstitel deuten bereits die gegensätzlichen Positionen an. Jandl würde einem Titel wie Lorbeer über gestirntem Haupt allenfalls eine ironische Pointe abgewinnen. Es kann aber hier nicht darum gehen, den einen gegen den anderen auszuspielen. Vordringlicher scheint mir, die thematisch und formal unterschiedliche Eigenart beider Lyriker herauszustellen und eben dadurch die Spannweite dessen, was in der derzeitigen deutschsprachigen Lyrik sagbar ist, zu kennzeichnen. Ohne allzu voreilige Schlußfolgerung mag man darin, daß beide Autoren im letzten Jahr wichtige Gedichtbücher veröffentlichen konnten, für den gegenwärtigen Stand des Gedichts, für die keineswegs erschlaffte oder ans Ende gekommene Möglichkeit des Sich-Mitteilens im Gedicht ein gutes Zeichen sehen.
(…)
Auch Ernst Jandl schreibt „mit Wörtern die jeder kennt“, allerdings ohne den Wörtern mehr zuzumuten, als das zu Bezeichnende hergibt. Im Gegensatz zu Poethen bleibt die geschichtliche und erst recht die mythische oder mythenbildende Beziehungsvielfalt außer Betracht. Was gemeint ist, zeigt programmatisch Jandls Titelgedicht „dingfest“:
auf einem stuhl
liegt ein hut.
beide
wissen voneinander
nichts.
beide
sind
so dingfest.
Jandl überrascht mit seinen 159 Gedichten aus den Jahren 1952 bis 1971 diejenigen, die ihn ausschließlich als witzigen und gewitzten Handhaber der konkreten Poesie einordnen. Nach kaum beachteten Anfängen zählte der Wiener Gymnasialprofessor seit seinem Gedichtbuch Laut und Luise (1966) zur Gruppe der Konkreten, die in den bloßen Sprachzeichen, unabhängig von ihrer Mitteilungsfunktion, selbständige, eben konkrete Objekte sehen. Jandl hat, vor allem durch das eigene virtuose Sprechen seiner sprachspielerischen Lautkompositionen, viel dazu beigetragen, Vorbehalte gegenüber solcher experimenteller Lyrik abzubauen. Der vorliegende Gedichtband beweist nun, daß Jandl keineswegs auf die konkrete Poesie, die ihn allerdings bekannt gemacht hat, definitiv festzulegen war oder ist. Im Vorspann zu Dingfest widerspricht Jandl unmißverständlich jeder formalen Ausschließlichkeit:
es gibt dichter, die alles mögliche sagen, und dies immer auf die gleiche weise, solches zu tun habe ihn nie gereizt; denn zu sagen gäbe es schließlich nur eines: dieses aber immer wieder, und auf immer neue weise.
So bedient sich Jandl, abgesehen von der bereits genannten Einschränkung, durchaus der vielfältigen Ausdrucksformen traditioneller Lyrik und der im Gedicht möglichen Mitteilung. Es sind alltägliche, oft banale Begebenheiten, Zustände, Erfahrungen, Meinungen, Gefühle, die Jandls direkte, unverstellte und jedermann zugängliche Sprache benennt. Daß der Witz gelegentlich in Platitüden oder Blödeleien verpuffen kann, muß man wohl auch anmerken. Was solls, wenn Jandl beifallsicher fragt:
wer ist unser ur-
ahn unser alt-
vorderer dieses arsch-
loch.
Erstaunlich ist die Spannweite dieser Sammlung mit witzig-vergnüglichen Versen nach Dada-Manier und völlig vereinfachten Feststellungen („es war die farbe grün / also nicht winter“), mit schlichten Zwei- und Vierzeilern, die an Kinderverse erinnern oder den Volksliedton aufgreifen, oft und nicht nur parodistisch gereimt, mit Erzählgedichten, die Ausschnitte alltäglicher Realität festhalten, mit kleinen, streng geschlossenen lyrischen Fügungen und grotesken Wortverbindungen. Wie in einigen seiner konkreten Gedichte kommt auch hier nicht selten Jandls Sprachwitz zur Geltung, der bekanntlich Kindern Vergnügen macht. Die naive, auf Anhieb verständliche Bildlichkeit in den Erzählgedichten prägt sich ein. Eines beginnt:
immer schaut die kleineminna
aus dem fenster in ein zimmer vis-à-vis.
Aber das Einfache, das scheinbar rührend Naive nimmt unterderhand melancholische und bittere Züge an, indem ein Stück Wahrheit aufgedeckt wird, fast beiläufig. So in diesem harmlos beginnenden Gedicht:
frau puppengesicht
hat unser sofa besucht.
melancholisch wie ein Waschbrett
lehnte sie
und seufzte Seifenblasen.
ihre verlangen
haben sich zu Symptomen verschärft
mit denen sie ärzte abnützt.
ihr mann, ach – ihr mann, ach –
ach ach, ihr mann.
Überhaupt decken die Gedichte mehr Dunkelheiten und vertrackte, gar nicht mehr heitere Situationen auf, als man dem Jokulator Jandl zugestehen möchte. Das Spielerische, Sprachwitzige, auch der eingängige, mitunter an Heine erinnernde Volksliedton erweisen sich als hauchdünne Schicht über den Untiefen einer brüchigen Realität.
Etwas mühsam versucht Hans Mayer im Nachwort den Ort dieser Gedichte zu bestimmen. Gewiß sind es, trotz einiger Annäherungen, keine Erlebnis- oder Dinggedichte, keine statischen Gedichte im Sinne Benns. Doch Mayers Anmerkung „Humanlyrik und Naturlyrik in einem, aber gebrochen“ behängt den so einfachen wie hintersinnigen Vierzeiler „sommerlied“ mit unnötigen Gewichten. Mayer stellt Jandls Gedichte in „eine plebejische Tradition“. Das kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß Jandls vielfältiger „art und weise, etwas zu sagen“ ein nicht zu unterschätzender Kunstverstand zugrunde liegt, und zwar gerade dort, wo die Gedichte Jandls, anders als bei Poethen, „dingfest“, realitäts- und alltagsbezogen bleiben.
Eberhard Horst, Neue Rundschau, Heft 1, 1974
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Jürgen P. Wallmann: Auch die Dada-Väter sind zu Gast
Rheinische Post, 8. 9. 1973
Helmut Mader: Einige Personen aus vielen Dramen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. 10. 1973
„Am Anfang war das Wort…“
– Ernst Jandls 1957. –
1957 ist sicherlich das wichtigste Jahr im Schaffen von Ernst Jandl. Es entstehen in dieser Zeit viele Gedichte, die Jandl berühmt gemacht haben und die mittlerweile zu seinen Klassikern gezählt werden. Was dieses Jahr aber vor allem auszeichnet: ihm gelingt es endlich Gedichte zu schreiben, die sich deutlich von der Tradition absetzen, und das in einer großen Anzahl. 1957 entwickelt sich Jandl zum unverwechselbaren Neuerer, zu einem einzigartigen Sprachakrobaten, der die Welt in unseren Köpfen zum Tanzen bringt. Und da bei Ernst Jandl alles die Tendenz hat, kunstvoll aus den Fugen zu geraten, beginnt bei ihm das Jahr 1957 auch nicht mit dem 1. Jänner, sondern bereits drei Jahre früher, im Sommer 1954.
Zum 5. Mal fand damals die Österreichische Jugendkulturwoche in Innsbruck statt, und Ernst Jandl nahm daran wie viele andere Autoren auch teil, darunter Friederike Mayröcker. Sie faszinierte ihn, da sie schon der Nimbus einer großen Autorin umgab, und er sich nichts sehnlicher wünschte, als mit einer Schriftstellerin zusammen zu leben. Während eines Englandaufenthalts war Ernst Jandl von Erich Fried auf die Literatur eingeschworen worden. Fried hatte ihm geraten, er solle entweder alle Kräfte für das Schreiben einsetzen oder es sein lassen. Zusammen mit Friederike Mayröcker glaubte er, das leichter schaffen und gemeinsam richteten sie sich in einem lebenslangen Provisorium ein, die entscheidende Grundlage ihrer und vor allem seiner poetischen Existenz. Ernst Jandl dazu im Rückblick:
bitte, wir sind nicht verheiratet, wir haben keinen gemeinsamen haushalt, wir führen keine ehe. unser leben ist seit vierzig jahren ein gemeinsames, ohne eine gemeinsame wohnung und ohne kochtopf. der turbulente anfang wich alsbald einer bis heute anhaltenden ereignislosigkeit, ohne idylle, das telefon unser kontaktmedium nummer eins.
Damit hatte sich Ernst Jandl von seinem bürgerlichen Leben verabschiedet und seine ganze Existenz auf das Schreiben ausgerichtet, noch aber stand keine Zeile auf dem Papier. Er mußte sich zwei weitere Jahre gedulden, bis zum Vorfrühling 1956. Damals begab er sich auf ein Gebiet, das er sonst meidet. Er unterbrach seine Arbeit an Gedichten und machte einen kurzen Ausflug auf das für ihn damals unvertraute Gebiet der Prosa. Freiwillig geschah das keineswegs, er befand sich in einer Klemme. Seine Produktion von konventionellen Gedichten, die er seit 1952 mit Erfolg schrieb, war vollkommen versiegt. Wie aber konnte er seine Arbeit fortsetzen, denn was wollte er außer Gedichte schreiben? Seit langem schon hatte er eine Schwäche für Gertrude Steins Erzählstudien. Von ihr hatte er zum ersten Mal etwas gelesen, als er in einem britischen Kriegsgefangenen-Lager eingesperrt war, und war fasziniert. Jetzt nimmt er diese frühe Lektüre wieder auf und sofort stellt sich eine Idee ein: Ließe sich vielleicht Gertrude Steins Schreibtechnik irgendwie für die eigene Arbeit nutzbar machen?
Im März 1956 war es dann soweit. Jandl begann sich mit Reminiszenzen an seinen Aufenthalt in England zu beschäftigen, und das Ergebnis war eine Überraschung. Nach und nach stellten sich Sätze ein wie diese:
england ist niedrig und grau. alles in england ist niedrig und grau. aber alles grau in england ist grün, und das ist das wunderbare. alles ist in england niedrig und grau. aber alles niedrige sind anker des himmels über england. das ist das wunderbare.
Das ist der Anfang von Ernst Jandls „prosa aus der flüstergalerie“ – was war neu und unerhört an diesen Sätzen? Ernst Jandl hatte seine Sprache von den alltäglichen Mitteilungszwängen weggeführt. In einem Satz wie „england ist niedrig und grau“ errichtete er eine den üblichen Sprechgewohnheiten zuwiderlaufende, ihnen aber überlegene Logik. Nach den Regeln der Alltagssprache hätte Jandl diesen Satz als falsch und damit als unbrauchbar einstufen müssen. England kann wie kein anderes Land auf der Welt als „niedrig“ bezeichnet werden. Diese falsche Zuordnung einer Eigenschaft gibt dieser Fügung jedoch erst ihren unverwechselbaren Charakter und verleiht ihr sein poetisches Gewicht. Die Aussage „england ist grau“ wäre blaß und würde nur ein literarisch höchst unattraktives Klischee über dieses Land verbreiten, demzufolge viele Gegenden öde sind und es häufiger als anderswo regnet. Durch das Wort „niedrig“ wird der Satz jedoch aufgebrochen und restlos von seiner Durchschnittlichkeit befreit. Das Niedrige nimmt gigantische Ausmaße an („aber alles niedrige sind anker des himmels über england“) und von dem Bedrückenden, das diesen Wendungen anhaftet, beginnt eine seltsame Anziehung auszugehen. Durch das gezielte Verbiegen der gewohnten Sinnlogik hatte Ernst Jandl gefunden, wonach er gesucht hatte und das ihn zutiefst prägen wird: eine radikal neue und unverbrauchte Methode, Literatur herzustellen.
Bestärkt, in dieser Richtung weiterzuarbeiten, wurde Ernst Jandl auch durch einige wenige Autoren, die ungefähr im gleichen Alter wie er waren.
Dann kamen einige Monate intensiven Kontakts mit Artmann und Rühm, Friederike und mir. Friederike Mayröcker und ich auf der einen Seite und Artmann und Rühm auf der anderen, wir sind oft in der Wohnung von Friederike zusammengekommen und haben uns gegenseitig Texte ausgetauscht, d.h. wir haben sie einander lesen lassen oder einander vorgelesen und kritisiert. Das war sehr interessant und für mich sehr fruchtbar.
Diese Miniatur-Gruppe-47, aus der dann, aber ohne Ernst Jandl, die Wiener Gruppe hervorgehen sollte, unterstützte ihn in seiner Vorstellung von einer radikalen Poesie. Gerhard Rühm schrieb seit 1952 bereits Lautgedichte, Hans Carl Artmann beschäftigte sich mit dem Barock – im Vergleich mit diesen beiden Autoren konnte Jandl sicher sein, daß seine Versuche, sich von der traditionellen Lyrik abzusetzen, keineswegs im Bizarren endeten. Einen nächsten wichtigen Schritt vollzog er dann Anfang des Jahres 1957 im Gedicht „hosi“.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahosi
anna
maria
magdalena
aaaaahosi
aaaaaaaaaaaaaaaaahosianna
aaaaaaaaaaaaaaaaahosimaria
aaaaaaaaaaaaaaaaahosimagdalena
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahosinas
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahosiannanas
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahosimarianas
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahosimagdalenanas
ananas
In diesem Gedicht arbeitet Jandl zum ersten Mal mit Worttrümmern. „hosianna“ wird in zwei seiner Bestanteile „hosi“ und „anna“ zerlegt. Von „anna“ führen die Assoziationen zu anderen weiblichen Vornamen, und Jandls Worttravestien können beginnen. Der unauffällige Vorname „anna“ verwandelt sich über den Umweg „hosianna“, und die lautliche Schnittstelle „hosinas“ in die damals noch exotische Frucht „ananas“, und mit dieser Wortverdrehung hat Jandl höchst spielerisch, aber unmißverständlich sein Verhältnis zu den religiösen Praktiken der katholischen Kirche zum Ausdruck gebracht. „hosianna“, der Gebets- und Freudenruf, büßt, wenn ihn Jandl durch seine Wortmühle dreht, seine heilige Aura ein, dafür werden an diesem Wort bislang vollkommen unentdeckte groteske Seiten zutage gefördert. Vor allem aber ist ihm mit diesem Gedicht ein Quantensprung in der Literatur gelungen. Er hat die Sprache in Wort und Laut zerlegt und ist in der Arbeit mit diesen elementare Teilchen zum ersten Mal zu einem aufregenden Ergebnis gekommen.
Indem Jandl auf die Sprache als poesietaugliches Material stößt, hat er in der Literatur ähnliches vollbracht, wie die 12-Ton-Komponisten in der Musik oder die ersten abstrakten Maler in der bildenden Kunst: er hat eine radikal neue Art des Dichtens begründet. Ernst Jandl könnte eine Art von Arnold Schönberg auf dem Gebiet der Poesie angesehen werden.
Damit hatte sich Ernst Jandl in eine Richtung fortentwickelt, die ihm, seit er Gedichte bewußt wahrnehmen konnte, den größten Spaß gemacht haben. In seinem Aufsatz „Mein Gedicht und sein Autor“ vom Jänner 1967 erinnert sich Ernst Jandl:
Mein lyrischer Proviant zwischen 1938 und 1943, als Gymnasiast, hatte aus je drei Gedichten von Stramm, Wilhelm Klemm und Johannes R. Becher bestanden, aufgefunden in einer Gedichtsammlung aus dem Jahr 1926. Eines, „Lied“ von Johannes R. Becher, wirkte auf Dauer.
LIED
Stern ob Straßenbündel
Weht dein Angesicht.
Winde krumme münden.
Schwarm der Häuser dicht.
(…)
Die Hochstimmung dieser expressionistischen Zeilen, erzeugt aus einer Sprache, die dicht neben der gewohnten liegt, fand Ernst Jandl hinreißend. Wie aber konnte er selber Gedichte von vergleichbarer Dichte herstellen? Denn genau das wollte er. Wie die Expressionisten suchte er nach unbekannten Wegen, um zu eigenen Gedichten zu gelangen. Er befand sich in einer Aufbruchsstimmung ohne näher zu wissen, wie dieser Aufbruch zu schaffen sei. Das Zwiespältige seiner Lage drückte er in dem berühmten Gedicht aus:
ZEICHEN
Zerbrochen sind die harmonischen Krüge,
die Teller mit dem Griechengesicht,
die vergoldeten Köpfe der Klassiker –
aber der Ton und das Wasser drehen sich weiter
in den Hütten der Töpfer.
In diesem Gedicht umreißt Jandl klar seine Schreibsituation. Die anerkannten Traditionen taugen nicht mehr, gleichwohl besteht das Bedürfnis, sich auszudrücken, unvermindert fort. Damit beschreibt Jandl nicht nur die allgemeine Situation, in der er die Dichter seiner Generation sieht, sondern er wird sich in der Art dichterischer Selbstfindung auch seiner eigenen Lage bewußt und bereitet seine Entwicklung vor, die aber erst 5 Jahre später in eine ungeahnte produktive Erruption mündet. Am Anfang steht bei ihm der Wunsch, etwas neues machen zu wollen, und die Ablehnung von allem, was nur in die Nähe von geschmackvoll-lyrischen Gedichten kommt. Das einzige Adjektiv in diesem Gedicht zeigt bereits zu dieser Zeit, daß Jandl keineswegs ahnungslos ist, in welche Richtung er später aufbrechen möchte. Das Zerbrochene ist „harmonisch“ gewesen, und Jandl weiß genau, daß es bei ihm nicht harmonisch zugehen soll, im Gegenteil: Er wünscht sich Gedichte, die dissonant, laut, grell sind. Heftig sollen sie auftreten und je entschiedener sie das tun, um so besser.
Im Vergleich zur Musik und Malerei war es auf dem Gebiet der Literatur jedoch weitaus schwieriger, in der Sprache selbst poesietaugliches Material zu erkennen. Ein wesentlicher Grund bestand darin, daß Töne und Farben, das, woraus Musik und bildende Kunst entstanden, nicht eingegliedert in die alltäglichen Verständigungsvorgänge waren. Sprache dagegen hatte eine genau umrissene Aufgabe zu erfüllen. Sie hatte der Mitteilung, Rede und Gegenrede zu dienen, darin bestand ihre einzige und als natürlich empfundene Bestimmung. Diese Selbstverständlichkeit mußte Jandl erst einmal durchbrechen. Hinzu kam, daß sich der Faschismus in der Literatur verheerend auswirkte, auch als er politisch längst zur Kapitulation gezwungen war.
Und da man, während der nazizeit, also in Deutschland von 33–45 und Österreich von 38–45 einen beträchtlichen Teil der relevanten Literatur einfach vernichten konnte, die davon nirgends zurückgekommen wäre, so ist man 45 dagestanden und hat so erste Gehversuche gemacht in konventionellen Formen. Zwar unter Einbeziehung der Kriegsthematik, aber eher in konventionellen Formen.
Konjunktur hatte nach wie vor eine Kultur, die auch bei den Nazis nicht auf Widerspruch gestoßen wäre, Operetten füllten die Säle, Lustspiele die Kinos, gegenüber allem Neuen gab es regelrecht einen Affekt.
Der Brecht wollte einen österreichischen Paß. Der Brecht hätte gern mal in Salzburg inszeniert, oder so was, aber da hat man gesagt, der ist Kommunist und soll woanders hingehen. Unerhörtes Versäumnis. Ein ebensolches Versäumnis wie der Erfinder des Volkswagens war ein Österreicher und der hat den Österreichern das angeboten, Volkswagen zu bauen, na dös brauchn mer net. Was haben wir da an nationalem Vermögen eingebüßt, dadurch daß es in Wolfsburg und nicht irgendwo bei uns errichtet wurde. Und wir haben natürlich an kulturellem Potential auch viel eingebüßt.
Eine höchst unglückliche Rolle spielten auch die wenigen österreichischen Autoren, die aus dem Exil zurückkehrten: Jemand wie der Lyriker Rudolf Felmayer oder der Romancier Friedrich Torberg oder der Feuilletonist Hans Weigel, sie alle waren erklärte und vehemente Gegner der Nazis, deswegen mußten sie auch das Land verlassen. Sie standen jedoch für eine Literatur, deren formale Anlage notfalls auch von den Nazis geduldet worden wäre. Ernst Jandl dagegen vertrat eine unversöhnliche Position:
Ich meine, in grober Vereinfachung habe ich zum Beispiel gesagt, ausgesprochen, nirgends hingeschrieben, alles was man macht an Kunst verdient Beachtung, wenn es sich um etwas handelt, was bei den Nazis nicht möglich gewesen wäre. Das gilt für Sprache, Musik und bildende Kunst in gleicher Weise. Also darin liegt an und für sich schon eine Qualität, nicht die einzige, nicht die letzte. Was man sagen kann, das hätte man unter den Nazis verbrannt, dafür wäre man unter den Nazis ins KZ gekommen, oder ähnliches, da wärst du mit Schreibverbot, Malverbot belegt worden.
Ernst Jandls Kunstwollen war jedoch in einem viel umfassenderen Sinne radikal und erschöpft sich keineswegs nur in einer strikten Absage an die Nazis:
Und es kam natürlich darauf an, ich meine, so wie das in der Malerei und in der Musik geschehen ist, kam es darauf an, die Mittel, das Material, das man gebrauchte für ein Kunstwerk zu verändern und sich nicht vor das schöne Naturbild hinzusetzen und dieses schöne Naturbild auf eine schön Leinwand schön zu übertragen, sondern eine ganz andere Art der Auseinandersetzung mit der sichtbaren Welt, so wie ja z.B. die 12-Ton-Musik und radikal moderne Musikformen, eine radikal andere Auseinandersetzung mit der hörbaren Welt bedeuten, als das bis dahin geschehen war.
Kein schönes Naturbild! Vor diesem Hintergrund zeigt sich die Bedeutung dessen, was Ernst Jandl im Frühjahr 56 gelungen war. Mit seiner „prosa aus der flüstergalerie“ war Jandl seinen Ansprüchen endlich so nahe wie möglich gekommen. Er hatte ein Kunstprodukt geschaffen, das von den Nazis als entartet eingestuft worden wäre, mit allen Konsequenzen, die sich aus dieser Beurteilung ergeben hätten. Und ihm gelang es auch einen endgültigen Bruch mit den bürgerlichen Schreibtraditionen, mit der blind gewordenen Liebe des Schönen zu vollziehen. Nachdem aber die „prosa aus der flüstergalerie“ geschrieben war, kam die Produktion im nächsten knappen Jahr fast vollkommen zum Erliegen. Das Gedicht „hosi“ entstand, einige der Prosa nahestehenden Gebilde wie „ohren im konzert“ und „andantino“ (beide in Laut und Luise) wurden geschrieben, weiter vermochte Jandl nicht vorzudringen. Obwohl scheinbar nur wenig geschieht, fällt eines in dieser für Jandl typischen Inkubationszeit auf: die Gedichte sind von größerer Härte als die voraufgegangenen. Und im Februar 1957 ist es dann soweit: Es kommt zu einer gewaltigen Produktionsexplosion. Jandl konnte plötzlich wieder anknüpfen an die „prosa aus der flüstergalerie“. Im Gedicht „tief graben“ kommt es zu einer höchst ungewöhnlichen Reihung von Wörtern:
tief
graben
jordan
tief
graben
jordan
tief
fische
jordan
Der Effekt ist verblüffend. Durch diese Art der Wortwiederholung kommt eine bisher unerreichte Dynamik in das Gedicht hinein. Wenig später kombiniert Jandl diese Entdeckung mit Erfahrungen, die er beim Schreiben von „hosi“ gemacht hat. Kurz nach „tief graben“ entsteht eines der berühmtesten Lautgedichte: „bestiarium“, ein Lautfuriosum, das Ameisen, Libellen und anderes Getier in einen abgründig komischen Tanz durcheinanderwirbelt. In Jandls Zoo hausen bloß noch Wortpartikel und langgezogene Laute und vollführen eine rasante Polonaise. Mit diesem Gedicht beginnt bei Ernst Jandl auch eine seiner ertragreichsten Zeiten.
Soweit sich das anhand der vorhandenen Datierungen nachvollziehen läßt, entstehen im Jänner 6 Gedichte, im Februar und März sind es bereits 22. Im April erreicht dann Jandl mit 32 Gedichten seinen Höhepunkt. Im Mai und Juni verringert sich der Ausstoß an Gedichten merklich: 12 Gedichte werden im Mai geschrieben, 11 im Juni. Dann kommt es zu einem Einbruch, und für den Rest des Jahres versiegt die Produktion fast vollkommen. In diesem halben Jahr entstehen beinahe weniger Gedichte als in einem der Monate vorher: insgesamt nur noch 15 Stück. Damit waren in einem einmaligen Aufschwung von nur wenigen Wochen die Gedichte geschrieben, die später in den Band Laut und Luise finden sollten und mehr noch. Der Vorrat an Gedichten, der in diesem kurzem Zeitraum entstand, ist so groß, daß er sich aus diesem Fundus noch bedienen kann, als er die Bände sprechblasen, den künstlichen baum, dingfest und selbst 1974 das kleine Buch übung mit buben zusammenstellt.
Typisch für die Gedichte aus dem Frühjahr und Frühsommer 1957 ist beispielsweise „etüde in f“:
ETÜDE IN F
eile mit feile
eile mit feile
eile mit feile
durch den fald
durch die füste
durch die füste
durch die füste
bläst der find
falfischbauch
falfischbauch
eile mit feile
auf den fellen
feiter meere
feiter meere
falfischbauch
falfischbauch
fen ferd ich fiedersehn
falfischbauch
falfischbauch
fen ferd ich fiedersehn
fen ferd ich fiedersehn
falfischbauch
fen ferd ich fiedersehn
falfischbauch
falfischbauch
ach die heimat
ach die heimat
fen ferd ich fiedersehn
ist so feit
Das Ausgangsmaterial ist die Redewendung: Eile mit Weile. Sie wird aber durch Austausch des Konsonanten w durch f in eine grotesk wirkende Distanz gerückt. Dadurch, daß diese Wendung wiedererkennbar bleibt und Jandls kleiner poetischer Eingriff sofort bemerkt wird, kann sie in diesem Wechselspiel ihre eigentümliche poetische Kraft zur Entfaltung bringen. Hinzu kommt, daß dieses Gedicht wieder von einer Dynamik beherrscht wird wie vorher schon „bestiarium“. Auch hier wieder entsteht der Sog durch knappe Zeilen, unterbrochen von überraschenden Wendungen.
Charakteristisch an „etüde in f“ ist, wie für viele Gedichte aus dieser Zeit, daß sich in das leere Spiel mit Worten und Lauten immer deutlicher wahrnehmbar Inhalte und Gefühlswerte mischen. Vom Kompositum „falfischbauch“ geht eine unbestimmte Wehmut aus. Dieser Eindruck wird verstärkt durch die Zeile „fen ferd ich fiedersehn“. Mit „wiedersehen“ wird auf einen nicht näher umrissenen Abschied angespielt. Der Schlußseufzer bringt dann die inhaltliche Klarheit: „ach die heimat“. Was im Titel als eine Lautübung angekündigt wird, und als Übung dann auch beginnt, endet mit einer milden Verspottung von Heimweh und Heimatliebe.
Minimalistischer geht es in Jandls berühmtem Gedicht „schtzgrmm“ zu. Wieder ist der Ausgangspunkt eine geläufige Wendung, die in diesem Fall nur aus einem Wort besteht. Seit dem 1. Weltkrieg hat das Wort „Schützengraben“ Signalwert für das Absurde des Kriegs schlechthin. An diesem Wort nimmt Jandl, wiederum um dessen poetisches Inneres zu entblößen, eine kleine Manipulation vor. Er entzieht dem Wort sämtliche Vokale und damit seine harmonischen Klangqualitäten (Jandl: „Der Krieg singt nicht.“). Dadurch erhält das Gedicht eine überraschende Plastizität, und worum es Jandl noch mehr zu tun war, eine enorme Direktheit. Schüsse und Maschinengewehrknattern werden nicht beschrieben, sondern sind zu hören. Der Leser nimmt quasi an den Kampfhandlungen teil.
Das Gedicht kann jedoch nur seine Wirkung entfalten, wenn es gesprochen oder beim Lesen zumindest durch die innere Stimme in seiner lautlichen Gestalt nachgebildet wird. Damit hatte Jandl eine Sorte von Gedicht geschaffen, die für ihn von großer Bedeutung sein wird: das Lautgedicht. Der gezielte Umgang mit Lauten gehörte auch in der traditionellen Lyrik zu einem wesentlichen Element. Allerdings stellte Jandl die lautliche Gestalt des Gedichts derart radikal in den Mittelpunkt seiner Gedichte, daß eine neue Form der Poesie mit einer provokanten Ausdrücklichkeit entstand.
„schtzgrmm“ könnte durchaus als ein Antikriegsgedicht bezeichnet werden, allerdings zeigen sich sofort die Unterschiede zu seinen Vorläufern. Im wesentlichen sind sie in dessen rabiaten Ton zu suchen. Jandl legt seinem Abscheu gegen den Krieg und seiner Wut keine lyrischen Zügel an, im Gegenteil: In fast allen seiner Gedichte bricht sich etwas Elementares Bahn. Diese Gedichte sind von einer Vehemenz, als wirkten Naturgewalten, und lassen Theodor W. Adornos Horror vor generell zu viel heiler Welt in Gedichten, das er in seinem Diktum zusammenfaßte, wonach seit Auschwitz keine Gedichte mehr geschrieben werden können, als haltlos erscheinen. Da Jandl Lebensäußerungen in ihrer elementaren Form festzuhalten vermag, tritt er, ohne es darauf angelegt zu haben, den Beweis an, daß sich Gedichte der Realität nach 1945 gewachsen zeigen können. Allerdings müssen sie von einer ungewöhnlichen Härte sein. Die Gedichte haben in einem buchstäblichen Sinn laut zu werden.
Deutlich tritt in diesen Gedichten auch die Lust am Spiel zutage, wie beispielsweise in „minz den gaawn“ aus dem April 1957. In diesem Gedicht arbeitet er ausschließlich mit Rhythmus, den er aus Lautfolgen und deren Klangfarben erzeugt, und schafft ein Gebilde, das Vokale und Konsonanten zu einem melodischen Ganzen zusammenfügt: „minz den gaawn / bill den baud.“ Der Zweck dieses Gedichts: Freude, Spaß. Einen durch gewundene Interpretationen aus irgendwelchen Tiefen heraufzufördernden „Inhalt“ gibt es nicht. Dieser Rhythmus ist erfüllt von einem nur schwer zu besänftigenden Widerspruchsgeist und dem Wunsch, ihn auszudrücken.
Zu dieser Zeit entdeckt Jandl auch die inhaltlichen Bestandteile der Inhaltsleere. Ein schlagendes Beispiel: „talk“, „blaablaablaablaa“ usw. – Jandls Einschätzung unserer Dialogfähigkeit. Auch im ganzen Komplex der religiösen Gedichte gewinnt die Leere als bewußt in den Vordergrund geschobenes Zentrum des Lautspiels ebenfalls eine große Bedeutung. Im Gedicht „jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee“ zerlegt er das Wort „Jesus“ in seine Lautbestandteile, fügt noch das Wort „komm“ und in seiner Schroffheit das Wort „herrr“ hinzu und aus seiner lautlichen Unbestimmtheit ist mit zunehmender Dauer des Gedichts dann eine Anspielung auf das „Komm Herr Jesus / und sei unser Gast.“ herauszuhören. Doch je häufiger Jandl die Lautbestandteile des ersten Verses wiederholt, umso deutlicher wird, daß das Gebet zur Floskel erstarrt ist. Die Laute verhallen ohne Echo, religiöse Gefühle sind darin schon lange nicht mehr enthalten.
Ähnlich verfährt Jandl in einem seiner grundsätzlichsten Gedichte aus dem Jahr 1957: „fortschreitende räude“. Wieder entsteht das Gedicht aus dem Spiel mit bekanntem, die religiöse Tradition begründendem Sprachmaterial, aber dieses Mal setzt Jandl fundamentaler an. Er benutzt in der ersten Zeile einen der zentralen Sätze aus der Schöpfungsgeschichte: „Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott“, allerdings mit einer kleinen Veränderung. Bei Jandl lautet diese Zeile: „hirn hanfang war das wort hund das wort war bei / (…).“ Alle Worte, die mit einem Vokal beginnen, bekommen den Konsonant „h“ davorgesetzt. Das reicht aus, um den Ernst dieser Zeile zu brechen und der Komik, die auch darin liegt, bloßzustellen. Doch Jandl geht noch weiter. Das letzte Wort, das gleichzeitig die letzte Zeile des Gedichts ausmacht, heißt „flottsch“. Von „hirn hanfang war das wort“ kommt Jandl zu „flottsch“, einer Abwandlung von „flutsch“, und mit diesem Schluß furioso wird seine Sicht der Dinge deutlich. Für ihn geht der Geburtsvorgang der Welt mit einer ganz anderen Gewalt vor sich, als ihn die christlichen Religionen wahrhaben wollen. Für ihn ist das Entstehen der Welt ein zutiefst naturhafter und materieller Vorgang, dem kein weiterer Sinn anhaftet.
Für alle diese Gedichte hatte sich Ernst Jandl auch eine Gattungsbezeichnung ausgedacht: Sprechgedichte.
Das Sprechgedicht wird erst durch lautes Lesen wirksam. Länge und Intensität der Laute sind durch die Schreibung fixiert.
In dieser knappen und trockenen Definition hält Jandl fest, was nicht nur für die Gedichte gilt, die 1957 entstanden sind, sondern eine wesentliche Tendenz in seinem gesamten Werk ausmacht. Diese frühen Gedichte müssen, damit sie ihre endgültige Gestalt bekommen, gesprochen werden. Das Gedicht, wie es auf dem Papier fixiert ist, muß als Partitur angesehen werden. Aber die Sprache in ihrer lautlichen Gestalt wird für Jandl auch noch in anderen Versionen wichtig. In späteren Gedichten bedient sich Ernst Jandl bei einer gesprochenen Sprache auf eine ganz eigene Art.
im märz 1976 (…) begann (…) ich eine reihe von gedichten zu schreiben, deren sprache, im gegensatz zu aller herkömmlichen poesie, unter dem niveau der alltagssprache liegt. es ist die sprache von leuten, die deutsch zu reden genötigt sind, ohne es je systematisch erlernt zu haben. manche nennen es ,gastarbeiterdeutsch‘, ich aber, in hinblick auf poesie, nenne es eine ,heruntergekommene sprache‘.
Das Gesprochene in seinen Abweichungen vom genormten Sprachgebrauch wird zum Material, aus dem Gedichte hergestellt werden. Enthalten sind diese Gedichte, die einen Höhepunkt im Schaffen von Ernst Jandl darstellen, vergleichbar denen aus 1957, in den Bänden die bearbeitung der mütze und der gelbe hund, die 1978 und 1980 erschienen. 1991/1992 ist es dann erneut soweit. Ernst Jandl erobert sich wiederum ein Terrain, das von der Literatur eher gemieden wurde. Er besinnt sich auf seine sprachliche Herkunft, das Wienerische, und entdeckt für sich eine Versform, die in diesem Dialekt prächtig gedieh: die „stanzen“. Das besondere an dieser Form besteht darin, daß sie sprachliche Gebilde von äußerster Knappheit hervorzubringen vermag, aber das für Jandl fast noch Reizvollere bestand in ihrer Musikalität. Für gewöhnlich müssen sich stanzen zum Singen eignen. Diese Gedichte bedürfen wiederum eines Vortragenden, sie müssen, damit sie komplett erfaßt werden können, gesprochen, besser noch intoniert werden.
Doch Jandl befreit nicht nur den Laut und das alltäglich Gesprochene aus seinen Bindungen, er bricht auch die graphischen und visuellen Bestandteile aus ihren Verankerungen und beginnt damit sein eigenes Spiel zu treiben. Im Frühjahr 1957 entstehen visuelle Gedichte, Gedichte, die sich durch ihre graphische Anordnung mitteilen, und Gedichte, in denen bei des kombiniert wird, das „visuelle Papiergedicht“. Jandl geht aber auch noch in andere Richtungen weiter, er schreibt Nonsensverse, Gedichte als verdrehte Werbetexte und eine sogenannte „oberflächenübersetzung“. Gattungsgrenzen werden nicht respektiert, inszeniert werden Gedichte in Form von Dramen. Es befreit alle Bestandteile des Gedichts, die sonst in den grammatikalisch und syntaktisch geordneten Fluß der Rede eingebunden sind, um daraus etwas vollkommen anderes zu machen. Nach der „prosa aus der flüstergalerie“, hat Jandl in nur wenigen Monaten die Lyrik aus ihrem Material heraus revolutioniert.
Wie revolutionär seine Gedichte waren, das bekam er auch bereits im Jahr 1957 zu spüren. Auf dem Höhepunkt seiner Produktion mußte er auch seine niederschmetterndste Erfahrung als Autor machen. Im Mai veröffentlichte er in der Zeitschrift Neue Wege außer der „prosa aus der flüstergalerie“ (gekürzt) sieben Gedichte, darunte „schtzgrmm“. Die Wirkung war sensationell: Die Gedichte traten eine Lawine des Entsetzens los, und ihrem Autor schlug blanker Haß entgegen.
Jandls Lehrerkollegen konnten ihre Empörung kaum noch in Worte fassen und sprachen aus, was ein großer Teil des Publikums dachte:
Der junge Mensch nun, der solche sich großsprecherisch als ,Dichtung‘ gebärdende Erzeugnisse neben echter Dichtung zu sich nimmt, wird nach und nach, bei öfteren Wiederholungen zumal, nicht nur Geschmack und Urteilsfähigkeit, die er erworben hat, einbüßen, sondern – was noch schlimmer ist – auch den Glauben an das Schöne, und sich in den Regionen jener billigen, anspruchslosen literarischen Erzeugnisse wieder verlieren aus der herauszuheben unsere, der Lehrer, Pflicht und innere Lebensaufgabe sein muß.
Jandls Texte, gezielte Angriffe auf den guten Geschmack. Ohne darauf abzuzielen, mußten Jandls Texte seine Zeitgenossen in ihrem rückwärtsgewandten Verständnis von Literatur und Kultur aufs äußerste reizen. Aber auch die älteren Schriftsteller waren schockiert. Rudolf Felmayer, der Jandl wohl gesonnen war und 1956 seinen ersten Gedichtband Andere Augen herausgab, wollte bremsen und mäßigend auf Jandl einwirken.
Jandl, was machen Sie denn da, sie zerstören sich all ihre Chancen, und Gertrude Stein, ja Gertrude Stein, wer ist denn Gertrude Stein, für uns, was sol mer… oder Dadaismus und Expressionismus, das ist lang vorbei. Wir müssen doch heut was anderes machen, wir müssen für unsere Zeit, für die Menschen unserer Zeit etwas schreiben und nicht wieder auf so ausgefallene formale Dinge kommen. Und schauen Sie das in der Lyrik, es gibt ja kaum jemanden, der Lyrik will, der Lyrik liest, der Lyrik kauft, damit verschlechtern Sie doch nur die Chancen dieser Literaturgattung. Der hat das ganz ehrlich gemeint.
Im Namen des Fortschritts wurde hier die Tradition verteidigt. Das hätte als Kuriosität abgetan werden können. wenn Autoren wie Felmayer nicht Schlüsselstellungen in den Medien innegehabt hätten. Felmayer gab nicht nur eine Buchreihe heraus, er war auch Literaturredakteur beim Österreichischen Rundfunk und entschied, welche Literatur gesendet wurde und welche nicht. Da Ernst Jandl seinen Rat nicht annehmen konnte, brauchte er sich mit seinen Manuskripten im Funkhaus nicht sehen zu lassen.
Die Lage war also verfahren: Jandl hatte 1957 wenigstens 120 Gedichte geschrieben, aber an Publizieren war nicht zu denken. In Österreich war ein regelrechtes Publikationsverbot über ihn verhängt worden, und daran sollte sich über Jahre nichts ändern.
Wollte er einen Verlag finden, dann mußte er ins deutschsprachige Ausland gehen, nach Deutschland oder in die Schweiz. Zunächst aber brauchte er aber ein Manuskript, das er Lektoren und Verlegern präsentieren konnte. Von 1957 an vergingen fünf Jahre, bis sich Jandl dazu entschloß, aus dem großen Fundus seiner Gedichte eine Auswahl zu treffen. 1962 stellte er den Band Laut und Luise zusammen. Vier weitere Jahre vergingen bis das Buch im Schweizer Walter Verlag endlich erschien. Die Folgen waren für den Verleger des Buchs, Otto F. Walter, wiederum höchst unerfreulich. Es kam im Walter-Verlag zu herben Auseinandersetzungen über Jandls Gedichte, und Walter sah sich mit vielen von ihm verlegten Autoren gezwungen, den Verlag seiner Familie zu verlassen.
Worin lag das Provozierende von Ernst Jandls Gedichten? Jandl bezeichnet das, was er tut, als „aufgeklärte Massenliteratur“. Sie entsteht, egal ob er sich experimenteller oder, wie später geschehen, traditioneller Formen bedient, aus dem gleichen Geist, aus dem in den 50er Jahren Jazz und Rock’n’Roll entstanden. Seine Gedichte sind kurze, auf das äußerste komprimierte Nummern, sie müssen vorgetragen werden, und ihre Lesung verdichtet sich zu Konzerten. Nur sind sie immun gegen die von der elektronischen Unterhaltungsindustrie ausgehenden Korruption. Sie sind für den Massenkonsum geeignet, sind aber vollkommen frei von jeder Anbiederung an den Massengeschmack. Kein Wunder, daß Ernst Jandl unter den Studenten, die 1968 auf die Straße gingen, sein erstes Publikum fand und er nach mehr als 20 Jahren langsam aus seiner erzwungenen Isolation heraustreten konnte.
Klaus Siblewski, manuskripte, Heft 128, Juni 1995
Rede zur Verleihung des Georg-Trakl-Preises
am 10. Dezember 1974
Die jährliche Wiederkehr des Tages, an dem Georg Trakls kurzes, doch überaus produktives Leben endete, ist ein passender Anlaß, einen Preis für Lyrik zu verleihen, der den Namen des Dichters trägt. Für den, der den Preis dankbar empfängt, ist es ein Anlaß, an Trakl zu denken und an das Schicksal von Lyrik. Die in Trakl selbst liegende Gefährdung seiner Existenz und das von ihm erreichte Äußerste an Konzentration auf die Arbeit als Dichter, die innerhalb weniger Jahre ein großes lyrisches Werk entstehen ließ, scheinen einander gegenseitig zu bedingen. Was sonst noch in seinem Leben nebenherlief, etwa die zerfahrenen Versuche, sich durch einen bürgerlichen Beruf abzusichern und auf diese Weise seiner eigentlichen Aufgabe einen materiellen Rückhalt zu schaffen, wirkt demgegenüber als Nebensächlichkeit und mag auch für Trakl selbst, wenngleich oft irritierend, als solche gegolten haben.
Kaum erwachsen, erscheint Trakl bereits als einer, der alle Kraft daran wendet, seine ganze Person und Existenz in Dichtung umzusetzen, ein gewaltiges Unternehmen, das innerhalb weniger Jahre so vollständig verwirklicht wurde, daß der Tod des Siebenundzwanzigjährigen als das beinahe zwangsläufige Ergebnis dieses Prozesses der Verwandlung in ein anderes gedeutet werden könnte. Jeder aus meiner Generation wird einer solchen Spekulation mit Skepsis begegnen, denn es ist eine einfache Rechnung, und am eigenen Leben nachzuprüfen, was es für Trakl bedeutet haben muß, als bereits Siebenundzwanzigjähriger auf der ersten großen Erfolgswoge als Dichter, nicht ahnend, daß sein Werk nahezu abgeschlossen war, in einen plötzlich ausbrechenden Krieg brutal hineingezogen zu werden, während ein 1925 Geborener, wie ich, sozusagen das Glück hatte, sich vier Jahre lang aus der Entfernung, durch Zeitung, Wochenschau, Rundfunk und Augenzeugen auf den Moment vorzubereiten, da er selbst, 1943, in den Krieg hineingezerrt werden würde, und sich weitgehend dagegen zu immunisieren. Bis zu diesem Moment, im Gegensatz zu Trakl, nichts getan und erreicht zu haben, war eine weitere Voraussetzung fürs Überleben. Man schleppte nichts mit, an eigenem, außer dem Ekel an nahezu allem, das man kannte; und hatte zugleich die verrückte Hoffnung auf etwas vollkommen anderes, jenseits der Linie.
Adornos inakzeptable Losung, nach Auschwitz keine Gedichte mehr, hieße, in die Lebensumstände Trakls übersetzt, nach Grodek keine Gedichte. Fast so geschah es, indem Trakl die ihn zutiefst erschütternde Schlacht nur um knapp zwei Monate überlebte. Der andere Trakl, nämlich seine Essenz als Dichtung, hat den Sterblichen gleichen Namens um bisher sechs Jahrzehnte überlebt, ohne zu altern. Sein Werk, seit der Trennung vom Dichter, hat sich ausgebreitet, an Glanz und Wirkung stetig zugenommen, und ragt mächtig aus der Dichtung des Jahrhunderts.
Jene sind nicht zu vergessen, deren auch große Dichtung bedarf, um lebendig zu bleiben: nämlich alle die, die diese Dichtung zu einem Teil ihres eigenen Lebens machen und sich mit der Ausdauer von Liebe mit ihr befassen.
Der bloßen Aktualität wird jede Dichtung alsbald entrückt: die eine, ihrer beraubt, um von da ab unsichtbar zu sein, nicht mehr vorhanden; die andere, von ihr befreit, um nun erst wirklich sichtbar zu werden, erstrahlend, nicht mehr in fremdem, sondern im eigenen Licht, sich zeigend als das, was sie tatsächlich ist. Das ist das glückliche, keineswegs zufällige Geschick der Lyrik von Georg Trakl.
Der Erste Weltkrieg zerstörte die Blüte des deutschen Expressionismus; nicht weniger verheerend wirkte sich der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg auf die deutsche Dichtung aus. Beinahe dreißig Jahre danach befinden wir uns in einer neuen Epoche von Dichtung in deutscher Sprache, einer vielgestaltigen, ausgedehnten literarischen Landschaft. Wir haben weiterhin mit allen Gefährdungen zu rechnen, Erschütterungen und Zusammenbrüchen, zusätzlich zum Wissen um den eigenen Tod. Dem Unausweichlichen, damit es nicht alle Macht habe, das Resultat des eigenen Bemühens entgegenzustellen, Dichtung als etwas, das sich lostrennen konnte von der Begrenztheit der Person, und es zu verbünden mit dem, das auf diese Weise bereits überdauert, wie seit nunmehr sechzig Jahren das Werk Georg Trakls, liegt in der Absicht eines jeden, der etwas in dieser Art tut. So scheint es denn der zentrale Sinn dieses Preises, den Namen eines, dessen Werk den, der so hieß, in seinem Namen überlebt hat, an den Namen und das Werk eines um das gleiche sich heute noch Bemühenden zu binden.
Ernst Jandl, in Literatur und Kritik, Heft 10, 1975
Gejandelt
Wo der Mensch dem Hund nah ist, scheint auch Gott nicht fern zu sein; auffallend häufig jedenfalls verbindet sich in literarischen Texten die Präsenz des Hunds mit Grundfragen des Menschseins, mit der Frage nach dem Verhältnis des Menschen zur Natur, zum Tier, zum Mitmenschen, zu sich selbst, zu Gott. Bei Ernst Jandl, der in seiner Dichtung dem Tier, nicht zuletzt dem Tier im Menschen, immer wieder zu bemerkenswerten Auftritten verhilft, wird der Hund zum Ausgangspunkt und Impulsgeber für eine poetische, zwischen Kynismus und Zynismus schwankende Anthropologie, deren durchaus desolates Menschenbild durch seine hündischen Komponenten eher aufgehellt denn zusätzlich verdüstert wird. Der Mensch? Jandl macht sich auf die Krone der Schöpfung den folgenden Vers:
der mensch hat vieles von dem tier
aber doch nicht alles.
das kann aber vom tier
hinaufgewachsen sein.
schöner ist es aber schon
sich zu denken, dass es von oben kam.
dann muss man sich aber auch denken
dass vieles tief von unten kam
nämlich unterhalb des tieres.
dann hat man gott
aber man braucht auch den teufel.
Felix Philipp Ingold, aus: Felix Philipp Ingold: Gegengabe, Urs Engeler Editior, 2009
E . Jandls Spass am Herzeigen
Im Rahmen der Autorenabende, die vom Studentenzentrum an der Friesstrasse und dem Deutschen Seminar der Universität in unregelmässiger Folge veranstaltet werden, las am vergangenen Mittwoch der österreichische Schriftsteller Ernst Jandl aus seinen Werken. Das Publikum, das überaus zahlreich erschienen war, erlebte eine Lesung, die Sinne und Verstand gleichermassen ansprach, die zugleich ästhetisches Vergnügen und Denkanstösse vermittelte. Sogenannte Dichterlesungen kranken oft daran, dass die Autoren nicht unbedingt die besten Interpreten ihrer Texte sind, oder dass die gewählten Werke sich nicht so gut für eine öffentliche Lesung eignen und wenn nicht den Leser, so doch den Hörer überfordern. Der Abend mit Ernst Jandl muss da als eine lobenswerte Ausnahme bezeichnet werden. Die Aufmerksamkeit des Publikums blieb über die ganze Zeit erhalten, und der Vortragende fühlte sich durch den engen Kontakt zur Hörerschaft auch ermuntert, die Gedichte mit dem Einsatz seiner ganzen Person zu rezitieren.
Ernst Jandl hat sein Programm geschickt zusammengestellt. Gedichte wechselten mit biographischen Notizen und poetologischen Erläuterungen zu seinen Sprachexperimenten. All seine Ansätze und Methoden kamen zum Zug, Alltags- und Lautgedichte, visuelle Lippengedichte, solche, die mit Lautvertauschungen arbeiten („üch loch müch kronk“), Gedichte, die herkömmliche Bedeutungen abbauen oder aus einem scheinbar willkürlichen Lautmaterial überraschend pointierte Bedeutungen konstruieren (Napoleon oder Sebastian Kneipp). Gerade die Lautgedichte erfordern grossen physischen Einsatz und strapazieren die Stimme. Sie arbeiten mit unterschiedlicher Diktion – manche erinnerten an Rock-Rythmen –, Tonhöhe und Tonstärke. Erst beim Vortrag zeigt sich, wie diese Gedichte im Grenzbereich zwischen Poesie und Musik angesiedelt sind. Die Visualisierung in einem Druck verdeckt diese Dimension. Nur in der Rezitation zeigen sich alle Bedeutungsebenen von Jandls Lautgedichten. So sind aus einem Kriegsgedicht alle Vokale vertrieben, die Wörter erscheinen beschädigt, und es bleibt nur noch der „Lärm“ der Konsonanten. Im „Gute Nacht-Gedicht, gehaucht“ wird mit verschiedenen Geräuschen das Einschlafen nachgeahmt, während in den visuellen Lippengedichten auch die Geräusche wegbleiben und das Gedicht nur in „stummen“ Lippenbewegungen erscheint.
Die vorgetragenen Gedichte aus den fünfziger bis siebziger Jahren zeigten Jandls Vielseitigkeit. Für ihn gibt es nicht eine einzige „wahre“ Weise, ein Gedicht zu machen, sondern eine unbestimmte Zahl von Möglichkeiten. So greift er Ansätze der Expressionisten und Dadaisten wieder auf, bezieht sich auf englische Vorbilder, übernimmt Versuche der konkreten Poesie wie auch konventionelle Lyrik, um alle Möglichkeiten in seiner „jandlschen“ Art weiterzuverfolgen. Man kann jedoch seine Gedichte nicht als virtuose formalistische Spielereien abtun. Die Form ist bei ihm nie Selbstzweck, sondern untrennbar mit der von ihr transportierten Bedeutung verbunden. Darin unterscheidet er sich auch von andern Versuchen konkreter Poesie.
„etwas zu machen , das man herzeigen kann, hat mir immer schon spass gemacht“, meint Ernst Jandl über sich selbst. Der Spass war ihm sichtlich anzumerken, und er übertrug sich auch auf das Publikum. Jandl ist ohne Zweifel, das wurde an diesem Abend deutlich, der beste Anwalt seiner „Sachen“.
hvg., freiburger nachrichten, 7.12.1974
Sprache um ihr Selbstverständnis gebracht
Ernst Jandl gab einen umfassenden Überblick über sein gesamtes Schaffen, und indem er Buch auf Buch aufschlug, um in chronologischer Reihenfolge vorzulesen, wurde einem seine reiche Produktionskraft, die sich trotz zäher Widerstände immer wieder durchsetzt, bewusst.
Die schon zum klassischen Repertoire der Experimentaldichtung gehörenden Sprachspiele aus Laut und Luise erweckten auch diesmal in der authentischen Vortragsweise belustigte Anteilnahme. Jandls phonetische Purzelbäume und seine Vokalakrobatik auf dem hohen Seil der Sprachkunst schienen ihm selbst Spass zu machen, denn mit sichtlichem Vergnügen steigerte er sich in seine Sprechrolle hinein. Jandl lesen ist das eine, Jandl lesen zu hören ist das andere, weit ergiebigere Vergnügen. Aus Sprechblasen und Dingfest wurden die besten Gedichte gewählt und die Sprache nach wie vor um ihr eingefleischtes Selbstverständnis gebracht. Grammatikalische Amputationen oder Umstellungen schaffen literarische Experimente, die in einem gekonnten Durchspielen zu allerlei Assoziationen anregen. Der Zuhörer muss kombinieren und darf somit auch seinen stummen Beitrag leisten. In der konkreten Poesie hat die auch sich neu anverwandelte Kindersprache ihren Platz.
Neue Zürcher Nachrichten, 15.1.1982
Wie man den Jandl trifft. Eine Begegnung mit Ernst Jandl, eine Erinnerung von Wolf Wondratschek.
Ernst Jandl im Gespräch mit Lisa Fritsch: Ein Weniges ein wenig anders machen.
Eine üble Vorstellung. Ernst Jandl über das harte Los des Lyrikers.
Fakten und Vermutungen zum Autor + ÖM + KLG + IMDb + PIA +
Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + weiteres 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Ernst Jandl: Der Spiegel ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Die Welt ✝ Die Zeit ✝ der Freitag ✝ Der Standart ✝ Schreibheft ✝
graswurzelrevolution
Weitere Nachrufe:
André Bucher: „ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt“
Neue Zürcher Zeitung, 13.6.2000
Martin Halter: Der Lyriker als Popstar
Badische Zeitung, 13.6.2000
Norbert Hummelt: Ein aufregend neuer Ton
Kölner Stadt-Anzeiger, 13.6.2000
Karl Riha: „ich werde hinter keinem her sein“
Frankfurter Rundschau, 13.6.2000
Thomas Steinfeld: Aus dem Vers in den Abgrund gepoltert
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2000
Christian Seiler: Avantgarde, direkt in den Volksmund gelegt
Die Weltwoche, 15.6.2000
Klaus Nüchtern: Im Anfang war der Mund
Falter, Wien, 16.6.2000
Bettina Steiner: Him hanfang war das Wort
Die Presse, Wien, 24.6.2000
Jan Kuhlbrodt: Von der Anwesenheit
signaturen-magazin.de
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Karl Riha: „als ich anderschdehn mange lanquidsch“
neue deutsche literatur, Heft 502, Juli/August 1995
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Zum 20. Todestag des Autors:
Gedanken für den Tag: Cornelius Hell über Ernst Jandl
ORF, 3.6.2020
Markus Fischer: „werch ein illtum!“
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 28.6.2020
Peter Wawerzinek parodiert Ernst Jandl.
Ernst Jandl − Das Öffnen und Schließen des Mundes – Frankfurter Poetikvorlesungen 1984/1985.
Ernst Jandl … entschuldigen sie wenn ich jandle.


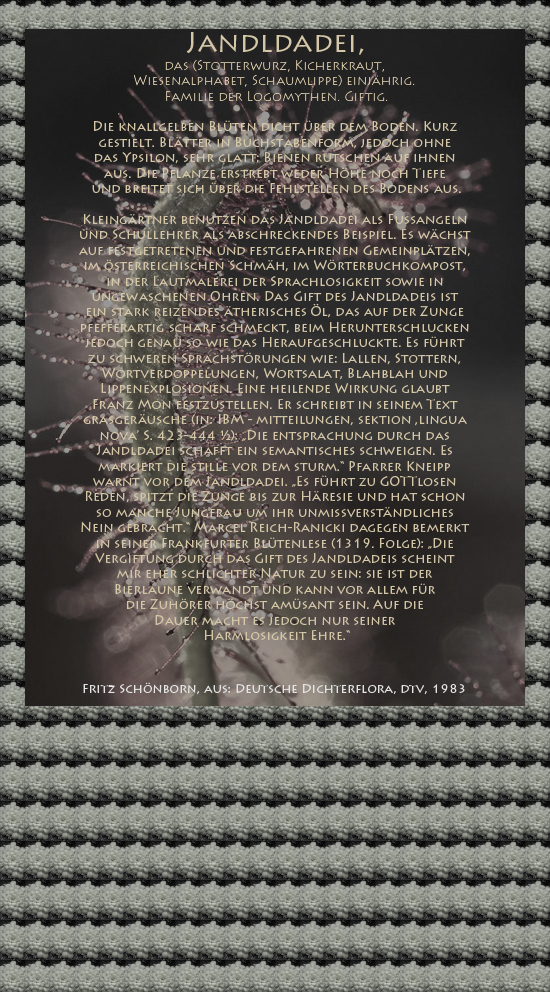












Schreibe einen Kommentar