Michael Lentz: zur kenntnisnahme
CALL IT
unsere köpfe sind glocken aus ton
feine risse darin das wetter nagt
nachts in den halden liegen sie wach
und schlagen alarm
sie binden schilder um aus kälte und wärmendem
aaaaaatem
stolpernd beginnen sie zu laufen sprachlos
wenn ihr pendel das dunkel zerbricht
komm näher und lösch den tag
du wirst die letzte sein
Ein viel zu kleines Besteck für diese Brocken
Nicht gelebt, aber (schon) geschrieben. Bis vor lauter Schreiben für das Leben auch gar keine Zeit mehr war. Ich habe zu der Zeit jeden Tag mindestens zwei Gedichte und jede Menge den Therapeuten ersetzende Prosa geschrieben. Auch an einem Roman habe ich mir eingebildet arbeiten zu müssen. Kaum war er aufgegeben, hielt ich ihn auch schon für völlig unbrauchbar. Allein im Trost war ich bereits Profi: War klar, daß das schiefgeht, der wäre sowieso nichts geworden. Das kladdenfüllende Zeug ist dann aber in die Hände einer Freundin gelangt, was neben Gesprächsbedarf auch tiefgreifende Peinlichkeit auslöste. Auf ein Gedicht in „zur kenntnisnahme“ war ich allerdings sehr stolz. Sein Titel ist eine Katastrophe: „unser sinn für gerechtigkeit“. 1985 habe ich das ganz unironisch gesehen. Jetzt lese ich da einen grinsenden Unterton hinein, der vielleicht durchgehen könnte. Das Gedicht habe ich 2003 als einziges der ganz frühen Gedichte in meinen Band aller ding (S. Fischer Verlag) aufgenommen – jetzt heißt es „bruchstück“. Vielleicht ist der alte Titel doch besser? Fünf Objekte bzw. Worte werden miteinander in Beziehung gesetzt:
im regen eine zurückgebliebene leiche
eine hinzugelaufene katze
ein offenes fenster noch
und wir
die alles zu ordnen
wissen
Eine Konstellation, erfunden 1981. Alles Überflüssige ausgespart, nur das notwendige Gerüst steht da. Da sollte es ,eigentlich‘ hingehen.
Ansonsten: Keine Worte gehabt, nämlich zu viele. Hochfahrendes Zeug, und alles mit an Bord: Seele, Welt, Beinhaus, Herz und Totenhemd, Sonne, Mond und Sterne. Die Verse ein viel zu kleines Besteck für diese Brocken. Zu viel gelesen. Nichtverstandenes einfach übernommen. Georg Trakl zum Beispiel. Oder Paul Celan. Ich stellte fest, daß Celan zu schreiben gar nicht so schwer ist. Man setzt sich einfach hin und schreibt sofort drei Celans, da wird gar nicht lange gefackelt. Dann liest man den selbstgeschriebenen Celan durch und versteht ihn nicht. Das habe ich dann für große, für bedeutende Poesie gehalten. Die Bestätigung für diese Annahme kam, wenn Freunde ebenfalls kein Wort verstanden haben. Jener schöne Moment, da man sagen konnte, siehst du, so ist das mit wirklich großer Lyrik.
Auf die zwanzig Gedichte und drei Prosastücke bildete ich mir 1985 einiges ein, so daß ich es nicht mehr für wert erachtete, mit überhaupt irgendwem noch zu sprechen. Ist doch alles gesagt, oder? Daß sie auf gelbem Büttenpapier gedruckt wurden, gestiftet von der Papierfirma Rencker aus Zerkall in der Eifel, und auf dem schwarzen Kartonumschlag in weißer oder gelber Schrift zu lesen stand „michael lentz“ und „zur kenntnisnahme“, das veredelte die ganze Sache.
Eine Geschichte handelt von meinem Lieblingsjoghurt, der nicht mehr von mir gegessen werden will. Lieber kommt er um, er verfällt, verwandelt sich in gefährlichen, staatszersetzenden Schimmel. Der Schimmel besetzt meine Wohnung, der Kanzler muß zurücktreten, der Schimmel übernimmt die Regierungsgeschäfte. Eine andere Geschichte hatte sogar etwas mit realen Umständen zu tun, meinem Zivildienst in einer Aachener Rheumaklinik: „ansprache eines pflegers an die zunft“. Zum Teil diaflacher, kläffender Thomas Bernhard. Die Gedichte eher verspäteter Postexpressionismus mit universalem Komponentenverkleber.
„Eine permanente erinnerungswelt“ steht auf der letzten Seite des Bändchens. Das ist es auch, eine Erinnerungswelt. Da bin ich bis heute dicht drangeblieben, am Erinnern. Jetzt habe ich „zur kenntnisnahme“ noch einmal komplett durchgelesen. Eine todtriefende Sache. Aber ich steckte schon drin. So alt muß ich erst mal werden, wie ich da geschrieben habe. Insgesamt ein sympathisch verworrener Mist.
Michael Lentz, aus: Renatus Deckert (Hrsg.): Das erste Buch, Suhrkamp Verlag, 2007
Warum steht jetzt da, was da steht?
– Eine nachgefragte Inventur. –
Für „Hinterkopf“ gibt es eine untergegangene Bezeichnung, die gar nicht mal subtil dazu verleiten könnte, das Nachdenken einzustellen: „Poetenkasten“. Beides, „Poet“ und „Kasten“, sind je nach Kontext nicht gerade die positivsten Benennungen komplexer Zusammenhänge. „Poetenkasten“ könnte als Metapher durchgehen für „Es ist vergeblich“, „Es hat keinen Sinn“, „Es ist fruchtlos“. Nichts auf dem Kasten haben ist ein Bruder von „dumm wie Brot“. „Sein Brot im Kasten haben“ gibt es nicht. „Er hat was auf dem Poetenkasten“ gibt es leider auch nicht. Den Poetenkasten leeren: Ein Buch schreiben. „Er hat richtig was auf dem Poetenkasten“ gälte es einzuführen für „er kann toll dichten“.
Kann ich das? Drei Schläge auf den Poetenkasten – fördern das Dichtvermögen?
Tägliche Besinnung: Jetzt habe ich schon wieder nicht das Buch geschrieben. Es ist mir entglitten. Von Anfang an schon. Ich habe halt weitergemacht. Das Buch zu Ende gestrickt. Beim nächsten Buch wird alles anders. Ich schwör’s. Da werde ich leben, um endlich nur zu schreiben. Man hat es, oder man hat es nicht. Und ich hab’s ja. Keinerlei Ablenkungen mehr. Das Minus auf dem Konto als irrationale Größe begreifen lernen. Vierundzwanzig Stunden sind ganz klar zu kurz. Erst einmal also die Segmentierung der Zeit in Stunden und Tage ignorieren. Diesen Zeitzwang innerlich außer Kraft setzen. In größeren Bögen denken. Überhaupt nicht mehr „rund um die Uhr“. Da wird man nur selber rund. Die entstundete Zeit ist sicher nicht näher bei Gott. Jenseits jeder Lebenserwartung ist sie sterbensnäher. Man denkt, man habe Zeit. Man hat überhaupt keine Zeit. Da liegt das Buch also, diese Unausstehlichkeit, das einen im Kreis laufen, an den Kopf fassen, an den eigenen Poetenkasten klopfen macht. Zeit für einige Nachfragen in eigener Sache.
Warum mußte das so kommen? Habe ich nicht lange genug nachgedacht? Kann man lange genug nachdenken? Waren die Vorbereitungen falsch? Ist ein Übermaß an Vorbereitung nicht ein Krampf, eine Totgeburt, das Ende jeder Spontaneität? Also ganz allein aus sich heraus etwas zu Tage fördern? Kein Input, kein Output? Der Wunschtraum einer naivischen Literatur, die so ganz unbefleckt erscheint? Welche Kompetenzmaße ich mir an, ein Buch schreiben zu können? Wo habe ich das denn gelernt? Bei sich selbst in die Schule gehen? Wie machen das denn andere? Wie schaffen die das denn? Nachschlagen. Lebenserinnerungen. Das schön geschriebene Leben.
Über ihren Mann berichtet Frau Thomas Mann:
Wenn er ein Buch schrieb, so vertiefte er sich ungeheuerlich in seinen jeweiligen Gegenstand und studierte viel und stets noch, während er daran saß.
Was hatte das ihrer Meinung nach zur Folge? Zur Zeit des Doktor Faustus war Thomas Mann „neben anderem“ „ein großer Musiktheoretiker, zur Zeit des Joseph ein großer Ägyptologe, Orientalist und Religionswissenschaftler, ein Mediziner für den Zauberberg.“ War das Buch dann endlich fertig, so die Gattin, „hatte er alles bald wieder vergessen. Er interessierte sich nicht mehr dafür.“ Der Schriftsteller als medialer Durchlauferhitzer und Schnellvergesser. Das Buch als Modellfall von ausgelagertem Gedächtnis. So man dem Bericht glauben mag und dahinter nicht eine verklärende (oder gar ironische?) Anekdote wittert. Aber würde das einer heutzutage von sich behaupten wollen, er sei während der Arbeit an einem Buch „ein großer Musiktheoretiker“ gewesen etc.? Einige, sicherlich.
Ist Literatur ein Vortäuschungsmanöver? Ja und? Die Lüge der Fiktion? Manchmal ist es einfach nur banal: Der Autor hat schlecht recherchiert. Oder falsch abgeschrieben. Oder falsch Vorabgeschriebenes übernommen. Und hat sich damit übernommen – eine fiktionale Verdrehung läßt immerhin nach ihrer poetologischen Funktion fragen. Eine saubere Recherche ist also Grundvoraussetzung einer faktisch orientierten bzw. auf irgendeine Weise mit Faktischem arbeitenden Literatur, will diese nicht bereits im Vorfeld am Faktischen scheitern, was sie dann spätestens im Nachfeld kritisch serviert bekommt. Wird Überprüfbares, Verrechenbares durch Literatur auf den Kopf gestellt, kommt es, wie gesagt, auf die Funktion dieser Differenz an. Mit dem alten Literaturstreit über das Mögliche, Wahrscheinliche und Wunderbare hat dies nur sehr bedingt zu tun. Wenn der Autor schon mit Pfunden wuchert, sollte er dies im abgesicherten Modus tun. Gibt es das, im abgesicherten Modus schreiben? Heißt das nicht, (zu) wenig wagen? Etwas wagen macht noch keine gute Literatur. Die Frage ist ja, was genau wagt der Autor? Auch eine Revolutionierung der Schreibungsart muß sich mit diesen Sachverhalten auseinandersetzen bzw. sich an diesen messen lassen.
Kommt Literatur also vom Lesen? Literatur entsteht aus Literatur, auch. Ein alter Hut. Ein tradierter Zirkelschluß. Zuviel lesen läßt den Poetenkasten überlaufen? Ist Lesen zur Schule gehen? Wie kann ich nur denken, einen einzigen verläßlichen Satz zustande zu bringen? Sind unbeantwortete Fragen erste Anzeichen einer umfassenderen Krise? Wer sollte diese Fragen denn beantworten? Haben Fragen nichts mit Literatur zu tun? Die Übervorsichtigkeit, überhaupt nur einen einzigen Schritt zu tun. Der niemals begonnene Beginn. Typisch deutsch? Leide ich unter Vollkommenheitswahn? Hätte ich besser aufpassen müssen? Habe ich das Falsche erlebt? Ist Schreiben immer noch zur Schule gehen? Warum steht jetzt da, was da steht? Und falls jemand nachfragen sollte, nichts hat das mit mir zu tun, gar nichts. Wäre ja noch schöner, ein Kurzschluß Leben und Literatur, dann hätte ich mir letztere ja sparen können. Oder umgekehrt.
Delirien. Nutzt Nachdenken was? Hat Literatur mit Nachdenken zu tun? Oder sind Schreiben und Nachdenken gleichursprünglich? Heißt „Gut gemacht“ nicht „Vergiß es“? Sollte ich mehr Zeitung lesen? Sind meine Vorratskammern leer? Was sagen die Kritiker? Sterbe ich bald? Denkmalgeschütztem Schriftsteller fällt nichts mehr ein. Kollege X hat sich endlich, nach jahrzehntelanger und reiflicher Überlegung, erschossen. Ich gratulierte ihm herzlich. Tatsache ist, ihm fiel nichts mehr ein. Wie man landläufig so sagt. Bei suizidauslösenden Rückfragen wie „Habe ich überhaupt das Zeug zum Schriftsteller?“ nutzen vielleicht Konter wie „Habe ich denn das Zeug zum Bademeister?“ Na also. Lebensweltliche Probleme sind ja ein anderes Thema. Lebensweltlicher Kollege, zwanzig Jahre alt. Hatte sich in seine zentrumsnahe Wohnung verschanzt. Wollte das Megaopus schreiben. Inklusive Selbstauslegung und Abschaffung der Romanform. Es blieb bei der Selbstabschaffung. Ja, so ein Buch wie Henry Millers Vom großen Aufstand, das ist noch schlüsselhaft, wie da der Rimbaud das Wort „Langeweile“ erfindet, auswandert – und mit nur einem Bein heimkehrt. Bis auch der Rest abhanden kommt. Und wir? Schreiben weiter, was das Zeug hält? Es wird geschrieben, weil schon immer geschrieben wurde?
Die Kopisten der isländischen Sagas zum Beispiel schrieben sich die Finger krumm und ruinierten sich mit dieser so mühsamen wie quälend langsamen Fixierung von Schriftzeichen den ganzen Körper. Auf manchen Seiten der auch bildlich mit großer Kunstfertigkeit gestalteten Bücher hat man Randnotizen der Kopisten gefunden wie „Es langweilt mich“ und „Das Schreiben zerstört mich“. Jahrelang in einer Gifte ausdünstenden Kunststoffabrik arbeiten zerstört auch. Und heute? Die Handschrift ist ja schließlich kein rein museales Medium. Sind wir nicht auch nur Kopisten? Und besteht der Unterschied zu den Schreibern früherer Zeiten vielleicht nur in der Vielzahl der Quellen, aus denen wir kopieren? Und die geringste sind vielleicht wir selbst? Also mal nicht zu anmaßend behaupten „ICH habe das geschrieben“. Es war niemand. Beruhigt?
Mal langsam. Ordne die Gedanken und fahre dann fort wie folgt: Es dauert Jahre, bis man ganz bei sich zu Hause ist. Immer auch gibt es das Gefühl, nie dort anzugelangen. Genau dieses Gefühl treibt an. Auf der Suche nach einem geeigneten Stoff ist man schon in der falschen Richtung unterwegs. Das wird nichts. Der Stoff stößt einem zu. Sosehr man auch versucht, vielfältig zu sein, unvereinbar, bunt, man verläßt den Käfig, in den man zu früh und von einem selbst unbemerkt hineingekrochen ist, nie. Cages Wortspiel erscheint da nur als utopischer Imperativ:
In welchem Käfig du dich auch befindest, verlasse ihn.
Sich selbst verlassen? Mit der Zeit und durch alle Krisen hindurch gerät man höchstens in eine gewisse Stabilitätslage, man rostet im Käfig ein, man wird selbst Käfig (aber nicht Cage). Der Käfig ist dieses Sprachkorsett, das man sich anlegt, das man enger schnürt, das man hassen lernt, ohne das man nackt zu sein glaubt, das man irgendwann nicht mehr spürt, das mitläuft. Man hat es nicht anders haben wollen. Hat man die Wahl? Zuviel Sartre gelesen? Der Trost ist ja, daß dies beileibe keine Erfahrung ist, die vor lauter Individualität von niemandem geteilt würde. Ist das ein Trost? Das Schlimme ist, daß man sich eines Tages in dem, was man tut, wenn man ein Buch schreibt, nicht mehr leiden mag, daß man sich auf die Nerven geht, gerne ein anderer sein würde, nur wer? Man wird sich damit abfinden, daß der eine oder andere Text, dieses oder jenes Gedicht gelungen zu sein scheint. Das Wichtigste aber ist, mit Hingabe zu schreiben, mit Enthusiasmus und dem Mut zum Absturz. Das sind mitunter die glücklichsten, die befreiten Stunden. Abtauchen, sich vergessen machen. In die Ferne!
gedichte
von der wollust
des dichtens
in worte
gefaßt (H.C. Artmann).
Eben. Kann man sich aber mal tatsächlich nicht leiden, nehme man ein Buch zur Hand und lese. Die Damen und Herren Kollegen kochen auch nur mit Wasser. Notorische Ausnahmen werden geflissentlich übersehen.
Welchen Nutzen soll das haben, Lesen? Liest man nicht am liebsten sich selbst? Überhaupt nicht. Mir graut vor mir. Dabei habe ich die Hoffnung aufgegeben, daß es mit den Jahren besser werden könnte. Das behindert mich aber nicht. Sicher, ich schäme mich für das eine oder andere, insbesondere, wenn es gedruckt vor mir liegt. Veröffentlicht heißt ja auch: zu spät. Die einzige Chance ist, daraus zu lernen. Auf diese Weise unterrichtet man sich auch selbst. Wenn’s schon kein anderer tut.
„Durchaus wohlmeinende Leute sagen: ,Literatur läßt sich nicht unterrichten‘, und was sie damit meinen, ist wahrscheinlich richtig.
Ganz sicher kann man einem Menschen beibringen, zwischen zwei Sorten von Büchern zu unterscheiden.
Bestimmte sprachliche Leistungen können als Maßstab angelegt werden, als Reißschiene, als Spannungsmesser, oder sie können ,zum Vergleich‘ dienen, und die Vertrautheit mit ihnen kann einen Menschen zweifellos befähigen, über den Stil schlechthin und über die Kraftströme in einem Buch, über seine Stärken oder Schwächen zu urteilen“, schreibt Ezra Pound in ABC des Lesens.1
Hievon später mehr.2
Lesen heißt, sich ernähren. Sich anspornen. Sensibel bleiben. Den Faden fortzuspinnen.
Zuflucht nehmen zu den Büchern anderer Autoren und Autorinnen. Im rettenden Sinne sind diese oft „Trostbüchlein“. Zum Beispiel Uwe Dicks Gedichtbände Theriak und Das niemals vertagte Leben.
Schreiben und Lesen
sind eine Tateinheit. Lesen ist vielleicht nichts weiter als eine (selbstreflexive) Manifestation der Gehirntätigkeit. „Hä?“ Ich lese, also bin ich noch da. Und zwar lese ich, was schon in mir ist.
Und so kann ich mich nach einem tausendseitigen Roman oft nur an das erinnern, an das ich mich auch außerhalb dieses Romans erinnern würde. Um mich an den Roman zu erinnern, hätte ich ihn also gar nicht lesen müssen. „Lesen ist ein bloßes Surrogat des eigenen Denkens“, so Schopenhauer, der Erfinder des „Selbstdenkers“. Wer liest, schreibt mit. Und denkt mit. Sollte man jedenfalls meinen.
Die beiden Kulturtechniken Lesen und Schreiben mit ihren medialen Rückkopplungseffekten verweisen den Lesenden und den Schreibenden als Betrachter immer wieder auch auf sich selbst. Der Schreibende (und der Lesende) nimmt sich selbst als Schnittstelle und Kontrollorgan der kognitiven Korrelation zwischen „Idealbewußtsein“ und je individuellem Betrachter wahr, die gegenseitig verrechnet werden. Das Idealbewußtsein als ein gedachtes ist stets fehlerfrei, verfügt über einen/den umfassenden Wortschatz, ist deckungsgleich mit dem kulturellen Gedächtnis, dessen Repräsentant der (individuelle) Schriftsteller ist (ist er das?), führt verlustfrei den intentionalen Prozeß des Schreibens durch – erinnert also an eine wartungsfreie eiskalte Maschine. Und gerade in der wahrgenommenen Differenz zu diesem Ideal erfährt die „konkrete, in der abendländischen Kultur meist gewohnheitsmäßig und wie unbewußt vollzogene Handbewegung, die Schriftzeichen und Schriftstücke hervorbringt“,3 oft genug eine Irritation und Störung. Das Kontrollorgan, das immer noch „Ich“ ist (oder?), schlägt Alarm: Hier stimmt was nicht. Der geschriebene Text ist ein einziges Defizit, entspricht nicht im mindesten den Idealvorstellungen – und ist vielleicht gerade deswegen gut; als Differenz, die sich dem Gedächtnis (des Lesers) einprägt?
Jedes Mal dieselben Kämpfe: Kunst schreiben, sich selbst nicht verraten oder eher doch mal konventionell. Als ob man tatsächlich imstande wäre, eine solche Entscheidung zu treffen. Wäre es nicht besser, einfache Geschichten zu erzählen, klare Gedichte zu schreiben, alltägliche Bühnenstücke zu verfassen, ungestörte Hörspiele… Besser als was? Als darüber zu schreiben? Als über das Schreiben zu schreiben? Ist die Geschichte der deutschsprachigen Poetik, kürzestgefaßt, eine Bewegung von der Norm zur Neurose?
Andererseits: Mich interessiert eine größtmögliche Kontrolle während des Schreibens. Als Leser meiner selbst – das Lesen setzt unmittelbar mit dem Schreiben ein und begleitet es – möchte ich mich nicht aus den Augen verlieren. Ich versuche immer konziser zu werden, eine Sprache zu finden, die ,realistisch‘ zu nennen ist, indem sie nah am Generalthema bleibt, dem Tod. Das spornt an zu Genauigkeit. Womit ich einen Teil meiner Arbeit selbst verleugne.
Was ist das Gegenteil von Schludrigkeit? Korrigier- und Verbesserungswahn: Einen Text nicht loslassen, ihn immer wieder durchlesen, bis selbst das Verständlichste völlig unverständlich, der ganze Text unbrauchbar geworden ist. Es muß jetzt Schluß sein mit dem Nachprüfen, und tatsächlich kommt man an kein Ende. Kommt man an kein Ende, fängt das Schreiben an, angstbesetzt zu sein. Sorge also dafür, dich nicht in eine Hysterie des Perfekten zu treiben. Das Übervorsichtige ist Selbstmord auf Raten.
Es gleicht zunächst einer Verstopfung: Es stellt sich das Gefühl ein, ein Text sei fertig. Ein Grund zum Feiern. Spannungsabfall. Wieder und wieder liest man ihn durch. Einige Fehler können entdeckt und ausgebessert werden. Es gibt da auch gar nichts zu diskutieren, das sind schlichtweg durch nichts motivierte Fehler der Wortverwendung, der Semantik, simple Verschreiber, Fehler der Grammatik, widersprüchliche Angaben etc. Die korrigierte Schlußfassung wird noch einmal durchgelesen. Sie wird vielleicht von einem anderen gegengelesen. Dieser findet eine Reihe von eines Schriftstellers nicht würdigen Kapitalverbrechen, die unerklärlicherweise von einem selbst nicht als solche erkannt worden sind. Schludrigkeiten? Unvermögen? Regional bedingte Eintrübung der Sprachkompetenz (Herkunft, Heimat,…)? Zweifel kommen auf, ob man noch laut Auskunft geben solle, welchen Beruf man ausübt. Bei Diskussionen kommt das ja noch gut, ein vermeintlicher Versprecher, ein Dativ, der eigentlich ein Genitiv ist, ein erstauntes Aufhorchen, wenn einem klargemacht wird, daß dieses und jenes Wort ganz und gar nicht so verwendet werden kann wie soeben vorgelesen, alles natürlich mit Augenzwinkern zur Kenntnis genommen, das zeigen soll, war mir eh klar, hab ich doch extra gemacht, ein Trick, sozusagen, dabei innerlich schon zernagt und kränkend wie ein in nächster Sekunde sinkendes Schiff.
Tatsächlich ist mein Wortschatz dermaßen beschränkt, daß ich zum Beispiel neulich mit größtem Entzücken zum ersten Mal in meinem Leben die Bezeichnung „Rabatten“ hörte und heute schon wieder an eine falsche Pluralbildung glaube. Es will sich mir einfach nicht einprägen, dieses botanische Gruppenbildwort. Ab dem soundsovielten Lebensjahr war wohl Schluß mit der sukzessiven Erweiterung des Wortschatzes, der Neuaufnahme nie gehörter Wörter, von da an mußte ich mit dem Vorhandenen auskommen. Und dann erst Fremdsprachen… Die „Muttersprache“ ist schon Fremdsprache genug. Da muß man nur ehrlich sein und dazu stehen, daß es in der sogenannten Muttersprache einfacher ist, auf die Frage, „Haben Sie das verstanden?“ mit „Ja“ zu antworten, auch wenn „Nein“ zu sagen die entsprechende Antwort gewesen wäre. Den berühmten Gesamtzusammenhang hat man ja irgendwie verstanden und könnte ihn mit eigenen Worten ebenso irgendwie wiedergeben, ohne sich die Blöße völligen Unverständnisses geben zu müssen. Diese Salbaderei wird schließlich schon in der Grundschule geübt und spätestens auf dem Gymnasium sehr hoch geschätzt. Zu Hause kann man dann ja immer noch in einem Wörterbuch nachschauen, wenn man dieses Wort bloß erinnern würde, das unbekannte, noch nie gehörte, das alle Aufmerksamkeit auf sich zog, so daß man, Hand aufs Herz, ab da überhaupt nicht mehr zugehört hat. Wie hieß dieses Wörtchen noch mal, daß man es auch nachschlagen kann? Gehört, vergessen. Man kann es auch handhaben wie Karl Valentin: Sehen sich zwei ehemalige Nachbarn nach, wie sich alsbald herausstellt, gar nicht mal so langer Zeit wieder. Keinem von beiden fällt der Name des anderen ein. Von sich aus nennt keiner den eigenen Namen; was auch keiner vom anderen erwartet. So setzt ein munteres Rätselraten ein, das immerhin eine gute Stimmung aufkommen läßt. Man erinnert sich. An was bloß? Die beiden Nachbarn sind wenigstens froh, ein nettes Gespräch miteinander zu haben. Hätten sie einander namentlich wiedererkannt, sie hätten den Namen des anderen wohl kurze Zeit später wieder vergessen. Gerade gestörte Kommunikation ist der Motor, weiterzumachen, aus ihr wird Sprachkapital geschlagen. Und das System Sprache – funktioniert. Vereinfacht gesagt. Der Fehler im System, der vielleicht Literatur ist.
Immerhin habe ich Zeit, etwas aufzuschreiben. Die Zeit davor, die Zeit danach habe ich verbummelt? Und genau die Zeit mittendrin habe ich konzentriert. Ist das ein Schriftsteller, jemand, der die Zeit ausnutzt, indem er innehält? Permanent in sich kreisende Erinnerungsarbeit. In der Hoffnung, daß eine Wiederholung, von der Sören Kierkegaard schreibt, tatsächlich nicht möglich ist. Schreiben ist dem Betonmischen nicht unähnlich. Es muß immer fließend gehalten werden, aber eben nicht zu flüssig; je nach Verwendungsbedarf und bei entsprechendem Aggregatzustand entnimmt man den Beton, um ihn an Ort und Stelle zu verarbeiten.
Der Unterschied ist, der eine schreibt es auf. Das heißt ja nicht, daß er nicht lebt. Es heißt auch nicht, daß der andere lebt – wenn er nicht schreibt. Eines Tages läuft jedenfalls die Zeit davon, da sollte man schon genauer wissen, was man wie schreibt. Kein Grund zur Panik? Die Wahrheit ist, man verschwendet nicht allzuviel Zeit mit poetologischen Fragen. Man schreibt halt. Der Text ist eine Baustelle. Und eines Tages stellt man vielleicht fest, daß die unterirdischen Leitungen nicht funktionieren. Die Baustelle wird zur Kanalarbeit. Bei dieser Gelegenheit stellst du möglicherweise fest, daß dein Text fundamental unbrauchbar ist. Zuviel Zeit schon verloren?
Höchste Zeit, von diesem Tiefgang poetologisch zu profitieren. Schreiben mit Strukturplan oder ohne? Wenn mit, ist das Korsett zu eng geschnürt? Sklavische Ausführung eines Reißbrettentwurfs, der Literatur sein soll? Habe den Mut, dich deiner Intuition zu bedienen und den Plan über den Haufen zu werfen. Intuition? Der ,Stoff‘ entfaltet sich nach einer nie ganz zu kontrollierenden Eigengesetzlichkeit. Es ist eine große Lust, diese Entfaltung zu beobachten und dabei festzustellen, daß eben – zum Glück – nicht alles nach Plan geht. Hiermit soll keineswegs einem autopoietischen Diskurs das Wort geredet werden. Es handelt sich hier schlichtweg um eine pragmatische Schreiberfahrung, daß die Sprache selbst, hat man erst einmal Fährte aufgenommen, zu denken scheint, daß Sprache selbst sich schreibt. Ein Wort scheint auf, und schon öffnen sich Assoziationsfelder, im Wort eingefaltete Geschichten bieten sich an, erzählt zu werden, das bloße assoziative Nebeneinanderstehen von Wörtern, verbunden zum Beispiel in der Zeile eines Gedichts, die mit anderen Zeilen eine Strophe bilden, suggeriert in der Rezeption Kausalitätsassoziationen; eine poetische Etymologie von Wörtern entsteht, deren lexikalisches oder alltagssprachliches Begriffsfeld erweitert bzw. umkodiert wird.
Ein Strategienbündel des Schreibens von Prosatexten und Gedichten: Reformulierungen eigener Arbeitserfahrungen.
Du bist der Beste, ganz klar. Behalte es für dich. Vergiß es am besten. Das sind die anderen auch.
Sieh das, was du machst, als Literatur an, die als solche ein Eigenleben führt, das schafft eine notwendige und erholsame Distanz:
Du gehst zur Arbeit, diese Arbeit besteht aus verschiedenen Problemstellungen, die eine Lösung erfordern. An dieser Lösung arbeitest du. Es ist ein Irrtum, zu glauben, es gäbe hierfür einen geeigneten Zeitpunkt. Diese Zeit ist immer (siehe oben).
Setze Angefangenes und seit Jahren Liegengebliebenes nicht mehr fort, es sei denn, du schreibst es ganz neu. Sonst kann es leicht zum Hemmschuh werden, zur völligen Blockade jeder Schreibbewegung. Glaube nicht, es gäbe da etwas zu retten. Sich von etwas trennen, ist die beste Schreiberfahrung.
Glaube nicht, auf allen Hochzeiten spielen zu können, und schon gar nicht auf allen gleichzeitig. Lasse also einen in den Kinderschuhen steckenden Roman nicht verhungern, nur weil du dir einbildest, unbedingt noch und auf die Schnelle ein weltbestes Drehbuch schreiben zu müssen, parallel zu einem seit Monaten zu schreibenden zyklischen Gedichtband, von dem erst ein schmales Gedichtchen da ist. Parallelarbeit ist praktikabel; du solltest aber in einem größeren Zeitraum denken und an einer Sache kontinuierlich arbeiten. Ganz einfach. Feste Arbeitszeiten sind von großem Vorteil. Sie treiben das Manuskript voran und geben einen Überblick, was noch zu tun ist. Und das ist immer eine Menge.
Triff Entscheidungen: Ich will jetzt einen Roman schreiben, ich will jetzt einen Gedichtband schreiben, etc. Fang an. Aber immer schön locker bleiben. Das braucht seine Zeit. Pessoa bastelte mehr als zwanzig Jahre an Das Buch der Unruhe. Vertraue auf deine Ausdauer, deinen langen Atem.
Versuche nicht, den Stil des Autors X zu imitieren (es sei denn, parodistisch), der Einfluß anderer kann sowieso fast nicht kontrolliert werden.
Was macht man zum Thema, was schließt man aus? Damit man nicht zu dem von Walter Benjamin beschriebenen Modellfall eines Autors wird, der alles, was ihn im Moment beschäftigt, was auf ihn eindringt, in einem Text, an dem er gerade ,sitzt‘, verarbeiten muß. Andererseits kann gerade dieses Prinzip Generalmotor eines Textes sein. Haben die Surrealisten aber schon ausgeschlachtet. Das systematisch Unsystematische wird meistens nichts. Der konstruktive Anteil wird immer der sein, an dem das Ganze gemessen wird. Debatten über die Intentionalität des Autors schließt man mit Hinweisen auf die Arbitrarität des Gemachten erst recht nicht aus.
Mache keine unnötigen Umwege. Segle hart am Wind, vermeide Exkurse, die eigentlich nur verschleiern, daß du im Moment nicht weiterweißt. Bleib auf Kurs, auch wenn gelegentlich Flaute herrscht. Das Zauberwort heißt Kohärenz. Die Debatte über die dem Text eigene Sinnkohärenz ist ein so notorisch streitbares wie fruchtbares Unterfangen. Wenn ein Text ein kohärenzstiftendes Gebilde ist bzw. sein soll, ein auf sich selbst abgebildetes System, das Aussagen über seine Gemachtheit zuläßt – auch von seiten des Autors, der Autorin –, dann läßt sich dies mittels Stilfragen, syntagmatischen und semantischen Detailfragen oder zum Beispiel der Erörterung von Vorlieben für ein lexikalisch-morphologisches Inventar untersuchen. Der Autor selbst muß ja nicht gleich in einen literaturwissenschaftlichen oder semiotischen Jargon verfallen, seine Textur mit Ausblühungen analytischer Metaphern überwuchern, poetologische Reflexionen über das Duo „was“ und „wie“ der eigenen Arbeiten schaden aber ganz und gar nicht. Und wenn auch nur das Vermeiden von immergleichen Fehlern erreicht wird.
Bleibe in der Sprache klar und deutlich. Sage dir das als Mantra. Klar und deutlich heißt nicht, daß der Leser alles verstehen muß. Es kann zum Beispiel auch ,konsistent‘ heißen. Zuviel vorweggenommene Versöhnung, zuviel Einfühlung in den Leser entfremdet dich von deinem Vorhaben.
Hat man auch ein „Großes und Ganzes“ im Blick, so sind es gerade die Mikrostrukturen eines Textes, die auch für den Autor überraschende Perspektivierungen, Umwege, Umkehrungen von „Figur“ und „Grund“ zutage fördern können. Die syntagmatische Ordnung eines Satzes kann Anlaß sein, andere Wege einzuschlagen, als im Entwurf verzeichnet. Ein bestimmter Satzbautyp kann so dominant werden, daß er zumindest für eine Wegstrecke konstitutiv wird – und in seiner formalen Dominanz von semantischer Relevanz. Bevor aber der Selbstlauf, das Sich-selbst-beim-Schreiben-Zusehen, das ganze Vorhaben aus dem Blickfeld geraten läßt oder zum Selbstzweck der Demonstration einer Ordnung als Bewußtseinsmodell wird, lege man einen Stop ein. Stets sollte die Funktion einer solchen Vorgehensweise, einzelnen Parametern des Textverfahrens freien Lauf zu lassen, hinterfragt werden: Ist sie integrativ und kann differierende stilistische und rhetorische Ebenen subsumieren, oder wirkt sie dissoziierend? Läßt sie einen ganz anders gearteten Text entstehen, als intendiert? – Autorenintentionalität ist ja ein so legendenumwobener wie nicht restlos in den Text einzuholender Komplex. Kurz, es stellt sich die Frage, streiche ich den ,befallenen‘ Passus, oder lege ich mit ihm ein kohärenzstiftendes Fundament. Kohärenz erster, zweiter oder dritter Ordnung wird auf den verschiedenen textkonstitutiven Ebenen erzeugt, auf der syntaktischen, semantischen, phonetischen Ebene etc. So liefert ein Text zugleich sein eigenes Netzwerk und seine eigene symbolische etc. Ordnung, die es lesend stets im Auge zu halten gilt, weil mit der Durchführung dieser produktions- und rezeptionsästhetisch relevanten Kohärenzebenen strategisch bewußt gearbeitet werden kann. Sie ermöglichen es zum Beispiel, im Text etwas anzukündigen, eine Erwartungshaltung zu erzeugen, die zumindest vorerst nicht eingelöst wird, den Leser auf die berühmte falsche Fährte zu lenken, den Blick auf Nebensächliches zu richten, um um so gewaltiger ins Zentrum zu gelangen, das nicht weniger berühmte Ganze, das nie ganz in den Blick zu bekommen ist, perspektivisch bzw. pars pro toto aufzufächern, sie ermöglichen es, auch längere Textstrecken produktiv zurückzulegen, weil sie den fiktionalisierten Zeitraum und nicht zuletzt die beanspruchte Geduld des Lesers legitimieren helfen.
Womit arbeitet Literatur auf der materialen Seite? Mit Worten und deren Zusammengruppierung. Was die Worte betrifft, sei hier Wladimir Majakowskis Empfehlung wiedergegeben:
Ständige Auffüllung der Vorratskammern und Speicher Ihres Schädels mit notwendigen, ausdrucksvollen, raren, erfundenen, erneuerten, erzeugten und allerlei anderen Worten.4
Das Verwenden und ,Ausstellen‘ entlegener, exotischer, ,hochpoetischer‘ Ausdrücke erzeugt nicht a priori einen komplexen Gedanken, auch wenn solche Ausdrücke die Anmutung einer (poetischen) Fachsprache vermitteln. Das Arbeiten mit einer dem alltäglichen Ausdrucksniveau analogen Sprache verhindert demgegenüber keine gedankliche Komplexität. Sicherlich läßt sich darüber streiten, was das sein soll, ein alltägliches Ausdrucksniveau von Sprache. Vielleicht läßt sich ein solches als nicht elaboriert und allgemein verständlich/zugänglich bezeichnen. Auch als Autor würde ich die Anverwandlung rarer, erfundener, erneuerter oder erzeugter Wörter eher mit Poesie bzw. Gedichten als mit Prosa oder Drama assoziieren. Im deutschsprachigen Bereich ist hier Oskar Pastior für mich paradigmatisch. Gleichwohl sind hier die Übergänge der Genres fließend, wie das Werk von Uwe Dick zeigt. In ABC des Lesens stellt Ezra Pound u.a. folgende Regel auf:
Hüte dich vor Abstraktionen.
In Zeiten der Metaabstraktionen und Begriffsmythologisierungen besitzen solche Imperative fast Glaubensrelevanz. Onomatopoetische Ausdrücke und Konkreta haben nicht selten haptische Qualitäten, einen Klangkörper, dessen phonetische Eigenschaften visualisierende Potenz haben können.
Die vermehrte Einbeziehung von Ausdrücken, die ungewöhnlicher, spezieller, unbekannter sind, beargwöhnt man oft als „manieriert“, „kapriziös“; auch wenn gerade diese „mots justes“ eben genau die richtigen, die präzisen, unersetzbaren sind. Denkfäule greift nur nicht auf sie zurück.
Führe dir deine immer wiederkehrenden Manierismen vor Augen, die dir selbst schon längst aus dem Hals heraushängen. Schaffe sie ab. (So schwierig wie das Aufhören mit dem Rauchen.) Schnell schon ist man dann mit dem Gerede von einer „Metapher“ zur Hand, einem „Sprungtropus“, als könne dieser in ein „eigentliches“ Sprechen zurückübersetzt werden. Paul Celan wies immer wieder darauf hin, daß seine Gedichte nicht mit Metaphern arbeiten. Nicht die Vorstellung eines Sprungs (von einem Kontext in den anderen) leite seine Poesie, sondern diese sei bereits die „eigentliche“ Rede.
Metaphernforschung arbeitet im Gesteinsbezirk der Sprache. „Versuchen Sie mal, bilderlose Verse zu schreiben“, fordert Ossip Mandelstam in seiner Schrift über Dante auf. Unzweifelhaft bedient sich Literatur bzw. Poesie vorgefundener Metasprachen, macht sich in spezifischen Sprachkontexten definierte Denotationen zu eigen und kodiert diese um, sie erfindet zuweilen nicht als System fungierende Pseudosprachen – dies zeigt zum Beispiel die Geschichte der Lautpoesie.
Fasziniert von Literaturen, die sich ausgiebig Fach- und Fremdsprachen bedienen und so die Anschauung schärfen und eine geheimnisvollere ,Tiefe‘ evozieren können, arbeite ich insbesondere in der Prosa zunehmend mit einem Vokabular, das der Alltagssprache nahe ist.
Regularitäten können (wieder)entdeckt oder in netzwerkartig funktionierenden Gruppen bzw. Bewegungen festgelegt werden. Stellvertretend genannt sei hier die Werkstatt OULIPO. Wer spielerisch und mit dem nötigen Ernst die Materialität von Sprache und ihrer Regularitäten erproben will und zugleich erkenntnisreich an ihren Eigendynamiken scheitern, dem sei die Anverwandlung einer oulipotischen Regel anempfohlen.5
Sollte es dir so gehen wie Ezra Pound, hat sich das mit dem Roman ja von selbst erledigt:
Ich habe keinen guten Roman geschrieben. Ich habe überhaupt keinen Roman geschrieben. Ich rechne nicht damit, daß ich jemals Romane schreiben werde, und werde niemandem erzählen, wie es gemacht wird, eh ich das getan habe.6
Wie es gemacht wird, kann man das nicht nur von Fall zu Fall sagen, und auch das höchst eingeschränkt und unzuverlässig?
Liebeserklärung habe ich in etwa vier Monaten geschrieben. Verschiedenes mündete in den Text: Sören Kierkegaards Die Wiederholung, eine kleine Passage aus Alain Robbe-Grillets Roman Die Wiederholung, eine Prosaskizze (Brief) von Heinrich von Kleist samt Details aus seiner Klingstedt-Zeit, Gedichte u.a. von Samuel Beckett, Alexander Block, Rolf Dieter Brinkmann, Paul Celan, Günter Eich, Sergej Jessenin, Ernst Jandl, Friederike Mayröcker, Songtexte u.a. von Herbert Grönemeyer, Fragmente der Alltagskultur (Radio, Fernsehen, Tageszeitungen, Werbung etc.), gesellschaftspolitische Vorgänge, in Zügen und auf der Straße aufgeschnappte Gesprächsfetzen, Selbsterlebtes samt Verfremdung – und das Ganze getrieben vom Rhythmus des nicht stillstehenden Bewußtseins, einer Schnittechnik, die das Ganze nur in der untergründigen Amalgamierung seiner Teile simulieren kann, um es gleich wieder zu verlieren. Im Strom des Erzählens wird Heterogenes mitgerissen, das als solches nicht mehr aufscheint, sondern bereits in der Transformation als Motiv, Folge oder Abglanz des zentralen Themas „Liebe“ (zu einer Person, zu einem Land). Die Referenzen zwischen Innen und Außen, die Adressierungen der Liebeserklärung gleiten. Erzählstrategisch möglich gemacht wird dieses Gleiten durch das Wahrnehmungsmodell Bahnfahren, das dem Roman zugrunde gelegt ist. Landschaft erscheint als Kulisse innerer Erfahrungsprozesse, diese wiederum finden in heterogenen äußeren Begebenheiten ihre quasisymbolische Manifestation: Alles geschieht im Zeichen der Krise. Das habe ich immer versucht, untergründig mitlaufen zu lassen, es durchscheinen zu lassen, ohne es direkt zu verbalisieren, so daß der ganze Roman (für mich) das Ausagieren einer Liebes- als Identitätskrise darstellt. Das ist seine Handlung.
Apropos Gedicht. Schreibe ein Gedicht wie Paul Celan. Dies setzt allerdings voraus, daß du ununterbrochen Celan liest. Sei überzeugt davon, dieses Gedicht sei von Paul Celan. Bist du in diesem Gedicht zu Hause? Was fehlt dir an diesem Gedicht? Verbessere nun das Gedicht. Ist es noch von Paul Celan?
Schreibe ein Gedicht wie Rilke und begründe, warum es nicht von Goethe sein kann – aber auch nicht von dir.
Schreibe ein Gedicht, von dem du behauptest, nur du hättest dieses Gedicht schreiben können. Stellt dich das vor eine unlösbare Aufgabe?
Wähle aus deinen Gedichten dasjenige aus, von dem du sagst, dieses Gedicht bin ganz ich. Erkläre das. Entzünde an diesem Gedicht eine Poetologie, und zwar so kompromißlos, daß du dein Gedicht für verbesserungswürdig hälst.
Nimm deine Gedichte immer wieder zur Hand, bevor du sie aus der Hand gibst. Verabschiede dich von früheren Fassungen nur, wenn du dir ganz sicher bist. Manchmal ist die Tagesleistung ein einziges Wort. Gedicht heißt, jedes Wort zählt. Hier muß die sprachliche Wünschelrute ausschlagen. Warum dieses Wort in dieser Zeile? Krame nach: Gibt es nicht doch ein genaueres Wort? Was soll dieser blinddarmartige Appendix, den du an den Schluß des Gedichts gesetzt hast? Kann man den nicht streichen? Genügt es nicht, das Gedicht bei einem poetischen Stilleben zu belassen? Wie kommt es eigentlich, daß Lieblingsfehler der Ungenauigkeit, des Vernebelten, ornamental Stimmungshaften immer wiederholt werden?
Oder mache es wie Velimir Chlebnikov (1885–1922). Über diesen „Kolumbus neuer poetischer Kontinente“ berichtet Wladimir Majakowski: „Zum Korrekturlesen“ war er „unmöglich zuzulassen – er strich immer alles durch, alles, und schrieb dann einen neuen Text.“ Arbeite also mit Ableitungen, Aufpfropfungen: Entfalte aus einem motivischen Gerinnsel des einen Textes das Thema eines anderen. Vielleicht ist das der Text, den du schreiben wolltest. Lasse dich auf keinen Fall zu der Jammerei hinreißen, dir falle nichts ein. Erstens ist das kein Verdienst, zweitens gehört das zum Geschäft. Die Arbeit an einem Gedicht heißt zunächst einmal Umkreisung. Umkreise das Gedicht wenn’s sein muß eine ganze Kladde voll. Drehe und wende es. Streiche kompromißlos durch. Das Durchgestrichene scheint ja vorerst noch durch. Lies das Erreichte immer wieder laut vor. Knacken die Gelenke? Brechen die Scharniere? Klingt es zu geschmiert? Wo sind die Sollbruchstellen?
„Geh in die Hölle: geh in Dich!“ (Uwe Dick)
Wenn alles nichts hilft, hilft vielleicht Chlebnikov: Chlebnikov schrieb viele kleine Zettel voll, mit denen er auch schon mal sein Kopfkissen ausstopfte. Das Kopfkissen ging verloren. Geht deines verloren, bist du vielleicht von einer großen Last befreit. Vielleicht hast du Glück. Das Kopfkissen wird gefunden, und du wirst berühmt.
Des einen Poetenkasten ist des anderen Botanisiertrommel. Exkurs über einige Vorurteile, erlernbares Schreiben betreffend
Imperative als Mutmachungen? Anmaßung des Vorschreibens? Wie hieß das eingangs noch mal? „Poetenkasten“? Ein einziges Wort, das einen langen Schatten wirft. Und dieser lange Schatten ist deshalb so dunkel, weil er andere Schatten in sich vereinigt – oder immer länger zieht. Zum Beispiel ist es bekannt, daß der Poet licht- und arbeitsscheu ist. Was Halldór Laxness für Island und das männliche Geschlecht reklamierte, läßt sich international und auch auf Dichterinnen ausweiten:
Seit undenklichen Zeiten mußte sich die isländische Nation mit Männern herumschlagen, die sich Dichter nannten und daher nicht arbeiten wollten.
Eine ganze Nation schlägt sich jahrtausendelang mit Dichtern herum. Schön wär’s. Und gab und gibt es wirklich so viele Dichter, daß eine ganze Nation um ihre ökonomisch zu messende Produktionskraft fürchten muß? Was Laxness hier pointiert, ist ein hartnäckiges Klischee. Samt Rattenschwanz. Was aber, wenn die Dichterlinge nicht nur nebenher zum leidigen Geldverdienen arbeiten gehen, sondern auch noch regelmäßig zusammenkommen, ihr dichtendes Tun selbstkritisch zu bedenken, ihre Schriftstellerei sogar als Arbeit begreifen (wollen)? Das könnte privat ja noch angehen, nach Feierabend eben. Aber ganztägig? Zur besten Schaffenszeit? Ein Buch liest man ja hin und wieder ganz gern, einen großen Autor will man vielleicht auch mal leibhaftig sehen, was aber ist von Autoren zu halten, die Schreiben lernen wollen? Dichten lernt man nicht, dichten kann man. Richtig. Auto fahren kann auch jeder, bevor er Auto fahren kann. Während aber fast jeder Neuinhaber eines Führerscheins stolz auf diesen verweist, ihn zumindest bei passender Gelegenheit mal dem einen oder anderen unter die Nase hält, wird vielleicht nicht jeder Literaturinstitutsabsolvent der Menge zurufen, er sei soeben „Diplomschriftsteller“ geworden. Warum aber nicht? In Deutschland scheint das etwas Anrüchiges zu sein. Aber gerade nicht im Sinne von Underground oder Hochkultur, sondern im Sinne von „da mußte nachgeholfen werden“, „da war von Grund auf was auszubessern“, „braves Durchschnittstalent“, „gibt es das jetzt auch schon bei uns?“ oder direkter noch „wieder so eine saublöde Idee aus Amerika“. Daß die wenigsten diesen Betrieb von innen kennen, ist schließlich kein Argument. Daß die kolportierten Meinungen durch und durch Unsinn sind, zeigt sich: Es zeigt sich in ebensolchen Seminaren, die nicht selten zur Aufklärung des Dozenten beitragen.
Ist klassenmäßig veranlagtes Schreiben eine Art verlängerte Jugend? Und was soll dann verlängert werden? Zum Schreiben antreten. Ein Grenzgang zwischen Stolz und Beschämung. Und zwar nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. „Ich lerne schreiben.“ „Hoffentlich!“ „Berufsmäßig.“ „Haben andere gar nicht nötig.“ „Wie meint er das, Papa?!“ Oder: „Warum wollten Sie eigentlich Schriftsteller werden?“ „ Weil ich etwas anderes werden wollte.“ „Als wer?“ „Als ich.“ Oder: „Sie als Schriftsteller…“ „Wer?“ „Sie!“ „Ich?“ „Ja.“ „Nein.“
Auch geläufig ist folgende Meinung, die auf Hörensagen fußt und zu jener Spezies von Meinungen gehört, die weder auszurotten noch quellentechnisch zu überprüfen sind: Eine Schreibschule ist Spießerschule. Da geht man nicht hin. Und wenn man schon hingeht, dann lehnt man sich dagegen auf. Dozenten sind übrigens Oberspießer. Die haben das Schreiben ja schon hinter sich. Mit dem Betreten des Dozentenzimmers haben Dozenten ihr letztes Buch geschrieben. Die schreiben jetzt nur noch Klassenbuch. Und sehen der Jugend beim Altern zu. Und überwachen eifersüchtig den sogenannten Nachwuchs. Damit da nichts nachwächst. Damit keiner heranreicht – an ihr Klassenbuch.
Laut einem Anbieter von Lebensqualitätsverbesserungen ist die Botanisiertrommel „ein bewährtes Transportgefäß, in dem die in Feld und Flur gesammelten Blumen, Blätter und Stengel bruchsicher und geschützt (auch vor unbotmäßigem Austrocknen) nach Hause gebracht werden können“. Manches Modell verfügt über eine verschließbare Mittelklappe. Der Dozent öffnet seinen Poetenkasten und richtet semesterweise eine Art Ausstellung seines poetanischen Gartens ein. Seine Zuhörer filtern aus dem Mitteilungsstrom (manchmal eben nur ein Bächlein) Denkwürdiges, das sie zunächst einmal, geschützt vor unbotmäßigem Sofortvergessen, in ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend eingerichteten Botanisiertrommeln ablegen. Manches aus diesen Trommeln wird im Laufe der Zeit neuen Schätzen weichen, ab und an wird etwas aus dem eigenen Herbarium hinzugelegt, das später vielleicht nicht mehr von einer Fremdaneignung zu unterscheiden ist, aus dem Verbleibenden wird ein eigenes geistiges Gebäude errichtet, darin der ehemalige Zuhörer dann wohnt. Aus der Mittelklappe geht er hinaus und kommt durch diese wieder hinein. Ein jeder wird so mit der Zeit, wenn alles gutgeht, seine eigene Botanisiertrommel, die sich selber ausstellt – die andere in sich enthält.
Paradoxale Erfahrung(en): Die gesammelten, aufgelesenen, im „Fanggedächtnis“ (Uwe Dick) gespeicherten Schätze müssen nun selbst erworben werden; die schützende Botanisiertrommel ist dann – windschief ins Bildreich gestellt – vielleicht nur die Leiter, die man erklimmt, um sie wegzuschmeißen. Vom Philosophen der Leiter zum Selbstdenker-Philosophen Schopenhauer:
Die bloß erlernte Wahrheit klebt uns an wie ein angesetztes Glied, ein falscher Zahn, eine wächserne Nase oder höchstens wie eine rhinoplastische aus fremdem Fleische; die durch eigenes Denken erworbene aber gleicht dem natürlichen Gliede: sie allein gehört uns wirklich an.
Was auch immer dir in einem Schreibseminar gesagt wird, du wirst es nie einsehen. Vielleicht ersetzt du mal das eine Wort durch ein anderes, streichst einen ganzen Satz, erweiterst ein Romankapitel, nimmst ein anderes heraus, änderst den Titel eines Gedichts… wirklich einsehen kann man nur sich selbst – höchstens. Und das ist auch gut so. Wenn ein Schreibseminar nur das bewirkt, ist es schon eine Menge. Wer ist „du“? „Ich.“
Merkwürdig genug, das „Ich“, das viele ist, kann nur im Kontakt mit und in der Differenz zu anderen „Ich“ sein. Diese anderen müssen unablässig durch dieses „Ich“ durchströmen: die Reuse als Botanisiertrommel. Sie bleibt allein.
Nach dem Schreiben ist vor dem Schreiben. Abspann.
Treibe Sport. Wer Sport treibt, macht nicht so schnell schlapp vor dem Computer, der Schreibmaschine oder dem Notizbuch. Außerdem macht Sport selbstbewußter – auch beim Schreiben.
Hör mit dem Rauchen auf – fang es erst gar nicht an. Rauchen vermittelt nichts, außer den Trugschluß, beim Schreiben kreativer zu sein. Schnell ist die Packung aufgeraucht, das Blatt Papier aber noch völlig unschuldig.
Hör nicht mit dem Lesen auf. Lesen als ein schöpferischer Akt ist selbst schon Schreiben. Mitschreiben, Vorausschreiben, Nachschreiben, Umschreiben.
Bringe Unordnung in dein Leben – ein Roman über diese Unordnung könnte wieder Ordnung hineinbringen.
Geh auf Reisen. Begleite die Reise schriftlich. Beiße dich an etwas Erlebtem fest, schlachte es aus. Beschäftige dich mit der Literatur vor Ort, das läßt einen nicht immer so beschränkt sein. Monokulturell denkende und arbeitende Autoren sind das Beschränkteste, was man sich vorstellen kann.
Literatur arbeitet mit Sprache. Was heißt da, nur? Aus der Sprache, aus dem Sinn, aus der Welt. „Über die Sprache“ hat Ernst Herbeck seinem Poetenkasten folgendes entlockt:
Die Sprache ist die Not-
wendigkeit der Menschen
und wird zu Papier gebracht.
Ist die Sprache vollständig, so
setzt man einen Punkt hin wie
bei der österreichischen. Wien
ist der Ausgangspunkt unserer
Sprache; die ist eine Abteilung
deutsch. Wird die Sprache gesungen
und getippt, so gibt sie der
Rundfunk – durch den Sender wieder.
So meint es mein Freund Kurt Bauer.
Michael Lentz, aus Josef Haslinger und Hans-Ulrich Treichel (Hrsg.): Wie werde ich ein verdammt guter Schriftsteller? Berichte aus der Werkstatt, Suhrkamp Verlag, 2005
MICHAEL LENTZ
Wolf wohl – Wolfswohl
Isegrim ist ein Wohlwolf auch
mit einem grauen grausen Bauch
der halb ist nur voll
Soviel also wissen wir
und auch der Jäger
ist ein Tier
In Anschlag sein Gewehr
Im Blattsattgrün schwer
(nun ja ist ein Jahr her
das der letzte Treffer
Keiner war)
fürwahr führwahr
Peter Wawerzinek
Yevgeniy Breyger und Michael Lentz – Das Gedicht in seinem Jahrzehnt – am 27.5.2022 im Haus für Poesie
Fakten und Vermutungen zum Autor + DAS&D + KLG + IMDb +
Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Michael Lentz – Performance wie es früher war beim PROPOSTA-Festival Barcelona im November 2002.
Keine Antworten : Michael Lentz: zur kenntnisnahme”
Trackbacks/Pingbacks
- Michael Lentz: zur kenntnisnahme - […] Klick voraus […]


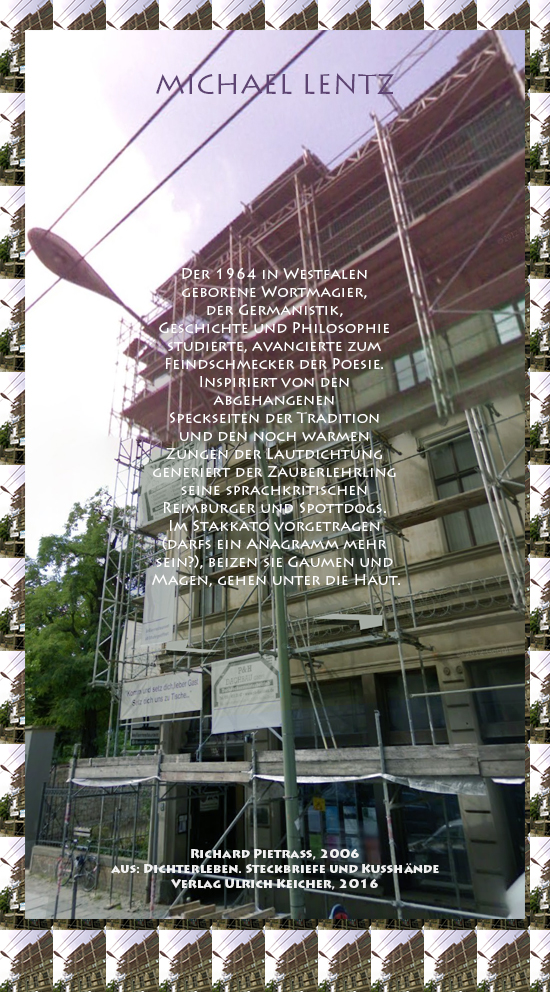












Schreibe einen Kommentar