Oskar Pastior: Das Unding an sich
DRITTE VORLESUNG
Text, gelesen am 25. Januar 1994
Meine Damen und Herren, guten Abend. Reden hieße: Sonden vorantreiben, die, sich am Weg reibend, die Sondierung herstellen.
Von der Rücksicht auf diese Grundsituation. Sie hören zu – ich grunze stante pede. Nehme, indem ich rede, keine Rücksicht, weder auf Ihren Wissensstand von dem was ich rede, noch auf meinen eigenen Wissensstand (gleich Null) von dem was Sie beim Zuhören voraussetzen.
Dies ist ein vorbereiteter Text.
Mein Anspruch dabei (und von dem kann ich reden) ist also unverhältnismäßig offen töricht hoffend, daß Sie, ebenso wie ich, Ihren Wissensstand von dem was Sie hier erwarten (und was Sie hier erwartet) nicht parat haben, geschweige denn resümieren könnten. Was liegt das pickt – gehabte Texterfahrung läßt sich nicht zurückschrauben, beliebig abrufen oder unverfälscht in praesumptive, besser gesagt postsumptive Etappen fixieren. Das ganze Debakel mit späterer Lektüre früherer Lektüre.
Selbst wenn ich didaktisch arrogant vorhätte, Ihnen all das was ich im Grunde bei Ihnen an Kenntnissen voraussetze, jetzt sozusagen noch einmal auf dem Präsentierteller auftischen zu wollen (alle meine Gänschen, schwimmen auf dem See – die Texte, die Geschichte, der Hintergrund – die Punkt für Punkt abhakende „Exposition“ wäre so schön absurd wie der Gedanke einer identischen Reproduktion der Welt etwa in einer Riesenbibliothek, um nicht Borges oder Stasi zu sagen. Abgesehen von allen Lücken und Auswüchsen, die rein technisch bei einer Verdopplung doch wieder entstehen würden.
Ich setze viel weniger voraus: bloß daß Sie natürlich meine Bücher kennen – nicht besser als ich – und, in großen Zügen, mit und ohne Schlafwagen, die biographischen Stationen, bzw, die Graphik davon. Nichts ist übrigens demütigender als das Prokustesbett der sogenannten biobibliographischen Angaben (ich nenne sie deshalb freundlich „die Biobibs“), mal nicht länger als 3, höchstens 10 Zeilen, wie sie alle Piff gewünscht werden, mal im Hinblick auf translatorische Aktivitäten, mal eher auf Lautpoetisches, oder dann gar nach dem Muster eines Formulars. Um nicht zu sagen einer Grammatik.
Denn von all den Erkenntnisgeschäften, über die ich schlecht Buch führe, sind zwar auch viel abwesend, doch selbst die Vordrucke entbehren fahrlässig der Vollständigkeit.
Heute Morgen kam ein Brief ins Haus geflattert. Das Statistische Landesamt Berlin will unter Bußgeldandrohung von mir wissen, wieviel Personen in meinem Unternehmen tätig sind, ob das Unternehmen Zweigniederlassungen hat, was für Güter oder Waren ich an meiner Arbeitsstätte herstelle. Nun ist freiberufliches Schreiben eine Veranlagung. Das Finanzamt veranlagt mich als Gewerbetreibender. Demgemäß habe ich im Volkszählungsbogen mein Wohnzimmer als Arbeitsstätte benannt. In der Eisenbahn schreibe ich, falls ich schreibe, auf den Knien. Mein Kopf ist 24 Stunden am Tag mein Kopf. In den Formularen ist für diese Arbeitsstätte kein freier Platz gelassen. Dies zur Poetik der dichterischen Existenz. (27.8.88)…
Oskar Pastior: Welt auf tönernen Füßen. Lauter Laute. Lesung am 15.5.1993 im Forum der Kunst und Ausstellungshalle der BRD.
Im Wintersemester 1993/94 hielt Oskar Pastior
an der J.W. Goethe-Universität in Frankfurt am Main fünf poetische Lesungen. Es war ein lautmalerisches „Rahmengeplänkel“, ein „poetologisch konstitutiver Wuselpunkt in allem was mich schreibt indem ich schreibe, also nicht das übliche Stöhnen über Schwierigkeiten überm weißen Papier“. Pastior gibt Einblick in Zwischenschritte, berichtet davon, wie er schreibend lebt und was er sonst verschweigt. Er spricht dichterisch vom Hören und Besserwissen, von Bedeutungsklumpen und Wörterbüchern als Kunstfundus. Herausgekommen ist weniger eine Vorlesung denn ein sprachtänzerisches Zeremoniell, ein wortflackerndes Ritual. „Ich setze also, auch hier, im Voodoo ludens, auf den springenden Punkt im gesträubten Fell des Denkens: Wortfelder, ein Text natürlich – das Unding.“
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1994
Über den Wuselpunkt
Wenn Dichter sich selbst erklären, ist das meist langweilig oder ein bißchen einfältig. Denn nicht selten sind poetische Texte schlauer als ihre Poeten, weshalb Poetik-Vorlesungen immer etwas Volkshochschulhaftes haben: Zugeschaut und mitgebaut – Wir machen Gedichte, 5mal einstündig, Raum 14, ein Unkostenbeitrag wird erbeten. Oder die Schnüffler unter den Lesern hoffen, den Hermetikern auf die Schliche zu kommen: So also hast du das gemacht, poetischer Lump! In Zukunft werde ich dich verstehen!
Nichts schlimmer als das. Da hilft dem Dichter nur eins: erklärend Verwirrung stiften. Wie Oskar Pastior am 11. Januar 1994 zu Frankfurt am Main:
Guten Abend, meine Damen und Herren, vergessen Sie einmal folgende Sätze: Vergessen Sie bitte noch einmal folgende Sätze, vergessen Sie wie Sie den Sätzen folgen. Haben Sie vergessen, wie die Sätze folgen … Ich weiß nicht was wissen heißt … Ich weiß nicht was Lyrik ist.
Das soll eine Poetik-Vorlesung sein? Geld zurück!
Was Pastior will, verrät er vierzehn Tage später (und ist in diesem Taschenbuch mit seinen „Frankfurter Vorlesungen“ nachzulesen). Die Zuhörer sollen, genau wie er selbst, am Ende nicht mehr wissen, was sie am Anfang erwartet haben. Oder gewußt haben. Autopoiesis als Selbst- und Fremdverwirrung. Pastior erklärt nicht seine Arbeit, er arbeitet seinem Publikum etwas vor. Seine Vorlesungstexte sind Partituren für eine Performance; Sprachwucherungen über die vertrackten Baupläne seiner kleinen „Kunstmaschinen“, all die Hörichte, sonetburger und Sestinen. Keine Theorie mithin, die ist von und für „sekundäre Geister“ und also ein Versehen. Pastiors poetologischer Standpunkt ist ein „Wuselpunkt“, eine ständige Flucht vor zuviel Sinn, vor Ideologie und Teleologie, ihr einziges Ziel ein Beweis: daß der poetische Text ein Unding ist.
Ein starkes Wort. Im Mittelhochdeutschen ist das undinc ein Übel, Unrecht, Schaden und Verderben. Etwas Unmögliches, in jeder möglichen Bedeutung des Wortes. Das ist ein Grundprinzip des Kauderwelschs, das der Dichter mal „krimgotisch“, mal „pastior“ nennt: „alles Wörtlichnehmen“. Dann gebiert ein Wort Bedeutung um Bedeutung bis zur Bedeutungsresonanzkatastrophe, aus der die entfesselte Sprache davonschwebt wie ein prallgefüllter Luftballon. Oder auch einer, aus dem die Luft knatternd, pupsend, röchelnd entweicht. Ein Spiel, an dessen Ende vielleicht sogar „Paradiessprache“ gesprochen wird.
Fast ganz im Ernst zeigt der Kunstmaschinentüftler dann doch ein paar Bauteile her; die Chaostheorie zum Beispiel, die beweist, das noch der Zufall eine Richtung hat, das Tohuwabohu ein System. Selbst einige Sentenzen für die Seminararbeit hat Pastior parat: „Vor dem Ohr sind alle Wörter gleich.“ Und:
Vielleicht ist Poesie nichts anderes als Beiordnung (nicht Einordnung), Juxtaposition.
Einmal scheint er gar den ganzen Bauplan auszuplaudern:
Wenn es ein Programm zu formulieren gälte, so wäre dies sein allgemeinster Nenner: Leser oder Hörer hellhörig machen für Differenzierungsmöglichkeiten, damit jeder zu seiner eigenen Sprache findet.
Da grinst sie schon, die Volkshochschulgrimasse, wäre da nicht, zum Glück, der Konjunktiv. Nichts gilt endgültig; das wahre Pastior-Programm klingt so:
Ich plädiere für das Stellwerk der heißen Pellkartoffel als Fußdecke.
Wer sich unter einem wohltemperierten Erdapfel die Haxen wärmt, kann dennoch mitten im Leben stehen. Bei Pastior gibt es sehr wohl hinter tausend Lauten eine Welt, die er im konzentrierten Schwadronieren immer mal wieder streift. Dazu gehören Hermannstadt, wo er geboren wurde, und Bukarest, wo er lange lebte. Und die Vorbilder, von Quirinus Kuhlmann bis Chlebnikov, die Freunde der Sprachartistentruppe OULIPO, die Feinde, die ihn der „Lautmalerei“ verdächtigen, die er doch wie alle mimetische Literatur nur für poppig präsentierte Butzenscheibe hält. Poesie macht nicht nach, sie stellt etwas her. „Gedankenmusik“ oder poetische Pantoffeltierchen. Oder „phonetisches Aspik“, das aber keineswegs unbegrenzt haltbar ist: Einen Text von 1976 „hat Mölln geschrotet“.
Keine letzten Rezepte für das Unding. Und schon gar keine Auswahlkriterien. „Sympathie braucht keine Begründung.“ Wie sympathisch.
Christof Siemes, Die Zeit, 24.3.1995
Rahmengeplänkel und Wuselpunkte
− Oskar Pastiors Frankfurter Poetik-Vorlesungen. −
Der Gastlehrstuhl für Poetik der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität sorgt glücklicherweise dafür, dass wir regelmässig mit der Selbstreflexion bekannter Autoren vertraut gemacht werden. Längst nicht immer sind Stil, Gedankenführung, Sprach- und Denkkraft so stimulierend, so elegant-souverän und konzentriert wie in Oskar Pastiors Frankfurter Poetik-Vorlesungen. Der aus Rumänien gebürtige, mit stimmhaftem Akzent begabte Autor beginnt und schliesst seine Ausführungen mit der Verpflichtung von Text und Leser auf Wörtlichkeit statt „Nämlichkeit“:
wo das wie und das was einander so lesen, dass es sie gibt.
Wir sollen sehen und vernehmen, was da steht, und nicht gleich in die Frage nach der „Bedeutung“ flüchten. Das von Pastior so souverän gehandhabte Palindrom – ein Text, der sich auch rückwärts lesen lässt – ist ein Kronbeispiel für die These „Sachverhalt ist Sprachverhalt“. Einverleibung und Entäusserung werden in dieser Form identisch: in einem Text, „der mit sich hadert, nicht metaphysisch, sondern tatsächlich, also vom Anfang, der schon sein Ende ist“. Oskar Pastiors Überlegungen tragen sich als Sprachspiele vor:
Als könnte Sprache, indem sie mich erfindet, dem ‚Wort vor dem Ding vor dem Wort vor dem Ding vor dem Wort‘ auf die Spur kommen.
Immerhin kam Pastiors Wörtlichnehmen vielen Formen auf die Spur, die er aufs neue in die deutsche Dichtung eingeschrieben hat: Anagramme, Vokalisen, Palindrome, Rösselsprünge und Sestinen; viele andere liessen sich nennen.
Rahmengeplänkel nennt er seine Vorlesungen, die sich an keiner Stelle bei zuhandenen Diskursen ausruhen. „Poetisch konstitutive Wuselpunkte“ sucht er zu benennen:
in allem was mich schreibt indem ich schreibe, also nicht das übliche Stöhnen über Schwierigkeiten überm weissen Papier.
Der Text „das Unding“ – wie wenig andere Dichter setzt Pastior den „linguistic turn“ voraus, die Anerkennung der Frage, „wer da wen denkt“. Seine Formen, etwa das „Leitartikelgedicht“, gewinnt er gutteils aus dem spielerischen Ernstnehmen dieser Frage.
Um überhaupt zu reden, schneidet und klebt die Sprache ‚mich‘ unentwegt vorsintflutlich aus und auf.
Immer wieder gelingt es Pastiors Vorlesungen, die Unsinnigkeit aller Dichotomien, etwa der von Sprache und Wirklichkeit, darzutun, und zwar am Leitfaden des eigenen Schaffens, der Versuchsanordnung Oskar Pastior. Dabei zeigt der Sprach- und Sprechkünstler aus Siebenbürgen, wie Sprache haltmacht und manches möglich macht, „das ungefragt nicht wäre“. Zugleich trägt er, nur ein wenig parodistisch übertreibend, Unordnungen in gut geregelt erscheinende Diskurse hinein. Etwa den der Wissenschaft, eine ironische Verbeugung vor der Sprechgelegenheit Universität:
Selbst die Spontangenese eines Blinddarms am Leib der Falsifikation im Zuge allgemeinen Ideologieabbaus mit Hilfe ungeahnter Katachresen im Auseinanderdriften ebensolcher Chancen zur Hinterfragung des Einwegs der sprachentropischen Entkrausung angesichts des Protokollcharakters jeder Entropie ist oder hat zur Folge, bei uns zumindest, die Satzaussage.
Ein „kognitives Blinzeln“ genügt Pastior als Wirkung. Das Sprachungetüm trägt immerhin nichts weniger als den Methodenweg der Philologie in den letzten zwanzig Jahren vor.
Pastiors Sprachbiographie beglaubigt den Versuch, die „Schiene der Einsprachigkeit“ zu „durchbrechen“. Folgende Sprachen kann Pastior für sich in Anspruch nehmen:
die siebenbürgisch-sächsische Mundart der Grosseltern; das leicht archaische Neuhochdeutsch der Eltern; das Rumänisch der Strasse und der Behörden; ein bissel Ungarisch; primitives Lagerrussisch; Reste von Schullatein, Pharmagriechisch, Uni-Mittel- und -Althochdeutsch; angelesenes Französisch, Englisch… alles vor einem mittleren indoeuropäischen Ohr… und, alles in allem, ein mich mitausmachendes Randphänomen.
Alexander von Bormann, Neue Zürcher Zeitung, 9.2.1995
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Jörg Drews: Einwickelnde Auskünfte
Basler Zeitung, 3.2.1995
Unter dem Titel Pastiors Poetik
Süddeutsche Zeitung, 11./12.2.1995
Felix Philipp Ingold: „… daß Text da sei“. Beispiele heutiger Autorenpoetik
manuskripte, Heft 127, 1995
Georg Aescht: „Eine kleine Kunstmaschine“ und „Das Unding an sich“
Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 1995
Pastior lesen
– Rückblick auf eine Lesung in der Literaturwerkstatt Berlin, am 9. März 1993. Der Abend hat mit den hier folgenden Sätzen begonnen (hier gibt es kleine Kürzungen). Während der Einführung haben wir uns immer wieder unterhalten, Oskar Pastior und ich, und er hat (meist verabredete) Textstellen vorgelesen. Unsere improvisierten Zwischen-Gespräche sind zwar leider für immer verloren, ein Stück weit hier zu erahnen. –
Die Vorstellerin, oder um es allgemeiner zu formulieren, der Vorsteller ist in diesem Fall ein Leser, der sich mit dem, den er eines Tages vorstellt, oft schon in einem Gespräch gewähnt hat. Als Leser hat er sich vorgestellt, mit dem Vorzustellenden zu reden. Hallo, dachte er, das Lesen, das Zitieren und sonstige Be- und Umarbeitungen sind so ein Hallo, hallo, dachte er, du hast wieder etwas Hochinteressantes gedacht und geschrieben, extra für mich, auf daß es ein schönes Gespräch zwischen uns gäbe.
Hingegen hat sich der Lesende nicht vorgestellt, den, den er für sich allein so denkenswürdig findet, in aller Offenheit anderen vorzustellen. Ihn nicht sich, sondern anderen vorzustellen.
Nicht sich, sondern den anderen ist ein großer Unterschied.
Der heutige Abend ist eine Gelegenheit, diesen Unterschied auszuloten. Allerdings: „Gegebenheit macht hindernis und macht gegebenheit siebe?“, schreibt Oskar Pastior.
„macht gegebenheit siebe, rückt mischmut auf“, sagt er. Recht hat er! Zwar hat er das als Palindrom geschrieben, was in etwa bedeutet, daß die Kehrseite ebenso stimmt, ein Palindrom hat eben eine Achse, und alles ist von der Achse her in mindestens zwei Richtungen lesbar, daher heißt es dann bei Pastior „mischmut rückt siebe“. So daß es nicht unbedingt möglich ist, diese Gegebenheit vollständig ausloten zu können.
Allerdings, durch die Palindrome steigert sich etwas, und auf diese Steigerung kommt es zunächst an.
Oskar Pastior hat seinerseits einmal Kurt Schwitters vorgestellt und dabei auf das Steigerungsmoment in der Nachsilbe -er hingewiesen; -er eigne „durchaus nicht nur Adjektiven, siehe Kupf-, Kupfer – am Kupfersten, Schwitt, Schwitter am Schwittersten“. Der Vorzustellende habe außerdem eine tiefe Abneigung gegen Superlative, fühle sich im Unterscheiden angemessen.
Die Steigerung im erwünschten Komperativ steckt besonders deutlich in seinem eigenen Namen. Pastor, Pastior. Pastor ist schlicht und eindeutig ein Hirte (übrigens hat der Gesteigerte neben Deutsch sein Rumänisch, ein wenig Lagerrussisch und auch Ungarisch im Kopf, und im Ungarischen klingt pásztor nicht lateinisch, sondern nimmt sich wie ein urungarisches Wort aus und heißt nichts sonst als Hirte, das weiß Pastior) und damit unterscheidet sich unser Dichter, der sich ungern als Poet bezeichnet, vom Hirten, indem er hirter ist, so daß man sich in seinen Zeilen, Wörtern, Sätzen und seinen Unwörtern nach Lust ausweiden kann.
Ausweiden! Wieder ein Problem mit dem Transitiv. Wen ausweiden? Sich selbst oder die Texte. „Vom Fleisch der Wörter, von der Karnation der Begriffe“ ist die Rede, sagt der Vorzustellende. Und im Unterschied zum Hirten ist der Hirter ein Weidmann, der, stets mit dem Messer unterwegs, Wörter auseinanderschneidet, aber er ist nicht ganz Weidmann, eher ist er Weider, weil die von ihm geschnittenen Wörter ihr Leben nicht verlieren, im Gegenteil. So stelle ich ihn vor.
– An dieser Stelle steht im Manuskript „Einschub“, hier hat Oskar Pastior etwas vorgetragen oder improvisiert. Was es war, muß man sich ausmalen. –
Noch eine Möglichkeit: Fassbinder hat in einem seiner frühen Filme von der Computerwelt erzählt. Findige Fachleute haben ein Programm erstellt, das sich anhand von einigen Daten selbständig weiterentwickeln kann, in diesem Programm entwickeln Leute, die selbst nur Daten sind, eine eigene Sprache, die für den Außenstehenden, und das sind wir, nur von ihrer emotionalen Haltung her verständlich ist. Manchmal kommt in dieser unbekannten Sprache eine Klarheit auf, als hätten sich zuvor nur Nebelschwaden über die Verständlichkeit gelegt.
Solche Nebelschwaden liegen scheinbar über den unzähligen Gedichten, Anagrammen, Palindromen, Hörichten und den Texten anderer Sorte bei Pastior, zwischendurch wachsen aber klare Verständlichkeitsinseln hervor.
Beinahe alles verstanden, doch nicht verstanden, wieder ziemlich klar verstanden, bewegt, gerührt, unschlüssig darüber, warum gerührt; und ja, da ist eine zwingende Logik, welche Logik, wie viele Arten von Logik, jedenfalls zwingend und voller Erinnerung: und damit meine ich, daß je ein Stück Text von Oskar Pastior jeweils mehrfache Erinnerungen weckt.
– Pastior liest aus „Lesungen mit Tinnitus“: –
die andel hat stochen durft
und reigen mag ich nicht
bin noch zu jum
wenn nickvollzieher klumpt
und nügele zytons –
sticht man ab
roger zu fühlinnen aber zeigt
wie man sich an hyazinthen
zu streusal hätte
da klüger und hortensien-pepitaph
und geigen mit wunder
empfindsamkeit
gar kühl bis anbar-hirnhaar
war blutjup im vergleich
zur stülung
auch rasche meermaultauschn
haben immer ein schlich-
tes glück im sinn
gerechter himmel nie stimmen die
pes im gewicht – nur zwei
zum abschmecken noch
möchte rittlich mal kniperboker
ihnen zum halef hinaus
ein andel fürenson
Manchmal wächst aus den nicht vernebelten Inseln auch deutlich Nacherzählbares hervor, so zum Beispiel im Taxi-Text.
– Oskar Pastior liest aus Jalousien aufgemacht. Ein Lesebuch: –
Sie aßen im Taxi. Sie entblätterten die Schnur, sie spalteten die Klarsicht, sie wickelten die Hülle aus der Fülle, sie drangen zum Kern vor. Sie lösten die Schale, sie puhlten die Fasern, sie stießen auf Überfluß. Sie entfernten das Überflüssige. Sie stießen zur Seite, sie kamen zur Sache. Sie packten aus. Sie ließen alles Überflüssige fallen, sie drangen zum Überfluß vor, sie stießen die Hüllen beiseite, das Taxi quoll über. Sie warfen alles Überflüssige aus dem fahrenden Taxi, sie pellten die Häute, schälten die Sache, lösten Knoten, zogen das Fell ab, schabten und puhlten, stießen zum Überfluß vor. Die Fülle quoll über. Sie warfen die Abfälle aus dem Taxi. Sie warfen sich auf die Sache, sie lösten die Verpackung, sie aßen im Taxi, sie waren scharf auf das Essen im Taxi, sie lösten sich, sie lösten das Taxi, sie warfen es aus dem fahrenden Taxi, zu allem Überfluß sich hinterher, es gab ja alles, in Knülle und Müll.
Diesen Text kann jeder leicht nacherzählen! Es geht um ein großes Schlemmen! Die Geschichte ist überaus einleuchtend. – Obwohl: Sie handelt nicht unbedingt nur vom Essen, sie hat etwas sehr üppig Erotisches, und vielleicht geht es noch um andere Dinge, am Ende berichtet die Geschichte, berichtet sehr unmittelbar von der Denkweise Pastiors und sogar von der Vorgehensweise in seinen Arbeiten. Und dadurch entstehen angesichts dieser Geschichte wieder mehrfache, gesteigerte Erinnerungen.
Solche Erinnerungen stellen sich auch durch seine Anagramme ein. Ana mit einem N ist die Frau, der Oskar Pastior die meisten Gedichte gewidmet hat, und diese Liebesgedichte erinnern ebenfalls an die Ursprache von Menschen in einer Art Urwald, die nach dem ganz und gar treffenden Wort suchen. Meine Frage: Wieviel wiegt eine Nichtbedeutung in diesem Urwald? Gibt es für Dich eine Nichtbedeutung?
– Pastiors Antwort muß man sich ausmalen. –
Stellen Sie sich zunächst einmal vor, (diese Art Vorstellung ist jetzt neu), stellen Sie sich vor, daß es zunächst nur um Unterscheidungen und Steigerungen geht. Oder das, worum es geht, einmal in Oskar Pastiors Formulierung:
Etwas schwebt mir vor, das kommt aus der Physik: Die Holographie… Einen Text möglichst so zu machen, daß jeder Teil das Ganze enthält. Das ist für mich so ein Vorbild. Das paradigmatische Beispiel bei der Holographie ist ja eine holographische Bildplatte. Dort ist ein Pferd zu sehen. Und dann nimmt man den Hammer und zerschlägt diese Platte und plötzlich ist das Pferd auf jedem Splitter zu sehen. Also: jeder Splitter enthält dann wieder das ganze Pferd.
Frage: Kann allein schon ein Buchstabe so ein Pferdchen tragen, verdeutlichen?
– Pastiors Antwort muß man sich ausmalen. –
Jetzt habe ich eine Antwort von Dir, Wörter haben einen Klang, eine Herkunft, eine Pseudoherkunft, eine Zeichnung. Die nächste Frage: Ist in Deinen Augen alles, was Du geschrieben hast – Buchstaben, Wörter, Zeichen, Zeichnungen und die Laute – sind sie für Außenstehende analysierbar?
skilk & aps
kanalipsion
analasikoin
paskopipian
pinaskapiol
isolaktinal
onopolonoks
naktaskopia
ipsiliminti
katastapnio
nisnaionokl
ospitaklian
plonikatsio
kilinapsana
snopinskino
(„Sonettburger“)
– Das ist wohl die richtige analytische Antwort auf die Pseudofrage. –
Der EINSTIEG zu Oskar Pastior war für mich das „Rheinmärchen“. Gerade hatte ich Brentano gelesen, war berauscht, hatte mit dieser Rheingeschichte eigene Absichten, die ich aber fallen ließ. Pastiors Lösung gefiel mir zu gut. Pastiors „Tireliertext“ ist wirklich ein Rheinmärchen, ist eine Art Brentano, völlig verdichtet, hier der Anfang:
daraufhin wollte dergestalt raus. dergestalt war fein allerley. nur eben was allerley dergestalt vorschwebte war nachgerade keinerley. ruhlos revox paradox: keinerley gallionsfigur auf weiter flur im schwebesitz ungewitter potenz – ein kleines rehlein tief in tee gesetzt gemeinhin eh gems weih: quaquas rad…
Das Lesebuch, benannt nach Pastiors berühmten Gedicht „Jalousien aufgemacht“, ist voller praktischer Hinweise. Da finden sich sogar Anleitungen, wie ein Text beschaffen sein sollte. „Entwaffnend bitte sei er also bis zur Entblödung, kurzum politisch erzieherisch, gespreizt, kurzum erotisch; auf einem anderen Blatt stehend, also zugehörig“, und „nichts als ein Privatbrief, du weißt schon…“
Oskar Pastiors Welt, die Welt der Karnation von Begriffen, ist groß, voll von Spielen und oft zugleich traurig. Sie ist groß genug, um traurig zu sein. Allein schon diese Karnation! Nation müßte ich sagen. Denn, ich zitiere:
ES: Unter anderem besteht es aus der Trennung seines Schnupper-Ichs vom anderen Teil, dem eigentlich Stummel
so beginnt ein Stück aus dieser traurigen Welt, in der durch den Verlust allen Glücks, durch den Verlust von Kar, sich Otte, Ussel, Ajan und Tause tummeln. Zu ihnen könnte auch die Nation gehören. Wird ihr verlorenes Ich wieder hinzugefügt, ist die Nation erneut die Karnation, Ajan ist Karajan, Tause die Kartause und so weiter.
Der Vorstellende ist jemand, der sich von dem, den er vorstellt, irgendeinmal wieder trennen muß. Das heißt: Von dem, was er an dem Vorgestellten so überaus gut findet, muß er sich loslösen. Was er überaus gut findet, nimmt er sozusagen an einem Ende, am noch freien Ende und versucht, damit weiterzugehen, auf diese (verbundene) Weise entfernt er sich von ihm.
So hat es auch Oskar Pastior mit Brentano getan oder mit Petrarca, in seiner Petrarca-Übersetzung hat er den bewunderten Vorgänger ganz beim Wort genommen, ihn trotz aller vorhandenen Übersetzungen nochmals übersetzt, ins Pastiorsche.
Eine andere Möglichkeit des Weiterkommens ist das Vergessen. „Was ist Zitat“? fragt Oskar Pastior. „Alles, Sprechen heißt: Wörter zitieren“, sagt er.
Einmal habe ich es fertiggebracht, sein Jalousiengedicht zu vergessen, bei dem Wort Jalousie fiel mir nichts als die Eifersucht ein, und als ich sein Gedicht wieder im Kopfhatte, war meine Jalousienarbeit bereits fertig. Ein Glücksfall.
Frage: Wie hältst Du es mit dem Vergessen?
– Pastiors Antwort muß man sich ausmalen. –
Wie, mit welchen Mitteln, welcher Logik, welcher Technik der Weidmann an die Wörter geht, ist eine Frage. Die andere Frage ist, welche Bilderwelten, welche Gedanken die Wörter und ihr Fleisch auslösen. Ich glaube, kein Roman reicht an ihr Reichtum.
Hier hat sich ein Superlativ eingeschlichen. Wenn Oskar Pastior dadurch irritiert sein sollte, korrigiere ich den Satz und sage: kaum ein Roman. Ohnehin war bisher in erster Linie vom Unterscheiden und vom Steigern die Rede, und um das richtig fortzuführen: Die Lesung von Oskar.
Zsuzsanna Gahse, die horen, Heft 224, 4. Quartal 2006
DER WAHRE DICHTER
Für Oskar Pastior II
Wer hört das Höricht? Sprich! Wer hört denn, wie es kreist
im sechsten Luftbereich, piano und sonor?
Das Ohr als Hörorgan, das Ohr in Pastior.
Ja, doppelt ist das Ohr vom Hörichthauch gespeist.
Es bringt ein ganzer Leib, die Seele und der Geist
bewegt, continuo im vielgestimmten Chor
die Wörtersymphonie so tief aus ihm hervor,
daß sich der Taube graust, der Germanist zumeist.
Doch lauscht inzwischen schon ein ganzer Erdkreis ihm,
die Schiffer von der Saar, die Goten von der Krim,
und selbst in Bielefeld man etwas von ihm hält.
Er öffnet seinen Mund, die schönen Wörter gehn
hinaus und sind doch nur inwendig zu verstehn:
Man hört das Weltgedicht, wenn ER das Höricht spricht.
Ludwig Harig
NEUN ZEILEN
für Oskar Pastior
Am Neunten November
um Dein Grab
zweihundert Gerechte
Deine Asche
in einer einzigen Urne
In meinem Zimmer aufgehäuft
ein kleiner Berg Werke
Unverbrennbar
der Gipfel der Einsamkeit
Uwe Herms
Interview mit Oskar Pastior für das Haus des Deutschen Ostens.
Interview mit mir. Diese Aufnahme beinhaltet ein poetologisch dichtes, leider aber nicht realisiertes Interview von Christian Prigent mit Oskar Pastior, dass vermutlich für die von Christian Prigent herausgegebene französische Zeitschrift TXT geführt wurde.
Lesung Oskar Pastior am 20.7.2005 im Deutschen Literaturarchiv Marbach.
Herta Müller: Mein Freund Oskar
Franz Josef Czernin: Die Regel, das Spiel und das Andere. Zum Werk Oskar Pastiors.
Oskar Pastior liest aus seinen verschiedenen Texten und Übersetzungen ein Programm, das die Sprachbewegung jeweils in der Konzentration auf einzelne Laute und Buchstaben nachvollzieht. Aufgenommen auf einem mehrtätigen Festival mit dem Titel Für die Beweglichkeit im Kunstverein Maerz in Linz.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Jochen Hieber: Die Suppe ist einmalig
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.10.1987
Herbert Wiesner: Frauen-Bild-Beschreibungsschrift
die tageszeitung, 20.10.1987
Hans Bergel: Vom Rückzug der Sprache auf sich selbst
Siebenbürgische Zeitung, 31.10.1987
Zum 65. Geburtstag des Autors:
Hannes Schuster: Ein „Wörtlichnehmer“, der das Wörtlichnehmen ertragbar macht
Siebenbürgische Zeitung, 15.11.1992
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Bettina Knauer/Gunnar Och (Hg.): Oskar Pastior, 70
Akzente, 1997
Herta Müller: Minze Minze
Die Zeit, 17.10.1997
Franz Mon: „die krimgotische Schleuse sich entfächern zu lassen“
Der Literaturbote, 2004
Jörg Drews: Eros & Callas?-: Ein Echo-Kollaps
Süddeutsche Zeitung, 20.10.1997
Zsuzsanna Gahse: Schwitt, Schwitter, am Schwittersten
Stuttgarter Zeitung, 20.10.1997
Harald Hartung: Jalousien aufgemacht!
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.10.1997
Paul Jandl: Die Hosenträger der Erkenntnis
Neue Zürcher Zeitung, 20.10.1997
Cornelia Jentzsch: Gimpelschneise in der Winterreise
Berliner Zeitung, 20.10.1997
Dorothea von Törne: Der Meister der Wortlust
Der Tagesspiegel, 20.10.1997
Ernest Wichner: Magier der Vernunft
Frankfurter Rundschau, 20.10.1997
Thomas Krüger: hart pommern die fritten
Die Woche, 31.10.1997
Gerhard Mahlberg: Aus Anlaß seines 70sten Geburtstags am 20. Oktober
Deutschlandradio
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Thomas Kling: Die Ballade vom defekten Kabel
Literaturen, 2002, Heft 10
Thomas Kling: Die glühenden Halden
Frankfurter Rundschau, 19.10.2002
Nachrufe auf Oskar Pastior: NZZ ✝ FAZ ✝ BZ ✝ Der Tagesspiegel ✝
Die Welt ✝ der Freitag ✝ die horen 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ✝ AdK ✝
Chimaere ✝ Schreibheft
Weitere Nachrufe:
Nico Bleutge: Ein Verwandlungskünstler der Sprache
Stuttgarter Zeitung, 6.10.2006
Michael Braun: Vom Sichersten ins Tausendste
Basler Zeitung, 6.10.2006
Michael Krüger: Schamane des Experimentellen
Süddeutsche Zeitung, 6.10.2006
Christine Lötscher: Er verzauberte die Sprache und Menschen
Tages-Anzeiger, 6.10.2006
Martin Lüdke: Aus dem Staub gemacht
Frankfurter Rundschau, 6.10.2006
Peter Mohr: Ein Magier der Sprache
Badische Zeitung, 6.10.2006
Lothar Müller: Der Zungenzwinkerer
Süddeutsche Zeitung, 6.10.2006
Hubert Spiegel: Im Exil bei Freunden
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.10.2006
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG + Archiv +
Internet Archive + Kalliope + IMDb + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1, 2 & 3
und zum IM Stein Otto
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 +
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Oskarine ist ein Gedicht-Generator von Ulrike Gabriel, der auf den Gedichten von Oskar Pastior basiert. Jedes Gedicht spricht sich selbst – immer neu und mit der Dichter-Stimme.


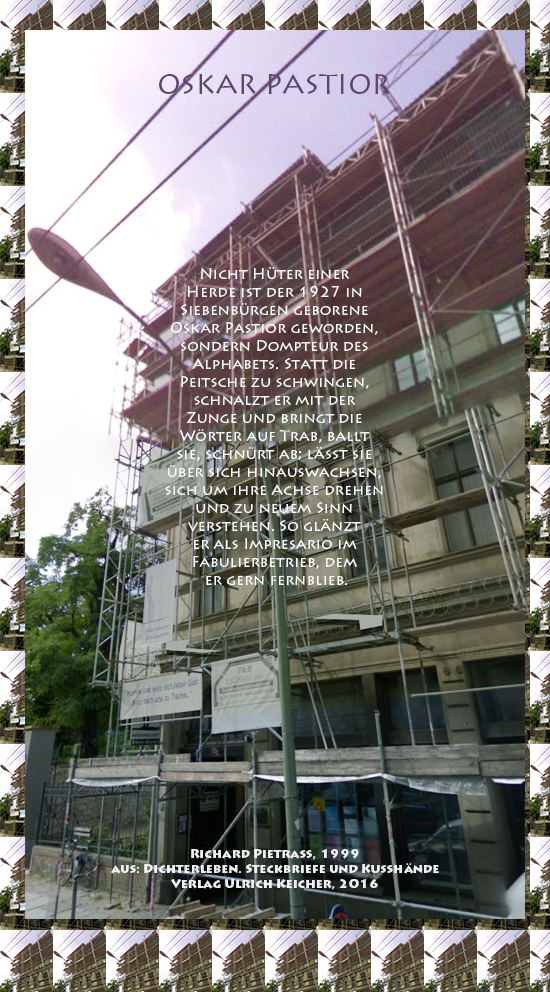












Selbstvorstellung
Anläßlich der Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
In der Vorstellung, mich – oder gar mich mir – vorzustellen, mischt bereits diese Wörtlichkeit, „etwas hätte sich da, womöglich schützend, vor etwas anderes zu stellen“, mit; die ihren Willen hat; vor den ich mich nun stelle.
Unter Hintanstellung solch retardierender Momente tritt das Gesagte hinter dem noch nicht Gesagten zurück. Wo Text entsteht, schieben Auge und Ohr ihn weiter. Am Defizit, das sie dabei erzeugen, hangeln sich beide entlang, stereo, das ist der Abfall des Auges vom Licht und der Abfall des Ohres von der Akustik – niederländische Gepflogenheiten.
Ich möge mich Ihnen fünf Minutenlang vorstellen.
Krause Gedankengänge aus den Gehörgängen einer weitaus längeren Schreibzeit, hinter der ich stehe, schieben sich in die Vorstellung, Sie, verehrte Damen und Herren, könnten „mich“ für „wahr“ nehmen – oder fürwahr für das Schilderhaus an irgendeinem Grenzbaum zum Schinderhannes; eine Lesart, die ins Geheimverlies der Poesie gehört, wo sich die Grenzgänger treffen. Dies Schmuggelgut etwa verdank ich Friederike Mayröcker.
Mit den Vorgaben sind uns die Wörter gleich aus der Hand genommen. Drei bis vier Parameter – und die Konstruktion fällt zusammen. Am Skandal des Anfangs (das ist der Lärm, der da entsteht) brechen sich die Zähne ihre Buchstaben aus, sechsundzwanzig an der Zahl, bei uns; und ich weiß nicht, wo der Text beginnt.
Hätte der Lebenslauf ein Vokabular in dem sich nichts wiederholt, käme es nur auf die Niederschrift der Reihenfolge an, ginge nichts flöten dabei, könnten die Roßtäuscher dicht machen, wäre ich einer von ihnen. Vor Stilisierung hilft nicht mal der Irrealis.
Was, wenn dann das farblose „und“, wiederholte es sich doch, grell und bunt zum ersten Fremdkörper würde – und damit zum letzten Wort?
Wo Muttersprache im Geruch von Brosamen steht, stelle ich mir vor, läuft der Text auf Abspeisung hinaus. Mit dem Vaterland kommt es zum Prozeß. Nachher ist Guttapercha im Schuh. Mutwillig (d.h. wie in jedem Text, der mir näher ist als Hämoglobin) ergäbe das ein Pfund läuseknackender Busen mit Stechnadeln und Anfechtung. Gedämpft wird anderswo (Klammer: gestorben). Dazugehört wird hier. Ein Jahrfünft im Donbas, lesend – wer? Beziehungsweise – was? Mach Ernst, mach mach, mach Überschall, Vitello Tubs. Lenins Abrechnung galt mir, dem Involvierten; der trotzdem seither nie genau begriffen hat, was Ismen sind (Empiriokritizismus!) und wie sich Macht und Ohnmacht im Auseinanderlaufen des Sprachkörpers in Machtkörpern zueinander verhalten. Uneinsichtig hungernd wider die bessere Wahrscheinlichkeit freilich, all die Begriffe, und die Stammsilbe könnte von Chlebnikov sein. Ein Organ, das dumm die Welt ist, die es sich ertastet, aber gewitzt (siehe Überschall, Bauernschläue, Stülpnagel) noch vor der Erkenntnis das Wissen hinter sich gelassen. Was ist das nun? Im Dampfkessel der Einzelfall. Wenn es Grammatik gibt, dann hier. Ach, die Populärwissenschaft.
Die heillose Zerfransung, der Rückfall in die Chance. Mai 1968. Aus Bukarest, über Wien gekommen, von Internationes sozusagen „mit dem Fahrstuhl in die Frühjahrstagung“ nach Saarbrücken „gebeamt“; nun also als Schnuppergast bei den Herren von Sprache und Dichtung. Du bist noch nicht wach! – auch so ein erster Tag, selbst wenn er inzwischen gute zwanzig Jahre dauert und sich als Anekdote unverdient erzählen läßt wie ein Statement, etwa, zu anderen Dingen wie „Heimat“, „Sprache“ oder gar „Exil“. Mißverständnisse, für die ich mich rechtfertige, indem ich mißverständlich schreibe. Man könnte sagen, Übergriffen des Begriffs, dem ich gewiß nicht überlegen bin, begegne ich mit einem Kraut für das noch nichts gewachsen ist. Ausflucht ins Einbezügliche vielleicht, ein fremdes Territorium auf eigenem Gebiet, eben ein Irrtum.
Die Vorgabe, mich hier in einem Limit vorzustellen, ist beruhigend arbiträr. Ich könnte zappeln wie ich will – Vorstellung ist Vorstellung.
Komm, du bist nicht wach. Deine Kondition ist List und Sägemehl – die ungarische Variante des Abfalls.
Nur, wenn ich mich in einem weitaus längeren Zusammenhang nun zappeln höre, stellt sich die Chose (causa, das öffentlich Verhandelte) so und nicht anders dar: „da steht es und das ist es“ (Zitat Gisela Lindemann).
Ich stelle mir wie Ihnen vor: eine Sprachverfassung, in der die Not „sich vorzustellen“ aufgehoben wäre in der Wörtlichkeit von Namen.
Stelle mir einfach vor: ich trüge meinen Namen nicht, ich werkelte an ihm – meinetwegen zirka fünf Minuten hier, in einer nun doch etwas ausgefransten Sprachgeschichte.
Oskar Pastior 1989, aus: Michael Assmann (Hrsg.): Wie sie sich selber sehen. Antrittsreden der Mitglieder vor dem Kollegium der Deutschen Akademie, Wallstein Verlag, 1999.