César Vallejo: Gedichte
ZU GRABE LÄUTET DER ZWEITE NOVEMBER
Diese Stühle sind eine gute Zuflucht.
Der Zweig der Vorahnung weht,
geht, kommt, schwankt, schweißbedeckt,
ermattet, durch dieses Zimmer.
Traurig läutet der zweite November zu Grab.
Ihr Toten, wie tief grabt ihr euer Gebiß ein,
das ausgelöschte, bis es den blinden Nerv berührt,
ohne an das harte Gewebe zu denken,
das die runden Arbeiter flicken, singend,
flicken mit endlosem Hanf, Knoten
schlagen und zuckende Kreuzstiche ohne Zahl.
Ihr Toten mit den schimmernden Knien,
durch Ergebung geläutert,
wie schneidet ihr in das andere Herz
mit euren weißen Kränzen. Euch fehlts
an Herzlichkeit. Ja, ihr Toten.
Traurig läutet der zweite November zu Grab.
Und in den Zweig der Vorahnung
verbeißt sich ein Karren, der einfach
die Straße heraufgerollt kommt.
Nachwort
Santiago de Chuco liegt dreitausendeinhundertundfünfzehn Meter hoch über dem Meer, in einem entlegenen Seitental der peruanischen Cordillera. Eine schmale, staubige Landstraße war vor siebzig Jahren die einzige Verbindung des Ortes mit der Außenwelt. Sie ist es heute noch; über ihre endlosen Haarnadelkurven kriechen die Lastwagen, die das Erz aus den primitiven Kupferminen, den Blei- und Wolframgruben der Provinz zur Endstation der Stichbahn bringen, die fast hundert Kilometer weit talwärts liegt. Die Bahn führt zu einem kleinen Erzhafen an der pazifischen Küste. Auch das Schlachtvieh von Santiago de Chuco wird dort verladen, der Weizen, der Schinken und der Käse; dazu ein paar Kisten voll Strohwerk, Sattler- und Töpferarbeit. Davon leben die Einwohner von Santiago; heute sind es viertausend, gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts waren es halb soviel. Die Reise nach Lima ist weit, sie dauert vier bis fünf Tage; die Hauptstadt liegt fünfhundert Kilometer weit im Süden. Während der Regenzeit gleicht Santiago einer Falle: die einzige Landstraße ist dann wochenlang unpassierbar. Nur vierzehn Häuser haben elektrisches Licht, die allermeisten sind ohne Trinkwasser und Kanalisation. Auf den engen, wirr ineinandergeschachtelten Dächern der Stadt – denn als Stadt fühlt sich Santiago – wächst Gras. Das nächste Telefon steht in Otuzco. Ein guter Reiter kann es in zwei Tagen erreichen.
César Vallejo hat seinen Geburtstag nie gefeiert. Er wußte zeit seines Lebens nicht, wie alt er war. Eine zulängliche Biographie gibt es nicht; sie wird nie geschrieben werden. Weite Strecken dieses legendären und exemplarischen Daseins werden immer in jenem Dunkel liegen bleiben, in dem Vallejo gelebt hat: die im Dunkeln sieht man nicht.
Als sein Name nach dem zweiten Weltkrieg, nach zehnjähriger Vergessenheit, in einem jähen Nachruhm aufleuchtete, der ihn zuerst über Lateinamerika, dann über die ganze Welt getragen hat, machten sich die Literaturhistoriker des Kontinents an die Arbeit. Schon das erste Datum, mit dem sie es zu tun hatten, zeigte sich widerspenstig. Zwischen 1892 und 1898 schwanken die Angaben über Vallejos Geburtsjahr. Ein zäher Gelehrtenstreit, geführt mit scharfsinnigen Hypothesen, komischer Akribie und pedantischer Erbitterung, heftete sich an dieses Detail; man scheint sich heute auf das Jahr 1892 geeinigt zu haben. Über Tag und Monat aber hadert die Vallejo-Forschung bis heute mit einem Eifer, der astrologisch anmutet. Es ist, als hätte sie sich von ihrem Gegenstand anstecken lassen, als wäre sie vom Dämon jenes Aberglaubens ironisch heimgesucht, den Vallejo, der Atheist, nie aus seinem Gemüt zu vertreiben vermocht hat.
Er war ein Mestize wie die Mehrzahl seiner Landsleute, wie fast alle Einwohner Santiagos. Seine Großmütter waren Indianerinnen vom Stamm der Quechua, seine Großväter aber zwei spanische Priester: Vallejos Stammbaum ist der Stammbaum Perus. Sein doppeltes Erbe hat er nie verleugnet.
Aufgewachsen ist er als der Jüngste von elf Geschwistern im Hause seines Vaters, der ein geringer Verwaltungsbeamter war. Dort war das Leben arm, patriarchalisch, nüchtern, doch nicht ohne Anstand und Wärme. So, zwischen Entbehrung und Würde, Ehrbarkeit und Bedrückung hat das vorindustrielle Kleinbürgertum, bevor es aufgeschwemmt oder zermalmt wurde, überall, auch in den peruanischen Anden, gelebt.
Mit neunzehn Jahren tauchte er in den Städten auf. „Er glich einem entblätterten Baum“, sagen seine Freunde, und auf alten Photographien sieht man einen melancholischen jungen Mann, mager, sehr dunkelhäutig, dunkel gekleidet, über dem steifen weißen Kragen eine weiche, pechschwarze, riesige Mähne, das Profil stark und hieratisch, die Hände groß, kalt und knotig, das Gesicht beherrscht von großen schwarzen Augen, glänzend wie Tollkirschen.
Erst in Trujillo, dann in Lima studiert er Literatur und Jurisprudenz. Er zieht in das erste jener elenden Hotels ein, in denen er bis zu seinem Tod leben wird; sein Anzug glänzt, er ist zu oft gebügelt worden; er hat kein Geld. Sein Brot verdient er sich als Volksschullehrer, ab und zu hilft er in einer Zuckerfabrik. Die Salons öffnen sich ihm nicht. Hinter den zauberhaften Fassaden aus der Kolonialzeit ist die triste Arroganz einer anachronistischen Aristokratie zuhause; der schöne Wappen- und Gitterschmuck der Stadthäuser deckt den bornierten Feudalismus, der Peru regiert. Der Provinzler aus Santiago kommt in die Hauptstadt und findet die Provinz noch einmal, matter und unbarmherziger. Die Universität: ein Museum der kulturellen Verzögerung. Descartes gilt als die avancierteste Position des Rationalismus, Auguste Comte als Ausbund der Gewagtheit und Proudhon als satanischer Ketzer. Hoffnungslos wie die Verhältnisse ist der Widerspruch, der sich gegen sie erhebt: die Bohème von Trujillo und von Lima. Wie ein skandalöses Gerücht vernehmen die akademischen Proletarier des Landes die Stimmen Verlaines und Baudelaires. Sie lesen Whitman, Julio Herrera y Reissig und den Propheten der modernen lateinamerikanischen Poesie, Rubén Darío aus Nicaragua, an dessen lyrische Schattenschwäne, Gold- und Elfenbeintöne mancher Vers in Vallejos erstem Buch erinnert. Bohème aus zweiter Hand, unfruchtbar und ohne Ausweg… Nichts erinnert an ihre vergessenen literarischen Duelle, an ihre betrunkenen Eskapaden, ihre erotischen Abenteuer und ihre Selbstmordversuche. Nur ein Smith & Watson-Revolver, der sein Ziel verfehlt hat, geistert durch die Erinnerungen seiner Zeitgenossen an Vallejos traurige Jugend.
Um das Jahr 1915 gab es in Peru, wie in allen südamerikanischen Ländern, Dichter zu Hunderten. Damals wie heute zählte die Literatur dort zu den bevorzugten Gesellschaftsspielen. Aber gab es überhaupt eine spezifisch peruanische Literatur? Sie war ein Gespenst. Freilich fehlte es an Versuchen nicht, dem epigonalen Wust, der Imitation europäischer Muster etwas Eigentümliches entgegenzusetzen: indigenismo hieß die Parole derer, die es versuchten, das will heißen: eingeborene Literatur. Auch sie war, ohne es zu wissen, ein Derivat europäischer Ideen von Rousseau bis Wundt, nämlich folkloristische Geisterbeschwörung. Der Indio diente ihr als Ornament, das präkolumbianische Zeitalter als Dekor, das Besondre des eigenen Landes als exotischer Reiz à la Salammbô.
Als im Jahr 1918 Die schwarzen Boten in Lima erschienen, ein Buch (und vielleicht das erste), das wahrhaft Stoff vom Stoff und Geist vom Geist dieses Landes ist, erkannte sich Peru in ihm nicht wieder. Diese Gedichte erschienen trotz der modischen Spuren von Symbolismus, die sich darin finden, fremd und erratisch in den Konventikeln der Hauptstadt. Gerade seine eingeborenen Züge machten sie unkenntlich: ihr grenzenloser, ganz und gar unliterarischer, nämlich indianischer Pessimismus, ihre amorphe und chaotische Stärke, ihre Besessenheit vom Leben der unbelebten Dinge, der animistische Rest, altertümlich und neu. Gewiß, Vallejo spricht die Sprache des Aberglaubens, die Sprache der zerbrochenen Spiegel, der erlöschenden Kerzen, der flüsternden Meerschweinchen. Die Welt voller Zeichen: die Eule auf dem Dach, das Salz auf dem Tisch, der schwarze Karren auf dem Weg, der Hanf, die Glocken, die Spinnen sind Figuren in einem Buch der Natur, das seiner Entzifferung harrt. Vallejo liest darin und schreibt; es wird erzählt, er habe sich als Kind die Mitra gewünscht. Ein Bischof ist nicht aus ihm geworden, aber ein Augur, halb Medizinmann, halb Prophet.
Er ist ein Opfer seiner Ahnungen; von seinem Unheil scheint er zu wissen, längst ehe es eintrifft. Im Juli 1920 kehrt Vallejo nach Santiago zurück, um seine Eltern zu sehen und die Fiesta zu feiern. Er gerät in eine jener blutrünstigen Kabalen, an denen die große und die kleine Politik Lateinamerikas es nie hat fehlen lassen: ein obskurer Skandal, ein korrupter Bürgermeister, betrunkene Gendarmen, eine erregte Menge, ein paar Schüsse, ein paar Kannen Petroleum, schließlich Verhöre, Steckbriefe und Haftbefehle. Neunzehn Einwohner von Santiago werden wegen Raub, Mord, Brandstiftung und Aufruhr angeklagt, unter ihnen César Vallejo. Er flieht und verbirgt sich, er wird ergriffen, ins Gefängnis von Trujillo gebracht und hundertdreißig Tage lang ohne Prozeß gefangengehalten. Dann wird er wegen erwiesener Unschuld freigelassen, das Verfahren schleppt sich noch bis 1929 fort und verliert sich dann im Staub der Akten.
Vom Trauma dieser Erfahrung hat sich Vallejo sein Leben lang nicht befreien können. Eine poetische Ungerechtigkeit liegt darin, daß er, der jede Ordnung, die er fand, als scheinhaft und betrügerisch verwarf, wegen eines Aufruhrs verfolgt wurde, an dem er unschuldig war. Mit dem unverbindlichen Widerspruch der Bohème war es vorbei; aber es ist, als hätte er die anarchistische Revolte nicht gewählt, sondern erduldet. Er ergriff sie nicht, er ertrug sie mit dem abgrundtiefen Fatalismus seiner Rasse.
Das geistige Klima Perus hatte sich zu Anfang der zwanziger Jahre verändert. Die Unruhe Europas war bis in die ferne Echokammer der Provinz gedrungen. Die aufgeweckten jungen Leute von Lima fingen an, von allerlei neuen Ismen zu sprechen: hie Ultraísmo und Creacionismo, hie Futurismus und Dada. Durch die ökonomische Krise, die das Land nach dem Krieg erlitt, schien die alte Herrschaft erschüttert. Die mexikanische Revolution rumorte in den Köpfen. Im Klima einer ungenauen Provinz-Avantgarde sprach sich Vallejos Name zum ersten Mal herum: er war berüchtigt, fast berühmt.
Diesen Ruf verdankte er seinem zweiten Buch, einem Gedichtband, der den seltsamen Titel Trilce trug, das heißt: drei Sonnen, auch drei Sonnentaler. Ein Buch des Bruchs, der Revolte; ein Buch, von dessen Explosionen sich die traditionelle Ästhetik in Peru nie wieder ganz erholen sollte. Kein politischer Sinn war ihm auf die Stirn geschrieben. Es ist ein Zeugnis bodenloser Grübelei, selbstquälerischer Enttäuschung und individueller Frustration. Daß es als Angriff aufs Bestehende verstanden wurde, liegt allein an seiner unerhörten Sprache. Sie ist völlig autonom, weder von einheimischen Konventionen abhängig noch von den neuen Mustern der europäischen „Bewegungen“. Sie verstößt gegen alle Regeln, bis zur Gewaltsamkeit. Der Dichter ist nicht ihr Gärtner, er ist ihr Demiurg. Trilce ist ein zutiefst erfinderisches Buch. Seine technischen Mittel, bewußter Solözismus, Entstellung gebräuchlicher Wendungen, Doppelsinn, semantischer Sprung und syntaktische Verschiebung, sind überraschend reich und neu. Ein verborgenes System von metaphorischen Schlüsseln geht durch das ganze Buch. Was es vor den gleichzeitigen und analogischen Erscheinungen Europas auszeichnet, ist jedoch die dauernde Spannung zwischen höchst artifiziellen und ganz alltäglichen Momenten in seiner Sprache. Vallejo ist des raffinierten Kunstdialektes spanischer Herkunft, der Sprache Quevedos und Góngoras, ebenso mächtig wie der elementaren Ausdrucksweise der Peones. Das Ineinander von extremer Kunstsprache und vernutzter Redensart ist seiner Poetik nicht äußerlich; es macht ihren Kern aus.
Vallejos Flucht nach Paris, eine Flucht ohne Wiederkehr, war seit 1920 für ihn beschlossene Sache. Die europäische Emigration ist für die schöpferische Intelligenz der südamerikanischen Länder von jeher eine Versuchung gewesen; viel von ihrer Kraft ist an ein vages Weltbürgertum verlorengegangen. Alle Wege scheinen für sie, heute noch, nach Paris zu führen, das in Buenos Aires und La Paz, in Managua und Lima nie aufgehört hat, als das Gravitationszentrum der Alten Welt zu gelten. Vallejo freilich ist nicht vor seiner Herkunft geflüchtet, nicht vor seinem Peru, das Santiago de Chuco hieß, sondern vor Lima, der Hauptstadt aus zweiter Hand, dem trüben Sammelbecken brackigen Ehrgeizes und abgestandener Erfüllungen. Das Wort Provinz hat zwei Bedeutungen, die einander entgegengesetzt sind: es bedeutet das Abgeleitete und Zukurzgekommene, die gesellschaftliche und kulturelle Schimmelbildung – in Vallejos Augen: Lima – und das Autochthone, die Substanz der Herkunft – das war die Landschaft der Sierra und der Alltag der armen Leute in der dünnen Luft der Anden. In diesem Sinn ist César Vallejo ein Provinzler geblieben, solange er lebte. Er war kein Kosmopolit; sein Peru nahm er mit in jedes Exil.
Was ihm bevorstand, er ahnte es: „Gewöhne dich daran“, sagte er zu einem Freund, der ihn begleitete, „wenig zu essen. In Paris werden wir von Steinchen leben.“ 1923 kamen sie an, und es begann die fürchterliche Litanei der elenden Hotels, der billigen Quartiere links der Seine: Hôtel Ribouté, Hôtel des Éscoles, rue Garibaldi, rue Molière, rue Delambre, Avenue du Maine; das Ritual jener Misere, die Paris für die Geblendeten bereithält, die sich ihm verschreiben: Petroleumkocher, verschmierte Treppenhäuser, schmutzige Bidets; Verlassenheit und Cafard. Dazu das Joch des Journalismus, in das sich Vallejo begab. Er schrieb für das Bureau des Grands Journaux Latino-Américains. Mochten die Zeitungen groß sein, ihre Honorare waren es nicht. „Briands direkte Diplomatie“, „Der Pariser Autosalon“, „Interview mit Poincaré“, „Isadora Duncans Begräbnis“, „Die Meister des Kubismus“ – Artikel zu Hunderten, hastig und febril geschrieben, dazwischen Wochen, in denen er sein winziges Hotelzimmer nicht verließ. Es war freilich die große Zeit der Cafés vom Montparnasse. Im Dôme und in der Rotonde begegnete er Picasso und Gris, Tzara und Diego, Huidobro und Neruda, nahm teil an den Erregungen der Epoche, den konvulsivischen Debatten um den Surrealismus und die Volksfront, saß in der Tischecke dabei, verschlossen, großherzig, ohne Eitelkeit, ein düsteres Kind mit den Augen eines verurteilten Mannes.
Der Kommunismus war für einen Mann wie Vallejo, im Paris der Weltwirtschaftskrise, kein Problem. Er hat ihn nicht gewählt. Der Kommunismus traf ein für ihn wie andere, wie alle seine Ahnungen. Keine Rede von einer Bekehrung; eher ein langsamer, aber unwiderstehlicher Sog, dessen zunehmende Kraft an Vallejos journalistischem Tagwerk ablesbar ist: „Über die proletarische Literatur“ (1928); „Die Lektionen des Marxismus“ (1929); „An der russischen Grenze“ (1929). Er hatte diese Grenze 1928 zum ersten Mal überschritten. Ein Jahr später besuchte er die Sowjetunion zum zweiten Mal – ohne irgendeine Unterstützung der sowjetischen Regierung anzunehmen, „als parteiloser Schriftsteller“, wie er selber sagt. Aber das Buch, in dem er über diese Reisen berichtet, hat ein Begeisterter geschrieben; einer, der im Kommunismus die einzige Hoffnung sah. (Ursprünglich wollte er es nennen: „Die Entdeckung der Welt“; erschienen ist es unter dem Titel Rußland 1931. Reflexionen zu Füßen des Kreml im Madrid der jungen Republik.)
Die Hoffnung galt den andern; für sich selbst hegte er keine. Solidarität war für Vallejo kein Fremdwort, sondern eine Leidenschaft, die bis zum Leiden ging, bis zur Preisgabe seiner selbst. So hat er nicht gezögert, seine Poesie zu verleugnen in dem rührenden Versuch, einen „proletarischen Roman“ zu schreiben. Wolfram – so heißt er – handelt von den Deklassierten, den Armen und Beleidigten Perus. Es findet sich darin das Gespräch eines Arbeiters mit einem Intellektuellen. Darin scheint der Held des Buches zu seinem Autor zu sprechen:
„Es gibt nur eines, was ihr, die Intellektuellen, für die armen Peones tun könnt, wenn ihr uns wirklich helfen wollt: tut das, was wir euch sagen, hört auf uns, gehorcht unsern Anweisungen und unsern Interessen. Das ist alles. Das ist die einzige Art, auf die wir miteinander reden können, jedenfalls heute. Später werden wir weitersehen. Dann wird es unter uns zugehen wie unter Brüdern. Aber heute müssen Sie wählen. Wählen Sie!“
Vallejo hat gewählt, nicht aus Linientreue, sondern aus Solidarität. Ob er jemals Mitglied der Partei geworden ist, scheint zweifelhaft. Ein Kommunist nach dem Herzen der Kommunisten wäre nie aus ihm geworden. Er wußte nicht, was Taktik war. Seine Naivität war stärker als jede Doktrin. Die politische Lehre war eine Rationalisierung seiner Kondition und seiner stärksten Wünsche, die immer den anderen galten; daher die utopische und religiöse Färbung, die sein Kommunismus verrät. Er ist von seinem eignen, alten und dunkeln Blut getränkt, nicht vom frischen Blut des Stalinismus.
Am 29. Dezember 1929 wies die rechtsgerichtete Regierung Tardieu Vallejo als unerwünschten Ausländer „wegen seiner Zugehörigkeit zu kommunistischen Kreisen“ aus Frankreich aus. Er ging mit seiner Frau Georgette nach Spanien. Dorthin war er schon drei Jahre vorher eingeladen worden: die spanische Regierung hatte ihm ein Stipendium angeboten. Trotz seiner Armut hatte Vallejo es ausgeschlagen, weil er in Primo de Riveras Diktatur nicht leben wollte.
Seine Madrider Jahre waren vielleicht die glücklichste Zeit seines Lebens. Er entfaltete eine erstaunliche politische und literarische Aktivität. Er sah den Sieg der Republik, bei deren Ausrufung er zugegen war; er gewann die Freundschaft von García Lorca, José Bergamin, Rafael Alberti, Antonio Machado, Pedro Salinas und Luis Cernuda; auch Unamuno ist er begegnet. Außer dem Rußlandbuch und dem Wolfram-Roman schrieb er eine Erzählung, mehrere Dramen, die nie aufgeführt worden sind, und zahlreiche Essays. Zum ersten Mal fühlte er sich auf einem Platz, wo er nützliche und sinnvolle Arbeit leisten konnte.
Was ihm Spanien bedeutet hat, sollte sich 1936 zeigen, als die Faschisten sich gegen die RepubIik erhoben. Vallejo war nach Paris zurückgekehrt, in die alte Misere. Seine Verträge mit dem Zeitungs-Syndikat hatte er wegen seiner politischen Haltung eingebüßt. Er lebte monatelang von Reis und Kaffee. Die spanischen Ereignisse verfolgte er, sie verfolgten ihn so erbarmungslos, daß seine Gesundheit zugrunde ging. Die Republik wollte ihn als Propagandisten nach Südamerika entsenden; er weigerte sich, das Geld des kämpfenden Landes anzunehmen und, blieb in seiner Matratzengruft.
Die Poesie, die er jahrelang fast vergessen hatte, brach in dieser Zeit mit vulkanischer Kraft neu hervor. Sie kreiste um Spanien. Spanien, nimm diesen Kelch von mir heißt das Buch, das er damals schrieb; die Soldaten der republikanischen Miliz sollen es im Feld gesetzt und auf primitives, selbstgeschöpftes Papier gedruckt haben. Die Rohbogen gingen im Zusammenbruch der katalonischen Front unter.
Das Spanien, von dem diese Gedichte heimgesucht sind, ist keine Figur auf dem Schachfeld der internationalen Politik, sondern ein neues Israel; sie künden nicht von einer ideologischen Auseinandersetzung, sondern von einem Martyrium, von Spaniens babylonischer Gefangenschaft und seiner fernen Erlösung. Ihre Inspiration ist keine Idee, sondern eine Erfahrung: die Erfahrung des Schmerzes.
Keine Philosophie begründet und trägt Vallejos letztes Werk, die Poemos humanos. Doch läßt sich nur philosophisch sagen, was der Schmerz darin bedeutet: er ist nicht Thema, sondern Existential, wie Kierkegaards Verzweiflung, Sartres Ekel. Er ist das Wesen aller Furien seines Lebens, die sich in diesen letzten Monaten um sein Bett versammeln. Ihr Blick tilgt aus dem, was er schreibt, die letzte Spur artistischer Attitüden. Das brillante technische Können, das sich in Trilce erwiesen hat, ist selbstverständlich geworden, eingeschmolzen im Feuer des Schmerzes. Das ermöglicht Vallejo, bis zum äußersten zu gehen: zum äußersten Pathos, zum äußersten Sentiment, zum äußersten Humor. Diese Gedichte scheinen wehrlos und sind nicht angreifbar, weil darin Poesie und Existenz zur Deckung kommen. Täuschen wir uns nicht: das ist ein sehr seltener Fall. Alle äußeren Bedingungen künstlerischer Produktivität in unserm Jahrhundert sprechen dagegen. César Vallejo ist zutiefst unzeitgemäß. Unzeitgemäß ist nicht allein die Unbestechlichkeit, mit der er seinen Untergang akzeptierte; unzeitgemäß auch seine Unschuld. So hat er auf dem beharrt, was uns, nach zwei Weltkriegen, nur noch ein Achselzucken wert ist: auf der Solidarität der Toten und der Lebendigen; auf der Armut, die wir für erledigt halten, indes zwei Drittel aller Menschen hungern; auf dem Schmerz, von dem zu sprechen uns anstößig scheint; und auf der Hinfälligkeit unserer Ordnungen, die wir, am Vorabend der Katastrophe, für unverrückbar erklären.
Im März 1938 wurde César Vallejo in ein Krankenhaus am Boulevard Arago eingeliefert. Er war erschöpft und hatte Fieber. Blutproben, Analysen, Röntgenuntersuchungen ergaben keinen Befund. Die Krankheiten, an denen Vallejo litt, waren der Medizin unbekannt. Die eine hieß Spanien, die andere, eine sehr alte, sehr ehrwürdige Krankheit, gegen die kein Medikament zu Gebot stand, war der Hunger. Am Karfreitag 1938 ist Vallejo Hungers gestorben.
Hans Magnus Enzensberger, Februar 1963, Nachwort
Mit César Vallejo (1892?–1938)
hat nicht nur Peru sich in die moderne lyrische Weltdichtung eingeschrieben, sondern die junge Dichtergeneration Südamerikas hat in ihm ihr gerühmtes und angebetetes Vorbild entdeckt. Er ist des raffiniertesten Kunstdialekts spanischer Herkunft ebenso fähig wie der elementaren Ausdrucksweise der Peones. Das Ineinander von extremer Kunstsprache und vernutzter Redensart ist seiner Poetik nicht äußerlich: es macht ihren Kern aus.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1963
César Vallejo 1892–1938
Vor langer Zeit, als es die von der damaligen niederländischen Intelligenz heftig geschmähte Avenue noch gab und ich in voller Freiheit ein paar ihrer Seiten mit Poesie füllen durfte, habe ich einige Gedichte von César Vallejo übersetzt und die folgende Einleitung dazu geschrieben:
Cesar Valléjos Leben beginnt im Ungewissen: Man weiß nicht wann er geboren wurde, nur, daß es irgendwann zwischen 1892 und 1898 war. Gestorben ist er 1938, Karfreitag, aber woran genau, bleibt unklar. An Hunger, sagt Enzensberger, und zweifellos hat Valléjo in seinem Leben immer wieder, vor allem während seiner Pariser Jahre, in wirklicher Armut gelebt und an Hunger gelitten, und das ist wörtlich zu nehmen. Seine ganze Existenz scheint von Not und Leiden durchzogen zu sein, ein Dasein wie in langsam verzehrendem Feuer. Hoch oben in den Anden kommt er zur Welt, in Santiago de Chuco. Zwei indianische Großmütter, zwei, wie es heißt, priesterliche Großväter. Der Ort zählt zweitausend Einwohner, eine Reise nach Lima dauert fünf Tage. Sein Vater ist ein kleiner Beamter – dort oben in den unbarmherzigen Bergen gehört Valléjo noch nicht zu den Getretenen. Das fingt an, als er studiert, zuerst in Trujillo, dann in Lima. Um sein Studium finanzieren zu können, muß er arbeiten, mal in einem Bergwerk, mal als Lehrer. Auf der großen Hacienda, auf der er später Privatlehrer ist, sieht er das Elend der Indianer, Ausbeutung und Erniedrigung durch Körperstrafen. Er liest die spanischen Mystiker, die Großen der kastilischen Literatur, Góngora, Quevedo, aber als sein erster Gedichtband Los heraldos negros (Die schwarzen Boten) erscheint, klingt darin schon etwas ganz anderes durch. Was diese Gedichte so fremd macht, ist ihr „grenzenloser, ganz und gar unliterarischer Pessimismus, ihre amorphe und chaotische Stärke, ihre Besessenheit vom Leben der unbelebten Dinge, der animistische Rest, altertümlich und neu“, wie Enzensberger es ausgedrückt hat. Wenn ich mich diesen Gedichten aussetze – denn einfach „lesen“ kann man sie nicht −, habe ich immer das Gefühl, daß in ihren Worten etwas sehr Altes langsam zertrümmert und zerrieben wird. Die Gedichte selbst sind Leiden. Roland Barthes kommt der Sache am nächsten, wenn er neben dem „Lesbaren“ und dem „Schreibbaren“ als weitere Kategorie das „Empfangbare“ nennt – nicht in diesem Zusammenhang, aber das Gesagte gilt sicher für Valléjos Lyrik. Gemeint ist etwas, das sich als ein Ganzes – bei Valléjo heißt das: einschließlich der anarchischen Syntax, der eigenwilligen Grammatik und der Anspielungen auf Bibel und Aberglauben dem Leser einbrennt, wie ein glühendes Brenneisen oder Siegel. So lesbar, angenehm und auch für Europäer leicht zugänglich die Lyrik Nerudas ist, so eigensinnig, unzugänglich und fremd ist die Poesie Valléjos. Auch 1978 ist der größte Teil seiner Prosa und seiner Dramen noch unveröffentlicht, und zu seinen Lebzeiten sind nicht einmal die großartigen Poemas humanos (Menschliche Gedichte) und seine leidenschaftlichen Gedichte über das Spanien des Bürgerkriegs erschienen. 1920 geht er nach Paris, Peru wird er nicht mehr wiedersehen. Er lebt von nichts, oder von dem, was er hin und wieder mit Artikeln für südamerikanische Zeitungen verdient. 1928 reist er zum erstenmal nach Rußland und spricht mit Majakowski. Es folgen Jahre der Streifzüge durch Europa und eine Irrfahrt durch die billigsten Hotels von Paris. 1931 wird Valléjo Kommunist, nachdem man ihn aus Frankreich ausgewiesen hat; über seine allwöchentliche Anwesenheit bei Versammlungen im Buchladen der Humanité hatte die französische Polizei genau Buch geführt. 1932 gelingt es ihm, wieder nach Frankreich einzureisen. Von da an lebt er – zunächst illegal, später geduldet – wieder in Paris, aber als Spanien schon vom Bürgerkrieg zerrissen wird, kehrt er noch zweimal für kurze Zeit dorthin zurück, zuletzt im Sommer 1937. Er hat dann noch ein knappes Jahr zu leben. Nach anderthalb Jahrzehnten, in denen er keine Poesie mehr hatte schreiben wollen, entstehen in diesen letzten Monaten, genauer gesagt von August bis Dezember 1937, der größte Teil der Poemas humanos und die fünfzehn Gedichte über den Bürgerkrieg, España, aparta de mí este cáliz (Spanien, nimm diesen Kelch von mir). Die gesamte Auflage dieser Sammlung, von republikanischen Soldaten gedruckt, geht im Chaos der Niederlage verloren. Im März 1938 wird Valléjo in ein Krankenhaus eingewiesen. Blutuntersuchungen und Röntgenaufnahmen bringen keine Klarheit über die Art seiner Erkrankung. Er ist erschöpft, hat schwere Fieberanfalle. Schließlich stirbt er, ohne daß die Ärzte die Todesursache angeben können.
In den Niederlanden hat die Rotterdamer Cold Turkey Press die Übersetzung einiger seiner Gedichte in einer hektographierten Ausgabe herausgebracht. Ich selbst habe in De Gids, Jahrgang 1970, Nr. I, ein paar Übersetzungen veröffentlicht. Auf englisch gibt es eine Auswahl in einer Penguin-Ausgabe von 1970, mit dem Titel Selected Poems, außerdem eine ebenfalls zweisprachige Ausgabe der Poemas humanos, übersetzt von Clayton Eshleman, zuerst in den USA bei der Grove Press, später, 1969, bei Jonathan Cape in London verlegt, sicher die beste Ausgabe. In Deutschland sind bei Suhrkamp mehrere Auflagen einer von Hans Magnus Enzensberger übersetzten Auswahl erschienen. Auch diese Ausgabe ist zweisprachig. (…)
Inzwischen gibt es andere Übersetzungen von Valléjos Lyrik. Das Gedicht, in dem er seinen eigenen Tod vorhersagt und beschreibt, wurde von Hans Magnus Enzensberger übersetzt. Es ist aus der Sammlung Poemas humanos und heißt „Piedra negra sobre una piedra blanca“.
SCHWARZER STEIN AUF WEISSEM STEIN
Schwarzer Stein auf weißem Stein
Ich werde sterben in Paris, mit Wolkenbrüchen,
schon heut erinnre ich mich jenes Tages.
Ich werde sterben in Paris, warum auch nicht
an einem Donnerstag vielleicht, wie heut, im Herbst.
Ein Donnerstag wird sein; denn heut, am Donnerstag,
da ich dies sage, tun mir meine Knochen weh;
noch nie wie heute hab ich mich allein
und meinen Weg erblickt von unserm Ende her.
Tot ist Cesar Valléjo. Eingeschlagen
habt ihr auf ihn. Er hat euch nichts getan.
Mit einem Stock gabt ihr ihm Saures, Saures
mit einem Tau. Die Donnerstage
sind seine Zeugen, Zeugen seine Knochen,
der Regen, die Verlassenheit, die Straßen…
Cees Nooteboom, in Cees Nooteboom: Gesammelte Werke Band 9, Suhrkamp Verlag, 2008
Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstler César Vallejo
Zwisprachen I: Steffen Popp über César Vallejo am 18.5.2015 im Lyrik Kabinett München
Fakten und Vermutungen zum Autor + Internet Archive
Porträtgalerie: Keystone-SDA
Nachruf auf César Vallejo: Tumba
César Vallejo – Chronologie von Leben und Werk in Bildern.
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Archiv + KLG + IMDb +
Interviews + Georg-Büchner-Preis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Hans Magnus Enzensberger – Trailer zu Ich bin keiner von uns – Filme, Porträts, Interviews.
Hans Magnus Enzensberger – Der diskrete Charme des Hans Magnus Enzensberger. Dokumentarfilm aus dem Jahre 1999.
Hans Magnus Enzensberger liest auf dem IX. International Poetry Festival von Medellín 1999.


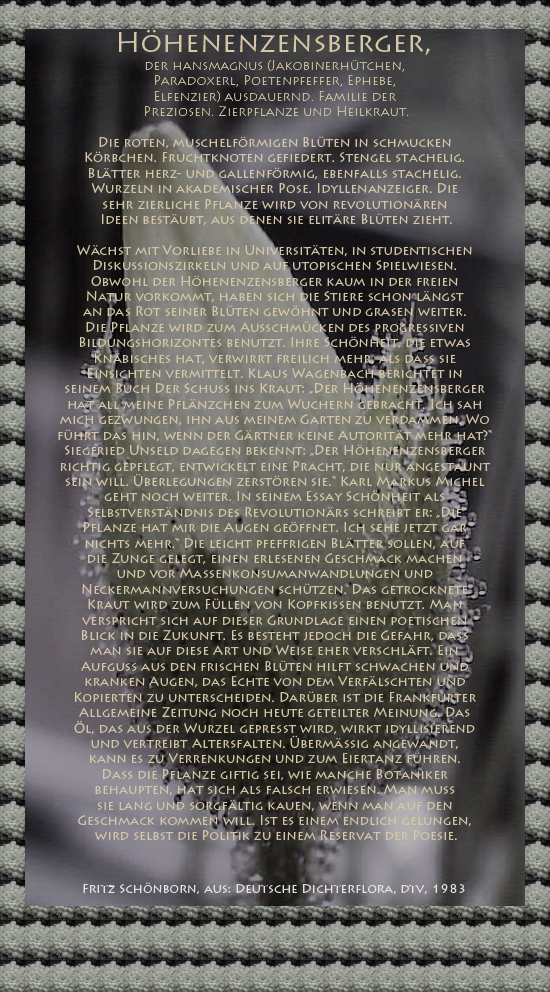
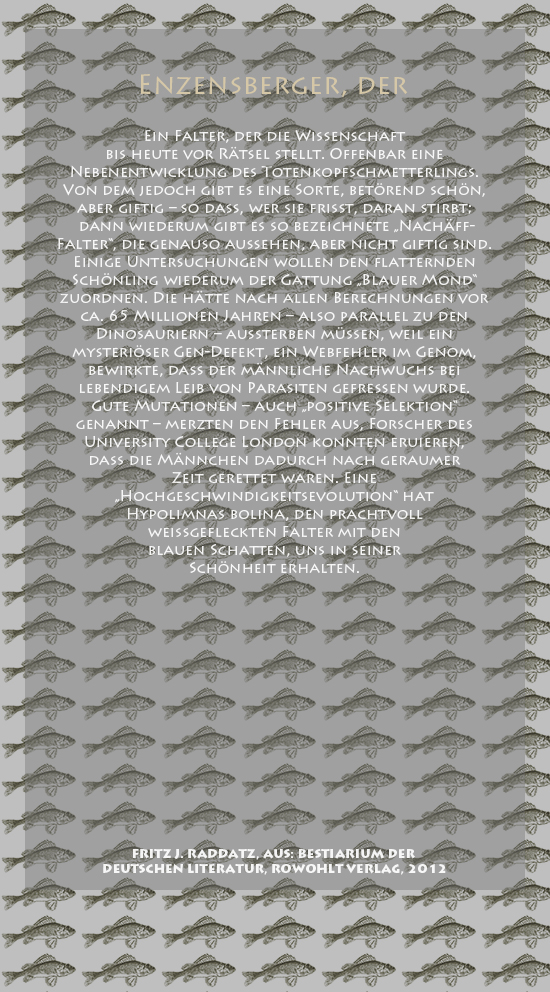












Schreibe einen Kommentar