Elke Erb: Der Faden der Geduld
ÉLUARD, ERINNERT VON NERUDA
Ein Normanne, blau und rosa
Seine Poesie kristallen,
(Seit dem Krieg von neunzehnvierzehn
Zitterten ihm seine Hände.)
Eine Art von Turm, französisch
Jenes leidenschaftlich Lichte,
Und am Rande eines Abgrunds
Sah ich ihn.
aaaaaaaaaa(Der zähneknirschend
Mitging auf der Ferne Wegen,
Fand an einer ihrer Kehren
Dominique, die letzte Liebe.)
Frankreichs Turm. Der Dichter sagte:
„Einsamkeit ist ein Verbrechen.“
Seine Größe war aus Wasser
Und aus Stein, den Stein umflochten
Gespräch mit Elke Erb
… denn künftig, wenn du erwachsen bist, wird es nur noch richtig sein, dich, dich, dich, dich als Angehörige eines Zweckes und einer Zukunft und zugleich als angekommenen, gegenwärtigen Menschen zu sehen und zu behaupten, endlich wie ein majestätisches Ding, sterblich mit einem Wort.
Elke Erb
Christa Wolf: Insistierend, hartnäckig, authentisch: so kamen mir deine neuen Texte vor, als ich sie jetzt, Anfang Februar 77, zum erstenmal las. Treffend in jedem Sinn einzelne Stücke oder Zeilen, Wortgruppen wie: „Alles nagt, was nagen kann“. Unübertrefflicher Ausdruck für ein nur zu bekanntes Befinden. Was aber, frag ich dich und mich, hat die Gestalt des Wolfs damit zu tun, die Ungestalt der Steine? Oder: Wie, auf welchem Weg erwirbst du dir am Ende des Kleist-Texts die schneidende Schärfe dieses einen Schlußsatzes: „Fern im Nahen, im Entfernten nah.“ Vor allem aber betraf mich „auf Anhieb“ jener Text – einer der wenigen dieses Bändchens, die die äußere Form eines Gedichts angenommen haben, den du „Widerspiegelung“ nennst:
Ich seh mich wieder groß an meinen Grenzen
Aufgetaucht, ich hatte mich vergessen,
Vogel, flugs die Grenzen zu verwunden,
Frohlocke ich, die Spiegelscherben glänzen.
Ich hungerte, jetzt will ich wieder essen:
Dies Manna der Verletzungen, die munden.
Da leuchtet bei jeder Zeile das Signal auf: Bekannt! Das Glück, etwas ausgesprochen, dabei aber nicht entzaubert zu sehen… Zugleich aber finde Ich deine neuen Texte ungefällig; nicht entgegenkommend; undurchschaubar; verschlüsselt. „Hermetisch“ sag ich nicht: Hermetisches kann mich nicht provozieren. Aber ich verhehle nicht: Ich glaube eine ganze Anzahl dieser Texte nicht zu „verstehn“. Ich fühle mich unzuständig, nicht einmal imstande – da du ja bereit bist zu antworten −, eingreifend zu fragen.
Elke Erb: Sag mir doch eins: Würdest du die Texte dieses Bändchens auch ohne Auftrag vom Verlag gelesen haben wollen?
Wolf:: Das weiß ich noch nicht. – Was wir hier machen ist unverbindliches Vorgespräch, darauf besteh ich. Ein Versuch, meine Verlegenheit wenigstens zu formulieren – das kannst du verlangen.
Erb: Ein Tonband kann man ja wieder löschen, nicht?
Wolf: Eben. Womit ich anfange, ist zufällig: Ich vergleiche diesen neuen Band – Der Faden der Geduld, ein schöner Titel! – mit deinem ersten Band, Gutachten, der 1975 erschien, und finde – das wird dir töricht vorkommen – etwas wie einen Rückgang, Rückgang wovon? Mußt du fragen. Rückgang wohin? Tastend, ungenau und wahrscheinlich ungerecht sage ich: Rückgang von Kommunikationsfreudigkeit; Rückgang von erkennbaren „Anliegen“. Konzentration, Formulierungsschärfe – das ja. Aber worauf beziehen sie sich? – Undenkbar, zum Beispiel, daß du, wie noch in Gutachten, deine Bedingungen und Bedingtheiten benennen würdest: Dorf, Wohnviertel, Natur, Landschaft; daß du so weit gingest, Namen preiszugeben: den deines Mannes, den eigenen, den eines Freundes; daß Elternfiguren auftauchen, Schwestern… Hier wird nicht mehr erzählt. Die Schilderungen des ersten Bandes erscheinen von der Strenge, der formelhaften Kürze dieser Texte her – wie Ausschweifungen, deren man sich fast zu schämen hätte. Verstehst du, was ich meine?
Erb: Ja. Bei dem Band Gutachten hatte ich noch ein stärkeres Sendungsbewußtsein, ich trat noch mit offeneren Händen oder Augen vor ein Publikum. Bei diesem Band ist es anders. Ich will ihn einfach hinstellen – den Band und jeden einzelnen Text. Vielleicht ist es, unbewußt, ein Verzicht auf das Ansprechen von Leuten; denn das ist ja kindlich, dieses unmittelbare Sich-Aussprechen und Andere-Ansprechen-Wollen in Gutachten. Jetzt bin ich runder oder reifer geworden – ich weiß nicht… Jedenfalls abgeschlossener.
Wolf: Abgeschlossener im doppelten Sinn?
Erb: Eine Blüte öffnet sich, und eine Frucht rundet sich, sie geht in sich zurück.
Wolf: Und wird damit vielleicht auch unzugänglicher?
Erb: Ja. Das ist das eine. Das andere, was diese Texte ausmacht: die größere Nähe zum Gegenstand, zum Material, das ich aufnehme. Ich lasse den Gegenstand manchmal ganz allein stehn.
Wolf: Das nennst du Nähe?
Erb: Ja. Ich mache mit den Gegenständen im Grunde dasselbe, was ich möchte, daß man es mit mir tut: direkt vor mich hintreten, mich sein lassen und mich aufnehmen.
Wolf: Ein neuer Ansatz. Der Kleist-Text, der mir nahegegangen und nachgegangen ist – übrigens, zufällig oder nicht, der längste des Bandes, derjenige auch, den ich am ehesten „episch“ im Sinne von „stoffdarbietend“ nennen würde; der zugleich Fragen zu deiner Ästhetik liefert. Du gibst drei Episoden aus deiner Ablage, drei Stücke, die bei dir „nicht durchgekommen“ sind, deren schwer faßlicher „Kleist-Gehalt“ dich aber weiter beunruhigt. Du stellst sie also hin, läßt sie sich reiben an „Kleist“ – den du, ganz nebenbei, auch hinstellst – und gehst diese drei Rohstoff-, Materialtexte schonungslos an: „Nach einer Kleistschen Anekdote sagt man nicht: Na, und? Ich kann diesen Text nicht so verfassen, daß keiner sagen kann: Na, und? Es ist allzu klar, daß er nichts weiter enthält, nichts von Belang.“ Und, etwas später: „Nicht das Gemeinwesen berührend. Nicht Kleist.“ Und schließlich, in einer Klammer, die ich hier weglasse: „Vielleicht taugen meine Geschichten deshalb nichts, weil sie im Fremden spielen und nicht im Eigenen?“ Ein Selbstverdacht, der mich erstaunte, rigoros, wie er ist.
Erb: Die Frage bezieht sich nur auf diese drei Geschichten, die ich nicht fertigmachen konnte.
Wolf: Ich aber frage, ob du dich nicht auch in anderen Stücken bewußt und konsequent abgrenzt von den Gegenständen – im Gegensatz zu Kleist mit seiner ungeheuren, wenn auch eisern zurückgedrängten Verstrickung in seine Stoffe: das Subjekt aus dem Text treibst. Dich scheust, selber Homburg, selber Kohlhaas zu sein.
Erb: Nein, davon grenze ich mich nicht ab. Das verlange ich gerade. Ich bin in meinen Texten. Während ich die Kleistsche Form aber nicht machen kann. Es ist wahr: Wenn ich selbst eine Geschichte gehabt hätte, die ich kleistisch hätte formulieren können, hätte ich sie wahrscheinlich nicht gemacht. Ich habe tatsächlich eine Scheu vor nicht eigenständigen Formen.
Wolf: Ist es die Form allein? Ist es nicht auch eine Scheu vor dem Bedeutung-Geben? Denn solche Formen wären ja die Formen von Inhalten, die „das Gemeinwesen berühren“. Eine meiner Beobachtungen an deinen Texten: Du beschränkst dich häufig auf Molekularvorgänge von geringer, nicht geringfügiger Bedeutung. Dafür gibt es in diesen Texten allerdings kein beliebiges Wort.
Erb: Weißt du, daß mir der Mut zum ungenauen Wort als eine fast unerreichbare Perfektion moralischer Art erscheint? Verstehst du, was ich meine?
Wolf: Ich denke, ja. Aber es geht wohl nicht um die Alternative: äußerste Präzision in kurzen, geringerer Genauigkeitsgrad in längeren Texten… Es geht um die Grenzen des Sagbaren, die bei jedem anders liegen, ein anderes „Gebiet“ einschließen.
Erb: Ich könnte dir, wenn du wolltest, von jedem Text angeben, welche Arbeit er tut. Welchen Teil des Gemeinwesens er berührt.
Wolf: Dann nimm doch, als Beispiel, einen Text, hinter dem ich eine Bedeutung ahne, ohne ihrer sicher zu sein, nimm „Hinweis auf dem Rückweg“.
Erb: Dieser Text ist umbenannt. Er heißt jetzt: „Das Mitgefühl des Passanten“.
Wolf: Ein Beispiel dafür, wie deine Überschriften an der Pointierung der Texte mitarbeiten.
Erb: Ja. Früher hatte ich übrigens keine Überschriften. Günter Caspar vom Verlag hat sie beim ersten Band verlangt. Seitdem nutze ich diese Möglichkeit, dank Caspar. „Das Mitgefühl des Passanten“. Natürlich „das Gemeinwesen berührend“: Menschen wollen feiern. Dahinter steht die Frage – wie übrigens auch noch in einigen anderen Texten: Wie verwirklicht sich der Mensch. Da wird also, von einem „Passanten“, ein Vorgang angesehen; eine Weihnachtsfeier; wie sich Menschen befinden, wie sie sich verhalten, in bestimmten Grenzen. Da ist kein Mitleid, kein Spott, es ist auch nicht einfach vernichtend: Es geht wirklich um die da. Das ist ihre Weihnachtsfeier. Ich beurteile sie nicht. Ich erlaube mir keinen Ton zu sagen, was eine Weihnachtsfeier sein könnte. Ich gehe so nahe heran, wie es mir möglich ist…
Wolf: Etwas besser glaub ich jetzt zu verstehen deine Dialektik von „Nähe“ und „Ferne“: Ganz nah an eine Sache herangehn bedeutet, ihr nicht zu nahe treten: Sie spricht nun selber für sich. Du willst bis an die Grenze der Gerechtigkeit gehen, man könnte auch sagen: der Vorurteilslosigkeit, der Objektivität. Wo bleibt da das Subjekt? – Daß es vorhanden ist, wird nicht bestritten: Der Ton des Bandes bezeugt es, dieses einheitliche, intensive Sprechen, das Sprechen eines Subjekts, das auf etwas aus ist. Worauf bist du aus? Wovon bist du getroffen?
ERB: Etwas mußt du wissen: Ich schreibe nicht am laufenden Band. Ich schreibe vielleicht jetzt, dann in drei Wochen wieder, dann in vierzehn Tagen. Und jedesmal ist es so, als ob ich danach nicht mehr schreibe, ich weiß nichts von vorher und nachher. Es sind wohl jeweils andere Anlässe, die den Text hervorbringen, wie er aus dem weißen Nichts, wie er aus dem Papier tritt. Ich kann erst anfangen zu reden, wenn ich drei oder vier Worte, wenn ich eine Gruppe habe… Nein, ich weiß nicht, ob es schon Worte sein müssen. Es muß eine spontane Erregung sein. Alle Texte sind spontan.
Wolf: Aber die Art des Getroffenwerdens?
Erb: Um mich zu kennen und zu verstehen, ist es vielleicht wichtig, daß ich dir sage, ich bin, bis ich elf war, auf dem Land aufgewachsen, in der Eifel, und zwar ohne Verwandte. Drei Kinder, die Mutter. Der Vater war im Krieg. Gegenüber drei Bauernhäuser, ganz andere Leute. Ich habe sehr viel Bildung, sehr viel Erfahrung nicht mitbekommen, die der städtische Bürger hat, der mit den Mitbürgern aufwächst und in der Verwandtenclique. Heckenrosen können das niemals ersetzen. – Mit zwölf Jahren kam ich hierher, nach Halle, in die Schule. Da war die Hauptsache die logische Ausbildung in den Naturwissenschaften. Ich war für diese Erziehung ein dankbares Objekt, frei von dem Widerstand einer sinnlichen Begabung (zur Malerei, zur Musik). – Du fragst nach Gründen für einen auf das Molekül fixierten Blick… Nun: Das logische Denken tendiert zur Formel. Dazu dann dieser Norm-Satz: Die Wahrheit ist immer konkret, der zu Logik und Formel eine arbeitende Spannung bildet, aber wie sie streng Genauigkeit und Klarheit fordert. Historische Gründe, im engeren Sinn: Als die Hitler gekommen und gegangen waren, blieb die Frage nach dem Volk, das heißt dem einzelnen. Schließlich: Wir sind aufgewachsen und leben in einer Zeit der öffentlichen Pläne, das heißt der Verwirklichung, das heißt der Ankunft am einzelnen Punkt des Alltags.
Wolf: Mir fällt auf, wie du, ein dialektischer Kopf, Widersprüchliches als Entsprechung behandelst…
Erb: Ein literarischer Grund für die Bevorzugung molekularer Vorgänge ist natürlich die Aussagekraft des Details, die ich sowohl benutze als auch demonstriere: das „Molekül“ als Indiz.
Wolf: Mir erklärt, was du sagst, noch nicht zureichend, warum du bis jetzt darauf beschränkt bist, den Zusammenhang im Einzelnen zu erfassen, und nicht versuchst, das Einzelne im Zusammenhang zu erfassen.
Erb: Warum der Zusammenhang mehr in Voraussetzung und Ziel als im Mittel erscheint? Die Antriebe kann ich nennen, die Schranken nicht. Aber wer kennt seine subjektiven Bedingungen so genau? Immerhin hat mich meine bisherige Arbeit so weit gebracht, daß ich nicht umhinkann, diese Bedingungen zu klären. Ich irre vielleicht in der Annahme, daß sie, die Arbeit, darauf aus war; doch hat es einen anderen Weg für mich sicherlich nicht gegeben, nachdem einmal entschieden war, daß ich nicht Wissenschaftler werde. Ich hatte das will ich noch einfügen – eine sehr lange, antizipierende Jugend, ein sehr langes Studium; es dauerte ewig, bis ich „ins Leben trat“. Außerdem: Das alles war überfrachtet mit Konzeptionen und Theorien, mit Antworten und Strukturen eigentlich. Aber ich wollte „das Letzte“ haben, das, was nicht mehr aufzulösen ist, als ich anfing, freischaffend zu werden, mit einer großen Angst zunächst, aber auch mit einem kleistisch definitorischen Mut… Und diese zwei Dinge hast du bei mir: Einerseits eine harmlose, arglose Treuherzigkeit, die sich auch nicht wehren kann, und andererseits ein Bestreben zu genauer Definition, der man nicht mehr ausweichen kann. Ich gehe einfach die mir möglichen Wendungen, aber die geh ich treuherzig, ohne daß ich wüßte, daß ich sie tatsächlich gehe. Also: Berechnet ist es nicht. Auch nicht verklausuliert, extra schwierig gemacht: das alles nicht.
Wolf: Das glaub ich aufs Wort. Sie kann nicht anders – das ist mein Hauptgefühl bei allem, was du schreibst. Eine Kompromißlosigkeit, die du dir nicht vornehmen mußt… Deshalb würde es mir nicht einfallen, zu „kritisieren“, im Sinne von: insgeheim etwas anderes wünschen.
Erb: Ich meine, daß man nicht sagen kann: Das ist schön, was ich mache. Dieses schöne befreiende Gefühl, Kunst zu erleben, stellt sich wohl nicht ein. Man wird vielleicht angerührt, getroffen, aber das ist etwas anderes…
Wolf: Den Ursachen für die Spannungen in deinen Texten – deinen eigenen Konflikten und Stimmungen – wird nicht erlaubt hervorzutreten. Sachlichkeit soll walten. Ich wüßte gern: Wie gehst du mit dir um in Krisenzeiten.
Erb: Da ist, vor Jahren, die Entscheidung gefallen. Ich hab mir gesagt: Ich kann mich in den Berufen, die es gibt, nicht bewegen. So kann ich diese Formen, die die Menschheit hat, nicht richtig mitvollziehen. Ich bin außerhalb der Form. Und das ist eine Chance und ein Risiko. So ungefähr. Und in dieser Situation ergibt sich ja das Äußerste, was man als konstruktiver Mensch machen kann.
Wolf: Dein Glück, daß dir außer Sensibilität auch Eigensinn mitgegeben ist. Vielleicht sogar die nötige Unbefangenheit gegenüber der Gefahr, der du dich, „treuherzig“, wie du sagst, aussetzt…
Erb: Und jetzt sah ich, wenn ich auf der Straße ging, plötzlich einen Krug und solche Dinge ganz deutlich. Das war, als es anfing, ein großer Sieg für mich.
Wolf: Ein Sieg?
Erb: Daß ich zu den endlichen Dingen gekommen bin – ohne Erklärung, ohne irgendeinen Katechismus. Wahrscheinlich wollte ich – eben weil ich das Risiko bin – so gegenständlich und von mir selbst anerkannt sein, wie so ein Ding ist. Alles, was da ist, empfinde ich als Majestät: Das ist für mich ein wichtiges Wort. Die Majestät des einzelnen Seins. Und was ich tue, das ist: eine Art Würdigung durch das Hinstellen.
Wolf: Du verhilfst „den Dingen“ aber was sind die Dinge?…
Erb: Ich meine damit alles, was geschieht, auch, was geschah…
Wolf: … den Vorgängen, wie sie sind, zu ihrer eigenen Sprache, läßt sie zur Sprache kommen… Ich gebe nur zu bedenken – nicht als Einwand; gegen notwendige Arbeitshypothesen habe ich keinen Einwand −, daß es dem sogenannten modernen Menschen beinah unmöglich ist, zu den Dingen vorzustoßen, wie sie sind: Unser Blick ist durch die Flut der Informationen, die man uns aufzwingt, beeinflußt. Vielleicht, weil du das weißt oder bei der Arbeit merkst, finden sich bei dir so häufig Ur-Vorgänge, archaische Bezüge, vorindustrielle Verhältnisse. – Wollen wir doch ein, zwei Proben aufs Exempel machen. Ich schlage Texte vor, die ich für Schlüsseltexte halte, und bitte, zugegeben, sehr primitiv: Erklär mir das. Zum Beispiel: „Memento“.
Erb: Ja, es ist schon schwierig, das gebe ich zu. Memento. „Mori“ fehlt ja. „Der Held ist empfindlich“ – das ist eine Art Spott, weil ein Mensch doch wissen sollte, daß er stirbt. „Lametta Engelshaar Altweibersommer“… Eine Assoziationskette. Von einer Rührung ausgehend: Lametta.
Wolf: Der Held fürchtet, daß es ihn einmal nicht geben wird.
Erb: Es gibt ihn nicht, in dem Moment, da er diesen Gedanken denkt. Er denkt: Alles bricht zusammen, dann ist er weg. Das ist die Vorstellung „Tod“. Und dann kommt er wieder rein in das „Leben“, indem er fähig wird, selber Dinge in sich verschwinden zu lassen: die Nuß, den Apfel …
Wolf: Dieses Zusammenrücken der Dinge um einen, verbunden mit diesem Vernichtungsgefühl – das kennt jeder.
Erb: Also gut, du kennst es. Aber nehmen wir an, du hast das Gefühl jetzt, in diesem Augenblick, und dann liest du diesen Text!
Wolf: Das wäre dann einer jener „günstigen Augenblicke“, auf die du für deine Texte hoffst.
Erb: Und glaubst du nicht, daß du in einem solchen Augenblick den Text von allein verstehst?
Wolf: Die Möglichkeit räume ich ein. Der Spott wird mir, in Zukunft, vielleicht heilsam sein, Selbstmitleid vertreiben… Vielleicht kann man, von einer solchen Deutung ausgehend, auch manchen anderen dieser Texte – ich will nicht sagen: verstehen; ich will sagen: aufnehmen.
Erb: Und doch müssen wir uns zurückentsinnen auf den Leser, dem nichts erklärt wird. Übrigens: Ich muß bei diesem Band nicht gleich Publikum bekommen, ich kann warten auf das Publikum der Antiquariate.
Wolf: Bist also deiner Sache sehr sicher … Und du kannst auch die Kommunikation mit dem Publikum entbehren?
Erb: Ich brauche sie jetzt, das ist ganz entschieden. Aber das hier mußte ich erst mal machen. Nun muß ich sehn, wo ich stehe, wie sich das reflektiert. Ich bin mit diesen Texten an meine Grenzen gegangen.
Wolf: Davon müssen wir noch reden. Zuerst mal, zweites Schlüsselbeispiel : „Die Gestalt des Wolfs“.
Erb: Das ist ja die Gestalt des Wolfs in „Rotkäppchen“. Ein inhaltlich elendiglich verkürzter Text. Im Grunde ein philosophischer Text. Ein Text über die Überwindung der vorgegebenen Denkformen im Bewußtsein. Äußerlich folgt er ja ganz der Reihenfolge des Märchenvorgangs. Das Märchen als gewohnte Dachstruktur…
WOLF: … aber es führt nicht zur Befreiung, nicht zum „happyend“. – Warum sagst du: „Die Gestalt des Wolfs“, nicht: der Wolf. Eine Vermittlung, Verfremdung, offenbar entscheidend wichtig – auch bei anderen Texten, wo sie nicht ausgesprochen wird.
Erb: Ich weise darauf hin, daß Wirklichkeit nicht unvermittelt uns entgegentritt, sondern interpretiert, zu Märchengestalten, Kunstgestalten, Denkgestalten umgeformt ist, bis das Eigentliche hinter ihnen verschwindet.
Wolf: Denkgestalten, die wir „gefressen“ haben, wie Effeff (du, ich) die Gestalten von Rotkäppchen und der Großmutter: Ich hab dich zum Fressen lieb, das kennt man ja. Wenn ich dich recht verstehe, bewegst du dich weg von vorgegebenen Seh-Rastern, so lieb sie dir gewesen sein mögen, so abhängig du von ihnen gewesen sein magst. Die Gestalt des Jägers operiert dem Helden, Effeff – eine positive Umdeutung des „bösen“ Wolfs −, die Gestalten von Rotkäppchen und der Großmutter heraus, die er doch so schön in sich reingefressen hatte. Ein schmerzhafter Vorgang, das kann man sagen. – Und nun, schreibst du, füllen die Gestalten Effeff mit „Steinen“ – in Anführungszeichen.
Erb: Hier identifiziere ich mich und kann nicht mehr „die Gestalt“ der Steine sagen: die Steine sind ungestalt. Effeff, „befreit“ von den Gestalten, die er „gefressen“ hatte, ist an den Rand geführt. Da wird es ganz schwierig. Die Gestalten hinterlassen Ungestaltes in Effeff. Alles nagt, was nagen kann in Effeff. Der ist, obwohl er Gestalten frißt, ein Held. In ihm ist produktive Kraft. Er muß den Mut finden, mit Ungestaltem umzugehen. Effeff muß selbst gestalten, sich selbst gestalten, sonst verwittern die Steine, machen ihn unproduktiv. Er muß das schaffen.
Wolf: Ja. Das ist das Thema, heute. Dieser Text wird in einem weiterarbeiten. Aber: Wer soll hinter ihn kommen, von allein?
Erb: Du, ich hab es erlebt, daß Leute drauf gekommen sind. Nicht, daß sie es so hätten sagen können, aber sie waren befriedigt davon. Du mußt bedenken, wie viele Leute es gibt, die, wenn sie fertig sind mit den Illusionen, dann nichts mehr machen, sich einfach fallenlassen. Dagegen ist die Geschichte angeschrieben. Ich behaupte: Wenn man mit den vorgegebenen Formen nicht mehr arbeiten kann, dann ist man nicht aus der Arbeit heraus, dann geht sie weiter. Das ist meine Meinung von den Menschen, daß sie, auch wenn sie sich geschlagen erklären und so verhalten, trotzdem arbeiten.
Wolf: Nicht alle. Manche überlassen sich dem Genuß ihrer Enttäuschungen, Verbitterungen und Beleidigungen… Im großen ganzen hast du recht: Wenn eine neue Runde eingeläutet wird, stehn neue Kämpfer im Ring, oder die alten, die sich wieder aufgerichtet haben. Sie unterziehen sich der Notwendigkeit, aus dem Ungestalten neue Gestalten zu schaffen, die zur Arbeit taugen, bis auch die wieder hinderlich werden, Wirklichkeit verstellen, an statt sie zu verarbeiten und zu verändern; und Effeff, der Held, steht wiederum vor der Aufgabe, seine eigenen Gestalten zu vernichten, Ungestaltes produktiv zu machen: Das ist so und ist auch ganz in der Ordnung. – Dies alles nun nicht nur zu begreifen, sondern es am eigenen Leib zu erleben: War das eine der Grenzen, von denen du vorhin sprachst, an die dich diese Texte geführt haben?
Erb: Das sind die Grenzen hinter mir. Irgendwann, in einem langen Zeitraum, habe ich gewisse Voraussetzungen abgebaut und in mir zerstört: diese bestimmte Art, gefangen zu sein, Folgenwollen, Verführtwerden, Glaubenwollen und -müssen. Das war sehr schlimm. Aus jener Zeit habe ich ein Herzweh, das stärker ist als alle Hammerschläge…, Es hing mit der Geburt meines Kindes zusammen; ich sah mit dem Kind einen neuen Ansatz zum Leben, und mit der Kraft, die da in mir frei wurde, konnte ich verschiedenes Wichtige zertrümmern. Ich bin im Auftrag dieser Sache aber immer noch: mit Illusionen zu arbeiten, gegen sie zu arbeiten und mir darüber klarzuwerden. Das ist mein Gewissen.
Wolf: Mir fällt auf: Du artikulierst nirgends Klage, Trauer, Verzweiflung. Ich finde auch kein Lachen, kaum ein Lächeln. Spott, das ja, auch Verschmitztheit, Zuversicht, Ermunterung…Was ist mit Hoffnung?
Erb: Ich brauche keine. Ich bin ja kein intellektueller Einzelfall. Millionenfach erleben es die Menschen, daß sie nicht mehr festhalten können an ihren Voraussetzungen.
Wolf: Ja. Es ist das Gewöhnliche. Nur kontrollieren es die meisten nicht an sich.
Erb: Was aber danach übrigbleibt, ist eine große Offenheit für das Leben, für das Kind, eine große Möglichkeit, Mitleid zu haben, anders zu sehen, Feindschaften aufzulösen…
Wolf: Ich spiele ja, du merkst es, hier die Rolle des Vermittlers, habe sie wider Willen angenommen, kann nun nicht mehr heraus. Der Grund: Deine Hartnäckigkeit hat mich in deine Welt hineingezogen. Also ich würde die Texte dieses Bändchens auch ohne Auftrag vom Verlag gelesen haben wollen. Es beginnt mir aufzugehen, was du anstrebst, und ich muß wohl später versuchen, es zu formulieren; denn meine Arbeit soll ja die Mit-Arbeit anderer Leser, die deine Texte benötigen, herausfordern und auch erleichtern. Zuerst aber möchte ich mich noch im Gespräch mit dir um mögliche Ergebnisse herumbewegen. Du bist Jahrgang 1938. Du sagst, wir sind theoretisch erzogen, in Dogmenverheißungen.
Erb: Nicht zufällig pocht die Lyrik meiner Generation auf das Konkrete: wie, das ist allerdings sehr verschieden. Das macht jeder anders.
Wolf: Interessant, daß ich kaum eine ähnlich verallgemeinernde Feststellung über die Prosa meiner Generation, der um zehn Jahre Älteren, machen könnte … Aber, worauf ich hinauswollte: voraussetzungslos leben kann ja keiner. Unsere Voraussetzungen sind uns sogar besonders stark eingebrannt.
Erb: Das ist es ja. Das ist ja wahrscheinlich das, was weh tut. Wie bei Effeff: das nagt an ihm, wenn er das nicht mehr haben kann, das Versprochene; wenn er angewiesen ist auf nicht vorgeformte Wirklichkeit, unerklärte, nicht offerierte…
Wolf: Gibt es die überhaupt? Ich frage. Mußt du sie dir nicht, um sie als Arbeitsmaterial zu haben, erst herstellen? Herauspräparieren? Und gibst dann von diesem doppelten Bewußtseinsprozeß: Vernichtung der Denkvoraussetzungen und Herstellung einer neuen „Wirklichkeit“, in deinen Texten nur die Ergebnisse, was sie natürlich notwendig „schwierig“ macht.
Erb: Aber sonst müßte ich ja eine richtige große Beschreibung machen!
Wolf: Ich unterdrücke meine Genugtuung über diese Bemerkung. Ja: Das ist der Punkt.
Erb: Wie das gekommen ist, daß ich nicht so ein Romanschreiber wie du bin, sondern fast nur mit Wörtern arbeite, alles in Wörter lege und nicht große Inhalte verarbeite, das weiß ich nicht. Das ist zu komplex… Aber es ist so, inzwischen. Sieh mal: Ich will doch nicht, daß die Voraussetzungen abgeschafft werden. Sie müssen nur verstanden werden, und man muß das Subjekt dazu werden, das ist das Wichtige. Die Texte helfen mir, das zu machen, sie sind das Lebendige. Wenn ich so einen Text schreibe, bin ich irgendwo dort, wo die Normen sich befinden, und ich habe das Gefühl, eine Wortmeldung zu machen; die Sache, die ich vertreten will, in den Vordergrund zu bringen, ins helle Licht. Dahinter steht, glaube ich, ein ziemlich scharfes politisches Bewußtsein oder, genauer gesagt, eine grundsätzliche Orientierung auf die gesellschaftlichen Dinge, und zwar von Kindheit an. Ich handle eine öffentliche Sache ab. Ich gebe Antwort auf etwas, was mir entgegengekommen ist. Und ich finde, die Beziehungen bei uns sind doch der Art, daß sie sich zunehmend auf Wesentliches richten: auf Arbeit.
Wolf: Und du stellst dich ganz selbstbewußt in diesen Kontext, nimmst teil an der Kommunikation der produktiv Arbeitenden: in der Gewißheit, daß dein Beitrag seinen Platz in dem größeren gesellschaftlichen Zusammenhang schon finden wird.
Erb: Ja. Ich biete meinen Beitrag der Gesellschaft an.
Wolf: Und gehst du so weit, zu denken, daß etwas fehlen würde, wenn dein Beitrag nicht da wäre?
Erb: Ich lebe, also denke ich. Ich brauche nicht das Bewußtsein, daß etwas fehlen würde, wenn ich fehlte. Ich nehme eine Stelle ein, wo verantwortlich gearbeitet wird, wo eine Aussage gemacht wird, wo Zeugnis abgelegt wird. Andererseits: Wenn da ein anderer wäre, an meiner Stelle, und man würde versuchen, ihn auszustreichen: dann würde ich ja aufstehn und mich dagegen wehren. Dann wäre ich das, verstehst du? – Mir ist jetzt aber wichtiger das, was ich vor mir habe.
Wolf: Mir fehlt es wohl an der Phantasie, mir vorzustellen, wie du jetzt weitergehen wirst. Wie – und vor allem: womit, mit welcher Art von Gegenständen – du diese Formelhaftigkeit wieder neu aufbrechen wirst.
Erb: Zuerst muß ich das reflektieren, was ich hier gemacht habe. Der Prozeß, der das zutage fördert, verläuft so, daß es sich um politische Reflexionen wird handeln müssen. Um die Stellung dieser Sachen hier in der Gesellschaft letzten Endes doch.
Wolf: Darf ich mal eine Vermutung äußern, nicht leicht auszudrücken. Dein Anspruch an den gesellschaftlichen Gehalt dieser Texte ist hoch; die reale Reibungsfläche, die du anbietest, ist verhältnismäßig klein.
Erb: Das stimmt. Meine Texte passen kaum in die Abteilung „kritische Lyrik“. Zum Beispiel habe ich einmal bewußt enschieden, keine „negativen“ Kritiken mehr zu schreiben. Aber was du meinst, ist noch etwas anderes … Sieh mal: Mir kommen eigentlich Texte nicht vor, die „nicht zu machen“ sind.
Wolf: Das ist mir etwas Undenkbares… Trotzdem: Ich sehe deine Intensität, deinen Rigorismus des Denkens. Ich habe nicht den Eindruck, daß du, wie so viele Schreiber, bewußt oder unbewußt Selbstschonung betreibst. Vielleicht mit einer Einschränkung: Verrät die Wahl der Gegenstände, meist auf den ersten Blick wenig brisanter Alltagsvorgänge, etwas wie Selbstschonung? Und wenn einem, jedenfalls zeitweilig, nur Stoffe zutreiben, die „nicht zu machen“ sind; bei deren Prüfung dich jegliche Gelassenheit, die du dir vielleicht schwer errungen hast, wieder verläßt?
Erb: Stell dir mal die Beanspruchung des Nervensystems vor, wenn das so ist! Aber hör mal: Ich drücke mich ja nicht. Ich weiche ja nicht zurück. Es trifft ja alles, was passiert, bei mir ins Schwarze. Ich bin nicht auf der Flucht, auch nicht auf der „Flucht in die Innerlichkeit“. Ich bin ja im Angriff.
Wolf: Merkwürdig ist: Ich sehe die Richtung deines Angriffs deutlicher in deinen theoretischen Arbeiten als in diesen, sagen wir mal: poetischen Texten. Das kann an mir liegen, an meinen Lesegewohnheiten, an der von mir bevorzugten Literatur. Jedenfalls: Daraus, was du an jemandem – zum Beispiel an Zbigniew Herbert vermißt, bei anderen – Mickel, Sarah Kirsch – dagegen findest, kann ich auf die Forderungen schließen, die du an dich selbst richtest: die „Glieder des Grundverhältnisses“ – zwischen Subjekt und Ding – „in einen arbeitenden Widerspruch immer neu zu versetzen“. Du willst nicht mehr und nicht weniger als dein dialektisches Weltverhältnis zur Struktur – nicht bloß: zum Gegenstand! – deiner dichterischen Produktion machen. Eine von Grund auf „unbürgerliche“ Haltung, in der Wurzel verschieden von nicht eingreifenden, undialektischen, illustrierenden Schreibhaltungen – übrigens auch von jenen pseudokritischen Haltungen aus eigenem Unvermögen, sich an die wirklichen Widersprüche heranzuarbeiten. Vor dir liegt ein Blatt, auf dem hast du die Texte dieses Bandes in Kategorien eingeteilt, je nach ihrem „moralischen Wert“, wie du sagst. Eine dieser Kategorien, die wir hier leider nicht alle aufzählen, geschweige denn Text für Text durchgehen können – heißt: Sichtung des Positiven. Das Positive wird bei dir, scheint mir, in sehr vielen Texten gesichtet. Was nennst du „das Positive“?
Erb: Das Erhaltende; das, was da ist, beständig bleibt, was man nicht kritisieren muß. Es ist schon wahr, daß ich das Bedürfnis in mir habe, positiv zu sehn. Vielleicht, weil ich eigentlich arglos bin: Dieses Kind, das da in der Eifel aufgewachsen ist – woher sollte das diese Unterhöhlungen haben, daß es fähig wäre zu Verdächtigung und zu Mißtrauen und zu scharfen Wachsamkeiten…
Wolf: Du nimmst in diese Kategorie Texte mit „ländlichen Gegenständen“: „Im Juni“, „Dieses und Jenes“, „Sommerzeit“…
Erb: … ein sehr friedlicher Text, der einen Menschen arbeiten sieht, ihn arbeiten läßt…
Wolf: … und, wonach ich dich fragen möchte: „Scheuer und Faß“.
Erb: In diesem Text stelle ich mir die Frage – ausgelöst wird sie von den zwei schlimmen Dürrejahren, die wir hatten −: Wenn wir jetzt eine große Not bekämen – würden wir wieder Urtiere werden? Und ich sage: Das würden wir nicht. Wir haben, als die Dürre war, die Preise nicht erhöht, die Läden nicht ausgekauft. Was woanders zu Not und Rückschlag führen würde, das führt bei uns nicht mehr dazu. Wir haben eine positive Grenze der menschlichen Norm erreicht, die dürfen wir nicht mehr unterbieten.
Wolf: Du meinst, wir haben einen Stand der gesellschaftlichen Moral erreicht, daß wir auch unter ökonomischem Druck nicht mehr hinter diese Grenze zurückgehn.
Erb: Ich hab mich nicht so festgelegt. Aber: ja.
Wolf: Zwei Jahre Dürre: Die halten wir aus. Man könnte sich schärfere Belastungsproben denken.
Erb: Sicher. Aber ich halte die Menschheit noch nicht für unmoralisch, wenn sie, bei echter Not, tierhaft sich um ihre Existenz bekümmert: Das ist ja wohl notwendig, nicht? Sonst wäre ich mit einem solchen Text etwas wie ein warnender Prophet: Wollt ihr wieder Urmenschen werden! Und diese Geste fände ich ein bißchen komisch.
Wolf: Du merkst, ich sage weder ja noch nein. Ich frage mich – da ich dich doch als eine Person kenne, die zornig sein kann, empört, aufsässig -, warum alles das deine Texte meiden. Ich denke noch nach über die Gründe für deinen Hang zum Positiven. Fürchtest du vielleicht, daß der Zorn über das Unrecht dir die Züge verzerrt?
Erb: Nein. Hauptsächlich aus Angst, wieder ein Konsument zu werden, könnte ich keine negative Bilanz machen, glaube ich.
Wolf: Konsumentenhaltung – eines deiner wichtigsten Stichworte. Wie definierst du es?
Erb: Ich setze mich in einigen Stücken des Bandes damit auseinander, die hier auf meiner Privatliste unter der Kategorie: Moralisches Verhalten beim Schreiben, das heißt beim Aufnehmen stehn: in „Ungenießbar“, natürlich in „Kleist“, in „Bild“, aber auch in „Kaltes Büfett“, ein Text, der sich gegen die Konsumentenhaltung bei Werfel richtet. Mir schien nämlich, als ich zum Beispiel „Abituriententag“ las, daß ihm ein produktives Verhalten zur Wirklichkeit überhaupt fehlt. Ein schreibender Konsument bedient sich der vorhandenen Dinge – daher das verächtliche Bild: „Kaltes Büfett“ −, er rechtet mit der Wirklichkeit: als Empfänger, als Verbraucher; er wiederholt sich auch, entwickelt keine Dynamik, arbeitet mit dualistischen Gegenüberstellungen, mit falschen, unfruchtbaren Alternativen.
Wolf: Der Schritt aus dieser Konsumentenhaltung heraus muß für dich ein einschneiden der Vorgang gewesen sein. Du gibst ihm Namen wie: zweite Geburt; Erwachsenwerden.
Erb: Der Schritt aus der Konsumentenhaltung ist schmerzhafter als Geborenwerden, und er hat ungeheure, immer andauernde Konsequenzen. Du hast keinen Papa, keine Mama mehr, keine Ideogramme, keine Instanz, bei der du dich über nicht eingelöste Glücksverheißungen beschweren kannst.
Wolf: Du kannst dir, vermute ich, nicht mal mehr den Luxus leisten, dir selber leid zu tun, weil du alles selbst verantwortest … Dieser Hochmut, das ist dein einziger Luxus.
Erb: Du bist ganz allein. Du mußt immer weiterarbeiten und Voraussetzungen abstreifen und Genüßlichkeiten loswerden und kleinbürgerliche Züge erkennen und dich von ihnen befrein. Es kann sein, du gibst dein mögliches Glück preis, nicht wahr. Andererseits: Wenn du das nicht machst, wenn du nicht arbeitest, sondern einfach nur nimmst und dich bedienst mit dem, was da ist; wenn du der Erbe nur bist und nicht auch der Großpapa: dann wirst du kein selbständiger Mensch sein, und wenn du das nicht bist, kannst du gewiß nicht glücklich werden.
Wolf: Ein Einschub. Einer der von dir nachgereichten Texte, die ursprünglich nicht im Band waren, „Meine Letteratur“, fällt aus dem Rahmen. Seh ich das richtig?
Erb: Ja. Das ist ein Stück, das eigentlich schon in den nächsten Band gehört, das – noch ausgeprägter als „Wortkrieg – Wortfrieden“ und „Memorandum für Empfänger“ – einen für mich neuen Weg eröffnet. Die Frage ist: Was kann ich, angewiesen nur auf das Sprachmaterial, ausrichten? In „Meine Letteratur“ ist nur das Alphabet da, das mit eigentlich leicht, herbeigeführten Assoziationen bedient wird.
Wolf: Aber mit aufschlußreichen Assoziationen. Ich hab mir den Spaß gemacht, das Alphabet meinerseits mit Assoziationen zu bedienen: Das waren von Grund auf andere.
Erb: Sicher. Aber es geht doch nur darum: Was kann ich machen – wie setze ich Verantwortung ein, gebe eine Widerspiegelung, nehme ein Protokoll auf: alles das, was Texte immer tun −, wenn ich sehr, sehr nah am Sprachmaterial bleibe.
Wolf: Pochst du nicht zu sehr auf dieses Wortmaterial ?
Erb: Ich gehe aber dahin.
Wolf: Mag sein. Aber du mobilisierst in diesem Spiel doch das Unbewußte, machst Spontaneität frei…
Erb: … was aber bei mir sehr bewußt geschieht. Solche Texte wie „Meine Letteratur“ stellen das Ding, das Sprachding, einfach hin.
Wolf: Das seh ich anders. „Sprachdinge“ als absolute Größen seh ich bei dir bis jetzt nicht. Was ich sehe, ist – etwa in „Wortkrieg – Wortfrieden“: Du setzt Sprache als Zeichen an die Stelle von Strukturen der wirklichen Welt – zum Beispiel für hierarchische Strukturen −, die du nun spielerisch angreifen kannst und die dir weniger Widerstand leisten, als das „wirkliche“ Material es täte: wie du das ja in dem ausgerechnet „Widerstand“ benannten Text exemplarisch vorführst. „Das Wortspiel befreit das unterdrückte System.“ Eine Freisetzung demokratischer Tugenden.
Erb: Aber in einer heiteren, undemonstrativen Weise, nicht wahr? – Daneben stehn ja, in der gleichen Gruppe, ganz anders geartete Texte, wie „In der Ecke“, das letzte Stück des Bandes.
Wolf: Was tun wir hier eigentlich! Auseinandernehmen, entzaubern? Den Text möchte ich am liebsten unangetastet lassen. Ein Gedicht in Prosa. Es verträgt und trägt unterschiedliche Deutungen, glaube ich.
Erb: Es geht aber in dem Text um die Unabdingbarkeit des Engagements. Guck mal – das ist ein bißchen ein Wahnsinnstext, hat so eine Ophelia-Haltung, nicht wahr, eine Figur wie die Else Lasker-Schüler wird da nahestehn … „Vöglein“ – das fällt mir jetzt ein, beim Schreiben wußte ich’s nicht -, Vöglein ist ein Begriff für Seele, ja? „Truhe“ ist ein Begriff für Sarg, nicht?
Wolf: „Truhe“ ist mir ein Begriff für beruhigend, altertümlich, anheimelnd, bewahrend. – Was ist mit den Marionetten?
Erb: Ich möchte eigentlich vielleicht Ruhe haben, weil ja auch die Truhe zu ist. Aber es geht nicht, ja? Die sind da, diese „Marionetten“, Hero und Leander und Odysseus – ein Bekenntnis, wenn du willst, zur tradierten Bildwelt, aber sie sind auch das, wovon ich lebe. Da spielt sich anscheinend ziemlich viel aus in diesem Text… Die Figur des Dichters mit seinem Engagement wird vorgestellt mit dem versöhnenden Angebot: Das ist närrisch. Das ist ja in unserer Situation eine Art Trotz, nicht? Zugleich ein unterschwellig verführerisches Angebot: ein sanfter Wahnsinn…
Wolf: In der Ecke steht die Truhe…
Erb: Man scheint in die Intimität gejagt worden zu sein. Dann wiederum: Dort, in der Ecke, kommen trotzdem die Geister; vielleicht gerade, weil man in der Ecke ist… Wahrscheinlich gerade, weil man den Sarg sieht, wird der Tote lebendig…
Wolf: Odysseus.
Erb: Odysseus ist ja schließlich auch kein Wort für „Intimität“, kein Wort für „In der Ecke“… Und zuletzt noch diese Aufforderung: Jetzt schreib du. Und es scheint auch gar nicht unmöglich zu sein, daß jetzt „du“ schreibst – nicht? Schließ dich mir an…
Nachbemerkung
Diese Niederschrift entstand aus der Aufzeichnung eines fast vierstündigen Tonbandgesprächs, das die Autorin und ich an zwei Abenden im Februar und im Mai 1977 miteinander führten. Zwischen diesen beiden Abenden veränderte sich der Band vor meinen Augen. Die Autorin tat, was sie angekündigt hatte: Sie begann über ihre Texte zu reflektieren, angestoßen durch meine Fragen und Vorhaltungen. Um zu dokumentieren, in welchem Maß diese Reflexion dem Band genützt hat, nenne ich die Texte, die sie lieferte: „Zufälle und Geduld“; „Beschleunigung“; „Meine Letteratur“; „Widerstand“; „Kürze als Forderung des ,Tages‘“ (ein älterer Text, neu aufgenommen); „Ja, mach dir nur ’nen Plan“; „Die Physiker“; „Sucht, so werdet ihr finden“; „Mit Gunst“. Nicht nur, daß das Verständnis der Texte gefördert, manche Frage und Erörterung überflüssig wurde: Aus der Spannung zwischen den poetischen und den reflektierenden Texten treten deutlicher die Widersprüche hervor, die die Autorin zur Produktion treiben. Dem Lauf unseres Gesprächs folgend, unternahm ich den Versuch, den Weg nachzuzeichnen, der mir den Zugang zu diesen Texten eröffnete.
Christa Wolf, Mai 1977
Denkvergnügen mit poetischer Prosa
− Der Faden der Geduld — Texte von Elke Erb im Aufbau-Verlag. −
„Mir geht mancher Text von anderen wie überhaupt manches Dargebotene und nicht Dargebotene erst in einem günstigen Augenblick auf.“ Der Satz ist auf der 99. Seite des zweiten Buches der Elke Erb zu lesen. Der Band trägt den Titel Der Faden der Geduld. Satz und Titel geben dem Leser einen Schlüssel zu den Texten der Schriftstellerin in die Hand. Einen Schlüssel jedoch, der so ohne weiteres kaum zu handhaben ist. Also muß Geduld mitgebracht werden, muß darauf geachtet werden, daß der Geduldsfaden nicht reißt. Oder sollte, in jedem Falle, besser auf den günstigen Augenblick gewartet werden?
Wer Sinn für die Atmosphäre des Augenblicks hat, der ist dem Sinnen und Trachten der Autorin schon um vieles näher. Einer Autorin, die mit allem, was sie schreibt, dem Augenblick verbunden ist, um weit über ihn hinauszuweisen: in der schriftlichen Formulierung. Besinnung findet also bei Elke Erb nicht um der schönen Besinnlichkeit wegen statt. Be-Sinnen heißt bei ihr den Sinn haben für das Bewahren der Erkenntnisse. Die Beachtung des Unbeachteten zu erleben, von der oberflächlichen Wahrnehmung wegzukommen zur exakten Feststellung, die überraschend da ist, ohne auf überraschend-sensationelle Offenbarungen aus zu sein, das ist das Denkvergnügen, das die Autorin gern erfährt. In ihren reflektorischen Unternehmungen ins Bekannt-Unbekannte ist sie gewaltsam geduldig und geduldiggewaltsam. Deshalb kommt die Schreiberin mit Stift und Papier meist erst dann in Berührung, wenn sie eine wirkliche Getroffene ist, eine, die das Sandkorn im Auge schmerzlich empfindet.
Es ist also statthaft, befangen zu sein durch die Deutlichkeit, Dringlichkeit, mit der Elke Erb die Dinge des Lebens sieht und benennt. Deutlichkeit und Dringlichkeit sind bei ihr nicht das Ergebnis schockierend-brutaler Ich- Bekenntnisse.
Die unverhohlenen Bekenntnisse des Erbschen Ichs sind Reaktionen auf das Gegen-Ich wie auf die Gemeinschaft, weil das Gegen-Ich und die Gemeinschaft oft unfreiwillig bekenntnishaft auf das Erbsche Ich wirken. Bekenntnisse als Erkenntnisse, die den prägnantesten Ausdruck verlangen und, nach dem Willen der Autorin, bekommen sollen. Immer wieder mit Ausklängen, Ausgängen, Abschlüssen des Lebens beschäftigt, mit dem Altern, dem Altsein („Der alte Kaspar Hauser“, „Um ihren Atem ringt sie“), kommt sie in „Hoch in den Jahren“ zu einer zweizeiligen Zustandserklärung, die weit mehr als einen Zustand erläutert, wenn gesagt ist: „Du? — sprichst zu schnell / Und dann ins taube Ohr“.
Die poetische Prosa, die die Lyrikerin Elke Erb verfaßt, kommt ohne Paukenschlag aus. Ihre Prosa ist von einer Stille, die in der Stille am besten klingt. In einer Stille, die viele feine Töne hat für den, der zu hören versteht, sich aufs Zuhören versteht. Die Erbsche Prosa ist ein Stoppschild vor dem Kühler der Nur- noch-Konsumenten und aller, die die Konsumentenideologie schüren. Ideen haben, mit Ideen sein, das ist die Devise der Schriftstellerin.
Der Faden der Geduld ist ein Band, der keine Lektüre bringt, die da ist, um sich die Zeit zu vertreiben: während langer Bahnfahrten, in Warteräumen. Zeit muß sein für das, was die Autorin an Erwägungen und Erwartungen zur Zeit und ihren Erscheinungen vorträgt. Zu einer Zeit, in der sie fest verankert ist: von allen Stürmen bewegt, um mit dem Gegenwind den Winden zu begegnen. Hier sein bedeutet für Elke Erb immer schon dort sein, wo eine Sache nicht bloßes Wort ist, sondern ein Inhalt, den sie durch sich selbst, ihr Verhalten bestätigt:
Vom Ich zum Wir, Schritt aus der Einsamkeit…
Die Texte, die sich dem leichten Zugriff entziehen, sind mit so viel sprachlichem Geschick gemacht, daß sie mit geistigem Geschick erobert werden müssen. Nur so ist der ungeteilte Spaß an der Literatur der Elke Erb zu haben. Ein Spaß, dem schneller auf die Schliche zu kommen ist, wenn das Buch mit dem Schlußteil begonnen wird: mit dem Gespräch, das Christa Wolf mit Elke Erb führte.
Bernd Heimberger, Neue Zeit, 5.2.1979
Elke Erb
Elke Erb geht es nicht expressis verbis um feministische Anliegen. Ihre zum Teil spröden, schwer und manchmal gar nicht zugänglichen Texte leisten Bewußtseinsarbeit. Sie sind entstanden aus situativer Betroffenheit. Und nur indem der Leser selbst in diese Betroffenheit hineingerät, in solchem günstigen Augenblick, in dem ein unvermitteltes Zitat Übereinstimmung entstehen oder ein unvermitteltes Bild Situationen erkennen oder begreifen läßt, stellt sich die Möglichkeit der Kommunikation und der Verständigung in den Texten her.
Zwei Textsammlungen sind bisher in der DDR von Elke Erb erschienen: Gutachten (1975) und Der Faden der Geduld (1978). In Gutachten versucht Elke Erb Sprache, Erlebnis, Wirklichkeit und literarische Fixierung in möglichst enge Beziehung zu setzen. Sie umschreibt ihre Gegenstände, kreist sie ein, gibt auch die literarische Methode ihres Vorgehens an, so daß verschiedene Perspektiven deutlich werden: Eine plötzliche Erkenntnis entsteht aus einem überraschenden Gesichtspunkt.
In einem Gespräch mit Christa Wolf weist Erb darauf hin, daß uns die „Wirklichkeit nicht unvermittelt (…) entgegentritt, sondern interpretiert, zu Märchengestalten, Kunstgestalten, Denkgestalten umgeformt ist, bis das Eigentliche hinter ihnen verschwindet. Auf das Hervorbringen oder Herausbrechen des Eigentlichen aus der Gewöhnung kommt es Elke Erb an, indem sie den Gegenstand einkreist, zugleich aber deutlich macht, daß die Notwendigkeit der Veränderung und die Veränderbarkeit im Denk-Detail liegen.
In der Bundesrepublik ist von Elke Erb bisher nur das schmale Bändchen Einer schreit: Nicht! (1976) erschienen. Zur Titelerzählung: Im Wald bei Pankow erleben Spaziergänger, wie vier Jungen gegenseitig aufeinander „mit einem Stück Holz, das das Gewehr war, (zielten) während ein fünfter quer durch den Wald zu ihnen hinrannte und schrie: ,Nicht!‘“. Wer wird da nicht an Kafkas „Auf der Galerie“ erinnert, wo der junge Galeriebesucher durch alle Ränge hinab in die Manege stürzt und das Halt! ruft. Daß dieses Halt! bei Kafka den Wunsch und das Verlangen nach Beendigung des quälenden sich in der Manege täglich wiederholenden Dressuraktes repräsentiert und – daß es nicht gerufen wird, wissen wir, da trügerischer Flitter die Sicht auf das Wirkliche, Eigentliche versperrt. Bei Elke Erb bricht der Text an jener Stelle ab. Wie die Situation ausgeht, erfahren wir nicht. Auch hier wird das Verlangen, daß etwas nicht geschehen soll, im Betroffensein deutlich, gleichzeitig aber auch die Aufforderung an den Leser, eine Haltung zu der Situation für sich selbst zu erarbeiten. Für Kafkas Galeriebesucher besteht nicht die Möglichkeit, die reale Situation zu erkennen, bei Elke Erb ist die Situation real, Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit sind hier erkennbar und zu verhindern.
Im Band Der Faden der Geduld ändert sich die Tonart von Elke Erbs Texten. Nicht mehr das Prinzip der Einkreisung der Gegenstände, sondern das der Eliminierung aller unwesentlichen Perspektiven, aller bloßen Vermittlungszusammenhänge prägt ihre Struktur. In diesen kryptischen Miniaturen fehlt das Subjekt. Elke Erb greift zurück auf symbolische, fast mythisch-märchenhafte Signaturen, aber auch auf solche, die, in weitgehender Distanzlosigkeit, Nähe repräsentieren, aber nicht zu nahe treten. In Gegenständen, die Verstecken gleichen, wie Krügen, Truhen, Wohnungen, Winkeln, wird dem Leser die Vermittlung und Interpretation dieser Wirklichkeit durch eigenes Bewußtsein gegenwärtig.
Das Experiment der Texte besteht in dem Versuch, vorzustoßen zu den Dingen selbst, zu dem, was vermittelt geschieht und geschah, um es zu seiner eigenen Sprache kommen zu lassen. Das jedoch bedeutet, mit Sprache überhaupt an ihre Grenze zu gelangen. In doppelter Weise werden die Texte so fast inkommensurabel: Die Dinge selbst zur Sprache zu bringen, erreicht Elke Erb durch Sprachknappheit, zugleich aber muß der Bezug zu Urvorgängen oder archaischen Verhältnissen erscheinen. Märchen, Sage, Mythos und Assoziation sind als Mittler Material der Texte. Der Leser ist entweder gezwungen, sich sprunghaften Assoziationen der Autorin anzupassen – dies gelingt einzig, indem er unmittelbar situative Betroffenheit erfährt wie die Autorin –, oder er läßt sich auf eigene Assoziationen ein. Damit ist der Text Anlaß zur Reflexion eigener Bewußtseinsinhalte, vermittelt über ein sozio-symbolisches System.
Das gesellschaftliche Bewußtsein ist geprägt durch die männlichen Strukturen des sozio-symbolischen Systems Sprache. Elke Erb geht es nicht um Überwindung oder Erneuerung von Sprache, sondern um einen Gebrauch, der dem Leser deutlich seine Motivation, sein Handeln und seine Denkkategorien vor Augen führt, um diese für ihn kontrollierbar, überwindbar und veränderbar zu machen. Notwendig ist die Veränderung des Gebrauchs von Sprache, indem durch assoziative Rückführung auf archaische Strukturen und Bedeutungen offenbar wird, welche Aspekte, Dimensionen, Inhalte gesellschaftlich – das heißt: durch den Mann – unterdrückt, ausgeklammert, desavouiert worden sind. Das Experiment, zu den Inhalten des Bewußtseins vorzudringen und auf diese verändernd, erneuernd Einfluß zu nehmen; birgt freilich die Gefahr – gerade in der Arbeit mit Verknappungen –, daß die Texte nicht mehr kommunizierbar sind. Dieser Gefahr ist sich Elke Erb bewußt. Dennoch unternimmt sie den Versuch, vorgegebene Denkformen zu überwinden, indem sie vermittelte Wirklichkeit dem Leser unvermittelt ins Bewußtsein zu rücken sucht.
Wenn man mit vorgegebenen Formen nicht mehr arbeiten kann, dann ist man aus der Arbeit nicht heraus, dann geht sie weiter.
In Elke Erbs Texten gibt es weder Klage noch Trauer oder Verzweiflung, kaum Lächeln oder Spott, allenfalls Verschmitztheit. Es gibt aber auch keine Hoffnung – literarisch gestaltete Hoffnung wäre konsumierbar. Der Schritt aus der Konsumhaltung ist der Anfang konsequenten Verhaltens.
Die so bewirkte Verunsicherung, zugleich gesellschaftliche Provokation, sowie das Erfordernis intensiver eigener Mitarbeit beschränken die Wirkungsmöglichkeiten auf den geduldigen Leser, der vor dem Problem steht – wie Christa Wolf formulierte – „bei Elke Erbs Texten eingreifend zu fragen“.
„Eingreifend fragen“ muß der Leser nach der Lektüre sich selbst; deshalb – so Elke Erb – „geht die Welt“ mit ihr „ein Risiko ein“. Der letzte Text in dem Band Der Faden der Geduld endet mit dem Satz:
In der Ecke steht die Truhe, jetzt schreib du!
Bernd Allenstein, Neue Literatur der Frauen, 1980
Weitere Beiträge zum Buch:
Wilfriede Eichler: Poetischer Reiz: Die Kraft des Details
National-Zeitung, 11.9.1978
Jan Gielkens: Signalelementen
Literair Paspoort, Heft 278, 1979
Martin Gregor-Dellin: Der Faden der Geduld. Tiefsinn aus der DDR
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.10.1978
N. N.: Elke Erb: Der Faden der Geduld
Sächsische Neueste Nachrichten, 24./25.3.1979
JBE: Neue Texte von Elke Erb
Mannheimer Morgen, 14.10.1979
Friedrich P. Ott: Elke Erb: Der Faden der Geduld
World Literature Today, 1979, Heft 3
Ursula Heukenkamp: Elke Erb: Der Faden der Geduld
Weimarer Beiträge, Heft 5, 1979
Gregor Laschen: Der Faden der Geduld
Die Zeit, 28.3.1980
Christine Cosentino: Literary Correlations between Sarah Kirsch’s Poem Der Rest des Fadens and Elke Erbs Volume Der Faden der Geduld
GDR Monitor, Heft 5, 1981
Christine Cosentino: Elke Erbs Dichtung Der Faden der Geduld: Roter Dada im Sozialistischen Realismus?
Germanic Notes , Heft 13, 1982
Hanne Castein: Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung: Zur Thematik der Frauenlyrik in der DDR
John L. Flood (Hrsg.): Ein Moment des erfahrenen Lebens, 1978
Genia Schulz: Kein Chorgesang. Neue Schreibweisen bei Autorinnen aus der DDR
Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.): Bestandsaufnahme Gegenwartsliteratur, 1988
Das Herantasten an die Worte
Von einer „weiblichen Ästhetik“ wird viel geredet. Die DDR-Autorin Elke Erb macht in ihren zwei schmalen Bänden mit lyrischer Prosa und Lyrik auf eine fast stille Weise Ansätze dieser Art deutlich: im behutsamen Voraustasten ihrer Sprache, im Ausprobieren der Prädikate, in der eher flächigen als linearen Struktur ihrer Wortschöpfungen werden durch spezifische Sozialisation geprägte weibliche Stilformen herausgearbeitet. Die 41jährige Autorin schreibt aus der Ambivalenz des Nahe-Herantretens an ihren literarischen Gegenstand und der Scheu, dem Gegenstand nicht zu nahe zu treten. Die Vorgänge sind so subtil, daß die Schriftstellerin bisher nahezu unbekannt geblieben ist.
Als auf dem Perron seine Stirn und Wangen um die blauen Augen weiß segelten, weiße Wölkchen über blauen Himmel, und das Schwarz der Locken flockte, Wolken schwarz auf einem Himmel blau, stach mich, daß er so verfallend aussah; verwünscht, verwünscht ich kann ihn pflegen, das Haar ihm schneiden gleich nach seiner Rückkehr, so daß er aussieht wie ein nacktes Kind.
Elke Erb, 1938 geboren in Scherbard/Eifel, mit dem Vater 1949 in die DDR übergesiedelt, nennt das Prosastück „Liebesgedicht“. Zwei Zeilen hat ein anderes Gedicht „Hoch in den Jahren“:
Du? – sprichst zu schnell.
Und dann ins tote Ohr.
Im Jahre 1975 erschien Elke Erbs erstes Buch mit dem Titel Gutachten, 1978 ihr zweites: Der Faden der Geduld. In der Bundesrepublik liegt seit 1976 ihr Band Einer schreit: Nicht! vor, das Geschichten und Gedichte aus den DDR-Erscheinungen zusammenfaßt. Elke Erb ist Mutter eines Kindes, war verheiratet mit dem Schriftsteller und Literaturkritiker Adolf Endler und lebt in Ost-Berlin. Sie ist eine hervorragende Slawistin, die Werke der Russen Gogol, Block und Zwetajewa übersetzte und nachdichtete. Sie sagt von sich:
Ich bin, bis ich elf war, auf dem Land aufgewachsen, in der Eifel, und zwar ohne Verwandte. Drei Kinder, die Mutter. Der Vater war im Krieg. Gegenüber drei Bauernhäuser, ganz andere Leute. Ich habe sehr viel Bildung, sehr viel Erfahrung nicht mitbekommen, die der städtische Bürger hat… Heckenrosen können das niemals ersetzen.
Einer ihrer schönsten Texte gilt Else Lasker-Schüler:
Wenn ich einmal hinsehe, kehre ich zurück mit dem Bild: auch noch in Jerusalem lebte sie arm. Besuch saß auf dem einzigen Stuhl, sie selbst auf dem Bettrand, plaudernd. Einiges verstand man, aus anderem wurde man nicht schlau. In einem privaten Hause, in dem sie Gedichte vorlas, hielt sie in der Hand ein winziges Glöckchen, läutete mit ihm. Was hätte sie gegessen, sie war dünn, was hätte sie gegessen! Als sie dann umgefallen war, verständigte man sich, trat zu einem Zuge an, der trug sie feierlich weg, letztes Geleit.
Jürgen Serke, aus Jürgen Serke: Frauen schreiben, Fischer Taschenbuch Verlag, 1982
Figuren des Werdens von Elke Erb
Elke Erb meldete sich in der DDR Ende der 60er Jahre zuerst als eine Vertreterin des Dichterkreises zu Wort, mit dem die Bezeichnungen „Lyrikwelle“, „Volker-Braun-Generation“ bzw. „Sächsische Dichterschule“ verbunden werden.1 In eine Darstellung der jungen Literatur der 80er Jahre scheint sie daher auf den ersten Blick nicht zu passen. Wenn dennoch hier auf einige Aspekte ihres Werkes eingegangen wird, dann wegen der wichtigen Rolle, die sie bei der Ausdifferenzierung einer autonomen literarischen Kommunikation spielte. Elke Erbs poetische Positionen führten sie Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in die Nähe der jungen Autoren im Untergrund. In den Texten der Jüngeren entdeckte sie bereits ausgeformte Überzeugungen und Denkweisen, auf die sie selbst sich erst hinbewegte. Sie hätten bei ihr das Bewußtsein für die „Strukturen und Konditionen des DDR-Denkens“ geschärft und ihre Ablösung davon beschleunigt.2 Ihrerseits fühlten sich die Jüngeren in ihren Bestrebungen durch die Anerkennung der Älteren bestätigt. Unter Erbs Moderation konnte die Arbeit am Manuskript der Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung (1985) zum Kristallisationspunkt des Entstehens eines unabhängigen Literatursystems innerhalb der DDR werden.
Elke Erb wurde 1938 in der Eifel geboren. Sie zog 1949 mit ihren Eltern in die DDR, nach Halle, wo sie u.a. Pädagogik, Geschichte und Germanistik studierte. Danach arbeitete sie als Lektorin und ließ sich 1966 als freiberufliche Autorin in Berlin nieder. 1975 debütierte sie mit dem Band Gutachten3, dem in regelmäßigem Abstand weitere Bücher folgten. Während das Interesse der Schriftsteller der ,Braun-Generation‘ auf eine möglichst konkrete, aber formbewußte Umsetzung der Realität in Poesie gerichtet war4, wandten sich die damals miteinander verheirateten Elke Erb und Adolf Endler (geb. 1930) in den 70er Jahren immer stärker der Konkretheit des verfügbaren formalen, sprachlichen Materials zu, ein Bemühen, das bei beiden weitaus konsequentere Formen annahm als bei den Altersgefährten. Das Ungenügen an einer subjektiven oder sozialutopischen Einbettung und damit poetischen Entschärfung dieser Problematik bei den Lyrikern ihrer Generation führte vor allem bei Elke Erb zu einem Gewinn an analytischer und produktiver Strenge. Über die Auseinandersetzung mit u.a. konkreter Poesie und mit russischen Avantgardisten wie Chlebnikow oder der Zwetajewa (von Erb nachgedichtet) schrieben beide zunehmend Texte, an denen eine immer deutlichere, sich nach der Biermann-Krise 1976 beschleunigende Distanzierung zu den Tradierungen der DDR-Literatur abzulesen ist. Aus Endlers kurzem, 1976 entstanden Gedicht „Akte Endler“ etwa spricht unverblümte Verachtung für die Epigonalität des sozialistischen Realismus:
Zieht (wöchentlich bis zu sieben Mal) und volltrunken dann
Vor ganz häßlichen Worten über unseren Johannes R
Becher zurück und vor allem dessen Sonettkunst.5
Elke Erbs erwachendes Bewußtsein für die Autonomie literarischer Sprache spricht aus dem Text „Die Physiker“ von 1977:
Ein gewisses Vergnügen tritt vor mich hin in der Erinnerung, mit dem ich vorgestern jenem mir recht unverständlichen Gespräch der beiden Physiker denn doch gefolgt bin, ein Behagen war es, so erkenne ich, an dem ungestörten Frieden, in dem sich diese Menschen in einer anderen (so wie mir) recht unverständlichen deutschen Sprache eine Weile unterhielten: Die dürfen das.6
Die Bedeutung, die die Abnabelung von der DDR-Ästhetik für sie hatte, wird in dem kleinen Prosastück „Verwahrung“ thematisiert, wo in einem Gespräch plötzlich die Äußerung fällt, Goethe sei kein großer deutscher Dichter. Für die Ich-Erzählerin ist diese Blasphemie eine enorme Erleichterung:
Eine sanfte, weltweite Freiheit schien, kaum begreiflich, hereinzuschneien.7
Die intellektuelle Befreiung Erbs und Endlers von den sozialistischen Erblasten ging so schnell, daß Endler sechs Jahre nach der Biermann-Affäre notieren konnte, die biederen Sätze in seinem und Elke Erbs damaligem Protestbrief muteten nun schon „wie ein Dokument von einem anderen Stern an. Sind wir wirklich so liebe Kinder gewesen?“8
Elke Erbs wachsender Dissens mit dem Hauptstrom der DDR-Literatur wurde 1978 mit ihrem Band Der Faden der Geduld öffentlich. Die „bedrohliche Stubenwärme“ ihrer früheren Texte machte „der Kälte des linguistischen Konstrukts“ (Berendse)9 Platz. In dem in den Band aufgenommen Gespräch mit Christa Wolf aus 1977 entgegenete Erb bezüglich Wolfs hoffnungs- und bedeutungsvermittelnden Ansprüchen an Literatur, sie habe Abschied vom „Sendungsbewußtsein“ genommen. Sie konzentriere sich zunehmend auf das Sprachmaterial, aufs Positive, aufs Wort und stelle „das Ding, das Sprachding, einfach hin.“10 In dem poetologischen Text „Widerstand“ verteidigt Erb ihre Hinwendung zum Wortspiel, es sei nicht „Selbstgenügsamkeit, Esoterik, Beliebigkeit, Elfenbeinturm Amoralität“, sondern:
Ich sah das Spiel als Ernst. […] Das Wortspiel befreit das unterdrückte System. Deshalb ja nennt man es Spiel, denn der Befreiungseffekt löst Heiterkeit aus.11
Das „unterdrückte System“ der Sprache in der Poesie zu sich selbst kommen zu lassen und mithin eine Autonomie des literarischen Sprechens und der literaturimmanenten Sprachreflexion gegenüber vermeintlich übergeordneten Anforderungen der Gesellschaft herzustellen, bildete seitdem den Kern von Elke Erbs Schreibbemühungen.
Als einen diese Problematik reflektierenden Schlüsseltext läßt sich das Gedicht „Auskunft nachts“ aus dem Jahre 1980 lesen. Ein Erlebnis, ein Wort für ein Erlebnis, „Im Sommer – Sommer war! – riß der Himmel über mir,“ wird von Erb als Anlaß genommen, einen Riß im Selbstverständnis zu verworten:
[…]
Ich weiß seit über einem Jahr,
daß Mut die Anerkennung der Fremdherrschaft ist.
Zwischen den Worten Mut und Übermut, die mich abwiesen,
hin und her irrte ich oft vor einem Jahr,
wenn ich den Trieb zum Leben, den Lebenswillen taufen wollte.
Wir haben eben innerhalb des Geheges nur Gehegebegriffe.
[…]
Unterlegen Angst und Flucht
vor den Phantomen der Selbstvernichtung.
Verlegen sehe ich mich ihnen entkommen.
Ich wage nicht, an neue Anfälle zu denken.
Ich freue mich, es gelingt mir stundenlang Heiterkeit.
Das ist mein Zustand. Das Bewußtsein des allgemeinen Zustandes
hat ihn schneidend und höhnisch hervorgereizt.
[…]
Aber ich bin nicht irre und kann nicht umkehren.
Stierkampfarena, und als sollte ich nur
kuschen vor ihrem Phantom.12
Solche Reflexionstexte, die weniger auf dem Materialcharakter der Worte als auf ihre Bedeutungen bauen, sind ab Ende der 70er Jahre bei Erb nur noch selten anzutreffen. In dem obenstehenden Gedicht hat ein Ich seinen Weg gefunden, es kann „nicht umkehren“, nicht „kuschen“. Diese Gewißheit leitet sich aus einer befreienden „Heiterkeit“ jenseits von „Mut und Übermut“ her. Bringt man diese Heiterkeit in Verbindung mit dem Text „Widerstand“, kann sie als Ergebnis der erlösenden Wirkung des Wortspiels verstanden werden. Bloße verbale Aufmüpfigkeit gegen die sozialen Zustände sei für ein sprechendes Ich gleichbedeutend mit „Anerkennung der Fremdherrschaft“, mache, wie Elke Erb in einem anderen Text verdeutlicht, Sprache zur „Sklavensprache“ („Wir haben eben innerhalb des Geheges nur Gehegebegriffe“):
Die Hände, die gestreichelt haben, kann man ruhig abhacken. Das ändert nichts, denn sie würden das Streicheln nicht lassen, und es führt zu nichts Gutem.
Man kann sie aber auch fesseln, und die Person, der sie gehören, folgt ihnen nach bis in die finsterste Zelle.13
Das „Testament der Sklavensprache“ sei körperliche, sei Existenzzerstörung.14
Der „Widerstand“, den Literatur leistet, ist, wie der gleichnamige Text behauptet, der Widerstand des Wortspiels. Statt sich negativ in Sprache und Denken der Macht zu verstricken, ermögliche die produktive Beschäftigung mit dem Sprachmaterial Texte, die Selbständigkeit erreichten, weil, wie Elke Erb an anderer Stelle sagt, „das, was wir als Identität erstreben, sich jenseits von Gefangenschaft und Freiheit befindet.“15 In der Gewißheit, daß die Funktion der Literatur nicht darin bestehen könne, politischen Widerstand zu leisten, sondern daß Literatur auf ihrem ureigenen, dem poetischen Feld den Mut aufbringen muß, die Fremdherrschaft der Alltags- und Verlautbarungssprache abzustreifen, fühlte sie sich den jungen Autoren aus der Subkultur verbunden. Beispielsweise forderte Erb zu einer solchen, die Wehleidigkeit über die politische Misere überwindenden ästhetischen Auseinandersetzung und Arbeitsweise 1987 in der Untergrundzeitschrift Ariadnefabrik auf:
Untersuchungen und Formen
Gehe ich dem Übel auf den Grund, kommt es über mich endlos
(Übel auf Übel!)
Gehe ich nicht auf den Grund
(sondern in umgekehrter Richtung? von ihm aus?):
Form auf Form, Leben von allein.
Also ist ihm doch einzig und allein ästhetisch zu begegnen.16
Elke Erb unterscheidet hier dezidiert zwischen dem poetischen Produkt und der Herkunft seiner sinnlichen, sinnhaften und linguistischen Bestandteile. Literatur unterliege eben anderen Kriterien als die Bereiche außerhalb von Literatur; Literatur habe ihre Fremdreferenzen selbstreferentiell zu bearbeiten, habe autonom zu sein und könne nur so ihre spezifisch ästhetische Antwort auf die Umwelt geben, nur so ihre Funktion erfüllen.
Zu ihrer Arbeitsmethode hat sich Erb vielfach geäußert. Entsprechend ihrer poetischen Überzeugung gewinne sie den Anfang für ihre Texte nicht aus Erlebnissen oder Reflexionen, sondern aus mehr oder weniger zufällig vorgefundenem Sprachmaterial, aus den verschiedensten Fundstücken, die – miteinander konfrontiert – Bewußtsein erregten, irritierten, an die sich sprachliche und reflektorische Assoziationen knüpften:
Im Prinzip würde ich sagen, ist es so, daß sich eine Lautfolge schon abbildet, schon ergibt, sowie du etwas vor dich hinmurmelst. Und dann hast du Lust, das weiterzubauen, oder es fordert sogar, daß du’s weiterbaust.17
Erb spricht von „prozessualem“ Schreiben18, das nicht nur zu einem Einzeltext führen, sondern sich auch zu Reflexionen über den Text, zu einem Zyklus oder ganzen Band ausweiten könne. Während sie in ihren frühesten Gedichten auf sachliche Weise additiv und unpointiert „das Konkrete“ aneinander fügte, später Wortmaterial systematisch und spielerisch mit Assoziationsketten verband und ausprobierte, ging sie Anfang der 80er Jahre zu nichtlinearen Konstellationen von Wörtern und Wortgruppen über. Die Pflicht zur sequentiellen Reihung von Wörtern und Bedeutungen empfand sie jetzt als kulturelle Reduktion, die sie mit Aggregationen von Worten und Bedeutungen auf der Fläche aufbrechen wollte. Als Beispiel diene hier der kleine Text „Natürlich“:
Eine Blume
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaim Gefüge meiner Knochen
aaaaaaaaaaaaaaaaaaader Schulterknochen
aaaaaaaaain
einem Herbstgarten,
keine Empfindung
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaeiner anderen Jahreszeit19
Die Anordnung der Wortgruppen in der Fläche ermöglicht die Wahl mehrerer Leserichtungen und Wortfolgen, ermöglicht die Konstruktion mehrerer Beziehungen zwischen „Blume“ und „Schulterknochen“ und Gleichzeitigkeit von Assoziationen, womit schon äußerlich die Vielzahl semantischer Konstellationen, in denen ein Sprachelement, ein Wort funktionieren kann, angezeigt ist. Dieses simultane, mit der Fläche spielende Schreibverfahren erlaubt, mehrdimensionale Texturen zu entwickeln, die Bedeutungsräume bilden. Dabei dürfe der Zufall des Wortfundes, ja sogar ein Tippfehler mitbestimmen:
Sind Worte unter sich, entscheiden sie. 20
Aus systemtheoretischer Sicht illustrieren Elke Erbs poetologische Überlegungen und poetische Praxis beinahe exemplarisch den Übergang zu literarischer Autonomie, der sich in ihren Texten unter den Bedingungen der unifizierten sozialen Sinngebung in der DDR, historisch gesehen, aufs neue vollzieht. Bei der Beobachtungsweise der Umwelt, die sich in Erbs Texten manifestiert, werden die sprachlichen Bezeichnungen bzw. Unterscheidungen in der Welt nach rational kontrollierten oder zufälligen, aber immer literaturinternen Gesichtspunkten getroffen. Erb formulierte es so: „Ein Gedicht ist den Bedingungen entkommen, die es erfüllt“; wenn dieser Satz gültig sei, sei ein Gedicht „selbständig“.21
Seit ihrem zweiten Band, dem Faden der Geduld, gibt Elke Erb ihren Büchern poetologische Texte bei. Diese Kommentare, die sich nicht als Interpretationsanleitungen verstehen, sind Texte, die die Setzungen bzw. Unterscheidungen der poetischen Texte beobachten, sie sind, in Luhmanns Terminologie, explizit formulierte Beobachtungen zweiter Ordnung. In ihnen werden die Selektionen, die das Entstehen des Gedichts ausmachten, kommentiert. Erbs Schreibprozeß erweist sich hier als ein ständiger Wechsel des Beobachterstandorts:
wenn wir aus dem Eigenen zu sprechen beginnen, [formen wir] uns unbewußt aus der Sprache, der wir entgegnen, ein Gegenüber […], mit dem wir über unser Menschbild sprechen.22
Erbs Kommentare reflektieren neben dem Entstehen des Gedichts ebenfalls das Entstehen des Kommentars, schließen an die Differenz zwischen Gedicht und Kommentar erneuten Kommentar an, gewinnen Eigenwert, sind wie ihre Gedichte unabgeschlossene und unabschließbare „Figuren des Werdens“ 23 bzw. – romantisch ausgedrückt – „progressive Universalpoesie“. Ihr Band Kastanienallee führt solches Werden sowohl als Gedicht- als auch als Kommentartext teilweise exzessiv vor: die Sekundärtexte nehmen mehr Raum ein als die Gedichte selbst.
Diese Arbeitsweise wird an ihrem wichtigen Gedicht „Überlegung im D-Zug, Erinnerung (Schock)“24 besonders deutlich. Es beginnt wie folgt:
Sehnsucht nach Geborgenheit
ist, sehe ich suchend,
Sehnsucht nach Geborgenheit
an dem Ort, den eine zu treffende
Übereinkunft schafft,
die man gern, übereilt,
für getroffen hält. Es ist verrückt,
aber leuchtet ein:
Die Sehnsucht will
Geborgenheit in der Zukunft,
wenn auch schon von jetzt an,
wenn auch für jetzt gleich.
In dem zugehörigen mehrseitigen Kommentartext macht Elke Erb nicht nur auf die dem Entstehen des Gedichts vorausgegangenen Empfindungen und deren poetische Folgen aufmerksam, sondern auch auf ihre schreibtechnischen Entdeckungen, die u.a. in die dritte und vierte Strophe eingegangen seien: Sie habe „plötzlich die Körperlichkeit der ,rationalen‘ Überlegungen des Gedankenganges“ entdeckt und „ein Gebot, das ihnen den Eintritt in den Vers untersagte“, durchbrochen: „Gelenke, Scharniere, Behelfe – wieso sollten sie nicht Verse sein?“ Mit dieser Entdeckung der „Versfähigkeit“25 von Beobachtungen, die Beobachtungen zweiter Ordnung sind, wird das Gedicht buchstäblich selbstreflexiv und leitet gewissermaßen dazu an, die von Literatur kreierten ,konkreten‘, aber kontingenten Formen als Beobachtungen und Unterscheidungen in der Welt auf die Einheit der als Ganzes unbeobachtbaren Welt zu beziehen:
Schreiben ist nicht Beschreiben, es ist Ändern. Sich zur Welt bringen. Die Welt zu sich bringen.26
Elke Erb treibt ihre Texte herausfordernd an die Grenzen des Kommunizierbaren und versucht so, den Spielraum literarischer Sprache zu testen und zu erweitern. Daß sich manche ihrer Texte einer verstehenden Erschließung überhaupt zu verweigern scheinen, nimmt sie in Kauf, denn poetische Rede sei auch dann, wenn sie in herkömmlichem Sinn unverständlich bleibe, „unmittelbare Rede“. Einen Text „wahrnehmen ist ihn erfüllen, und es ist dabei gleich, ob man den Sinn erfaßt oder nicht, diese seine Wahrheit, Klarheit, Unmittelbarkeit, Stille, Geschlossenheit, Gestalt wahrnehmen heißt seine Gründe als Boden voraussetzen.“27 Wichtig ist für Erb also, daß ein Text zur poetischen Apperzeption, zu einer Kommunikation im System Kunst bzw. Literatur einlädt. Daher wehrt sie sich entschieden dagegen, die Unzugänglichkeit eines poetischen Textes für ein Irrationales zu halten, das heilig, unerschließbar wäre. Auch ein hermetisches Gedicht sei ein „Vexierbild“, für das es eine oder mehrere Sehweisen zu entdecken gebe, auch ein verschlossener Text bleibe für ein Bewußtsein prinzipiell zugänglich, öffne sich einem prozessualen Verstehen und gestatte demzufolge, im Sinne des hier vertretenen Konzepts, eine Anschlußkommunikation:
Sprechen ist veröffentlichen.28
Da Elke Erb mit ihren Texten und ihrer Poetologie ab Ende der 70er Jahre als einzige der älteren Lyriker die Tauglichkeit der herkömmlichen Rede- und Schreibweisen in der DDR grundsätzlich in Frage stellte und sich radikal avantgardistischen Positionen zuwandte, irritierte sie unter anderem das Selbstverständnis eines Volker Braun deutlich.29 Die Selbständigkeit ihrer Literaturauffassung ermöglichte ihr, in der selbstbestimmten unbotmäßigen Poetik der jungen Autoren jenseits der offiziellen und gelenkten Literaturentwicklung kongeniale Bemühungen zu sehen. Aus diesem Einverständnis heraus wurde, mehr noch als Endler, Elke Erb zu der wichtigen Mentorin, Beraterin und Anregerin, zu einem Anlaufpunkt der sprachgerichtet arbeitenden jüngeren Schriftsteller, und sie befruchtete als Beiträgerin in der unabhängigen Zeitschriftenszene mit ihren Aufforderungen zur poetologischen Diskussion den Selbstverständigungsprozeß der jüngeren Autoren wesentlich.
Ekkehard Mann, in Ekkehard Mann: Untergrund, autonome Literatur und das Ende der DDR. Eine systemtheoretische Analyse, Peter Lang Verlag, 1996
Gedichtverdachte: Zum Werk Elke Erbs. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung In den Vordergrund sprechen Hendrik Jackson, Steffen Popp, Monika Rinck und Saskia Warzecha über Elke Erbs Werk.
Gerhard Wolf: Die selbsterlittene Geschichte mit dem Lob. Laudatio für Elke Erb und Adolf Endler zum Heinrich-Mann-Preis 1990.
Franz Hofner: Hinter der Scheibe. Notizen zu Elke Erb
Elke Erb: Die irdische Seele (Ein schriftlich geführtes Interview)
Elke Erbs Dankesrede zur Verleihung des Roswitha-Preises 2012.
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Elke Erb und Friederike Mayröcker.
Klassiker der Gegenwartslyrik: Elke Erb liest und diskutiert am 19.11.2013 in der literaturWERKstatt berlin mit Steffen Popp.
Lesung von Elke Erb zur Buchmesse 2014
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Steffen Popp: Elke Erb zum Siebzigsten Geburtstag
literaturkritik.de
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Waltraud Schwab: Mit den Gedanken fliegen
taz, 10.2.2018
Olga Martynova: Kastanienallee 30, nachmittags halb fünf
Süddeutsche Zeitung, 15.2.2018
Michael Braun: Da kamen Kram-Gedanken
Badische Zeitung, 17.2.2018
Michael Braun: Die Königin des poetischen Eigensinns
Die Zeit, 18.2.2018
Karin Großmann: Und ich sitze und halte still
Sächsische Zeitung, 17.2.2018
Christian Eger: Dichterin aus Halle – Wie Literatur und Sprache Lebensimpulse für Elke Erb wurden
Mitteldeutsche Zeitung, 17.2.2018
Ilma Rakusa: Mensch sein, im Wort sein
Neue Zürcher Zeitung, 18.2.2018
Oleg Jurjew: Elke Erb: Bis die Sprache ihr Okay gibt
Die Furche, 8.3.2018
Annett Gröschner: Gebt Elke Erb endlich den Georg-Büchner-Preis!
piqd.de, 27.6.2017
Zum Georg-Büchner-Preis an Elke Erb: FR 1 & 2 + MOZ + StZ + SZ +
Echo + Welt + WAZ + BR24 + TTB + MAZ + FAZ 1 & 2 + TS + DP +
rbb +taz 1 & 2 + NZZ +mdr 1 & 2 + Zeit + JW + SZ 1 & 2 +
Zur Georg-Büchner-Preis-Verleihung an Elke Erb: BaZ + BZ + StZ +
AZ + FAZ + SZ
Verleihung des Georg-Büchner-Preises 2020 an Elke Erb am 31.10.2020 im Staatstheater Darmstadt.
Fakten und Vermutungen zur Autorin + KLG + IMDb + Archiv +
Internet Archive + PIA + weiteres 1, 2 & 3 +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Galerie Foto Gezett 1, 2 & 3 +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Elke Erb: FAZ ✝︎ BZ 1 + 2 ✝︎ Tagesspiegel 1 +2 ✝︎ taz ✝︎ MZ ✝︎
nd ✝︎ SZ ✝︎ Die Zeit ✝︎ signaturen ✝︎ Facebook 1, 2 + 3 ✝︎ literaturkritik ✝︎
mdr ✝︎ LiteraturLand ✝︎ junge Welt ✝︎ faustkultur ✝︎ tagtigall ✝︎
Volksbühne ✝︎ Bundespräsident ✝︎
Im Universum von Elke Erb. Beitrag aus dem JUNIVERS-Kollektiv für die Gedenkmatinée in der Volksbühne am 25.2.2024 mit: Verica Tričković, Carmen Gómez García, Shane Anderson, Riikka Johanna Uhlig, Gonzalo Vélez, Dong Li, Namita Khare, Nicholas Grindell, Shane Anderson, Aurélie Maurin, Bela Chekurishvili, Iryna Herasimovich, Brane Čop, Douglas Pompeu. Film/Schnitt: Christian Filips
Elke Erb liest auf dem XVII. International Poetry Festival von Medellín 2007.
Elke Erb liest bei OST meets WEST – Festival der freien Künste, 6.11.2009.



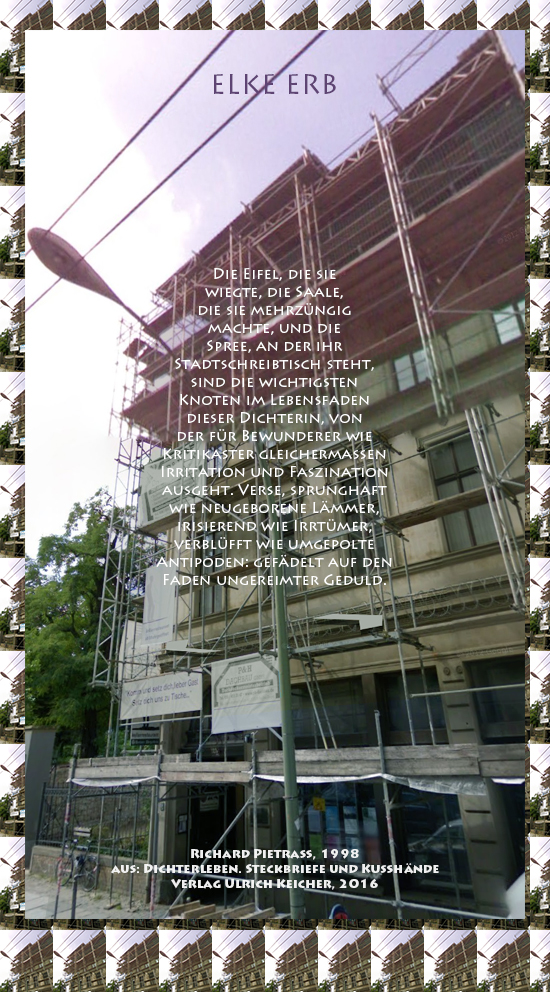












Schreibe einen Kommentar