Inger Christensen: Das Schmetterlingstal (CD)
Eine Dichterin aus der Zukunft
Man hat nicht oft Gelegenheit, über das vollkommene Kunstwerk nachzudenken, nicht in einer Zeit wie der unseren, die von allem reichlich hat und manches besser kann als jede vor ihr und so vieles gleichzeitig will, nur eben das eine gerade nicht: das vollkommene Kunstwerk. Manchmal aber scheint es doch Ausnahmen zu geben, und auf eine solche hinzuweisen, erlaubt mir die vorliegende Edition.
Es ist schon einige Jahre her, da geschah das Unwahrscheinliche. Bei einem dieser Lyrikertreffen, die ihren Teilnehmern zumeist eine Tortur sind (wie ich aus eigener Erfahrung weiß), hörte man plötzlich die unglaublich sanfte, wunderbar unverdrossene Stimme einer Dichterin aus Dänemark, die in einem bemerkenswert regelmäßigen Singsang ihre Verse vortrug. Es waren dies Verse von einer modulatorischen Ordnung, wie man sie normalerweise nur von streng durchkomponierten Musikstücken kennt, etwa der „Partita“ eines Johann Sebastian Bach. Ich sage Dichterin, denn dies war offenkundig: Hier sprach ein Mensch, der mühelos an die Geheimnisse der Sprache rührte, in diesem Falle des Dänischen, und dem Zuhörer im Moment des Vortrages ein Vertrauen einflößte, wie es nur die Wiegenlieder aller Kulturen vermögen.
Sie machte das Dänische, seine Sprachmelodie, in einer Weise begehrenswert, daß man die Nichtbeherrschung dieser Sprache sofort als schlimmen Verlust empfand. Ich erinnere mich, wie ich ein andermal darüber fast schmunzeln mußte. Aber das gehört vielleicht nicht hierher. Nur so viel, ich stand in Helsingör (gut anderthalb Stunden nördlich von Kopenhagen) auf den Festungswerken des berühmten Kronborg-Schlosses, schaute über den Sund zum schwedischen Ufer hinüber und dachte darüber nach, wie anders Hamlets Monolog sich in der Sprache des Staates Dänemark anhören mochte. Nicht, daß der Zauber gebrochen war, mir fiel nur auf einmal, im Rauschen der Ostsee und beim Anblick des grünen seeländischen Rasens, die Stimme der Dichterin wieder ein. Und statt der wohlbekannten shakespeareschen Fetzen („To die – to sleep, / No more; and by a sleep to say we end“) hatte ich plötzlich ihren Originalton im Ohr und sah dies rundliche Märchenerzählerinnengesicht mit der Brille:
Es ist der Tod, der dich mit eigenen Augen
vom Schmetterlingsflügel aus anblickte.
Man sollte es kaum glauben (und man verzeihe mir den nun folgenden Stilbruch), aber als Dänemarks bekannteste Gegenwartsdichterin Mitte der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts in Vejle an Ostküste Jütlands geboren wurde, da begann unweit der beschaulichen Hafenstadt die Erfolgsgeschichte eines Markenprodukts, das Millionen Kinder überall auf der Welt später schätzenlernten. Ein kleiner Baustein aus Kunststoff, an dem der aufgeprägte Firmenname das Wichtigste ist (Lego), kaum der Rede wert, wäre da nicht dieses Kinderzimmerwunder, daß man mit Hunderten und Tausenden dieser farbigen Quader und Würfel ganze Märchenwelten hervorzaubern kann, Ritterburgen und Phantasiepaläste und intergalaktische Raketenbahnhöfe. Man wird gleich noch sehen, warum die Erwähnung von Legoland nötig war. Daß auch die Massenkultur ihre Schönheiten und (wenigstens kindlichen) Mythen hat, wissen wir, aber wissen wir auch, wo die Basis für jene Schwierigkeit ist namens Poesie?
Und wenn der Tor des Universums sich vorgaukelt,
daß andere Welten existieren,
wo die Götter bellen wie auch rufen und uns
ein zufälliges Würfelspiel nennen können…
So hebt das siebte Stück an aus Inger Christensens Zyklus Das Schmetterlingstal, ein Sonettenkranz in streng klassischer Manier, der mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, und dies zu Recht. Denn nach Form und Symmetrie (aber auch Unergründlichkeit) des Ausdrucks liegt hier ein Kunstwerk an der Grenze zur Vollkommenheit vor. Ich kenne kein anderes Wortgebilde der Gegenwartsdichtung, das der Idee einer Unabschließbarkeit im Innern bei äußerlich abgeschlossener Form so nahekommt. Man reibt sich die Augen, liest man das Erscheinungsjahr: 1991. Hier die schwergewichtige Welt des Historikers, eben in Schwung gekommen mit der Auflösung eines ganzen Imperiums, eine Welt im Aufruhr der Transformation – und da die flügelleichte Halluzination einer Erinnerungslandschaft mit Schmetterlingen über den Wiesen. Glücklicher Leser: Vor ihm tut sich das Paradies eines Lepidopterologen auf, beschworen im jambischen Pferdchentrott einer Reise zurück in die Kindheit. Es ist, als habe die Dichterin einen Beweis zugunsten der Gleichzeitigkeit antreten wollen. Sie führt uns vor, daß es möglich ist, im selben Atemzug klassisch und gegenwärtig zu sein, magisch und analytisch, unerschöpflich und kontingent. Wie kann das sein, fragt man sich: ein Requiem, das gleichzeitig ein Hymnus auf das Leben ist, und versucht noch der Suggestion zu trotzen, da ist man schon tief verstrickt in dieses Wunderwerk aus fünfzehn mal vierzehn Zeilen. Man kann vieles hineinlesen in diese Sonette, aber noch mehr wird man herauslesen müssen. Und dies ist das Zeichen, daß der Leser es mit einer Ausnahmeerscheinung zu tun hat.
Klassisch ist ein Stil, der im Moment der Formbeherrschung das Gleichgewicht hält. Es ist ein flüchtiges, spannungsgeladenes, vorübergehendes Glück, das die Griechen als akmé kannten – ein Ausdruck, der entgegen der landläufigen Vorstellung von Erstarrung in der Vollendung, etwas Höchstlebendiges, Blutvolles meinte, ein Atemholen auf Messers Schneide. Gibt es ein besseres Bild dafür als das kaum merkliche Beben der Schmetterlingsflügel? Denn aufregender noch als die Symmetrie und der feine Pigmentstaub, der so leicht an den Händen abfärbt, scheint mir das lauernde Innehalten dieser kleinen Papierservietten, wenn sie eben gelandet sind und man mit wachsendem Herzklopfen ihre Manöver verfolgt, sich totzustellen. Das leichte Klappen der Schmetterlingsflügel, in dauernder Startbereitschaft gehalten: Wäre dies nicht eine passende Definition für den klassischen Stil?
Nicht ohne Wehmut bemerkte ein Dichter des vorigen Jahrhunderts, Paul Valéry, am Beispiel des Sonetts den Wandel der Kunstauffassungen und des Zusammenspiels von Leben und Form. Man habe in Zeiten, als die Zeit nicht zählte, gesehen, wie einfache Sonette ihren Verfassern viele Jahre der Mühe und der Reifung abverlangten (Jahre voller Eifer, Verzweiflung, Wiederholungen, fast erreichten Versöhnungen), die das Verhältnis des Dichters zu seinen vierzehn Versen in eine lange und dramatische Liebesgeschichte verwandelten. Das war nobel gedacht, und man meinte sogleich die alte Leier zu hören vom Verfall des Handwerks und der Moral, die immer angeschlagen wird, wenn die altmeisterlichen Formen auf dem Spiel stehen. Valérv aber fährt mit der ruhigen Sicherheit des Propheten fort:
Ich glaube, daß diese Zeiten vorbei sind und daß wir uns im Goldenen Zeitalter befinden. Noch nie gab es jedes Jahr so viele Früchte und ich weiß nicht, wie viele Ernten.
Inger Christensen weiß, in welcher Zeit sie sich befindet und was sich in ihr ernten läßt. Und dieses Wissen, von Melancholie nicht ganz frei, in dem sich Sprachanalytik und poetische Intuition zu einer Art sechstem Gegenwartssinn verbinden, macht die eigentümliche Leistung ihrer Dichtung aus. Lange Zeit war ihre Muse die Linguistik, wobei sie sich streng an die Umgangssprache hielt und den einfachen Nominalsatz. Durch den Zusammenstoß simpler satzlogischer Aussagen entstand etwas wie eine karge Paradoxie. Man spürt es noch an dem kühlen Wind, der durch die großen seriellen Gedichtzyklen weht, Kompositionen wie alphabet von 1981 oder das von 1969. Während das eine, in Wiederholungen kreisend, den Dingcharakter der Sprache herausstreicht, ihr lexikalisches Eigenleben, mathematisch gezügelt in der Aufzählung vom Aprikosenbaum bis zum Narwal (denn bei N bricht ihr Versuch ab, der bis Z unmöglich durchzuhalten war), liest sich das andere als eine über zweihundert Seiten ausgebreitete Variation auf die Syntaxtheorien des damals sehr populären Sprachwissenschaftlers Chomsky. Manch einer wird erschrocken sein vor dem Pathos des Unpersönlichen, erst recht, wenn er hört, was diesen Dichtungen zum Konstruktionsprinzip wurde: von der progressiven Zahlenreihe (der sogenannten Fibonacci-Folge im Falle von alphabet) über die Generative Grammatik (in ihrer nüchternen Ode an eine Präposition im Falle von (das) bis zur Idee einer klassenlosen Sprache (in dem gleichnamigen Essay-Manifest). All das sieht auf den ersten Blick nach reiner Kombinatorik aus, nach lyrikgestützter Sprachtheorie. Leicht könnte man Inger Christensen für eine Vertreterin der abstrakten Moderne im Bereich der Wortkunst halten – wäre da nicht ihre Stimme. Gemeint ist nicht die Vibration im Kehlkopf, der akustische Fingerabdruck, sondern die Dichtergabe, den eigenen Schatten, das unruhige Selbst zum Rendezvous mitzubringen.
Denn anders als Skulpturen aus Sperrmüll, aufgeschlitzte Leinwände oder raumfüllende Installationen, die in zufälliger Anordnung Materialproben enthalten, wird das Sprachkunstwerk niemals ganz seinen Urheber verleugnen können. Kein Gedicht, egal wie transsubjektiv oder strukturautonom es daherkommt, wird sich am Ende auf die Bedeutsamkeit des Form-losen herausreden können. Denn es sind Seelen, die aus dem Alphabet Funken schlagen, ein Lyrik-Automat wird allenfalls verbale Lego-Steinchen ausspucken, etwas Präfabriziertes, das so berechenbar ist wie das Muster in den Socken des Konstrukteurs, so überzeugend wie das Gefasel vom Tod des Autors.
Dagegen sind die Gedichte der Inger Christensen gründlich gefeit. In ihnen wird, um eine Wendung George Steiners aufzugreifen, der Kontrakt zwischen den Worten und der Welt regelmäßig erneuert. Wie Hamlet weiß auch sie um ihr heilloses Verstricktsein in „this mortal coil“, weiß mit einem gerade bei Dichtern seltenen Realitätssinn, in welcher Zeit sie lebt und wofür sie mitverantwortlich ist. Das Technische als organisch begreifend und das Organische als Technikum behandelnd, arbeitet sie an einer Sprache, die beidem gerecht werden soll. Das Ziel, soweit es sich in den nahezu wissenschaftlich diskreten Selbstaussagen der Dichterin abzeichnet, ist eine Elementarpoesie für den heutigen Menschen. Nur so erklärt sich, warum ihre großen Gedichte immer auch Modelle sind von Gedichten. Jedes steht für ein anderes sprachliches Experiment, folgt seinen eigenen Regeln, seiner einmaligen Schreibmethode, die erst verabschiedet wird, wenn sich das Quod erat demonstrandum gleichsam vom Leser mitsprechen läßt. Ausgangspunkt aber, und das erlöst diese Dichtung von allem bloß Ambitionierten, war noch jedesmal, „was man eine Krise nennt“. Die umschreibende Formel stammt von ihr selbst, mit ihr geht die Dichterin auf Distanz zu allem vorschnellen Psychologismus, der beim Wort Krise gleich an Gemütsschwankung denkt, seelische Labilität. Ein Mißverständnis wie dieses erledigt gewöhnlich der Hinweis auf eine Schrift Stéphane Mallarmés mit dem Titel „Krise des Verses“, seine Abrechnung mit den Gewißheiten klassischer Verskunst, ein Dokument der Verstörung. Darin wird zum ersten Mal das Verschwinden des Poeten im Gedicht in Aussicht gestellt. Aber Verschwinden heißt keineswegs Tod. Unterwegs zum reinen Sprachkunstwerk werde der Dichter die Initiative an die Wörter abtreten. Dazu Christensen:
Wenn ich Gedichte schreibe, dann kann es mir einfallen, so zu tun, als schriebe nicht ich, sondern die Sprache selber.
Man beachte den Vorbehalt, die Figur des Als-ob in diesem Bekenntnis, denn die dänische Dichterin am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts ist eine ganze Drehung weiter als der Vater des Freien Verses am Ausgang des neunzehnten. Nicht das Verschwinden im Text ist ihre Provokation, sondern ihr verzweifeltes Wiederauftauchen, sobald die Luft knapp wird zwischen den willfährigen, aber fühllosen Wörtern, und ihre Schwerkraft erdrückend.
Das aber ist ihre Methode: In jedem ihrer großen Zyklen beginnt sie wieder am Nullpunkt, gegen gewaltige innere und äußere Widerstände, wie jemand, der noch nie eine Zeile geschrieben hat, jemand der nach einem erkenntniskritischen Unfall das Sprechen mühsam erst wieder erlernen muß. Oder wie ein großes, skeptisches Kind, das die Sprache wie ein Spielzeug auseinandernimmt, um nachzuschauen, woraus sie gemacht ist, wie sie funktioniert, woher ihre unüberwindlichen Defekte rühren (Mißverständnis, Irreführung, Inkongruenz, Aporie, schlichter Widersinn), und dies selbst auf die Gefahr hin, daß die Einzelteile (die Elemente der Sinngebung und Weltgewißheit) nachher verstreut umherliegen, wie beim zerbrochenen Wecker, den eingestürzten Türmen aus Plastiksteinen. Nicht auf Zerstörung hat sie es abgesehen, nicht um mutwilliges Experimentieren geht es ihr, sondern um ein Heraustreten aus dem Dämmerzustand, in dem das Bewußtsein die meiste Zeit durch Sprache gehalten wird. Existenzgründung ist das, wahrhafter Neubeginn im Sprechen, und das Leben geht mit in das jeweils Neue, noch Ungesicherte, folgt ihr in eine andere Stadt etwa, wie in Brief im April, einem Zyklus aus den 70er Jahren, der in Paris entstand während eines längeren Aufenthaltes dort mit dem fünfjährigen Sohn. In Gegenwart des Kindes geschieht es, daß sich die Welt in einem Akt umgekehrter Mimesis regelrecht neu konstituiert, vor den Augen der beiden wie vor denen des Lesers, in kurzen stockenden Zeilen wie diesen:
Wer weiß
ob ich selber
vielleicht
anders heiße
als ich selber.
Ich denke,
also bin ich Teil
des Labyrinths
Brief im April, abermals die Gangart wechselnd, folgt einem Kompositionsprinzip aus der Neuen Musik, der sogenannten symmetrischen Permutation, doch auch hier bleibt das Ich in der Nähe, vorauseilend und wiederkehrend, ein treuer Hund. Es ist das Kind, das den Anstoß zu einem neuen Sehen gibt. In einer Fernsehsendung über indische Architektur erblickt es einen jener unwahrscheinlichen Märchenpaläste, ich nehme an, ein Gebäude aus der Mogulzeit, und stellt die Frage:
Ist dieser Wasserfall aus Bildern wirklich ein Haus?
Der Satz findet wörtlich Eingang in das Gedicht. Man könnte sagen, er ist dort die Keimzelle einer weiteren semantischen Revolution, deren Ausgangspunkt der kindliche Blick war.
Und noch etwas fällt auf: In Christensens Elementarpoesie sind Lyrik und Prosa mitunter ununterscheidbar. Die Permutation prosaförmiger Syntaxelemente kann so weit gehen, daß das Ergebnis Gedichtfragmenten zum Verwechseln ähnlich sieht. Ein gutes Beispiel für solche Variationskunst ist etwa der Zyklus Wassertreppen, ein Stück klassischer Konkreter Poesie. Es ist ein Text, aus einfachen Satzaussagen im Präsens bestehend, der in seiner graphischen Anordnung von außen einem Gedicht aus Langzeilen gleicht. Entstanden ist er während eines Rom-Aufenthalts in den 60er Jahren. Verschiedene öffentliche Plätze mit Springbrunnen werden aufgezählt, die ewige Stadt wird in ihrer Barockarchitektur heraufbeschworen, und immer wieder fährt ein roter Jaguar durch die Postkartenmotive, in die auch die Beobachterin selbst eingegangen ist, in wechselnden Positionen, am Caféhaustisch sitzend, auf den Treppenstufen, als Touristin umherspazierend. Der Klang italienischer Eigennamen (Via Delfino, Pomodori ripieni, Il Tempo) gibt dem Ganzen, bei aller Nüchternheit, den Charakter eines Hymnus. Das Beharren auf der einen Zeitform weist darauf: Es geht um die Darstellung reiner Gegenwart, die Zerlegung der Gegenwart in wiederkehrende Einzelmomente. Das Ich erstattet über eine Folge diskreter Augenblicke im Stadtraum Meldung. „Das Licht wechselt von Alt auf Avanti“. Man könnte auch sagen, es geht um die allmähliche Auflösung des Beobachterstandpunktes, eine grammatikalische Trunkenheit, bei der die Elemente der Umwelt in zunehmender Synästhesie durcheinanderwirbeln. Was die Wassertreppen, ungeachtet ihres Prosaduktus’, zum Gedicht macht, ist ihre strenge Gliederung in sieben Abteilungen zu je fünf Absätzen, die ihrerseits Strophen entsprechen. Wiederholung und Vertauschung der Redeteile, schließlich ihre Reduktion auf wenige Bildelemente sind das Bauprinzip. Hört man genau hin, mischt sich von ferne sogar das Plätschern von Rilkes „Römischer Fontäne“ aus dem Garten der Villa Borghese unter („Zwei Becken, eins das andre übersteigend / aus einem alten runden Marmorrand“), von der Dichterin aufgefangen und transportiert in ihren eigenen Cantus Lingualis.
Wofür steht das einzelne Wort in den Gedichten der Inger Christensen? Ist es der bloße Signifikant, ein launischer Schnörkel aus Haken und Ösen, das Spielzeug des Kalligraphen? Ist es der Talisman, den man unter der Zunge trägt, ein Fetzen im Sinne Shakespeares? Oder ist es als Rätsel, rein entsprungen, selbst Sinnbild, Notenwert für eine Klangfügung, die bis zur Psyche durchdringt und erst dort völlig aufgeht? Inger Christensen selbst hat ihre Tätigkeit einmal mit der eines Baums verglichen, der einfach Blätter treibt, ganz so, als gehorche auch sie beim Aneinanderreihen von Worten nur einem Natur- und Wachstumsgesetz. Es gibt eine Aufzeichnung des jungen Walter Benjamin zur Sprachphilosophie, darin ist vom Skelett des Wortes die Rede. Gemeint ist das eigenartige Phänomen, daß ein Wort, sieht man es lange genug an, die Intention auf seine Bedeutung verlieren kann. Schon das Schulkind macht die Erfahrung, wie Langeweile ihm das an der Tafel Geschriebene entzieht, je länger es ins leere starrt. Die symbolische Kraft läßt nach, das Wort fällt gewissermaßen vom Fleisch, wird zum Skelett: Es grinst dann und schneidet Grimassen.
Genauso kann es einem beim Lesen von Inger Christensens „Gedicht vom Tod“ ergehen. Gerade die Nacktheit der Worte ist hier das Beklemmende: das betont magere Inventar weniger wiederkehrender Ausdrücke, die schnell durchsichtig werden bis auf die Knochen. Auch diesem Gedicht ging wie alphabet eine schwere Krise voraus. „Warum überhaupt schreiben, wenn die Unlesbarkeit bloß anhält?“ fährt es der Dichterin durch den Kopf. Die Frage, ein äußerst starkes, die Schreibhand lähmendes Gift für den, der von ihr gebissen wird, geht an die Substanz literarischen Ausdrucks, der Zweifel betrifft die Vermittlerfunktion: ob die Welt in poetischen Stenogrammen überhaupt faßbar und lesbar wird. „Gedicht vom Tod“ handelt von der Unmöglichkeit, den eigenen Tod zu fassen, ihn im Wort einzukreisen. Wer es dennoch versucht wie die Autorin, muß feststellen, daß jede Meditation zuletzt leer ausgeht. Dies aber ist es, die Unmöglichkeit, den eigenen Tod zu denken, was die Angst vor dem leeren Blatt zum Faktum macht, das ein volkstümlicher Aberglaube gern mit der Platitüde erledigt, dem armen Künstler falle halt manchmal nichts ein.
„Nichts ist geschehen / tagelang sitz ich / vorm Papier aber / nichts geschieht“, so beginnt das Gedicht, und bald heißt es resigniert:
die Wörter sterben ja wie Fliegen
ihre Leichen überall weggefegt
von dem weißen Papier
gib dem Staub etwas Platz
Einige Strophen später aber kommt es, bei aller Sachlichkeit des Tons, zu einem fast Rilkeschen Wetterleuchten, so in den traurigen Zeilen:
Heut nacht hab ich geträumt
ich sei tot und käme mit meinem
Hund zusammen ins
Totenreich gelaufen.
Unmerklich hat das Bewußtsein doch noch durch das leere Blatt hindurchgefunden und ist entwischt. Schmetterlingsleicht hat die Dichterin das Papier gestreift und fein wie Pigmentstaub ihr Siegel hinterlassen, eine Geste von kindlicher Transzendenz.
Ausgerechnet von Stéphane Mallarmé, der mit seiner Poetik so viele Wege verbaut hat, kam die Botschaft, die mit einem Satz Horizonte eröffnen sollte. Nachdem alle Versuche gescheitert waren, Poesie zu definieren ohne sie gleichzeitig zu denunzieren, kommt ihm die schlichte Einsicht. „Es gibt das Alphabet, und dann Verse“, sagt er, „mehr oder weniger dicht, mehr oder weniger locker gefügt.“ Es ist die allgemeinste Bestimmung dessen, was wir uns angewöhnt haben, Lyrik zu nennen. Mallarmé hat recht behalten, und hier ist ein Werk, das ihn wörtlich nimmt. Es könnte der erste Hauptsatz der Poetodynamik Inger Christensens sein:
Es gibt das Alphabet, und dann Verse.
Bleibt zum Schluß die Frage, wer jener „Tor des Universums“ ist, der in den Sonetten vom Schmetterlingstal umgeht? Der neuzeitliche Mensch, ein Wesen vom Typ des Quantenphysikers, des Genomforschers, dem Natur fremd wird in dem Maße, wie er gestaltend in sie eingreift und so eine zweite Natur schafft, grausam schön und in sich katastrophisch? Der dreiste Beobachter, dessen Schwindelgefühl zunimmt, je mehr er sich von ihr lossagt, der neuen, unabsehbaren Kettenreaktionen noch kaum Eingedenk? Der Universalmelancholiker, der Chaosforscher mit seiner schaumigen Lehre vom Schmetterlingseffekt, eine Art Hamlet des Atomzeitalters? Ihnen allen wird etwas vorgegaukelt, das dem Dichter, dem Liebhaber primärer Erscheinungen, mit etwas Glück als flüchtiges Wesen und Wort hin und wieder ins Netz geht. Das Gedicht ist ein Wegweiser in eine Zwischenwelt, in der Traum und Realität verschmelzen, in dem das Universum physikalischer Gegenstände und die Welt des menschlichen Geistes, der Mythen, Erzählungen und Gemälde eins werden. Inger Christensen ist eine Dichterin aus der Zukunft – die aber zufällig heute schon lebt. Mit ihrem Sonettenzyklus vom Schmetterlingstal, der einsam dasteht in der Gegenwartslyrik, hat sie viel Zeit gewonnen, genügend Zeit für eine Wiederkehr in immer neuer Lektüre.
Soll ich von unseren zahlreichen Begegnungen erzählen – in München, Berlin, Kopenhagen, Münster? Nein, lieber nicht. Es ist auch nicht viel zu sagen. Außer, daß man dann lange zusammensitzt, schweigend, jeder ein Weinglas vor sich, und wie überaus angenehm und beruhigend ein so gesteigertes Kommunizieren sein kann. „In einem gesättigten bildlosen Ausruhn / des Gemüts“, wie es bei Christensen einmal heißt, im Epilog zu Es, ihrem großen, zweihundert Seiten umfassenden Gedicht, mit dem sie sich in den Atlas der europäischen Poesie eintrug. Eines Tages weiß jeder Dichter so gut wie alles über die Dichtung, man kann ihm nichts mehr vormachen, wenig Neues mehr beibringen. Das Schwierige daran ist nur: Jeder weiß es auf seine eigene Weise. Er weiß es sozusagen nur für sich selbst, und sein Wissen besagt wenig für die anderen, die eben erst anfangen und aufs neue die Sprache erfinden.
Es gibt eine gewissermaßen cartesianische Vollkommenheit, wie man sie von Eiskristallen oder Flugzeugturbinen kennt. Mit tiefer Bewunderung bekenne ich, daß Inger Christensen ihr in manchen ihrer Gedichtzyklen ganz nahe gekommen ist. Zugegeben, die Vollkommenheiten der Sprache sind von anderer Art als die von Natur und Technik. Wir wissen aber von Graden der Annäherung, und von diesen hat uns die dänische Dichterin eine Vorstellung gegeben. Der Dichter Peter Waterhouse hat es so ausgedrückt:
Unsterblichkeit heißt auch: große Gleichmäßigkeit. Inger Christensens Gedichte und andere Schriften sind von großer Gleichmäßigkeit.
Ich möchte ergänzen: von einer neuen, bislang unbekannten Regelmäßigkeit, einer eigenen Landvermesserqualität, die sich nicht nur ihre erstaunlich funktionalen Karten samt zugehöriger Kartographie selber schuf – sondern auch ihr eigenes Territorium dazu. Mehr läßt sich beim besten Willen nicht verlangen. Wir sollten dankbar sein, daß es das gibt.
Lassen Sie mich mit einem Hinweis schließen, der in der Aufregung um große Dichtung sich leicht vergißt. Ich nehme an, die wenigsten Leser sind des Dänischen mächtig, gleichwohl sind sie, angelockt von den Schätzen der Nachbarsprache, zum Zuhören gekommen. Öffnen aber kann ihnen die Schatztruhe erst genaueste Übersetzung. Deshalb sei an dieser Stelle auch der Übersetzer bedankt, Hanns Grössel, der seit vielen Jahren die Gedichte Inger Christensens ins Deutsche importiert. Ohne sein Tagwerk bliebe einem Indogermanen, außer der lieblichen Sprachmusik, allenfalls eine Ahnung von den großartigen Gedankensprüngen des Originals. Die großen Gedichte sind so beschaffen, daß man sie auf der Stelle laut lesen möchte.
Berlin, 2007, Nachwort
Entfaltung der Perfektion:
Inger Christensen liest selbst auf Dänisch ihr Meisterwerk Alfabet und Das Schmetterlingstal, Hanna Schygulla leiht der deutschen Fassung des Schmetterlingstals und den Wassertreppen ihre Stimme. Nach den Regeln der Fibonacci Zahlen legt die skandinavische Lyrikerin in Ihren Gedichten ein Inventar der Welt an. Behutsam und in Bildern von eindringlicher Schönheit errichtet sie darin, bei A beginnend, ein poetisch-präzises Weltgebäude. Wer je gehört hat, wie Inger Christensen ihre Gedichte liest, mit leiser Stimme in einer Art Gesang, weiß, welche Suggestion davon ausgeht, eine unbezwingbare Gewissheit, ein Meisterwerk zu hören.
PFAUENAUGE, ZU INGER CHRISTENSEN
im wasserspiegel, kostbar und oval,
im ersten strahl schon reflexiv,
schön rief mein fühler-, flügelpaar,
einander lustoral, liebäugling uns.
im blätter-, doch auch wetterleuchten
uns zungenspalter sind und -psalter,
einander blütensäugling, postnatal
dies musterexemplar im lebensfeuchten.
ornatmental und hieroglpyhisch tief
blieb selbsterfasser und -entfalter,
als mit geschmetter, solcher donnerletter
uns selbst erbrach der brief, mein siegel.
Franz Josef Czernin
Thomas Sparr: Lesbarkeit der unlesbaren Welt. Die dänische Lyrikerin Inger Christensen, Merkur, Heft 567, Juni 1996
Uljana Wolf sprach im Rahmen des poesiefestival berlin 2008 mit Inger Christensen.
Zwiesprachen: Nico Bleutge über Inger Christensen. Am 5. November 2019 im Lyrik Kabinett, München
Jan Wagner: Weltenformeln. Vor allem über Inger Christensen. Zweiter Bamberger Poetikvortrag im Rahmen der Bamberger Poetikprofessur
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Archiv + Kalliope +
Johann-Heinrich-Voß-Preis + Europäischer Übersetzerpreis
Porträtgalerie
Nachrufe auf Hanns Grössel: Übersetzen ✝︎ FAZ ✝︎
Fakten und Vermutungen zur Autorin + IMDb + Internet Archive +
Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Inger Christensen: FAZ ✝ Die Zeit ✝ poetenladen.de ✝
Neue Zürcher Zeitung ✝ FR ✝ Die Welt ✝ cafebabel.com ✝ Tagesspiegel
Inger Christensen spricht 2008 mit Paal-Helge Haugen.


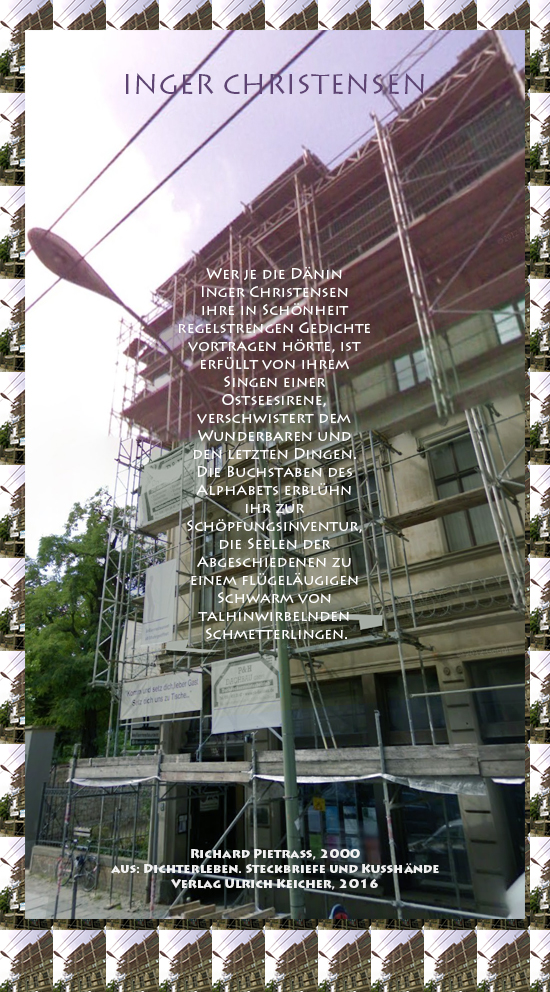












Schreibe einen Kommentar