Jan Faktor: Henry’s Jupitergestik in der Blutlache Nr. 3 und andere positive Texte aus Georgs Besudelungs- und Selbstbesudelungskabinett

Faktor-Henry’s Jupitergestik in der Blutlache Nr. 3 und andere positive Texte aus Georgs Besudelungs- und Selbstbesudelungskabinett
LEST DIE MANIFESTE DER TRIVIALPOESIE !
Trivialpoesie ist der Ausweg aus der gegenwärtigen
aaaaaKrise der Poesie
Trivialpoesie ist die Poesie des Geistes dieser Zeit
Trivialpoesie entspricht als einzige den Forderungen
aaaaaradikaler Ästhetik
die Manifest der Trivialpoesie werden euch die Augen
aaaaaaufschließen
werden euch die Fragen beantworten die euch schon lange
aaaaaquälen
in den Manifesten der Trivialpoesie werdet ihr die Theorie der
aaaaaaaaaawirklichen Poesie der Gegenwart kennenlernen
Lest die Manifeste der Trivialpoesie !
Mit diesen Texten
wird zu heftigem Widerspruch oder sarkastischer Zustimmung aufgefordert. Jan Faktor gehört zu den Autoren, die sich herkömmlicher Literatur strikt verweigern und ihre Arbeit aus einer konsequenten Anti-Ästhetik heraus entwickeln.
Ein-Akter gerieren als Open-End-Bühnenwerk, als Minimal-Plays für zahllose Darsteller – Travestien und Tragic-Comics in einem. Sein bravouröses Manifest steigert die Selbstbezichtigung des eigenen Berufsstandes ins wahrhaft Monströse – mit einem radikalen Humor, um einer Phase depressiven Zweifels aggressiv zu begegnen. Dabei ist der Autor immer den Meriten und Komplikationen auf der Spur, die ihm unsere Sprache bietet. Oft düpiert er die eigenen Exerzitien durch listige Überlegungen und hinterhältige Fallen: Was ist neu an der jungen Literatur der 80er Jahre? Texte für Leser, die mit ihm Spaß daran finden, den eingelaufenen Literaturbetrieb ernsthaft in Frage zu Stellen.
Janus Press & BasisDruck Verlag, Klappentext, 1991
Das Spiel ist die Regel
… Henry’s Jupitergestik in der Blutlache Nr. 3 und andere Texte aus Georgs Besudelungs- und Selbstbesudelungskabinett lautet der Titel von Jan Faktors zweitem Buch. Der Autor bleibt seinen Gegenständen treu: der literarischen Existenz als Dauerskandal und dem Räderwerk des Sprachgetriebes. Wie fast jeder Schreiber sucht er die Mehrheit der Leser zu erreichen und spricht so mit Vorliebe die Freunde und Freundinnen der „wahren Kunst“ an, der „hübschen“ und „didaktischen“, der „ernsten“ und „ausgewogenen“ Literatur, der Literatur der „niedlichen Gefühlsfülle“ und „gemäßigten Stilhaftigkeit“. Ihnen sucht er beizubringen, daß „das Hauptproblem der Literatur ist, daß alle schlecht schreiben“. Wenn dem so ist, kommt es darauf an, gut schlecht zu schreiben, was Faktor durchaus gelingt. In doppelbödiger Literaturbeschimpfung zum Beispiel: „Das Selbstbesudelungsmanifest fünf tapferer Literaturrevoluzzer, wie es die Zeit verlangt.“ „Diese Selbstbesudelung ist ernst gemeint, und sie ist auch ernst zu nehmen.“ Solcher Satz – sind es doch die ausdrücklichen Versicherungen, die Zweifel wecken – verrät Faktors gewieften Umgang mit rhetorischen und psychologischen Mustern. Denn in seinen Manifesten stecken viele Wahrheiten, übertriebene Wahrheiten, wahre Übertreibungen – aber können Wahrheiten überhaupt übertrieben werden? Wie auch immer, das Selbstbesudelungs- wirkt zugleich als Selbstreinigungsmanifest, verdankt es sich doch nicht zuletzt der Erfahrung, daß auch der inoffizielle Literaturbetrieb Literaturbetrieb ist und war…
Jürgen Engler, 1992
Neue Manifeste
− Buchtitel müssen nicht kurz sein, um zu beeindrucken. So Jan Faktors Henry’s Jupitergestik in der Blutlache Nr. 3 und andere positive Texte aus Georgs Besudelungs- und Selbstbesudelungsmanifest. −
Der 121 Seiten umfassende Band ist im vergangenen Jahr in Gerhard Wolfs Verlag Janus press erschienen und enthält Texte verschiedenster Coleur: So einen Einakter, eine „Sprechübung für zwei Stimmen“, einen Essay zur „jungen Literatur der 80er Jahre“ und das, was in der gegenwärtigen Literatur meist schlicht als „Text“ bezeichnet wird. Und was natürlich bei Jan Faktor nicht fehlen darf: Manifeste. Denn Faktor, geboren in der ČSSR, Anfang der 80 Jahre in die DDR übergesiedelt, hat in seiner Dichtung die Tradition der Manifeste der zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts fortgesetzt. Das „Selbstbesudelungsmanifest fünf tapferer Literaturrevoluzzer, wie es die Zeit verlang“ gehört zu den eindrucksvollsten und stärksten Texten des Buches. Mit ironischer Distanz werden hier die in der Literatur tätigen und ihre Welt beschrieben. Das intelligent verfaßte Selbstbesudelungsmanifest beeindruckt auch in seiner sprachlichen Vollkommenheit, etwa wenn es heißt. „Wir sind ,Desperados des Papiers‘, um es mittelmäßig originell und vollblutig geschmacklos zu sagen.“
Im gesamten Band steht, im gängigen Sinne, Sinnvolles neben wieder, im gängigen Sinne, Sinnlosem, das aber meist, läßt man sich darauf ein, erheitert, Neues über Sprache erkennen läßt, so etwa „ein Versuch, den Konsonanten ,f‘ stimmhaft auszusprechen.
Bei einigen Texten allerdings fällt es auch dem aufgeschlossenem Leser schwer, zumindest Assoziationen (von Verstehen nicht zu reden) entwickeln zu können, etwa bei „Adornos Wahrheit“.
Auch wenn Faktor feststellt: „Das Hauptproblem der Literatur ist, daß alle schlecht schreiben“ so ist dies keineswegs belehrend gemeint, sondern wieder mit der ihm eigenen Ironie vermischt.
Faktor, der selbst mit der „Szene vom Prenzlauer Berg“ zusammengearbeitet hat, erkennt durchaus deren Grenzen. Etwa wenn er in dem aufschlußreichen Vortrag zur jungen Literatur der 80er Jahre vom „gewaltlosen Abtreten des Sprachspiels an die Werbeagenturen“ spricht, denn gerade der spielerische Umgang mit Sprache war auch diesen Dichtern eigen.
Wegen seines Witzes, seiner Sprachgenauigkeit, seines Nicht-Belehren-Wollens, seiner Vielseitigkeit, ist dieses schön gemachte Bändchen Jan Faktors mit dem so sehr langen Titel zu empfehlen.
Timme, Leipziger Rundschau, 10.6.1992
Alle schreiben schlecht
− Jan Faktor und das Positive. −
Einen „Schalksnarr“, einen „Schweijk“ hat man ihn genannt, diesen Jan Faktor aus Prag, der seit 1978 in Ost-Berlin lebt und tschechisch, aber auch zunehmend deutsch schreibt. Seine experimentellen Texte haben einige Beachtung gefunden. Vor allem wohl deshalb, weil sie das Methodische als höheren Jux traktieren. Etwas als Georgs Versuche an einem Gedicht und andere positive Texte aus dem Dichtergarten des Grauens. Faktors neuestes Produkt benennt sich Henry’s Jupitergestik in der Blutlache Nr. 3 und andere positive Texte aus Georgs Besudelungs- und Selbstbesudelungskabinett.
Man liest manchmal witzige, manchmal zähe Exerzitien mit Worthäufigkeiten oder –vertauschungen, Sprechübungen à la Jandl und so etwas wie die Skizze einer Sprechoper. Aus ihr kann man getrost zitieren, ohne einen Zusammenhang zu beschädigen; etwa „Prometheus zum Adler: Wenn du mal Heiner Müller siehtst, erzähl ihm, daß ich in Ruhe gelassen werden wollte“. Faktors Krähe nährt sich nicht von Heldenlebern, sondern von Verbarien. Die Sprache bietet Reiz und Verfremdung genug. Faktor möchte solch linguistische Poesie nicht mit großen Begriffen belasten. Er gibt sich als Narr, der durch schlichte Wahrheiten frappiert. „Politisches Engagement an sich schützt nicht vor Harmlosigkeit!“ oder „Das Hauptproblem der Literatur ist, daß alle schlecht schreiben“. Recht hat er. So liest er sich und den Kollegen in seinem „Selbstbesudelungsmanifest“ gehörig die Leviten. Schreiben erscheint als Laster, als lebenslange Krankheit, als progressiver Lebensverlust: „Je professioneller wir schreiben; desto abgestorbener sind wir.“
Derlei bringt er ohne Wut vor, ein heiterer Bezichtiger, aber um den Preis der Provokation. Er kommt aus dem Spaßen nicht mehr heraus: „Richtige Kunst entsteht nicht aus Wut, und in uns ist zu viel Wut. Auch dieser Text ist scheußlich, ungerecht, unrein.“ Das ist leider eine Selbsttäuschung. Nichts an Faktors Texten ist scheußlich und unrein. Nicht mal ungerecht kann er sein, dieser Schalk, geschweige denn zornig. In einem langatmigen Vortrag für ein Bremer Symposion 1988 plaudert er halb ironisch über die DDR-Literatur der achtziger Jahre: ein bißchen über die Lesungen in Wohnungen und Kirchen, über die Zeitschriften und das Scheitern der Projekte, ein bißchen über Repression und die verlorene poetische Autonomie, und „Sascha“ erscheint in milder Distanz als Promotor der Szene. „Einiges bewegt sich“, heißt es am Schluß.
Es hat sich tatsächlich einiges bewegt, seitdem. Wenn dieser überholte Text schon dokumentiert werden mußte – warum nicht mit einer abschließenden Glosse? Die Krähe darf ruhig mal ein Auge riskieren, notfalls ihr eigenes. Sonst bleibt sie wirklich harmlos.
Harald Hartung, Frankfurter Allgemein Zeitung, 21.3.1992
Das Verschwinden des Autors
Anmoderation: Jan Faktor stammt aus Prag und lebt seit 1978 im Ostteil Berlins. In der DDR wurden seine Texte nur in selbstverlegten Zeitschriften abgedruckt. Erst 1989 erschien im Aufbau-Verlag ein Buch von Jan Faktor mit dem Monstertitel: Georgs Versuche an einem Gedicht und andere positive Texte aus dem Dichtergarten des Grauens, mit Gedichten und experimentellen Textmontagen. Jan Faktors zweiter Band ist bei Janus press herausgekommen und hat ebenfalls einen gedächtnisfeindlichen Titel: Henry’s Jupitergestik in der Blutlache Nr. 3 und andere positive Text aus Georgs Besudelungs- und Selbstbesudelungskabinett.
Sprecher: Dem gutwilligen Leser wird gleich von Anfang an der Boden unter den Füssen weggezogen: „Wer heute die wahre Kunst ernst nimmt, dem ist nicht zu helfen“, heisst es in der boshaften Statement-Montage mit dem Titel „Das Hauptproblem der Literatur ist, dass alle schlecht schreiben.“ Denn die Literatur krankt nicht nur an der Ignoranz der Kritiker, der Dummheit der Leser und dem Literaturbetrieb überhaupt, sondern in allererster Linie an ihren Urhebern: den Autoren. Nachdem die Ära der Publikumsbeschimpfungen allmählich zu Ende geht, scheint nun die grausige Zeit der Selbstbesudelung angebrochen. Das „Selbstbesudelungsmanifest fünf tapferer Literaturrevoluzzer, wie es die Zeit verlang“ ist eine groteske Attacke auf alles, was da schreibt.
Zitat: „Wir fünf von innen faulende, mit besten Giften geladene Kotzbrocken denunzieren hiermit alle, die wir erreichen können; also nicht nur die anderen Literaten, nicht nur uns selbst (uns fünf), sondern alle, die sich zu uns Literaten hingezogen oder uns zugehörig fühlen sollten. Wir alle sind arme Schweine und als solche sind wir etwas sehr Unschönes geworden: Literatur zu einem ganz üblen Zweck – zum Zweck der Verachtung aller anderen, die keine sind. Und von uns, gerade von uns Literaten werden so etwas wie Klarheit und so etwas wie Antwort erwartet. Von uns – von den faulenzenden geistigen Geheimkrüppeln der Nation, die sehr viel Schlaf brauchen und trotzdem nie richtig frisch sind (wir wachen einfach schon müde auf).“
Sprecher: Schonungslos kotzen diese Impotenzler ihren belletristischen Jahrhundertfrust aus, vierzig penetrante Seiten lang.
Des Selbstbesudelungsmanifest ist jedoch nu das nervtötendste und bissigste einer ganzen Reihe von Manifesten. In Jan Faktors erstem Band lernt man bereits die Manifeste zur Trivialpoesie kennen. Seine Vorliebe für das Manifest ist durchaus kein Zufall, denn im Manifest wird die Schwachstelle der Literatur, der Autor kurzerhand suspendiert. In Jan Faktors Text-Kabinett finden sich allerdings noch ganz andere Ungeheuer, die bestens ohne Autor auskommen: Der Auszug aus dem Anti-Drama „Henry’s Jupitergestik in der Blutlache Nr. 3“ lässt beispielsweise ein perpetuum mobile aus Wörtern erahnen, das sich endlos selbst reproduziert.
In der Strategie solcher Texte macht sich jede Mystifikation und Metaphorik aus dem Staub. Eine fast schon stoische Nüchternheit bestimmt auch den Vortragstext mit dem prosaischen Titel: „Was ist neu an der Literatur der 80er Jahre?“. Dies ist der einzige Text, der sich von seinem Autor nicht lösen lässt: Aus betont subjektivem Blickwinkel unternimmt Jan Faktor seine kritische Bestandsaufnahme dessen, was in der unabhängigen DDR-Kulturszene entstanden ist. Man liest diesen Bericht freilich mit erhöhter Aufmerksamkeit, nachdem Sascha Anderson und Rainer Schedlinski als Stasi-Mitarbeiter bekannt sind. Obwohl der Text schon vor vier Jahren entstanden ist, wirft er auf viele Details ein erhellendes Licht. Man beginnt zu ahnen, dass das Selbstbesudelungsmanifest durchaus etwas mit dem Innendruck und der Isolation der Dichterszene am Prenzlauer Berg zu tun haben könnte…
Im Vergleich mit dem ersten Band ist Jan Faktors zweites Buch in verschiedenen Punkten radikaler. Man vermisst jedoch gleichzeitig etwas, oder vielmehr jemanden: „Georg“ fehlt. Die unsichtbare Figur „Georg“ pflegte nämlich immer dann aufzutauchen, wenn sich zwischen dem Autor und seinem Text ein Zwischenraum auftat. Mit dem Verschwinden des Autors aus seinem Text hat sich jedoch auch dieser Spielraum verflüchtigt, und was vorher oft rätselhaft schillerte, ist nun in Gefahr, monolithisch zu erstarren. Georg lebt in einem ungewissen Exil. Auf der Rückseite des Buchdeckels heisst es geheimnisvoll: „An Georgs Vergangenheit wird gearbeitet“. Hinter dem Rücken des Autors ist schon längst ein Fortsetzungsroman in Gang…
Sieglinde Geisel
Lest Coca-Cola!
Was Adolf Endler die „Prenzlauer-Berg-Connection“ genannt hat, fand seinen mittlerweile nachprüfbaren Niederschlag in den Materialschlachten der Hinterhofpoeten aus Erfurt, Dresden, Leipzig und vor allem Berlin (Ost). In zahlreichen Anthologien, Dokumentationen und Einzelbänden wird zur Zeit die Geschichte einer Insubordination festgehalten, das Erscheinungsbild einer Subkultur, deren Träger jene erste Künstlergeneration war, auf deren Integration der DDR-Staat glaube verzichten zu können.
Daß Künstler unbestechliche Seismographen gesellschaftlicher Befindlichkeit sind, hat sich noch einmal bestätigt: Während sich die politisch- und musisch-sensibilisierten Verweigerer aus der Generation der „Hineingeborenen“ lediglich ins Exil der Hinterhöfe flüchteten, wählten ihre etwas materialistischer veranlagten Altersgenossen bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zu Hunderttausenden die Flucht über die Grenze. Spätestens jetzt sollte sich die arrogante Verlautbarungspolitik einer monologisierenden Macht, die jahrelange Verweigerung des gesellschaftlichen Dialogs rächen. Ohne es zu bemerken, hatte die politische Klasse eine Auseinandersetzung verloren, die sich im Rückblick als entscheidend für ihre Niederlage erweisen sollte: den Kampf um die Sprache.
Da sich die Wirklichkeit und die Sprache der Macht nicht mehr deckten, bedeutete dies für eine auf Ideologie begründete Herrschaft die Aushöhlung ihrer Autorität, deren Verlust zum Schluß nur noch mit nackter Gewalt zu verhindern gewesen wäre. Doch auch das wäre nicht mehr als ein Aufschub gewesen, da die Herrschaft über die Wörter längst verlorengegangen war. Dafür hatten in erster Linie die Buchstaben-Guerilleros aus den Hinterhöfen gesorgt. Indem sie die Sprache beim Wort nahmen, brachten sie das Lügengebäude der Ideologien zum Einsturz.
Zu den Vorläufern der politischen Luntenleger gehörten die autonomen, sprich: selbsternannten, Sprachbesetzer der Republik, Poeten wie Sascha Anderson, Stefan Döring, Bert Papenfuß-Gorek und viele andere, unter ihnen auch der 1951 geborene Prager Jan Faktor, der seit 1978 in Ostberlin lebt. Faktor nimmt in mehrfacher Hinsicht eine Sonderstellung ein.
Als redlicher Pfropf aus dem Holz des braven Schwejk ist er unter den närrischen Prenzelberger Poeten der vielleicht Närrischste. Seine Texte gibt er aus als die Versuche anderer; er „erfindet“ z.B. Georg, eine Figur, der er risikolos poetische Experimente unterschieben kann, die so neu gar nicht mehr sind, oder er „findet“ die „Gedichte eines alten Mannes aus Prag“, die „Fragmente eines unbekannten Gesamtwerkes“. Das sind legitime Techniken der Distanzierung, die den Verdacht ausräumen, hier könnte einer womöglich versucht haben, poetische Versuchsanordnungen, die aus anderen Epochen der Sprachrevolte hinlänglich bekannt sein dürften, auf naive Weise zu wiederholen.
Auch bei der Mitteilung/Warnung(?) am Anfang des Bandes, alle Texte – abzüglich einiger Ausnahmen – seien in Tschechisch geschrieben und dann erst ins Deutsche übersetzt worden, kann man sich nicht ganz sicher sein, ob dies nicht auch als Methode der Verfremdung gedacht uns die Übersetzerin „Annette Simon“ nichts als die „Erfindung“ eines eulenspiegelnden „Faktors“ ist. Sollte ich mich irren, dann verbeuge ich mich vor den Sprachkünsten der Dame, denn es dürfte nicht ganz einfach gewesen zu sein, Texte zu übersetzen, die, wie Adolf Endler bemerkte, „oft wie in einem angelernten Deutsch geschrieben wirken (oder tatsächlich sind), was auch von Jan Faktor, dem wirkungsvollen Entertainer und Inszenator nach Art manches Zirkusclowns als verfremdender Reiz eingesetzt wird…“
Wie dem auch sei, vermutlich muß man dem Sprachartisten Jan Faktor bei seinen Exerzitien live beigewohnt haben, um wie Adolf Endler dabei ins Schwärmen zu geraten. Das Filet-Stück des Bandes „Georgs Sorgen um die Zukunft. Ein Text zum Durchblättern (gekürzte Fassung), dauert, wenn man den Anmerkungen des Autors Glauben schenken will, 27 Minuten und setzt wie folgt ein:
Das zukünftige wird immer zukünftiger
das Sorgende immer sorgender
und
das Hiesige immer hiesiger
das Dortige immer dortiger
das zerbrechliche immer zerbrechlicher
das Langweilige immer langweiliger
das Irreparable immer irreparabler
das Sinnlose immer sinnloser
das Tatlose immer ratloser
das Böse immer böser
das Senile immer seniler…
usw.usf.
Man kann diese Orgie der Komparationen in ihren geglückten Partien durchaus als eine Beschreibung der Hoffnungslosigkeit in der damals noch realexistierenden DDR betrachten, d.h. dem realitätsbezogenen, politischen Charakter des Textes den Vorzug gegenüber dem experimentellen, sprachbezogenen Aspekt geben. Das käme den Intentionen Jan Faktors, so wie man sie seinen „Manifesten der Trivialpoesie“ entnehmen kann, sicher entgegen. Ziel seiner pädagogisch bemühten Poetik ist die Emanzipation des Gefühls gegenüber dem Verstand. Das ist begreiflich, wenn man sich wie Jan Faktor in einer Gesellschaft bewegt, wo das Gefühl gegen die zustände rebelliert, der Verstand aber zu Vorsicht und Kompromissen mahnt. „Der Sinn der Trivialpoesie liegt in ihrer subversiv oppositionellen Wirkung.“
In diesem Sinn ist das laute Aussprechen von Gefühlen revolutionär: Es zeugt von einer Umpolung des individuellen Weltbildes; nicht mehr der Kopf bestimmt, im Namen eines wie auch immer gearteten, ideologischen Entwurfs, sondern der Bauch, ausgehend von den ureigensten Bedürfnissen des einzelnen. So weit, so gut. Wie aber hat man sich diesen Ansprüchen entsprechend „ideale“ Trivialpoesie vorzustellen? Laut Faktor so „Beispiel Nr. 1:! Ich habe Hunger.“ Oder auch so: „Beispiel Nr. 2! Ich will ficken.“ Höhepunkt der Trivialpoesie dürfte also der Ruf der Straße gewesen sein: Wir wollen raus! Dem konnte eigentlich nichts mehr folgen, es sei denn etwas in der Art von: „Ich will Coca Cola! Die „Trivialpoesie“ ist also von der Geschwindigkeit der Veränderungen überrollt und historisch geworden, bevor sie überhaupt zur Kenntnis genommen werden konnte.
Wie aber steht es um den ästhetischen Innovationswert dieser Poesie, so wie er sich an den Texten ihres „Erfinders“ ablesen lässt? Es ist angemerkt worden, dass sich die Texte Faktors vielfach gebrochen, oft als „Clownerie“ darbieten, letztendlich als Kommentar, was sich auch in der Auswahl der Textsorten spiegelt: serielle Versuchsreihe, grammatikalisches Exerzitium, Anmerkungen, Manifest, Motto usw.
Das ist von der aufklärerischen Intention her löblich, doch wegen der geringen Geschwindigkeit des Textablaufs eher langweilig. Alfred Andersch hatte sich bei seiner Auseinandersetzung mit der Nachkriegsavantgarde dagegen ausgesprochen, dass der Künstler wie der Wissenschaftler Versuchsreihen veröffentlicht: Was er vorzulegen habe, „sind Ergebnisse, nicht Experimente“. Wenn man bedenkt, dass heute die Werbung den Geschwindigkeitsfaktor bei der synthetischen Textwahrnehmung maßgeblich bestimmt, muß man damit rechnen, dass diese Art von beschleunigte Rezeption das Bewusstsein des Lesers mit geprägt hat.
Sicher ist es legitim nach Mitteln zu suchen, die sich dieser Beschleunigung entgegenstellen, indem sie den Materialcharakter der Sprache hervorzaubern, aber es kommt auf die Mittel an. Deshalb, wenn schon Reduktion, dann eine hochgradig beschleunigte: Lest Coca Cola!
Klaus Hensel, Frankfurter Rundschau, 23.3.1991
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Fritz J. Raddatz: bebe go ehed. Lyrik von Flanzendörfer, Jan Faktor, Bert Papenfuß-Gorek und anderen. Rückblick auf die alternative Literaturszene der DDR
Die Zeit, 8.5.1992
Gespräch mit Jan Faktor 1994
Cécile Millot: Inwiefern macht sich die Wende für den Schriftsteller bemerkbar? Kann man auf dieselbe Weise schreiben, wenn das Publikum von früher nicht mehr da ist?
Jan Faktor: Es ist eine Illusion zu denken, man wäre völlig unabhängig von Stimmungen und Erwartungen von außen. Beim Schreiben ist man zwar letztendlich allein, man erwartet aber auch etwas. Ich habe schon lange vor der Wende gespürt, wie bei den Lesungen die Spannung nachließ, sich etwas Atmosphärisches veränderte. Irgendeine Art Bruch kündigte sich unterschwellig schon an. Meine Unzufriedenheit führte schließlich dazu, daß ich (meine Frau war daran beteiligt) 1987 einen relativ scharfen Angriff auf die Ostberliner literarische Szene1 geschrieben habe. Natürlich hatte das auch mit mir persönlich zu tun. 1985, 1986 hatte ich eine kleine schöpferische Krise; ich spürte, daß ich so wie bisher nicht weitermachen konnte. Und sah deswegen auch mein Umfeld kritischer. Bis dahin hatte ich einiges intensiv durchgespielt, mich experimentell ausgetobt, plötzlich fehlten mir aber neue, grundsätzlich neue Ideen – und ich wollte mich auf keinen Fall wiederholen. Aus dem Grund fing ich wenigstens an, über meine innovativsten und sprachlich radikalsten Arbeiten zu schreiben.2 Ich versuchte vor allem die Entstehung von zwei längeren seriellen Texten zu beschreiben, sie theoretisch zu beleuchten und detailliert zu belegen, was in ihnen lexikalisch, kombinatorisch, musikalisch passiert. Für mich war diese Art zu arbeiten ungewohnt: ich bin kein theoretischer Kopf, anfangs war ich noch etwas hilflos. Die angenehme Überraschung am Ende war, daß diese Texte auch wieder eine literarische Qualität bekamen. Gerade vor kurzem habe ich in der Akademie3 einen dieser eigentlich theoretischen Texte sogar gelesen; beim Vortrag wirkte er seltsam skurril – und nicht einfach nur detailbesessen, trocken oder sogar kleinkariert. Dieser Text gehört zu denjenigen, die bleiben, denke ich, die ich also ohne weiteres auch wieder vortragen könnte. Andere dagegen – auch wenn ich weiter zu ihnen stehe – funktionieren beim Vortragen inzwischen überhaupt nicht mehr. Sie haben, könnte man sagen, „die Wende nicht geschafft“.
Millot: Sie sprachen auch von der Radikalität der Sprache, die in den Sprachstilen oder in den Experimenten früher steckte. Ich nehme an, diese Radikalität richtete sich auch gegen die DDR. Wogegen richtet sich die Radikalität jetzt, falls sie noch besteht? Oder verschwindet sie gerade deshalb, weil sie kein Objekt mehr hat?
Faktor: Bei einigen anderen Beteiligten aus den damaligen Zusammenhängen – wie Papenfuß zum Beispiel – richtet sich der Protest jetzt gegen den Kapitalismus. Das ist der neue Koloß, gegen den man sich – wenn man es unbedingt braucht – auflehnen kann. Mir ist es wichtiger, beim Schreiben immer wieder unbedingt etwas Eigenes zu finden, auch ohne irgendwelche größeren, radikalen Gesten. Ich habe gerade den Zyklus der Körpertexte4 beendet. Einige der Texte sind zum Teil sehr persönlich und intim – vielleicht etwas anders konsequent; die Phase der plakativen Radikalität ist für mich allerdings endgültig vorbei. Aber konventionelle und gefällige Prosa zu schreiben – das ist trotzdem nicht mein Ding, so weit wird es mit mir hoffentlich nicht kommen.
Millot: Aber daß z.B. zu DDR-Zeiten die experimentellen Texte gegen die DDR gerichtet waren, das würde für Sie auch stimmen?
Faktor: Ja, sicher. An sich war das aber nicht ganz im Vordergrund. Manche Texte wurden auch bei inoffiziellen Lesungen als Provokationen empfunden, auch dort haben Leute manchmal den Raum verlassen oder schrieen dazwischen. Normal sahen die Texte oft ziemlich wild aus – und ich konnte schon deswegen davon ausgehen, daß man sie ohne weiteres offiziell nicht publizieren würde. Auch wenn die Texte inhaltlich, also politisch nicht weiter brisant waren. Es wäre für mich sowieso unerträglich gewesen zu publizieren – mit dem Wissen, daß andere nicht gedruckt werden durften; in meiner Heimat zum Beispiel.5 Mit der offiziellen DDR-Kultur wollte ich also nichts zu tun haben und habe es im Grunde, bis auf eine kleine Ausnahme (und dann die große Ausnahme6 gegen Ende der DDR), auch durchgehalten. Dieses „Dagegen“ war als Haltung ziemlich eindeutig, trotzdem war es – politisch gesehen – ein relativ sanfter Impuls.
Millot: Und jetzt, also nicht unbedingt nach der Wende, sondern nach dieser eigenen Entwicklung, ist es nicht vordergründig, gegen etwas zu schreiben, weder vom Inhalt noch von der Art der Sprache her, die Sie anwenden?
Faktor: Ich konnte als Tscheche ab und zu auch in den Westen reisen und war schon vor der Wende gezwungen, über die Schriftstellerei auch außerhalb der DDR nachzudenken. Im Westen kam mir oft die Art, wie die Westschreiber auftraten, redeten, vorlasen irgendwie „zu gut“ eingeübt und seicht vor; als ob ihrer professionellen Souveränität etwas fehlen würde. Mir fehlte da eben die Auflehnung, die ich im Grunde schon seit dem Ende des Prager Frühlings so gewohnt war. So gesehen war ich ganz zufrieden damit, in Ostdeutschland weiter unter einem nicht akzeptablen Regime zu leben – und nicht im Westen. Jetzt aber mit Abstand gesehen: Diese „Vorteile“ hatten natürlich ihre Grenzen; die DDR-Enge war ermüdend, auf Dauer wurde dann auch die alternative Kultur langsam steril. Und mein Blick auf den westlichen Literaturbetrieb hat sich inzwischen auch längst gewandelt. Die Bedingungen sind eben anders; und ich bin jetzt außerdem genauso gezwungen, in dieser Gesellschaft klarzukommen. Weil ich die Probleme und Haltungen der Westliteraten aber schon früher als Außenstehender mitbekommen hatte, versuche ich jetzt möglichst nicht über „Jobbenmüssen“, Zeitmangel, Ignoranz der Literatur gegenüber usw. zu jammern. Diese Sorgen relativieren sich im Vergleich zu denen von früher. Ich genieße die neuen Freiheiten, reise zu Lesungen in Städte, in die ich sonst nicht hinkommen würde, bin neugierig. In diesem Kulturbetrieb sehe ich aber auch für mich einige Fallen; die Gefahr seichter zu werden zum Beispiel. Oft gibt es da und dort einfach Geld, ohne daß ernstes Engagement oder echter Einsatz verlangt werden. Man muß nichts existentiell Wichtiges liefern. Ich versuche mich zum Glück auch wieder wie von außen zu beobachten und in diesem Kulturbetrieb möglichst nicht ganz aufzugehen. Es hat also auch etwas Gutes, daß ich aus der DDR, also Osteuropa, komme und nun diese ganz speziellen Erfahrungen habe. So gesehen bin ich schon einer, der eindeutig aus dem Osten kommt, und das auch nicht verleugnen und vergessen will. Man war früher ständig dabei, sich selbst, die Umstände, das eigene Lebensgefühl zu prüfen, nichts war selbstverständlich… auch diese Art Mißtrauen hängt mit der Ostsozialisation zusammen, glaube ich. Man trumpft öffentlich nicht gleich auf wie manche Westler, man überschätzt sich nicht so leicht, trampelt nicht über Widersprüche hinweg. Ich sehe das als eine gute Voraussetzung dafür, sich auch in dieser Gesellschaft literarisch treu zu bleiben.
Millot: Was Sie jetzt erwähnt haben, betrifft die Arbeitsbedingungen im alten Osten im Verhältnis zu denen im Westen. Könnte man das auch an den Texten erkennen? Könnten Sie von Ihren Texten sagen, dieser ist jetzt ein DDR-Text, also ein Ost-Text? Sieht man den Texten eventuell an, wo sie entstanden sind?
Faktor: Ich glaube nicht. Was man an meinen Texten sehen könnte, ist höchstens ihre, also meine Entwicklung. Wenn ich einen Doppelgänger im Westen hätte – dann könnte man theoretisch irgendwelche Vergleiche anstellen. Ich bekomme auch gar nicht so viel mit, was geschrieben wird und was alles erscheint; ich könnte irgendwelche pauschaleren Behauptungen gar nicht belegen. Nur mein Gefühl oder besser gesagt Eindruck, den ich dank einiger gemeinsamer Lesungen gewonnen habe: Die Ostler kommen mir irgendwie ehrlicher, substanzieller vor, sie sind mehr bei sich selbst, mehr an ihren Nöten dran, schützen sich weniger. Bei den „Wessis“ ist oft einfach mehr Show, Schein und Darstellung dabei. Ich will aber nicht ungerecht sein; es gab genug Ostler, die viel mehr aus Schein bestanden haben als aus echter Substanz – wie Sascha Anderson zum Beispiel; Thom di Rhoes (Thomas Roesler) hatte etwas furchtbar Theatralisches. Jemand wie Hilbig war und ist dann das genaue Gegenteil: ein ganz bescheidener, zurückhaltender Mensch, der in seinem Schreiben immer ganz aufging und auf seine „Außenwirkung“ nie bedacht war… das hat etwas in gutem Sinne „Ostiges“ an sich. Eine ganz eigene Kategorie bilden dann noch Leute wie Papenfuß, die sich inzwischen verstärkt als Ostler aufführen, gegen die sogenannte „Westinvasion“ ankämpfen und tendenziell in diesem Sinne auch schreiben, sich gleichzeitig aber – was ihre Art ist, wie sie mit Menschen umgehen, in ihrer Unverbindlichkeit – von der ursprünglichen Ossi- Mentalität sehr weit entfernt haben. Konkret auf Papenfuß bezogen: Was ich gerade gesagt habe, ist nicht nur negativ gemeint. Bert war uns allen immer etwas oder sogar weit voraus – in vielen Dingen; er hat die westlichen Manieren vielleicht als erster aufgenommen und dann einfach „reingeschleppt“. Leider hat er sich – wahrscheinlich aus Enttäuschung über den Systemwechsel – in seiner Haltung zu stark politisiert, thematisch verengt, tut jetzt genau das, was in unseren Zusammenhängen vor kurzem noch so verpönt war. Statt einer literarischen, machte er eher eine ideologische Entwicklung durch, habe ich den Eindruck.
Millot: Ist es bei Ihnen nicht der Fall?
Faktor: Na ja, was habe ich seitdem geschrieben? Ich habe die Körpertexte publiziert, außerdem habe ich mich lange mit den ganzen Stasi-Angelegenheiten geplagt. Ich schreibe sehr langsam, überarbeite meine Texte immer wieder von neuem, so daß ich oft bis zu zwanzig Fassungen produziere. Auch in relativ kurzen Texten steckt extrem viel Arbeit, so daß meine sichtbare Produktion alles andere als umfangreich ist. Und mit Unterbrechungen arbeite ich seit 1986 an einer Art Roman7 völlig im Hintergrund. Es ist ein Experiment und es ist völlig unklar, was daraus wird und ob ich damit je fertig werde. Nach der Wende habe ich die Arbeit daran wieder aufgenommen, wegen der ganzen Stasienthüllungen mußte ich leider alles wieder beiseitelegen. Trotzdem ist die Arbeit relativ weit und einiges steht schon lange fest: die Konzeption, Sprache, Struktur. Es ist kein konventioneller Roman, eher ein Geflecht von einzelnen kurzen, durchnummerierten Statements. Ich habe einen Stoß von Notizen und arbeite diese in die festgelegte Struktur ein. Angenehm ist, daß ich hier nach der Wende sofort wieder ansetzen konnte – als ob es keinen großen Umbruch gegeben hätte. Der Text liegt da, ich kann nach einer auch längeren Pause wieder loslegen, einfach wieder die nötige Kleinarbeit leisten. Die größere innere Anstrengung habe ich im Grunde hinter mir. Die Idee, eine strukturierte Prosa zu schreiben, war für mich seinerzeit wirklich rettend. Es war etwas ganz Neues, genau danach habe ich gesucht. Ich habe neuerdings ein Stipendium beantragt, um an dem Text in Ruhe arbeiten zu können. Die materiellen Bedingungen für Autoren sind hier in Deutschland – das ist mir ganz klar – unglaublich gut. Nach der Wende mußte ich mich, wie andere Autoren auch, erst neu orientieren und umstellen, fühlte mich dank meiner Frau und ihrer Eltern existentiell nie wirklich bedroht.
Millot: Hat Ihnen die Wende keine materiellen Schwierigkeiten gebracht?
Faktor: Erstmal war es natürlich schwierig. Zum Glück gibt es aber genug Möglichkeiten, Stipendien zu beantragen – ohne dieses Auffangnetz ginge es natürlich nicht. Dabei muß ich als Autor keine hohen Mieten fürs Atelier zahlen, wie viele Maler z.B. Über den „nur raffgierigen Kapitalismus“ kann ich einfach nicht herziehen, mir würden bald die Argumente ausgehen.
Millot: Sie haben gerade von Ihrem Romanversuch gesprochen mit den numerierten Sätzen, Absätzen usw. Warum ist Ihnen diese Systematik so wichtig, die jetzt in diesem experimentellen Roman eine so große Rolle spielt? Auch in vielen anderen Ihrer Texte ist sie erkennbar.
Faktor: In Prag habe ich mehrere Jahre als Programmierer gearbeitet (sogar sehr leidenschaftlich), mein wichtigstes Fach in der Schule war die Mathematik. Exakt beschreibbare Strukturen und genaue Systematik haben mich immer schon angezogen. Sicher versuche ich damit, nebenbei meine Ängste vor Chaos zu bewältigen. In manchen Texten herrscht dann zwar eine gewisse Ordnung, ich breche sie in anderen Arbeiten aber auch ganz gern – und schreibe dann eher wild assoziativ. Und genieße es, nicht wirklich berechenbar zu sein. Gleichzeitig sollte man meine Strukturverliebtheit oder die Zurschaustellung von „Ordnung“ nicht übertrieben ernst nehmen. Diese Arbeitsweise hat auch etwas Ironisches an sich; nimmt den Dingen einiges an Schwere ab.
Millot: Die Texte wirken manchmal auch ganz schön chaotisch, wenn man sich auf die rationelle, fast mathematische Ordnung wirklich einläßt.
Faktor: Wenn Dinge, die eigentlich nicht geordnet werden können, geordnet werden, tritt gleichzeitig auch ihre Absurdität deutlich zutage. In dem besagten Roman mache ich auf den ersten Blick – dank der Struktur und der Numerierung – außerdem klar, daß ich mich weigere, konventionelle Prosa zu schreiben. Davon gibt es meiner Meinung nach genug. Der Text sah anfangs allerdings noch relativ unscheinbar aus. Ich schrieb mir die einzelnen Sätze untereinander, sammelte sozusagen spontan nur die einzelnen „Sprüche“. Irgendwann verlangte dieses Konglomerat aber nach Ordnung, Eingruppierung – und auch nach einer sichtbaren Struktur; der Klumpen aus nur untereinander stehenden Sätzen wäre schwer lesbar. Zuerst ballten sich thematisch und wie von selbst immer wieder kleine Untermengen zusammen, die im Stück besser überschaubar waren. Beim Abtippen und lautem Vorlesen habe ich dann allerdings gemerkt, daß Dreiergruppen am besten klangen; und habe angefangen, den Text systematisch in dreigliedrige Kapitel zu unterteilen. Auch aufgrund der vielen, die einzelnen Sätze und Kapitel trennenden Zwischenräume wuchs der Text noch zusätzlich – und es wurde irgendwann nötig, die Kapitel zu numerieren. Daß auch Sätze innerhalb der einzelnen Kapitel Nummern bekommen haben, ist eher ein kleiner Scherz von mir.
Millot: Haben Sie ein Gedicht, die Sie als ihr Wendegedicht, als das Gedicht nach der Wende, bezeichnen würden?
Faktor: Nein, gar keins. Ich habe in dieser turbulenten Zeit die Zeitung des Neuen Forum mitbegründet, also journalistisch und politisch gearbeitet. Im Sommer 1989 ist zwar mein erster Band beim Aufbau-Verlag erschienen,8 im Herbst wurde es aber sehr schnell klar, daß eine ganz neue Zeit einbrach – und ich würde auch von etwas leben müssen; ich habe mich sogar darauf eingestellt, wieder als Programmierer zu arbeiten. Das habe ich dann eine Zeitlang für den Basis-Druck-Verlag, den Hausverlag des Neuen Forum, auch gemacht. Sogar neue Software für die Anbindung der Redaktion-PCs an das Satzsystem DOSY-Hell einer Großdruckerei geschrieben (die Zeitung Die Andere wurde im Berliner Verlag gedruckt). An das Schreiben von Literatur war damals gar nicht zu denken, ich hätte sowieso keine Zeit dafür gehabt. Einige vorsichtige literarische Versuche aus dieser Zeit empfand ich schon beim Schreiben als gewollt, durchschaubar, schwach – außerdem entweder unangenehm depressiv oder zu aufgewühlt. Für mich war es insgesamt keine einfache Zeit. Ich brauche mehr Abstand zu den Dingen, spiele mit der Sprache gern mit Humor und Leichtigkeit, auch wenn dahinter ganz andere Erlebnisse stecken. Leicht war mir damals überhaupt nichts.
Millot: Sprache ist also auch nicht wirklich das Medium gewesen, das Sie in dieser Zeit nutzen wollten. Könnte man das so formulieren?
Faktor: Doch, doch! Es war eine erregte, sehr chaotische Zeit – auch sprachlich war alles in Aufruhr. Ich habe einige Artikel für unsere Zeitung geschrieben, der Chefredakteur hat leider nichts davon drucken wollen; er fand meinen Stil zu anarchisch, meine Ironie unseriös. Ich habe eine Weile dann nur noch am Computer gesessen; als Administrator eine Weile durchgehalten, weil ich dort gebraucht wurde.
In der DDR war man als eine Art Aussteiger im Grunde ständig unterfordert, die Möglichkeiten, sich aktiv irgendwo einzubringen, waren begrenzt. In der Umbruchzeit entwickelte man dann plötzlich unglaubliche Energien, schlief sehr wenig, wurde regelrecht euphorisch und merkte auf einmal, welche Fähigkeiten in einem überhaupt stecken. Ich diskutierte manchmal bei großen Versammlungen, obwohl ich damit absolut keine Erfahrungen hatte. Politisch wollte ich aber auf keinen Fall arbeiten. Etwa ein Jahr später, als die erste Euphorie vorbei war, fiel ich in ein ziemlich unerfreuliches Tief. In der Arbeit bei der Zeitung sah ich schon lange keine Perspektive mehr, ich mußte mich irgendwie neu sammeln. Trotzdem habe ich keine Schuldigen gesucht und nicht über die „schlimmen Zustände“ der Nachwendezeit geklagt. Mein Engagement für das Neue Forum fand ich völlig in Ordnung, der Ausgang für mich persönlich war eben ungewiß. Anschließend hatte ich dann wieder mal Glück: Ich wurde als Sprecher in einer Multimedia Performance von Arnold Dreyblatt9 engagiert, fand neue Freunde, verdiente wieder Geld, ging mit dieser Company auch auf Reisen.
Millot: Schreiben Sie kürzere oder längere Texte?
Faktor: Im Moment gehe ich eher zu längeren Texten über. Die ewig langen seriellen produziere ich aber nicht mehr. Neulich wollte ich bei einer Lesung diesen Muttertext10 erstmal gar nicht lesen, hatte mir eher wilde rhythmische Texte von früher vorbereitet; vielleicht weil in den Clubräumen oft auch experimentelle Musik gespielt wird. Plötzlich fühlte ich aber ganz intensiv, daß die Zeit der schrillen – ich nenne sie jetzt so – „Blödeleien“ vorbei und die Ästhetik, in der für mich früher so viel Sinn und Frische steckte, überholt ist; als ob in dem Moment eine Art Konstrukt implodiert wäre. Und ich fand es plötzlich legitim, daß von einem greifbare und klare Inhalte erwartet werden; also etwas, was an der aktuellen Realität näher dran ist. Und ich habe dann doch den Muttertext gelesen – und er kam sehr gut an. War auf alle Fälle mehr angebracht als meine spielerischen, „mechanisch-technischen“ und egal wie perfekt gearbeiteten Experimente. Sollte ich das jetzt nachträglich als eine spontane Anpassung ans Publikum sehen? Kann sein. Etwas lag an diesem Abend in der Luft, auf beiden Seiten. Das Interesse war da, die Leute wurden plötzlich von Vorgängen aus meinem und ihrem eigenen Leben erreicht.
Millot: Ist der Muttertext, den Sie gelesen haben, in den Körpertexten enthalten oder gehört er zum Roman?
Faktor: An dem Abend habe ich einiges aus den Körpertexten gelesen, auch den Muttertext. Die Körpertexte sind jetzt abgeschlossen. In dem angefangenen Roman geht es auch um meine Kindheit und natürlich auch um meine Familie, meine Mutter; was aber meine Offenheit in persönlichen Angelegenheiten angeht, hat der Roman eine ganz andere Qualität – und Qualitäten. Außerdem arbeite ich noch an einem längeren, auch sehr persönlichen Prosatext über eine für mich sehr wichtige Freundschaft aus den 80er Jahren. Er ist klar und direkt formuliert, es ist im Grunde mein nächster Abschied vom Experiment.
Millot: Ist die Prosa vielleicht persönlicher, also privater bei Ihnen?
Faktor: Für mich schon. Bei Gedichten (richtigen Gedichten) hätte ich zu viel Scheu davor, pathetisch zu werden. Streng gesehen habe ich Gedichte wahrscheinlich aus diesem Grund nie geschrieben. Natürlich ließe sich Pathos irgendwie unterlaufen und brechen, aber Prosa liegt mir inzwischen näher. Sie hat nicht den Anspruch, emotional sofort unter die Haut gehen zu müssen. Als ich spontan und naiv zu schreiben anfing, kam dabei auch eine Art Prosa heraus. Ich habe damals gern einzelne Sätze lose untereinander geschrieben oder hintereinander weg. Es sollte keine erzählende Prosa sein – aber auch keine Gedichte. So etwas entscheidet sich aber nicht erst beim Schreiben, sondern lange davor. Schon in dem ursprünglichen Einfall, der emotional geladenen Idee, sind die formalen Aspekte halbwegs enthalten. Man stellt sich im Grunde schon den ganzen Text vor, hört/sieht nicht nur die ersten Sätze. Den Rest besorgen dann sowieso die vielen formalen Zwänge: Wenn ein gedichtartiger Satz nicht auf eine einzelne Zeile paßt, wird er umbrochen. Und wohin dann mit dem nächsten Satz, wenn ich keinen Punkt setzen will? Hier fällt dann eine sehr wichtige gestalterische Entscheidung.
Millot: Das ist dann ein eher optischer Einfall, kein auditiver? Denn vorher haben Sie von Rhythmus gesprochen.
Faktor: Bei manchen Texten kam die Idee gleich „laut“ – tönte mir regelrecht im Schädel; einiges passiert aber doch eher graphisch auf dem Papier oder Bildschirm. Es ist viel Vergnügen dabei, den Text, seine Struktur wachsen zu sehen. Bei dem „lyrikkritischen“ Text „Wir brauchen eine neue Lyrik“11, den ich neulich auch gelesen habe, mußte ich nicht lange überlegen – die einzelnen litaneiartigen Sätze mußten einfach untereinander geschrieben werden.
Millot: Haben Sie ein gutes Verhältnis zur deutschen Sprache oder ist das ein problematisches?
Faktor: Deutsch ist nicht meine Muttersprache und ich weiß, daß ich darin immer noch nicht völlig zuhause bin. Umso genauer nehme ich aber alles wahr und bin regelrecht gierig, Neues zu entdecken. Gleichzeitig spreche ich kaum noch tschechisch und meine Muttersprache stagniert, ich spreche wie in den ’70er Jahren. Wenn ich in Prag bin, brauche ich immer eine gewisse Anlaufzeit, bis ich ganz fließend reden kann. Ich würde mich also nicht mehr trauen, Tschechisch zu schreiben. Das heißt – und das ist das Gute dabei: Mein Deutsch wird immer besser, muß besser werden. Ich habe sozusagen keine andere Wahl, als in dieser Sprache heimisch zu werden. Und mir macht es richtig Spaß zu sehen, was ich mit dieser Sprache schon alles angestellt habe! Manchmal bin ich selbst überrascht – nicht nur die Zuhörer. Als Deutscher wäre ich vielleicht nicht darauf gekommen, daß sich auch praktisch alle Substantive – analog zu Adjektiven – steigern lassen12 oder was man alles mit dem deutschen Genitiv anstellen kann13. Ich bin natürlich noch darauf angewiesen, daß meine nicht-experimentellen Texte grundsätzlich – bevor ich sie aus der Hand geben kann – korrigiert werden; ohne meine kompetente und liebe Frau wäre das ein großes Problem. Ich nehme alles ziemlich genau und es ist mir enorm wichtig, nicht nur genau zu formulieren, sondern auch in einwandfreiem Deutsch. Deswegen wird das Schreiben manchmal mitunter zu einer Qual; das wäre im Grunde noch eine wichtige Ergänzung zum Thema „,gutes‘ Verhältnis zur deutschen Sprache“. Manchmal bin ich regelrecht verzweifelt – wenn ich beispielsweise an der vierzehnten Fassung eines Textes arbeite und spüre, daß da immer noch etwas nicht stimmt, daß ich den Text immer noch nicht aus der Hand geben kann, gedanklich aber schon an der nächsten Arbeit dran bin. Und das geht weit über die übliche Problematik „den Autor endlich vom fertigen Text trennen“ hinaus. Bei diesen Kleinarbeiten passiert allerdings auch viel Gutes, im Grunde stehe ich dazu. Die Texte werden genauer, ich denke über das und jenes nochmals nach; als gründlicher Mensch brauche ich einfach mehr Zeit als andere. Es ist mir extrem wichtig, meine Texte nicht nur oberflächlich in Ordnung zu bringen; ich brauche das Gefühl, vor potentiellen Kritikern möglichst keine Angst haben zu müssen.
Millot: Hatten Sie zuvor schon Tschechisch geschrieben?
Faktor: Der autobiographische „Roman“ in kurzen Sätzen – das habe ich vergessen zu erwähnen – entsteht natürlich in meiner Muttersprache. Und in den ’70er Jahren in Prag habe ich selbstverständlich Tschechisch geschrieben. Den Anfang des Romans – genau gesagt 63 der Kurzkapitel (von geschätzten 2000 bis 3000) – habe ich probeweise ins Deutsche übersetzt; auch deswegen, um daraus bei Lesungen auszugsweise lesen zu können. Habe allerdings parallel dazu an der tschechischen Fassung weitergearbeitet. Aus dem Grund entsprechen die 63 übersetzten Kapitel längst nicht dem aktuellen Stand des Originals. Aber dieses Problem kenne ich schon von früher, als ich alle meine übersetzbaren Texte in beiden Sprachen auf dem neusten Stand halten wollte. Noch etwas Wichtiges im Zusammenhang mit der Wendeproblematik: Da ich in der Szene in den 80er Jahren viel mitbekommen habe, in vieles involviert war, empfand ich später eine Art Verpflichtung, mich nach den Stasi-Enthüllungen zu unserer Geschichte, Entwicklung und Blindheit zu äußern. In diese Aufarbeitung habe ich sehr viel Zeit investiert und habe dafür andere Arbeiten lange liegenlassen müssen. Die meisten anderen Autoren haben sich öffentlich nicht artikuliert, sich bedeckt gehalten oder vielleicht die anstrengende Arbeit einfach gescheut. Aus unseren Kreisen war ich im Grunde ziemlich der einzige. Das hat eine gewisse Vorgeschichte: 1986 habe ich gemeinsam mit meiner Frau einen szenekritischen Text geschrieben: „Das, wozu die Berliner Szene geworden ist…“14 Deswegen bekam ich schon damals relativ viel Ärger. 1988 habe ich mir dann für eine Tagung einen längeren Text abgerungen („Was ist neu in den ’80er Jahren?“, enthalten in Vogel oder Käfig sein15). Mit dieser Arbeit bin ich aber nicht zufrieden, ich bin kein Essayist und theoretischer Denker, es liegt mir einfach nicht; und obwohl ich mit dem Text sehr viel Zeit zugebracht habe, ist er furchtbar „verquatscht“ und unkonkret. Inzwischen tue ich mir so etwas nur an, wenn ich mich zu einem Thema unbedingt äußern soll – nach Anfragen zum Beispiel – oder auf irgendwelche schief geratenen Darstellungen von anderen unbedingt reagieren muß. Einerseits gab es früher eine starke Idealisierung der damaligen Szene, später wurde dann wieder vieles pauschal für minderwertig, epigonal oder hinterwäldlerisch erklärt. Im Grunde war mein publizistisches Engagement ein Versuch, wenigstens einen Teil meiner, unserer Geschichte zu retten.
Millot: Wenn ich mich richtig erinnere, erwähnen Sie in dem Aufsatz von ’88, daß die Leute in der Prenzlauer-Berg-Szene geschrieben haben, um „durchs Leben einigermaßen heil durchzukommen“ – praktisch aus Selbsterhaltungstrieb. War das für Sie auch der Fall?
Faktor: Da meine Texte ganz gut aufgenommen wurden, fühlte ich mich relativ schnell zu dieser Subgesellschaft zugehörig; und die Entscheidung weiter zu schreiben und sich dem offiziellen Betrieb nach Möglichkeit zu verweigern, bekam noch mehr Sinn. Natürlich lebte man damals im Osten in einer Art Ausnahmesituation; Schriftsteller zu sein war etwas ganz Besonderes, man nahm sich enorm wichtig. Mit dem Bedeutungsverlust nach der Wende zurechtzukommen und trotzdem nicht die ganze Vergangenheit in Frage zu stellen, war für viele nicht einfach. Mir wurde erst in dieser Zeit, also nachträglich klar, wie künstlich unsere damalige Situation gewesen war. Einige aus den damaligen Zusammenhängen lösten die Widersprüche und ihre Enttäuschungen durch vereinfachte Projektionen gegen den „bösen Westen“. Zum Glück habe ich mich mit der Schriftstellerrolle schon lange vor der Wende beschäftigt; beobachtete auch mich selbst gern mit Mißtrauen und war – was die Motive für das schriftstellerische Schaffen und das „Reine und Edle“ an diesem Beruf angeht – immer skeptisch. Auf den Nachwende-Einbruch war ich also ein bißchen vorbereitet.
Millot: Dadurch, daß Sie die Rolle des Schriftstellers in der DDR nie so ernstgenommen hatten?
Faktor: Erstmal natürlich schon! Anfang der ’80er war ich sogar ausgesprochen euphorisch, zum Teil unkritisch und habe einiges auch sehr genossen. Das war an sich legitim, ich war Anfang dreißig. Eine so intensive Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Künstlern war für mich neu, ich hatte mich nach so etwas lange gesehnt und habe es dann auch sehr genossen – naiv und unreflektiert. Manchen Texten von mir merkt man das vielleicht auch an, in ihnen steckt tatsächlich ganz reine und nicht hinterfragte Begeisterung. Aber mit der Zeit, wenn man auch sich selbst gegenüber kritisch bleiben will, muß man einiges in Frage stellen und sich nicht einfach in einer Wagenburg einrichten. Daher bin ich ganz froh, daß ich schon lange vor der Wende einige Konflikte mit der Szene ausgetragen hatte, daß ich gezwungen war, darüber nachzudenken, warum atmosphärisch, inhaltlich, menschlich usw. das und jenes nicht mehr stimmte. Auch bei meiner eigenen Arbeit mußte ich immer wieder darauf achten, mich nicht mit einer Art Leerlauf zufrieden zu geben. Vieles, was ich in diesem Zusammenhang reflektiert habe, ist – natürlich stark verfremdet – in meine dadaartigen „Manifeste der Trivialpoesie“ vom Anfang der ’80er Jahre eingeflossen. Diese vier Manifeste sind in Georgs Versuche16 abgedruckt, meine eigene Antwort auf die Manifeste – also eine Fortsetzung davon – in meinem zweiten Band17 Alle diese Manifeste sind natürlich überzogen formuliert, sind stark übertrieben bis ins Absurde, enthalten aber im Kern trotzdem die Essenz dessen, was ich auf der gedanklichen Ebene in mir damals bewegte. Dieser prüfende Blick hat mir sicher dabei geholfen, die großen Gesten, die übertriebene Künstlerpose, wie sie in der damaligen Szene üblich war, abzulegen. Bert Papenfuß, mit dem ich damals eng befreundet war und dessen enorme Begabung ich nach wie vor schätze, hat sich davon leider nicht ganz frei machen können. Zu einem Bruch zwischen uns mußte es also irgendwann tatsächlich kommen.
Millot: Ist das der Hauptgrund für das Zerstrittensein oder ist da noch etwas ganz anderes?
Faktor: Mit der uneingeschränkten Bewunderung – auch von ihm als Person – war es irgendwann einfach zu Ende, ich wurde auch bei seinen Texten, auch was seine Auftritte betrifft, viel kritischer als früher. Darauf hat er alles andere als souverän reagiert; und er kann leider sehr verletzend sein. Ich mochte und schätzte ihn trotzdem weiter. Was uns zusätzlich entfremdet hat, war seine kontinuierliche Hinwendung zu Sascha Anderson. Meine Vermutung: Bert wollte sich auch im Westen profilieren, diesbezüglich logischerweise auch Andersons Kontakte und Kanäle weiter nutzen. Mir war Andersons Kunsthändler-Gebaren sehr fremd, die sukzessive Kommerzialisierung der Produktion empfand ich als nicht wirklich echt. Ernsthafte künstlerische Entwicklung des ganzen Umfelds – Andersons Einfluß darf man nicht unterschätzen! – drohte dabei auf der Strecke zu bleiben. Daß vielen Kunstmappen mit unseren Texten im Westen verkauft wurden, daß man mit der eigenen Arbeit auch etwas verdienen konnte, war an sich natürlich in Ordnung. Diese Angelegenheiten wurden aber plötzlich viel zu wichtig, mit diesem Handel steigerte sich außerdem eine Art professionelles Gehabe; und im Osten wirkten diese importierten Spielregeln etwas „ortsfremd“. Und ich bekam das Gefühl, die anderen würden diese auch emotionalen Veränderungen gar nicht spüren. Gestalterische, drucktechnische Dinge wurden wichtiger als die inhaltlichen, formalen, menschlichen – dieses für mich so wichtige Bei-sich-Sein, Auf-dem-Bodenbleiben… Mein lieber Freund Papenfuß hat diese unterschwellig stattfindende Entwicklung leider mitgemacht, sich von Anderson beeinflussen und in sein Schattenreich einbeziehen lassen. Hat davon sicher auch profitiert – künstlerisch aber eher nicht. Anfangs habe ich noch versucht, meine Skepsis Bert gegenüber zur Sprache zu bringen. Er und Anderson haben sich aber – für mich war es lange unverständlich – leider ganz gut ergänzt.
Millot: Ich finde diese Schilderungen sehr interessant; es wird deutlich, daß die Wende hier nicht unbedingt der einzige Einschnitt war, sondern, daß die Ausrichtung nach Westen, wenigstens bei einigen Autoren, schon viel früher vorhanden war.
Faktor: Das stimmt. Als Beispiel könnte man die Zeitschrift schaden nehmen; sie sah immer „schicker“ aus, wurde mit immer mehr Aufwand produziert, die aufwendig hergestellten Grafiken standen plötzlich eindeutig im Vordergrund. Zum Teil war das auch legitim – die Macher haben sich eben professionalisiert und versuchten davon (wie Egmont Hesse18) auch zu leben. Mir kam das aber trotzdem etwas unheimlich vor. Das Gefühl der Autonomie, das so wichtig war, stimmte für mich nicht mehr. Plötzlich wurde hier unmittelbar neben mir aus kommerziellen Gründen eindeutig auch für „den Markt“ produziert. Ein Teil der Exemplare war von vornherein für den Westen bestimmt, wurde dort verkauft, und das Westgeld dann im Verhältnis 1:7 zurückgetauscht. Für die Beteiligten steckte darin relativ viel Geld.
Als ich von Anderson 1985 angesprochen wurde, ein Grafikbuch mit Hans Scheuerecker aus Cottbus zu machen, sagte ich selbstverständlich zu. Scheuerecker kannte ich persönlich noch gar nicht und war auf die Zusammenarbeit mit ihm neugierig. Bald danach merkte ich aber, daß ich mich auf ein mir völlig unbekanntes Terrain begeben hatte: Aus Cottbus erfuhr ich eines Tages zufällig, daß Scheuerecker „an der Mappe schon mit Eifer arbeitet“. Dabei haben wir uns noch kein einziges Mal getroffen, es gab bislang keine Absprachen, nichts Gemeinsames! So sah also Andersons Projekt „die Künstler und Autoren zusammenbringen…“ aus. Darunter hatte ich mir natürlich etwas völlig anderes vorgestellt. Anderson hat die Sache daraufhin vorläufig gestoppt, Scheuerecker und ich haben uns einmal getroffen und ich sah mir einige von seinen Arbeiten an. Meine einzige Forderung war dann: Bitte bitte keine Strichmännchen, keine Strichgesichter. Alle zeichneten und malten damals wie Penck, ich konnte das nicht mehr sehen. Die ganze Angelegenheit endete schließlich aber doch mit einem Eklat und mit meinem endgültigen Bruch mit Anderson. Das Graphikbuch19 wurde irgendwann nach dem Sommer 1986 fertig und nach einer nur mündlichen Absprache sollte ich, wie üblich, die Hälfte der Auflage bekommen, also zehn Stück. Anderson reiste im Sommer 1986 nach Westberlin aus und hat für mich lediglich fünf Exemplare zurückgelassen. Wie ich später erfuhr, war ich nicht der Einzige, mit dem er so verfuhr; offenbar plante er das von vorneherein ein. Döring hat sich das sogar, wenn mich nichts täuscht, gefallen lassen. Eine Mappe war 300 Westmark wert, also etwa 2.000 Ostmark. Für mich war es die erste Möglichkeit, mit meinen noch nicht publizierten Texten Geld zu verdienen. Ich habe Anderson daraufhin einen ziemlich scharfen Brief nach Westberlin geschrieben und ihm gedroht, die Sache publik zu machen. Er hat die Mappen dann umgehend nachgeliefert, ich konnte mir die fehlenden Exemplare in der Werkstatt von Wilfriede Maaß abholen. Dazu hat er mir allerdings noch einen so verlogenen und alles Mögliche verdrehenden Brief geschrieben, daß ich bei der Lektüre als erstes ein schlechtes Gewissen bekam. Er versuchte mir zu erläutern und zu suggerieren, ihn – der an großer Geldnot leide – zu Unrecht beschuldigt zu haben. Er war nicht nur extrem geschäftstüchtig, er war auch ein begabter Demagoge, das muß man ihm lassen. In unseren Kreisen war das etwas ganz Ungewöhnliches.
Nicht nur die Graphikmappen, auch die Zeitschriften (in 50er Auflagen, wenn ich mich nicht irre) wurden im Westen verkauft. Und es war nie ganz klar, wieviel Anderson dabei für sich selbst abgezweigt hatte. Man sprach über diese Dinge sowieso nicht laut, schrieb nichts auf. Und auch wenn man etwas angesprochen hätte, hätte das überhaupt nichts gebracht. Seit unserem „geschäftlichen“ Streit wußte ich mit Sicherheit, daß Anderson ein Betrüger ist und wollte mit ihm nach der Wende nichts zu tun haben. Aus dem Grund bin ich nicht zum Galrev-Verlag gegangen, obwohl er mich unbedingt dabei haben wollte.
Millot: So daß die Vermarktung der Literatur, die die DDR-Autoren nach der Wende eventuell befürchtet haben, eigentlich schon da war?
Faktor: Im Prinzip ja – es war aber noch keinesfalls ganz vordergründig und prägend. Trotzdem lebte man damals literarisch mit einem Bein schon im Westen. Man publizierte da und dort in Westzeitschriften, man bekam Einladungen zu Lesungen; und ich als Tscheche konnte schon ab 1985 manchmal reisen. Im Grunde privat als Tourist, es war aber immer aufgrund einer Einladung. Alle anderen von uns – wenn ein Buch in Vorbereitung oder erschienen war – bekamen dann sofort Pässe und Visa. Alles schien plötzlich so einfach, dabei war die Konstellation ein bißchen irreal: Man lebte im Osten ausgesprochen billig, drüben wurden die im Westen üblichen Honorare gezahlt. Und außerdem bekam man dort als Exot aus dem Osten sofort einen Aufmerksamkeitsbonus. Dieses Gefälle brachte einem also nur Vorteile. Und wenn man außerdem einigermaßen geschäftstüchtig war, konnte man dieses Pendeln mit dem Kommerz verbinden. Anderson war in Westberlin die zentrale Anlaufadresse, seine Geschäfte – auch mit den Untergrundzeitschriften – hat er von dort aus weiterbetrieben, stand in Verbindung mit Egmont Hesse und Schedlinski. Über diese Dinge weiß ich aber überhaupt nichts Genaueres; ich habe mich dafür nicht sonderlich interessiert und man hat mich auch nicht eingeweiht. Als Schedlinski – unser neuer Promoter und Kontaktmann – seit 1988 reisen durfte, nahm er auch Texte von Freunden mit, um sie in Zeitschriften unterzubringen – zum Beispiel in Niemandsland20. Natürlich verfuhr er dabei sofort selektiv. Weil es zwischen uns mal einen Konflikt gegeben hatte, hat er mich dabei völlig ignoriert. Von heute aus ist das natürlich irrelevant und lächerlich, damals hat es mich aber natürlich gekränkt.
Millot: Worin bestand der persönliche Konflikt?
Faktor: Nachdem ich 1987 den schon erwähnten Angriff gegen die Szene geschrieben habe und Schedlinski für seine ariadnefabrik21 gegeben habe, hat er für dieselbe Nummer gleich eine wütende Polemik dagegen verfaßt. Von heute aus gesehen ist das ziemlich absurd: Ausgerechnet er als Inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit meinte, alles sei in bester Ordnung und ich würde völlig überzogene Ansprüche stellen. Darauf habe ich zum Glück ganz ruhig geantwortet, außerdem hat ihm Annette22 einen persönlichen Brief geschrieben. Er fühlte sich aber sicher weiter im Recht und betrachtete seine Spitzelarbeit wahrscheinlich als ein legitimes Teil des Spiels. Danach blieb unser Verhältnis einfach auf Dauer abgekühlt – und das hatte Folgen. Nach der Wende ist bei Galrev eine Anthologie aus den in der ariadnefabrik231990 publizierten Texten erschienen und obwohl ich fast alle meine Arbeiten zuerst dort veröffentlicht habe, ist in der Anthologie von mir überhaupt nichts drin. Daß diese kleinliche Art Rache im Verlag niemandem, auch nicht dem anderen Herausgeber Koziol, aufgefallen war, hat mich sehr gewundert. Mein Name taucht in dem Band trotzdem auf weil ich Mitautor des dort als Faksimile abgedruckten manifests „Zoro in Skorne“24 bin. In dem Band Vogel oder Käfig sein25 wurden die Texte meiner Kontroverse mit Schedlinski aus dem Jahre ’87 abgedruckt. Zu einem richtigen Streit war es damals aber nicht gekommen, auch später nicht, eine Streit- und Diskussionskultur gab es einfach nicht. Wir hatten darin keine Übung und waren trotz unserer „Arbeit an der Sprache“ leider so gut wie sprachlos. In der sogenannten „Szene“ gab es zwar viel Unzufriedenheit, aber niemand hat sich dazu normalerweise geäußert. Als ich es dann gewagt habe – und sogar schriftlich –; galt ich plötzlich als Nestbeschmutzer und wurde weitgehend allein gelassen. Aversionen, Spannungen wurden damals eben nicht offen ausgetragen, Kritik zu üben war tabu – man drückte einiges nur in der Haltung aus. Der eine oder andere wurde plötzlich nicht eingeladen, nicht einbezogen, wurde hinter seinem Rücken belächelt. Psychologisch konnte ich mir einiges natürlich erklären: In einer so überschaubaren Gruppierung – mitten in einem übermächtigen Staat – ist ein offener Angriff auf die eigenen Leute etwas problematisch.
Leider stand dann auch mein bester Freund Papenfuß nicht zu mir, zu einem klärenden Gespräch zwischen uns kam es leider auch nicht. Im Grunde hat unser persönliches Zerwürfnis in dieser Zeit angefangen. Nach der Wende ginge das sicher so weiter. Diejenigen, die unbedingt zusammenhalten wollten, versuchten sich bei Galrev gegen die feindliche Welt einzuigeln. Zum Glück bekam die „Szene“ nach den Stasi-Enthüllungen sehr viel Gegenwind – vor allem aus dem Feuilleton. So gesehen war das eine Art Erlösung, auch wenn nicht immer alles fair war, wie über die damalige Szene geschrieben wurde.
Millot: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Galrev und Janus press heute? Beide Verlage haben ja zum Teil dieselben Autoren. Sind sie komplementär oder bestehen sie einfach nebeneinander?
Faktor: Gerhard Wolf, der Verleger von Janus press, kooperiert mit Galrev bei der Herstellung, und muß damit nicht unbedingt Probleme haben wie ich. Bert Papenfuß publiziert z.B. bei Galrev und jetzt auch bei Janus press. Als Verleger ist Gerhard Wolf bei der Auswahl der Autoren allerdings viel strenger. Manche Autoren, die er nicht haben wollte, sind später bei Galrev untergekommen. Galrev profiliert sich als reiner Lyrikverlag; ökonomisch ist das natürlich problematisch, aber auch mutig. Es erscheinen dort Autoren, die sonst große Schwierigkeiten hatten oder hätten, einen Verlag zu finden. Aber offenbar arbeiten die Galrev-Leute wirtschaftlich, das Druckhaus hat einen sehr guten Ruf – und ist gleichzeitig preisgünstig; billiger als manche Westberliner Setzereien. Im Auftrag wird dort also Satz, Film-Belichtung usw. für andere Verlage gemacht. Natürlich ist es nicht unbedingt das, was man bei Galrev ursprünglich wollte. Man wollte einen bedeutenden Lyrikerkreis um sich versammeln, große Anthologien herausgeben. Inzwischen sind einige Autoren wieder abgesprungen. Und nicht nur wegen der Stasi-Verstrickung von Anderson und Schedlinski, manche hat man menschlich einfach nicht gut behandelt, es lag viel Arroganz und Kaltschnäuzigkeit in der Luft – wie noch zu Ostzeiten, als man sich unter dem Slogan „Wir sind die Größten“ noch viel mehr einbilden und folgenlos leisten konnte. Bevor die Stasiblase platzte, ging ich manchmal noch hin (einfach „alte Freunde besuchen…“) und konnte den Umgang mit Gästen beobachten. Nur ein Beispiel: Ich komme rein, Schedlinski grüßt mich nicht, unterhält sich weiter mit seinen Leuten, ich mit anderen. Nach etwa zehn Minuten sagt er: „Willst du nicht wieder gehen? Wir haben hier etwas zu besprechen.“ Mir ist in dem Moment zum Glück etwas Passendes eingefallen: „Rainer, du hast mich nicht gegrüßt, ich bin gar nicht hier.“ Und bin dann eine Weile noch geblieben. Egmont Hesse ist natürlich ein viel angenehmerer Zeitgenosse – und viel verbindlicher.
Anfangs hatte man vielleicht eine vage Idee vom Zusammenhalt der Lyriker, wollte etwas von früher retten, das real nie wirklich da war. Ich erfahre einiges aber nur über Dritte. Eine Kuriosität möchte ich noch erzählen: Bei Galrev gibt es Konflikte zwischen Opitz, der dort das Café Kiryl (Lyrik rückwärts gelesen) betreibt, und Schedlinski. Man streitet sich über Heizungskosten, Anwälte wurden eingeschaltet. Und wenn nichts half – die Stasi gibt es nun mal nicht mehr – denunzierte Schedlinski seinen Freund und Pächter des Cafés wenigstens bei der Gewerbeaufsicht; wegen der Mißachtung von Hygiene- und anderer Vorschriften. Beweisen konnte das der geplagte Detlef zwar nicht, die Kontrollen vom Bezirksamt erschienen aber auffallend oft ausgerechnet in der Zeit, als die Konflikte mit Schedlinski eskalierten. Ist das nicht eine schöne Illustration dessen, wie sich die Geschichte fortsetzt?
Gespräch mit Jan Faktor 18. August 2009
Goepper: Wenn ich bei den am Projekt beteiligten Autoren auf den Titel „Lyrik nach der Wende“ hinweise, stoße ich manchmal auf irritierte Reaktionen. Daher möchte ich wissen, was Sie vom Begriff „Wende“ halten.
Faktor: Bevor ich Ihre Frage beantworte, möchte ich kurz etwas erzählen. Vor ein paar Tagen war ich beim Begräbnis von Adolf Endler. Danach war ich etwas deprimiert; ich habe dort zwar einige Freunde von früher getroffen, es gab aber – wie schon so oft – keine wirklich persönlichen Gespräche zwischen uns. Manche sind zu mir gekommen, andere wiederum – das war zu spüren – wollten überhaupt keinen Kontakt. Also auch oberflächlicher Small Talk funktionierte nicht. Manche waren sicher noch sauer wegen meines Textes in TEXT+Kritik26, obwohl das schon so lange her war… Wir sind uns einfach sehr fremd geworden mit der Zeit. Wahrscheinlich haben Sie inzwischen mehr Einblick in die Köpfe der anderen als ich.
Ich persönlich habe mit dem Begriff „Wende“ kein Problem. Ich war einer der wenigen aus der Szene, die schon vor dem heißen Herbst 89 politisch aktiv geworden waren. Und ich machte dann auch weiter, habe unter anderem die Zeitung des Neuen Forum mitgegründet. Ausgerechnet aus diesem Grund wurde ich dann von einigen auch angefeindet; vielen hat die Wende überhaupt nicht gepasst. Detlef Opitz hat zu mir beispielsweise gesagt:
Diesen Scheißwesten haben wir euch vom Neuen Forum zu verdanken.
Es war nicht wirklich persönlich gemeint, wir beide kamen miteinander sonst sehr gut aus, er war einfach gerade ziemlich aufgebracht – und verunsichert. Die im Grunde auch ökonomisch geschützte DDR war auch für uns, die sich nicht angepasst hatten, der „bessere“ Staat, in dem man es einfach materiell viel einfacher hatte. Und wer von uns dann ein Buch herausgebracht hatte, bekam einen Pass und konnte nach Belieben reisen. Nach dem Mauerfall brachen die meisten der auch für uns wichtigen Koordinaten einfach zusammen. Der westliche Literaturbetrieb war ganz anders, wir wurden plötzlich zu „Vollmitgliedern“ des ganzen Rummels, waren keine Exoten mehr, und das passte vielen natürlich nicht. Mich traf die materielle Bedrohung im Grunde genauso hart wie alle anderen und es war überhaupt nicht klar, wie es beruflich mit mir weitergehen würde. Trotzdem habe ich den ganzen Zusammenbruch der DDR eindeutig als Befreiung erlebt und habe daher mit dem knappen und vordergründig nicht besetzten Begriff „Wende“ auch keine Probleme; egal wie wenig stimmig bis unwahr er ist. Seit dem Einmarsch der Russen in die Tschechoslowakei 1968 habe ich diesen Sozialismus so gehasst, dass es völlig absurd gewesen wäre, wenn ich dessen Zusammenbruch nicht begrüßt hätte.
Goepper: Meine Frage zielte nicht darauf, ob und wieweit Ihre Kollegen das Ende der DDR und des Sozialismus bedauern, sondern darauf, dass der Begriff „Wende“ für Sie problematisch ist. Vielleicht könnte man sich andere Wörter einfallen lassen?
Faktor: Das Unbehagen mit diesem Begriff hat unterschwellig trotzdem diesen besonderen Hintergrund, glaube ich. Ist dieses „semantische Unbehagen“ nicht einfach vorgeschoben? Und muss man diesen Zusammenbruch – und es war einer – unbedingt anders nennen? Mir gefällt das Wort doch auch nicht besonders. „Wende“ hat aber nur zwei Silben, ,,Zusammenbruch“ vier. Der kürzere Begriff hat sich sehr schnell etabliert, man wird ihn sowieso nicht los. Vielleicht auch deswegen, weil das Wort (psychologisch gesehen) ein reiner Euphemismus ist – und stark vereinfachend. Vielen Mitläufern im Osten passte es wunderbar in den Kram und der Westseite entsprach „Wende“ auch ganz gut: Es beschämte niemanden und verschleierte geschickt das Eigentliche: den leisen Triumph. Bei dieser Umwälzung handelte es sich doch faktisch um eine komplette, wenn auch freundliche und in vielerlei Hinsicht gelungene Übernahme bei laufendem Betrieb; also von wegen „Wende“. In meinem Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit27, den ich gerade fertiggestellt habe, geht es zwar in erster Linie um meine Kindheit und Jugend in Prag, punktuell aber auch um die Zeit nach 89 – und für die tschechische Wende verwende ich dort den (nicht ganz ernst gemeinten) Neologismus „Umvolution“. Das Wort benennt sowohl einen Umbruch als auch eine Revolution, denn weder das eine noch das andere allein ist wirklich stimmig. Aus „Umvolution“ kann man außerdem „Umwälzung“ oder „Evolution“ heraushören – wunderbar! Im alltäglichen Umgang sage ich trotzdem weiter „Wende“. Alle wissen Bescheid und zucken nicht unbedingt zusammen.
Goepper: Wie wär’s mit „friedlicher Revolution“?
Faktor: Das war doch keine Revolution, zumindest nicht im politischen Sinne, sondern Folge von Auflösung grundlegender Strukturen; die DDR erklärte sich Schritt für Schritt bankrott. Der Staat konnte seine Leute einfach nicht mehr ruhig und nicht im Land halten, auch die ganz Braven hatten plötzlich viel weniger Angst als früher, und viele wollten nur noch weg. Der Hauptanstoß kam dann von dem riesigen Druck der Ausreisewelle. Dass es die Bürgerbewegung gab, war zwar erst mal – auch moralisch – sehr wichtig, das Interesse der Leute flaute aber sehr schnell ab. Als das ganz brisante überregionale (also DDR-weite) Koordinierungstreffen des Neuen Forum zwei Tage nach dem Mauerfall, also am 11. November in Berlin-Oberschöneweide stattfand, reisten viele Delegierte gar nicht erst an. Und Bärbel Bohley28 meinte in einem Interview in diesem Zusammenhang, die DDR-Regierung hätte die Mauer absichtlich geöffnet, um die Menschen vom eigentlichen, also vom politischen Kampf, abzulenken. Das war emotional verständlich, politisch aber extrem unklug; vielen wurde auf einen Schlag klar, dass das Neue Forum nicht für sie sprach, sie nicht wirklich repräsentierte. Und erst mal wollte man sowieso lieber im Westen etwas erleben, einkaufen gehen, sich friedlich betrinken… Die DDR-Opposition hat als ein Machtfaktor von Anfang an stark geschwächelt. Der Begriff „friedlicher Zusammenbruch“ wäre vielleicht richtiger, er ist aber eindeutig zu lang.
Goepper: Was jetzt die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Land betrifft: Sind Sie eher enttäuscht oder haben Sie sowieso nichts Besonderes vom neuen System erwartet?
Faktor: In der letzten Zeit habe ich mich darüber amüsiert, was für ein Schauspiel uns die zusammenbrechenden Banken geliefert haben. Ich fand es extrem interessant.
Goepper: Können Sie sich wirklich darüber amüsieren?
Faktor: Was bleibt einem übrig? Sollte ich als ein Außenstehender etwa die Gefahren erkennen; oder dann sogar versuchen, den Crash zu verhindern? Wenn die Profis, die mit den Dingen täglich zu tun haben, auch nichts verhindert haben? Man ist in vielerlei Hinsicht doch eher ahnungslos, weiß also in der Regel nur das, was man sich selektiv und fragmentarisch aus den Medien und dem Internet zusammengeklaubt hat. Auf dieser Basis geben dann viele Intellektuelle gleich gewichtige Kommentare und Analysen ab. Und egal wie originell sie sind; es ist die schlichteste Wiederverwertung irgendwelcher Basisinformationen. Ich würde keine ernsthaften Statements zur Bankenkrise u.ä. abgeben wollen, wie es früher die Großschriftsteller der älteren Generation gewohnt waren. Es kann nicht meine Aufgabe sein, über Nacht ein Bankenexperte zu werden – und dann wieder Experte für Tiefseebohrungen… Mir sind sowieso Leute suspekt, die sich andauernd aufregen und immer wieder aufs Neue ins Zeug legen. Und „vom System etwas erwarten“ – um auf Ihre eigentliche Frage zurückzukommen: Meistens hat die Unzufriedenheit der Leute ganz andere Gründe. Ich gehe dann eher psychologisch ran, versuche die persönliche, individuelle Seite ihrer „Positionen“ zu finden. Also wenn einer konkrete Geldverluste zu beklagen hat, darf er deswegen auch ordentlich wütend sein. Wenn aber dauernd irgendwelche dunklen Mächte schuld dran sein sollen, was in der Welt nicht gut läuft, dann sind derartige Zuweisungen eher Gefühlsderivate.
Bert Papenfuß fragte mich einmal – wir saßen in einem Straßencafé in Berlin-Mitte – ob ich das alles, was um uns herum zu sehen war, gut fände. Er meinte den auf der Oberfläche so quirligen und schön anzusehenden Kapitalismus. Ich antwortete nur indirekt; ganz ernst kann ich auf solche idealistischen und aufs Ganze zielenden Fragen schon lange nicht mehr reagieren:
Ich wünsche mir nur, dass sich alle Menschen auf der Welt lieb haben.
Bert reagierte ganz souverän, hat die Zurückweisung zum Glück so stehen lassen.
Goepper: In Schornstein[footnote]Jan Faktor: Schornstein, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2006[/footnote] fiel mir trotzdem die gesellschaftliche, womöglich sogar die politische Dimension auf: Die Hauptfigur bekämpft eine Krankenkasse, die sie nicht mehr für ihre chronische Krankheit behandeln will. Schon in den ersten Seiten wird auf eine stark alkoholisierte Männergruppe auf der Straße fokussiert. Die Nachbarin Frau Schwan ist auch ziemlich heruntergekommen. Wollten Sie damit nicht doch auf Fehlerscheinungen, die vielleicht die Wende mit sich gebracht hat, hinweisen?
Faktor: Obwohl ich Vorbehalte gegen die Kapitalismuskritik mancher meiner Schriftstellerkollegen habe, bedeutet das nicht, dass ich die gesellschaftlichen Schieflagen ignorieren würde. Wenn das soziale Netz bedroht ist und dabei ist, Schaden anzurichten, sehe ich natürlich auch genau hin; ich weigere mich lediglich, darauf mit Pauschal- oder Fundamentalkritik zu reagieren. Im ersten Kapitel von Schornstein erbricht sich jemand friedlich inmitten einer zufälligen Menschenansammlung in einer Parkanlage; alle bis auf diesen einen Unglücksraben wollen dort eigentlich die erste wärmende Frühlingssonne genießen. Der Mann steht nach einer Weile wieder auf greift sich sein Köfferchen und verlässt seine Bank selbstständig und in Würde. Diese Szene trägt viel Symbolkraft für das ganze Buch in sich. Der Mann musste nicht abtransportiert werden und kam aus eigener Kraft weiter, ohne zu klagen, ohne großes Geschrei. Ich bin kein Fatalist, ich resigniere doch nicht!
Die reale Frau Schwan (in Wirklichkeit hieß sie Huhn29) wohnte tatsächlich hier in unserem Haus und ich mochte sie sehr. Jetzt lebt sie im Altersheim.
Auch ihr Geruch ist weg. Als ihre Wohnung entrümpelt wurde, erfuhr ich, dass es in ihrer guten Stube tatsächlich ganze Mäusenester gab. Sogar unter ihrem heiligen Sofa. Dabei war die Beschreibung der verwesten Ratte im Roman reine Fantasie von mir.
In diesem Zusammenhang wollte ich aber auf keinen Fall auf irgendwelche „Wendeerscheinungen“ hinweisen. ,,Asoziale Existenzen“ gab es auch in der DDR reichlich, diese Leute zeigten sich aber lieber nicht in der Öffentlichkeit. Schornstein spielt nun mal in der Nachwendegesellschaft, und ich begann erst in dieser Zeit gezielt und anders zu beobachten, Material zu sammeln. Und da in meinen früheren Experimenten und Sprachspielen die DDR-Realität direkt nicht vorkommen konnte, hatte ich sowieso keinen Raum für inhaltliche Aussagen, Bezüge oder Beschreibungen. Ich vermied damals grundsätzlich alles Direkte, ging rein assoziativ vor, berührte die Realität eher vermittelt – höchstens in Anspielungen oder mit Hilfe von Reizwörtern. Mit irgendwelchen Vorsichten hatte das aber wenig zu tun – mich zu den Dingen direkt zu äußern, mich sozusagen festzulegen, also nicht mit Mehrdeutigkeiten zu spielen, kam nicht infrage. Ich hätte das damals als plump und künstlerisch minderwertig empfunden. Für viele andere galt das Gleiche: Man wollte auf keinen Fall beim Wort genommen werden – von wem auch immer. Lutz Rathenow30 schrieb ganz anders und hatte in der Szene genau aus diesem Grund keinen guten Stand. Dass ich jetzt eine Menge an Erinnerungen und Geschichten habe, die ich literarisch noch gar nicht berührt habe, ist also kein Zufall. In meinen neuen Roman, der eigentlich in Prag spielt, habe ich einige Beobachtungen, Szenen und Figuren verarbeitet, die aus ganz anderen Lebensabschnitten stammen – beispielsweise aus DDR-Zeiten. Meine Literatur ist dadurch nicht unbedingt politischer, „aktueller“ geworden. Prosa hat für mich sowieso einen ganz eigenen Anspruch, was den Bezug zur Realität angeht: Manche Themen kann man gar nicht meiden. Wenn sie für einen dringende Aktualität haben, muss man sie auch abarbeiten.
Goepper: Heißt es, dass man bei Ihnen eine Verbindung zwischen der Wende und dem Übergang zur Prosa herstellen kann?
Faktor: Nein, nicht wirklich. Ernsthaft habe ich es erst im Jahre 1993 und dann 1996 bis 97 versucht, diese beiden zweifelhaften Romanexperimente31 sind aber nie publiziert worden; einen wirklichen Neuanfang gab es dann erst im Jahre 2000 mit Schornstein. Nach der Wende habe ich das spielerische Experimentieren – nach einer kleinen, politisch bedingten Zäsur – erst mal fortgesetzt, habe konsequent versucht, mich in dieser besonderen, inzwischen aber etwas ins Abseits geratenen Literatenszene durchzusetzen. Und das klappte ganz gut, es gab viel Interesse – zu verdanken hatte ich das vor allem dem Verlag Janus press von Gerhard Wolf. Dieser fast nahtlose Übergang hatte aber natürlich eine Vorgeschichte: Ich wurde schon im Frühjahr 1989 – als Tscheche konnte ich schon länger in den Westen reisen, wenn ich eine Einladung vorlegen konnte – zum Bielefelder Colloquium neue Poesie32 eingeladen (als Gast) und wurde in den 9oer Jahren dann tatsächlich auch Mitglied. Ich hatte also von Anfang an einen Platz auch unter den Autoren der „Konkreten Poesie“. Etwas später habe ich aber – als Alternative zum Schreiben sozusagen – trotzdem versucht, auch ganz andere Wege zu gehen. Habe mehrere Jahre Lichtbildvorträge über Gebrauchsanweisungen aus DDR-Zeiten gehalten33 – im Grunde war es Realsatire, für mich aber gleichzeitig ernsthafte Arbeit an Fremdtexten und auch an meinen eigenen biografischen Erlebnissen mit der ostdeutschen Warenwelt. Die Vorträge habe ich ausschließlich frei gehalten, habe also nichts schriftlich festgehalten.
Parallel dazu habe ich von 1997 bis 2000 mit dem Choreografen Johannes Bönig und seiner Balletttruppe Bönig Körperschafft zusammengearbeitet. Bönig kam nach Dresden erst nach der Wende, wo es in den 90ern eine ziemlich starke Tänzerszene gab. Als er für das Projekt „Tanz und Text“ Autoren suchte, hörte er sich in der Literaturwerkstatt Berlin Tonbandaufnahmen von Lesungen an und stieß dabei auf meine Körpertexte. Ich wurde in die Choreografien eingebunden und bei den Auftritten musste ich dann meine Texte nicht nur lesen, ich musste dabei (es war aber auch mein Wunsch) mit Rollerblades zwischen den Tänzern herumfahren. Das war aufregend und nicht ganz ohne Risiko. Wir traten mit dem Programm auch im Ausland auf, für mich waren das ganz neue Erfahrungen. Inzwischen existiert die freie Tanzgruppe leider nicht mehr. Literarisch brachte diese Zusammenarbeit im Grunde nichts Neues, meine Texte wurden aber wenigstens noch mal und vor ganz anderem Publikum vorgeführt. Innerlich ging für mich die Zeit der Experimente aber endgültig zu Ende. Mir fiel nichts weiter ein – als ob ich alles, was mir möglich war, abgearbeitet und ausgeschöpft hätte. Insgesamt brauchte ich aber ziemlich lange, bis ich das Experimentieren endgültig aufgab. Indirekt noch zu Ihrer eigentlichen Frage: Ich habe also nicht gleich nach dem Mauerfall die neuen Freiheiten genutzt, um irgendwelche lange zurückgehaltenen Dinge endlich aufzuschreiben. Ich nahm in den 90er Jahren wie alle anderen die unterschiedlichsten Stimmungen auf, merkte, was in der Luft hing, und was die Leute wirklich bewegte – und versuchte, mich literarisch weiterzuentwickeln. Bei meinen Lesungen stellte ich allerdings bald fest, wie meine textliche Zerstörungsarbeit rasant an Brisanz verlor. Und auch mir wurden manche der früheren Experimente plötzlich suspekt, obwohl ich zu den meisten von ihnen bis heute stehe; bei den Auftritten funktionierten sie einfach nicht wie früher.
Goepper: Würden Sie mir zu den Gebrauchsanweisungen-Vorträgen mehr sagen?
Faktor: Dass ich mich jahrelang mit den DDR-Gebrauchsanweisungen beschäftigt habe, bevor es wieder ernsthaft ans Schreiben ging, hatte einige gute Seiten. Es war sozusagen eine Art Latenz- und Reifezeit für mich – und ich hatte ganz neue Verdienstmöglichkeiten gefunden. Das alles fing aber erst mal ganz harmlos an, falls Sie das interessiert… Ich hatte die Gebrauchsanweisungen zu DDR-Zeiten einfach auch aus praktischen Gründen aufgehoben, mit den vielen unansehnlichen Zetteln aber künstlerisch nie etwas vorgehabt. Manche zwanghaft genauen Zeichnungen und Erläuterungen fand ich nur etwas kurios, typisch ostdeutsch. Manche der Texte waren zwar sachlich klar geschrieben, wirkten aber seltsam bis skurril; sie waren so überengagiert, dass sie unfreiwillig komisch wirkten. 1996 hatten wir mit Freunden bei uns Sylvester gefeiert und ich kramte spontan zur Belustigung einige Gebrauchsanweisungszettel aus und las aus ihnen vor. Die Reaktion war überwältigend, mich hatte der Erfolg des spontanen kleinen Kulturprogramms – alle haben sich fast krankgelacht – völlig überrascht. Meine Frau hatte dann die Idee, dass ich aus meinem Fundus auch bei öffentlichen Auftritten lesen könnte. Anfangs präsentierte ich einige Exemplare aus meiner Sammlung auf großen Flipchart-Bögen, später ging ich zu Diapositiven über, suchte neue Kontakte und recherchierte weiter; außerdem begann ich Gebrauchsanweisungen auch gezielt zu sammeln und die entsprechenden Gegenstände zu fotografieren. Nach und nach entstand so ein längerer Dia-Vortrag, den ich mehrere Jahre lang anbieten und in Galerien, Klubs, Literaturhäusern, kleinen Theatern vorführen konnte. Mit dem Vortrag war ich von 1997 bis 2000 viel unterwegs, und in dieser Zeit lernte ich endlich, Vorträge auch frei zu halten. Früher wäre das für mich undenkbar gewesen. Hier konnte ich mich immer auf das Bildmaterial beziehen, und es funktionierte sogar überraschend gut…
Die Texte haben zum Teil tatsächlich gewisse verborgene Qualitäten, ich suchte fieberhaft nach neuem Material, ging zu Sammlertreffs und war schon dabei, einen Folgeabend zu entwickeln. Aber so weit ist es nicht gekommen, inzwischen war für mich auch dieses Thema gewissermaßen erschöpft; vor allem fehlten mir wirklich lohnende Funde, also gewisse Highlights, für die sich ein neuer Anlauf gelohnt hätte. Und etwas in mir wollte sicher zurück zur Literatur. Die große Frage war aber, zu welcher; zurück ging es auf keinen Fall. An sich war ich eigentlich überzeugt, ich könnte ohne Probleme auch gute Prosa schreiben, wenn ich es nur wollte. Das war allerdings ein grober Irrtum. Und ich hatte sowieso keine Geschichte zu erzählen, kein dringendes Thema vor Augen. Bis mir eines Tages wie ein Blitz die Idee zum Roman über den „Kassenkampf“ kam – also zu Schornstein. In der anfänglichen Begeisterung (und ich war tatsächlich wieder ein Anfänger) kam ich zwar gut voran, nach einigen Rückmeldungen musste ich mir etwas später aber eingestehen, dass ich vom Romanschreiben konzeptionell sehr wenig Ahnung hatte. Als experimenteller Autor war ich es „dummerweise“ gewohnt, eher gegen die Regeln zu schreiben; bei Prosa lassen sich manche Regeln aber auf keinen Fall ignorieren. Ich machte also alle möglichen Anfängerfehler, produzierte zu viele Figuren und redundante Handlungsstränge, manche Figuren gerieten für viel zu lange in Vergessenheit… Meine Ernüchterung war dann zwar frustrierend, war aber auch lehrreich; beim Kürzen merkte ich zum Beispiel, dass dem Text auch eine radikale Verknappung in der Regel gut tut – und er sogar stark an Wirkung gewinnt, statt an Gehalt zu verlieren. Insgesamt hatte ich natürlich sehr viel Arbeit in den Sand gesetzt.
Goepper: Was ist aus dem Prosatext mit den nummerierten Sätzen geworden, den Sie 1994 im Gespräch mit Cécile Millot erwähnt haben?
Faktor: Daraus ist mein jetziger großer Georg-Roman geworden. Anfang der 9oer Jahre wurde mir endlich klar, dass diesen experimentellen „Hypertext-Roman“ wahrscheinlich niemand lesen wollen würde – er wäre tatsächlich unlesbar, denke ich, egal wie beeindruckend er in Details oder in einzelnen Kurzkapiteln vielleicht geworden wäre. Diese Einsicht hatte nichts mit Anpassung an den Normalgeschmack zu tun. Die Arbeit mit den ganzen Verflechtungen im Text und den vielen Verweisen auf andere nummerierte Stellen mündete in aufreibenden und kleinkarierten Fummeleien; und ich spürte dabei, dass ähnliche Qualen man sicher auch als Leser erleiden würde. Und warum sollte man sich das als ein solcher überhaupt gefallen lassen? Mir wuchs die gigantische Aufgabe nach und nach einfach über den Kopf. Bei dem allerletzten Rettungsversuch versuchte ich die Sache noch verzweifelt mit meinem ersten PC zu bewältigen. Es war aber sinnlos, die Nummerierung und die Querverweise hätte ich sowieso weiter selbst, also manuell überwachen müssen. Und die grundlegenden Schwierigkeiten blieben die gleichen: Jedes neu eingeschobene Kapitel veränderte sofort die nachfolgende Nummerierung – und auch viele mit Nummern versehenen Querverweise stimmten auf einen Schlag nicht mehr. Danach ließ ich das Vorhaben über zehn Jahre ruhen. Den Ehrgeiz, auch gute Prosa hinzubekommen, gab ich aber nicht auf. Als ich viel später begann, den wirklichen Georg-Roman zu schreiben, baute ich unauffällig einige besonders wichtige und prägnante Sätze aus der ursprünglichen Fassung in den fließenden Text ein. Auf diese Weise wollte ich wenigstens punktuell einige „Satzperlen“ retten, die nicht ganz verloren gehen sollten; sie sollen im Text allerdings nicht weiter auffallen, tun es auch nicht. Irgendwann gab ich es aber auf. Ich hatte genug Stoff, war auf diesen so schön nummerierten Fundus gar nicht angewiesen.
Ich habe schon die beiden Romanversuche erwähnt. Der eine ist nie fertig geworden, der zweite war grundsätzlich missraten. Ich versuchte darin, mich in einem monologistischen Schreibfluss zu versteigern, ohne eine Geschichte zu erzählen. Außerdem lehnte ich damals auch noch alles Fiktionale ab und wollte Erlebnisse, Szenen so erzählen, wie sie sich tatsächlich zugetragen hatten. Ich war nun mal gegen alles Konventionelle… Ich experimentierte gewissermaßen weiter und meinte, dass ich dabei vielleicht meinen eigenen Stil finden würde. Mit den umständlichen, überperfektionierten und verschachtelten Sätzen wollte ich die Leser außerdem bewusst ärgern – eine verrückte Idee! Kein Wunder also, dass das Buch dann auch kein Verlag haben wollte. Erst nachträglich musste ich mir (wieder einmal!) eingestehen, dass diese Erzählweise beim Lesen schnell langweilig werden würde, niemand würde sich auf diese Art und Weise lange quälen lassen. Und „wie es wirklich war“ interessiert bei gut erzählter Prosa sowieso niemanden. Ich testete den unfertigen Text probeweise sogar mehrmals bei Lesungen; und spürte eindeutig, dass mit ihm etwas Grundsätzliches nicht stimmte. Trotzdem dauerte es lange, bis ich mich von dem „Roman“ auch emotional verabschieden konnte. Insgesamt habe ich wirklich acht, zehn Jahre gebraucht, um mich selbst zu überzeugen, dass man doch Geschichten erzählen muss. Dass nur die Geschichte das ganze Textgebilde zusammenhalten kann, dass sich nur so die Aufmerksamkeit und die Neugier der Leute am Leben halten lässt. Die Überwindung meiner Widerstände und Vorbehalte hat mich sehr viel Kraft und Zeit gekostet, war aber offenbar nötig.
Goepper: Handelt es sich nur um einen Reifungsprozess oder gab es trotzdem einen präziseren Auslöser?
Faktor: Schornsteins Kampf mit der Krankenkasse hat schon einen realen Hintergrund – und über diesen wollte ich irgendwann auch unbedingt „berichten“. Wegen des realen Kampfs mit der Krankenkasse musste ich natürlich viel recherchieren – und hatte schon nach einigen Monaten sehr viel Wissen (auch über ganz andere Schicksale) angehäuft. Ich hatte also eine ganze Menge Stoff etwas fehlte mir aber immer noch: eine Geschichte. Als mir dann auch diese einfiel, wurde das Buch – jedenfalls meinem Gefühl nach – innerhalb einer halben Stunde bei einer Fahrradfahrt in mir fertig. Ich musste es nur noch aufschreiben; es war ein ganz neuartiges Gefühl. Neu war außerdem, dass ich beim Fantasieren über den Verlauf der Geschichte begann, auch vollkommen frei zu erfinden – und überraschenderweise empfand ich das plötzlich als legitim. Die Fertigstellung hat dann allerdings ganze sechs Jahre gedauert. Als ich den Text 2003 zum ersten Mal aus der Hand geben konnte, begann die Zeit der harten Prüfungen. Alle wichtigen Verlage lehnten das Manuskript ab, ich bekam zum Teil sehr unangenehme Absagen. Aber auch kleinere Verlage – manche der Verlagsleiter kannte ich sogar persönlich – wollten das Buch nicht drucken. Dabei war ich fest davon überzeugt – und die Überzeugung verließ mich die ganze Zeit nicht –, ordentliche Prosa abgeliefert zu haben, die alle nötigen Zutaten enthielt: Kampf, Dramatik, Liebe, Befreiung. Ganz so gut lesbar und einfach verdaulich war das Buch anscheinend aber doch nicht. Vor allem war es zu lang und teilweise etwas redundant zugewuchert. Nachdem ich das begriffen hatte, begann ich zu kürzen und entdeckte dabei die Vorzüge der Stringenz und Sparsamkeit. Aber auch die 2004 überarbeitete und stark gekürzte Fassung kam bei den Verlagen nicht gut an. Die Ekelszenen, das Kotzen gleich im ersten Kapitel usw. schreckte viele offenbar ab; man machte sich sicher Sogen um „die Leser“, die das Buch deswegen gleich ablegen könnten… Warum die Ablehnung aber so einhellig war, verstehe ich bis heute nicht ganz. Auf jeden Fall störte man sich auch an der Sprache des Ich-Erzählers, der dort mit Absicht eher gewöhnliches Alltags-Deutsch spricht. Eine Lektorin vom Suhrkamp-Verlag meinte dazu (obwohl kein Slang dabei war):
Da ist zu viel Sprachmüll, Herr Faktor. Davon haben wir genug im Alltag.
Offenbar schrieb ich doch ein bisschen gegen den Strom; die Geschichte sollte unbedingt etwas Rohes und Ungeschliffenes haben, sollte von mir aus auch Ekel hervorrufen. Dabei wollte ich nicht nur provozieren, mich ziehen solche Dinge einfach an – und ihre nachträgliche sprachliche Ausgestaltung sowieso. Einige wenige Verlage – Kiepenheuer & Witsch zum Beispiel – lehnten die überarbeitete Fassung nicht grundsätzlich ab; man wollte sich das noch überlegen. Mitten in dieser angespannten Zeit bekam ich dann 2005 den Preis34 und mit der Verlagssuche wurde es ganz einfach.
Goepper: Im vorhin erwähnten TEXT+KRITIK-Aufsatz35 haben Sie geschrieben, die Künstler des Prenzlauer Bergs würden sich „selbst sabotieren“, weil sie immer noch nicht lesbar genug schrieben. Was sagt die Tatsache, dass es auch mit der Veröffentlichung von Schornstein Schwierigkeiten gab, über den heutigen deutschen Literaturbetrieb?
Faktor: Als ich den Aufsatz schrieb, war ich schon längst entschlossen, anders zu schreiben – und versuchte es seit Jahren auch redlich, bislang allerdings erfolglos. In dem Aufsatz spreche ich also nicht nur über die anderen, sondern auch über mich selbst, denke darüber nach, warum eigentlich „aus uns allen nichts geworden ist“. Ich bekenne mich darin u.a. zu meinem eigenen zwiespältigen Verhältnis zum Publikum. Ich war lange genug ein Teil der Ostberliner Szene und war es ebenfalls gewohnt, möglichst GEGEN etwas anzuschreiben. In meiner kleinen Analyse beschäftige ich mich im Grunde eher mit unserer publikumfeindlichen Haltung, nicht so sehr mit der Lesbarkeit der Texte.
Dass meinen Schornstein lange niemand publizieren wollte, war für mich natürlich erst mal sehr hart – es hatte aber eine gewisse Logik und hängt mit dieser ganzen Problematik eindeutig zusammen. Die vielen Absagen lieferten mir seinerzeit wenigstens gutes Material zum Nachdenken. Mein Fazit: Ich habe mich dem Publikum, dem „Betrieb“ doch wieder nicht ganz angepasst; und in den Verlagen muss man diese Widerborstigkeit auch gespürt haben. Und schließlich begriff ich dank einiger persönlicher Gespräche, dass auch ganz professionelle Lektoren die Manuskripte mitunter rein emotional und sehr persönlich beurteilen. So gesehen ist der Begriff „Literaturbetrieb“ vielleicht ganz falsch: Es wimmelt dort von vollkommen unterschiedlich fühlenden und subjektiv urteilenden Menschen, die unter anderem im Blick behalten müssen, dass die Bücher ihres Verlages sich auch verkaufen sollten. Der erwähnten Suhrkamp-Lektorin ging beispielsweise mein schwieriger bis desolater Schornstein als Figur (um den man sich im realen Leben – als Frau wohlgemerkt – wahrscheinlich dauernd kümmern müsste) einfach auf den Wecker. Der Verlagsleiter von Eichborn.Berlin meinte, mein Buch wäre nur etwas Unentschiedenes zwischen Roman und Betroffenheitsbericht. Mit dem Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch und dem Lektor Olaf Petersenn hatte ich letzten Endes etwas mehr Glück. Olaf hat auch als Mensch viel Sinn für Humor. Trotzdem schienen auch ihm einige peinliche bis eklige Stellen im Text (für „die Leser“…) problematisch zu sein. Die humorige Seite der Geschichte kam auch bei ihm nicht gleich an und er konnte sich für das Buch lange Zeit nicht klar entscheiden.
Im Grunde setzte sich in mir doch die widerborstige Haltung von früher fort – nur etwas verdeckter und mit anderen Mitteln.
Goepper: Glauben Sie, dass ein Künstler sich dem Geschmack des Lesers anpassen sollte?
Faktor: Man tut es teilweise einfach unbewusst, denke ich. Und das muss mit direkter Anbiederung überhaupt nichts zu tun haben. Zum Schreiben gehört natürlich auch eine Erwartungshaltung – man will von der „Lesergemeinde“ nicht nur irgendwelche sachlichen Rückmeldungen, nach der geleisteten Arbeit sehnt man sich doch auch nach einer Art Beglückung. Und wenn lobende Worte, also ein gewisser Rückfluss von Emotionen ausbleiben, kommt der Frust; davon bekommt man in den Künstlerkreisen mehr als genug mit. Was ich hier jetzt beschreiben will und was an sich ganz unterschwellig abläuft, ist allerdings kein plumpes Spiel, es umfasst ganz komplizierte, seelische und eher subtile Bewegungen: Als Autor nimmt man die Stimmungen und Erwartungen, die in der Luft hängen, auf, verarbeitet sie und macht dann etwas Eigenes daraus – und jeder anders. Und jeder wartet dann gespannt, wie viele Menschen sich ausgerechnet von dem ganz bestimmten „Prozessergebnis“ werden beeindrucken lassen.
Über diese Dinge musste ich schon viel früher nachdenken – als ich die stark nachlassende Wirkung meiner Sprachexperimente spürte. Darüber haben wir schon gesprochen. Als mir seinerzeit klar wurde, dass diese Art von Literatur ihre Brisanz verloren hatte, war ich einfach gezwungen umzudenken. Man bewegt sich in diesem Strom von Befindlichkeiten und Geschmacksumwandlungen doch selbst mit – als Rezipient sozusagen. Sollte man das als Anpassung ans Publikum verstehen? Ich glaube nicht.
Goepper: Viele Autoren behaupten, sie wüssten gar nicht, wer sie liest.
Faktor: Wissen Sie, meine Frau ist Analytikerin, daher bin ich psychologisch ein bisschen vorgeschädigt. Wenn einer nicht sehen will, was seiner Arbeit „libidinös“ zu Grunde liegt, soll er damit glücklich werden. Freud hat diese Dynamik schon sehr früh erkannt und in seinen Vorlesungen36 wunderbar schnörkellos benannt. Und mir persönlich hat diese Art Lektüre offenbar nicht geschadet. An sich ist es aber natürlich nicht wichtig, sich beim Arbeiten Gedanken darüber zu machen, was das eigene Unbewusste mit einem so treibt. Man setzt dieses Wissen doch nicht einfach ein. Man hat beim Schreiben sowieso nicht viel Wahl. Worüber man zukünftig schreiben wird – und es kann sich dann um mehrere Jahre handeln, die folgen werden –, entscheidet sich oft in seltenen und völlig unkontrollierten Augenblicken. Diese unbewussten Erst-Impulse sind für die Wahl des Themas, die Ausrichtung der Geschichte und so weiter ganz entscheidend. Und wenn man sich in die Arbeit einmal verbissen hat, bleibt man auch dran und denkt nicht vordergründig über Perspektiven oder Erfolgschancen der Arbeit nach oder darüber, für welches „Zielpublikum“ man sich gerade abmüht. So gesehen haben auch diejenigen Autoren recht, die Sie in Ihrer Frage meinen: Man schreibt nicht einfach „für die Leute“, sondern wirklich so, wie es kommt. In den 90er Jahren stand für mich einige Male fest, dass ich Prosa schreiben werde – trotzdem hat es erst mal absolut nicht funktioniert. Zu der ganzen langen Entwicklung gehörte für mich allerdings auch viel Selbstreflexion, Reifung – und eben auch Freud. Aber sicher noch vieles mehr, was sich gar nicht so einfach benennen ließe.
Goepper: Oft geht man davon aus, dass Lyrik persönlicher ist als Prosa. Bei Ihnen scheint es umgekehrt zu sein.
Faktor: Das stimmt. Im Grunde habe ich bis auf eine Ausnahme37 nie persönlich und emotional beladene Gedichte geschrieben. Meine Spezialität waren eher entkleidete Wortgebilde und serielle Textkonstruktionen, ohne Metaphern und anderen poetischen „Firlefanz“. Oft habe ich einfach kunstferne Fremdtexte bearbeitet – und da kam kein einziges Wort von mir. Viele der Texte haben dann sowieso erst beim Vorlesen ihre wahre Gestalt bekommen. Damals wollte ich von mir auch nichts weiter preisgeben. Die experimentellen Spielereien waren eine gute Möglichkeit, mich zurückzunehmen, aus den Texten alles Persönliche rauszuziehen. Dagegen war ich beim Vorlesen sehr emotional, schrie manche meiner „Litaneien“ regelrecht, laut und ausdauernd. Aus diesem Kontrast entstand viel Spannung: Das Anliegen hinter den Texten war natürlich sehr ernst und im Verborgenen auch persönlich. In meiner Kindheit und Jugend spielte ich Gitarre, hörte viel Musik und habe außerdem viel gesungen – zur Gitarre eben, und dies natürlich entsprechend emotional. So gesehen habe ich für meine späteren Auftritte schon früh geübt. In einigen der Experimente steckt – auch rhythmisch – einiges an Musik. Einige dieser Texte sind mir zum Glück nicht fremd geworden und ich kann sie, wenn es dazu eine Gelegenheit gibt, bis heute ohne Weiteres vorlesen. Das ist ein gutes Zeichen; für mich war es das eine oder andere Mal eine kleine Überraschung, wenn manche Arbeiten so zeitlos funktioniert haben.
Goepper: Denken Sie, dass Sie nie wieder Gedichte schreiben werden?
Faktor: Ich kann mir das schlecht vorstellen. Der neue Roman ist 600 Seiten lang, es war eine Menge Arbeit; ich bin dabei inhaltlich sehr viel „losgeworden“ und habe einiges dazugelernt. Die Latte liegt jetzt sehr hoch – und woanders, nicht bei Lyrik.
Goepper: Trotz des Gattungswechsels sehe ich eine Gemeinsamkeit in Ihren Texten, und zwar im Körperlichen, im Organischen. Ist dieses Moment in Ihrem neuen Prosawerk auch vorhanden?
Faktor: Ja, in dem neuen Roman geht es auch viel um körperliche Dinge, um Sexualität und um „Organisches“, wenn Sie wollen. Weil Sie das gezielt ansprechen: Organische Substanzen neigen dazu zu faulen, zu gären, sich zu zersetzen – im Spiel ist also auch wieder viel Ekel (inzwischen meine Spezialität, könnte man sagen). Aber im Buch dreht sich vieles auch um politische, zeitgeschichtliche Dinge, um Prag, um den unaufhaltsamen Niedergang der Stadt. Es spielt in den 60er Jahren, zu denen auch der Einmarsch der „Bruderstaaten“ gehört, dann in der 70ern – also in der Atmosphäre der sogenannten Normalisierung; diese war für mich vor allem prägend. Natürlich kommen darin auch ganz persönliche, familiäre Dinge aus der Zeit meiner Kindheit und Jugend vor – eingebettet in eine skurrile, fiktive Wohnsituation. 1968 war ich siebzehn und habe dieses Jahr politisch ganz bewusst erlebt, auch dank meiner Mutter, die als Journalistin nicht nur gut informiert, sondern in viele politische Vorgänge (vor allem in den Schriftstellerkreisen) damals auch involviert war. Geschichtlich waren das sehr aufregende Zeiten. Wenn nachts russische Panzer die Straße lang rollen, in der man wohnt… so etwas vergisst man nicht. Aber wie gesagt: Noch schlimmer war die Zeit des gesellschaftlichen und kulturellen Niedergangs nach dem Einmarsch. Die „Normalisierung“ habe ich dann zehn Jahre lang bis zu meiner Übersiedlung in die DDR hautnah mitbekommen, wie auch die weitere Entwicklung in den 80er Jahren. Meine Mutter lebte in Prag und ich fuhr mindestens zwei-, dreimal im Jahr hin. Und meine Mutter versorgte mich regelmäßig mit Informationen und Samisdat38-Materialien. Einiges davon, was ich damals erlebte und erfuhr, habe ich im Buch natürlich auch verarbeitet.
Warum mich Ekelgefühle, die körperliche Verletzbarkeit sowie Endzeitzustände und -stimmungen so anziehen, habe ich mich beim Schreiben natürlich auch selbst fragen müssen; woher also mein etwas absonderlicher Hang zu diesen Dingen, meine diesbezügliche „Begeisterungsbereitschaft“ kommen. Es könnte mit den KZ-Erfahrungen meiner Mutter und meiner Familie zu tun haben. In den KZs wurden alle zivilisatorischen Regeln ausgesetzt, es ging nur um die nackte Existenz; offen war nur noch, wie hässlich einen irgendwann der Tod erwischt. Ich bin zwar erst sechs Jahre nach dem Krieg geboren – sechs Jahre sind aber nicht viel, diese Erfahrungen waren bei uns noch sehr präsent. Im Buch spielen sie natürlich eine gewisse Rolle – wenn auch auf einer eher etwas tiefer liegenden Ebene.
Goepper: Diese Thematik kam schon in Schornstein vor. Sie erzählen dort also auch die wahre Geschichte Ihrer Mutter?
Faktor: Ja und nein. Meine Mutter ist tatsächlich eine geborene Schornstein, so heißt auch der Ich-Erzähler des Romans. Ich hätte mir einen so übertrieben sprechenden Namen niemals ausgedacht. Meine Mutter hat über ihre KZ-Erlebnisse nie genauer irgendwie ausschöpfend oder in größeren Zusammenhängen schreiben wollen, sie hat nur einige ausschließlich anekdotische, also kleine komische Geschichten festgehalten und diese später (gemeinsam mit drei anderen Frauen, auch Überlebendem) publiziert.39 Die drei anderen Frauen haben ganz ernste autobiografische Aufzeichnungen über die ganzen Vorkriegs- und Kriegserlebnisse geschrieben, die sie ursprünglich vor allem für die Kinder und Enkelkinder festhalten wollten. Meine Mutter war aber der Meinung, dass man über das Grauen in den KZs unmöglich so berichten kann, dass es auch für Außenstehende nachvollziehbar wäre. Und hat eben diese „witzigen“ Geschichten aufgeschrieben; über die meisten wurde natürlich erst hinterher gelacht. Auf diese humorige Art und Weise wurden mir diese Erlebnisse auch in meiner Kindheit erzählt, bei uns in der Familie wurde insgesamt viel gelacht. Vor allem meine Großmutter war ein sehr fröhlicher, optimistischer Mensch. Ernsthaft und detailliert hat über die ganzen Kriegs- und Lagererlebnisse einzig meine Tante geschrieben, wenigstens sie. Deshalb weiß ich darüber relativ gut Bescheid. Für Schornstein habe ich allerdings nur einige der witzigen Geschichten meiner Mutter verwendet – also in den Text vorsichtig kurz eingeflochten. In meinem neuen Roman, also Georg, kommen wiederum ganz andere Familiengeschichten vor – selbstverständlich stark literarisiert. Aus der Elterngeneration lebt inzwischen niemand mehr, ich konnte mich auch beim Erfinden von Dingen, die so nie stattgefunden haben, vollkommen frei fühlen. Was aber geschichtliche Daten und Ereignisse betrifft, die Lebenswirklichkeit von Prag der damaligen Jahre, da blieb ich sehr nah an der Realität. Letztes Jahr habe ich aus dem Arbeitsmanuskript bereits vier- oder fünfmal gelesen (Anlass war beispielsweise das Jubiläum von 1968) und es hat sehr gut funktioniert. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen.
Goepper: Können Sie bei solchen Lesungen immer noch Unterschiede zwischen dem Publikum in den alten und in den neuen Bundesländern feststellen?
Faktor: In den 90er Jahren hatte ich beim Lesen von Prosa – also meiner Prosaversuche – einige dramatische Erfahrungen gemacht. Wie das Publikum auf mich als Person, auf meine Art zu lesen und meine Texte reagierte, waren die Unterschiede zwischen Ost und West anfangs noch relativ groß. Ich war in mehrerer Hinsicht sowieso eine Art Exot. Inzwischen ist es relativ egal, die eher atmosphärischen Probleme haben sowieso sehr unterschiedliche Gründe. Manchmal hat man bei Lesungen den Eindruck, vor einer verstockten Ansammlung von Unwilligen zu sitzen. Und man begreift nicht, was im Raum eigentlich vor sich geht, was die Leute stört oder verwundert; was in dem Moment also nicht stimmt. Aus Schornstein habe ich einmal das Kapitel über den etwas schrägen Psychiater Dr. Brakvart gelesen. Diese Figur wird dort sehr lebendig geschildert, und sie ist mir, glaube ich, ziemlich realistisch gelungen – obwohl hier alles vollkommen fiktiv ist, Dr. Brakvart ist eine reine Kunstfigur. Bei der erwähnten Lesung kam – für mich völlig unerwartet – bald eine unangenehm peinliche Stimmung auf. Und ich fühlte mich plötzlich wie ein Patient, der eins zu eins über seine Psychotherapie-Erfahrungen berichten würde! Vielleicht bin ich in diesen Dingen zu sensibel, vielleicht bildete ich mir diese atmosphärische Missstimmung nur ein. Ich fühlte mich aber tatsächlich wie bei einer öffentlichen Beichte – und habe mich dann nie wieder getraut, dieses Kapitel zu lesen. Jetzt fällt mir aber noch eine andere Lesung ein, bei der ich mich doch noch mal traute, aus diesem Kapitel zu lesen! Die Veranstaltung fand in einer psychiatrischen Klinik in Kreuzberg statt. Und alles ging gut, ich habe mich dabei sogar selbst ganz gut amüsiert. Wie Sie sehen – ich werde aus mir nicht wirklich schlau. Und Ihre eigentliche Frage habe ich sowieso noch nicht beantwortet. Vielleicht kommen wir später noch dazu. Für mich wird es, glaube ich, insgesamt einfacher sein, aus dem neuen Roman zu lesen als aus dem persönlich doch etwas heikleren und mehr in der Gegenwart spielenden Schornstein.
Goepper: Für Ihr Schreiben schöpfen Sie ausgiebig aus der Familiengeschichte und der eigenen Biografie. Sind Sie aber auch ein Leser, der sich von anderen Künstlern, beziehungsweise zeitgenössischen Künstlern begeistern lässt?
Faktor: Eigentlich lese ich verhältnismäßig wenig, weil ich sehr langsam lese. Dafür tue ich es wenigstens gründlich und merke mir viel. Meine Frau liest dagegen schnell und viel mehr als ich, wir tauschen uns regelmäßig aus. Ich lese gern auch Sachbücher und Biografien, meine Frau eher Gegenwartsromane. Ich habe natürlich einige Vorlieben: Frank McCourt zum Beispiel. Die Asche meiner Mutter ist ein unglaubliches Buch. Es ist sehr witzig, eindeutig autobiografisch – gleichzeitig große Literatur. Er beschreibt seine schlimme Kindheit mit unglaublichem Humor, insofern ist es schon ein Vorbild.
In meinem neuen Roman, wo Sexualität eine große Rolle spielt, habe ich natürlich an Henry Miller denken müssen, von dem ich bis dahin nur Wendekreis des Krebses kannte. Ich hatte es vor langer Zeit gelesen und dann im Einzelnen natürlich komplett vergessen. Als mein Buch in der ersten, schon ziemlich weit gediehenen Fassung 2007, 2008 fertig war, entschloss ich mich, den Wendekreis noch einmal zu lesen – und war vollkommen elektrisiert. Danach hatte ich mir die weiteren Bücher vorgenommen, natürlich auch die Trilogie Sexus, Nexus und Plexus; las außerdem die beiden, sich teilweise widersprechenden Biografien, die es über Miller gibt. Die eine wurde von einem Mann und die andere von einer Frau geschrieben. Letztere ist kritischer, aber dafür sehr gut recherchiert. Mein eigentlicher großer Meister und Vorbild ist also Henry Miller. Ein frecher, ehrlicher, schamloser Schweinehund, abnorm begabt, manisch, in den Texten spürt man die explosive Kraft seiner literarischen Befreiung – die sehr spät kam. Er kann richtig gemein sein, im Grunde wollte er natürlich auch schockieren. Ich kann diese Impulse sehr gut nachvollziehen, dennoch kann ich nicht wirklich vom literarischen Einfluss sprechen. Es waren ganz andere Zeiten; so wie er schrieb – teilweise auch ziemlich sexistisch –, kann man heute nicht mehr schreiben. Er gilt als sexbesessener Mensch, was so nicht stimmt. Er war eher seriell monogam. Und Wendekreis des Steinbocks ist ein unglaublich zartes Buch über seine Kindheit in Brooklyn, das zarteste, was ich je gelesen habe. Sexualität steht zwar immer wieder im Vordergrund, er beschäftigt sich darin aber viel mehr mit Menschen aus seiner Umgebung, mit seiner Familie, seiner stark zurückgebliebenen Schwester, mit seinen Freunden – und das mit sehr viel Liebe. Der Roman Sexus nimmt dann fast überbordende Ausmaße an, zum Beispiel wenn er den emotionalen Überdruck beschreibt, unter dem er in den Jahren steht, als er sich beim Schreiben nur und nur quält und nichts zustande bringt. Trotzdem ist er fest davon überzeugt, ein Schriftsteller zu sein. Er schont sich dabei kein bisschen, lässt sich erniedrigen und benutzen – und beschreibt es ohne jegliche Scheu; man weiß aber – und er auch – dass in ihm eine ganz heiße Magmablase brodelt. Das ist ganz große Literatur. Miller hat eben lange gebraucht, bis er sich für seine Art zu schreiben öffnen konnte und war siebenunddreißig Jahre alt, als sein erstes Buch herauskam. Vielleicht ist es auch ein Grund für meine Begeisterung. Ich bin ebenfalls ein Spätentwickler.
Goepper: Wann haben Sie angefangen zu schreiben?
Faktor: Etwa mit siebzehn auf dem Gymnasium; und erst mit fünfzig habe ich ernsthaft angefangen, Prosa zu schreiben. Über diesen späten Start bin ich ausgesprochen froh. In mancher Hinsicht müsste ich den damals Herrschenden fast dankbar sein. Für Leute wie mich kam es erst mal nicht infrage, am literarischen Leben teilzunehmen; und so gab es absolut keinen Druck, das oder jenes literarisch zu verarbeiten und zu publizieren. Ich hätte das ganze Material, die Themen usw. aber sowieso nur „verbraten“, denke ich. Ich war erst viel später in der Lage, wirklich wichtige Dinge über mich, meine Familie und Freunde preiszugeben. Und dann konnte ich an das Vergangene endlich mit mehr Reife, Leichtigkeit und Humor herangehen. Es gibt natürlich andere, sehr frühe Begabungen… Mir persönlich graut es aber davor, was ich mit zwanzig eventuell hervorgebracht hätte, wenn ich es – mit der Aussicht, es auch publizieren zu können – versucht hätte.
Witzigerweise habe ich diese Problematik schon vor fünfundzwanzig Jahren thematisiert. In den „Gedichten eines alten Mannes aus Prag“ von 1983 schrieb ich:
Mit fünfzig fing ich an zu schreiben
jetzt mit sechzig wird mir von mir selbst die Anerkennung zuteil
daß ich ein Schriftsteller bin40
Ich habe mich mit diesen Gedichten vor Kurzem beschäftigen müssen und habe diese Stelle leicht verändert. Sie lautet jetzt:
Mit fünfzig fing ich an zu schreiben
jetzt mit siebzig habe ich manchmal das Gefühl
dass ich es kann
Goepper: Ich habe den Eindruck, dass Sie an den früheren Texten ständig weiter arbeiten, indem Sie sie korrigieren und kürzen. Stimmt das?
Faktor: Nein, bloß nicht! Nur ausnahmsweise gibt es Situationen, bei denen ich aus alten Texten lesen möchte – oder es unbedingt soll. Und wenn ich merke, dass der Text aktuell wahrscheinlich so nicht funktionieren würde, muss ich mir ihn natürlich noch mal vornehmen. In dem gerade erwähnten Fall wollte ich unbedingt aus diesen Gedichten lesen – der Anlass war eine Trauerfeier für einen verstorbenen Freund. Beim lauten Üben habe ich sofort angefangen zu korrigieren, vor allem zu verknappen. Ich hätte die Gedichte sonst nicht lesen können.
Goepper: Können Sie den Stil Ihres neuen Romans im Vergleich zum Stil von Schornstein beschreiben?
Faktor: Schornstein ist eine Art Gesellenstück von mir, der neue Roman ist sprachlich noch souveräner. Er ist knapper, konzentrierter formuliert – obwohl er über 600 Seiten lang ist. Es ist eben ein kleines Panorama der damaligen Zeit, in dem viel mehr Stoff und viele Geschichten stecken; ein ganz anders angelegtes Buch. Ich kreise darin thematisch viel breiter und bunter um die vielen Zentren als es im Schornstein möglich gewesen wäre. Zeitlich werden darin vierzig Jahre im Leben des Ich-Erzählers beschrieben. Der Roman beginnt in den 50er Jahren und endet nach 89, also nach der Wende. Der Erzähler ist wieder mal mein Georg, diesmal macht er sich allerdings eher Sorgen um seine Vergangenheit und nicht um die Zukunft.41 Man kann sich allerdings nur über etwas Sorgen machen, in dem eine gewisse Ungewissheit steckt – und das ist bei der Vergangenheit nicht mehr der Fall. Der Titel ist also nicht ganz ernst gemeint, enthält einen kleinen „Denkfehler“. (Schornstein ist überhaupt nicht so doppelbödig.) In dem neuen Roman behandle ich alles Mögliche mit einem ironischen Abstand; man darf dem lieben Georg – also mir – auch ganz zentrale Aussagen nicht so abnehmen, wie sie dastehen. Gleich im ersten Kapitel sagt Georg:
Seltsamerweise war mir auch in den schlimmsten Perioden meines Lebens klar – und es stand trotz aller Dauerqualen immer außer Zweifel –, daß mich eine helle Zukunft erwartete.
Danach bleibt es auf über 600 Seiten allerdings unklar, wie die Geschichte ausgehen wird. Wegen der vielen persönlichen und politischen Einbrüche verläuft alles natürlich nicht geradlinig. Als es Georg eine Zeit lang dreckig geht, hört er einfach auf; über seine helle Zukunft nachzudenken. Und ich verrate lieber nicht, wie das Buch dann schließlich endet. Nur Folgendes: Ich persönlich hatte sehr viel Glück im Leben; und das neue Buch ist alles andere als schwermütig.
Goepper: War es nicht verwirrend, die Geschichte Ihrer Kindheit und Jugend, die in der Tschechoslowakei spielte, in deutscher Sprache zu reflektieren?
Faktor: Die schon erwähnte Ur-Fassung, die aus einzelnen nummerierten Sätzen bestand, hatte ich seinerzeit noch auf Tschechisch geschrieben. Damals stand für mich fest, dass ich über meine Kindheit unbedingt in meiner Muttersprache werde schreiben müssen. Außerdem war mein Deutsch noch lange nicht gut genug. Zwanzig Jahre später sah dann alles anders aus. Ich war schon zu lange weg, beherrschte alle möglichen aktuellen Nuancen im Tschechischen nicht mehr; und im Deutschen war ich mir nach Schornstein inzwischen vollkommen sicher. Und es fiel mir überhaupt nicht schwer, über die Dinge von damals auf Deutsch zu schreiben. Die Erinnerungen sind sowieso sprachunabhängig, es sind größtenteils Bilder und Gefühle – und das wenige wörtlich Gesagte übersetzt sich irgendwo im Hinterkopf von selbst. Sicher wird es in vielerlei Hinsicht große Probleme mit der Rückübersetzung ins Tschechische geben. Und nicht nur wegen der vielen substantivistischen Wortspiele, die ins Tschechische so nicht übertragbar wären.42
Noch eine inhaltliche Kuriosität: Mir ist es gelungen, in dieses durch und durch Prager Buch auch ein Stück DDR-Realität hineinzuschmuggeln. Ein Kapitel spielt dort einfach in der DDR. Gegen Ende der Geschichte gibt es eine Autofahrt, die dank eines Zufalls durch den Lausitzer Zipfel der DDR führt. Ich konnte hier in konzentrierter Form viele meiner DDR-Erfahrungen verarbeiten. Und es ist interessanterweise ein ziemlich böses Kapitel geworden. Dabei habe ich in der DDR nie sonderlich leiden müssen und den Wechsel in dieses so andere Land nicht bereut. Allerdings war die DDR ein ziemlich bedrückendes, engstirniges, ängstliches Land – voller verklemmter, zwanghafter, erschreckend ordentlicher und angepasster Kleinbürger. Beim Schreiben des besagten Kapitels war ich selbst überrascht, wie viel Wut in mir hochkam; aber ich genoss es ungemein. Das Kapitel heißt „essen? – hier kann man nicht essen – DAS kann man wirklich nicht essen“.
Goepper: Sie haben gerade gesagt, dass Sie trotz dieser furchtbaren Atmosphäre in der DDR nie gelitten haben. Glauben Sie, dass die gewisse „Liberalität“, die in Ostberlin im Vergleich zu Prag herrschte, mindestens in den künstlerischen Kreisen, heute zur sogenannten „Ostalgie“ beiträgt?
Faktor: Das ist ein bisschen komplizierter. Der „Ostalgie“-Begriff beschreibt die Befindlichkeit ganzer Bevölkerungsschichten, die Problematik der kleinen exklusiven „Szene“ ist eine ganz spezielle. Wir bewegten uns eben eher am Rande der Gesellschaft und mussten die üblichen beklemmenden Rituale in der Regel gar nicht mitmachen. Und auch mit dem Wort „liberal“ sollte man vorsichtig sein. In der Provinz der DDR war die Stasi ganz und gar nicht zimperlich, ausschließlich in Ostberlin hielt sie sich stark zurück – und eben besonders in den Künstlerkreisen. Einfach aus Rücksicht auf die in der Stadt anwesenden Korrespondenten und Diplomaten; die Westmedien hätten gleich alles publik gemacht. Und außerdem hatte die Stasi in der Szene ihre Spitzel, die – wie Anderson – selbst als Organisatoren eine zentrale Rolle spielten. Die Stasi konnte dann also auch gegen viele andere Initiativen nicht viel anders vorgehen; und so entstanden in Ostberlin nach und nach ganz verschiedene Freiräume, die selbstverständlich auch genutzt wurden. Es gab da und dort Lesungen, Ausstellungen und Konzerte. Der Gegensatz zu Prag zum Beispiel war riesig, in Prag wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Die gesamte Ostberliner „Szene“ war kein festes Gefüge mit nur einem Zentrum – und sowieso kein „Schrebergarten der Stasi“, wie Biermann meinte. Aber auch in Ostberlin hörte der Spaß sofort auf, wenn irgendwelche politischen Gruppen (der Friedensbewegung zugehörig, Umweltgruppen) aktiv wurden, Öffentlichkeit suchten oder sogar Westkontakte knüpften. Und auch Künstler bekamen sofort massiv Schwierigkeiten, wenn sie offen politisch Stellung bezogen: zum Beispiel Reiner Kunze, Wolf Biermann, Lutz Rathenow, Stephan Krawczyk. Fast alle diese Leute sind schließlich in den Westen gegangen – oder wurden gegangen. Auch dadurch kam es zu der letztendlichen Entpolitisierung der alternativen Künstlerkreise.
Ich war zwar aus ganz anderen politischen Verhältnissen gekommen, fand aber alle politischen Reibereien mit der vergreisten und engstirnigen Macht ähnlich sinnlos wie meine neuen Freunde. Unsere Rebellion war eine ästhetische, wir arbeiteten uns eher an den Problemen der frühen oder früheren Avantgarden ab als an den plumpen und durchschaubaren Machtspielen der SED. Allerdings währt so eine Art Radikalität nicht ewig, wenn man sich abschottet und an der einen umgebenden Realität nicht mehr reibt. Irgendwann ist die Spannung einfach raus – und das war in den letzten Jahren der DDR eindeutig der Fall.
Apropos Ostalgie: Ich kann einiges davon natürlich nachvollziehen. Viele DDR-Bürger sind gesellschaftlich und ökonomisch abgerutscht – sie haben schon ihre Gründe, wenn sie jetzt auf den Westen schimpfen. Vieles aus der Vergangenheit wird dabei aber natürlich total verklärt. Deswegen sehe ich nicht viel Sinn darin, mich mit dem Thema tiefer zu befassen oder mich mit jemandem zu streiten. Diese Problematik ist emotional stark besetzt, auf sachlicher Ebene kann man hier nur schwer etwas klären.
Goepper: Können Sie sich vorstellen, eines Tages ein Buch nur über die DDR zu schreiben?
Faktor: Ich hätte natürlich Lust, über die Zeit in Ostberlin zu schreiben, nur bräuchte ich dafür eine packende, ganz persönliche Geschichte. Und dazu noch einen starken emotionalen Antrieb; beides habe ich im Moment noch nicht. Aber wenn… dann würde ich sofort loslegen. Ich kann sowieso nur über Dinge schreiben, die ich gut kenne – und ich kenne das Leben in den besagten Ostberliner Kreisen wirklich gut, jedenfalls gut genug.
Goepper: Gibt es Texte oder einen Text, den Sie für Ihren „Wendetext“ halten?
Faktor: In der Wendezeit habe ich fast gar nichts geschrieben. Ich war damals bei der Zeitung des Neuen Forum Die Andere beschäftigt, war mit dabei, als es bei der Gründung um ganz grundsätzliche praktische Dinge wie das Papierkontingent und die Beschaffung von Räumlichkeiten ging – oder um die Abstimmung über den Namen der Zeitung. Natürlich wollte ich dort auch journalistisch arbeiten. Was ich dann spontan schrieb und gern gedruckt sehen wollte, war nicht unbedingt ganz ernst und politisch korrekt – die Artikel waren eher literarisch; in einem ging es um Gysi, das weiß ich noch. Der damalige Chefredakteur Dietmar Halbhuber fand meine Beiträge leider unpassend, nicht seriös genug. Und hat von mir nie etwas abgedruckt. Nach drei, vier Versuchen gab ich es schließlich auf. Ich hatte in der Redaktion sowieso genug zu tun. Damals war ich der Einzige, der sich mit Computern, also PCs, auskannte und war nicht nur mit der Texterfassung beschäftigt, habe für die Zeitung sogar ein ganz spezielles Konvertierungsprogramm, also Software für Word-Texte geschrieben. Auf diese Weise konnten die Artikel direkt bei dem Satzrechner des Berliner Verlags eingelesen und in Spalten gesetzt werden. Ich beschränkte mich also darauf, die Computer zu betreuen, bat allerdings nach einer Weile darum – wenn man von mir schon nichts drucken wollte –, dass wenigstens mein Name und meine Funktion im Impressum erscheinen. Aber auch diese Bitte wurde als unpassend eingestuft. So bin ich (glaube ich) das einzige Gründungsmitglied, dessen Namen in der Gründungsphase der Zeitung kein einziges Mal auftaucht. Von heute aus gesehen ist es aber nur eine kleine Episode am Rande; die Zeitung ist längst Geschichte und so gut wie vergessen.
Nach den ersten Stasi-Enthüllungen und in deren späteren Verlauf begann ich mich intensiv mit den Stasi-Verwicklungen in der „Szene“ zu beschäftigen und schrieb 1991/92 mehrere Zeitungsartikel.43 In der Nachwendezeit entstanden außerdem zwei größere literarische Texte: „Das Selbstbesudelungsmanifest fünf tapferer Literaturrevoluzzer; wie es die Zeit verlangt“44 und „wir brauchen eine neue lyrik“45. Der Letztere ist ein indirekter: aber sehr heftiger Angriff auf den von Sascha Anderson gegründeten Lyrik-Verlag GALREV und seine Autoren. Aber diese überschäumende verbale Attacke ist kein Gelegenheitstext mit plumpen Anspielungen. Der Text ist stark assoziativ und wild entfesselt geschrieben, vom eigentlichen Thema also so weit losgelöst, dass er fast zeitlos ist, wie ich dann nachträglich feststellen konnte. Er ist im Verborgenen zwar einerseits konkret, andererseits dank der vielen sprechenden Bilder und Wortverdrehungen auch vom eigentlichen Gegenstand und Anlass befreit. Ich habe ihn neulich in Weimar bei einem Festival mit vollem Einsatz gelesen – achtzehn Jahre nach der Entstehung! Und ich würde ihn bei Auftritten ohne Weiteres wieder lesen können; das ist für einen Text ein richtiges Gütesiegel. 1991 habe ich außerdem den ersten, den wichtigsten meiner Körpertexte geschrieben: „ungesund“46.
Goepper: Glauben Sie, dass Sie anders als Ihre westdeutschen Kollegen schreiben? Dass Ihre sozialistische Prägung in Ihren Texten zum Ausdruck kommt?
Faktor: Auf jeden Fall. Ich merke das an meinen Präferenzen: Die Autoren, die mir nah sind und inzwischen auch von gesamtdeutscher Bedeutung sind – wie Wolfgang Hilbig oder Thomas Brussig –, stammen aus dem Osten. Die Diktaturerfahrung ist für einen Autor nicht nur sehr prägend, es schärft auch die Sensibilität für Dinge, die einem bei einer anderen Sozialisation gar nicht auffallen würden. Wenn man im Osten einen einfachen Polizisten sah, zuckte man innerlich zusammen; ganz automatisch – man war doch ein feindliches Element, nicht wahr? In diesem System war man innerlich andauernd damit beschäftigt, sich zu behaupten. Das formte einen ohne Unterlass…
Viele Sehnsüchte wurden wachgehalten, und man verlernte es nicht, auch für ganz elementare Dinge dankbar zu sein. Einem Freund von mir fiel nach der Wende auf, dass manche Westler ausgerechnet auf diese Erfahrungen neidisch waren. Sie hatten zwar ein viel bequemeres, ereignisreicheres Lehen gehabt, vermissten jedoch manche existenziellen Erfahrungen. Dieses Zurückgeworfen-Werden auf sich selbst und auf die paar Leute um einen herum brachte mitunter eine ganz besondere Intensität mit sich; und viel Brisanz im Alltäglichen – als Literat kann man davon profitieren. Was natürlich aber nicht bedeutet, dass der Osten – oder eben Diktaturen – bessere Menschen hervorbringen würden. Bloß nicht! Wahrscheinlich ist das alles noch viel komplizierter.
Ich habe schon erwähnt, dass ich Mitglied des Bielefelder Colloquium Neue Poesie war. Ich fuhr regelmäßig, etwa jedes zweite Jahr, zu den Kolloquien, blieb aber trotzdem ein anderer; ob das auch die anderen so empfanden, weiß ich nicht genau. Nach der Wende wurde ich bald vierzig, war eben ganz anders sozialisiert. Als ein jüngerer Mensch würde ich in eine solche Kommunität sicher viel leichter hineinwachsen.
In meinem Text (in einer nicht ganz ernst gemeinten Art „Stück“) Henry’s Jupitergestik oder Othello und Aphrodite47 ist Henry eine Chiffre für Heiner Müller. Es ist eine Auseinandersetzung mit seinen großspurigen Posen und pathetischen Gesten, seinen Parabeln und mythologischen Verklärungen, die er dann auch noch gern mit marxistischem Gedankengut vermengte. Er ist natürlich als Person und Denker eine „ehrliche Haut“, kann auch wirklich schonungslos sein – auch sich selbst gegenüber. Als eine einmalige rhetorische Begabung fand ich ihn ebenfalls oft beeindruckend, trotzdem störte und stört mich an ihm einiges. Er ist im Grunde ein enttäuschter Idealist, der den Ekel über die „Verdorbenheit des Menschen und das Böse in der Welt“ (große Worte, ich weiß) bombastisch zelebriert – wenn die Welt schon nicht so wunderbar geworden ist, wie gewünscht… Sie sehen: ein typischer Generationskonflikt. Unsere Vater und Mütter hatten sich nach dem Krieg etwas sehr Schönes ausgemalt und sind dabei ziemlich gescheitert. Andererseits ist mir das Subversive und Radikale an Müller auch nah, auch seine Begeisterung fürs Abnorme, blutig Zugerichtete, für alle diejenigen, die irgendwo in Bodennähe liegen. Eine passende Möglichkeit, mich mit Heiner Müller und seiner Ästhetik auseinanderzusetzen war eben, eine Parodie auf ihn zu schreiben. In dem besagten Text spiele ich auf seine kraftmeierischen Theaterstücke an. Ursprünglich wollte ich dieses „Stück“ auch für Lesungen nutzen, das funktionierte aber überhaupt nicht; die ganzen Anspielungen teilten sich einfach nicht mit und wirkten plump, wie ohne Abstand, der Witz fehlte… Seltsam, etwas paradox, auf dem Papier stimmte noch alles.
Noch zurück zu Ihrer eigentlichen Frage, oder vielmehr zu einer der früheren: Mit dem Text „Selbstbesudelungsmanifest fünf tapferer Literaturrevoluzzer“ hatte ich bei einer Lesung in Westberlin eine ziemliche Bruchlandung erlebt. Der Text kam im Osten und im Westen diametral unterschiedlich an. Den Text begann ich im Februar 1989 zu schreiben, also zu Ostzeiten, er wurde dann aber erst nach der Wende fertig. In diesem Manifest greife ich das elitäre Denken der Szene-Schreiber an, reagiere im Grunde auf die Arroganz der Leute vorn Prenzlauer Berg und denunziere sie dabei bewusst verletzend. Den Text habe ich dann 1991 bei der Leipziger Messe gelesen. Und es war ein richtig toller Auftritt, die Leute haben sich köstlich amüsiert. Mit dem gleichen Text erlebte ich dann im Westberliner Literarischen Colloquium (LCB) ein Desaster. Es war eine Lesung, die mit der Verleihung des Döblin-Preises zusammenhing; ich war immerhin in die engere Auswahl gekommen. Im Publikum saßen dort lauter renommierte Autoren und Kritiker, unter anderen auch der Stifter des Preises Günter Grass. Da ich eben diesen Revoluzzer-Text zum Wettbewerb eingereicht hatte, wollte ich ihn bei der Veranstaltung auch vorstellen. Als ich begann zu lesen, spürte ich sofort eine gereizte, eisige bis feindselige Stimmung im Publikum, es gab Gemurmel und Unruhe. Natürlich bezogen die Leute den Angriff unmittelbar auf sich selbst, ordneten ihn also falsch ein. Das war fatal. Als Literat hat man in der Westgesellschaft natürlich einen ganz anderen Status, hat es auch materiell viel schwerer… und plötzlich taucht da einer aus dem Osten auf und fängt an zu schimpfen! Als ich fertig war, wurde ich ziemlich wütend angegriffen. Auch Günter Grass hat sich aufgeregt. Das Ganze war ein grandioses und in der Situation nicht gleich zu klärendes Missverständnis. Meine Freude an diesem Text (und die Gründe für meine Wut) konnte ich dort niemandem begreiflich machen – und die eigentlichen Adressaten, also meine Kollegen von früher, waren nicht anwesend. Der Einzige, der sich für mich einsetzte, war der Germanistikprofessor Dieter Zimmermann von der Technischen Universität Berlin. Er meinte, es gab sowieso von vornherein eine Ablehnung gegen die in Minderheit anwesenden Ostliteraten. Auch Kurt Drawert und noch andere Ostler kamen nicht gut an, mussten gegen Ablehnung kämpfen. Das konnte tatsächlich auch mit der entstehenden Konkurrenzsituation zusammengehangen haben.
Goepper: Sie haben gerade erwähnt, dass der Schriftsteller in der Westgesellschaft nicht so geachtet wird. Haben Sie persönlich an dem Statusverlust der Ostautoren nach 1989 gelitten?
Faktor: Die materielle Seite des Literatendaseins war für mich nach 1989 natürlich auch schwierig, ich fühlte mich aber wahrgenommen, wurde beachtet. Für mich und viele andere öffnete sich damals doch das ganze deutschsprachige Kulturleben. Und die frühere Überschätzung und Selbstüberschätzung der Autoren im Osten (besonders der offiziellen) war vollkommen übertrieben. Diese litten unter dem Bedeutungsverlust dann natürlich viel mehr. Ich kam aus einer Nische und als ein experimenteller Autor blieb ich in einer Nische. Ich bekam aber mehrere sehr gute Stipendien, viele Einladungen, 1993 den Kranichsteiner Literaturpreis der Akademie in Darmstadt. Es kam eben auf die Ansprüche an. Ich war es nicht gewohnt, mich zu jedem politischen Großereignis öffentlich zu äußern – ich konnte also die Aufmerksamkeit auch nicht vermissen, als sie dann ausblieb oder sich stark reduzierte. Als Schriftsteller ist man eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt. Und wenn man Zeitungen liest oder Radio hört, tut man das auf ähnlich schlichter Ebene wie alle anderen.
Goepper: Das soll doch nicht heißen, dass der Schriftsteller ein ganz normaler Mensch ist?
Faktor: Ja, doch.
Aus Sibylle Goepper und Cécile Millot (Hrsg.): Lyrik nach 1989 – Gewendete Lyrik? Gespräche mit deutschen Dichtern aus der DDR, Mitteldeutscher Verlag, 2016
Erich Klein im Interview mit Jan Faktor: Was zählt, ist Lebensfreude
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
Jan Faktor präsentiert vom Kunstbüro Wilhelmsburg.

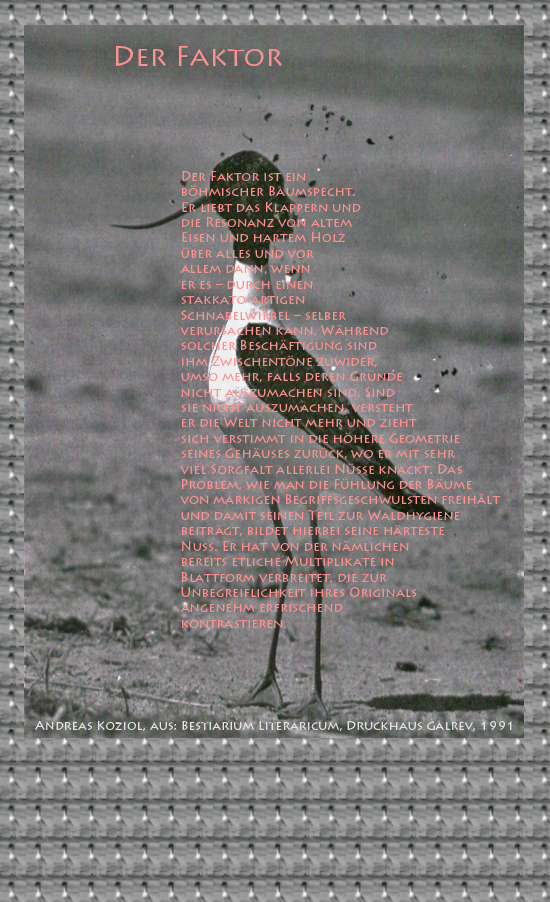












Schreibe einen Kommentar