Sascha Anderson: Crime Sites. Nach Heraktlit
WAS HAB ICH NICHT ALLES GERAUCHT,
UM DIE ZEIT …
totzuschlagen, die längst zugeknotet war wie der
aaaaaMüllsack
für den Müllcontainer. Schon am Abend vorher.
aaaaaBevor
die Müllmänner kommen, die mit ihrem Monatslohn
aaaaaim Wochenrhythmus
arbeiten und wahrscheinlich auch leben, Jahr für
aaaaaJahr. Eins ist
ins Andere und dies wieder in ein Weiteres oder Inneres verpackt. Und
dann denke ich dran, was ich außerdem noch alles geleert habe, um es
später seiner Haut, der innersten, der Vorhaut
sozusagen, zu berauben, und, selbst wenn ich keineswegs
über den Dingen stehe, daß Gott eine Wüste ist, die uferlos
wächst, ohne auch nur im geringsten an Trennung zu denken.
(…)
Christine Taxer: Sie schreiben in der dritten Person – ungewöhnlich für einen, der sich als Lyriker versteht, für einen, der keine Gelegenheit ausgelassen hat, Ich zu sagen. Ein Ego, das eine fast schon renaissancetechnische Verbindung zwischen Provinz und Welt vorführt, eine demonstrative Aufspaltung zwischen Macht- und Ohnmachtsgefühlen.
Sascha Anderson: Ich kann es ja nicht anders als schreibend. Dann hab ich die ,Ich’s‘ gezählt in der Datei von Sascha Anderson und bin auf über tausenddreihundert gekommen. Da hatte ich das dann satt und auch keine Lust mehr, von einem ,Mit-mir-einverstanden‘ aus auf das Geschehen, auch das geschriebene, zurückzublicken.
Eine andere Sache ist, welche Psychologie zwischen meiner Person und meinem Text gesehen wird. Aber das geht mich eigentlich nichts an während des Schreibens. Unmöglich, diesbezüglich noch einmal ein WIR zu bemühen, in egal welchem – dann doch wieder rückübersetzbaren – gesellschaftlichen Zusammenhang.
Taxer: Wäre es nicht besser, sich für „Sascha Anderson“ ein Pseudonym zu suchen? Die Verlage und nicht zuletzt – nein: gerade im Vorfeld jeder neuen Veröffentlichung – die Feuilletonisten sind doch allein an Ihrer Figur interessiert – nicht am Text als solchem. Hat es nicht einen Anstrich von Masochismus, sich alldem auszusetzen?
Anderson: Mag sein, dass es Schreibende gibt, deren Texte die Reaktion der sogenannten Öffentlichkeit antizipieren. Diese ,reaktionäre‘ Dimension schlägt aber immer durch. Das einzig Aufregende an solcher Literatur ist ihre Aufgeregtheit.
Ansonsten fühle ich mich frei von zwischenmenschlicher Zensur – gerade weil sie auf moralischen und ethischen Vereinbarungen basiert –, selbst dem Recht, einen Menschen zum von aller Kunst freien Ich zu verdonnern. Eine mir durchaus nicht fremde Art ein- oder auch auszuschließen. Aber das Schreiben verbieten, das geht halt nicht, und das damit verbundene Veröffentlichen, den Gestaltwillen einer Sicht auf die Dinge, zu unterdrücken, ginge nach meiner Erfahrung von einer – wie gehabt – eingebildeten Position aus, einem Missverständnis über das, was immer wieder so hochtrabend Kreativität genannt wird. Das ginge weit über meine eingebildete Position und meine Irrtümer in den 80er Jahren hinaus.
Das Absurde an meiner Situation ist, dass ich in den letzten fünfzehn Jahren immer mal wieder um ein Manuskript gebeten wurde oder auch um redaktionelle oder gestalterische Mitarbeit, was ja seit jeher mein Brotberuf ist. Nur stand dann im Hintergrund die Frage, ob ich mir nicht diesen oder jenen Namen dafür zulegen wolle.
Mich hat dieser gewaltige Bruch, das Ende des DDR-Systems, mit seinen diversen Ent-Täuschungen natürlich von mehr befreit als nur den Einbildungen. Ich bin von einer Bühne verschwunden, auf der mir nur zwei Rollen auf den Leib geschrieben schienen: die Feigheit vor dem Freund oder die Feigheit vor dem Ich. Und genau das – nämlich auch nur irgendeine Rolle zu spielen – hab ich mir gründlich abgeschminkt. Und dazu brauche ich selbstverständlich auch keine Decknamen mehr. Ob aus politischen oder aus ökonomischen Gründen, macht im Ende keinen Unterschied.
Taxer: Das klingt ein wenig, als wären Sie auf Ausgleich aus – auf Ruhe. Wovon in ihrem Text kaum etwas zu spüren ist. In Totenhaus. Novelle dominiert die alte situationöse Zwangsläufigkeit.
Anderson: Ja, das sehe ich auch so. Aber der entscheidende Unterschied: Friedrich Weisz ist nicht Sascha Anderson. In den dreihundert Seiten von Sascha Anderson sind vierzig Jahre abgehandelt, in den hundertfünfzig Seiten der Novelle eine Woche.
Wer mit mir zu tun hat, der bekommt es früher oder später auch mit meiner Geschichte zu tun, das ist klar, und das kann jetzt, nachdem alles offensichtlich ist, jeder selbst entscheiden. Vor vier Jahren, eine Woche vor Erscheinen meines autobiografischen Versuchs, hat mir der damalige Verleger Gottfried Honnefelder, und das vor Zeugen einen Vertrag über wenigstens zwei weitere Bücher, egal ob Prosa oder Lyrik – ,Was immer Du willst‘ –, angeboten. Ich hab ihm sofort gesagt, dass die Kritik sowieso erstmal ihre Alternative zur Kalaschnikow aus dem Ärmel ziehen wird und dass es dann nicht nur mich trifft. Er wollte es mir schriftlich geben, aufgrund eines plötzlich für nötig befundenen, überstürzten Einheitswillens zwischen Mensch und Verleger – zwischen Hauptgang und Dessert beim Nobelitaliener. Ich hab dankend verzichtet. Und dann, als von hundertzwanzig Reaktionen der Presse ganze zwei wohlwollend ausgefallen sind und das Buch sich auch nicht zwanzigtausend, sondern zweitausend Mal verkaufte, hat er den Schwanz eingezogen und auf Zeit gesetzt. Aber das ist seine Zeit, die geht auch nicht anders den Bach runter als meine.
Insofern halte ich zum Beispiel meine neuen Gedichte, ihr Erscheinen im Schuber, gemeinsam mit der Novelle und beim gutleut verlag, für ausgleichend. Die Verhältnisse, wie sie sich hinter den drögen Kulissen des Literaturbetriebs gebärden, sind alles andere als stabil. Und da kann man sich durchaus entscheiden für den Satz ,Wer mitmacht hat mit Macht‘ oder eben die Dinge selbst in die Hand nehmen. Kann ja sein, dass mir gar nichts anderes übrig bleibt mit meiner Vergangenheit, aber das ist nicht die unangenehmste Seite dieser Medaille.
Taxer: Das klingt ein bisschen ungebrochen. Aber waren Sie nicht selbst so ein typischer Autor mit Verlag und so was wie Verlagstreue, damals bei Rotbuch in Westberlin?
Anderson: Ich weiß nicht, was Heiner Müller vor fünfundzwanzig Jahren und beim wievielten Whisky in Berlin-Schöneberg mit Gabriele Dietze, meiner Lektorin bei Rotbuch, besprochen hat. Aber erstens hatte ich ja schon eine mehrjährige, wenn auch den äußeren Umständen entsprechend selbsthergestellte Veröffentlichungspraxis hinter mir – vor allem natürlich in Malerbüchern und bei Lesungen und Rockkonzerten – und zweitens: Ich habe mich wohlgefühlt beim Rotbuch Verlag. Da war man nicht nur Autor, sondern gefragt, was das Programm betraf, das Denken der Leute dort in dieser Fabriketage in der Potsdamer Straße. Da arbeiteten Leute wie Walter Hellmann als Buchgestalter und Otto Kalkscheuer als Lektor. Und ich bin immer noch der Meinung, dass, wer es zu was bringen will, die Dinge tun muss – und zwar selbst. Ich halte Zellteilung in diesem Betrieb für produktiv, für geistig effektiver als Wachstum. Das bedeutet, zum Beispiel, die üblichen Trennungen zwischen Autor, Herausgeber, Lektor und Verleger aufzuweichen. Das haben wir im Druckhaus Galrev so gemacht und werden es natürlich auch beim gutleut verlag so handhaben.
Es gibt genug Arschlecker alter Provienz, die sich bei gestandenen Marken einschleimen und dann da hinten – im würdelosen Lyriksegment – dranhängen und den Autor mimen. Und die Wirklichkeit sieht noch beschissener aus. Sie buckeln sich durch die Preisverleihungen, die Stipendien und Festivals und gehen den Verlegern, Lektoren und Feuilletonisten so lange auf den Sack, bis die die Geduld verlieren und sie veröffentlichen. Oder sie erarbeiten sich auf irgendeinem kulturpolitischen Sektor eine Position, am besten interdisziplinär, zum Beispiel beim Goethe-Institut, und dann schieben sie sich, obwohl sie eigentlich als Funktionär anwesend sind, permanent als Poet über die Theke, und ihre verkitschten Kurzzeiler hängen hinten dran wie der coupierte Schwanz an der Hundeseele. Irgendwann zahlt sich das auf jeden Fall aus. Da gehen sie dann primär als Lyriker durch – und sie haben ja auch seit ihrem sechzehnten Lebensjahr Gedichte geschrieben. Letztlich ist das alles simpelster Protektionismus. Hätte ich gar nichts dagegen, wenn man denen nicht ansähe, dass sie sich selbst in die eigenen Taschen lügen. Gehen Sie doch mal zu so einem Event, und zählen Sie dann die, die ihre Aktentaschen so pedantisch neben sich abstellen. Ich kann Ihnen sagen, was drin ist: der Mehrwert der Anwesenheit, ein paar Flyer und ein Flachmann.
Taxer: Ist das jetzt Frust auf die Nebenwirkungen, die eben auch dazugehören, oder Verbitterung? War für Sie das Galrev-Projekt, gegründet im Dezember 1989, eine Flucht vor den sich ankündigenden ,Katastrophen‘, die Sie ohne weiteres hätten voraussehen können… eine Flucht ins Privateigentum?
Die Aufdeckung Ihrer Doppelexistenz als Dichter und Spitzel, der daraus folgende Zusammenbruch ihrer privaten Verhältnisse, die Stigmatisierung durch die Medien, der Ausschluss aus dem Gefüge von Verlagen, ergo Literaturpreisen und Einladungen: Meinen Sie nicht, dass jene, die Sie programmatisch vernetzt und praktisch involviert haben, durch die Art des langen und quälenden Endes, das dem Druckhaus Galrev von Anfang an unsichtbar eingeschrieben war, an Reputation eingebüßt haben, inklusive ihrer Lorbeeren, deren Fundament mit einem diffizilen Begriff von Freiheitsbehauptung verbunden war?
Anderson: Der Verstand, der so gern mit billigen Kausalitäten handelt wie ein auf Ordnung erpichtes Kind, vielleicht noch ein bisschen dialektisch aufgepeppt und zur Not von einer analogisch wohltönenden Metapher abgerundet, mag das so betrachten. Mein Gefühl sagt mir – und weil hinter dem Vorschlag, es so zu sehen, ein so uraltes Transparent wie ,Missbrauch‘ lauert –, dass diese Art Wahrnehmung von Abhängigen ausgeht, von Hörigen, von Opfern in Reingestalt und einfach so – schon immer und nun schon wieder – zu Betrügenden, Betrogenen, von Unmündigen. Das wäre ein verletzender Irrtum, wahrscheinlich sogar eine Beleidigung, eine den Beteiligten die Dummenkrone aufsetzende Verletzung.
Nur zwei, drei Richtigstellungen, und es dreht sich hier nicht um das, was ist, sondern um das, was war. WIR haben das Druckhaus Galrev gegründet, nicht ICH. Vielleicht wäre es ohne mich, ohne die Kontakte, die aus meinen über drei Jahre Westen resultierten, nicht möglich gewesen. Aber jedes der vielleicht zehn Gründungsmitglieder kann Ähnliches von sich behaupten. Der Rest war Arbeitsteilung, und ob man davon etwas hält, ist eine grundlegende Frage.
Als es dann, nach meiner Enttarnung, um die Entscheidung ging, ob der Verlag, der immerhin sechs Jahre lang mit etwa zehn Titeln pro Saison ins Rennen ging – also auch nicht viel weniger als Wagenbach im Hauptprogramm –, primär Literatur drucken solle oder die Geschichte der belasteten Autoren aufarbeiten, wobei das suggestive Feuilleton von so etwas wie einer kollektiven Verantwortung ausging, habe auch ich mich selbstverständlich für Literatur entschieden. Abgesehen davon, dass wir fünfzig Prozent aus dem Westen kommende Autoren hatten, die vielleicht zwar interessiert, aber nur marginal betroffen sein wollten, ist es doch klar, dass die Literatur des einzelnen Autors diese Geschichte nicht aussparen oder verdrängen wird.
Schon möglich, dass es dann mit der Aufarbeitung etwas länger dauert, die Bücher schreiben sich halt nicht so schnell wie die Thesen, in denen steht, was ihnen alles fehle. Andererseits gab es natürlich interne Auseinandersetzungen darüber, wer nun von diesem point of no return an im Verlag und demnach beim Programm das Sagen haben solle. Es wurde ein Autoren-Beirat installiert, von dem aber niemand verlangen konnte, täglich sechzehn Stunden und mehr im Verlag zu hocken. Also delegierte der die Arbeit an einen [Michael Thulin], der sich voll reinhängte in die Windrichtung – immer voll auf Linie war. Und das lief in meinen Augen darauf hinaus, dass wir gleich mit dem BasisDRUCK Verlag in der Schliemannstraße hätten fusionieren können, der auf diesem politischen Aufklärungs-Terrain Erhebliches leistete. Ich habe dann, 1994, als ich aus Rom zurückkehrte, das Ruder wieder rumgerissen. Und ich denke immer noch, dass wir von alldem, was war, nichts hätten, wenn es nicht die Literatur gäbe, ihre sich [für sich] Zeit nehmende Art. Mag sein, dass sie in Konkurrenz steht mit anderen Techniken der Aufzeichnung, aber das ist nicht der Grund ihres Vorhandenseins.
An meiner Geschichte kann man ziemlich gut verfolgen, wie – und da können die Gründe, die dazu führen, sehr verschieden sein – Abhängigkeit von einer Ordnung, die mittels einer aktiven, das Hochgefühl zementierenden Rolle [Ziel: Hauptrolle] kompensiert werden will, zu Deformation führt. Beim Einzelnen wie bei der Gesellschaft. Letztlich kann man von Gegenseitigkeit sprechen. Diese Gesellschaft ist an solchen wie mir zugrunde gegangen, und ich an ihr. Die DDR gibt es nicht mehr, und ich werde es mir nicht verzeihen. Und ähnlich unverzeihlich läuft die Chose zwischen Autor und Literaturbetrieb ab – zwischen Künstler und Kunstmarkt, das ist ein anderes Kapitel. Aber in diesem Fall stehe ich mir zum Glück selbst im Weg.
Taxer: Sie meinen, es wird sich für Sie keine Tür mehr zum Literaturbetrieb hin öffnen?
Anderson: Genau das meine ich. Nein, nicht, auf der einen Seite der Literaturbetrieb und auf der anderen irgendein Ich – ich meine: wer soll – aber ich kann dieser Tür-Metapher eigentlich nichts abgewinnen – diese Tür und mit welchem Ziel öffnen, und welchen Grund gäbe es dafür, von der einen wie von der anderen Seite. Mittelpunkte wie die Medien existieren nicht nicht eigennützig. Mit dem Literaturbetrieb bin ich einsam, mit der Literatur nur allein – dem Leser gleich. Die Literatur schützt die menschlichen Verhältnisse im besten Fall vor Selbstbetrug, und der Literaturbetrieb, ein Motor gesellschaftlicher Verkitschung [dazu: Stanislaw Lem: Aspernicus], wird keine Gelegenheit auslassen, mir das Gegenteil zu demonstrieren.
Taxer: Wieso jetzt der gutleut verlag und wieso in einem Programm, das Sie fürderhin selbst bestimmen? Und, nicht zu vergessen: warum wieder einmal gemeinsam mit Bert Papenfuß? Und, wenn mit Papenfuß, dann läge doch auf der Hand: gutleut verlag Berlin und Frankfurt am Main, nicht Weimar.
Anderson: Der gutleut verlag, das heißt der Verleger Michael Wagener hat – ich sag’s Englisch, weil ich das Wort wunderbar gegenständlich finde – Relationships, die bauen auf Persönlichkeiten auf, die eben zum Beispiel in Weimar leben. Und in Papenfuß habe ich einen Freund, der mir mein Leben lang widersprochen hat. Wir haben extrem unterschiedliche Haltungen zur Literatur, weniger [siehe oben] zur Kunst. ,black paperhouse‘ beansprucht auch nicht, kookbooks Konkurenz zu machen. Bei gutleut soll von uns weder eine Gruppe noch ein Netzwerk installiert werden. Ob lebendig oder tot, von den Autorinnen und Autoren werden Texte veröffentlicht, die auf einem von Häresie unterkellerten Kontinuum aufbauen. Wenn Daniela Seel, die Verlegerin von kookbooks, sagt, dass ein Großteil ihrer Autoren zukünftig eine gewisse Rolle im Literaturbetrieb spielen wird, dann ist das ehrenwert und wird sich wahrscheinlich bewahrheiten, formuliert jedoch gleichzeitig unterbewusst jenen Oportunismus mit, der eben dafür nötig ist.
Taxer: Sie sagen, dass Sie sich seit Jahren mit Prosa befassen. Entfernt Sie das vom Gedicht? Hat das Erzählen einen Einfluss auf Ihre Arbeit am Gedicht? Und umgekehrt: Finden Sie selbst Ihre Erfahrungen mit dem Gedicht – in die letzten vier erschienenen Gedichtbände waren immer auch kurze poetologische Texte eingebunden – in Ihrer Prosa widergespiegelt?
Anderson: Das ist auch in Crime Sites wieder der Fall. Da zieht sich eine linksseitig fünfseitige Reflexion durch das Buch. Ich bin ja kein Konzeptionist, sicher auch kein Gelegenheitsdichter, aber diese fünfzig Gelegenheitsgedichte in fünf Jahren sind auch nicht gerade viel. Das ist abgelagertes Zeug. Ich ändere nicht gern, so kurz vor der Veröffentlichung, und so ein kleiner zusammenfassender Denk-Raum, der die Zeit umreißt, in der diese Gedichte entstanden sind, gehört für mich, irgendwie dazu.
Eine Bibliothek aller auch nur einigermaßen einflussstarken Poesie, plus dies und jenes, auf das Sie vielleicht persönlich stehen, wie ich auf Erstausgaben der deutschen Romantik, und außerdem noch ein wenig mit alldem zusammenhängende Sekundärliteratur, kostet vielleicht knapp zehn Regalmeter.
Neulich habe ich von meinem Vater die vollständige Reihe Spektrum vom Verlag Volk und Welt geschenkt bekommen. Er musste seinen Lebensraum verkleinern, weil sich der aus dem Westen nach Radebeul bei Dresden exportierte Bankfilialdirektor das Haus, in dem die Familie meines Vaters fünfzig Jahre lang gelebt hat, selbstverständlich leisten konnte und nun auch Eigenbedarfsansprüche stellt. Diese Reihe, das sind zwei Meter vom Feinsten. Andererseits verweist fast jeder der dort erschienenen Autoren außer auf sich selbst noch auf mindestens drei weitere Autoren, die bei Spektrum nicht erschienen sind. Das ist nur ein Beispiel für die Uferlosigkeit einer Prosa, die in meinen überschaubaren Verhältnissen immer noch dreimal mehr Platz beansprucht als alles, was so unter dem Namen Gedicht läuft.
Meine eigene Prosa muss sich – wie gesagt – auf das, was sich im dritten Teil meines autobiografischen Versuchs weniger erzählt als gestisch angedeutet hat, beschränken. Jetzt arbeite ich an einer zweiten Novelle, die wieder das Thema der Wahrnehmung abtastet. Die Wahrnehmung des Künstlers und die eines Mannes, der die Kunst, in dem Fall die Kunst einer Künstlerin, für wahr nimmt. Über die zwei darüber hinaus angelegten Texte kann ich noch nichts sagen.
Ich selbst betrachte gute Gedichte prinzipiell als autobiografisch, mache allenfalls einen Unterschied zwischen Schreibern, die sich in eine tradierte Form gießen, also die, die meinen, eine Blume genüge nicht, ihr Einsatz sei die Vase, die sie sinnigerweise von der Blumenverkäuferin haben auswählen lassen, und solchen, die diese Vase von der Blume, von der sie schreiben, regelrecht erschaffen lassen. Das ist jetzt nicht zu Ende gedacht, meint aber letztlich, wovon ich anfänglich gesprochen habe: dass es nicht um Schöpfung geht, sondern um Interpretation. Das hat was mit Musik zu tun, mit einem Raummoment, der den Leser zum Sich-Hören verleitet. Die Vase ist innen, ihr Äußeres unabhängig von der Betrachtung des sich derart verweigernden Schöpfers.
Das Gespräch wurde im Juli 2006 in Weimar geführt und ist auf dem Umschlag von Sascha Anderson: Crime Site. Nach Heraklit nachzulesen.
Über den letzten Gedichtband,
das 1997 erschienene Herbstzerreißen, schrieb Christian Eger in einer Kritik:
Anderson schreibt: „Bisher wollte ich einen Text, der im Auge des Betrachters sich subjektiv darstellt. Nun nicht mehr.“ Und er zitiert den Philosophen Schelling in eigener Sache: „Die tiefste Note des historischen Gemäldes bezeichnen die Jagdstücke.“ Den Einband des bibliophil gestalteten Buches ziert eine Jenaer Schießscheibe des Jahres 1830. Es mag heute Anderson jagen, wer will. Herbstzerreißen ist ein Gedichtband für Leser, nicht für eifrige Bekenntnis-Fahnder – eines der eindruckvollsten Poesiealben des Jahres 1997.
Und Thomas Kling schrieb in seinem Katalogtext zu Herbstzerreißen:
In den 80er Jahren erschienen Andersons Bücher wie nebenbei, waren immer da, andere, teils leichtfüßiger daherkommende Berliner Dichter gerieten mehr ins Augenmerk – was schade ist, da die durchaus anstrengende Beschäftigung mit Andersons Gedichten lohnt. Auch in Herbstzerreißen ist die düstergestimmte Grundmelodie, die sein viriles Pathos trägt, stets unüberhörbar – das, was als Andersons Kennung bezeichnet werden könnte.
Nun erscheinen – nach einer zweiten, um unveröffentlichte Gedichte und eine CD erweiterten Auflage seiner Erstveröffentlichung von 1982 (Jeder Satellit hat einen Killersatelliten, Druckhaus Galrev, Berlin 1998) und dem autobiografischen Versuch (Sascha Anderson, DuMont Literatur und Kunst, Köln 2002) – nach knapp zehn Jahren Crime Sites. Nach Heraklit, Gedichte aus den Jahren 1998 bis 2005: noch immer der unverwechselbare Sound, noch immer das in der vom Autor selbst betriebenen Mühle des Sprachzeitraums geschredderte Ich, noch immer ein fast exerzierter Rhythmus aus „Asche und Atmen“, das Aufwirbeln unaufhörlicher Augenblicke und ihr Sichabsetzen in einer absolut komprimierten Form des Erzählens.
Gutleut Verlag, Ankündigung
Die Frauen in Iwanowo
– Lange Zeit war Sascha Anderson nur noch der enttarnte Stasi-Spitzel. Doch die Kritik hat bemerkt, dass man an der poetischen Gabe dieses Mannes nicht vorbeigehen kann. Nun las Anderson in Frankfurt. –
Sascha Anderson liest in der Frankfurter Romanfabrik. Er begleitet seinen Vortrag, der mit einem Zyklus neuer, noch unveröffentlichter Gedichte beginnt, anfangs mit einer Computerprojektion von Verszeilen, die sich bewegen, versetzt werden, die sich in reine grau-graphische Blöcke verwandeln, dann wieder lesbar werden. Dazu läuft im Hintergrund eine unaufdringliche Ambient-Musik. Schon immer gehörte Anderson zu den Dichtern, für die die visuelle Erscheinung des Gedichts auf der Seite, die Typographie, die Illustration, ja die ganze Buchgestalt einen wesentlichen Teil der Gabe der Musen oder, schlichter, des Handwerks ausmachen. Er war Verleger, er war Musiker, er ist ein Dichter.
Anderson liest mit großer Intensität, eine zurückhaltende Choreographie der Hände gehört dazu. Auch die Prosa klingt wie ein Gedicht, mit ihren ausschweifend langen Sätzen, es sind Passagen aus der vor einem Jahr veröffentlichten Novelle Totenhaus. Unter den Motti des Buches findet man eines von Novalis, Andersons Haupt-Hausgenius:
Kurz, man verliert die Lust am Mannigfaltigen, je mehr man Sinn für die Unendlichkeit des Einzelnen bekömmt.
Damit ist der Stil sehr gut beschrieben. Es geht in der Novelle um ein Haus, Anderson muss sich über die Jahre ein besonderes Wissen um Bau- und Ausstattungsdetails angeeignet haben, ganz offensichtlich liebt er das technische Können.
Die Zeit: Spätphase der DDR; Ausreisewillige hier, ein Mitarbeiter der Hauptverwaltung Aufklärung dort. Der Schauplatz: Ost-Berlin, dann das Elbtal. Konspiration und Doppel-Konspiration. Kunst. Und ein Tod. Die Sätze sind bis zum Bersten gefüllt mit Einzelheiten, mit Gedanken oder Gedankensplittern. Avantgarde-Tradition also, nur dass die Menschen zum Beispiel „Erdmannsdorff“ heißen wie der klassizistische Architekt. Aber die Hauptfigur, Friedrich Weisz, trägt einen Namen, in dessen Schreibweise man neben der deutschen Herrschergeschichte ein Fremdheitssignal erkennt.
Es gab eine Zeit, da niemand, jedenfalls im organisierten Kulturbetrieb, etwas von dem enttarnten Stasi-Spitzel annahm. Diese Zeit ist vorbei. Die Kritik hat bemerkt, dass man an der poetischen Gabe dieses Mannes nicht vorbeigehen kann. Den Schluss der Lesung machen Gedichte aus dem gleichfalls vor einem Jahr veröffentlichten Band Crime Sites. Nach Heraklit. Und am Ende spricht Anderson das vielleicht schönste, jedenfalls unmittelbar zugänglichste, das von den Frauen in Iwanowo, einer Stadt der sowjetischen Textilindustrie, in der in den siebziger Jahren mehr als zwei Drittel der Bevölkerung weiblich war:
Sie trug ihr Kleid, wie alle tausend Rosen des Abends ihre Kleider
aaaaaauch. Ich weiß
Der Tag zieht aus, er macht sie nackt und stellt sie in die Vase,
aaaaaallein, die Dunkelheit verhüllt die Nacht. Nur umgekehrt
Wird nichts daraus.
Lorenz Jäger, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.9.2007
Comeback eines „Arschlochs“
Er dichtete und verriet seine Freunde: Der heute 54-jährige Lyriker und Prosaschreiber Sascha Anderson lebt im Frankfurter Stadtteil Nordend. Er schreibt wieder. Kürzlich erschienen Gedichte in Crime Sites. Nach Heraklit und Totenhaus. Novelle im Frankfurter Gutleut Verlag. Dort verdient sich der gelernte Schriftsetzer als Herausgeber und Layouter den Lebensunterhalt. In den achtziger Jahren galt der in Weimar geborene Dichter als einer der führenden Protagonisten der Künstlerszene im Ostberliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Anderson galt damals als gesellschaftlicher Widerständler, pokerte beim „Runden Tisch“ kurz vor und nach der Wiedervereinigung mit. Was niemand ahnte: Anderson wurde seit 1971 unter den Decknamen „Fritz Müller“ und „David Menzer“ von der Stasi als Inoffizieller Mitarbeiter geführt, nach seiner Übersiedlung nach Westberlin 1986 arbeitete er für sie weiter. Mit „Feindberührung“, wie in den 1991 vom Dichter-Kollegen Jürgen Fuchs entdeckten Akten zu lesen stand. Zu Andersons Spitzel-Opfern zählen die Ostberliner Künstlerfreunde Cornelia Schleime, Ralf Kehrbach, Helge Leiberg und A.R. Penck. Den Verrat geißelte Wolf Biermann unmissverständlich, indem er Anderson 1991 in einer öffentlichen Rede „Sascha Arschloch“ rief. Im vorigen September lud Anderson zu einer Lesung mit Computerprojektionen und aufdringlicher Ambient-Musik in die Frankfurter Romanfabrik. Es kamen rund 70 Schriftsteller und Journalisten. Alte Freunde und Weggefährten hat man nicht gesehen.
Thorben Leo, cicero.de, 18.2.2008
Stefanie Flamm: Ich und Er
Der Tagesspiegel, 12.3.2005
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG + IMDb +
Gegner + U. K. + E. E. + noch einmal + Förräderi + Anatomie
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer +
Dirk Skibas Autorenporträts + Robert-Havemann-Gesellschaft +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
Sascha Anderson antwortet auf die Standartfragen von faustkultur.


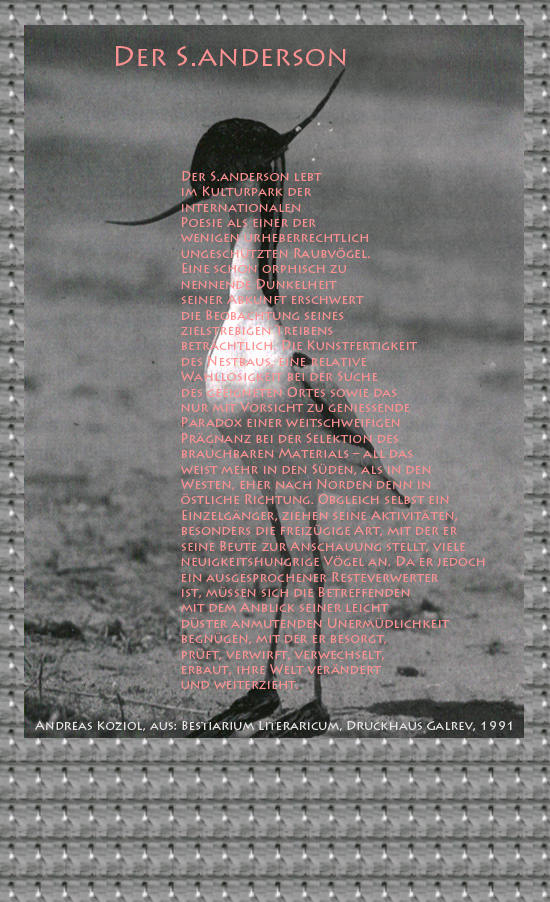












Schreibe einen Kommentar