Theodor Kramer: Poesiealbum 96
SELBSTPORTRÄT 1946
Buschig ist mein Haar, ist strähnig,
schon von Grau durchsetzt ein wenig,
schmerzhaft mein Gedärm verwachsen
und mein Herz macht mir schon Faxen.
Alles Laue, Halbe haß ich,
was an Geld kommt ein, verpraß ich;
was ich weiß – nicht viel – das weiß ich,
auf die Neunmalweisen scheiß ich.
Einstand stets ich für die Armen,
oft mit mir kommt mir Erbarmen;
nötig hätt ich oft ein Fuder −
alle sind wir arme Luder.
Blau schon schwillt mir das Geäder,
unbeirrt führ ich die Feder;
schön ist’s, Tag für Tag zu schreiben:
dies und das davon wird bleiben.
Theodor Kramer
Theodor Kramer starb nach einem über zwanzig Jahre währenden Exil in England vereinsamt und beinahe vergessen 1958 in Wien. Mit ihm hat die realistische deutschsprachige Poesie unseres Jahrhunderts einen Dichter von hohen Graden verloren. Kramers zumeist karg und gedrosselt erzählende Gedichte, ihre ingrimmige Melancholie und ungebrochen sozialkritische Frontstellung gegenüber einer Gesellschaft, die ihm ein in der Tat jammervolles Leben zugewiesen hat, sind trotz allem durchwoben von einer herzergreifenden, verzweifelten Sehnsucht nach dem Glück, die sich in Gedichten von selten erreichter Eindringlichkeit und schlagender Einfachheit ausspricht.
Aus Walter Werner: Poesiealbum 95, Verlag Neues Leben, Klappentext, 1975
Dichtung
ist immer etwas mehr als das Milieu, dem sie sich unter Umständen verschreibt. Die Poesie Kramers dokumentiert – auch mit der „konventionellen“ Mechanik ihrer Form – nicht zuletzt den einsamen Widerstandskampf eines durchbohrten Herzens; verzweifelter Fleiß, wütende Konsequenz, erbitterter Trotz, die „am Rand“ bis an die Grenze gingen. Daß solcher Weise die größte liedhaft-balladeske Dichtung deutscher Sprache der letzten fünfzig Jahre wuchs, für wen ist es auch nur eine Ahnung?
Adolf Endler, Verlag Neues Leben, Klappentext, 1975
„Wie das Laub, das grün verdorrt
[…] schwinde vor der Zeit ich fort.“ (1.9.1954)
− Theodor Kramers Lyrik und „lyrische Manufaktur“ in den 50er Jahren. −
Vorüberlegungen
Während Kramers Lyrik der Vorkriegszeit durch mehrere fundierte Studien und Interpretationen gut erschlossen ist und neuerdings auch der England-Band Beachtung zu finden beginnt, steht eine kritische Würdigung der lyrischen Produktion der 50er Jahre, die über den Niederschlag der prekären existentiell-emotiven Befindlichkeiten, der Nachzeichnung der zunehmenden Verbitterung und Vereinsamung des Dichters hinausgreift, derzeit noch aus.
Ausgehend von der im obigen Titel zitierten, für das Selbstverständnis des Dichters in den 50er Jahren durchaus kennzeichnenden (durch andere Beispiele ersetzbaren), in Richtung wie Tonfall vielfach variierten Standortbeschreibung soll im folgenden versucht werden, das lyrische Schaffen der 50er Jahre sowie Aspekte einer möglichen Poetologie desselben zwar nicht systematisch, aber doch anhand einiger übergreifender Motive, Gestaltungen und Thesen ins Blickfeld zu rücken. Als Material liegt diesen Recherchen – neben den veröffentlichten Texten – der Nachlaß Michael Guttenbrunners zugrunde, mit dem Kramer zwischen 1951 und 1957 im Briefwechsel stand (330 Briefe) und dem er im Lauf dieser Zeit etwa 600 Gedichte (darunter fast ein Drittel unveröffentlicht gebliebene) übermittelt hat.
Um möglichen Mißverständnissen vorzubeugen: Der Beitrag hat nicht die Absicht, die Beziehung zwischen Kramer und Guttenbrunner nachzuzeichnen, zu der bereits Daniela Strigl eine anregende Skizze vorgelegt hat, wiewohl zwangsläufig manches „en passant“ einfließen wird. Auch dürfen die Erwartungen insgesamt nicht zu hoch angesetzt werden; denn wer Kramer kennt, weiß, daß von ihm eine intensive Reflexion oder ein Essay über Probleme der Lyrik, der über Anmerkungen zu einem in Arbeit befindlichen oder gerade fertiggestellten Gedicht hinausreichen würde, nicht zu erwarten ist, auch nicht in nachgelassenen Materialien. Durch die Exil-Erfahrung zunehmend um sein Werk besorgt und bemüht, tritt uns Kramer im Briefwechsel (mit Wotruba, Zohn, Stadlmann, Rakovsky etc.) trotzdem als kommunikationsfreudiger, mitteilender Autor entgegen, weshalb es durchaus nicht abwegig scheint, nach „poetologischen“ Anmerkungen zu suchen.
Die Fragestellungen, die für den vorliegenden Beitrag leitenden Charakter hatten und die den umfangreichen Materialbestand ein wenig strukturieren (auch selektieren) müssen, waren nun folgende:
1. Findet im Rahmen des Briefwechsels eine poetologische Reflexion/Diskussion bzw. ein Gedankenaustausch statt bzw. enthält er überhaupt programmatische, manifestartige Textteile; wenn ja, welcher Art sind diese?
2. Inwieweit sind die – wie vorausgesetzt werden darf – dominanten existentiellen Überlegungen und Momente – vor allem hinsichtlich der Wahrnehmung der Fortdauer des Exils nach 1945 sowie Fluchtüberlegungen aus ihm – auch als poetologische Wegmarken begreifbar und für die lyrische Produktion von Belang?
3. Inwiefern findet in den brieflichen Kommentaren zur zeitgenössischen Literatur eine Auseinandersetzung mit oder eine Rezeption zeitgenössischer Lyrik statt?
4. Verändert, modifiziert sich oder bleibt der Blick Kramers im wesentlichen derselbe, was die eigene Produktion angeht, und finden sich Ansätze zu einem formal und sprachlich das Gerüst der 30er und 40er Jahre hinter sich lassenden lyrischen Sprechens?
5. Treten Themen und Formen im Briefwechsel in den Vordergrund, die durch die Gliederung der Werkausgabe (Bde. 2-3) nicht erfaßt oder anders gewichtet werden?
Die naheliegende Frage, ob sich im Lauf des Briefwechsels ein Austausch zwischen den beiden Lyrikern im Sinn eines Gesprächs über Gedichte (eigener und fremder) entwickelt, ist bereits durch Strigls Aufsatz beantwortet worden: Ein „einschlägiges“ Gespräch, vor allem seitens Kramers, kommt nicht zustande. Dieser ernüchternde Befund wird lediglich in einer einzigen Phase überwunden, nämlich im Zusammenhang mit der Guttenbrunner’schen Auswahl der Gedichte für den Sammelband Vom schwarzen Wein, als Kramer seine Auswahlkriterien festlegt bzw. Guttenbrunners Entscheidungen jeweils im Einzelfall kommentiert und sich somit – allerdings nur auf das eigene Werk bezogen von März bis Juni 1955 sowie zur Jahreswende 1955/56 – auf ein Gespräch über Texte, über formale und thematische Aspekte seines Schaffens, einläßt.
Poetologische Reflexionen – programmatische Texte im Briefwechsel
Obwohl poetologische Reflexionen für Kramer kein vordringliches Anliegen waren (ich denke, dies ist konsensfähig), enthalten seine Briefe doch eine Reihe programmatischer Aussagen über das eigene Werk, über Schreiben von Lyrik allgemein, über Methoden, Stoffe, formale, metrische und sprachliche Aspekte, die allein schon durch ihre Häufigkeit über den Charakter des rein Zufälligen, Gelegentlichen hinausweisen und den Briefwechsel während des gesamten Zeitraumes im Sinn einer ständigen fragmentartigen Annotation begleiten.
Findet sich darunter auch kein einziges herausragendes Dokument – etwa im Sinn eines Bilanzierungsversuchs wie in Günther Eichs „Die heutige Situation der Lyrik“ (1947) oder einer „Rede über Lyrik und Gesellschaft“ (Theodor Adorno) −, so lohnt es sich doch, diesen verstreuten Notationen und dieser Selbstzusprache nachzugehen und sie, soweit dies möglich ist, zusammenzuführen.
Im überwiegenden Fall handelt es sich bei diesen Äußerungen einerseits um Erwiderungen auf den deutlich stärker am Schaffensprozeß interessierten Briefpartner (Guttenbrunner), andererseits um spontan wirkende, z.T. bekenntnishafte Aussagen, um Fest- und Klarstellungen im Anschluß an Berichte über gerade Fertiggestelltes. Auffällig ist dabei ihr defensiver Charakter (Inschutznahme, Bekennerschaft) zum eigenen, aus der literarischen Öffentlichkeit, an der Kramer sehr gelegen war, mehr und mehr zurücktretenden, verdrängten Werk, dem andererseits eine kontinuierliche Selbstzusprache, Selbstvergewisserung über den exemplarisch-eigenständigen (Stellen-)Wert seiner Gedichte bzw. seines Gesamtwerkes gegenübersteht. Letztere manifestiert sich in Äußerungen wie „[…] es steht in sich sicher und bleibt stehen“ (KG, 5.12.1955), oder aber: „Stärkere Triebkraft als Angst und Qual ist meine Verbitterung; noch in diesem Zustand kann ich noch immer mehr und Besseres schreiben, als die seit Kriegsende in Oe. gefeierten Lyriker.“ (KG, 8.7.1956) Geradezu kompensatorisch zu dieser defensiven Haltung gewährt Kramer Einsicht in einen exzessiven, überbordenden Produktionsprozeß, welcher freilich wiederum selten zur Gänze freigelegt wirkt.
Fast jeder Brief enthält ferner einen Absatz, in dem zwei bis vier neue Gedichte erwähnt oder projektiert werden; dagegen finden sich höchstens in einem Drittel bis einem Viertel der Briefe Stellen, wo im Anschluß daran auch poetologische oder werkgeschichtliche Aspekte zur Sprache kommen, durchwegs knapp, in zwei drei Sätzen, aber immerhin.
Wie ein roter Faden zieht sich durch den Briefwechsel die immense lebensgeschichtliche Bedeutung des Schreibens von Gedichten: ein Schreiben aus Notwendigkeit heraus, als Überlebenstherapie, als Beweisführung, dem unbefriedigenden Alltag und dem der Kontrolle entgleitenden Körper wieder oder gerade noch einmal etwas abgerungen, entgegengesetzt zu haben: „Ich könnte mein erbärmliches Leben nicht ertragen ohne Neues zu schreiben.“ (KG, 4.12.1951) In den letzten beiden Jahren ist schließlich wiederholt vom „Hass gegen meinen Leib“ (KG, 10.5.1956) bzw. von „Haßgedichten« (z.B. „Vitriol“) die Rede.
Der Bogen spannt sich auf den ersten Blick über vermeintlich Unvereinbares wie systematische, handwerkliche Produktion und heroische, lustvoll-vitale Schöpfungsaura, zu der – ab 1955 – eine offen einbekannte Verbitterung, eine ihr entspringende plebejische Aggressivität tritt. „Lyrische Manufaktur“ – „Orgasmus“ sind jedenfalls zwei Schlüsselbegriffe, welche zur poetologischen Substanz der frühen 50er Jahre (etwa bis zum Sommer 1954, d.h. bis zum schweren psychischen Zusammenbruch und Aufenthalt in Brockwood September/November 1954) gehören. Konkret liest sich das, und zwar bereits im ersten Brief vom 12.8.1951, so:
… meine lyrische Manufaktur halte ich nebenher natürlich in Betrieb. Ich „fische“ beim Gehen nach Einfällen, zum Durchführen setze ich mich jeden Tag vor dem Frühstück an den Tisch. Aber ungeheure Stösse sind ungeordnet und ungefeilt, mindestens 6 Bücher könnte ich zusammenstellen, wenn ich es könnte.
Der Kontrapunkt zu dieser buchhalterischen Schreibpraxis findet sich im darauffolgenden Brief, wenn es heißt, „dass das Schreiben eines Gedichtes, wenn man weiss, dass es gelingen wird, eine Befriedigung gibt, die an Heftigkeit nur mit dem Orgasmus verglichen werden kann.“ (KG, 5.9.1951)
Einen weiteren Kontrapunkt zur geregelten Schreibwerkstatt stellt ein Artikel Guttenbrunners im Forum dar, aus welchem Kramer die von der Redaktion gestrichene „beste“ Zeile aufgreift und ergänzt. Demzufolge sei seine Lyrik „wie ein Hieb über den Schädel, wie ein Tritt in den Hintern, wie ein Griff ans Geschlecht. Sie könnten hinzufügen: wie ein Schnitt durch die Gurgel, wie Vitriol ins Gesicht.“ (KG, 20.12.1955)
Die Art und Weise, in der die lyrische Manufaktur in Gang kommt, – manchmal ist dabei von „Methode“ die Rede (18.12.1952) – klingt zwar reichlich prosaisch, deckt sich aber doch, wenngleich auf einer sehr allgemeinen Ebene, mit der – nicht nur bei Kramer ausgeprägten – Idee von der orgiastischen Konstruktion von Gedichten, einem Axiom der modernen Lyrik seit Valery, der bekanntlich Kunst/Dichtung als „Fest des Intellekts“ definiert hat. Was dabei ins Auge springt, ist die unbekümmert wirkende Gewißheit, daß Stoffe allein bzw. primär den Ausgangspunkt für Gedichte bilden können und es sehr oft tatsächlich auch sind: „[…] Krieg ich nun einmal einen neuen Stoff, so vertief ich mich so darin, dass ich mit einem einzigen Gedichte einfach nicht mehr das Auslangen finde.“ (KG, 23.3.1952)
Überzeugender ist Kramer freilich immer dort, wo Begriffe wie „Erfahrung“, „Realismus“ oder „Asphaltliteratur“ aufgegriffen und präzisiert werden. „Erfahrung“ bedeutet auch für Kramer eine Schlüsselkategorie, ist Garant für Authentizität: Was in der Kunst „zählt“, seien „Erfahrungen, für die man sehr schwer bezahlt, bei mir ist es jedenfalls so […]“ (KG, 15.8. 1954) bzw. „Mit mir ist es so, dass ich etwas selbst erleben bzw. erleiden muß, sonst ist es mir nicht zugänglich […]“ (KG, 24.8.1954) Der häufig zitierte Passus über „Asphaltliteratur“, zu der Kramer ein durchaus ambivalentes Verhältnis an den Tag legt („ein blödes, missbrauchtes Wort“ einerseits, „hoffentlich“ andererseits), steht schließlich als Vorspann zu einer Schlußfolgerung, die mehrmals wiederkehrt, u.a. auch in den Äußerungen zu Brecht und seinem Einfluß auf Kramers Lyrik der späten 20er Jahre, nämlich der, „überhaupt ein Lyriker, der die ganze Breitseite des Lebens angeht“, sein zu wollen. (KG, 18.12.1952 bzw. 25.3.1953).
Die beiden Pole – Manufaktur, Stofflichkeit, Breitseite des Lebens versus Schreiben als Genuß/Suchtierotische (kompensatorische) Erfahrung bzw. Überschwang, Gewalttätigkeit als Gegengewicht zum disziplinierenden, systematischen „realistischen“ Ansatz (KG, 25.3.1952) – kehren bis in die Schlußphase des Briefwechsels mit zwar abgestuften Gewichtungen, aber im Grunde konstant bleibend, wieder. Im November 1955 heißt es z.B.: „Ich dichte, weil ich süchtig bin und ohne zu dichten kaum leben könnte. Wenn mir noch was gelingt, gibt mir dies vorübergehend Befriedigung.“ (KG, 20.11.1955) bzw. im Jänner 1957: „Daß ich ein Vielschreiber bin, weiss ich. Ich ,muss‘ schreiben […]“ (KG, 8.1.1957)
Wie sehr Kramer daran gelegen war, nicht festgelegt zu werden, geht auch aus manchen seiner Bemerkungen zum Guttenbrunner-Nachwort hervor, vor allem aus folgender:
… dass ich nicht nur mit dem sozialen Realismus oder wie man das heutzutage nennt, vertreten bin, sondern auch mit jener dunklen Kraft, zu der ich mich im Titelgedicht [Vom schwarzen Wein; P-H. K.] bekenne. (KG, 25.7.1956 und nochmals 27.7.1956).
Auch eine der letzten Anmerkungen zu einem „Oh Marie-Gedicht“ verleiht jener merkwürdigen Spannung Ausdruck, unter der Kramer in den 50er Jahren gelebt und gelitten und welche er mitunter auch zelebriert hat: der paradoxen Situation, als Mensch ausgelaugt, „des Lebens müde zu sein“ und als Dichter ein Gedicht zustandezubringen, „das am Überschwang des Lebens leidet.“ (24.4.1957), eine Art Vorwegnahme der lakonischen Formel vom drohenden, baldigen Ende: „Das Dichten hab ich eingestellt.“ (KG, 6.5.1957)
Zur Charakteristik der Kramer’schen Reflexionen und Bezugnahmen auf das Schreiben gehört ferner die zum Teil überraschende, zum Teil ungewöhnliche Bewertung der eigenen Gedichte, vor allem der gerade fertiggestellten sowie der noch im Entwurf befindlichen. Auch dabei greifen zwei Ebenen ineinander: jene der sehr allgemeinen Feststellungen über Gelingen oder Mißlingen und jene der stets recht knappen Kommentierung einzelner Gedichte, – eine ununterbrochene Bewegung von Selbstzuspruch und Zweifel, Koketterie, Attraktion und Aversion. Heißt es einmal „[…] doch nach wie vor bin ich überzeugt, dass ich im Gedicht den meisten Dingen beikommen und sie in manchen gültig gestalten kann […]“ (Juni 1954), so brechen unmittelbar darauf oder zuvor tiefere Zweifel durch, die mit der Formel „Die Arbeit taugt nichts“ (KG, 10.9.1953) ihren Leitsatz erhalten. Zudem bringt Kramer eine sehr ausdifferenzierte, für den Leser mitunter schwer nachzuvollziehende Skalierung zur Anwendung. Demzufolge wären einzelne Gedichte nicht nur: sehr gut, gut, persönlich, bitter, merkwürdig, interessant, stark, böse, einfach, pervers, flott, zufriedenstelIend, mäßig, ungenügend, schwach, sondern auch:
• „leider nicht recht aufgegangen“ („Das Mittagsschläfchen“; 31.5.1953)
• „vielleicht zu trocken“ („Die Sekretärin“, 17.5.1953) „ganz laubig“ („Der sorglose Mieter“, 15.9.1953)
• „besser, aber nicht zum Optimum aufgelaufen“ („Die tote Frau“, 25.10.1953)
• „woher ich den Einfall hab, weiss ich nicht, höchstwahrscheinlich bin ich eben doch ein Dichter ,sui generis‘“ („Der alte Pfandleiher“, 14.1.1955)
• „urig und auch für mich originell“ („Vorm Urlaub“, 4.3.1955)
• „allgemein zutreffend und erbarmungslos“ („Die gleiche Geilheit“, 15.2.1956)
Gewiß, Annotationen – wie die hier aufgelisteten – erschweren den Zugang zu vielen der späten Gedichte. Und doch reflektieren sie im Kontext der intrikaten Verschränkungen von Leben, Wahrnehmen und Schreiben eine ästhetisch-gesellschaftliche Position, die in der illusionsarmen, scheinbar idyllisierenden und auf die Leiblichkeit der Kreatur zulaufenden nicht-optimistischen Perspektive ein subversives Moment entwickelt, das für die Zerbrechlichkeit, Kreatürlichkeit sowie Ungleichzeitigkeit, und damit wieder für die brüchige Konfiguration des sprechenden Subjekts, einsteht. Eine Haltung, welche zwangsläufig nicht mehr geschlossene ästhetische wie politische Entwürfe und Projekte zu formulieren imstande ist und gerade deshalb nicht, auch im Gestus des Resignativen wie des trotzig bitteren Aufbäumens, utopischer Aussage und Qualität entbehrt.
Auswirkungen und poetische Reflexe der existentiellen Situation auf das lyrische Arbeiten
Die zahlreichen Eintragungen, welche Kramers verbitterter und prekärer existentieller Situation entspringen, einer Situation, die wesentlich von der Wahrnehmung der Isolation bestimmt erscheint – „Denn diese Isolierung macht mich fast wahnsinnig“ (KG, 7.10.1951) – sowie von der geringen Resonanz auf sein Werk in Österreich – „Wie lange wird mich das Gesindel [= österreichische Kritiker / P-H. K.] noch totschweigen?“ (KG, 24.2.1952) −, werfen die Frage auf, ob sich eine genauer bestimmbare Richtung der Eintragungen herausfiltern läßt oder ob diese letztlich den wechselnden psychophysischen Befindlichkeiten des Dichters folgen. Zunächst ist davon auszugehen, Kramers Situation als eine zu erfassen, in der die erbärmliche Alltäglichkeit des Exils mächtiger zu Wort kommt als jede programmatische Reflexion über Exilerfahrung an sich. Die Frage stellt sich daher, in welcher Form schlägt sich diese Alltäglichkeit in der nahezu ungebrochenen frenetischen Produktion nieder. Bleibt diese lediglich auf die Ebene eines Hintergrundes beschränkt oder schreibt sie sich in die Sprechweise und in die Form der Gedichte ein?
Auf den ersten Blick scheint der Ertrag nicht besonders ergiebig zu sein. Zu bekannten Gedichten wie „Spätes Lied“ (1946 entstanden, aber in Zeitungen erst 1955/56 gedruckt), „Wenige Dinge nur bleiben“ oder „Spätsommer“ – Gedichte aus Lob der Verzweiflung – gesellen sich nur wenige, meist in Briefen skizzierte Kompositionen, die aus individuellen Lebenssituation heraustreten und, wie das diesem Essay als Motto vorangestellte Gedicht, signalhaft poetische Akzente zu setzen imstande sind, welche den Erfahrungshorizont qualitativ anreichern. „Gastmahl“ – ein „Emigrantenzechgedicht, sehr stark und gut“ (14.6.1955) – wäre ein solches, und manche der Staub- und Rostgedichte sind in Erinnerung zu rufen: „Du bist der Stau“ mit seiner Spannung aus lakonisch inventarisierender Befindlichkeitsaufnahme und Poetisierung des sich schmerzhaft Verflüchtenden oder das – in Sprecherhaltung und Form – konventionellere „Mit dem Staub“.
Versucht man dagegen einen Zugang im Sinn einer Befragung der Textur des Briefkorpus und der Gedichte, dann wird man kaum umhin kommen, einige Momente wahrzunehmen, die gewissermaßen Scharniere zwischen der Lebens- und Produktionsschiene bilden: Auffällig ist etwa der manische Blick auf bestimmte, wiederkehrende, nebensächlich wirkende Themen des Alltags, z.B. die Organisation des Bibliotheksbetriebes, das Registrieren kleinster Veränderungen in der unmittelbaren Umgebung (wie Launen der Vermieter), ferner die Sehnsucht nach Kontakten und nach der Großstadt, die Probleme mit gebrochenen Buchstaben der Schreibmaschine und natürlich die kulinarischen Lamenti und Projektionen sowie die unterschiedlichsten physischen Beschwerden. In diesen Blickwinkeln, für Kramer wie Einbrüche in eine jederzeit auffindbare äußere Sicherheit, in ein mühsam ausbalanciertes Gleichgewicht, liegt zweifellos etwas Pathologisches oder – näher besehen – ein kaum chiffrierter Ausdruck jener Isolation und der Angst, dem Alltag nicht widerstehen zu können. Um 1955/56 tritt – so die Briefe – eine weitere Belastung hinzu, die durch Träume, „die nun fast jede Nacht die Nazizeit zurückbringen und ärger, als sie für mich persönlich war.“ (KG, 24.1.1956) Eine Form, dem zu widerstehen, ist gewiß das Schreiben von Briefen und Gedichten, die genau diese Erfahrungsebene zum Thema macht. Als Leitmotiv könnte die Überlegung vom 20.6.1953 herausgegriffen werden, wo im Anschluß an das Konstatieren fehlender rebellischer Kraft in vielen Gedichten der Autor für sich bilanziert, diese hätten „als Inhalt gemeinsam, wie man es sich noch einrichten kann in diesem Leben.“
Später wird gelegentlich von einer „biologischen Funktion“ die Rede sein, von einem „Drang in mir, der alles zu Gedichten macht“ (KG, 2.9.1956). Beipiele, in denen dieser Drang und die Verschränkung von körperlicher Defizienz und poetischer Kompensation faßbar wird, sind z.B. die Gedichte „Ich bin kein Held, kein Säusler“ oder auch das formal ungewöhnliche „Immer“, das nach einer litaneihaften Aufzählung der physischen Gebrechen des Ich in seinen Schlußversen ein Bekenntnis zum Schreiben als produktives Gegengewicht zum devastierten Körper ablegt: „immer werd ich schreiben, süß und herb, / immer werd ich schreiben, bis ich sterb.“
Ein anderer Punkt wäre die zunehmende Sorge um das Verlorengehen des Werkes überhaupt, die neben häufigen Auflistungen Guttenbrunner gegenüber, welche Bände unveröffentlichter Gedichte mehr oder weniger druckreif vorlägen, Anlaß zu zahlreichen Verszeilen, Strophen oder von ganzen Gedichten wird.
Kramers „Soho-Gedichte“
Ein weiterer Aspekt, den ich hier mit einigen Beispielen vorstellen möchte, ist jener der Anstrengung, der Alltags-Isolation – als Signum der Exilwirklichkeit – zu entfliehen und jenen Erfahrungshunger, jene vitalistische Potenz, von der bereits die Rede war, zurückzugewinnen. Es handelt sich um Gedichte, welche als Gruppe der „Soho-Texte“ zusammengefaßt werden könnten, basierend auf Soho als Inbegriff eines anderen Lebens, – „[…] sonst lebe ich überhaupt nicht […]“ (KG, 24.6.1954) – quasi als Kompensation für die nicht geschaffte Rückkehr nach Österreich sowie als wichtige inspirative Quelle. Fast im Sinn einer Bilanz über das Schreiben in den letzten Jahren liest sich daher folgende Briefstelle:
[…] Meine Einfälle verdanke ich dem Umgang mit Menschen, Soho, der Fahrt in einem leeren Abteil (nach London/Soho und zurück), dem Kino; sie kommen, wenn ich gehe […] (KG, 26.2.1956)
Im Briefwechsel werden insgesamt rund ein Dutzend Soho-Gedichte erwähnt; man kann aber davon ausgehen, daß sich wesentlich mehr der Soho-Erwartung und Soho-Erfahrung verdanken. Nicht wenigen London-Fahrten Kramers ist – neben Besuchen bei Fritz Brassloff, Anny Friedman, Gretl Oplatek, Hilde Spiel oder Eleanor Farjeon u.a. – die Aussicht oder Hoffnung auf ein Soho-Streunen eingeschrieben. In die Werkausgabe sind vier davon aufgenommen worden: „Die Vierzigerin“, „London“, (wobei nicht sicher ist, ob es sich um das von Kramer im Briefwechsel gemeinte Gedicht handelt); „Oh Marie, lass heut mich länger liegen“ sowie „Weihnachten in Soho“. Ferner spricht einiges dafür, daß auch das dem England-Zyklus zugeschlagene späte Gedicht „Liebe in London“ den Soho-Gedichten zuzurechnen ist.
Im Typoskript-Konvolut des Guttenbrunner-Nachlasses finden sich weitere fünf Texte, welche unmißverständlich um Soho kreisen: „Gwen“ (1951), „Lied in Soho“ (1954), „Sonntag in Soho“ (1955), „Abbruch in Soho“ (1955), „London“ (undat.), weiters einige sogenannte „4 Uhr früh-Gedichte“ (Schenkengedichte, z.B. das von Kramer geschätzte „Die Gäste sind gegangen“; 1957). Zwei große Themen bestimmen diese Gedichte: das Thema der Liebe und das der Zeit. Während das erste Thema nochmals die bekannte Modulationsbreite der illusionslosen, aber ausdrucksstarken Sprechweise Kramers versammelt, variiert und die um ihre Vergeblichkeit wissende, aber sich nie aufgebende kreatürliche Vitalität beschwört, zeigt das andere, wie der Dichter mit immer knapper werdenden, über Signalwörter sich quer durch die Gedichte der 50er Jahre verästelnden Bildern auszukommen sucht. Den existentiellen Bedürfnissen des Lebens, die abhanden zu kommen drohen, tritt Kramer mit einer Sprache und einem Bildrepertoire entgegen, welches sich diesen Erfahrungen stellt, Spuren des Schwindens aufzeichnet und dies im sprachlichen Gestus reflektiert.
„Gwen“ – für Kramer ein sehr „zartes Soho-Gedicht“ (KG, 17.11.1951) – gehört in jene Gruppe von Liebesgedichten, welche in Form einer dialogisierten und referierten Episode einen gleichsam doppelten Blickwinkel zur Sprache bringen: den des schreibenden Subjekts auf sein Objekt hin, auf Gwen, eine Prostituierte, die trotz ihres Geschäfts in der ersten Strophe mit den Attributen einer Geliebten versehen und als liebes- und leidensfähig gezeichnet wird, sowie jenen des Ich auf sich selbst, ein düsterer Kontrapunkt, in der zweiten Strophe:
Was stehst bei diesem Wetter,
der Mund zwei Blütenblätter,
du in der Dunkelheit?
Du scheinst verschämt, bescheiden,
zu lieben und zu leiden
mir gleicherweis bereit.
Verfettet, alt, nur strähnig
erst grau, kann ich nur wenig
dir bieten, Gwen an Geld;
nur eine kurze Weile,
denn du, ich weiss, hast Eile,
wenn es dir so gefällt.
Beide Blickwinkel und Bilder konvergieren, ja fließen in der dritten Strophe, sich in eine höhere Solidarität aufhebend, ineinander: die Erbärmlichkeit eines Hurenlebens, welchem die Scham auf die Blütenblätter des Mundes geschrieben steht, und die eines Dichterlebens, das physisch, ökonomisch und wohl auch erotisch abgedankt hat. Anstelle des Geschlechtsakts als rollentypische Bestätigung bittet es, einen letzten Rest von Autonomie vor Augen, einer Inspiration wegen, nur mehr um Zuneigung, um flüchtige Zärtlichkeit, – um Erbarmen.
Auch wo sie nicht verlassen
lass durch die nassen Gassen
uns gehn drum Arm in Arm
zu unserm flüchtigen Bunde
dass in der schwersten Stunde
sich unser Gott erbarm.
Indem sich das Subjekt gänzlich bloßlegt, ohne Klage seine Ohnmächtigkeit eingesteht – „verfettet, alt nur strähnig“ −, wird es der solidarischen Bewegung auf sein Gegenüber fähig. Beide, Gwen und der Dichter, sind Außenseiter und Geschlagene, und dies ermöglicht ein Überschreiten der vorgezeichneten Rollen. Es ist – wie in der dritten Strophe deutlich wird nicht mehr der männliche Part, der das Geschehen bestimmt, die Beziehung über Geld, Potenz oder intellektuelle Ausstrahlung regelt; weit mehr bestimmen die existentielle Befindlichkeit und das Ambiente die Möglichkeiten eines Zusammenseins; sie räumen dem Dichter, um dessen einziges Kapital wissend, d.h. die Sprache, ein vorübergehendes Gastrecht ein.
In „London“ hingegen steht Kramers Erfahrung und Wahrnehmung der Zeit bzw. Zeitlichkeit Mitte der 50er Jahre, eingebettet in eine Synthese aus Stadt- und Naturbildern, im Vordergrund. Die ersten Verse scheinen zunächst auf ein konventionelles Herbst- und Abschiedsgedicht hinauszulaufen, das, in bündige Verse gesetzt, lakonisch das Rinnen der Zeit festhält.
Es glühn die Pflasterkerben,
das Laub fällt grün verdorrt;
die Malven, Linden, sterben
hier schon im Sommer fort.
Der Mörtel rinnt, mit Frieden
füllt mich das Rieseln weit;
ist’s doch auch mir beschieden,
zu schwinden vor der Zeit.
Zugleich aber zeichnen die ersten drei Zeilen einen Übergang von einer vitalen („glühn“) in eine morbide Landschaft nach, in der nicht nur den Malven, sondern auch dem Ich ein Ende vor der Zeit in Aussicht gestellt wird, und deuten somit eine komplexere Bedeutungsebene an. Daß dieses Absterben und Rieseln der Malven bzw. der Großstadt, beide an sich Verkörperungen der Kraft, Dynamik und Farbigkeit, als offenbar unausweichlich empfunden und konstatiert werden, mag irritieren, zumal kein Motiv dafür angegeben wird und jeder Widerstand – durch die Natur wie durch den Betrachter – aufgegeben erscheint, ja in der zweiten Strophe ein tieferes Eingebundensein in diesen Prozeß – „mit Frieden füllt mich das Rieseln weit“ – zu Tage tritt. Überhaupt verstärkt sich von der ersten zur zweiten Strophe dieser Blickwinkel des Abgesangs, dem nicht mehr, wie z.B. in „Immer“, am Schluß ein trotziges Aufbegehren, eine Gegenrede, entgegengesetzt wird.
Man kann dieses Gedicht als ein resignativ-melancholisches Lied sehen, von denen es in der späten Lyrik Kramers einige gibt, und es dabei bewenden lassen. Verdorren und Schwinden, – läßt sich das nicht auch anders lesen? Etwa als Ausdruck eines Nebeneinanders von Faszination, genauer Beobachtung und skandalöser Schwunderfahrung? Als Faszination über die (sich regenerierende) Dialektik von Aufblüte und Verfall der städtischen Natur, wie auch eine einschlägige Briefstelle offenlegt: „In London ist es die Mischung aus Grün und Verfallenheit, die mich anzieht […]“ (KG, 19.3.1956). Und klingt hier nicht leise eine tiefe Verbitterung über die Aussichtslosigkeit der eigenen Lebens- und Schaffenssituation durch, die zwangsläufig in eine fremdbestimmte Akzeptanz dieses Schwindens, die vom Ich nicht mehr aufgehalten werden kann, wie das Adverb „beschieden“ anzeigt, mündet: „[…] ist’s doch auch mir beschieden?“ Die in der letzten Schaffensperiode wiederkehrende Metaphorik des „grün verdorrt“, man denke nur an das thematisch und im Sprechergestus verwandte Gedicht „Zuhaus in London“, scheint letztlich doch vorwiegend diese Verbitterung zu reflektieren, auch in der durchschimmernden Annahme mancher dieser prekären Bedingungen. Dafür spricht auch der Umstand, daß ein Teil des sprachlichen Materials, der Bilder sowie der Perspektiven in mehreren Gedichten wiederkehrt. So treffen wir auf ein Malvenbild schon in „Der Rost am schwarzen Gitter“ und die „verglühenden Malven“ tragen geradezu signalhaft – vielleicht ist dies doch eine lyrisch-poetologische Wegmarke? – ein so symptomatisches und den Leser spontan einnehmendes Gedicht wie „Laßt uns von den Malven singen…“ (vermutlich Sommer 1953), wo in der letzten Strophe jener schmerzliche, aber zugleich sanfte Wechsel aus der Naturlandschaft in eine existentielle Befindlichkeit vollzogen wird. Insofern ist der Versuch, die Unwiderbringlichkeit der „vergehenden Stunden“ lyrisch ins Blickfeld zu setzen, wohl als existentielle wie typologische Form möglicher Anverwandlung der Wirklichkeit zu sehen, gleichwohl ihr manche der dynamischen Facetten, so etwa die Herausforderungen durch Technik, Vermassung und großstädtische Zeichenwelt abhanden kommen.
Laßt uns von den Malven singen…
Laßt uns von den Malven singen,
von den Malven, die verglühn,
von den feingerippten Broten,
von den Rispen schwarzer Schoten,
die im Frühjahr wieder blühn.
Laßt uns von den Nüssen singen,
von den Nüssen, die zerschelln,
die zu Brot und Wein uns munden,
die mit gelb und grünen Runden
übers Jahr den Plan erhelln.
Laßt uns von den Stunden singen,
von den Stunden, die vergehn,
von den Stunden unterm kühlen
Himmel, wie wir heut sie fühlen,
die wir nie mehr wieder sehn.
Spuren der Rezeption zeitgenössischer Literatur und Lyrik
Während der Briefwechsel häufig auf Prosalektüren und vereinzelt auf dramatische Texte Bezug nimmt und Kramer als aufmerksamen, an der europäischen „klassischen“ Moderne – weniger seiner Gegenwart – interessierten Autor und kritischen Leser ausweist, sind die spärlichen Anmerkungen zur modernen Lyrik von Distanz, Irritation oder Abwehr gekennzeichnet. Der Begeisterung für Silone – „eine große Erscheinung in der abendländischen Literatur“ (KG, 27.6.1953) – und der Anerkennung von Verga, Capek, Thomas Mann, Dino Buzzatti (den Kramer in englischer Übersetzung gelesen hat), Camus [Die Pest], Canetti (insbesondere als faszinierende Persönlichkeit) oder Schnitzler (ab 1954) steht – hinsichtlich der zeitgenössischen Literatur – nichts Vergleichbares gegenüber. Vielmehr treffen wir auf das Eingeständnis, und zwar bezeichnenderweise im Umfeld einer Eintragung über das Altern, „dass sich im Unterbewußtsein was dagegen sträubt.“ (KG, 24.7.1954)
Diese Abwehr des Neuen hat – so mein Eindruck – ihren Ursprung in der Diskontinuität der Zeitgenossenschaft sowie darin in der Wahrnehmung nicht mehr rezipiert, ja im Gegenteil in der literarischen Öffentlichkeit an den Rand gedrängt zu werden. Kann Kramer das eigene Werk der 30er Jahre noch in einen Kontext stellen, der mit Brecht, dessen Hauspostille als wichtige Anregung mehrmals genannt wird, aber auch mit Georg Heym – der „geniale Georg Heym, von dem ich gelernt habe […]“ – und überraschenderweise mit Trakl („heiß geliebt; im Vagabund eine Zeile von Trakl übernommen“; KG, 7.3.1952) einen beeindruckenden Epochenbezug besitzt, so bieten sich offenbar für die Nachkriegsjahre weder gemeinsame Erfahrungshorizonte noch ein gemeinsames Traditionsverständnis oder das Bewußtsein von den Möglichkeiten lyrischen Sprechens mit der nach 1945 auftretenden Generation an nicht mit Guttenbrunner und auch nicht mit Fried oder anderen österreichischen und deutschen Lyrikern.
Wenn Kramer aufgrund von Zeitungsnotizen über Preisverleihungen oder zugesandten Zeitschriften überhaupt auf neue Lyriker zu sprechen kommt, dann steht dies oft im Zeichen der Distanz. So attestiert er Christine Busta „zwar Können“, fügt jedoch klarstellend hinzu: „aber mit diesen Worten kann niemand was anfangen, am allerwenigsten ich. […].“ Die Trakl-Preisträgerin Martha Hoffmann, deren Vorkriegsgedichte er gekannt hat, erscheint ihm dagegen zu „formglatt“ (KG, 14.1. 1955); den Gedichten in Wort in der Zeit, ausgenommen denjenigen von Friedrich Torberg (Themen: Exil, Landschaft-Heimat), „stehe ich mit großem Unverständnis gegenüber.“ (KG, 24.8.1955) Im ersten Heft dieser von Kramer in Folge trotz Nadler-Präsenz geschätzten Zeitschrift kamen Busta und Wieland Schmied, im zweiten Herbert Zand und Kurt Klinger zum Abdruck; über die Kenntnis anderer Hefte (und Autoren wie z.B. Okopenko, Walter Schlorhaufer, Ernst Waldinger, Felix Braun, Werner Riemerschmid) sagt der Briefwechsel nichts aus.
Es versteht sich daher fast von selbst, daß vom Briefwechsel her kaum weiterführende Überlegungen zu den „repräsentativen“ Tendenzen in der deutschsprachigen Lyrik der 50er Jahre zu erwarten sind: weder zu Günther Eich, noch zu Gottfried Benn, dessen Präsenz seit den Statischen Gedichten und der Marbacher Rede bekanntlich eine gewichtige war, nicht zu Ingeborg Bachmann und Paul Celan, dessen Mohn und Gedächtnis in Heft 3 (1955) von Wort in der Zeit durch Wieland Schmied besprochen wurde, und auch nicht zum generations- und erfahrungsmäßig verwandteren Wilhelm Lehmann. Parallel zu der diskontinuierlichen Erfahrungsebene mag ein weiterer Grund im spezifischen Sprachansatz gelegen sein, in der Tendenz, so Kramer, Rilke nachzudichten, wobei „die deutsche Lyrik ziemlich auf den Hund gebracht“ werde (KG, 15.12.1951).
Im Rückblick nimmt sich natürlich manches als verkürzte Sicht der Dinge aus; ich plädiere jedenfalls dafür, darin einen Ausdruck jener Isolation zu erblicken, die es Kramer verunmöglicht hat, am literarischen Diskurs der 50er Jahre teilzunehmen bzw. ihm vorurteilsloser zu begegnen. Der Sprachansatz war ja – ohne hier einen ausführlichen Nachweis führen zu müssen – trotz mancher Rückgriffe auf Rilke oder Trakl ein weit differenzierter, das „alte Haus der Sprache“ nach den Erfahrungen des Faschismus durch die neuauftretende Generation bei weitem keine Selbstverständlichkeit mehr. Zutiefst geschändet, jedoch auch kontaminiert, hatte die „Sprache“, die für Kramer nie in Frage stand und in seiner Exilzeit vor allem Zuflucht und Heimat verkörpert hatte, einen mühsamen Prozeß und Weg einer Neupositionierung zu durchlaufen, in welchem Chiffrierung, Polyphonie, Metaphorisierung, Zerlegung oder Montage weit mehr als nur formale Experimente bedeuteten.
Daß Kramer der modernen Lyrik mit Skepsis und Irritation begegnete, – „verstehe kein einziges der Gedichte“ (anläßlich der Lektüre der ihm zugeschickten Zeitschrift Alpha; KG, 17.8.1955) – und im Briefwechsel gerade nur Albrecht Goes als einzigen Autor des deutschen Nachkriegsspektrums nennt, der ihn tiefer beeindruckte (vgl. KG, 24.4.1955), sowie Martina Wied lobend erwähnt, befriedigt zunächst nicht sehr. Es kann aber nicht so ausgelegt werden, als wäre ihm die Bewußtheit und Berechtigung von Ausdrucksformen lyrischen Sprechens gänzlich abhanden gekommen. Gerade im Akt des ständigen Sich-Vergewisserns der eigenen Position als „repräsentative“, die Heraus- und Anforderungen gemeistert habe, wird nämlich eine tiefere Verunsicherung über das vorgelegte Werk insgesamt fühlbar. Zugleich klingt hier die selten offen ausgeprochene Notwendigkeit einer nicht nur noch vollständigeren thematisch-figurativen Ausschöpfung der sogenannten Breitseite des Lebens durch, sondern auch einer Recherche nach neuen formalen Möglichkeiten, wenngleich sich diese als nicht besonders experimentell, kühn oder innovativ erweisen sollte, was von einem 50jährigen Lyriker unter den gegebenen existentiellen und literarischen Bedingungen auch kaum zu erwarten ist.
Veränderungen, Modifikationen, Konstanten in Kramers Blick auf die eigene Produktion; Ansätze zu formalen Neuerungen?
Sieht man von der in Briefen einbekannten Schwierigkeit, das eigene Werk zu überblicken und im Kontext der zeitgenössischen Lyrik zu verankern, einmal ab, so kann man doch festhalten, daß in Kramers Blick, Bewußtsein und lyrischem Arbeiten, bei allen diskutablen Wahrnehmungen und Einschätzungen, Überlegungen zu formaler und sprachlicher Neu-Gestaltung einen gewissen Stellenwert behaupten können. Freilich geht dem die Bewußtheit der singulären Leistung voran, d.h. neben Brecht und nach Trakl einen maßgeblichen lyrischen Akzent im 20. Jahrhundert gesetzt zu haben. Weiters bleibt das Bekenntnis zur metrischen Komposition, zur formalen Tradition, zur Beherrsch- und Verfügbarkeit der Sprache und der realistischen Arbeitsweise im Grunde bestehen, ja findet Bekräftigung:
[…] Aber ich glaube tatsächlich, als gedemütigte Kreatur, mit Ihnen, dass in der realistischen und drastischen Manier ich geschrieben habe, was gedruckt und gewürdigt werden sollte. (KG, 21.11.1954)
Um 1953/54 findet sich trotzdem eine Reihe von Überlegungen zu formalen, kompositionellen und thematischen Neuansätzen. Kramer meint damit einerseits die Zuwendung zu konziserer Strophenform und Versgestaltung – Zwei- und Dreizeilergruppen statt der zwei- bis achtstrophigen Vier-, Fünf-, oder Achtzeiler mit zusätzlicher Verknappung bzw. Konzentration durch Kehrreime, Anaphern oder Infinitivstruktur nach innen. Andrerseits verwendet er einige Energie darauf, Stilmittel wie Kontrast, gedrängte Rede und plötzlichen Umschlag in seine „lyrische Manufaktur“ zu integrieren. Bereits 1952 findet sich in einem Brief eine Skizze zu einem möglichen Gedicht, die einen dieser Neuansätze markiert: „Mir ist so wohl, als wär mein ganzer Schädel / mit einem scharfen Messer ausgekrazt.“ (KG, 7.3.1952). Zu manchen der als „Neuland“ deklarierten Gedichten fehlen im Nachlaß allerdings die entsprechenden Texte, so etwa zu „Die Kundin“ (1.8.1954), dem mehrmals als „gelungen“ erwähnten Haßgedicht „Vitriol“ („August“ 1955) oder den „ätzend scharfen“ Gegengedichten „Mein Sohn, du bist ein steifer öder Wicht“ und „Mein Vater ist zwar noch im Kopf gescheit“.
„Roter Wein und weißer Wein“, ein Gedicht über die Bitternis des Exils mit seinen Bildoppositionen, Alliterationen und Wortwiederholungen, zeigt vielleicht jene mögliche neue Richtung an und setzt um, was Theodor Kramer unter formalem und sprachlichem Neuansatz verstanden wissen wollte: einen Ansatz, der Liedhaftes und Konzentration, Verknappung ineinander zu blenden sucht. Auch dazu eine Briefstelle: „Ich glaube, ich könnte noch mehr Kontraste verwenden, liedhafte Zeilen, einfach, fast simpel bei krassem Geschehen […]“ (KG, 27.5.1956).
Allerdings, bei aller Knappheit (durch Kehrreim etc.), „das Milieu muss zu sehen, zu riechen und zu schmecken sein.“ (1.6.1955). Wie allerdings zahlreiche Gedichte der 50er Jahre zeigen, konnte es sich dabei nicht mehr mit jener Selbstverständlichkeit – wie sie noch in den ersten Nachkriegsbänden durchschimmert – um das ihm vertraute Milieu der Vorkriegszeit handeln. Es liegt geradezu auf der Hand, daß dieses zunehmend Züge eines Milieus einer desolaten Exillandschaft im topographischen wie psychischem Sinn annimmt.
Wenn es im lyrischen Schaffen einen Zyklus gibt, der auf die bisher referierten Themen und auf Theodor Kramers Ringen um neue Ausdrucksmöglichkeiten bei gleichzeitigem Festhalten an Bewährtem abgestimmt erscheint, dann ist dies wohl der Zyklus „Mit dem Staub“. Ein Vergleich der Gedichte, die den späten 40er Jahren angehören (d.h. etwa ein Drittel des Zyklus) mit jenen aus der Periode 1952-1956, vermag dabei deutlich zu machen, daß Theodor Kramers lyrisches Sprechen trotz einer geradezu beeindruckenden thematischen Konstanz doch Ansätze zu formaler Erneuerung im Sinn einer zunehmenden Verdichtung und Verknappung nach innen aufweist, – Ansätze, die zwar vereinzelt bereits in früheren Gedichten – wie z.B. „Ich komm zu dir…“ (1947) – anzutreffen sind, die sich aber in jener Spätphase bündeln.
Auch die während der Gesichtslähmung 1956 entstandene Gedichtgruppe „Die Fratze“ – sechs dreistrophige Zweizeiler und das Gedicht „Handmarie“ – zählt zu jenen Anstrengungen, indem sie auf eine sehr lakonische, prosaische Sprech- und Gangart baut, wie sie sonst kaum bei Kramer vorkommt. Ist Kramer von manchen Ergebnissen (bedauerlicherweise oft ohne Titelangabe) in der Zwei- und Dreizeilertechnik auch tief überzeugt, so halten doch einige bei weitem nicht das, was der Dichter zu erreichen glaubt. Dazu nur ein Beispiel, das ihm als „Spitzenleistung“ erschien, genauer besehen aber doch nur kalauernde und geschlechtsdiskriminierende „Qualität“ besitzt: „Heut macht jeder, der mein Freund ist blau, / heut nimmt niemand, was er sagt, genau / heut ist jede Jungfrau eine Sau“ (5.12.1955).
In den letzten Monaten des Exils in England halten sich die bedrückenden und lichtvolleren Einschätzungen durchwegs die Waage. Einerseits kehrt das Bekenntnis zum Liedhaften wieder – „die liedhaften Stücke aus Lob machen mich ganz besoffen […]“ (KG, 26.8.1956) oder „Ich muß im Liedhaften Trost suchen, Figuren, wie es Brassloff zu nennen pflegt, gibt es längst keine mehr […]“ (KG, 2.4.1957). Als Beispiel für diese Trostsuche kann der demselben Brief beigelegte Zweizeiler gelten: „Nun geht die Nacht zur Neige, fahl kommt vom Saum es her / verlassen sind die Steige und alle Nischen leer.“ (ebd.)
Andrerseits treffen wir auf ernüchternde und den Dichter gewiß deprimierende Befunde wie: „Das Traurigste ist, dass ich eben nichts vorlegen kann aus den letzten 10 Jahren, in denen ich auf neuen Wegen bin“ (KG, 19.12.1956). Nichtsdestotrotz darf auch sein Spätwerk, sein Sprechen von einer zunehmenden Isolation her, als ein in ihrer spezifischen Form einmaliger und wohl auch unterschätzter Beitrag zu den Möglichkeiten und Grenzen lyrischen Arbeitens im Exil gerechnet werden. Zu einem Arbeiten nämlich, das in der konsequenten Verweigerung der Demontage und Re-Montage seiner sprachlichen Voraussetzungen und seinem Beharren auf eine realistische wie kreatürlich-abgründige Ausdrucks- und Gestaltungskraft nicht nur vormodern, sondern in sich stimmig wirkt, gerade indem es Widersprüchlichkeiten nicht in eine „moderne“ lyrische Matrix zwängt.
Primus-Heinz Kucher, in: Zwischenwelt. Chronist seiner Zeit – Theodor Kramer, 2000, Theodor Kramer Gesellschaft und Drava Verlag
Fakten und Vermutungen zum Poesiealbum + wiederentdeckt +
Interview
50 Jahre 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber
Porträtgalerie
Zum 25. Todestag des Autors:
Zum 50. Todestag des Autors:
Günther Doliwa: Gewaltig ist das Leben
literaturkritik.de, April 2008
Daniela Strigl: Hieb auf den Kopf, Griff ans Geschlecht
Der Standart, 29./30.3.2008
Cornelius Hell: Für die, die ohne Stimme sind
Die Furche, 27.3.2008
Fakten und Vermutungen zum Autor + ÖM + Archiv 1, 2 & 3 +
Internet Archive + Kalliope
Theodor Kramers Gedicht „Geboren ward ich in die Wende“ gesungen von Wenzel.

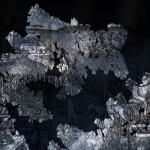












Schreibe einen Kommentar