Ernst Jandl: sprechblasen
VORWORT
1
der baum ist kunstvoll
und alles in der luft
zugleich. von weitem
erhebt natur den schatten.
luftig in der hand schwindet
die schwarze tiefe. noch unvertrieben
kommt die erwähnte
kurze kurze zeit.
schnee und reif
sind eng genug dazu.
horch! die kirschen
enthüllt er gelassen.
2
verhaftet
in diesem haufen stein
blickt er
aus strahlen
nach norden.
an kopf und kinn
die sterne des himmels
flogen tief
aus genieteten augen.
etwas ist
der käfer.
ein feuerball.
dreißigtausend
gebar
ein sandkorn.
3
rascher, kleiner: das
ist ordnung und
verstaubt.
weiter
umschweben
die breitschultrigen straßen
grat und boot.
wurzelfest gebrannt,
den schnabel steil,
krächzen
zahlen.
ein fremdes schleift
hinter den blitzen her.
die wolle
frischer geschlechter
ist angepaßt.
1968 erschien diese Sammlung
voller Poesie zum ersten Mal, und sprechblasen war das erste Buch von Ernst Jandl, das im Luchterhand Verlag erschien. Damals wurde über diesen Band gesagt: „Indem Ernst Jandl das Gedicht – im herkömmlichen Sinn – radikal in Frage stellt, schafft er eine neue, eine äußerste Position und Möglichkeit des Gedichts in deutscher Sprache.“
Heute befindet sich Ernst Jandl nicht mehr in dieser Randlage, die sprechblasen zählen zum klassischen Bestand der experimentellen Poesie und der Dichtung überhaupt. Ihre Sprachkraft hat nicht nachgelassen, viele Gedichte sind im Lauf der Jahre erst entdeckt worden. Und noch immer stimmt, wie damals geurteilt wurde: „Ernst Jandl zählt also zu den vielseitigsten unter den Experimentellen.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Und: „Seit Ernst Jandl gibt es im Bereich der experimentellen Poesie wieder etwas zu lachen, ohne daß man das unangenehme Gefühl zu haben braucht, man hätte etwas theoretisch ungeheuer Kluges bloß falsch verstanden.“ (Die Zeit)
Luchterhand Literaturverlag, Klappentext, 1993
Spielgedichte zum Selbermachen
– Zu den lyrischen Experimenten des Wieners Ernst Jandl. –
Manche werden ihn einen Textebastler nennen wollen. Ernst Jandl, von Beruf Gymnasiallehrer, schreibt, was der Einfachheit halber als experimentelle Poesie bezeichnet wird. Doch er schlägt der Richtung ein Schnippchen. Es gibt eine Photographie von ihm, und schon darauf verrät er sich. Er steht dort, rechte Schulter hochgezogen, die linke hängen lassend, ein professioneller Aktentaschenträger, verschmitzt in die Kamera lächelnd. Seine Texte geben dieser Aufnahme recht. Walter Höllerer:
Lautgedicht, Poème object, Buchstabengedicht hat Jandl mit Witz durchschossen –, so pädagogisch der Gymnasiallehrer Ernst Jandl auch sein mag.
Ein nicht ganz einfacher Fall. Jandl hat, so scheint mir, aus Heißenbüttels Krümel-Text („1 Mann auf 1 Bank“) Methode gemacht, und seither gibt es im Bereich der experimentellen Poesie wieder etwas zu lachen, ohne daß man das unangenehme Gefühl zu haben braucht, man hätte irgend etwas theoretisch ungeheuer Kluges bloß falsch verstanden. Soweit ich sehe, meint Ernst Jandl es wirklich komisch, wenn auch keineswegs unernst. Schließlich ist er ja auch noch Pädagoge.
Abgesehen von einigen Veröffentlichungen an entlegenerem Ort liegen inzwischen zwei Bücher dieses Autors vor –
Ernst Jandl: Laut und Luise; Walter-Druck 12, Walter-Verlag, Olten/Freiburg; 208 S., 28,– DM
Ernst Jandl: sprechblasen, Gedichte; Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied/Berlin; 96 S., 9,80 DM.
Beide Bände, zeigen ihren Verfasser von derselben Seite, was bedeutet, daß die siebenundsechzig „Sprechblasen“-Texte gegenüber dem ersten großen Sammelband Laut und Luise nichts grundsätzlich Neues bringen. Jandl scheint seinen Stil gefunden zu haben und innerhalb der selbstgesteckten Grenzen mit den vorhandenen Variationsmöglichkeiten spielen zu wollen. Überhaupt ist das Spiel mit der Sprache das wesentliche Prinzip seiner literarischen Technik.
Jandl hat versucht, die Sprache aus den Fesseln des konventionellen Sprechens und Schreibens zu befreien. Er macht sich in seinen Texten die Offenheiten der Sprache zunutze. Sie sind in den Lücken angesiedelt, die die syntaktischen und grammatischen Regeln, die Orthographie und die Interpunktion dem Benutzer der Sprache lassen. Und sie beweisen, daß es auch jenseits der durch Regeln festgelegten Sprache noch gibt, was üblicherweise für ihr Wesen angesehen wird, Verständigung nämlich:
BESSEMERBIRNEN
als mehr kanonen.
Wer wollte das bestreiten? Jandl läßt die Sprache gewähren, lauscht aber sehr genau auf das, was ihr, sich selber überlassen, alles so einfällt. Und dann macht er daraus ein Gedicht von Ernst Jandl.
Wie das Beispiel zeigt, braucht er dabei nicht viele Worte zu machen. Seine Gedichte sind zum großen Teil sehr kurz. In den „prechblasen findet sich unter dem Titel „sprach mit kurzem o“ lediglich das Wort „ssso“. Aber auch die umfangreicheren Texte kommen durchweg mit einem minimalen Grundbestand von Wörtern aus. Der Text „klare gerührt“, der sich über neunzehn Seiten hinzieht, besteht nur aus diesen beiden Wörtern. Durch Variation und Wiederholung wird die Wendung „viel / vieh / o / so / viel / vieh“ zu einer längeren rhythmisch gegliederten Komposition ausgebaut, und das dreieinhalbseitige Gedicht „bericht über malmö“ basiert allein auf den fünf Buchstaben des Wortes „malmö“.
Poetologische Voraussetzung dabei ist natürlich, daß die feste Lautstruktur des Grundwortes aufgelöst werden darf und die einzelnen Laute zu neuen Konstellationen zusammentreten können. So kommt es zu neuen Wörtern, bekannten oder unbekannten, und der „bericht“ ergibt endlich das Wort „malmö“ als das Ergebnis einer witzigen Multiplikation nach dem Muster: „alm / mal / lamm / mal / Öl / mal / alm / mal / lamm.“
Wer dergleichen als müßige Spielerei abtun will, der sei etwa an die Sprachalchemie mancher Barocklyriker erinnert und an deren Versuche, die paradiesische, die adamitische Ursprache zu rekonstruieren. Nun ist Ernst Jandl selbstverständlich kein barocker Sprachmystiker, und man braucht auch gar nicht bis zum Barock zurückzugehen, um Vorbilder für diese Art der Dichtung zu finden. Die Lyrik des zu Unrecht unterschätzten August Stramm zum Beispiel, sowie Expressionismus und Dada ganz allgemein, haben in den fünfziger Jahren den Versuchen der Wiener Gruppe zur Anregung gedient, und davon ist auch Jandl nicht unberührt geblieben.
Hat man sich erst einmal von der geläufigen und kaum je reflektierten Vorstellung freigemacht, daß Sprache ein festes, nach unveränderlichen Regeln aufgebautes System sei, dann eröffnet sich ihrem Benutzer eine Fülle neuer Möglichkeiten. Und dann wird einem auch Jandls Vorgehen weit weniger revolutionär erscheinen. Im Grunde betreibt er ja nur das mit Methode, was jeder Sprechende, wenn auch ohne Methode, täglich tut. Wer spricht, nutzt auch bereits, ohne groß darüber nachzudenken, die Offenheit der Sprache. Feststehende Redensarten, alltägliche formelhafte Wendungen sind jedermann verständlich, auch wenn sie nur fragmentarisch ausgesprochen oder vernommen werden. Ähnliches gilt für einzelne Wörter. Ist unsere Schriftsprache nicht überdeterminiert? Das Hebräische zum Beispiel kommt in seiner Schrift ohne Vokalbezeichnungen aus. Kann man im Zweifel darüber sein, was das Wort „schtzngrmm“ bedeutet? Jandl versucht daraus eine akustische Demonstration des Schützengraben, zu machen, mit dem Geratter der Maschinengewehre, dem Sirren der Geschosse, mit dem Gurgeln der Getroffenen, mit allem Grimm und Zorn der Schützen und einem langgezogenen „sch…“ als drastischem Kommentar.
Ein Wort kann aber auch, je nach Zusammenhang, Verschiedenes bedeuten, erst die Schreibung eines Lautes entscheidet über seinen Sinn. Es gibt inhaltliche Assoziationen und lautliche, es gibt Dialektgewohnheiten und physisch bedingte Sprechweisen (Lispeln). Ernst Jandl versteht in seinen Gedichten all dies und anderes mehr auszunutzen und beweist damit eine ungewöhnliche Sensibilität für die Sprache.
Diese Begabung hat zur Folge, daß der Autor mit seinen Einfällen verschwenderisch umgehen und die Gefahr, seine Prinzipien durch allzu häufige Wiederholung totzureiten, vermeiden kann. Und diese Gedichte besitzen sogar noch einen weiteren Vorzug, dessen viele andere derselben literarischen Richtung nicht selten ermangeln: Auch Ernst Jandl experimentiert mit der Sprache, doch seine Experimente begnügen sich nicht damit, angestellt worden zu sein. Sie zielen auf ein Ergebnis außerhalb des Sprachlichen. Häufig ist es ein Witz, immer eine Überraschung, und über manchen von Jandls Ergebnissen könnte man geradezu tiefsinnig werden. So über der auf einem simplen Konsonantenaustausch beruhenden „lichtung“:
manche meinen
lechts und rinks
kann man nicht
verwechsern.
werch ein illtum!
Die Negierung eines irrtümlich behaupteten Sachverhalts wird schon in seiner Niederschrift augenfällig demonstriert. Die Einheit von Sprache und außersprachlicher Wirklichkeit wird hergestellt, eine für unüberschreitbar gehaltene Grenze im Nebenbei eines Epigramms übersprungen.
Interessant ist Jandls Stellung zu den überkommenen lyrischen Formen. Auf eine ganz eigene Art hält er an ihnen fest. Ein Gedicht mit dem Titel „sonett“ enthält lediglich dies eine Wort, vierzehnmal wiederholt, in den Reimen angeblich, „vereinfacht oder artistisch gesteigert“, aber in der klassischen Gruppierung von zwei Quartetten und zwei Terzetten. Auch Helmut Heißenbüttel hält in seinem Nachwort zu Laut und Luise ausdrücklich am Begriff des Gedichtes fest. Es seien, so sagt er, „Gedichte wie eh und je, wenn es je Gedichte wie eh und je gegeben hat“, und knüpft damit Jandls in der Lyrik scheinbar ungewöhnliche Formen an die Tradition an. Epigramm, didaktische Poesie, Natur- und Liebeslyrik, Lied und Bekenntnisgedicht, alle diese altehrwürdigen lyrischen Gattungen erscheinen bei Jandl wieder, umgeformt, manchmal reduziert, manchmal parodiert, immer aber ernst genommen.
Dennoch bleiben gewisse Vorbehalte. Sicherlich; man mag ein Gedicht wie „fragment“ der poetischen Lyrik zurechnen können:
wenn die rett
es wird bal
übermor
bis die atombo
ja herr pfa.
Man wird es sogar als witzig empfinden können. Ob es aber wirklich politisch ist? Ob Buchstabenspiele der Erfahrung des Schützengrabens gerecht werden? Jandl scheint die Realität in erster Linie als sprachliches Phänomen zu erfahren, und das hat notwendig einen gewissen ästhetischen Immoralismus zur Folge.
Gewarnt durch meine Erfahrung mit der Lyrik von Jandls Freundin Friederike Mayröcker, räume ich die Möglichkeit ein, daß ich auch Jandls Gedichte, gerade weil sie mir gefallen, falsch verstanden habe. Gleichviel. Ich habe sie als Anleitung zum Selbermachen gelesen, als Spielgedichte. Und als solche empfehle ich sie weiter.
Helmut Salzinger, Die Zeit, 28.3.1969
Ferne Zeitgenossen (XIII)
Ernst Jandls anhaltende Popularität beruht wesentlich auf einer fundamentalen Fehleinschätzung. Dem mehrheitlichen Publikum wie auch der Kritik gilt er als herausragender Repräsentant heiterer Wortkunst, als ebenso subtiler wie souveräner Sprachartist; er ist nach wie vor beliebt als unterhaltsamer Performer eigener Texte (auf CDs und Youtube) und wird gleichzeitig als strenger Experimentator geschätzt.
Dieses publikumsfreundliche Image wird indes rigoros dementiert durch das Bild (oder Bildnis), das der Autor von sich selbst in der Öffentlichkeit abgibt, sei es in der Verlagswerbung, sei es in Veranstaltungsprogrammen, in Magazinen oder auf Plakaten. Zu Hunderten ist Jandls unauffälliges Konterfei, das mit dem Berufsbild eines Lehrers oder eines Versicherungsvertreters eher übereinstimmt als mit dem eines Dichters, in den Medien präsent, und es kehrt unentwegt wieder in diversen Bildbiographien, die eigentlich – unabhängig von seinem Alter – immer nur einen Jandl zeigen: einen mürrischen, abweisenden, melancholischen, ja verzweifelten Menschen, dem kein Lachen gelingt und schon gar nicht ein Lächeln. Als einzige, freilich maskenhafte Variante dazu präsentiert Jandl auf manchen Photos (zumeist bei öffentlichen Lesungen) ein grotesk verzerrtes Gesicht, zeigt sich mit aufgerissenem Mund, vorstehenden Augen, exzentrischen Gesten.
In dieser Hinsicht bleibt Jandl einzig mit Buster Keaton vergleichbar, dem grossen Stummfilmkomiker mit dem todernsten Gesicht, der letztlich ebenfalls ein verkappter Tragiker und Tragöde war, als solcher aber zumeist nicht erkannt und ernstgenommen wurde. Es genügt, sich die Jandl’sche Sprechoper Aus der Fremde von 1980 vorzunehmen, um die tragische Grösse des Autors zu ermessen:
Wohl wird hier (in indirekter konjunktivischer Rede) wortreich von Fusspilz, lästigen Brosamen, Alkoholabhängigkeit, jeglichem „Alltagsdreck“ und sonstigem minderen Ungemach gesprochen, und was der Protagonist larmoyant von sich gibt, mag trivial oder lächerlich erscheinen, kann und sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Mann „aus der Fremde“ mit unbedarfter Rhetorik seine tiefste Existenznot, seinen Selbsthass, seine Verlassenheit auf den Punkt zu bringen sucht – das Malaise des Menschseins schlechthin. Das ist keine Tragikomödie, es ist eine Tragödie von absurder Komik, ohne Trost und ohne Katastrophe, gang und gäbe, in der wirklichen Welt zumeist überspielt und verdrängt, la tragédie humaine in permanenter, endlos sich wiederholender, sich in sich selbst erschöpfender Erstaufführung.
Felix Philipp Ingold, aus Felix Philipp Ingold: Endnoten: Versprengte Lebens- und Lesespäne, Ritter Verlag, 2019
Wie man den Jandl trifft. Eine Begegnung mit Ernst Jandl, eine Erinnerung von Wolf Wondratschek.
Ernst Jandl im Gespräch mit Lisa Fritsch: Ein Weniges ein wenig anders machen.
Eine üble Vorstellung. Ernst Jandl über das harte Los des Lyrikers.
Fakten und Vermutungen zum Autor + ÖM + KLG + IMDb + PIA +
Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + weiteres 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Ernst Jandl: Der Spiegel ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Die Welt ✝ Die Zeit ✝ der Freitag ✝ Der Standart ✝ Schreibheft ✝
graswurzelrevolution
Weitere Nachrufe:
André Bucher: „ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt“
Neue Zürcher Zeitung, 13.6.2000
Martin Halter: Der Lyriker als Popstar
Badische Zeitung, 13.6.2000
Norbert Hummelt: Ein aufregend neuer Ton
Kölner Stadt-Anzeiger, 13.6.2000
Karl Riha: „ich werde hinter keinem her sein“
Frankfurter Rundschau, 13.6.2000
Thomas Steinfeld: Aus dem Vers in den Abgrund gepoltert
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2000
Christian Seiler: Avantgarde, direkt in den Volksmund gelegt
Die Weltwoche, 15.6.2000
Klaus Nüchtern: Im Anfang war der Mund
Falter, Wien, 16.6.2000
Bettina Steiner: Him hanfang war das Wort
Die Presse, Wien, 24.6.2000
Jan Kuhlbrodt: Von der Anwesenheit
signaturen-magazin.de
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Karl Riha: „als ich anderschdehn mange lanquidsch“
neue deutsche literatur, Heft 502, Juli/August 1995
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Zum 20. Todestag des Autors:
Gedanken für den Tag: Cornelius Hell über Ernst Jandl
ORF, 3.6.2020
Markus Fischer: „werch ein illtum!“
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 28.6.2020
Peter Wawerzinek parodiert Ernst Jandl.
Ernst Jandl − Das Öffnen und Schließen des Mundes – Frankfurter Poetikvorlesungen 1984/1985.
Ernst Jandl … entschuldigen sie wenn ich jandle.


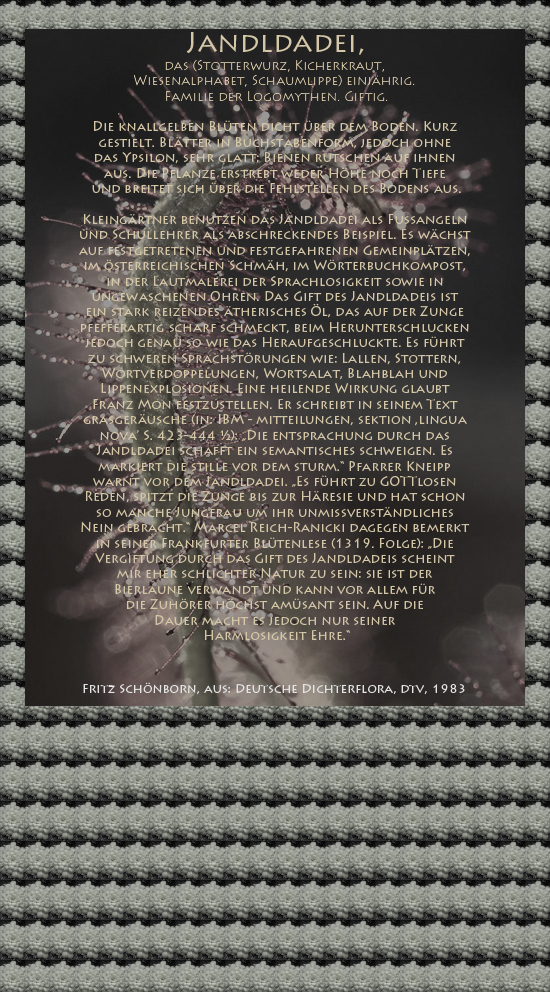












Schreibe einen Kommentar