Dorothea Grünzweig: Glasstimmen lasinäänet
HEUTE WILL ICH VON NAMEN SPRECHEN
aaaaaaaaaaaaaaazum Beispiel
Menschennamen Ortsnamen
es wäre schön wenn ihr
glaubtet wie früher dass
zwischen Name und Ding ein Bund ist
besteht dass alle Gerharde alle Lisas
eine stille Gemeinschaft
fern vom Alleinsein bilden
Heißt einer den wir treffen
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBerg
übersetzt aus anderer Sprache
und waren wir in eine Schlucht
gesperrt so lässt uns
der Name nach oben
steigen die Sonne sehen
aaaaaaaaaaaaaaaaaund Seili
die Verbannungsinsel Seili Saari
von Schmerz vergällt
im Namen aber die Seligen Sail Segel
Sellhund Seal Själ der
durch die Wasser davonschwimmt
Namen gibt es die gegentönen
man muss nur das Ohr an sie
legen die bitten
zu söhnen als läg
aaaaaim Namen ein Trost
Als Lyrikerin
hat Dorothea Grünzweig einen Ton gefunden, der Tradition mit Frische und Innovationslust verbindet.
Wallstein Verlag, Ankündigung
In Winterzungen
− Körniger Sprechgesang, finnisch geprägt: Neue Gedichte von Dorothea Grünzweig. −
Für einen Dichter, eine Dichterin gibt es keine Zufälle. Wo der Zufall endet, setzt das Werk an. Bei Dorothea Grünzweig endete er, als sie fünfundvierzigjährig nach Finnland ging. Nach Aufenthalten in England und Schottland arbeitet sie dort an der deutschen Schule in Helsinki. Dort ist sie geblieben. Von dort kommen ihre Gedichtbücher: Mittsommerschnitt (1997), Vom Eisgebreit (2000) und nun Glasstimmen lasinäänet. Die Titel verabschieden sich sukzessive vom Lokalkolorit, vom allenfalls noch Gefälligen. Sie sind auf dem Weg in ein poetisches Exil.
Man sollte mit dem Begriff „Exil“ vorsichtig sein. Auch dann, wenn das Adjektiv „selbstgewählt“ die Sache modifiziert. Grünzweigs um eine Generation älterer Kollege Manfred Peter Hein hat seinerzeit die Übersiedlung nach Finnland mit einer poetischen Formel beschrieben: „Ich habe den Winter gewählt.“ Auch Dorothea Grünzweig hat so gewählt. „Ich sprech in Winterzungen“, bekennt sie in ihrem neuen Band. Aber sie hat auch nicht unterschlagen, was solche Wahl bedeutet.
In ihrem Debüt Mittsommerschnitt spricht sie von ihrem Assimilationsproblem im „Freizeitpark Finnland“, der ihr „zusagt“ und sie zugleich „kalt läßt“. Sie hat anfangs auch das Problem der persönlichen Akzeptanz: „Deutschland wie aus dem Gesicht / geschnitten / heißt es von mir / seitdem verhäng ich die Spiegel.“ Der Band Vom Eisgebreit bringt die schmerzhafte Distanzierung zu „D“:
In Nacht und Schnee gepackt
ist meine Sprache
mein Was ich bin und
Post aus D.
Aus diesem Eisgebreit tönt Grünzweigs Stimme von Buch zu Buch eigener und deutlicher; und die Autorin weiß sehr wohl, was sie Finnland zu verdanken hat: die Initiation ihrer Poesie:
Und da wo ich jetzt bin
im Ankommland
sind meine Worte leicht
sind aufgehoben
begann das Schauen.
Schauen – nicht Sehen! Der emphatische Begriff ist mit Bedacht gewählt. Die Gedichte suchen nicht das präzise Bild, sondern die Evokation. Sie vertrauen weniger dem Auge als der Stimme. Sie suchen nicht die geschmeidige Melodie, sondern den gestauten körnigen Sprechgesang.
Dorothea Grünzweig liebt die raffenden eigenwilligen Komposita. Sie schwelgt in originellen, manchmal auch gewollten Fügungen, in Adjektiven wie „schlafschnurrgeschwisterlich“, „augenblicklieb“ oder „immerfremd“, in Substantiven wie „Schneehoffnung“, „Sturzackerzeit“ oder „Greisbettliegen“. Zunehmend wirkt das „Ankommland“ auch in die Texte hinein. In vielen Gedichten gibt es finnische Einsprengsel, die im Anhang erläutert werden, aber auch ganze Sequenzen, die unübersetzt bleiben. Auf den des Finnischen unkundigen Leser wirken sie wie Zaubersprüche: „kellojenkieli kilisee helisee / kilkatus kimallus / Glas lasi lasienäänet.“
Das sind die Glasstimmen, die der Titel meint. Sie sind aber nicht auf bloßen Klang aus, auf keine Artistik oder absolute Poesie. Im Gegenteil. Dorothea Grünzweig hat einen fast religiösen Begriff von Sprache und Namengebung und glaubt:
die wahrhaften Namen stammen aus der Dingmitte
ja sie waren vor den Dingen da
die um sie wuchsen.
Das ist ein Stück Erbe, das Erbe des schwäbischen Pfarrhauses, dem sie entstammt. Zu ihm gehört auch die Erinnerung an den Vater. Er erscheint als jemand, der erkannte, „was geschehen war / mit dem Volk seines Gotts“, und der darum „Verbrennungen im Innern“ erlitten habe. Daher scheint die „Schneebedürftigkeit“ der Tochter zu rühren, also wohl auch die Wahl ihres Exils.
Grünzweigs finnische Existenz ist nicht ohne ein Element von Zeitkritik, das den biographischen Bezug transzendiert. In einigen ihrer Gedichte erreicht das eine apokalyptische Dimension: Die Zeitangst wird zur Weltangst. „Es ist ein Sterben angebrochen“, beginnt eines der Gedichte, das immer wieder zu der Vorstellung zurückkehrt, der klein gewordene Erdball könne dem „Druck der Menschenschwere“ nicht mehr standhalten. Nicht von ungefähr erinnert dieser Ton an das wundersam-traurige Gedicht der Else Lasker-Schüler, das anhebt: „Es ist ein Weinen in der Welt, / als ob der liebe Gott gestorben wär.“ Es spricht sehr für Dorothea Grünzweigs Gedichte, daß man sie in einen solchen Zusammenhang stellen darf.
Harald Hartung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.1.2005
Schutzzusprechung durch Poesie
− Textgalerie Dorothea Grünzweig. −
Unser ironisches Zeitalter hat jede romantische Regung und jeden höheren Auftrag an die Dichtkunst unter Ideologieverdacht gestellt. Wer am Glauben auf eine „Zuschirmung durch Worte“ festhält, der wird als naiver Spätling der deutschen Kunstreligion belächelt. „Wer heute als Heinrich von Ofterdingen erwacht“, so pointierte schon Walter Benjamin, „muss verschlafen haben“.
Die Dichterin Dorothea Grünzweig hat sich das allerorten brüchig gewordene Vertrauen in die „wärmenden“ Worte der Dichtung bewahrt. 1952 in der schwäbischen Provinz bei Stuttgart geboren, wuchs die Autorin in einem protestantischen Pfarrhaus auf – und knüpft nun in Gestus und Motivik an jene pietistische Gefühlskultur der Empfindsamkeit an, der wir die großen Werke der romantischen Schule verdanken. Seit 1989 lebt Dorothea Grünzweig in Finnland und flicht dort als „Bürgerin zweier Sprachwelten“ an einer naturmagischen Textur, in der finnische und deutsche Sprachoffenbarungen eine innige Symbiose eingehen. Seit 1997 hat die Autorin drei Gedichtbände vorgelegt – aber noch nie ist sie ihrem Traum eines „magischen Singens“ so nahe gekommen wie in ihrem Gedichtbuch Glasstimmen lasinäänet („lasinäänet“ ist die finnische Vokabel für „Glasstimmen“).
In sieben großen Kapiteln wird in diesem Band „das Singen in Klanglust und Bilderrede“ erprobt. Dass es sich dabei um ein zutiefst romantisches Projekt handelt, erschließt sich auch aus dem zeitgleich erschienenen Essay Die Holde der Sprache (Edition Ulrich Keicher), in dem die Dichterin ihr Nomadisieren zwischen zwei Sprachlandschaften als sprachmystisches Erweckungserlebnis beschreibt. Die Begegnung mit den „bergenden Wörtern“ des Finnischen weckt die romantische Sehnsucht nach einer paradiesischen Ur-Sprache. Wie im vorliegenden Gedicht kehrt Grünzweig auch im Essay zu den Wurzeln ihrer Kindheit im protestantischem Pfarrhaus zurück, in dem die Ehrfurcht gebietende Sprache des Vaters, des mächtigen Pastors, die unbezweifelbare Sprache des Göttlichen war. Die intime Nähe dieser Poesie zum Gesang hat ihren biographischen Ursprung im ritualisierten Singen der Pastorenkinder nach dem Gesangbuch, im täglichen Repetieren der Choräle.
Die Erinnerung des Gedicht-Ichs an die „Vaterliebe“ bleibt im Gedicht zwiespältig. Zunächst wird sie schroff negiert, um sie gleich darauf wieder ehrfürchtig zu beschwören. Denn der als unfehlbarer „Wortausrichter“ in strenger Definitionsmacht über die Welt gebietende Vater vermittelt auch die Sehnsucht nach intimer mystischer Nähe zu den Buchstaben. Die Poesie als Obdach und Rettung, die uns „Schutzzusprechung“ gewährt – man muss vermutlich an der europäischen Peripherie leben, um diese poetische Confessio noch formulieren zu können. Wir aber dürfen es einen Glücksfall nennen, dass es noch Gedichte wie die von Grünzweig gibt, die uns – wie es ihr Essay andeutet – am „Nachglühen des Gartens Eden“ teilhaben lassen.
Michael Braun, der Freitag, 11.3.2005
Lagebesprechung (17)
Frostbrand, oder Schneedecke… – da, wo es in den Wintern wirklich kalt wird, östlicher, nördlicher in Europa, scheinen die Wörter für Wärme und Kälte leicht zusammenzufallen, nachvollziehbare Oxymora, die sich der Erfahrung wie von selbst aufdrängen, und doch kann es in diesen beinahe schlichten Fügungen viel tiefer hinabgehen, als die Wetterberichtsrekorde ahnen lassen:
Die Suche nach Schnee
ist aus dem Feuer geboren
aus dem Versengen
aus Schuldangst Schmerz
aus Flammen lodernd in Erzählungssplittern
aus jenem Gasgeruch in
Kindheitswinkeln
Man muß Dorothea Grünzweigs Gedichte nicht im Winter lesen, im Gegenteil, rufen doch ihre finnischen Stimmbilder ebensooft die Helligkeit des Mittsommers auf, „Johannisfeuer in lichtweiten Wäldern, … es kann nicht wahr nie mehr die Nacht / geben eine Platte / im Jahrumdrehen auf uns herabsinkend / uns zu begraben in Atemkapseln“ –, und tatsächlich dachte ich nicht an Kälte, Melancholie, Erstarrung, als ich diese Gedichte für die „Lagebesprechung“ aussuchte, ich hatte viel stärker ihren hymnischen, sanglichen Ton im Sinn als diesen Schnee- und Kindheitsklang, der mir beim Schreiben jetzt (kürzeste Tage, sibirischer Wind…) so nahekommt – auch der Schnee- und Kindheitsklang im übrigen ein hymnischer, sanglicher Klang, der aus den freien Metren entsteht, geschult an den schwingenden Versen eines „hohen Tons“, wie er sich im Deutschen in der Nachfolge Klopstocks und Hölderlins finden läßt –
Sind das nun „junge“ Gedichte? Es sind wunderbare, interessante Gedichte, aber „jung“? – In welchem Sinne müßten sie das überhaupt sein, damit ich sie hier in der „Lagebesprechung“ vorstellen kann? Die Rubrik trägt den Obertitel „Junge deutschsprachige Lyrik“, was sich in meinem Kopf immer unwillkürlich übersetzt hat in „Neue deutschsprachige Lyrik“ – beides nach meinem Verständnis keine Kriterien für Dichtung, weder „jung“ noch „neu“, aber angenommen, die Frage stellte sich tatsächlich: Gibt es so etwas wie eine „Jetzt“-Generation der Lyrik, die sich über das Geburtsjahr definiert? Eine „Jetzt“-Altersspanne, die möglichst nicht über die Mitte der Dreißig hinausreicht? Ohne daß es dabei allein um finstere Interessenpolitik ginge, um den Ellenbogenkampf um die rare Ressource „Aufmerksamkeit“ von jener Handvoll LeserInnen, die sich überhaupt professionell (als LektorInnen, RezensentInnen, PreisrichterInnen) mit Lyrik befassen?
Das ist keine Frage, die Dorothea Grünzweig beantworten muß. Seit rund zehn Jahren werden ihre Gedichte vom renommierten Wallstein Verlag betreut, sie erscheinen unter angesehenen Adressen und gelten als eigenständige, eben nicht im Umfeld einer bestimmten Generation einzuordnende Poesie. Was sicher auch damit zusammenhängt, daß die Autorin nicht in Deutschland lebt, sondern in Finnland. So daß ihre Gedichte uns zunächst eine ganz andere Frage stellen, nämlich die, was in einer Gedichtsprache geschieht, wenn die alltägliche Sprache, das tägliche Handeln, Denken, Träumen ausgewandert ist in eine Zweitsprache –
In gewisser Weise sprechen Gedichte natürlich immer eine „Zweitsprache“ – es kann jene von der Allerweltssprache verschiedene Sprache sein, die Dorothea Grünzweig in ihrem Essay als heilige Sprache definiert, aber es gibt in der Geschichte der Poesie ein breites Spektrum von Abweichungen und Fokussierungen, aus denen sich der Abstand zur Alltagssprache herzuleiten vermag. Wobei „Abstand“ eine äußerst bewegliche Größe bleibt, ein Feld fließender Übergänge zwischen vertrautem und unvertrautem Gebrauch. So, wie eben auch das Eintauchen in eine Fremdsprache das gewohnte Sprechen auf vielfältige Weise verändert, weil sich die Grenzen des Verstehens und Verstandenwerdens verändern –
Eine Verunsicherung, die paradoxerweise das Vertrauen in die eigene Sprache steigern kann – nicht, weil es eine 1:1-Übersetzung zwischen den Sprachen gäbe (das Finnische gehört zur finno-ugrischen Sprachgruppe, die sich vom Deutschen und seinen indoeuropäischen Nachbarsprachen stark unterscheidet), sondern weil Dorothea Grünzweig sich in einer anderen Lebenswelt bewegt, in der sie Landschaft, Geschichte, Gesellschaft anders erfährt als in der Herkunftssprache, in der sie schreibt. Vielleicht ist der lebensweltliche Unterschied für sie sogar wichtiger als der in den Sprachen. Denn in diesen Gedichten gibt es eine gleichzeitig beruhigende und beunruhigende Kindheitsschicht, etwas Dörflich-Protestantisches, das auf seltsam „unzeitgemäße“ Anmutungen zurückgreift, ein geschlosseneres Weltbild als die gesamteuropäische, globalisierte Gegenwart, die uns (vornehmlich als Medienphänomen) heute allenthalben selbstverständlich erscheint. Auch Finnland ist selbstredend von dieser Gegenwart nicht ausgenommen, wie überhaupt die Gegenwart (ihre Verkehrsmittel, ihre Kommunikationstechnik, ihr Informationspotential) in den Gedichten nicht im geringsten ausgeblendet wird. Aber es scheint, als befreie Dorothea Grünzweig die Auseinandersetzung mit ihrem deutschen Kindheitswinkel durch die poetische Übertragung in Schnee und Mittsommer von den allzu deutschen Schrecken, die heute nur noch als bloße Stereotype wahrgenommen werden – jenem für die in den Fünfzigern des letzten Jahrhunderts Geborenen noch so deutlich wahrnehmbaren Gasgeruch –
Verläuft also hier, in dieser unfreiwillig-persönlichen Nähe oder Ferne zu den deutschen Jahrhundertverbrechen, die eigentliche Grenze zur „Jetzt“-Generation? Oder andersherum: Wieviel Gewicht hat dagegen die Widerspiegelung einer Eigenzeit in der Poesie, deren Ausdehnung in Geographie und Geschichte, in Wahlverwandtschaften, Sprachwelten. Hybridformen den DichterInnen selbst überlassen ist? – Wie gesagt, das ist keine Frage, die Dorothea Grünzweig beantworten muß. Aber ohne sie erschiene mir, was deutschsprachige Dichtung heute versucht, unvollständig,
Brigitte Oleschinski, Ostragehege, Heft 41, 2006
Winterinland
– Laudatio auf Dorothea Grünzweig zur Verleihung des Anke-Bennholdt-Thomsen-Preises am 26.10.2010 in Weimar. –
Mir ist der Winter eingegeben
erst wenn die letzte Schweigezeit
vorüber ist wird sich das ändern
das Frostgestirn und die erstarrten Seen
Bäume gekrallt ins Himmelsfleisch und
Schneegeschneckel stummen Wilds in
weißen Wäldern um die
die Nacht sich schließt und
was das Festland aufsucht übers Meer
kommt’s her als brennendkaltes
sturmgetriebnes Eis wer weiß seit
wann ich dieses Winterinland habe
(aus: Dorothea Grünzweig, Vom Eisgebreit, „Thema in Polar-Dur“)
Aus Finnland reiste sie an, die Dichterin deutscher Sprache, die wir heute in Weimar auszeichnen. Was trieb Dorothea Grünzweig, die 1952 in Korntal bei Stuttgart Geborene dorthin, in ein Land, das wir mit Kälte, Schnee und langer Dunkelheit, kurzer schlafloser Mittsommernachtshelligkeit, tiefen Wäldern, Osten, Karelien und großer Einsamkeit assoziieren? Finnland mit seiner langen Grenze zu Rußland, seit fünfzehn Jahren Mitglied der Europäischen Union und mit derselben Währung ausgestattet wie wir. Oder sollten wir besser fragen, was zog Dorothea Grünzweig 1989, im deutschen Schicksalsjahr, nach Helsinki und ins südliche Finnland, und warum ist sie noch immer dort? Die Frage stellt sich um so mehr, als man den Dichtern nachsagt, sie könnten im fremden Sprachraum in der eigenen – der „Mutter- und Vatersprache“, wie Dorothea Grünzweig sie nennt – nicht überleben.
Ein Blick in die jüngste Literaturgeschichte zeigt, daß es noch andere Dichter gab, die nach 1945 freiwillig das heimische Sprachland verließen. Ingeborg Bachmann, die 1965 nach Rom ging, dort aber kaum noch Gedichte schrieb, Paul Celan, der aus Czernowitz über Wien kommend weiterzog nach Paris, Wolfgang Bächler, der den nachkriegsdeutschen Literaturbetrieb ebenfalls gegen Paris eintauschte, jedoch später nach München zurückkehrte, Christine Koschel, die seit 1965 in Rom Gedichte schreibt, Helga M. Novak, die aus persönlichen Gründen Island wählte, später das ehemalige Jugoslawien und Polen. Oder W.G. Sebald, der England zu seinem Lebenszentrum machte und dort zu einem deutschen Schriftsteller wurde. Alle Genannten gehören der Generation vor Dorothea Grünzweig an. Sie waren Zeitzeugen oder Betroffene von Krieg und Shoa und mußten der Sprachlosigkeit, der Schuld, der für sie manchmal nur schwer nachvollziehbaren Wiederherstellung deutscher Normalität entkommen. Auch Manfred Peter Hein, der schon seit 1958 in Finnland lebende Dichter, gehört dieser Generation an. Sein Herkunftsland, das deutsche Ostpreußen, ist eine verlorengegangene Welt, die er nur noch in der Erinnerung aufsuchen kann.
Diese Dichter folgten gewissermaßen jenen, die, um zu überleben und weiterschreiben zu können, gezwungen waren, ins fremdsprachige Exil zu gehen, und die oft unter großen Entbehrungen für die Bewahrung ihrer Sprache einstanden. Nicht unterschlagen möchte ich die aus der DDR stammenden Exilanten, die in die Bundesrepublik flüchteten. Doch bleibt zu bedenken, was einer der Betroffenen, Hans Joachim Schädlich, einmal sagte: er wolle sich nicht mit den ins Exil genötigten Schriftstellern der Nazizeit vergleichen, denn er habe niemals die Sprache wechseln müssen und sei in der Bundesrepublik wohlwollend aufgenommen worden.
Handelt es sich also um eine Art freiwilliges Exil, das Dorothea Grünzweig in Finnland auf sich genommen hat? Und was bewegte sie, so ganz allein in dieses Winterland zu gehen? Die Antwort liegt nahe, daß sich Dorothea Grünzweigs dichterisches Werk diesem Fortgehen zu verdanken hat. Finnland wurde zum „findland“ im Gedicht – zum „findland“ der Sprache. Durch den Klang und den Gebrauch der fremden Sprache verlor sie nicht die Mutter- und Vatersprache, sondern erschuf sie sich neu. Im „Winterland“ konnte sie unbefangen ins Buch der Natur schauen. In Finnland fand sie ihre Bilder.
Ich lernte Dorothea Grünzweig vor zehn Jahren in der Villa Waldberta kennen, dem Künstlerhaus Münchens am Starnberger See, mit dessen Leitung ich damals beauftragt war. Sie hatte gerade Vom Eisgebreit, ihren zweiten Gedichtband, veröffentlicht. „Einen Herbst lang / trafen sie in dem Haus das sie hergeholt hatte / täglich zusammen / um ihr Alleinsein miteinander zu teilen“, las ich später in der der Villa gewidmeten Gedichtfolge „Der Fund“. Für uns, die wir dort zusammenkamen, war sie die „unerklärliche“ Lyrikerin aus Finnland, unerklärlich wegen der aus freien Stücken getroffenen Wahl, in einem Land zu leben, das uns so fern und fremd erschien. Dorothea „mit ihrer ruhigen, genauen Interessiertheit, die jeden erzählen macht“, wie der Literaturkritiker Andreas Nentwich, der sich gleichzeitig mit ihr in der Villa aufhielt, später in der Neuen Zürcher Zeitung über sie schrieb, und die, das steht zwischen den Zeilen, von sich selbst nicht so leicht etwas preisgibt. Ihr vielsagendes Schweigen über sich selbst schien uns eine direkte Aufforderung zu sein, ihr Werk, ihre Gedichte, zu lesen. Darin steht alles geschrieben, sagten wir uns. Dort fänden sich die Deutung und die Antwort auf unsere Fragen. Doch wie konnten wir unseren Deutungen vertrauen? Hatten wir ein Recht, sie den Gedichten zu entreißen? Vielleicht kennen einige von Ihnen den Vortrag „Blaue Orangen“ von Franz Wurm, dem letzten Prager Dichter deutscher Sprache, der vor kurzem, unbemerkt vom deutschen Feuilleton, in Ascona starb. Der Autor fragt sich, auf welche Weise Gedichte zu verstehen sind, und ruft aus:
Die Deuter, ach die Deuter. Sie haben so eine Art, ein Textgewebe in ihre Maschen zu verhäkeln.
Für ihn ist „Dichten eine Art Übersetzen des Sprachlosen in Worte, die lesend (oder hörend) man seinerseits ins Verstehen übersetzt; ein Versuch, durch Worte zu sagen, was sich mit Wörtern nicht sagen läßt.“ Wie aber dann die Leseerfahrung in Worte fassen? Die meisten Dichter, sagt Franz Wurm, „nehmen Deutungen, die ihren Arbeiten widerfahren, als Aufmerksamkeiten hin, so lange sie den Text nicht verfälschen… Sie möchten ja gelesen werden.“
Begeben wir uns also auf den Weg der Auslegung. Und vergessen wir nicht: so wie Übersetzungen zu Nachfolgeübersetzungen führen, führen Auslegungen zu Nachfolgeauslegungen. Es könnte also auch alles ganz anders sein, als ich es hier sage.
Was Sie zu Anfang hörten, waren die ersten beiden Strophen des Gedichts „Thema in Polar-Dur“ aus Vom Eisgebreit. Polar-Dur, nicht Polar-Moll. Denn der Winter ist der hier Schreibenden wie eingegeben:
wer weiß seit wann ich dieses Winterinland habe
Der Winter entlockt ihr Jubel, und mit ihr nehmen wir Abschied von der Vorstellung, Winter, Schnee und Eis seien Metaphern für Tod und Ende.
es fiel mir zu
dies Land am Rand der Welt
das fruchtbar ist
sich mehrt und Kälte
gebärt Schnee
heißt es in dem Zyklus „Sieben Variationen über den Schnee“, zu lesen im Band Glasstimmen lasinäänet von 2004. Schöpferisch ist hier der Winter – wie in unserer Vorstellung sonst nur der Frühling, der Wärme und Regen bringt.
Es ist etwas von Kindheit darin, als man juchzte über den Schnee, der die dunkle, düstere Welt draußen veränderte. Endlich geschah etwas, war über Nacht alles anders geworden. Für Dorothea Grünzweig „sind Herden / meine Wörter zu ihm aufgetrieben / durch seine Weiße seh ich sie / hör ihre Stimmen“. Diese sieben Variationen sind eine Apotheose des Schnees, der dem Dichter-Ich „das Sehen der Wörter geschenkt / die Blindheit weggemerzt“ hat, und sie sind ein einziger Lobgesang auf das „Ankommland“, wo „das Schauen“ begann.
Das „erstland“, wie es in einem späteren Zyklus genannt wird, ist Deutschland, manchmal wird es nur als kleines oder großes „D“ in die Verse geworfen:
Ich bin eine D
D wie Deutschland
(„Vom Eis befreit“).
Näher betrachtet ist das Erstland der Ort Korntal bei Stuttgart, wo sie in die Liebe zum Wort und in die Furcht vor dem Wort gewissermaßen hineingeboren wurde. Der Vater war pietistischer Pfarrer und ganz erfüllt von seiner Aufgabe:
Vater
Wortausrichter Mann aus
Wort
(„Glasstimmen“).
Wir begegnen ihm in vielen Gedichten, fangen an, ihn zu kennen, wiederzuerkennen, auch sein Tod wird verzeichnet. Die Vorherrschaft des Wortes, in dem auch alles Sinnliche aufzugehen hat, muß für das Kind gewaltig gewesen sein, zugleich war sie von prägender Kraft für die werdende Schriftstellerin. In ihrem Essay „Die Holde der Sprache“ (2004) wird sie die Sprache des Vaters und der Brüder – es sind die pietistischen Brüder gemeint – als „heilige Sprache“ bezeichnen. Ihr wird das finnische Wort „vuori“ zugesprochen, das zugleich „der Berg“ und „das Kleiderfutter“ bedeutet. Denn die vuori-Sprache, diese heilige Sprache der Kindheit, ist wie eine „inwendige Landschaft“, wie eine Gebirgs- und Gletscherlandschaft ausgekleidet. Über die Vaterliebe schreibt die spätere Dichterin, „daß / diese Lieb auch heut noch in / den Worten bis / zum Buchstab und den / Buchstabszwischenräumen wohnt („Glasstimmen“).
Vielleicht gibt es noch etwas, das für eine nach der Sprache Suchende überwältigend ist. Das literarische Erbe nämlich, die Umgebung der großen poetischen Wortvergangenheit. Korntal liegt in der schwäbischen Dichterlandschaft. Alle sind sie hier präsent, Schiller, gebürtig aus Marbach, Schelling, aus dem benachbarten Leonberg, wo auch Christian Wagner herkommt, Mörike, Uhland, Hauff, reden wir nicht von Hegel. Und erst Hölderlin, was für eine Nähe! Er kommt später mit ins Reisegepäck. „hölderlins heimatgesänge dabei / wie war er zur heimat wonne- und elendsgehörig / durch sein geleit ist es mir sehr und auch gar nicht / nach deutschland zumute“ heißt es in „journal in mai- und vogelfühlung“, einem langen, an slawische Dichtung erinnernden Poem (ich denke an den tschechischen Dichter Vladimír Holan) aus Grünzweigs letztem Gedichtband Die Auflösung. Hier steht auch geschrieben, daß sie dem Vater wünscht, er wäre einmal nach Finnland gekommen, „einmal den kopf hinaushängen / aus der deutschen geschichte / einmal reden auf an nichts gebundene weise / mit dem heute dafür wachen kind“. In diesem langen Gedicht, einer Reise „im zugschiff nach süden“, finden wir alles, was diese Schreibende aus D. bewegt, nämlich immer wieder die Bedrückung durch die Geschichte des Herkunftslandes:
das gruppenschweigen preßt den atem flach
… wir nachgeborenen angebändelt
an die zugrunde liegende
die über allem schwebende geschichte
Wir erkennen das Hin-und-Hergerissensein zwischen der Liebe zum „findland“ und zum Gefährten „vjell“ – dem seit vielen Gedichten uns schon Vertrauten, der der Schreibenden immer die Hand aus der anderen, der finnischen Welt reicht –, und der Notwendigkeit des Aufbruchs nach D:
Immer wieder will ich in das erstland reisen
mich zugschiffen einverleiben
von den zugvögeln hinreißen
die erinnerung stampfen lassen
kopfspringen in meine in die deutsche geschichte
Und die sogleich ausbrechende Sehnsucht nach dem, was sie zurückläßt, kaum hat das Schiff den Hafen verlassen:
heimweh nach vjell und heimweh das strahlt
in alle richtungen
Dorothea Grünzweigs Gedichte sind narrativ, sie leben von Bewegung, von Rhythmus und manchmal euphorischen Wortschöpfungen. Manches verstehen wir – nicht gleich, doch dann plötzlich, beim vierten, beim fünften Lesen. Wiederholung ist ein von ihr gepriesener Vorgang. „Bei unserem Umgang mit der poetischen Sprache erwachen alle unsere Sinne“, sagt sie in „Die Holde der Sprache“, einem Text, den sie uns als Leitfaden der Deutung mitgibt, und der zugleich ein Beispiel ihrer essayistischen Kunst ist.
Sie geriet, als sie in die Fremde ging, nicht ins Verstummen. Im Gegenteil, der „verschlossene Mund“ öffnete sich, im „Stiefland, Ankommland, findland“, in dieser nicht von unheilvoller Geschichte, nicht von einer „zweiten Natur“, die die Liebe mit Scham paart, gequälten neuen Umgebung.
Auf den Plan trat ein Land mit seiner Sprache. Mit dem Finnischen ist es mir beigesprungen.
(„Die Holde der Sprache“)
Die Begegnung mit der gänzlich anderen Sprache. die kaum Verwandte auf Erden hat, ließ Dorothea Grünzweig zu einer Neusprache finden, „die mehr ist als eine Schulsprache. Und mehr als eine Gebrauchssprache. Neusprache als Entlastungssprache.“ Hier liegt das Geheimnis ihrer dichterischen Produktivität:
Die eigene Sprache, die Mutter- und Vatersprache, die man vielleicht gar nicht beachtet und geachtet hat, die einem wirkungslos und ausgelaugt schien, die einen einschnürte und angriff, wird zu gegebener Zeit – und allein unter diesen Bedingungen des Fremdgehens – zu einem kostbaren Gelände. Zu einem Gelände der Heimkehr auf regelmäßig sich zutragenden Durchreisen.
Und sie geht noch weiter: daß wir nämlich mit dem Sprechen einer anderen Sprache neue Möglichkeiten erfahren, der Welt zu begegnen. Ganz und gar sprachwissenschaftlich, nicht etwa psychologisch, stellt sie in ihrem Essay dar, wie man sich durch die „Einverleibung“ – das ist ihr Wort – der finnischen Sprache verändert, sich in seiner von der Erstsprache, dem Deutschen, geprägten Art abmildert, „zum Beispiel im Trieb, einzuteilen“. Und schon fühlt man sich ertappt und sehnt sich nach dem Finnischen.
Dabei hatte Dorothea Grünzweig schon einmal ihr Herkunftsland verlassen. Nach dem Studium der Germanistik und Anglistik in Tübingen ging sie mit einem Forschungsstipendium nach Oxford, damals noch in der Vorstellung, eine Doktorarbeit über den sie seitdem nicht mehr loslassenden viktorianischen Dichter Gerard Manley Hopkins zu schreiben. Sie entschied sich gegen eine akademische Laufbahn, sah darin nicht ihren Weg. Wir dürfen vermuten, daß die Auseinandersetzung mit dem englischen Dichter eine Art Initiation war für ihr eigenes lyrischen Schreiben. Sie dankte es ihm mit einer umfassenden, verblüffend eigenständigen, gleichzeitig dem Original innig verwandten Neuübersetzung seines als unübersetzbar geltenden Werks. Diese sich über viele Jahre erstreckende Arbeit erschien im vergangenen Jahr als zweisprachige Ausgabe, mit Kommentaren und erläuternden Texten der Übersetzerin, unter dem Titel Geliebtes Kind der Sprache in der Edition Rugerup, einem in Schweden ansässigen deutsch- und englischsprachigen Verlag. Die Wendung Geliebtes Kind der Sprache findet sich schon als Motto ihres Gedichtbandes Die Auflösung von 2008. Nicht der Dichter ist mit dieser Zeile aus einem Brief Hopkins gemeint, sondern die Poesie selbst:
poetry, the darling child of speech
Dieser Titel könnte über Grünzweigs gesamtem Werk stehen, zu dem auch Übersetzungen zeitgenössischer finnischer Dichter gehören. Wir wissen, daß Gastfreundschaft in der eigenen Sprache, wie George Steiner einmal sagte, Tradition unter Dichtern ist, und wir sind glücklich, daß sie fortdauert.
Als Dorothea Grünzweig von Zuhause aufbrach, suchte sie, so deute ich es, nach dem Land und Sprachland, das sie zum Reden bringen könnte, das ihren Sehsinn, dem Dichter Hopkins der wichtigste, beflügeln und das Schauen der Wörter, der Bilder hervorbringen würde. „In Bildern besteht der ganze Schatz menschlicher Erkenntnis und Glückseligkeit“, zitiert sie in „Die Holde der Sprache“ Johann Georg Hamanns Aesthetica in nuce von 1762. Hamann, jener Magus im Norden, der mit Herder befreundet war, Goethe faszinierte und etliche Romantiker beeinflußte. Während ihrer Suche war sie eine Zeitlang in Schottland – auch hier schon der kalte, wegen seiner Schönheit besungene Norden –, wo sie an der Universität Dundee lehrte. Dann ging sie noch einmal nach „D“ und fand, wieder über das Unterrichten, schließlich den Weg nach Helsinki.
Ankunft 1989. „Ich sage ich bleibe für immer / und grabe im Park meine Kiste ein / gepackt mit den Hufen zur Flucht“ („Mittsommerschnitt“), so der Anfang eines frühen Gedichts. Jetzt beginnt das Reisen, das immer wieder Neuaufnehmen des zurückgelegten Weges. Die Achse Korntal-Helsinki und zurück, auf der sie reisen wird und bis heute reist. Als 1997 ihr erster Gedichtband Mittsommerschnitt bei Wallstein in Göttingen erscheint, ist sie fünfundvierzig Jahre alt. Keine Anfängerin. Wir wissen nichts von früheren Gedichten. Hoffen wir, daß sie sie nicht verbrannt hat, wie Hopkins es mit seinen Jugendgedichten tat, als er zum Katholizismus konvertierte und in den Jesuitenorden eintrat. „In vorauseilendem Gehorsam“, mutmaßte Dorothea Grünzweig einmal.
In „Mittsommerschnitt“, der Titel sagt es, hat sie durch die Begegnung mit dem Anderen, mit der Fremde und der Fremdsprache zu ihrer poetischen Diktion gefunden. Von Anbeginn an finden wir hier die Schöpfung eigener Wörter, neuer, nie gesehener Bilder. „Da ich mich fort aus dem Eisreich mach“, beginnt das Gedicht „Vor Einer Winterreise (oder In der Schwebe)“, gefolgt beinahe von einem Beschwören:
Ich kehr zurück
Hab mir den Schlafsaum hochgenäht
die tüchtige Taghaut übergestreift
und laß das Deutschweh
an mich heran.
Mit den Jahren ändert sich die Gewichtung. Nicht daß sie das Reisen aufgegeben hätte, sie, und mit ihr das lyrische Ich. Nicht daß es keine Überwindung mehr wäre:
leicht stößt uns schmerz und verletzung zu
gehen wir auf reisen
reisen zu unseren früheren zeiten
(„Die Auflösung“).
Das Herkunftsland, „erstland“, wird immer mehr zum Abschiedsland; „hyvästi haus“ (Abschiedshaus) ist ein Kapitel in Die Auflösung überschrieben, von einer Rückkehr ins Elternhaus, der Lösung von der Mutter, der Auflösung der väterlichen Bibliothek erzählen die darin enthaltenen Gedichte. Bruder und Schwester rücken ins Licht. Die Herkunftswelt löst sich in Sprache auf – Auflösung bedeutet nicht nur Verschwinden und Verlust, sondern auch die Lösung einer Aufgabe – während das „findland“ mit seiner Sprache in die deutschen Gedichte immer öfter und mit immer größerer Selbstverständlichkeit vordringt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Dorothea Grünzweig in ihrem jüngsten Gedichtband zur durchgängigen Kleinschreibung, wie sie im Finnischen üblich ist, überging, während sie bis dahin die Groß- und Kleinschreibung beachtete. Die finnischen Wörter und Worte häufen sich nun. Doch die scheinbar entgegengesetzten Sprachen verstehen sich in dieser Lyrik. Wir stolpern nicht über die fremden, so gänzlich unbekannten Wörter. Wir staunen sie an wie Wunder, die sich in die Sätze einfügen, ihren Platz gefunden haben, dort, wo sie offensichtlich hingehören.
Wir begreifen auch, daß das Reisen nicht enden wird, sie wird weiter unterwegs sein. Wir können noch viel erwarten, denn die Quelle scheint nun unerschöpflich. Es gibt zudem eine „kleine Achse“ – so will ich sie hier nennen – auf der die Dichterin ständig unterwegs ist. Zwischen dem Weiler, eine Stunde von Helsinki entfernt, wo sie lebt mit vjell und der Natur, und der Metropole, wo sie ein Pied-à-terre hat und dazu die Deutsche Bibliothek am Kasarmitori, im Herzen der Stadt. Dies ist ein Stück Heimat, hier kann sie die deutsche Sprache, wann immer sie will, aufsuchen. Ich hatte das Glück, die Bibliothek im vorigen Jahr kennenzulernen. Ich hörte, daß sie durch einen deutschen Lesekreis im neunzehnten Jahrhundert entstanden ist und all die Jahrzehnte und all die Kriege überdauerte, wenngleich sie mehrfach umziehen mußte. Sie ist ein Ort, den man mit Staunen betritt. Deutschsprachige Bücher überall, den ganzen Oskar Maria Graf sah ich dort, viel zeitgenössische Literatur und einen Leseraum, der zum Bleiben einlädt. Ich kann mir vorstellen, daß Dorothea Grünzweig hier manchmal sitzt und in der deutschen Sprache regelrecht badet.
Verena Nolte, Sinn und Form, Heft 5, September/Oktober 2011
Im Dachzimmer Europas
– Dankrede zum Anke-Bennholdt-Thomsen-Preis gehalten am 26.10.2010 in Weimar. –
Ich bin eine Spätberufene. Und ich lebe nicht in Deutschland. Lebe in Finnland, das zu dieser Jahreszeit schon seine erste Schneedecke empfängt. Beide Tatsachen lösen bei mir den Wunsch aus, etwas dazu zu sagen – und darüber, wie ich zum Schreiben kam.
In meiner Kindheit in einem pietistischen schwäbischen Pfarrhaus wohnte ich, bis ich dreizehn war, in einem Durchgangszimmer. Man hatte nicht viel Platz, mußte sparen. Das schien den Eltern ganz natürlich. Sie stammten aus ärmeren Verhältnissen. Wir gehörten nicht zu einer seit Generationen bestehenden Pfarrerdynastie.
Mein Vater kam von einem Kleinbauernhof der Schwäbischen Alb. Er war vor dem Krieg Notar gewesen. Sein Entsetzen über die Geschehnisse im Dritten Reich und seine Fronterlebnisse bewogen ihn dazu, umzusatteln. Er habe einen Ruf gehört, sagte er. Sein Entsetzen schlug auch Wurzeln in uns Kindern.
Mein Zimmer hatte drei Türen. Dort zogen nicht nur Vater, Mutter und Geschwister durch – auch bei uns einquartierte Sorgenkinder aus den Kinderheimen der Gemeinde, dazu häufiger Besuch: Einsame und Gestrandete, Mitarbeiterinnen des Pfarrbüros, Gemeindeälteste und Kollegen des Vaters.
Es war ein menschenhingeneigtes, menschenoffenes Leben. Offen gelegt. Bescherte einen einsehbaren Durchgangszimmerkopf.
Die inwendige Welt versuchte zu erstarken. Ich las mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Sang und sprach mit den Tieren und Dingen um mich herum. Gab ihnen Namen.
Mit dreizehn dann die Veränderung: Ich durfte nach oben ziehen. In die Dachstockwohnung, wo ein Geschwistertrio lebte. Musiker. Der Musik hingegeben. Bei ihnen erhielt ich eine Kammer. Und damit ein eigenes Oberstübchen. Ein Leibstübchen. Wenn sie auch immer noch zugig waren.
Die Sprache, ihre Wörter machten mir eine Gänsehaut. Die kernige der Ulmer Mutter und vor allem die Amtssprache des Vaters. Von anderer Welt. Die poetische Sprache der Psalmen zum Beispiel, der alten Choräle – der Mittelpunkt unseres Alltags. Das gewichtige Wort – das Wort – war beim Vater. Und das Wort des Vaters war bei seinem Vater, der ihm Vollmacht schenkte.
In der Dachkammer fuhr ich fort, die Reimgedichte zu schreiben, zu denen man mich ermutigt hatte. Themen – vorgeschlagen, erwartet. Aber oben besaß ich, zusätzlich zu meiner Geige, jetzt eine Gitarre. Mit ihr verfaßte ich „Songs“, so hieß ich sie. Den Songs wuchsen Texte, die mich überraschten. Nicht harmlos wie die anderen: Ich zeigte sie niemandem.
Zu Weihnachten erhielt ich ein Buch, worin die gezeigten Gedichte für mich sauber abgeschrieben und geordnet waren. Durch führende Hand gegangen, besetzt.
Ich erschrak. Hörte auf mit dem Schreiben. Auch von den Songs, die an die Gelegenheitsgedichte angelagert waren, ließ ich allmählich ab. Doch feste Traumschilde wuchsen.
Längst war abgemacht: Als Mädchen ergreife ich einen Beruf mit Menschen: etwas Soziales, Lehrerin.
Mein „Kindheitshaus“, wie die Finnen sagen, war ein vom „weltlichen“ Außen abgesetztes Universum, das aber mit seinesgleichen im Land vernetzt war. Abgesetzt. Und doch auch nicht.
Zeitgeschehen war gegenwärtig, die Freuden und Leiden der Menschen – aller Lebewesen. Die Fürbitten, das Fürbeten, schickte uns um den ganzen Erdball.
Es trug auch den Namen Drandenken – Drodenka.
Nur die Kunst traf auf Argwohn.
Die große Schwester steckte mir eines Tages ein Buch zu: Gedichte und Prosa der Romantik. Es stammte von ihrem ersten Freund. Der gehörte in einem der evangelischen Seminare, die auch einst Hölderlin besucht hatte, zu einer Art dead poets’ society, die auf dem Kloster-Dachboden nachts ,Séancen‘ abhielt. Das Buch, und seine Aura, elektrisierten mich, schalteten mich dazu. Ich traf in den Texten auf ein meiner Kindheitswelt nicht fernstehendes Empfinden. Aber dort gab es die erotische Liebe und das erregende Spiel mit den Wörtern.
Und nach dem Abitur dann weg. Nach Tübingen, Großbritannien. Hippie werden. Sich ins Leben werfen, ins Studium, in die Kunst und wieder mitten ins grelle, lärmige Leben. Später Lehrende, Lehrerin. Am liebsten für Literatur. Vor allem Poesie. Im Unterricht, bei meinen Theatergruppen. – Aber auch, das soll hier vor der Schillerstiftung gesagt sein, sehr gerne Schillers Dramen.
Nach sieben Jahren Internat, auch als Erzieherin, kam die mit ganzer Seele erfolgte Hingabe an ihr Ende. Der Wunsch schlug durch: Ich mußte selber die Sprache suchen, die unter der Alltagssprache, der Obersprache liegt. Tiefer – und gleichzeitig höher. Die sinnlich ist, an alle Sinne angeschlossen. Die uns von Kopf bis Fuß durchfährt, von den Dingen kommend und zu ihnen zurückkehrend. Näher beim Wesen der Dinge, schon allein deshalb, weil sie unserem wahren Denken auf die Spur kommt. Durch ihre Bilder, deren wunderliche Läufe. Durch ihr Bloßlegen und ihr Verhüllen. Die Sprache, welche Menschen, Tiere, die ganze Natur – das, wofür wir Verantwortung tragen – in uns leiben und leben läßt. Sie von ihrer Taubheit befreit, bestaunt, bewundert – beklagt und gleichzeitig verschont von forscher Benennung. Die getrennte Dinge zusammenführt und miteinander verschwistert. Die Freude und Grauen auffängt, die Wucht all des von uns Gesehenen und Gehörten. Uns dadurch hält und uns ein wenig hin- und herwiegt, bis wir ruhig werden.
Die Eigensprache, die aber trotzdem nicht wirklich uns gehört. Die musizierende Sprache.
Nachts, in der Internatszeit, versuchte ich Gedichte zu schreiben. Und am Wochenende. Keine verborgene Oberstube. Wohnen im Durchgangszimmer.
In der Leitung plante man mein Bleiben. Ich mußte fort. Weit fort. Wanderte nach Finnland aus. Schlug gleich nach der Ankunft im Helsinkier Hafen ein frohes Bindebrückchen nach Deutschland, nach Württemberg.
Zwischen Wohnung und Schule schob sich ein schmaler Meeresarm.
Ich bin eine Spätberufene. Erst seit vierzehn Jahren besitze ich die Entlassungsurkunde aus dem deutschen Schuldienst. In Finnland ist ein weiter, geschlossen-poröser Raum, fremdelnder Raum: mit seinen Lauten, die die meinen ins Lot bringen, mit seiner Stille darum.
Ich wohne im „Dachzimmer“ Europas. Im „hohen Norden“. Doch in Wirklichkeit bedeutet das Wort Norden „hinunter zum Grund“.
Und ich stelle mir vor, es sei, wo ich wohne, das erämaa, die Wildnis, die Einöde, das wilde Land. Das scheint mir, der Deutschen aus heimeliger Landschaft, gerne so. Erämaa – gehört zu erakko, der Einsiedler. – Die Einsiedelei. Die meine ist eine milde, denn mein finnischer Mann gehört mit dazu.
Erämaa hat ein Synonym. Es heißt sydänmaa – auch Wildnis. Aber wörtlich bedeutet sydänmaa: Kernland, inneres Land. Herzland. Herzgelände.
Gerard Manley Hopkins hat diese Definition gegeben:
Die Poesie ist gehörte Sprache, gebildet zur Kontemplation des Geistes.
Zur Kontemplation. Zur Sammlung. Zur Versenkung, die zum Grund strebt, wo sich alles aufhält und beständig Neues einstürmt, womit wir erst auf diese Weise bedachtsam umgehen können.
Im sydänmaa, im Herzgelände, stellen wir’s der reichen Sprache, ihrer Fassungskraft anheim. Was auch immer sie daraus macht, damit wir mitwirken.
Dorothea Grünzweig, Sinn und Form, Heft 5, September/Oktober 2011
Fakten und Vermutungen zur Autorin
shi 詩 yan 言 kou 口


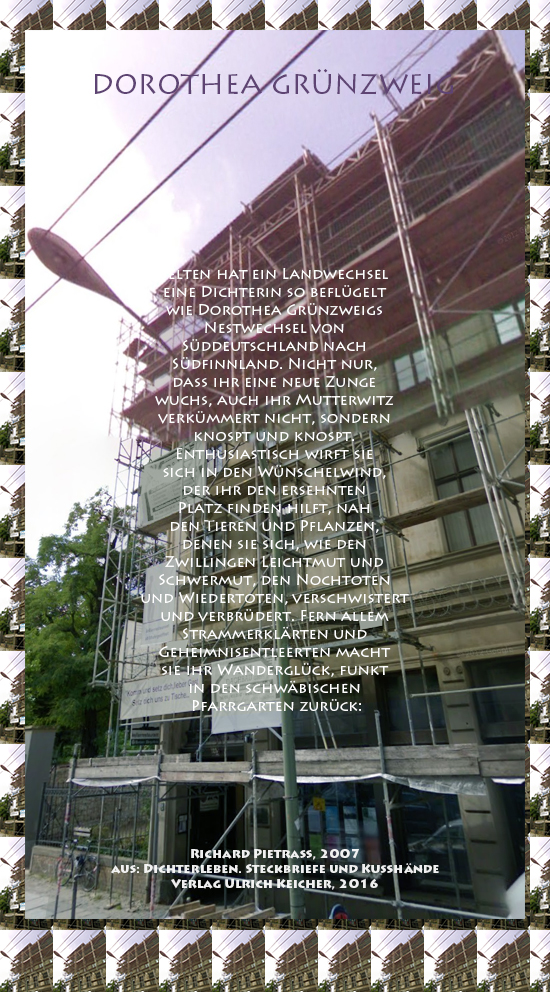












Schreibe einen Kommentar