Durs Grünbein: Grauzone morgens
AN DIESEM MORGEN GINGEN die 80er Jahre
aaazuende mit diesen Resten der
aaaaaaaaa70er, die wie die
aaaaaaaaa60er erschienen: nüchtern und wild.
,3 Jahrzehnte mit einer Hoffnung im Off…‘
Nimm dir ein Negativ (und vergiß): diese
aaaWarteschlangen sich kreuzend an
aaaaaaaaaaaaHaltestellen, die Staus im
aaaaaaaaaaaaaaaBerufsverkehr, total
eingefrorene Gesten am Zeitungskiosk, die
aaaaaaaaaMißverständnisse (,Sind Sie
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaverletzt?‘ −
aaa(,Kennen Sie DANTE?‘). Du sahst wie sie
warteten, manche vom Glanz ihrer Exile
aaavereinsamt. Die Luft (sonst
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaunverwundbar)
aaaaaaaaaaaaaawar voller Szenen aus
aaaaaaaaaaaaaaaaaaChaplinfilmen, ein
Wirbel grauer Pigmente davor, Tag und
aaaNacht grauer Regen vom
aaaaaaaaaaaaaaaaaaKohlekraftwerk über der
toten Ähnlichkeit aller toten arm- und
aaabeinlosen Engel auf den
aaaaaaaaaaaaaRuinen ringsum. Also schön,
aaaaaaaaaaaaaaaaaadachtest du: dieser Ort
aaaaaaaaaaaaaaaaaaso gut wie ein anderer
aaaaaaaaaaaaaaaaaahier in Mitteleuropa
aaaaaaaaaaaaaaaaaanach Sonnenaufgang mit
galoppierenden Wolkenherden und frühem
aaaStimmengewirr wie vom Sog
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeines Hafens
erfaßt… Ist es das? während du weiter-
aaaaaaaaaaaaamachst, dich erwärmst, ein paar
aaaaaaaaaaaaaaaaFremde grüßt gähnend
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(,ein Gähnender!‘) über-
drüssig der Tautologien, des Hungers, der
aaalangsamen Einführung in diesen Tag.
Der 26jährige Dichter Durs Grünbein
aus Dresden stellt sich mit seinem ersten Buch vor: Grauzone morgens.
„Eine Serie von Stimmen ohne festes Zentrum, stückweise und in Fragmenten, graue Wellen aufgeworfen beim Gang durch die Stadt, gebrochen an dieser harten Kante des Morgens, alles in allem nur eine andere schräge Art Straßenmusik.“
„Stiller Aufruhr“ treibt Durs Grünbeins Gedichte voran, poetische „Zeitrafferaufnahmen“ aus dem „Ghetto einer verlorenen Generation“, die zugleich in den Rissen des Alltags die Tagträume einer jungen, in die DDR hineingeborenen Generation sichtbar werden lassen.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1988
Inhalt
Der „stille Aufruhr“ eines elegischen Expressionismus treibt die Gedichte von Durs Grünbein voran, der sein Wirklichkeitserleben in krassen und direkten Bildern notiert.
In diesen Gedichten, einem Protest gegen eine immer ungreifbarer werdende Realität, „passiert alles in Augenhöhe“. Durs Grünbein hält in seinen Poemen in „Glimpses & Glances“, Gedichten aus dem „Ghetto einer verlorenen Generation“, die flüchtigen Augenblicke fest: graue Städte, zerstörte Landschaften und die „kaputten Visagen“ der Arbeitshelden. Zugleich aber träumen diese Gedichte auch davon, der Schwerkraft der Verhältnisse zu entkommen. Stellvertretend für eine junge, in die DDR hineingeborene Generation fragt Durs Grünbein:
Amigo, was ist bloß schiefgelaufen, daß sie uns derart zu Kindern machen mit ihrer Einsicht in die Notwendigkeit, ihrer wachsenden Rolle des Staates?
Suhrkamp Verlag, Ankündigung
Neue deutschsprachige Lyrik
Das kleine Bändchen Grauzone morgens der edition suhrkamp Reihe, verfasst von Durs Grünbein, ist sein Geld wert. Der Autor hat ein überwältigendes Gespür für Atmosphäre. Die Gedichte, die er schreibt, schauen aufs Detail, nicht auf die Masse, Details, die oft übersehen werden, zersplittertes Glas und Neonreklame, der Hauch des Augenblicks. Durs Grünbein lebt in Berlin, und eben die Straßen Berlins sind häufig Schauplätze seiner Gedichte, besonders früh morgens –Grauzone morgens! – fast noch im Schlaf oder auch schon „frei von Traumbelag“, und die Gedichte entdecken, „was dieser Morgen an Schönheit verspricht“, selbst zwischen Eisenbahngleisen und inmitten all diesem Grau (doch dann wieder: knallgelbe Schuhe…).
Ein Kunde, amazon.de, 8.12.1999
Der moderne Klassiker
Grauzone morgens ist der moderne Klassiker der deutschen Lyrik. Sehr feinsinnig, ja schöngeistig, doch auch für jeden lesbar und jugendlich. Besonders gelungen ist auch die Mischung aus klassisch geschulter Form, perfektem Rhythmus und umgangssprachlichem Jargon. Dieser Band bietet eigentlich für jeden etwas, der irgendwas mit Lyrik anfangen kann – oder möchte.
„marcovista“, amazon.de, 11.1.2002
Eingefrorene Augenblicke
Gewöhnlich ist es mit der Lyrik die einem so unterkommt so eine Sache.
Meist handelt es sich dabei entweder um intellektuell abgehobene Ergüsse, die außer dem Autor kaum wer versteht oder um belanglose, humoristische Mundartdichtung.
Den breiten Raum dazwischen teilen sich ganz wenige ernst zu nehmende Autoren.
Durs Grünbein ist einer davon und Grauzone morgens macht da weiter, wo z.B. ein Charles Bukowski aufgehört hat.
Ohne sich in publikumswirksamen Obszönitäten zu verlieren, schafft es der Autor mittels Worten den Augenblick einzufrieren um ihn dadurch festhalten und betrachten zu können.
Udo Kaube „novalisudo“, amazon.de, 5.2.2008
„Ways are, there you go“
Etwas das zählt (gleich am Morgen) ist,
dieser träge zu dir
herüberspringende Chromblitz eines
Motorrads.
Durs Grünbein selbst war, wie man in Das erste Buch: Schriftsteller über ihr literarisches Debüt nachlesen kann, nicht besonders überzeugt von seinem Erstling. „Dieser zitronengelbe Broschurband erinnert mich an das häßliche junge Entlein aus Andersens Märchen, von dem gesagt wird, es hätte zu lange im Ei gelegen und darum sei es etwas mißraten.“ Der Band, so meine er, beziehe seine Kraft vor allem aus der Phantastik des damaligen sozialistischen Staatengebildes; nach dem Zusammenbruch des Ostblocks sei das Buch sofort um Jahrzehnte gealtert. Er selbst sah seinen richtigen lyrischen Durchbruch, seine „Technicolor“, erst in dem zweiten Gedichtband Schädelbasislektion: Gedichte.
Doch der Leser kann schon sehr froh sein, dass dieses erste Büchlein preisgünstig und noch neu zu kaufen ist, denn trotz des grau in grau getönten Spiels der Wörter vor den Fassaden von Dresden und Berlin, eine nahezu unerklärliche Reizquelle entspringt diesem Dunst, dieser Ruhe, dieser tauben Agonie; sie rührt nicht von den Dante Zitaten, den plastisch-pessimistischen Depressionsfahnen oder den Antilebenbildern – nein – sie lebt auf, wenn Grünbein Kaugummi auf Barockphobie reimt; wenn er Gedichte beginnt mit: „ALSO VON VORN: manche Tage beginnen wie / alte Schellackplatten total zerkratzt mit / einem Knistern […]“ – oder wenn er plötzlich nach oben sieht und „Abendhimmel wie Seen voller / ungestillter Farbbegierden“ erblickt…
Moderne Lyrik ist oft schwierig; manchmal geschmacksneutral und wunderlich. Was macht Lyrik denn aus?
„Lyrik ist die subjektive Suche nach angefüllten Momenten.“ Einer der banalsten Sätze überhaupt. Doch Durs Grünbein ist ihm in diesem Band konsequent gefolgt. Er lässt und durch seine Augen sehen – erfolgreich führt er uns ein in die – Grauzone morgens – … „[…] Denn / was ist schon die Surrea- / listik der Ängste gegen die / maßlos zufälligen kleinen / Tricks eines Gedichts.“
Timo Brandt, amazon.de, 3.2.2011
Keine Eule der Minerva
Viel Information gibt der Verlag diesem Bändchen ja nicht mit. Nur daß Durs Grünbein ein sechsundzwanzigjähriger Dichter aus Dresden und das vorliegende sein erstes Buch sei. Einzelpublikationen in der DDR? Vermutlich Fehlanzeige. Halten wir uns also an die Gedichte selbst. Was für eine Zone ist das, diese „Grauzone morgens“?
Auf keinen Fall jene DDR, wie wir sie etwa aus Volker Brauns Lyrik oder noch aus den Versen des jungen Uwe Kolbe kennen. Nichts mehr von der Dialektik der Verhältnisse. Nichts an Utopie oder aber dem, was sich fälschlich real existierender Sozialismus nennt. Das ist für den jungen Mann, der hier schreibt, fort und abgeschminkt. Der Rest allenfalls ein salopper Seufzer:
Amigo, was ist bloß schief
gegangen, daß sie uns derart zu Kindern
machen mit ihrer Einsicht in die Not-
wendigkeit, ihrer Wachsenden Rolle des
Staates?
Doch die Antwort auf die Frage interessiert schon nicht mehr. Das Mißtrauen ist total. Der da sich nicht zum Kind machen lassen will, hat anderes im Sinn: „Sieh genau hin, ehe sie dich / für blöd verkaufen.“ Nur hat er selbst Schwierigkeiten, diese Maxime zu befolgen. Denn die Verhältnisse, die sind nicht so – so durchschaubar, wie sie einst Brecht erschienen. Eine präzise Formel will sich nicht einstellen. Grauzone morgens ist ein Bild für das Diffuse der gegenwärtigen DDR-Realität:
In dieser
Grauzonenlandschaft am Morgen
ist vorerst alles ein
toter Wirrwar abgestandener Bilder, z.B.
etwas Rasierschaum im
Rinnstein, ein Halsband
oder im Weitergehn ein Verbotsschild.
Also beliebige Details im ungenauen Licht, und nichts davon wirklich signifikant (außer vielleicht den Verbotsschildern). Über diesen Befund und über seine Variation kommt Durs Grünbein nicht wesentlich hinaus. Eine Eule der Minerva ist nicht in Sicht.
Die Frage ist, was einer aus seinen Befunden macht, wenn er Poet ist. Wenn Grünbein seine Optik präzis einstellt, gelingen ihm deutliche Realitätsausschnitte, einzelne Szenen: die „hagere Frau“, „mit dem / Ausdruck der Müdigkeit / unverändert nach Wochen“. Oder das telefonierende „Nullbock“-Pärchen am Prenzlauer Berg als Bild der Sonntagslangeweile. Oder nur eine einzelne treffende Beobachtung wie „der träge zu dir / herüberspringende Chromblitz eines / Motorrads“. Der Autor fühlt sich bei seinen Erkundungen als „kleiner Statist / hinund herbugsiert in den / Staffagen eines schäbigen / Vorstadtkinos / 4 Jahrzehnte / nach diesem Krieg“, also in einer fingierten oder simulierten Realität. Was immer man unter den hier imaginierten „Staffagen“ verstehen mag – dem Autor scheint es auf Genauigkeit und Konkretion nicht sehr anzukommen. Gleich anschließend bekennt er nämlich, dieser Vers sei „so gut wie ein anderer / hier / auf einer Grautonskala“.
Sind im Grauen nun alle Verse grau? Durchaus nicht. Es gibt bessere und schlechtere. Die schlechteren sind von dieser Art:
Manchmal
ist nichts banaler als ein
Gedicht, eine erste Tagung
so früh am Morgen auf den
erstarrten Flügeln der Motte.
Lassen wir die Frage nach der Banalität dieser oder anderer Verse. Aber ich möchte schon wissen, was eine „Tagung“ auf Mottenflügeln ist.
Die besseren Zeilen – denn was Grünbein als Verse drucken läßt, ist abgeteilte Prosa – möchten „Glimpses & Glances“ sein, also poetische Observationen im Stil von W.C. Williams. Auch auf „Meister Bâsho“ beruft er sich, also auf die Kunst des Haiku. Aber dessen Konzentration ist Grünbeins Sache nicht. Hauptvorbild aber ist Rolf Dieter Brinkmann. Wie der sich räuspert und spuckt, hat Grünbein ihm abgeguckt. Leider auch die Manierismen: die Unschärfen, Stoffanhäufungen, funktionslosen Zeilenbrechungen. Da ist für den Autor noch viel zu tun, wenn er übers Epigonale hinausgelangen möchte.
Stofflich gesehen ist die kompensatorische Funktion dieser Lyrik offenkundig. Vielleicht erregt einen jungen Leser in Dresden oder Umgebung die bloße Vorstellung, „vorübergehend in New York zu sein“. Aber würde er sich auch mit dem begnügen, was Grünbeins lyrisches Ich halluziniert?
In New York
hättest du todsicher jetzt den
Fernseher angestellt, dich zurückgelehnt
blinzelnd
vom Guten-Morgen-Flimmern belebt.
Ein Surrogat des Surrogats. Es zeigt, wie bescheiden die Tagträume in Grünbeins „Grauzone“ sind.
Harald Hartung, als: Tagträume in der Grauzone, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.10.1988
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Michael Braun: „Dem Weltgeist die dicke Möhre ins Mondgesicht“. Neuere deutsche Lyrik
Die Weltwoche, 16.3.1989
Hajo Steinert: Schutzzone nachts. Über Drawert, Grünbein, Igel, Rosenlöcher
Die Zeit, 8.12.1989
Michael Neubauer: Erfrischendes aus Ostdeutschland
GrauZone. Zeitschrift für neuere Literatur, Ausg. 2, 1995
Stefan Sprang: Fahrt durch die Grauzonen oder Der Dichter als Grenzhund
Rheinischer Merkur, 11. 10. 1991
Revision Grauzone morgens
Dieses erste Buch liegt so lange zurück, daß es mir wirklich leid tut: daran, wie es zustande kam, kann ich mich kaum noch erinnern. Unvorstellbar der Gedanke, ich sollte bei einer der üblichen öffentlichen Lesungen daraus vortragen. Seit Jahren lasse ich, wenn es auf Lesereise geht, das kleine Debüt-Büchlein mit dem Titel Grauzone morgens zu Hause. Dieser zitronengelbe Broschurband mit seiner zerrauften Typographie erinnert mich an das häßliche junge Entlein aus Andersens Märchen, von dem gesagt wird, es hätte zu lange im Ei gelegen und darum sei es etwas mißraten. Jetzt erreicht mich die Bitte um eine neuerliche Lektüre, und sie kommt einer Peinigung gleich. Nichts um alles in der Welt kann den Autor dazu bringen, dieses Dokument seiner Unmündigkeit noch einmal in Betrachtung zu ziehen. Wer das verlangt, ahnt nichts von dem Komplex, der da in ihm aufgewühlt wird, sobald er lesen muß: „Grauzone morgens, mon frère, auf dem / Weg durch die Stadt…“
So war es auch reine Notwehr und alles andere als Koketterie, was er einem besonders neugierigen Frager einmal zu Protokoll gab. Er sprach von seiner übergroßen Distanz zu dem Buch und erklärte, daß er die darin enthaltenen Gedichte heute lesen würde wie die eines fremden Verfassers. Interessant an ihnen sei nur, wie sie die Situation eines geschlossenen Gesellschaftsraumes abbildeten, das Alltagsleben in einer Garnisonsstadt im deutschen Osten. Ihre Exotik verdanke sich allein der Tatsache sowjetischer Fremdherrschaft und jener versunkenen Welt des Staatssozialismus, die ihm zwar rückblickend noch immer als das phantastischste Lebensabenteuer erscheine, mit der ihn aber heute kaum mehr als ihr einstiger Schauplatz verbinde, eine Stadt namens Dresden. Diese allein sei das Bleibende darin, ein Stück geschundener europäischer Barockkultur, und sie so früh schon besungen zu haben in aller Sprödigkeit, der wahre Zweck des Büchleins, das ihm ansonsten ganz gleichgültig sei. Der Ort, der da beschrieben ist, sei ohne Zweifel ein magischer Schauplatz, festgehalten in einer Folge verwackelter Momentaufnahmen, in den frostigen Impressionen einer ewigen Morgendämmerung. Er war das Tor zu einer unheimlichen Zone, die vor der Haustür begann und sich bis in die innerste Mongolei hinzog. Und ganz sicher sei dieser Ort auch der Ursprung seiner ganzen Dichterei gewesen, und für den kommenden Wortstrom so etwas wie der Ur-Topos überhaupt: die hippokrenische Stelle oder Quelle, auf die der gesamte Mäander von Versen und Bildern seither sich zurückführen ließ. Hier war zuerst der Blitz in ihn eingeschlagen, hier war sein poetisches Bewußtsein erwacht. Auch wenn die Zeit, in der dies geschah, geradezu himmelschreiend mythenfern war und für den Hufschlag des Pegasos das Rattern und der Funkenregen einer elektrischen Straßenbahn herhalten mußte.
Eines ist ihm noch genau im Gedächtnis: ein langer Nachmittag an den Kaianlagen unten beim EIbehafen, unweit des Schlachthofs, in dem sein Großvater gearbeitet hatte ein Leben lang. Da … da … da waren ihm erstmals ein paar abgerissene Verszeilen ins Ohr diktiert worden, und er hatte sie sogleich aufschreiben müssen, und dies war der Beginn. Noch immer besitzt er das alte Notizbuch, das er mit sich trug damals, bei Wind und Wetter, in seiner braunen Ernst-Thälmann-Jacke. Jede Seite war mit Zitaten gespickt, viel Dante und Leonardo da Vinci darunter, aber plötzlich fand sich dort auch ein Fetzen wie dieser:
Du, allein mit der Geschichte im
Rücken, „Zukunft“ ist
schon zuviel gesagt…
Oder ein Bruchstück wie dieses:
man
sah uns nicht an wie
uns zumute war beim
Verlöschen der Ziele.
Letzteres hatte es dem Dichter Heiner Müller besonders angetan, dem einzigen Menschen in jener geistigen Wüstenei, in dem er so etwas wie den klassischen Mentor wiedererkannte. Er war es auch, der ihn seinerzeit auf die eigene Spur ansetzte mit seiner Frage: „Wie kommt es, daß alles Utopische bei dir restlos aufgebraucht scheint? Wie lebt es sich ohne Utopie?“ Die Frage war zu folgenschwer, als daß er sie hätte beantworten können. Aber mit ihr war doch blitzartig die Szenerie erhellt, von der die Gedichte des Bandes Zeugnis ablegten. Eine seltsam danteske Industrielandschaft war da gezeichnet, die Rede war gar von den „dröhnenden Labyrinthen der Industrie“, und das offenbar blutjunge Ich zeigte seine Fremdheit und Unzugehörigkeit zu dieser Umgebung in Gesten des Erstaunens, der Geringschätzung und des Widerwillens. Noch heute verblüfft mich der Grad von Verachtung, den das lyrische Ich hier an den Tag legt. Ich fühle mich zu ihm hingezogen wie zu einem jüngeren, wilderen Bruder – meinem Alter ego in der Sehnsuchtsgestalt eines Ausreißers. Dabei habe ich mich niemals mehr so gefangen und gefesselt gefühlt, sosehr ohnmächtige Geisel, wie als derjenige, der ich seinerzeit war, der Autor von Grauzone morgens.
Siebenfach ist die Entfernung zu diesem Buch. Was mir damals die erste eigene Gedichtsammlung war, kann heute bestenfalls als historisches Dokument gelten, ein „Tagebuch 51° Nördlicher Breite“, wie es an einer Stelle verräterisch heißt. Die Stimme, die hier erklingt, die Person hinter ihr, haben sich vollständig in Luft aufgelöst, sie sind nurmehr Geistererscheinungen auf einer weißen Seite. Verschollen ist nicht nur dies Ich, auch die Lebenswelt, in der es sich damals ereignete, auch das Land, der Staat, die Gesellschaftsform, ein ganzes Imperium, so mächtig wie Rom oder Byzanz. Das heißt, der Autor selber erlebt sich heute beim Wiederlesen als ein Verschollener. Jenseits der zeitlichen Distanz, ist es die metaphysische, die unaufhaltsam zunimmt. Und nicht zuletzt sind es die poetischen Mittel, kläglich als solche, die mir das Buch entfremden in seiner ganzen Dürftigkeit. Das Primitive des Prosaverses, sein willkürliches Enjambement, das keiner Zerreißprobe standhielte, die unverschämte Mischung aus Freistil und idiomatischer Arte povera, alles das ist mir doch mittlerweile in weite Fernen gerückt. Heute, da ich weiß, Prosa heißt: Alle Worte schwitzen. Während Dichtung die Forderung enthält: Jedes Wort muß sitzen. Aber nicht nur im Gegensatz von entwickeltem Formbewußtsein und jugendlicher Vers-Anarchie (oder besser: prosodischer Gleichgültigkeit) zeigt sich der Abstand, es ist das Selbstbild des erwachsenen Dichters, des avancierten Ost-West-Bastards, das nicht mehr recht passen will zu jenem Portrait des Künstlers als junger Rekrut. Und schließlich ist da noch ein Unterschied, der die Bildästhetik dieser frühen Gedichtgebilde betrifft. Daß es der Blick in ein Archiv ist, der hier erprobt wird, ist für den Verfasser schon darum offenkundig, weil er die Texte von damals als einen Schwarzweißfilm zu sehen gelernt hat. Erst mit dem nächsten Gedichtband (Schädelbasislektion) erstrahlte die Welt ihm in Technicolor.
Schon ein Jahr nach seinem Erscheinen war das Buch um ein halbes Jahrhundert gealtert. Es gehörte nun zu den Überbleibseln aus einem Kulturkreis, für den das Ende des Zweiten Weltkrieges erst 1989 anbrach, mit dem Fall der Berliner Mauer. Es ist sein Memento mori, eines der Fotoalben der letzten Stunde.
Durs Grünbein, aus: Renatus Deckert (Hrsg.): Das erste Buch, Suhrkamp Verlag, 2007
Durs Grünbein und der Aschermittwoch der DDR
Will man verstehen, woran die DDR zugrunde gegangen ist, so befrage man die heute viel geschmähten, weil in die Geschehensabläufe so oder so verstrickten Dichter. Dichter sind gewiß keine Seher, die der Zukunft ins Auge blicken, sie sind auch meist keine Helden, die zu politischen Schlachten aufrufen; nicht einmal als in einer herausragenden Weise bewußte Zeitgenossen sind sie befähigt, die Trends der Zeit analytisch zu durchdringen.
Das Dichterische in seinem Verhältnis zur historischen Zeit – so läßt sich an den zwischen 1985 und 1988 geschriebenen Gedichten des jungen Lyrikers Durs Grünbein ablesen (Grauzone morgens) – besteht vielmehr im Verhältnis einer ausgeprägten Wahrnehmungsfähigkeit einerseits, der Einbildungskraft andererseits, die sich am Wahrgenommenen abarbeitet, und dem präzisen Ausdrucksvermögen, welches beide Seiten derart verklammert, daß das poetische Resultat über seine subjektiven Elemente gleichsam hinausschießt, um etwas von der Signatur der Zeit freizusetzen.
Grünbein. 1962 in Dresden geboren, schrieb in den achtziger Jahren im Umkreis des Prenzlauer Bergs, neigte jedoch kaum zu den postmodernistischen Avantgardismen der sich auf dem Boden der DDR exterritorial verstehenden Künstlergruppe. Seine frühen Gedichte weisen vielmehr eine eher einfache, auf Gegenstände und Bilder zentrierte Struktur auf, die von gewollten Extravaganzen und absichtsvollen Pointen weitgehend freigeblieben ist. Hier arbeitet (noch) nicht ein lyrischer Handwerker, der mit seinem Material haushalten muß und ihm deswegen noch den letzten Witz abzupressen bemüht ist, sondern einer, der die Welt, vielfach naiv, niemals aber stumpf, in ihrer Hohlheit und Farblosigkeit registriert, gegen diese Wahrnehmungen jedoch nichts anderes aufzubieten hat als literarisch oder medial vermittelte Träume von einer anderen Welt, von der er gleichwohl weiß, daß er sie nur auf das Papier zu zitieren vermag, weil sie praktisch für ihn unerreichbar ist. Wer wie Grünbein den mexikanischen Regengott Tlaloc, altchinesische Schriftzeichen, die Spanierin Carmen, darüber hinaus viele andere exotische, zumindest aber raumzeitlich unerreichbare Farbsymbole eines intensiveren Lebens gegen die zwanghaft immer wieder registrierten Grauzonen einer tristen Alltäglichkeit setzt, propagiert nicht den Ausbruch ins Phantastische, operiert vielmehr in der Weise mit den Gegensätzen, daß beide Seiten in der Fiktion des Gedichts ihre strenge Isolation aufzugeben beginnen. Nicht als ob Mexiko oder China nun als träumerische Illusionen angesichts grauer Alltäglichkeit, als lediglich subjektive Wunschbilder festgemacht würden, nicht aber auch, als ob es den exotischen Signalen gelingen sollte, die Alltagswelt des Realsozialismus wenigstens poetisch mit dem Glanz des Andersartigen zu schmücken: es sind vielmehr Konstellationen beider Seiten, gleichsam objektive Gebilde, welche, ohne ihn zu thematisieren, den tiefen Abgrund erkennen lassen zwischen Realwelt und Wünschen.
Um diesen Abgrund ist es Grünbein in seinen frühen Gedichten zu tun. In ihm wird weit mehr und Grundsätzlicheres laut als etwa nur ein Mauerbewußtsein oder unbefriedigte Reiselust in ferne Welten. Jener Abgrund bezeichnet vielmehr in aller Deutlichkeit den Verlust utopischer oder auch nur auf Zukunft orientierter Erwartungen: daß es je anders werden könnte, als es ist, daß jemals die Kluft zwischen Menschheitsidee und ruinösem Verfall selbst des noch bestehenden Alten aufgehoben werden könnte. Im Gegenteil: Der Verfallscharakter des Bestehenden strahlt aus auf die Wünsche und läßt sie in sich zusammenschrumpfen zu abstrakten Zeichen. Carmen ist nur eine Karnevalsmaske, steht am Aschermittwoch im letzten Wagen der Straßenbahn. Signalisiert sie die Wünsche des Betrachters, so sind es vorgestrige, während es diesem „fraglich“ erscheint, „wie sie da / wieder rauskam“. („Olé“)
Jedoch nicht irgendeine weltschmerzliche Katerstimmung vermitteln Grünbeins Gedichte, als ob ihnen der Rausch eines Festes vorausgegangen wäre, sondern umgekehrt das Bewußtsein, daß dem Katzenjammer nichts vorangegangen ist, was ihn nach sich gezogen haben könnte. Zeit erweist sich als Endzeit, da ein Wechsel zwischen Erhobensein und Fall weder pragmatisch noch emotional mehr anzutreffen ist. Insofern läßt sich „Aschermittwoch“ nicht als Zeitsymbol auffassen, da dieses eine Zäsur zwischen Gewesenem und Zukünftigem anzeigen würde, sondern als Metapher eines Endes, von dem nicht feststeht, wann es seinen Scheitelpunkt erreicht und überhaupt wieder ein Zeitmoment zu werden vermag.
Grünbeins Gedichte sind kraft ihrer strukturellen Eigenarten Gebilde von geschichtlicher Bedeutung, und der Autor ist sich der Tatsache bewußt, daß dieser Umstand sich dem gegenläufigen Verhältnis zwischen dem über sein Material verfügenden Dichter und den sich von ihm emanzipierenden Bildern und Gedichten verdankt. („MonoLogisches Gedicht No.4“)
Immer dort nämlich, wo Grünbein westliche Kunst und Künstler als Symbole der DDR-Ungleichzeitigkeit zitiert, immer dort also, wo das Thema den Bildern ihre Prägung und Bedeutung zu vermitteln sucht, geraten die Gedichte in die Nähe weltanschaulicher Effekthascherei. Die abgetakelte Karnevals-Carmen im letzten Wagen des Straßenbahnzugs ist indessen allemal bildmächtiger denn Verweise auf Jackson Pollock oder García Lorca. Das Absichtsvolle beschränkt, wie Grünbein selbst es weiß, die Autonomie einer Form, die aus dem Magnetismus von Vorstellungen und Bildern gleichsam selbsttätig erwächst. Literarische und bildkünstlerische Zitate und Anspielungen verleiten nur dazu, in Grünbein den souveränen Vermittler zwischen östlichen und westlichen Kunstwelten erkennen zu wollen, was er zumindest im ersten Gedichtband Grauzone morgens beileibe nicht ist und zu sein auch nicht beansprucht.
Weitaus komplexer strukturiert, viel schwieriger auch sind die um und nach der „Wende“ geschriebenen und 1991 in dem Sammelband Schädelbasislektion publizierten Gedichte Grünbeins. Sind die Gedichte aus Grauzone morgens meist zweistimmig angelegt, indem Wahrnehmungen und Wünsche einander entgegenstehen, erfüllt sich die Signatur der Zeit im Abgrund zwischen beiden Ebenen, so gilt für Schädelbasislektion eine weitaus umfassendere Mehrstimmigkeit, als hätte sich das vormals halbierte lyrische Ich nun aufgelöst in die Vielfalt geschichteter und einander widerspruchsvoll zugeordneter Stimmen. Benn und Enzensberger, Rimbaud und Brecht, darüber hinaus viele andere kommen in Zitaten und Anspielungen zu Wort, ebenso Geschichte und Gegenwart, Namen und vieldeutige Namenspartikel („STALIN… STAL… INSTA… LINS… TAL… INS… TAL“). Der Weg der Wahrnehmung weist hier nach innen, in die Räume unterhalb der Schädeldecke, in das Hirn als biologisch-psychisches Zentrum der Wahrnehmungen, Triebe und Wünsche, ohne daß diese allerdings zur Deckung gebracht würden. Gesucht wird nach einem neuen Integral, das an die Stelle eingebüßter Struktur-Homologien zu treten vermöchte. Allerdings erweist sich die Suchreise nach innen eher als Weg in disparate Materialfülle denn als erfolgreich verlaufender Integrationsversuch. Waren die frühen Gedichte zumeist eher einfache, weil in sich konzentrierte Gebilde, so neigen die neueren bisweilen zu einer beinahe epischen Breite (insbesondere im II. Teil des Bandes), wenngleich sich auch hier noch schlichte Sechszeiler und andere Kurzformen finden. Grünbein wagt im neueren Band formal weitaus mehr, geht jedoch das Risiko ein, sich in der Stoff-, Bild- und Anspielungsfülle gänzlich zu verlieren und nicht selten sogar ins Unverbindliche abzugleiten. Mögen die Gedichte aus der DDR-Spätzeit häufig auch stark von der grauen Farbe des geschichtlichen Verfalls bestimmt gewesen sein, so ließen sie doch erkennen, daß im objektivierenden Duktus des Sprechens noch eine Subjektivität eingelagert war, die als emotionaler Energieträger Spannung zutage treten ließ. Die DDR-Endzeit war kein Gegenstand, über den sich in unverbindlichem Gleichmut sprechen ließ. Dagegen wirken Zeilen wie die unter dem Datum des 12/11/89: „Komm zu dir Gedicht, Berlins Mauer ist offen jetzt“ eher hilflos angesichts der historischen Zäsur. Die Aufforderung an das Gedicht, zu sich zu kommen, und dies noch im Zusammenhang mit der offenen Mauer, läßt poetisch nichts Gutes erwarten, was Grünbein gewiß nicht zu verübeln wäre, wagte er sich nur nicht an ein Sujet, daß nach trivialem Pathos geradezu schreit und dem auch dadurch nicht beizukommen ist, daß das Gedicht gleichsam vorab zur Ordnung gerufen wird. In Grauzone morgens hingegen finden sich Verse – bezogen auf geradezu mikrologische Sujets –, denen man eine vollendete Poetizität deswegen zusprechen kann, weil hier eine genaue Entsprechung herrscht zwischen Gegenstand und Sprechweise:
EINE REGUNG
Dieser flüchtige kleine Windstoß, Luft-
aaaaawirbelsekunde, als ein
aaaaaaaverschreckter Sperling kurz
aaaaaaaaaaaaaaavor mir aufflog, schon
außer Sicht war und eins der
aaaaaleichtesten Blätter folgte zer-
aaaaaaaaaarissen in seinem Sog.
Eine Regung, die zugleich eine poetische Regung zu nennen ist: eine Regung, die der Grauzone blasser Alltäglichkeit und dem Ruinenzerfall eines politisch-sozialen Systems in subtiler Weise Unscheinbares entgegensetzt. Insbesondere sind es mutige und phantasievolle Wortbildungen wie „Luftwirbelsekunde“, die Grünbeins Sprachfähigkeit dokumentieren. Hier kündigt sich an, was Grünbein werden kann: ein ebenso wahrnehmungs- wie stilbewußter Lyriker.
Gerhard Pickerodt, aus Karl Deiritz und Hannes Krauss (Hrsg.): Verrat an der Kunst? Rückblicke auf die DDR-Literatur, Aufbau Taschenbuch Verlag, 1993
Der Nachgeborene auf dem Barockwrack
– Durs Grünbein über Dresden. –
I
Die Herkunft läßt uns keine Wahl. Ihre Prägungen sind unwiderruflich. Auch die Zeit löscht sie nicht aus. Noch Jahre später sucht die Erinnerung die von einem überhellen Bewußtsein erfaßten ersten Augenblicke auf. Die Welt der Kindheit bleibt länger im Gedächtnis haften als alle anderen Orte. Es ist, als speichere die Netzhaut die frühen Bilder ein Leben lang. Es bedarf dann nur eines winzigen Impulses, des Geschmacks einer Madeleine bei Proust etwa um den fernen Kontinent der Kindheit wieder aufzuschließen. Die im Unterbewußtsein versunkene Welt kehrt zurück, ohne daß ihre Farben verblaßt wären, selbst wenn sie, wie im Fall von Durs Grünbein, eine „Landschaft in Bleisatz“ war. Es ist, als habe der Grauton, der seine Erinnerungen an Dresden einfärbt, tatsächlich eine größere Strahlkraft als das Rot der Straßenbahnen, das nach der Wende plötzlich aus dem Stadtbild verschwand.
Das Grau in Grau des real existierenden Sozialismus, in dessen Endstadium Grünbein aufwuchs, war spürbar in dem Ruß, der in der Luft lag und sich auf Häuserwänden und Gesichtern absetzte. Er färbte alles, was Grünbein in dem Jahrzehnt vor dem Mauerfall schrieb. Grauzone morgens hieß folgerichtig sein Debüt von 1988. Eine Farbe war zum Synonym geworden für ein System, dessen Eckpfeiler längst wankten. Goethes „gemalte Fensterscheiben“ waren gesprungen. Kohlenstaub lag auf dem Glas, durch das man auf verrottete Industrieanlagen und zerstörte Landschaften blickte. Eine bleierne Öde, durch die das Ich dieser Gedichte streifte wie Tarkowskijs Stalker. Grauzone morgens gab Kunde von einer sozialistischen Welt in den letzten Zügen, einem „Wüsten Land“ im Klammergriff des Kalten Krieges. Reinhard Baumgart sah in diesen Gedichten Epiphanien der DDR, und Michael Braun spricht von einer Lyrik und Poetik des Fragments, für die „das zerbröckelnde Regime“ Grünbein den Stoff geliefert habe. Von einem anderen Fragment, das seinem Schreiben zugrunde liegt, war bisher jedoch selten die Rede. Dieses Fragment ist Dresden, die Stadt, in der Grünbein 1962 geboren wurde. Von ihr sprechen viele Gedichte in Grauzone morgens. Nur einmal wird ihr Name genannt, aber der Zwinger taucht auf, die Elbe, und in „Europas Balkon“ erkennt der Dresdner die Brühlsche Terrasse wieder. Man bedarf dieser Koordinaten nicht, um zu wissen, daß es sich bei der „Tal versunkenheit schwerer Kuppeln und // schmaler durchbrochener Türme“ und der „toten Ähnlichkeit aller toten arm- und / beinlosen Engel auf den / Ruinen ringsum“ nur um Dresden handeln kann. „Langsame Einfahrt in die zerstörte Stadt“: Das war noch in den achtziger Jahren der Eindruck dessen, der aus dem Zugfenster auf die geborstene Silhouette blickte.
„Scheintote Stadt, Barockwrack an der Elbe“, das sind nur zwei der kühlen Metaphern, die Grünbein für seine Geburtsstadt gefunden hat. Sie leiten das „Gedicht über Dresden“ ein, das wie kein zweites die Stadt verhöhnt, ihr voller Ingrimm und dennoch mit kalter Präzision seine Sarkasmen entgegenschleudert.
Das beste Depressivum ist der genius loci
An einem Ort, gemästet mit Erinnerungen,
Schwammfäule, schön getönt als Nostalgie
Die ruinierte Stadt wird ins zynische Bild gesetzt und Wagners Musikdrama aufgerufen:
Ein Gesamtkunstwerk
Singt unter Trümmern noch in höchsten Tönen.
So hatte noch keiner über Dresden geschrieben. Gewiß, auch Karl Mickel hat das zerstörte Dresden ein Kunstwerk genannt und seinen ästhetischen Reiz als außerordentlich bezeichnet. Doch diese Pointe in seinem Darmstädter Vortrag „Naturform und Menschenwerk“ von 1999 ist eher eine Koketterie denn eine Provokation. Zumal sie zu einer Zeit fiel, als Dresden, im Zuge des Aufbaus Ost endgültig der Asche entstiegen, alles tat, um seine Vorkriegsveduten wiederherzustellen und das Ganze mit der Kuppel der Frauenkirche zu krönen. Durs Grünbein aber schrieb sein „Gedicht über Dresden“ zu einer anderen Zeit, in einer anderen Stadt.
Die Stadt hieß zwar Dresden, aber sie hatte nicht viel gemein mit jenem berühmten Elbflorenz, das vor dem Krieg eine der prachtvollsten Barockstädte war, eine europäische Kulturhauptstadt, lange bevor dieser Titel vergeben wurde. In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 ging das alte Dresden, von Bomben schwer getroffen, in Flammen auf. Dahin der Canaletto-Blick, zwischen den rauchenden Trümmern lagen die verkohlten Körper seiner Bewohner. Tag für Tag war der Dresdner Maler und Holzschneider Wilhelm Rudolph in der Trümmerwüste unterwegs, um durch seine Federzeichnungen das furchtbare Ausmaß der Zerstörung für die Nachwelt festzuhalten. Kreuzkantor Rudolf Mauersberger komponierte nach den Klageliedern des Jeremias die Motette „Wie liegt die Stadt so wüst“. Später war die Altstadt beräumt, bis auf das wenige, was als Baudenkmal galt und dem stalinistischen Neuaufbau nicht im Weg stand. „Von Dresden blieb: die Elbe und die Hänge“, schreibt Volker Braun. Die Stadt gab es nicht mehr, nur noch ihren Namen. Nicht Chemnitz hätte damals in Karl-Marx-Stadt umbenannt werden sollen, sondern Dresden. Lew Kerbels monströser Marx-Kopf hätte ebensogut die neuerrichtete Prager Straße zieren können. Das hätte nichts daran geändert, daß diese Stadt „attraktiv war wie Minsk oder Swerdlowsk, so unverwechselbar sozialistisch wie jede andere sozialistische Stadt auch“, wie Grünbein in seinem Essay „Chimäre Dresden“ sagt.
II
„Die Geschichte“, fragt Roland Barthes, „ist das nicht einfach die Zeit als wir noch nicht geboren waren?“ Der Untergang Dresdens im Luftkrieg, der Bumerang, der aus Warschau und Rotterdam, aus London und Coventry zurückkam, war für Durs Grünbein etwas unerreichbar Fernes. Das nachapokalyptisch anmutende Terrain an der Elbe trug die Spur der Geschichte. Einer finsteren Zeit entronnen, ist Grünbein einer der Nachgeborenen, die Brecht um Nachsicht bat. Das hat seine Auseinandersetzung mit Dresden von Anfang an bestimmt. In einem Gespräch in der Zeitschrift Lose Blätter sagt er.
Schon als Kind hatte ich den Wunsch, das Stadtbild sozusagen im Traum zu komplettieren. Während die Älteren genau wußten, was fehlte, weil sie immer diesen Kontrast sahen, mußte man als Jüngerer vermittels des Phantomschmerzes sich jenen Kontrast erst erarbeiten.
Heinz Czechowski, Karl Mickel, B.K. Tragelehn und Volker Braun haben als Kinder den Untergang ihrer Stadt erlebt. Er hat sich in ihr Gedächtnis eingebrannt und trotz aller Bemühungen, sich von der Heimat abzustoßen, eine besondere Identität gestiftet. Czechowski, der Dresden immer wieder zum Gegenstand seiner Gedichte wählt, bekennt, daß er ohne den 13. Februar 1945 niemals zum Schreiben gekommen wäre. Und für Volker Braun ist Dresden, wie Gustav Seibt gesagt hat, die „Brandstätte“, auf der seine „Wortschöpfungen voller Pathos und Philosophie mit ihrer Spannung von Scharfsinn und Versmaß, Eleganz und Entsetzen, Trauer und Witz erst entstehen konnten“.
Dem Nachgeborenen müssen Überlieferungen das Erlebnis ersetzen und Fotografien die Erinnerung. „Von Anfang an“, schreibt Grünbein in seinen Berliner Aufzeichnungen „Das erste Jahr“, „definiert so das Zu spät alle Wahrnehmung, die wütende Ohnmacht vor soviel entschwundener Klasse.“ Die wütende Ohnmacht des Nachgeborenen: Sie durchzittert auch das „Gedicht über Dresden“. Die Distanz gegenüber dem Mythos vom alten Dresden, der noch immer die Gegenwart überstrahlt und offen boykottiert, ist ihm deutlich eingeschrieben. Sein Herkunftsort erwies sich als ein ästhetisches Erbe, das Grünbein alle Kraft abverlangt. Kein Wunder, daß dieses Bewußtsein gelegentlich zu heftiger Ablehnung führt:
Oft habe ich geflucht, weil ich gedacht habe, es wäre besser gewesen, an einem neutralen Ort aufgewachsen zu sein. Statt dessen war Dresden immer noch eine Projektionsfläche für viele draußen in der Welt.
Gut, daß es Kaugummi gibt:
weil es die beste
Arznei ist gegen
Barockphobie.
Beim Kauen kommt keine Trauer auf, nicht einmal im „Museumszwielicht“ des Dresdner Zwingers. Der Zahn tropft, und auf der Zunge sammelt sich der Speichel, den das Ich von der „kahlen Uferterrasse herab“ in die vergiftete Elbe spuckt. Da hat einer es satt: das sozialistische Einheitsgrau ebenso wie die schale Nostalgie seiner ruinierten Geburtsstadt. Das „Gedicht über Dresden“ ist ein bissiger Abgesang. Immun gegen die Sirenengesänge des alten Dresden, benötigt Grünbein nur wenige Strophen, um seiner Stadt den Spiegel vorzuhalten und das polyphone Wehgeschrei ihrer erinnerungssüchtigen Bewohner mit den Realien der Geschichte zu konfrontieren:
Auch Dresden ist ein Werk des Malerlehrlings
aaMit dem in Wien verstümperten Talent
aaaaDer halb Europa seinen Stilbruch aufzwang.
aaaaaaIn diesem Fall ergab sich wie von selbst
aaaaaaaaDie Technik flächendeckender Radierung
aaaaaaaaaaDurch fremde Bomber, Meister ihres Fachs
aaaaaaaaaaaaIn einer Nacht mit schwarzem Schnee im Februar.
In dem erwähnten Gespräch wird Grünbein grundsätzlich:
Ganz brutal mit Hegel gesprochen, war die Zerstörung Dresdens eine historische Notwendigkeit.
Victor Klemperer hat in seiner LTI das Verb coventrieren überliefert. Am 14. November 1940 hatten deutsche Jagdbomber Coventry fast völlig zerstört. „Da ist eine Stadt wirklich ausradiert worden“, schrieb Goebbels in sein Tagebuch. Wie Klemperer notierte, drohte man danach, alle englischen Städte zu coventrieren. Später, als längst nur noch die eigenen Städte brannten, sei das Verb in der Sprache des Dritten Reichs nicht mehr aufgetaucht. Es liege begraben unter dem Schutt deutscher Städte. Die Gefühle bei deren Anblick hätten aber nichts zu tun mit jenen erhabenen Gedanken, die den Malern und Dichtern des 18. Jahrhunderts in den Sinn kamen, wenn sie vor den Mauerresten mittelalterlicher Klöster standen und sich ihrer eigenen Vergänglichkeit bewußt wurden.
Nein, zu sanfter Melancholie regen sie nicht an, unsere Ruinen. Und wenn zur Bitterkeit des Anblicks das Wort ,coventrieren‘ tritt, dann schleift es einen trostlosen Gedankengang hinter sich her. Er heißt: Schuld und Sühne.
Der im Spätsommer 1996 entstandene elfteilige Zyklus „Europa nach dem letzten Regen“ knüpft an das „Gedicht über Dresden“ an, wenn auch in einem anderen, weniger rachsüchtigen Ton. Was nichts an Grünbeins Haltung ändert: Auf sein Mitleid können die Ausgebombten vom Februar 1945 nicht zählen. Zumindest durch ihr Schweigen tragen sie Schuld daran:
Daß ganze Städte,
Aus denen Züge zur Vernichtung rollten,
Brachflächen wurden an den Ufern Lethes.
Es mag Zufall sein, daß es die Dresdner Wirklichkeit war, die Victor Klemperer in seinen Tagebüchern überliefert hat, aber das relativiert nicht seinen Befund: Dresden war nicht weniger nationalsozialistisch und antisemitisch als andere deutsche Städte. Seine Rettung vor der Deportation verdankte Klemperer denn auch nicht einem Akt des Widerstands, sondern der Zerstörung der Stadt, in dessen Chaos er untertauchen konnte.
Und so gedenkt der Nachgeborene der Älteren keineswegs mit Nachsicht. Zwar weht ein Hauch von Elegie durch das Gedicht, das die Erlebnisse von Grünbeins Großmutter in der Brandnacht nachzeichnet. Sie lag mit Scharlach im Krankenhaus, als die Bomben fielen. „Im bloßen Nachthemd, in eine Decke gewickelt, war sie zuerst an die Elbwiesen gerannt und später vor den Tieffliegern in Richtung Süden davongelaufen“, heißt es in Grünbeins Berliner Aufzeichnungen von ihr. So wie Dora W. erging es zahllosen Dresdnern, die, von den Sirenen aus dem Schlaf gerissen, hilflos durch die brennende Stadt rannten. Am Ende des Gedichts ist aber auch dieser elegische Hauch verbraucht:
Da war kein Weinen,
Das auf den Trümmern noch verfing.
Genauso wenig verfing das Geschrei der panisch davonstiebenden Tiere des Zirkus Sarrasani:
Ein Pferd, das rechnen konnte, und der Tiger,
Den William Blake rief. Keins ein Ungeheuer,
Verglichen mit den smarten Jungs, den Fliegern,
Die sich im Tiefflug Mensch und Bestie holten.
Das Feuer, das im Auge von Blakes Tiger brennt: Man stelle sich vor, wie sich in den Pupillen der verängstigten Tiere der Untergang Dresdens spiegelt. Schon Karl Mickel erwähnt in seinem Gedicht „Die Elbe“ die „Bestien“ aus dem Zoologischen Garten, die nach den Angriffen über die Elbwiesen irrten. Sie tauchen in keiner der Statistiken auf, die jene zählen, die in dieser Nacht erstickten oder verbrannten. Das Dresdner Gedenken schließt sie nicht ein. Vielleicht hält Grünbein sich deshalb in den Städten der Welt an die Tiere. Eingesperrt in Stahl oder Zement, erinnern sie ihn an Rilkes Panther oder an die vom Feuer gehetzten Pferde und Löwen, die damals wohl nur der Zoodirektor und ein paar Clowns beweinten. Womöglich sind ihnen insgeheim jene Gedichte gewidmet, die er ihren Leidensgenossen geschrieben hat: einem Fennek in der Altstadt von Sanaa, einem Okapi im Münchner und einer Gepardin im Moskauer Zoo.
III
Unter dem 6. August 2000 findet sich in Grünbeins Tagebuch Das erste Jahr eine Reflexion über Dresden, die einen ganz neuen Ton anschlägt. Anlaß ist der Jahrestag von Hiroshima.
Ein einziges Mal, immerhin, bist du der logischen Verzweiflung nahegekommen.
Dieses eine Mal freilich ist das Fazit eines Gedankengangs, wie er unerbittlicher nicht sein kann. Er kreist um die Frage: Was wäre gewesen, wenn die für Hiroshima bestimmte Bombe auf Dresden gefallen wäre? Zumindest eines ist sicher: Diese Überlegungen wären niemals angestellt worden, nicht von Grünbein.
Bei einem Einsatz auf dem Kriegsschauplatz Deutschland wäre alles vernichtet worden, was dich ermöglicht hat: von der mütterlichen Eizelle über die zufällige Angestelltenfamilie bis hin zur Geburtsstadt selbst, jener kostbaren urbanen Sphäre, an die sich all die musischen Phantasien bis heute klammern.
Schon in dem Zyklus „Europa nach dem letzten Regen“ hatte Grünbein diesen Gedanken aufgegriffen. Damals hatte er sein Erschrecken mit einem sarkastischen Bild gebannt. Durch eine elegische Formulierung war ihm dennoch das Entsetzen abzulesen:
Der Riesenpilz, die weltberühmte Abschiedsgeste
Der alten Opernhimmel. Wieviel schöner
Wäre der strahlende Bovist hier aufgeblüht
Über der sandsteinhellen Residenz als Krönung
Barocker Baukunst. Aufs Gemüt
Schlägt die Vision, wie stilvoll hier die legendäre
Finale Wolke aufgegangen wäre.
Das Nachdenken über den Ast, auf dem man sitzt, und über die Säge, die ihn fast abgeschnitten hätte, läuft unweigerlich auf eine Aporie hinaus. Für den Metaphysiker hält eine solche Überlegung dann aber doch eine Erkenntnis bereit:
Die heilsamsten Gedanken sind jene, die an den Ort zurückkehren, an dem möglich und unmöglich zwei Seiten derselben Medaille sind.
Der Körper hingegen hält sich nur an das Mögliche, an das, was ist, beglaubigt durch seine Existenz. „Du, allein mit der Geschichte im / Rücken“, heißt es in Grauzone morgens. Was der Nachgeborene bedauern mag, ist dem Körper die einzige Realität. Nicht selbst erlebte Geschichte wird nicht registriert und nicht erinnert. Oder, wie Barthes schreibt:
Als lebendiges Wesen bin ich das genaue Gegenteil der Geschichte, ich bin das, was sie dementiert, was sie zugunsten meiner eigenen Geschichte zerstört.
Aber nicht nur der Gedanke, der Grünbein „der logischen Verzweiflung“ nahebrachte, ist bemerkenswert. Erstaunlich ist vor allem sein Ton. Keine Spur mehr von dem Sarkasmus, der das „Gedicht über Dresden“ fast elektrisch auflud. Im Tagebuch spricht Grünbein vom „geliebten Dresden“ und seiner „kostbaren urbanen Sphäre“. Am Jahrestag steht in Klammern der Satz:
Dreizehnter Februar: alle Jahre wieder geht Dresden, die schöne Heimatstadt, unter.
Die Abkehr von den Zynismen, die sich schon in „Europa nach dem letzten Regen“ andeutete, wird hier zum Programm. Die Distanz gegenüber der Geburtsstadt scheint nur noch minimal, der elegische ersetzt den kalten Blick. So auch in dem Band Erklärte Nacht: Ein Gedicht wie „Nostalgischer Krebs“, Ingo Schulze, dem Freund aus Dresdner Tagen, gewidmet, hätte Grünbein zur Zeit von Schädelbasislektion sicher nicht geschrieben. Auch wenn sein Thema, die Schrecken der Kindheit, keine wirkliche Nostalgie weckt, ist sein Ton mild.
Zeit: Sie färbt nicht nur den Dresdner Sandstein grau, sondern läßt auch die Vergangenheit in einem anderen Licht erscheinen.
Je mehr erlebte Zeit vergangen ist, desto untröstlicher wird alles, was man schreibt und damit tränenreicher, fließender.
Jeder Jugend, überall auf der Welt, falle es leichter, in harten Sätzen auszusprechen, was sie bedrücke oder ablehne. Wenn man dann nach Jahren wieder auf dasselbe blicke, werde aus der Ferne ganz unvermittelt Nähe.
Aus brutaler Einsicht wird historische Gelassenheit.
In diesem Spannungsfeld bewegen sich Grünbeins Texte über Dresden. Am Anfang steht die „Grauzone“, das „Barockwrack“, am Ende das „Musennest“.
IV
In dem Jahr, in dem Grünbein geboren wurde, erschien in Halle Heinz Czechowskis Debüt Nachmittag eines Liebespaares. Darin findet sich das bereits 1957 entstandene Sonett „An der Elbe“. Als das Gedicht Anfang der achtziger Jahre in dem Auswahlband Ich, beispielsweise erneut gedruckt werden sollte, ließ der Autor nur noch die abgewandelte erste Zeile stehen: Sanft wie Tiere gehen die Berge neben dem Fluß.
Alles andere verwarf er, weil, wie Wulf Kirsten erklärt, „ihm das Ganze in seiner linearen Schreib- und Denkweise zu stark auf Illusion und Idyll aus war“. Von Czechowskis Sonett bis zu den apokalyptischen Flußbildern in Grauzone morgens ist es ein weiter Weg. Auch Grünbein hat ein Gedicht mit dem Titel „An der Elbe“ geschrieben, doch anders als bei Braun, Mickel, Tragelehn und auch dem 1951 geborenen Michael Wüstefeld findet sich darin keine Reminiszenz an Czechowskis Vers. Sein Gedicht liest sich wie ein Gegenentwurf zu dem Sonett des Älteren. Während Czechowski die „Schönheit der Welt“ anruft und das leise „Gurgeln des Wassers“ als Idyll beschreibt, schwärmt Grünbein längst nicht mehr vom Duft der Gräser, von Wolken, Wiesen und Sternen. Das Ich streunt „ganz // grundlos diesen vergifteten Fluß entlang“, zählt „die Enten und un- / verwüstlichen Schwäne“ und schaut dem „treibenden Unrat“ nach: „Papierfetzen und / Blechkanister, etwas // Polystyrol“. Von der „kahlen Uferterrasse herab“ beobachtet es angewidert, wie jeder Zufluß „neue Blasen zartleuchtender / Chemikalien“ aufwirft. Im Gegensatz zu Czechowskis emphatisch ausgestelltem „Glücklichsein“ konstatiert Grünbein Unbehagen beim Anblick des grauen Stroms.
Auch Grünbeins Gedicht „No. 8“ spricht von der Elbe, wie sie, „Kloake mit ihren wenigen quellebendigen // Wirbeln längst ölgeworden doch / eines Morgens wieder entufert lag“. Wenn von Landungspontons „strudelnd in Seenot“ die Rede ist, von „Möwenspähtrupps“ und „Regenfluten“, die „das Einerlei des / verdammten Elbtalkessels zum / Brodeln“ bringen, erinnert der Text auf frappierende Weise an das Dresdner Hochwasser. Grünbeins Sprache ist ebenso genau wie seine Beobachtung. Diese Genauigkeit läßt keine Verzerrung zu. Es liegt Grünbein fern, seinen Grauton auch nur aufzuhellen. Dieses Mißtrauen gegen jegliches Idyll teilt er mit einem anderen Dresdner Dichter, der nur von einem flüchtigen Leser unter die Idylliker eingereiht werden kann. Ein solcher aber ist Thomas Rosenlöcher keineswegs. Das Bild der toten Elbe etwa hat er schon immer in düstersten Farben gemalt:
An schwarzer Mauer schwarze Industrie
entleert sich schweigend in das schwarze Wasser.
Durs Grünbein ist nicht durch die Sächsische Dichterschule gegangen, die für einen ihrer Protagonisten nicht viel mehr war als ein Treppenwitz Georg Maurers. Prägend waren für ihn Dichter wie T.S. Eliot und Ezra Pound. Das „Wüste Land“ fand er auf den spätsozialistischen Müllhalden und Schrottplätzen wieder. In seinem Essay „Vulkan und Gedicht“ erzählt Grünbein von den verbotenen Exkursionen seiner Kindheit auf einen riesigen Müllberg in der Vorstadt Hellerau: „unter dichten Rauchwolken wie ein Vulkan“ aufgeschüttet, „kegelförmig mit breitem Plateau“, ein „Endlager aller verdaulichen Reste, die die Stadt täglich ausschied“. Die Berge urbanen Mülls zogen ihn an und erwiesen sich bald als Fundgrube: Fahrradteile und schmierige Illustrierten, für Fotografien längst Verstorbener, alte Münzen, Verbandszeug, Eiserne Kreuze. In diesen Schichten, Resten vergangener Leben, war für den Nachgeborenen zum erstenmal die Geschichte mit Händen zu greifen. Sie war der Berg, auf dem er stand: ein stinkender Abfallhaufen, der wacklige Grund unter seinen Füßen, den er durchstöberte, auf der Suche nach Dingen, die man noch brauchen konnte.
Es muß für ihn ein Schock gewesen sein, als er später erfuhr, daß unter diesem Müllberg das alte Dresden begraben lag.
Hier am nördlichen Stadtrand hatte man seine Trümmer zu einem riesigen Tafelberg aufgetürmt, die gestürzten Kirchenportale über die leeren Balkone, die Emporen zerbombter Theater über Rümpfe brandgeschwärzter Statuen. Und als hätte der glorreiche Schutt alles spätere nach sich gezogen, war seither sämtlicher Müll aus den Wohnhäusern hierher geschafft worden, abgelagert auf dem Ruinenkehricht einer untergegangenen Stadt.
Die untergegangene Stadt aber war jenes „Suchbild“ am Fluß, das den Nachgeborenen täglich verwirrte.
Die poetologischen Überlegungen, die sich mit dem Bericht von den Erkundungen auf dem Müllberg verbinden, machen diesen Essay zu einem Schlüsseltext für Grünbeins frühe Lyrik. Das Umdrehen und Beiseiteräumen, das unter der Oberfläche zu älteren Schichten führt, erscheint als eine archäologische Grabung. Verschüttetes wird in die Gegenwart zurückgeholt. Nicht nur die Skelette des von der Lava wie eine Fliege im Bernstein eingeschlossenen pompejischen Liebespaares oder das Eiserne Kreuz des von einer Statue erschlagenen Soldaten, sondern auch die jahrtausendealten Schriften von Horaz und Seneca. Grünbein hat die Episode auf dem Müllberg mit benjaminscher Präzision gedeutet: Die grauen Fundstücke, die er damals aus dem Abfall klaubte, seien Kapseln gewesen, aus denen die Denkbilder fielen.
Das wenige, worauf später die Spitzhacke stößt, der Pinsel des Ausgräbers, die Schaufel des Müllsammlers, dies ist der Stoff, aus dem die Gedichte sind.
V
Der Pinsel des Ausgräbers: Er ist das bevorzugte Instrument der Dichter an der Naht der Jahrtausende. Es spielt keine Rolle, ob sie aus Ost oder West kommen. Auf ganz eigene Weise gehen Lyriker wie Marcel Beyer, Thomas Kling, Lutz Seiler und Christian Lehnert den Dingen auf den Grund. Das Gedicht beginnt mit einer „Trümmerschau“. In dem Essay „Mein babylonisches Hirn“ spricht Durs Grünbein davon, daß nur wenige Zeilen der Sappho auf winzigen Tonscherben überliefert seien. Um ebensolche Scherben, Bruchstücke einer früheren Erinnerung, handele es sich im Grunde bei jedem Gedicht:
Vor uns liegt ein Splitter manifest gewordenen Bewußtseins aus einem Leben, das wir niemals leben werden, weil es ein anderer schon gelebt hat, unwiederholbar, Lichtjahre entfernt in seiner Monade, und wahrscheinlich ist auch das Fenster, durch das wir hineinsehn jetzt, nur eine Täuschung.
Lichtjahre entfernt erscheint heute auch Grünbeins Dresden. Mit der DDR hat die Geschichte auch das „Barockwrack“ verschluckt. Auferstanden aus den letzten Ruinen ist der Genius loci und triumphiert über die sozialistische Großstadtkultur. Reingewaschen von den reißenden Fluten der Elbe und der Weißeritz im August 2002, erstrahlt Dresden in neuem Glanz. Man nennt sich Freistaat, und in der Elbe, sagt man, gibt es Lachse.
Das Fragment der Stadt, das zur Zeit von Grauzone morgens Alltag war, jedoch nie als normal empfunden wurde, ist heute nicht mehr ohne weiteres erkennbar. Die Nachkriegszeit endete in Dresden erst 1990, da aber mit einem Paukenschlag.
Hoch- und Tiefbau verändern das Stadtbild in wenigen Wochen mehr als früher in ganzen Jahrzehnten.
Eine Fermate nennt Grünbein die vierzig Jahre davor. In seinen ersten Gedichten ist Grünbein der Chronist dieser Fermate. Die Bewußtseinssplitter in Grauzone morgens überliefern ein Bild der „Restestadt“, wie eine Fotografie es nicht genauer wiedergeben kann. Ihr fragmentarischer Charakter ist schon an der typographischen Anordnung der Verse erkennbar, die den Eindruck von Zerrissenheit erweckt. An die Stimme dieser Gedichte wird sich halten müssen, wer wissen will, wie es in Dresden war, als es noch einen Rotarmisten gab auf einem Platz der Einheit.
Seit dem „Gedicht über Dresden“ war der Blick auf seine Heimatstadt für Grünbein ein Blick in den Rückspiegel. Fast alle Texte zu diesem Thema sind Erinnerungstexte. Sie suchen einen Ort auf, den es nur noch in der Vergangenheit gibt. Die Stadt, über die Grünbein in der Gegenwart schreibt, ist Berlin. Doch auch hier kommt ihm zuweilen der Gedanke an das „Musennest“ in die Quere, werden in der Stille des Tagebuchs Vergleiche gezogen, deren Ironiepotential womöglich auch für den Schreiber eine Variable ist. „Wie ist dagegen Berlin?“ fragt er in seinen Aufzeichnungen Das erste Jahr nach einer kleinen Betrachtung über den beleidigten Schönheitssinn, der für ihn mit Dresden zu tun hat. Die Antwort ist nichts für Zartbesaitete:
Ein Kasernenhof von städtischem Ausmaß, ein pockennarbiges, mit Beton begradigtes Pflaster, der Kronkorken als öffentliche Anlage, ein Rekrutenstall als urbane Norm.
Wer im Ernst möchte da leben?
Durs Grünbein hat nichts dagegen. Berlin sei der tröstlichste Ort, wenn man aus einer der großen Weltstädte zurückkehre, weil es „der ideale Transitraum geworden ist und ein ganz zentraler europäischer Ort, an dem sich die Kräfte sammeln“. Man kann diesen Trost vielen seiner Gedichte ablesen, die in den letzten Jahren entstanden sind und von Berlin erzählen. Trotz mancher Sarkasmen ist er zu hören. Heimatgefühle sind in dieser Wertschätzung durchaus enthalten, auch wenn sie von anderer Qualität sind als die, die er Dresden entgegenbringt. Was heute dort geschieht, kann dem nichts anhaben. Ort, an dem er aufgewachsen ist und der ihn geprägt hat, existiert nur noch in der Erinnerung. Erst der Blick zurück trifft das Vertraute, das nur in der Imagination nicht verloren ist. Von dort stammen die Splitter, aus denen er seine Gedichte formt. „Nostalgischer Krebs“ ist einer dieser Texte, der die versunkene Welt der Kindheit beschwört. Ein anderer, erst kürzlich veröffentlicht, trägt den Titel: „Heimliche Rückkehr“. Er spricht davon, wie es ist, an einem Ort wie Dresden geboren zu sein, wo „der Traum restaurierte, was draußen fehlte“. Es ist ein Rückblick: elegisch, von keiner Nostalgie schöngefärbt. Noch immer ist Grau die vorherrschende Farbe, die sich ins Hirn frißt und das Denken vernebelt. Die gefühlte Temperatur geht gegen Null. In der dritten Strophe wird die Grenze markiert, wo jeder Rückblick endet: Erst wenn sich mit der Zeit die Erinnerung verliert, gibt es nichts mehr über die verlorene Heimat zu sagen.
Staub oder Dunst oder Ruß – das Gemüt, früh bedruckt
Von der Landschaft in Bleisatz, dem Graudruck ringsum,
Federt spät erst wie Tundra, gefrorener Boden, zurück,
Bis als letzter der Zeugen das Gedächtnis verstummt.
Renatus Deckert, Sinn und Form, Heft 2, März/April 2004
2 Werkinterpretation
2.1 Kontrollierte Entfremdung. Der Gedichtband Grauzone morgens
2.1.1 Annäherung an keine Farbgebung – Das Grau als Folie für Berichte von einer mediokren Welt. Einige Überlegungen zur Korrelation von Titel und Inhalt des Grünbeinschen Debüts
Grau ist… die Farbe der Endlichkeit1 Aris Fioretos
Grauzone ist ein schweres leichtes Wort. Es steht nach allgemeiner Auffassung zunächst vor allem für einen Raum zwischen Offiziellem und Inoffiziellem. Eine Grauzone markiert gemeinhin einen Ort des nicht Reglementierten, des Unkonventionellen – einen Ort, an dem Versuche und Alternativen möglich sind. Expressis verbis ist die Grauzone aber auch eine Zone des Übergangs, in der Hell und Dunkel ineinander übergehen, Konturen verwischen und sich aufzulösen scheinen. Die Grauzone ist somit ein Distrikt an den Rändern der Wirklichkeit.
Das Grau verfälscht nicht nur die Konturen, es macht Dinge auch durchschaubarer, indem es ihnen falsches Licht nimmt. Die Kontraste werden deutlicher, unnötige Bilderfracht verblasst.
Dementsprechend funktioniert die Grauzone morgens bei Durs Grünbein: Sie wird als Filter benutzt, der den Grundcharakter, das ,Skelett‘ der Dinge stärker hervortreten lässt. Die Wirklichkeit pellt sich vor den Augen des Betrachters, ohne dass hinter den Hülsen ein lohnender Kern zu entdecken wäre.
Die Grauzone verkörpert mit Grünbein Kälte und Ernüchterung. Sie ist ein seelenloser Bereich mit fast stummen Emotionen. Sein Zonengänger darin ein stoisch-gelassener Passant, das in doppeltem Wortsinn Diktat der Umwelt unaufgeregt verzeichnend, das Grau in Grau samt den Untertönen mitnehmend, befragend und es insubordiniert entlarvend.
Die Grauzone morgens ist nicht die Phase der morgendlich-unvollendeten Dämmerung, die ins Helle keimt – sie ist die Grauzone, morgens betreten. Das Grau ist der Status quo. Das von Grünbein gezeichnete Universum ist eine Grauzone bereits morgens. Der Tag tritt aus dem Dunkel nicht ins Licht. Die Welt ist verbraucht und wird es bleiben. Romantik ist keine. Das Ich erlebt kein Refugium, sondern einen zugewiesenen Raum, in dem grau und Grauen eng beieinander stehen.2
„Im Grau steckt der Übergang, das Retardieren aller chromatischen Möglichkeiten“3, erklärt Durs Grünbein das motivische Grundmuster seines ersten Buches. Er konstruiert und reflektiert einen Raum der Haltlosigkeit. Der goldene Abhang der Frühe4 wird in einem Gedicht nur deshalb entworfen, um zynische Pointe zu sein – eine Farce angesichts zuvor notierter Tierherden auf dem Weg in den Tod:
Gesehen ganz wie
von neuem (geschockt):
diese Viehtransporter
vollgestopft mit
geduldig blökenden
Schafen und Massen
dreckiger Rinder
steifbeinig äugend
durch schmale Ritzen
im Holzverhau. „Da war
nichts zu machen da
mußte man durch…“.
Was für ein Lärm
auf den Straßen in
dieser Morgenstunde
unterwegs nach dem Schlachthof die
alten Hundertopfer5.
Die graue Zone ist die „schwarze Milch der Frühe“6, die Paul Celan in der „Todesfuge“ beschwor. „wir trinken sie“, schreibt Celan, „mittags und morgens wir trinken sie abends“7. Grauzone morgens zeigt die selbe tragische Vision. Es gibt einen latenten Schmerz, einen Rückstand, eine ,Asche‘ im Sinne Derridas.8 Ihr Konsum ist unausweichlich. Die Grauzonentexte haben einen ähnlich bitteren Rhythmus, auch wenn die Motive des ohnmächtigen Sprechens zwischen der „Todesfuge“ und den Gedichten Durs Grünbeins voneinander verschieden sind. Dessen Distanzhaltung erscheint weniger depressiv als die tief verinnerlichte, historisch bedingte Konsternation bei Celan. Das weniger Unfassbare ist fassbarer, gefasster. In der Asche des Grau gibt es mehr Raum für eine Leichtigkeit des Sprechens.
Staffierten die Vertreter frühmoderner Literatur ihre pessimistischen Fantasien noch mit apokalyptischem Rot und der Düsternis des Schwarzen aus, formuliert Grünbein die seinem Ich im Kern fremde Welt als auch farblich mediokre Erscheinung.
Grau ist Weder-noch, ist als Summe aller Farben keine. Sie ist gesteigertes Schwarz. Die Welt ist nicht finster, wird nicht nihilistisch gesehen: sie ist bloß grau, mittelmäßig und per se einförmig. Im Grau, dem Ende der Farben, offenbart sich das, was weißes Rauschen (ein eigentlich graues Rauschen) ausmacht: die Überlagerung von Zeichen. Es ist eine Wüste von Signifikaten, ein Zuviel. Das monotone Chaos der Grauzone ist Grünbein die untere Grenze verwertbarer Signale.
2.1.2 Das Ich zwischen Kulissen von Harmlosigkeit und Katastrophe – Auf der Suche nach dem ephemeren Schatten des Schönen
Wie ein Fremder flaniert Durs Grünbein durch seine diagnostizierten Räume urbaner Paralyse. Stehende Zeit ist ein grundlegendes Symptom dieser Grauzone.9 Die Lyrik dazu erzählt kaum Geschichten, sondern reiht Bilder und lakonische Synopsen aneinander.
Der Zustand des Ist ist die Folge einer Krankheit im Gestern. Dort liegt ein ungenanntes Fiasko, das als schwere Bürden Alltäglichkeit und Normalität hinterlassen hat.
Die Texte berühren teilweise das Nachrichtengenre. Ohne herausgehobene innere Bewegung werden die Erfahrungen von Extremen aufgeführt – vielleicht, weil sie zur Gewohnheit geworden sind, unverkennbar zu Sachverhalten. Mit nüchterner Stimme evoziert das lyrische Ich die von ihm erlebten Bildwelten. In einer Mischung aus Verwunderung und seltsamer Ferne tritt es in die Grauzone ein, der eine fast nur ahnbare Bedrohung eingeschrieben ist:
Den ganzen Morgen ging dieses Geräusch gleich
förmig und offenbar unterirdisch dieses
Geräusch so unablässig daß kaum jemand es hörte?
dieses Geräusch tausender Reißwölfe einer un
sichtbaren Institution die jeden lebendigen
Augenblick frisch vom Körper weg wie Papier
kram verschlangen10
Die suggerierte Beklemmung gleicht einer alptraumhaften Lähmung. Ein Geräusch, als dieses Geräusch schon fast mystisch, ist analysiert, kann aber nicht lokalisiert werden. Es ist nicht infernalisch, sondern suggestiv, ist ohne Spur und damit viele Spuren. Dieser unbestimmte Dauerton einer unsichtbaren Institution verweist symbolisch auf etwas wie einen Moloch; der das Ich systematisch martert. Durs Grünbein scheint zu sagen: Die Diagnose ist uns noch möglich, die Schädigung aber schon eingetreten. Wir sind ausgeliefert, einem anonymen Gegner.
Das Präteritum des Sprechens charakterisiert den Zugang als eine Art Autopsie. Hier wird ein Mysterium ex post betrachtet, hier findet eine Rede nach einem Tod oder Verlust statt. Als sei dieses düstere Geräusch schon Sieger.11
Etwas ist integral in die Welt gebrochen und nicht bezifferbar. Die unterirdische Institution tausender Reißwölfe assoziiert Geheimdiensttreiben, Kafkas Schloss oder die Moderne an sich – ein stupides Räderwerk. Mitgeteilt ist die kategoriale Entmenschlichung, die unerbitterliche Basis des Seins.
Ein Phänomen, das auch Johannes Jansen fasst, wenn auch mit weniger dramatischer Konsequenz:
seit längerer zeit hängt ein konstant wahrnehmbarer schwirrender ton in der luft dessen herkunft nicht genau auszumachen ist. dieser ton ist mal leiser mal lauter stört aber vor allem nachts ganz erheblich.12
Hier hat sich der Mensch mit der subtilen Maschinerie des Unnatürlichen bereits in grotesker Weise arrangiert, dort wird ihm noch das Leben wie Papierkram vom Leib gerissen. Bei beiden Autoren ist er nur mehr Material, Körper, Insasse.
Fast analog offenbart sich die indefinite Bedrohung auch in einem frühen Text Hans Magnus Enzensbergers:
etwas, das keine farbe hat, etwas,
das nach nichts riecht, etwas zähes,
trieft aus den verstärkerämtern13.
Auch hier ein kafkaeskes Regulativ, ausgehend von einer Apparatisierung des Lebens.
Es ist eine Annäherung an die „Keime des Monströsen“14, wie sie Peter Geist bei Thomas Böhme ausmacht. Das Martyrium der ominösen Institution hat sich in den Menschen selbst hineingefressen. Das „Rauschen der Filter- / anlagen in uns“15, wie es im folgenden Gedicht Grünbeins heißt, ist eine ähnlich selektierende Maßnahme wie das peinigende Wirken der tausenden Reißwölfe. Der Mensch sei sein eigener Reißwolf und der der anderen.
Alles passiert jetzt in Augenhöhe. Den
ersten Gesichtern, kantig und
hart, fehlen
nichts als die schwarzen Balken
über den Augen16
Das Gedicht transportiert die Wahrnehmung extremer Anonymisierung. Die Passanten „auf dem / Weg durch die Stadt / heimwärts / oder zur Arbeit (was macht das schon17 sind isolierte, vom Alltag modifizierte Wesen. Ihr Puls ist die Vorgegebenheit.
Durs Grünbein verlässt das eher metaphysische Szenario der Evokation und dringt in die ,Realität‘ ein. Erhalten bleibt – als Grundmelodie – das fast schon materielle Geräusch des Eingangstextes. Der Mensch als Sadist produziert es mit und duldet es masochistisch, indem er „schräg / gegen d[ies]en Kopfschmerz“18 geht. Man wird quälend fremdbestimmt und ist zugleich selbst Auslöser des Schmerzes. In Grünbeins Grauzone sind die Menschen fatale Wesen, in ihrer Tragik Lemmingen gleich. Das was ,passiert‘, ist nicht nur ereignis-, sondern letztlich auch bedeutungslos.
Den „verfallenden Kulissen einer in Auflösung begriffenen Welt“19 gegenüber ist das Ich mundtot20. Die Rettung liegt, wenn überhaupt, im Detail:
Etwas das zählt (gleich am Morgen) ist
dieser träge zu dir
herüberspringende Chromblitz eines
Motorrads.21
Oder
Kaugummi, weil es die beste
Arznei ist gegen
Barockphobie22
Gegen den Wust von Künstlichkeit23 und Tristesse setzt Grünbein unscheinbare, unverlogene Idyllen, die trotz ihrer Banalität wenigstens für Momente die graue Ordnung durchbrechen. Das Paradigma des Grauen, der Bereich der Schatten ermöglicht eine Art ,Zwiewahrnehmung‘. Versöhnung und Fatalität durchdringen sich ständig: Hinter dem Chromblitz versteckt sich ein abgekühlter Sommer24 und „pünktlich wird Herbst / kommen die Depressionen“25.
Die Essenz der Moderne findet sich in Durs Grünbeins panoptischem Universum überall. Pars pro toto lässt sich der Charakter der Gegenwart aus den Niederungen des Alltäglichen, der Nebenschauplätze heraus lesen.
frühmorgens genügt schon
ein einzelner Mann
alles ringsum
aufzusaugen wie hinterm
erstbesten Stellwerk am Nebengleis
dieser pissende Kerl. Unkraut und
brauner Schotter
soweit der Blick reicht.26
Das lyrische Ich erlebt eine lethargische Welt lethargisch. Stellvertretend nölt ein Radio späte Verzweiflung,27 In den Bildern liegt monotone Trauer28 – und dahinter (zunächst) kein Mythos.
Grünbeins Psalme lakonischer Pointierung verkümmern im dauerhaften Gebrauch zu mindestens ermüdendem Pathos. Er seziert die Grauzone weiter und weiter und damit auch ins Uferlose. Sein Bemühen, die Stimmung ,grau‘ umfassend zu explizieren, anonymisiert den Einzeltext innerhalb einer ,grau‘ werdenden Masse von Gedichten. Der ganze Zyklus erhält im Wechsel des Aufbaus scheinpoetischer Stimmungen und deren Brechung den Charakter einer einzigen Ballade.
„Beliebige Details im ungenauen Licht, und nichts davon wirklich interessant“29, kritisiert Harald Hartung in einer frühen Reaktion auf die Grauzone morgens. Das feststellbare Abarbeiten von eher konventionellen Einsamkeitsvokabeln (Nomade, Ruine, Plastikklänge, anonym, zersplittert etc.) lädiert die poetische Idee. Man landet zwangsläufig selbst im „toten Wirrwarr abgestandener Bilder“30, die Grünbein an den Pranger stellt.31 Das konzentriert einseitige Empfinden an Orten der Agonie provoziert Verschleißerscheinungen.
Energie bezieht die Lyrik vor allem auch aus Sarkasmus in zumeist Kurzfassung. Seine Versuche über die Erfahrung der Agonie nennt Grünbein rückblickend „Sarkasmen, die das verwundete Ich für Momente befriedigen sollten“32. – Eine Befriedigung wohl deshalb, weil selbst die gefühlte Stasis beruhigend wirkt, wenn sie geteilt wird.
Die forciert sarkastische Depressivität in den Texten Durs Grünbeins ist Programm. In einem fiktiven Brief an sich selbst bekennt er eine „Grundhaltung, die man nach und nach als konfessionell bezeichnen könnte“33. Es ist ein Zwang auszumachen, die maroden Räume, welche ohne wirkliche Poesie sind, mit der Ohnmacht, die sich an ihnen entwickelt ( oder schon da war?), nicht verlassen zu können.
Für ihn ist der Schaffensraum zwischen dem – ambivalent genug – Sich-Einlassen und dem Distanzgestus „ein Versuch, mit prinzipiell antihumanen Situationen umzugehen. Sarkasmus“, sagt er, „kommt ja daher, dass man versucht, in einem uralten Medium mit den paar idiotischen Erfahrungen, die man hat, auf Situationen zu reagieren, die längst absolute Zerreißproben darstellen. […] Ratlosigkeit gegenüber Zusammenbrüchen, Tod und Vergänglichkeit, dazu ein gewisser Trotz: Das führt zum Sarkasmus.“34
„Also von vorn“35 heißt es einmal. Das Ich muss sich immer wieder überwinden, die Grauzone aufzunehmen und mitzuteilen, die Rage zu dämpfen: Weil im Sprechen ein Mittel der Verarbeitung liegt, in der Wiedergabe die Möglichkeit, sich frei zu sprechen. Als der Erlebende spricht Grünbein zu sich selbst, als Autor zum Leser: Zu dem, der ihm den schweren, schwärigen Weg durch die Grauzone folgt. Das also von vorn ist der Imperativ des Chronisten, den Unzustand kontrastiv gegen dessen Duldung zu setzen. Die Welt, die Grünbein schildert, gelangt- wenn man so sagen will – immer wieder in ihrer Urkatastrophe an. Die Poesie des Augenblicks wird mit metronomischer Präzision von der Destruktion eingeholt. Das Schöne ist ein ephemerer Schatten. Den wenn auch per se faden, so doch zu grotesker Individualität inszenierten Bildern und Szenen folgt unausweichlich der trockene Abgesang, das herbe Fazit. Nach dem Gang durch eine morbide Urbanität vermeldet der Dichter in postapokalyptischer Ruhe die „langsame Einfahrt in die zerstörte Stadt“36.
Was zerstört ist, ist aber noch lange nicht vernichtet. Diese Welt funktioniert, aus ihr lassen sich eben nur keine absoluten Idyllen (mehr) erzeugen. Es existiert eine elementare Diskrepanz zwischen ihr und dem Dichter: Welt hier, Weltschmerz da – wenn auch souverän gehandhabt. Die Gegenwart kann noch erfahren werden, es wird aber zu keiner Synchronisation kommen. „Das Misstrauen ist total“37, stellt Harald Hartung fest.
Die Menschen sind Gefangene eines inhumanen Trugbildes.
Frei
von Traumbelag kommen dir
selten Entzugs-
erscheinungen längs
all der funkelnden Schienen an die
geheftet du durch den Tag
gleitest.38
Der Einzelne, die Bedeutung minimiert, ist zum Mitlaufen verurteilt, „eingeschlossen / geduldig im Leib des Tausendfüßlers“39, immer den orwellschen Staat im Nacken.
Grünbein zeichnet den Menschen als ,glückliches‘ Opfer, „süchtig / nach einer Wirklichkeit wie / aus 2ter Hand“40. Zufrieden mit „dieser eiskalten Reizworthölle, den / Massen zersplitterter Bilder / […] / eingesperrt in überfüllte Straßenbahnen, gepanzert auf / engstem Raum“41. Man lebt im Klima subtiler Aggression, durch Gewöhnung und intellektuelle Defizite fatal verkettet mit der Realität. Es sind nur wenige Schritte vom Instinktiven zum Automativen und Ignoranten. Der Mensch wird verwaltet, stellte Max Weber fest. Für Grünbein sitzen die Restriktionen schon im Innern. Die Verschmutzung der (zwischen-)menschlichen Substanz – ein weiteres Grau.
Der Mitmensch gerät als Humanoid ins Blickfeld, dem die Humanitätsgeste nicht unbedingt eigen ist. Grünbein verzeichnet einen ,molekularen Krieg‘ der modernen citizens. In diesem Gefecht ist die Kommunikationslosigkeit eingeschlossen. Das menschliche Wesen, welches bereits von Nicolas Born als Lochkartenexistenz42 klassifiziert wurde, scheint nunmehr völlig ausgestanzt zu sein; erreicht das lyrische Subjekt nur als fiepende Rückkopplung.
Mit Texten wie den eben beschriebenen projiziert der Autor den Backdraft einer inhumanen Unwirtlichkeit auf das menschliche Subjekt, wodurch sich in zweiter Linie dann ein Katalog des Objekts des gesellschaftlichen Körpers ergibt. Die gesamte Gefühlskälte, die Fortentwicklung der Wirklichkeit vom Menschen,43 die Unkontrollierbarkeit des Lebensraumes, der Kakophonie der Wahrnehmungen, sowie die erbarmungslos rasante Entwicklung verdichten sich zu einer so etikettierbaren ,Hartmoderne‘. Die Stadt ist das Dickicht der Stadt – umfassend überlagern sich Lebenswelten. Es ist die Stadt der postmodernen Moderne „mit all ihrer kaleidoskopischen Komplexität“, mit einer „zunehmenden Gleichwahrscheinlichkeit von Leben und Tod und damit der maximalen Entropie“44.
Die Reibung dieser Sphären erzeugt keine Energie, nur Verlust. Durs Grünbein setzt sein Skalpell tief an:
Stell dir vor: Ein Café voller Leute, alle
mit abgehobenen Schädeldecken, Gehirn
bloßgelegt
(Dieses Grau!) und dazwischen
nichts mehr was eine Resonanz auf den
Terror ringsum
dämpfen könnte. Amigo, du
würdest durchdrehn bei diesem einen
Sinuston von
garantiert 1000 Hz…45
Grünbeins Gesellschaft ist pathologisch, unpersönlich; Individualitäten sind nicht auszumachen. Das System Menschheit findet sich als Kollektiv von Einzelkörpern wieder: Pure Organismen, Biomaschinen – angekrankt, ignorant und gleichgeschaltet.
Das menschliche Wesen ist auf ein malades Gehirn reduziert, das als Restleistung eine flat line46 ausstrahlt. Der Ton klingt nach Perfidie, nach Nichtkommunikation auf hoher Frequenz. Das Homo hominis lupus est drängt aus dem Zwischenraum der Zeilen.
Durs Grünbeins Gedichte sprechen von der Ähnlichkeit, mit der die Welt geschlagen ist. Ein Text potenziert die Fülle leerer Zeichen, den „Wirbel grauer Pigmente“47, zu einer „toten Ähnlichkeit aller toten arm- und / beinlosen Engel auf den / Ruinen ringsum“48. Grünbein dekonstruiert die Engel als Mittler zwischen Mensch und Gott, die sie in religiösem Verständnis waren. Gottes Tod wird noch einmal festgestellt. Zu glauben hieße, sich zu belügen, geistlos ein Trugbild zu akzeptieren.
Das Ich durchmisst seine Welt in – schwere Fügung – hoffnungsvoller Hoffnungslosigkeit.
Also schön,
dachtest du: dieser Ort
so gut wie ein anderer
hier in Mitteleuropa
nach Sonnenaufgang mit
galoppierenden Wolkenherden und frühem
Stimmengewirr wie vom Sog
eines Hafens
erfaßt… Ist es das?49
entscheidende Frage – jene, die im Brei von Resignation und Duldung einen wachen Kern erkennen will, im langweilig Normalen das Außergewöhnliche, das Wahre, Schöne und Gute finden. Die poetische Suchbewegung hofft, das Leben dort anzutreffen, wo es lebenswert ist, phänomenal und unverwechselbar und nicht bloß eine Lüge des Designs: Attrappe und Kulisse.
Das Essentielle stellt sich aber nicht ein, die Texte fixieren Ersatzparadiese. Das Ich erlebt bestenfalls Surrogate wirklicher Erfüllung. Die Begegnung mit der Grauzone bedeutet die fortlaufende Amputation von Idealen. Es gibt keinen endgültig Optimismus bietenden Ort, keinen Sinn, der sich konservieren ließe. Das Leben ist ein Komplex von Ritualen und nivellierenden Tautologien – hypertrophisch angefüllt mit „eingefrorenen Gesten“50 in unnützer Wiederholung.
Das lyrische Ich ist mittendrin. Und unfähig bis unwillig, eine positive Resonanz auf den Terror ringsum zu geben. Sein zweifelhafter Vorzug: Das Grau überhaupt wahrnehmen zu können.
Selbst die Psalme der MonoLogischen Gedichte51 bieten kein Refugium. Die Meditationen führen zu keiner tröstenden Gewissheit, sondern brechen immer nur wieder in die unumgängliche Gegenwartstragik aus. Erik Grimm sagt über die monologische Sequenz:
the addresses are urged to keep their light mood despite the messages of upcoming disasters. A simple confirmation, not the rejection of bad news, will maintain one’s peace of mind.52
Die meisten der Ausblicke enden in sackgassenartigen Rückkopplungen.
Grünbeins Sarkasmen ergeben sich aus frappierend nüchternen Umgebungen. Es sind Orte ohne Charakter, Orte von A-priori-Illusionslosigkeit. Da ist die konturenlose Stadt, das billige Hotelzimmer oder die Industriezone, die jeweils selbst Tristesse verströmen und den Blick öffnen auf die sich ereignende Ereignislosigkeit.
Friedhof und oder Bibliothek (wie Peter Hamm nicht ganz zu Unrecht vermutet53) können dann für Momente eine Enklave sein, weil sie sich quasi außerhalb der Regungen der Zeit befinden. Durs Grünbein:
Gerade an solchen Morgen
da man im billigsten Hotel-
zimmer einer Kleinstadt
eingenistet aus Faulheit
ins Waschbecken pißt –
während draußen
das letzte Lied durch ein
Werkstor verschwindet
und niemand sich nach ihm
umdreht, niemand die
Münze aus dem Asphalt kratzt
oder zurückgeht dahin
wo er beim Frühstück hastig
das Stehenbleiben der Uhr
registrierte –
gerade an solchen Morgen
ist die Gastfreundschaft
der Toten geduldig
an ihren streng geheimen Ver-
sammlungsorten das einzige
wofür es sich lohnt
alles wegzuschmeißen.54
Sollte die Grünbeinsche Exegese der Misere doch einmal stimmungsvollen Beschreibungen weichen, dann sind es Bilder (mindestens) erodierten Charmes:
Kühl beim Durchqueren der Lattenzaun-
schatten war diese Luft
gesprenkelt von
Morgengerüchen, noch anonym. Erster Rauch
trieb vor mir her und das Hundegebell
aus den Schrebergärten
klang wie beim
Aufbruch aus einem Sammellager gedämpft.55
Das vordergründig Schöne ist eine Schattenwelt, eine beinahe zynische Phrase, die immer auch Assoziationen an die zivilisatorischen Ausgeburten weckt. Konsequent verweigert sich Grünbein jeglicher Faszination. Mit Adorno ist ihm die moderne Welt kein Raum mehr für (absolute) Pittoresken. Vor den kollabierten Bildern treibt Grünbein Kapriolen mit den Formeln der frühmodernen Theorie:
Schiefer Nomade, wach endlich auf! (In der
Mund-Höhle Eisengeschmack)… wo du
nicht bist, da fegt dieser Wind
über die trockenen
Hochlandsteppen des Nordiran oder
transsibirisch
für ein unhaltbares Ich.
In meinem Mantel
gilbte vergessen ein Zettel mit einer Fall-
Tabelle lateinischer Verben…
dissoziiert.56
Ambivalent ist die Rolle der Natur. Nur scheinbar ist sie eine Insel – ein Hauch atmosphärischer Stimmung erweist sich nicht als das Novalissche geheime Wort57, das die Welt von neuem elektrisieren könnte. „Die silbrige Leucht- / spur haarfein durch den / frostklaren / Himmel gezogen58, empfindsamer Beginn eines Gedichtes, ist nicht die letzte Option des Arrangements mit der eigenen Existenz.
Dennoch bildet die Wahrnehmung dieser Romantik wenigstens indirekt die Grundlage für einen rauschhaften Zustand. Auch für Grünbein „schwer zu / beschreiben: als dieses erste Licht / halbwegs vergessen war, spürtest du / plötzlich die Schwerkraft // in deinen Knochen. Alles schien dir / verkürzt (,Eine / Ordnung nie dagewesen…‘) und du // gingst wie benebelt im Ätherrausch / über den dröhnenden / Labyrinthen der Industrie.“59
Beinahe mystisch, weil unvorhersehbar, entwickelt sich eine Leichtigkeit, die die eben noch bewusst erlebte Prosa der Verhältnisse hinter und unter sich lässt. Der wenn auch flüchtige Eindruck von Naturromantik initiiert über den Umweg der spürbar gewordenen Schwerkraft das Vergessen-Können. Das Auratische des Moments und seine Wirkung generieren einen Zustand, in dem der Himmel plötzlich zur astralen Luft antik-griechischer Vorstellung wird.
Es sind vor allem die Menschlichkeit tragenden Augenblicke, die das Phlegma der lyrischen Stimme aufbrechen. Für Momente wird das ,kleine Leben‘ zum ,großen‘, essentiellen.60 Urplötzlich tut sich eine „ein wenig / lebendige Überraschung“61 auf, selbst an den in Grünbeins Lyrik gefassten unspektakulären Orten wie den überheizten Bibliotheken postlagernder Sorgen62. Ein schwules Tête-à-tête, nur am Rand wahrgenommen, wird so zum Eigentlichen.
Auch die Grauzone hat ihre lichteren Bereiche:
ICH
erinnere noch genau eines Nachmittags
im Sommer das
raschelnde Zwielicht als ich
beim Scheißen aus einer Nebenzelle der
Bibliothekstoilette
gedämpftes Atmen und Stoß auf Stoß
schnell sich steigern hörte: Mein Herz
flog plötzlich auf und ich
erschrak wie ein ganzer
Schmeißfliegenschwarm vor dem
Liebesspiel zweier Männer die stumm
aneinander arbeiteten
schwitzend und selbst-
vergessen wie fremde
kentaurenartige Wesen auf einer
überbelichteten Fotografie.
Schwer zu vergessen mit welcher
Erleichterung sie nachher
frischgekämmt jeder
hochrot und mit cremigem Teint
einzeln an mir vorübergingen und nur
ein Augenzwinkern (durch mich
hindurch) verriet mir:
Sie hatten sich kennengelernt.63
Und Grünbein ist insofern doch Positivist, als er diese Wahrnehmungen einfängt und nicht einem moralischen Programm nachordnet. Staunend steht sein Ich dann vor der Monumentalität der unscheinbaren Dinge, behutsam-hartnäckig64, wie Fritz J. Raddatz meint. „Was für seltsame Lebewesen / in diesem kalten Monat November“, heißt es angesichts traumartig wie Spinnen erscheinender Fensterputzer, die an „speichelsilbrigen Fäden hängen“65.
Das Bild wird so weit entrückt, dass es sehr lyrisch wirkt. Doch die Heile-Welt-Romantik ist nicht rein. Nur das Wort, nicht das intendierte Bild rangiert dicht am Mythischen:
[…] ich sah Antaios
gewandelt zum Schaufelbagger der
mastodontisch sich am
Chausseerand entlangfraß: Hüter der
Ausfallstraßen in ein gerodetes Land
und zwischen Kettenspuren blieb diese
Kabelrinne häßlich zurück und
anderntags tief ins Gedächtnis gegraben
die morgendliche Gewißheit:
Wie diese Erde aufgerissen stinkt.66
Obwohl die Texte insgesamt einen Energieverlust des Sprechenden offenbaren, gibt es durchaus unbeschwerte Stimmungen. Die Last des Pessimismus wirkt weniger konstruiert, wenn es Situationen des Ausbrechens, des Widerstandes gibt. Das Leben mag erbärmlich sein, aber in einer „herrlichen nervenkitzelnden / Irrenhaus-Nacht“67 wird es mindestens erträglich.
Fast ein Gesang reflektiert die Zwiespältigkeit der manifesten Tristesse, den Stimmungshochs dazwischen und der Befindlichkeit des Autors:
Wenn dir das
Elefantengrau dieser Vor-
stadtmauern den
letzten Nerv
raubt für die Unmengen
freundlicher Augenblicke.
Dann geht plötzlich alles
schief
du bist nur noch
aufgelegt zu geduldigen
Elegien
montierst lustlos
ein bißchen an diesen
verbogenen Mobiles aus
Tele-
graphendrähten und altem
Gitterwerk – […]
peinlich umzäunt bist du
die meiste Zeit
nichts als
ein drahtiger kleiner Statist […].
Klar daß
fast jedes Gedicht dir
vor Müdigkeit schlaff wie
ein loses Spruchband zum
Hals heraushängt:
dieser Vers
so gut wie ein anderer hier
auf einer Grautonskala68
Durs Grünbeins Lyrik spricht ganz deutlich aus, dass diese Gesellschaft nicht die des Autors ist. Die Gedichte der Grauzone morgens sind Bestandsaufnahmen eines Fremden. Selbstaussage Durs Grünbeins:
Zurück aus der falschen Zukunft, entkommen den halborientalischen Wirren, wie Marx die Folgen eines russischen Vorgehens in Europa nannte, denke ich heute an jene klassenlose Abart der Tyrannei zurück wie an ein Abenteuer, das den Verstand irritiert.69
Wortfetzen wie „was hier so / Brauch ist“70 oder „WIE DAS DEUTSCHE SAGT“71 deuten darauf hin – vielleicht auch affektiert –, dass nicht nur die DDR nicht als Heimat empfunden wurde,72 sondern dass insgesamt zivilisatorische Auswüchse kritisiert sind. Gleichmütig verlautbart Durs Grünbein die Diagnose:
Es wird eine lange Kur
brauchen ehe wir restlos entgiftet sind.73
Das betrifft weniger das politische System als die Gesellschaft mit ihrer Oberflächlichkeit, den freundlichen Testbildmorgen74 oder – aus dem Olymp des Dichtens gesprochen – ihren ramponierten Gedichten75. Wer so spricht, ist früh selbstbewusst oder schnell arrogant oder bereits ehrlich genug, mit eigener lyrischer Kurzware spöttisch umzugehen.
Salopper Zynismus, wie ihn Grünbein zum Schluss der ,Kern-Grauzone‘76 serviert, ist der Extrakt aus den Gedichten des Debüts.
Sardinen plattgewalzt
zwischen den Gleisen &
an den Seiten quillt
überall Sauce raus rot
wie Propangasflaschen
(& ziemlich
bedeutungsarm) sie allein
unter sovielem Strandgut hält schon
was dieser Morgen an Schönheit verspricht77.
Eine zerquetschte Sardinenbüchse ist vor dem Abfall der Gesamtgesellschaft genau so gut wie alles andere ein Hoffnungsgrün78. Grünbein lässt es nicht zur Erlösung kommen und bremst den Charme der silbrigen Dose gleich wieder aus. Denn, so souffliert das Gedicht, Weißblech ist das Silber, das die Welt verdient (und auch hat).
2.1.3 Mimetisierung des Gedichts. Die Wiederkehr des Imagismus im Aufnehmen des Unbedingten
Grünbeins Gedichte lösen das ein, was zu Beginn des Jahrhunderts Thomas Ernest Hulme von einer neuen, antiromantischen Poesie forderte. Die Literatur ist dry & hard79 und nicht von Kontemplation oder weltflüchtigem Symbolismus infiziert. Tatsächlich bewegen sich wenn nicht alle, so doch viele Verse in der Nähe des literarischen Imagismus. Die Grauzone morgens gibt dem visuellen Überfall nach, dem sich der Urheber der Texte ausgesetzt sieht. In „Verdorbene Fische“80 wird die Nähe zum imagismustypischen (zunächst) philosophiefreien Verzeichnen von Gegenwart am deutlichsten erkennbar. Das Gedicht ist eine kaum weiter als über das Gesagte hinaus zu öffnende Kurzsequenz. Metaebene? Nein. Oder vielleicht später.
Grauzone morgens liefert „die genaue Beobachtung des Augenfälligen“81, von der Hans Magnus Enzensberger im Blick auf William Carlos Williams sprach. Es sind Momente überwiegend sachlichen Notierens versammelt, die ohne Vorgefasstheit und Vorgeblichkeit auskommen. Die Gedichte gleichen Joyceschen Epiphanien, sind „Schnittbilder, in denen die Dimension der Zeit eliminiert scheint“82.
Gestus und lyrische Sprache verweisen auf Unmittelbarkeit; die Zitatsprengsel suggerieren eine direkte Übertragung innerer Zwiegespräche vom Moment des Erlebens in den Text. Der Kontakt mit „undurchdringlichen Augenblicken“83 erfährt nicht die Anstrengung intensivierten Ergründens, weil sich die Situationen durch sich selbst zu erkennen geben sollen. Es geht, unterstützt auch durch die Inkongruenz von Satz und Zeile, um die Schraffur von Gegenwart, die Bildbewahrung noch des flüchtigsten Augenblicks.
Grünbein selbst attestiert seiner Poesie imagistischen Charakter. Er greife Zufallselemente auf, „die sich zusammenfügen zu einer signifikanten Konstellation, einem natürlichen Gesamtzeichen.“ Im Rückgriff auf W.C. Williams spricht er von glimpses: „Momenten[n], in denen das Reale emblematisch erstarrt.“84 Die Augenblicksimpressionen – also quasi fotooptisch-schnelle Aufnahmen, Einblicke wie aus den Augenwinkeln – markieren eine Poetologie, die die Gesamtexistenz als Folge von Einzelmomenten begreift und umsetzt. Dabei kann das Nebensächliche exquisit werden, weil es nicht um die Frage des Sinngehaltes geht.
Die Anrufung des Haikus, der Bezug auf seine im knappen Umreißen der Verhältnisse gewonnene Untrüglichkeit85, zeigt, dass Grünbeins ersten lyrischen Gängen eine Tradition Pate stand, die auf prosaischen Ballast verzichtet. Aus den Grauzonen-Serials schimmern Haikus hervor: Arrangierte Fetzen, die eine Anmut von Dingen bezeugen. Basis dieser Momente ist eine singuläre Wahrnehmung, die nicht in den Bereich der Erkenntnis drängt.
In den glimpses und glances, die Durs Grünbein formuliert, wird etwas angedacht, nicht ausgeweidet. Erst die Folge der Schnappschüsse bildet jene literarische Lomografie, die an immer wieder anderen Stellen scharf oder verwaschen wirkt. Manchmal werden die Gedichte zu multiplen image-Evokationen beschleunigt, aber zumeist entspricht die Bildlichkeit dem Imperativ Pounds:
An ,image‘ is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time.86
Grauzone morgens ist das Album einer Lyrik, die sich nah am Zeitpunkt neuronaler Stimulation bewegt. Grünbein bedient sich im Fundus entsprechender Terminologie und spricht von Engrammen, wenn er den Kontakt von äußerer Wirklichkeit und zerebraler Reaktion meint. Das Engramm bezeichnet die bleibende ,Einschreibung‘ von Reizen in das Nervengewebe, einen Algorithmus, der nach der ersten Stimulation immer ähnliche Reaktionen veranlasst. Das Engramm ist für Grünbein „eine Leuchtspur im Gedächtnis, und so wie ein Leuchtspurgeschoss ein großes Manöverfeld erhellt, reißt das Engramm ganze Bewusstseinsregionen in ein plötzliches Licht.“87
Aus dem imagistischen, verzeichnenden Prinzip heraus formiert sich die Lyrik zu einer Poetik der Präsenz88, in der zunehmend der Körper eine Rolle spielen wird.
2.1.4 Schockwirkungen
Die Stillleben, die aus der Methode des Minimalisierens von Reizflut entstehen, gerieren sich mal als behutsame, fast ,minnende‘ Lyrik (Eine Regung89), mal als ungefiltert-eiskalter Blick (Wärmeplastik nach Beuys90). Dabei ist die Grenze zwischen ,Hell‘ und ,Dunkel‘, zwischen beruhigter Flaneur-Erfahrung und Penetration durch Gewalt instabil. Eben noch angewidert von der Umgebung, der sorglos betriebenen Umweltverschmutzung, bewundert das Ich fast im gleichen Atemzug „ein Paar strom- / abwärts keuchender / alter Männer“91.
Der Passant ist eingeübt in den Wechsel von Schönheit, Tragik und dem ganz Gewöhnlichen. Wenn wie eine plötzliche Amplitude aus der monotonen Verlaufsform ein emotionalisiertes Ich erscheint („ich habe es satt so ganz / gramgesättigt zu leben“92), dauert es nicht lange, bis der spontane Gefühlsausdruck wieder negiert wird.93
Anders: Der Schock bedeutet eine Hypothek, die bereits so weit konventionalisiert ist, dass sie sich nach Belieben zuschalten lässt.
Du wartest und
beugst dich vor zwischen
Kinderwagen und
Scharen räudiger Tauben die
einen Wirbel machen beim Füttern –
Du siehst ihre Köpfe ab-
getrennt
blutig im Rinnstein, ein
schillernder Tagtraum, ringsum
bespritzte Statisten in einem
Attentatsfilm […]94
Der Ausstieg aus zumindest der Ebene des Visuellen scheint möglich:
Ein Gelächter fing
Feuer, ich bezahlte den Kellner und
irgendwer
schrie wie seit Stunden von allen
Wespen der Erinnerung dicht
umschwärmt bis zum Stimmbruch, da
ging ich raus.95
Im System immanenter Ernüchterung, das kaum noch Erschütterungen kennt, bleibt als letzte Option der ent-emotionalisierte Zugriff auf die Wirklichkeit. Schockwirkung kann entsprechend auch simuliert werden. „Nullbock“ ist ein solcher Text, der sich weniger als zufällige Aufnahme denn als selektierter und durch die Distanz radikalisierter Augenblick liest:
Ein Junge
in Jeans
streichelt ein Mädchen lässig beim
Telefonieren am Apparat dicht
vor der Hauswand zersplittertes Glas. Sagt
„Nichts los heut“ und wendet
sich um in die Richtung aus der
der Schrei eines
verunglückten Kindes kommt aus-
gestreckt wenige Meter vor dem
zerquetschten Ball.
An dieser Stelle kreuzt sich der Ennui des Betrachters mit dem des Betrachteten – ohne dass sich feststellen ließe, welcher eher da war.
Der Grünbeinsche Stadtgänger begegnet dem Desaster konfrontativ und registriert die Reize nur noch mechanisch.
Vom Fenster abgerutscht
mit dem Schienbein auf-
geschlagen am Gitterrand
einer Hortensienrabatte
sahst du zum ersten Mal deinen Knochen bloßgelegt
gelblichrot und wo kein
Blut war elfenbeinweiß.
So gesehen das weißt du
nun prägen sich Farben
besonders fest ein.96
Hier wirkt der Autor, der weiß, dass die Imagination jener Szene Magendruck hervorrufen kann. Die Haltung erinnert an den Gottfried Benn der Morgue, dem es, wie Jörg Magenau präzisiert, „um die Demonstration der eigenen Unberührtheit angesichts des Todes“ ging, und der diesem „durch Affektabtötung“97 zu begegnen trachtete. Benns anatomische Sektion, so Christiaan L. Hart Nibbrig, „stilisiert den Körper zur nature morte, jenseits des Ekels, den er erweckt, und diesseits jeden Mitgefühls für einen Seelenlosen […].“98
Der Gestus wissenschaftlicher Entfernung zu üblicherweise emotionalisierten Dingen schlägt sich auch in den Beispieltexten nieder. Das lyrische Subjekt scheint fasziniert von der Außensicht, der nur visuellen Beteiligung.
Vor einem abgestumpftem Inneren, dem die Last der Geschichte em Dauerton ist, kollabieren die alten und neuen Utopien. Der lyrische Strom montiert das subjektive, radikalgenervte Gefühl mit optimistisch-zukunftsdesignenden Phrasen einer fortschrittsgläubigen Gegenwart:
Tag und
Nacht diese Dauerströme von
Informationen, die unsichtbaren Bakterien-
stämme der Worte, ein
riesiger Gallerthaufen aus schlaffen
Kondomen und fischgräten-
steifen Pessaren, befruchtete Eizellen
auf Eis kurz vorm Start
in ein vielversprechendes Leben mit
Voodoo-Zauber und maschinellem
Brave-New-World-Komfort zwischen Urlaut
&
,mega-corpse‘,
Steinzeit und kybernetischem Traum-
soviel
Verdauung ringsum, solche Spuren von
Heiterkeit im Vorbeigehen, Millionen
Augenpaare gebannt von den Fernseh-
orakeln am Abend. Fehlt nur
die ,Richtigstellung der Worte‘, was?[footnote]„,AIDS‘“. Grünbein: Grauzone. S. 44f.[/footnote]
Vielleicht lässt sich der Stil folgendermaßen umschreiben: Der Kontakt von Ernüchterung und glücklichen Momenten wird zum Mobile einer abgeklärten Alltagserfahrung in Echtzeit.
2.1.6 Statusfrage am eisernen Vorhang: Über Versuche, die Grauzone zu lokalisieren
Das Charakteristische der Grauzone morgens ist, dass sie sich nicht an einen Ort binden lässt: Nicht an die Geografie, nicht an die Bewirtschaftung eines Staates durch eine bestimmte Gesellschaftsform.
Doch ist diese Erkenntnis erst eine zweite, aus zeitlicher Distanz gewonnene. Denn Grünbein schreibt zunächst einen Staat ab, macht zuallererst dessen Fehlfunktionen dingfest. Dass er damit auch größere zivilisatorische Zusammenhänge erfasst, ist eine Nebenader der eigentlichen Absicht.
Grauzone morgens verweigerte der DDR die „offiziell geforderte poetische Aufbauarbeit“.99 Mit dieser Lyrik war affirmative Schönrede und lyrischer Fassadenputz nicht mehr zu machen. Sie hat mit diesem Staat keine Vision mehr und trauert auch keiner Vergangenheit nostalgisch hinterher:
Nichts mehr von der Dialektik der Verhältnisse. Nichts an Utopie oder aber dem, was sich fälschlich real existierender Sozialismus nennt100.
Diese Lyrik gehörten zu jenen Schreibweisen vor allem jüngerer Autoren, die den „vom Offizialdiskurs verhängten Geboten der ,Transitivität‘, der ,Kohärenz‘ und der ,Repräsentatio‘“ widersprachen und die „nicht unbedingt in ihrer politischen Aussage, sondern in ihrer Redeweise zu subversiven Elementen eines Gegendiskurses“101 wurden. In Kontur zu Sprechformen besonders am Prenzlauer Berg in Berlin ist hier, sagt Heiner Müller, „eine Generationserfahrung Form geworden, die sich bislang eher als Verweigerung von Form artikuliert hat.“102
Als „impressionistische Momentaufnahmen aus den grauen Metropolen des real existierenden Sozialismus’“103 stellen Grünbeins Gedichte deutlich das Diffuse der DDR-Realität heraus.104 Der zeit- und sozialismusgezeichnete Körper der Stadt ist die äußere Haut des Ausharrens im Fremdbleiben.
Entlang der Straßen tobt
architektonischer Kalter Krieg, stalineske
Fassaden, an denen noch immer
kein Riß sichtbar wird (TRAUM oder TRAUMA)
schattenlos 105
Grünbein markiert hier das Überkommene einer Vergangenheit, die sich in die Zukunft retten will, aber schon kaum die Gegenwart bewältigt. Die stalinesken Fassaden stehen für den Trotzkopf eines konservativen Scheinsozialismus, einen diktatorischen Wurmfortsatz der Geschichte.
Das Gedicht hält zurück, ob das ,Staline‘ noch traumatisch oder bereits traumzeugend wirkt. Der Passant wird weiter mit deprimierenden Normalzuständen beladen. Trotz bröckelnder Fassaden ist ein darüber hinaus gehender Riss nicht zu erkennen. Das völlig Andere ist vom System ausgeschlossen. Es bleibt das Abgestandene als Taktgeber.
Dass der Ton der Grauzone morgens „unausgesprochen viel mit der Zeit hinter verschlossenen Türen zu tun“ 106 hat und den Satz fast zum Stillstand zwingt, schreibt treffend Kurt Drawert. Die Enge der Perspektive hat ihre Wurzeln in der Ausübung des deutsch-demokratischen Systems. Es sind lähmungsnahe Erfahrungen. „Amigo“, tastet sich fragend eine enttäuschte Stimme in die Materie des sozialistischen Alltags, „was ist bloß schief / gegangen, daß sie uns derart zu Kindern / machen mit ihrer Einsicht in die Not- / wendigkeit, ihrer Wachsenden Rolle des / Staates?“107
Das entmündigte Ich entwirft ein Pathogramm des gesamten Systems. Gegen die euphemistische Losung geht eine verstörte Poesie an. Diversiv ist die Redeweise: Der sich entziehende Blick auf das offiziell zu lobende Land widersetzt sich den gültigen Doktrinen.
Status quo ist „der immerwährende Morgen in einer Gesellschaft, die auf der Stelle tritt“108. Grünbein brennt diese peinliche Stagnation durch Spiegelbilder ihrer Signaturen aus. Selbst wenn der „Schein einer immerfort / gestrigen Politik“109 nicht raumgreifend verzeichnet wird, zeigen die Fluchtpunkte die Entfernung an.
Es spricht für die intellektuelle Durchdringung der Materie, dass die Grauzonenreflexionen nicht nur das sozialistische System bestimmen. In den Gravuren siecher ostdeutscher Realität110 lassen sich viel allgemeinere gesellschaftliche Krankheitszeichen erkennen111. Man kann fast sagen, dass da ein urbanes Irgendwo vor sich hinwest, dass die DDR in der Grauzone liegt und nicht umgekehrt.
Grünbeins Lyrik sei, so Hermann Glaser, „kein DDR-Grübeln über bewältigte oder unbewältigte Vergangenheit, kein DDR-Oszillieren zwischen selbstmitleidiger Schwermut und trotzigem, antikapitalistischem Aufbegehren – also keine DDR-Gesinnungsästhetik, sondern virtuose Handhabung des postmodernen ,international style‘ mit einem hohen Anteil an Dunkelzeilen.“112
In gewissem Sinn zieht Grünbein den Kontext DDR sogar zurück und zeigt, mit Hermann Korte gesagt, „Desinteresse am politisch-ideologischen DDR-Diskurs als einer Weltanschauungsfrage“113. Wenn es heißt: „,Kein / Traum in Aussicht…‘, nur / diese ziellose Müdigkeit. In New York // hättest du todsicher jetzt den / Fernseher angestellt“114, schreibt der Autor einerseits vom Boden einer Gesellschaft aus, in der jeder Gedanke an die Utopie New York eine Abtrünnigkeit bedeutet, parallelisiert aber zugleich weltweite Erfahrungen und weist damit die Verwandtschaft von Seinsweisen auf. Der Verlust an Bezügen zum Kontext treibt den Menschen überall zu Ersatzbefriedigungen.
Die in der Grauzone morgens angegebenen Orte sind weitgehend Kulissen für Phänomene, die sich auch anderswo feststellen lassen. Einzelne Szenen sind so ins Ungewisse gerückt, dass die Beschreibung einer Autobahnbar115 eine ,amerikanische Stimmung‘ evoziert und man nicht immer festmachen kann, welches Jahrzehnt jeweils gerade ausgesprochen wird.
Gerastert werden die Strukturen moderner Zivilisation. „Jenseits anachronistischer Ost-West-Dichotomie“, folgert Hermann Korte, „wird die Koinzidenz von Gesellschaften sichtbar, die unter dem Diktat zivilisatorisch-technologischer Vernunft stehen und von denen, die sich ihr blindlings unterwerfen, als langweilig-leerer Status quo postindustrieller Systeme empfunden wird.“116
Dieses Gefühl der Leere wird in der Grauzone lokalisiert, ist aber nicht nur in jenem Erfahrungsraum lokalisierbar. Aber es ist die Basis für fortgesetzt konzentrierte Gegenwartsanalyse. Die zeitkritische Spannung wird sich in der Schädelbasislektion weiter gestalten – dann deutlicher über die Dekonstruktionen des als fortschrittlich befohlenen Horizonts hinaus. Was bisher der in der Perspektive verschwommene, in der Perspektivlosigkeit klare Staat war, wird nunmehr die Gesellschaft sein.
Grünbeins Methode ist Dichtung als Seismografie. Seine Übertragungen in den lyrischen Äther kommen kaum je ohne kratzende Stimme aus. Aus ihm spricht der Augenzeuge117, der die unmittelbare Umgebung viel mehr als nur optisch aufzeichnet. Und, wie Heiner Müller sagt:
Der Blick ist lidlos.118
Die Erfahrung, „mit dem Rücken an der Wand“119 gestanden zu haben, lässt sich nicht auslöschen. Grünbein, dem sich die letzten Atemzüge eines diktatorischen Sonderwegs deutlich einprägten, führt vor diesem Hintergrund wiederholt die Feder.
Wie es die anderen in Zukunft halten wollen, ist mir egal: Ich aber verzeihe keinem. Mit einem Dachschaden steige ich grimmig aus dem Schützengraben. Vielleicht hilft mir ja das Vergessen.120
Ron Winkler, aus Ron Winkler: Dichtung zwischen Großstadt und Großhirn. Annäherungen an das lyrische Werk Durs Grünbeins, Verlag Dr. Kovač, 2000
Der junge Grünbein und die DDR
– Poetik eines Schreibens jenseits der Avantgarden. –
Im Oktober 1991 beantwortet Durs Grünbein Thomas Naumanns Frage, warum seine Gedichte so gänzlich anders seien als jene der Dichter vom Prenzlauer Berg, zu denen er ja gezählt werde:
Der Fehler liegt in der Zuordnung. Ich war im selben Revier, aber fern der Programme.121
Von der jüngsten Dichtergruppe der DDR, die sich in den 1980er-Jahren konstituierte, grenzt er sich also entschieden ab. Und auch sonst dürfte man sein Verhältnis zur DDR-Literatur eher als ein ödipales anzusehen haben.122 Jedenfalls hat er in seinen frühen Essays keinen Hehl daraus gemacht, was er über den dazugehörigen Staat und dessen sozialistischen Legitimationsdiskurs dachte. In dem 1990 erstmalig publizierten Aufsatz „Verspätete Züge“ (1990) schreibt er:
Ich verrate nun die gewaltsame Landschaft der Theologie und gebe mich dem materiellen Gewimmel einer Welt hin, die nur den Tausch, aber keinen anderen Ausweg als den Tod kennt. Von einer geschlossenen Welt der Ideen laufe ich über in eine Dingwelt, die scheinbar offen ist. Ich weiß nun, daß ich nichts zu sehen bekommen werde, als was vor meinen Augen liegt, selbst im Traum. Alle Logik haftet den Dingen an und ist Tautologie.123
Vergleichbare Statements durchziehen sein lyrisches und essayistisches Werk wie ein roter Faden. An anderer Stelle, in dem ebenfalls frühen Essay „Im Namen der Füchse“ (1993) heißt es, nun mit einem dezidierten Blick auf literarische Fragen:
Im Streit zwischen Wolf Biermann und Sascha Anderson verneige ich mich voller Respekt vor der göttlichen Nina Hagen.124
Biermann hatte Anderson im Herbst 1991 als Stasi-Spitzel enttarnt und damit eine breite Debatte um den jungen Künstler ausgelöst. Da Grünbein sich von beiden distanziert, möchte er sich offenbar aus den politischen Querelen um die DDR-Vergangenheit heraushalten. Anders gesagt: Wenn er sich mit der exzentrischen Punk-Ikone Nina Hagen solidarisiert, dann suggeriert er, dass die Problemfelder der DDR-Literatur für ihn keine fruchtbaren Felder sind. Dass Hagen Biermanns zeitweilige „Quasi-Stieftochter“ war (immerhin war er von 1965 bis 1972 der Lebensgefährte ihrer Mutter), wird Grünbein gewusst haben, was seiner Abgrenzung eine (selbst-)ironische Pointe verschafft.
Auch wenn Grünbein auf dem Territorium der DDR aufwuchs und hier sozialisiert wurde – was er nach dem Mauerfall gelegentlich mit dem sarkastischen Bild des auf simple Reiz-Reaktions-Muster reduzierten Pawlow’schen Hundes quittierte125 –, so sieht er sich doch offenbar nicht ihrer literarischen Tradition verpflichtet oder will diese gar fortführen.126 Und aus diesem Grunde muss es auch als fraglich erscheinen, ob sein Œuvre überhaupt dem Text-Korpus der DDR-Literatur zugeordnet werden kann. Schon Fabian Lampart schätzte ihn bündig als einen ,Nicht-Repräsentanten‘ ein und schrieb über seine Poetik:
Sein ästhetisches Programm ist kaum vereinbar mit einer Lyrik. der es um die Kommentierung des Zeitgeschehens oder gar um Engagement zu tun ist. […] Als Repräsentant für eine die Wende- und Nach-Wende-Zeit problematisierende ,DDR-Literatur der neunziger Jahre‘ taugt Grünbein nicht.127
Als eine Situierung „jenseits der Avantgarden“ hat Grünbein knapp zwei Jahrzehnte später, in der Frankfurter Poetikvorlesung Vom Stellenwert der Worte (2009/10),128 seine eigene poetologische Position beschrieben und damit seine ausgeprägte Abneigung gegen jegliche Form engagierten Schreibens noch einmal unmissverständlich herausgestellt.
Diese post- oder auch – mit einem Ausdruck des italienischen Kunsttheoretikers Achille Bonito Oliva – trans-avantgardistische Poetik129 soll im Folgenden rekonstruiert werden, und zwar mit besonderer Betonung des Frühwerks, wie es sich im unmittelbaren zeitlichen Umfeld des Mauerfalls entfaltet. Daraus folgt, dass ich mich auf jene beiden Gedichtbände beschränken werde, die dieses zeitgeschichtliche Ereignis flankieren – Grauzone morgens (1988) und Schädelbasislektion (1991). Die dazugehörigen poetologischen Selbstvorgaben aus Grünbeins Essayistik sind ebenfalls vorzustellen. Abschließend werde ich einen knappen Ausblick auf das spätere Werk vornehmen.
Grauzone morgens (1988): Geschichtsverlust, Individualismus, Wahrnehmungspoesie
In seinem Buch La Transavanguardia Italiana (1980) vertritt Oliva die These, dass das Fortschrittspathos der Avantgarde seit den 1970er-Jahren in der Kunst nicht mehr gegeben sei. Anstatt dem Zwang zum Neuen zu folgen, emanzipieren sich laut Oliva die Künstler von kollektiven Semantiken. Der Einzelne folge keiner normativen Dogmatik mehr, sondern arbeite nach einem Ansatz, der jeglicher Dogmatik gerade entgegengesetzt sei: Er arbeite an dem „Bruch des gesellschaftlichen Bedürfnisses“. 130
Damit hat Oliva eine Beobachtung gemacht, die sich cum grano salis als eine wesentliche Tendenz auch des Grünbein’schen Œuvres festhalten lässt. Schon von seinem ersten Gedichtband Grauzone morgens an, der noch zu DDR-Zeiten erschien, sucht Grünbein den von Oliva proklamierten „Bruch des gesellschaftlichen Bedürfnisses“, der vor allem ein Bruch mit dem sozialistischen Bedürfnis nach allgemeiner Erziehung ist.131 Grünbein, der von sich selbst bekennt, dass die Dichtung für ihn „ein großes Einzelgängerspiel“132 sei, beschreibt seinen Debütband als „eine Art friedliche[n] Impressionismus, verschlafen und provinziell“133. Der Band, der in seinem titelgebenden Hauptzyklus eine Flanerie durch das frühmorgendliche Dresden der 1980er-Jahre mit lyrischen Mitteln inszeniert, sei „gespickt […] mit dresdentypischen Impressionen, lauter kleine Anti-Elegien, detailreich und minimalistisch aneinandergereiht“.134 Grauzone morgens ist ein Buch, das die „Agonie des Realen“ (Baudrillard) kurz vor dem Zusammenbruch der DDR dokumentiert;135 es zeigt eine Welt im Stillstand („,Nichts geht mehr‘ heißt ein Gefühl / von allen Seiten fotografiert“),136 behauptet aber auch gleichzeitig ein frühmorgendliches Orientierungsverlangen, den Augenaufschlag beim Erwachen. Ein Buch auf der Schwelle zu einer neuen Zeit, die noch nicht angebrochen ist.
Grünbeins Erstling fällt in eine Zeit des rapiden Autoritätszerfalls der staatlichen Mächte wie der utopischen Legitimationsdiskurse der DDR.137 Die Geschichte, an der sich noch die Autoren der ersten Generation – insbesondere sein Förderer Heiner Müller – abgearbeitet hatten, hat für die jungen Dichter wie Grünbein ihre bindende Kraft verloren. Grünbein artikuliert ein Zeitgefühl des „Du, allein mit der Geschichte im / Rücken“ und des „alles erlaubt“.138 Radikaler Individualismus und Bewusstsein des Posthistoire sind bei Grünbein keine schmerzlichen Verlusterfahrungen mehr, sondern Voraussetzungen eines Schreibens, das in ihnen Möglichkeiten zur Freiheit erkennt.139 Die Unbekümmertheit, ja die Kälte, mit der das Ende der Geschichte diagnostiziert wird, hebt ihn selbst unter den desillusionierten jungen Dichtern seiner Generation heraus,140 die dort auf ideologische Selbstwidersprüche aufmerksam zu machen suchten, wo Grünbein nur noch süffisant das „Nonsense-Ping-Pong- / Geschwätz“ „einer immerfort / gestrigen Politik“141 konstatiert und sich, achselzuckend wie ein Baudelaire’scher Flaneur, von ihm abwendet.
Da die Geschichte, der primäre Bezugsrahmen der DDR-Literatur, nicht mehr die Intentionen und Funktionen lyrischen Sprechens vorgibt, kann es für Grünbein auch kein Engagement geben, das sich in historischem Wissen rückversichert und aus ihm seine Energien wie Zukunftshoffnungen bezieht. Das funktionsspezifische Vakuum, das sich daraus ergibt, füllt Grünbein durch die „radikale[] Hingabe an eine heterogene Realität“, durch eine geradezu obsessiv betriebene „Suche nach einer zersplitterten Erfahrung“. 142 Nicht die ,Ideenwelt‘, die Grünbein – wie bereits im eingangs aufgeworfenen Zitat – gern mit dem Sozialismus assoziiert, steht im Vordergrund, sondern die ,Dingwelt‘, zu deren „Erkundung“143 der Dichter in dem wenig später entstandenen Essay „Ameisenhafte Größe“ (1989) aufgefordert wird. Und erkundet werden soll hier auf eine recht wenig sozialistische Art: nämlich ohne hochtrabendes ideologisches Rüstzeug, nur ausgestattet mit Wahrnehmung und Verstand habe sich der Dichter auf den Weg zu machen, so Grünbein sinngemäß im selben Aufsatz. Der „Stelzengang der Geschichte“,144 wie es in „MonoLogisches Gedicht No. 2“ heißt, wird ersetzt durch das ameisengleiche, sensible und detailversessene Vorantasten auf Tuchfühlung mit dem ins Auge springenden Realen, das in einer unsystematischen Folge lyrischer Notizblätter dargeboten wird. Nicht das, was Marx den ,Überbau‘ nannte, der schöne Traum der Utopie, interessiert Grünbein, sondern das einzelne, sprechende Detail: Unabhängig von sinnhaften Kontexten wird es als Gegenstand transitorischer Wahrnehmung, augenblicksweise und kühl, registriert. Schon Jahre bevor er dies im Essay thematisieren wird, tritt Grünbein als ein Dichter der „Anschauung“145 auf; und das Ding, das Objekt dieser lyrischen Anschauung, ist ein opakes Ding, d.h. eines, das sich eben nicht mehr auf eine höhere, geschichtliche Wahrheit öffnet, sondern idealiter reines „Konzentrat der Erscheinungswelt“146 ist – und daher auch kein Medium zur Verkündung von (gesellschaftlich funktionalen) Botschaften, keine symbolische Form zur Stimulierung von politischem Engagement mehr sein kann und will.
In Grünbeins Erstlingsband, der das Konzept einer phänomenologischen Wahrnehmungspoesie lyrisch umsetzt und damit einen wichtigen Aspekt der exogenen Poetik, wie sie sich mit „Ameisenhafte Größe“ zu entfalten beginnt, vorwegnimmt, tritt uns ein Autor entgegen, der sich genauso kaltschnäuzig wie unbeirrbar aus dem realexistierenden Sozialismus davonstiehlt – nicht wie Wolf Biermann auf dem Wege lautstarker Rebellion, sondern als ein Unterwanderer des (brüchig gewordenen) Ganzen im Namen des (ins Recht gesetzten) Singulären, dessen akribisch genaue Notation den Widerspruch gegen das SED-System und seinen totalitären Herrschaftsapparat anzeigt.147
Die bewusste Subversion der machtgestützten historischen Semantik darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gegenwartswahrnehmung doch von Zeit zu Zeit erinnerungsintensiv aufgebrochen wird, in einzelnen Reminiszenzen oder erleuchteten Augenblicken etwa, in denen etwas Historisches aufblitzt, das der öden Gegenwart eine komplexere zeitliche Tiefenstruktur unterschiebt. Nur werden in diesen Reminiszenzen keine DDR-typischen Autoritäten – wie etwa Maxim Gorki oder Anna Seghers – mehr sichtbar. Im Gegenteil: Grünbeins Anspielungsverhalten zeugt von einer Weltläufigkeit, die allein schon als staatsgefährdend hätte eingestuft werden können. Neben dem die „Gastfreundschaft der Toten“148 suchenden Höllenwanderer Dante („Kennen Sie Dante?“)149 und dem Archetypen aller lyrischen Flaneure. Charles Baudelaire („Grauzone morgens, mon frère“),150 die beide jenen diskontinuierlichen Wahrnehmungstyp verkörpern, auf den es ihm ankommt, sind außerdem der US-amerikanische Dinglyriker William Carlos Williams (vgl. den Zyklus „Glimpses & Glances“), der japanische Haiku-Dichter Matsuo Bashô, das spanische Bürgerkriegsopfer Federico García Lorca, T.S. Eliot und vor allem Ezra Pound die maßgeblichen Vorbilder, die hier erinnernd herbeizitiert werden und als Autoritäten für eine der Grauzonen-Landschaft angemessene Schreibweise fungieren.151 In der Erwähnung Ossip Mandelstams, des Opfers stalinistischen Terrors, wird darüber hinaus Grünbeins indirekter Einspruch gegen das sozialistische Schreiben besonders beispielhaft manifest. Ferner zeigt sie, dass die so nüchterne und emotionslose Poetik des jungen Grünbein durchaus eine ethische Seite hat, obgleich Ethik an sich – zunächst – keinen Programmpunkt in dieser Poetik darstellt.
Frühe Essayistik: Formierung einer postutopistischen und nachidealistischen Poetik
Der Abstand Grünbeins zu DDR-typischen engagierten Schreibverfahren kommt vielleicht nirgendwo so deutlich zum Ausdruck wie in seiner Bemerkung, dass „das Begreifen und Deuten“ ihm mehr abverlange als „jedes Meinen und Handeln“.152 Das (selbst-)bewusst gewählte Oppositionspaar dokumentiert die programmatische Stoßrichtung unmissverständlich. Wie ernst es Grünbein mit seiner selbstauferlegten Verpflichtung zum „Begreifen und Deuten“ ist, geht aus seinen Essays hervor, die ab 1989 zahlreich und in rascher Folge entstehen.153 Hier zeigt sich ein Autor, der seinen poetologischen Standpunkt zu bestimmen sucht, in einem offenen Prozess des Suchens und Fragens, aus dem sich die eigenen Positionen erst nach und nach herauskristallisieren. Sicher ist zuerst nichts; nur eines ist von vornherein klar: Ein engagierter Autor will Grünbein nicht sein.
Solches geht schon aus dem bereits erwähnten Essay „Ameisenhafte Größe“ hervor, der die „Verbindung von Poesie und Erkundung“154 behauptet und in dem Schulterschluss zwischen Dichtung und Naturwissenschaft einen „dritten Weg“155 jenseits von l‘art pour l‘art und littérature engagée erkennt, dem zu folgen Grünbein sich selbst beauftragt. Der Autor dieses Essays ist kein politischer Idealist, sondern ein Erfahrungshungriger:
Wissen will ich, schräg hineinsehen in Werdegänge, begreifen was los ist, was vor sich geht mit mir und den andern.156
Den alten, bis auf Platon zurückgehenden Topos des Dichters als Biene nach den Maßgaben postmoderner Selbstwahrnehmung aktualisierend, führt Grünbein den von ihm favorisierten Dichtertypus als eine Ameise ein, die gerade kein (idealistischer) „Honigsammler des Geistes“157 bzw. Welt-Geistes mehr ist, sondern ein empiristischer Sammler, der eine „ungeheure Terra incognita von Bildern und Prozeduren“158 vor sich ausgebreitet sieht und der sich als ein „poeta empiricus“159 durch die „Hydra der Empirie“ (Goethe) mühsam, aber neugierig voranarbeitet. Schon in seinem ersten Essay, also von Beginn seiner poetologischen Selbsterkundungen an, sucht Grünbein den Bodenkontakt; der Himmel der Utopie ist seine Sache nicht.
Zwei Jahre später bekundet sich diese Abneigung deutlich aggressiver. In dem im September 1991 verfassten „Brief über den Sarkasmus und das Gedicht als Konzept“, der aus einer Korrespondenz mit Marcel Beyer hervorging, entwickelt Grünbein anhand des Begriffs „Sarkasmus“ ein poetologisches Konzept, das auf ein dezidiert ideologiekritisches und antiutopisches Schreiben abzielt.160 Auf das altgriechische Verb sarkazein zurückgreifend, definiert er Sarkasmus als das Ablösen des Fleisches von den Knochen. Damit meint er die Abführung idealistischer und ideologischer Zuschreibungen zum Zwecke der Erkenntnis grundlegender Wahrheiten über den Menschen als biologisches Gattungswesen oder, wie er selbst sagt, zum Zwecke einer „Suche nach dem Arttypischen und Anonymen“.161 Um die „handelnden Ideen und Gebete bloßzustellen“,162 um den „Verblendungszusammenhang“ (Horkheimer /Adorno) der Ideologie als solchen zu entlarven, betreibt der Dichter ein „Spiel mit den Bruchstücken einer abduktiven Logik, die auf den Paradoxen tanzt“,163 damit wir die Zufälligkeit und machtbedingte Konstruierthet jeglicher Kontextualisierung erkennen.
Deutet sich hier bereits eine Ästhetik der Verflüchtigung an, so wird diese 1992, als Grünbein den Essay „Transit Berlin“ vorlegt, in einen typologischen und zeitdiagnostischen Rahmen gestellt. Der Frage nachgehend, welche Konsequenzen sich aus dem Übergang aus der festgefügten Welt des Kalten Kriegs in die offene Sphäre der nachsozialistischen Epoche insbesondere für die Künstler ergeben, entwickelt Grünbein sein Konzept vom „Transit-Künstler“,164 der als ein Gegentypus zum sozialistischen Künstlerideal einzuschätzen ist. Verfügte Letzterer – der offiziellen SED-Doktrin zufolge vor allem über eine durch ,Bewusstsein‘, ,Standpunkt‘ und ,Parteilichkeit‘ definierte Identität, gilt für Grünbeins Künstler die Identität nur noch als „Vexierbild“, als „Summe einzelner Illusionen, die insgesamt nur ein beliebtes Phantasma ergeben“.165 Anstelle eines Programms habe der Künstler „nur noch Nerven und einen feinen Spürsinn für Koordinaten“.166 Darüber hinaus ist er ortlos, zeitlos und führt das Dasein eines Nomaden, der „nirgends zu Hause und nie angekommen“167 ist, der sich durch „Nicht-Orte“ (Marc Augé) bewegt und dem das „Umschwärmen gerade der Übergänge und Schnittstellen“168 zum Prinzip geworden ist. Die Subjektvorstellung, die sich hier zeigt, ist nicht ausschließlich postmodern; vielmehr äußert sich in ihr eine Melange aus modernen und postmodernen Subjektvorstellungen:169 Grünbein denkt das Subjekt zwar als aufgelöst, hält aber dennoch an einer subjektartigen Instanz fest. Er bringt es zum Verschwinden, um seine Autonomie zu retten: „[L]istig einer anonymen Semantik entrissen“,170 sei der Künstler nunmehr auf freien Fuß gesetzt und „ganz allein zum Ansichsein verdammt“.171
Den bereits in Grauzone morgens lyrisch antizipierten und dann in „Ameisenhafte Größe“ auch in der exogenen Poetik eingeführten Typus des empiristischen Sammlers und dichtenden Forschers aufgreifend und diesen mit dem Ideal des ,Transit-Künstlers‘ und dessen Haltung des ,Immerfort unterwegs‘ verschmelzend, sucht sich Grünbein 1993 in dem Essay „Galilei vermißt Dantes Hölle und bleibt an den Maßen hängen“ ein neues Vorbild, das bereits in Grauzone morgens beiläufig erwähnt wurde und durch das er seiner nachidealistischen, auf das Empirische und Wissenschaftliche kaprizierten Poetik auch eine historische Legitimation zu geben bemüht ist: Dante Alighieri. Zugleich wendet er sich dem Problem einer spezifisch dichterischen ,Anschauung‘ zu. Anhand einer, Einflüsse von Ossip Mandelstam und Edmund Husserl verarbeitenden, Lektüre von Dantes Divina Commedia entwickelt Grünbein eine Konzeption des dichterischen Bildes, die eine Einheit von „dichterische[r] Imagination und naturwissenschaftliche[r] Abstraktion“172 anstrebt, die die physiologisch-sinnliche Wahrnehmung von Welt mit ihrer intellektuell-visionären Durchdringung verbindet und dabei auf die Gewinnung anthropologischen Wissens fokussiert ist.173 Ein ganz wesentlicher Punkt ist: Dante setzt sich nicht über die phänomenale Vielfalt hinweg, ist – anders als der als Kontrastfolie eingesetzte, an abstrakten Gesetzmäßigkeiten interessierte Galilei – kein Forscher „mit dem bewaffneten Auge“ (das den Phänomenen, salopp gesprochen, den Garaus macht), sondern er wendet sich dieser inkommensurablen, phänomenalen Vielfalt gerade zu und hält eine „Zwiesprache“ mit den Dingen.174
Die bereits in früheren Essays, etwa in dem eingangs zitierten „Verspätete Züge“, erfolgte Markierung des Bruchs mit der sozialistischen Vergangenheit gewinnt in der im Oktober 1995 gehaltenen Büchnerpreis-Rede „Den Körper zerbrechen“ eine ethische Komponente, wenn Grünbein dem utopischen Denken pauschal unterstellt, im Moment seiner politischen Umsetzung als „Gesellschaftsentwurf“175 zur Keimzelle für menschenverachtende Gräuel zu werden:
Daß sie tief einschneiden ins Fleisch, daß sie die Leiber zermalmt am Wegrand zurücklassen, das ist es, was Geschichte und Revolution so weit von jeder Erlösung entfernt. Und deshalb ist jeder Gesellschaftsentwurf wertlos, wenn er nicht auch das Bewußtsein von der Zerbrechlichkeit dieser traurigen Körper einschließt. Mag sein, daß die Utopien mit der Seele gesucht werden, ausgetragen werden sie auf den Knochen zerschundener Körper, bezahlt mit den Biographien derer, die mitgeschleift werden ins jeweils nächste häßliche Paradies.176
Die Emphase dieser Textstelle verrät, dass Grünbein sich unter der Hand nun doch zu einem Dichter gemausert hat, dem man die frühere Abgrenzung gegen das engagierte Schreiben nicht mehr so uneingeschränkt wird abnehmen wollen. Anders gesagt: Der Sprecher dieser Sätze ist ein Engagierter – sicher nicht im politischen, aber dafür im ästhetischen Sinne. Als ein höchst engagierter Anwalt der „Körperwelt“177 auftretend, votiert Grünbein für eine Achsendrehung im Begriff der Geschichte: Angesichts der Zivilisationsbrüche des 20. Jahrhunderts dürfe die Geschichte endlich einmal nicht mehr von den Träumen der Vernunft her gedacht werden, sondern mit Rücksicht auf die Realität der auf Schlachtfeldern oder in Folterkammern vernichteten Menschenleiber. Dem utopischen Denken (und Schreiben) stellt Grünbein in dieser Rede sein Konzept einer dichterischen Autopsie entgegen: Die „Obduktion“ der vom „solcherart präzisierten Körper her“178 gedachten Geschichte auf der Suche nach „etwas, das der ganzen kreatürlichen Existenz ihre Richtung“179 gibt.
Schädelbasislektion (1991): Beschleunigung, Polyphonie, Ichzerfall
Die in der Büchnerpreis-Rede geäußerte Leitvorstellung Grünbeins, in der Lyrik nicht mehr das Aussprachemedium einer gefühlvollen Subjektivität, sondern im Gegenteil „das geeignete Werkzeug für die vom Herzen amputierte Intelligenz“180 – also einer Intelligenz, die gerade nicht mehr von den ,warmen‘ Träumen utopischen Denkens beherrscht wird – vorlegen zu wollen, lässt sich als raison d‘être seines bereits vier Jahre früher publizierten, zweiten Gedichtbands, Schädelbasislektion, festmachen, der in unmittelbarer Folge der Wende entstand und veröffentlicht wurde. Dieser Band ist weit komplexer als der Erstling, und er reagiert auch auf eine wesentlich veränderte Situation: Nach dem Fall der Mauer findet sich Grünbein in einer offenen und beschleunigten Welt wieder, der Einheitssound der DDR-typischen Revolutionsrhetorik ist einer Stimmenvielfalt gewichen, die vom Subjekt nicht mehr bewältigt werden kann.
Aus diesem Grunde ist die Polyphonie ein wesentliches Leitmotiv dieses Bandes. Das Ich ist ein anderes als in Grauzone morgens: Kein stoischer Beobachter mehr, sondern nur noch eine anonyme Instanz „am Schnittpunkt sehr vieler Stimmen“181. Damit ist dieser Band eine einzige Kampfansage gegen die, dem Sozialismus entstammende, überkommene, „fatale Identität, die sich selbst nur in paranoischem Argwohn ertrug“.182
Die bereits in Grauzone morgens zu bemerkende Einbeziehung naturwissenschaftlicher Fachsprachen avanciert zum werkprägenden Merkmal. Sie ist sprachlicher Ausdruck der im Essay artikulierten Ambitionen, einem „Hunger nach Desillusionierung“183 bzw. „Verlangen nach anthropologischer Klarheit“184 nachgeben zu wollen. Die Haltung der Erkundung verschiebt sich ins Zerebrale und (Hirn-)Physiologische, die minutiöse Erkundung von Außenwahrnehmungen weicht einem schwindelerregenden Nachzeichnen hochkomplexer Wahrnehmungsprozesse, in denen sich die Grenzen zwischen Ich und Welt verwischen. Es ist, als ziehe sich Grünbein als Reaktion auf den plötzlich ins Unermessliche erweiterten Außenraum ins Schädelinnere – sein „endogenes Versteck“185 – zurück, als konzentriere er sich darauf, das urbane Leben als hirnphysiologisches Phänomen neu zu erschaffen. Das Ergebnis ist die verwirrende Topographie einer virtuellen Simultankonstruktion „[d]ieseits von Raum und Zeit“, geprägt von „Verwandlungen“ und „Hierarchiezerfälle[n]“.186
Das Transitorische, für Grünbein nunmehr zu einer alltäglichen Lebenserfahrung geworden, ist das bestimmende Stilprinzip. Es affiziert auch seinen Umgang mit den aus der Vor-Wende-Zeit überkommenen diskursiven Altlasten, die offenbar immer noch Bestandteil seines Hirns sind. Am markantesten zeigt sich dies in dem fünfteiligen Großzyklus „Niemands Land Stimmen“: In diversen Metaphoriken der Verflüchtigung bzw. Verflüssigung (vor allem im Motivbereich Wasser und Meer) werden zentrale Denkfiguren des sozialistischen Legitimationsdiskurses – etwa jene des geschichtlichen Fortschritts, der kollektiven Repräsentanz sowie auch und vor allem das substantialistische Identitätsdenken – zugunsten einer bewussten Veruneindeutigung und Virtualisierung raumzeitlicher wie personaler Koordinaten verabschiedet und auf diesem Wege die Künstlertypologie des Essays „Transit Berlin“ vorbereitet: Um die Hirnrinde, die den Alptraum Geschichte träumt, außer Kraft zu setzen, hat sich eine ,unrettbar‘ zerschlissene, auf die reine Wahrnehmungsfunktion reduzierte Ich-Instanz – oder besser: ein Nicht-Ich – ganz dem Andrang heterogenster Stimmen und Wahrnehmungen hingegeben und seine durch historisch-ideologische Narrative gestiftete Identität also ausgelöscht.187
Werden in „Niemands Land Stimmen“ Fragen, die Grünbeins Vergangenheit unter Hammer und Sichel berühren, noch ausschließlich auf der Ebene diskursiver Auseinandersetzungen verhandelt, so betrifft der Zyklus „Die leeren Zeichen“ Grünbeins Person ganz unmittelbar, und zwar in einer sehr direkten und schonungslosen Konfrontation mit dem Zwangscharakter des Systems DDR: Der Zyklus verarbeitet die leidvollen Erfahrungen des Autors in einem Ostberliner Polizeirevier vom Oktober 1989188 und thematisiert in verstörenden, sperrigen Bildern diese als eine die Integrität der Persönlichkeit bedrohende posttraumatische mémoire involontaire aus den Tiefen des Bewusstseins infolge einer körperlichen Gewalteinwirkung. Grünbeins Text, der Züge einer autopsieartigen Selbstschau trägt, führt die Regression eines kollektiven, durch die menschliche Vernunft erdachten schönen Traums in ein am eigenen Leib erfahrenes, sich leibhaftig konkretisierendes und dabei Körper und Geist des Individuums zerrüttendes Trauma plastisch vor Augen. Autobiographisches behandelt ebenfalls der Zyklus „Portrait des Künstlers als junger Grenzhund“, der aufgrund seiner zentralen Bedeutung für die vorliegende Fragestellung im Folgenden einer etwas genaueren Betrachtung unterzogen werden soll.189
Einflüsse aus der antiken Philosophie des Kynismus und der klassischen Moderne (u.a. James Joyce, Dylan Thomas, Franz Kafka) verarbeitend, stellt Grünbein sein vergangenes Ich in einem hochgradig sarkastischen und selbstironischen lyrischen Selbstporträt als einen ,Grenzhund‘ dar, der an der Zonengrenze der DDR entlangstreunt. Dieser Grenzhund – aufgrund der in sie einfließenden divergenten Semantiken eine überaus schillernde Metapher – ist zunächst und vor allem als Pawlow’scher Hund definiert: ein durch und durch konditioniertes Wesen, dessen leibseelischer Habitus vollständig in physiologischen Reiz-Reaktions-Mustern aufgeht.
Das Leben im Osten wird aus der Sicht eines Hundes geschildert, und damit bedient sich Grünbein eines Verfremdungseffekts, der die Funktion hat, das Offensichtliche und Vertraute so darzustellen, als sei es nicht mehr das Eigene, „als ginge es um irgendeine altgriechische Provinz“.190 In dieser „Parallelwelt“,191 in der die Zeit stillzustehen scheint, werden die Bürger mit „Illusionen“192 gefüttert, die wie Stickstoff eingeatmet werden und „als Gerücht längst reiner Traumstoff sind“,193 führen also ein fremdbestimmtes und der Wirklichkeit entrücktes Dasein par excellence:
Ein sattes Schmatzen zeigt: Auch Hunde träumen.
Was ihm den Maulkorb feucht macht, ist der Wahn
Daß Parallelen irgendwann sich schneiden194
Die sozialistische Utopie als das Wunschdenken des entsprechend konditionierten Hundes – mit dieser Vorstellung überträgt Grünbein implicite Herbert Marcuses Idee der repressiven Gesellschaft auf den Sozialismus und ironisiert auf diese Weise dessen Befreiungsrhetorik mit kaum zu überbietendem Hohn. Im Bild der sich im Unendlichen schneidenden Parallelen wird die sozialistische Erlösungsmetaphorik, die den Erlösungszustand in Gestalt des verwirklichten Kommunismus als Hoffnung an ein diesseitiges Ende projizierte, sarkastisch destruiert. Konsequenterweise erscheint in dieser Optik auch das marxistische dialektische Denken, das den DDR-Bürgern von früh auf antrainiert wurde, ausschließlich als „Hundetreue“, die lediglich vom „Sinn für die Stimmung in his master’s voice“ zeuge.195
So scheint die Situation der allgegenwärtigen Gängelung keinen Ausweg zu bieten – und doch zeigt Grünbein eine Möglichkeit auf, wie man dem fatalen ,Verblendungszusammenhang‘ entgehen kann bzw. konnte:
Doch blieb ich stoisch, mein Revier im Blick.196
Die Pawlow’schen Gemengeanteile in seiner Hund-Metapher zurückdrängend und dafür die traditionellen, d.h. die antiken und modernistischen hervorkehrend, stilisiert er sich zu einem intrakulturellen Widergänger,197 der sich nicht vereinnahmen lässt, sondern aus der Distanz beobachtet, was um ihn her geschieht. Anstatt sich durch die politische Theorie korrumpieren zu lassen, nimmt er sich den sophistisch-zweiflerischen Sokrates mit seiner festgefügte Welterklärungen zertrümmernden Denkweise zum Vorbild:
Denk an Sokrates.
Wenn der schwor ,Beim Hund!‘
Fiel eine Welt aus Meinungen in Scherben.198
Zum Schein mimt er den Angepassten, der im Himmel der Ideologie mitzuschweben vorgibt, in Wirklichkeit aber Bodenkontakt behält:
Wenn ich auf allen Vieren Haltung annahm,
Zündstoff mein Fell, lud mich der Boden auf.199
Das Bedürfnis, sich zu tarnen, nimmt er als Erblast der sozialistische Vergangenheit mit in die Gegenwart, denn in „Transit Berlin“ bestimmt er die „ironisch spielerische Tarnung oder Mimikry“200 als typischen Stil des postmodernen Künstlers.
Insbesondere aus der siebten Strophe geht deutlich hervor, dass Grünbein sich auch früher den politischen Kräfteverhältnissen zu entziehen suchte, um – wie schon die Vorbilder James Joyce und Dylan Thomas – eine Haltung des radikalen Individualismus zu pflegen:
Im Westen, heißt es, geht der Hund dem Herrn
Voraus.
Im Osten folgt er ihm – mit Abstand.
Was mich betrifft, ich war mein eigner Hund,
Gleich fern von Ost und West, im
Todesstreifen.201
Mit dem Mauerfall hat sich dieser Wille zur Autonomi nicht erledigt. Im Gegenteil: Die in ihm angelegte (modernistische) Tendenz zur Selbstmarginalisierung reichert sich um postmoderne Elemente an und radikalisiert sich zu einem Kurs der – bereits für „Niemands Land Stimmen“ und „Transit Berlin“ bemerkten – „Selbstverflüchtigung“:
Die Landschaft sinkt zurück, ein neuer Baugrund.
Seit ich hier raus bin, kennt mich niemand mehr.
Der Sand löscht aus.202
Mithin ist die neue Freiheit, die sich dem Hund erschließt, eine der Auslöschung. Er will vollkommen vergessen, wer er war und wo er herkam, seine Vergangenheit tilgen, sich vom antrainierten „Identitätszwang“ (Adorno) reinigen und diesen auf der „historischen Müllhalde“203 entsorgen. Denn was auf die (moderne) Ära historischen Stillstands folgt, ist die (postmoderne) unablässige Grenzüberschreitung in der „Flucht nach vorn“.204
Ausblick
In den folgenden Büchern, insbesondere in den Gedichtbänden seit 1999, wird diese ,Flucht nach vorn‘ sich allerdings als eine ,Flucht zurück‘, nämlich – zunächst – in die (spätrömische) Antike kundtun.205 Ganz generell kommt es zu einschneidenden Veränderungen in seinem lyrischen Werk. Die markanteste ist sicherlich die Schwerpunktverschiebung von der Naturwissenschaft zur Geschichte als maßgeblichem Fundus, aus dem sich Themen, Inhalte und vor allem die Form der Gedichte speisen.206 Grünbein avanciert immer mehr zum ,Klassizisten‘, der sich mit vollen Händen aus dem „Katalog sekundärer Formen“,207 wie er durch die Tradition bereitgestellt wird, bedient. Das hatte er zwar auch schon früher getan: Bereits in Grauzone morgens und in Den Teuren Toten (1994) spielte er mit Variationen der Dante’schen Terzine, im „Portrait des Künstlers als junger Grenzhund“ verwendet er die Stanze in (unreinen) Blankversen. Doch erst seit Nach den Satiren (1999) wird dieses so typisch für sein lyrisches Schaffen, dass man Grünbein mittlerweile geradezu mit einer postmodernen ars magna zu identifizieren geneigt ist. Seine Poetik arbeitet zusehends mit ihren eigenen Beständen, variiert und aktualisiert ihre programmatischen Kernbereiche und Motivfelder, nimmt Neues hinzu (wie beispielsweise Anbindungsversuche an die Philosophie, man denke an seine Auseinandersetzung mit Seneca und Descartes), gibt aber nichts vollständig auf. Nichtsdestotrotz ist unverkennbar, dass die frühe Poetik der sarkastischen Reduktion und des solipsistischen ,Einzelgängerspiels‘ ihre Dominanz verliert und dass statt ihrer ein dialogisches, ein ,metaphysisches‘ Poesie-Konzept an Boden gewinnt, das die Dichtung in ein Gespräch mit den großen Wahlverwandten der Tradition verwickelt sieht und sie solcherart vorrangig als ein Medium des Gedenkens und des Aufbereitens von Geschichtlichem begreift.208 Das 2003 veröffentlichte Descartes-Epos Vom Schnee spricht hierzu deutliche Worte.
Immer wieder finden sich in den späteren Büchern (Erinnerungs-)Gedichte, die die Wendezeit oder – weit häufiger – die eigene Vergangenheit unterm Sozialismus thematisieren: Denken wir etwa an „Trigeminus“ aus Falten und Fallen (1994), an „Novembertage“ oder „Vita brevis“ aus Nach den Satiren, an „Abschied vom Fünften Zeitalter“ aus Erklärte Nacht (2002) oder „Russischer Sektor“ aus Strophen für übermorgen (2007). So unterschiedlich diese Gedichte im Einzelnen sein mögen, gemeinsam ist ihnen eines: Der sarkastisch-mokante Ton, der sie nach wie vor prägt, verliert seine provokante Schärfe, wird abgeklärter und souveräner, etabliert sich als ein Muster, das routiniert fortgeschrieben wird. Während der junge Grünbein noch an der Subversion DDR-typischer, engagierter Schreibverfahren und -intentionen arbeitete, hat sich der ,zweite‘, der ,historische‘ Grünbein davon gelöst. Nun erhebt er seine Stimme als kritischer Kommentator, erprobt er Formen literarischer Einmischung, die im Zeichen einer „elitären“ Variante engagierten Anti-Engagements zu sehen sind. Der Sarkast aktualisiert sich, indem er sich neuere, zeitgemäßere Angriffsflächen sucht, etwa den Kapitalismus, die westliche Freizeitindustrie oder auch den islamischen Dschihad-Gedanken. Um in dem zuletzt in Koloß im Nebel (2012) ausgiebig bemühten Bildbereich, jenem des Meeres, zu bleiben: Sein Schiff hat die brüchigen Taue endgültig losgeworfen, die das Frühwerk noch mit der Literatur der DDR verbanden, und sei es nur in der „Geste des Abwinkens“.209 Die Geschichte ist für ihn nicht nur, wie Helmut Böttiger es einmal formulierte, der „Fluchtpunkt nach dem Büchnerpreis“210 geworden, sondern auch und vor allem ein Fluchtpunkt nach der Überwindung der Avantgarde.
Hinrich Ahrend, aus Mirjam Meuser, Janine Ludwig (Hrsg.): Literatur ohne Land? Schreibstrategien einer DDR-Literatur im vereinten Deutschland Band II, fwpf, 2014
Aris Fioretos und Durs Grünbein
– Gespräch über die Zone, den Hund und die Knochen. –
In der Zone
Aris Fioretos: Vor kurzem las ich in einer noch unveröffentlichten Tagebuchnotiz von Ernst Jünger, wie er Besuch bekommt. Es muß so um 1986 gewesen sein, jedenfalls vor der sogenannten Wende. Der Besucher war Jünger nicht sonderlich gut bekannt, dir dafür um so besser. Es war Heiner Müller. Der Kollege, schrieb Jünger, sei wohl, dem Hörensagen nach, ein guter Schriftsteller. Er kam, fügte er hinzu, „aus der Zone“.
Durs Grünbein: Gemeint war hier natürlich die Sowjetzone, die alte Besatzungszone, das graue Ostdeutschland. Ein Ort wie aus einem Science-fiction-Roman, ein verstrahltes, kontaminiertes Gebiet. Ich fand die Bezeichnung immer sehr brauchbar, weil sie das Exterritoriale, den Sonderstatus betont. Die DDR, das wurde nicht erst hinterher klar, war eine unmögliche Konstruktion, eine Art Testgelände für eine klassische deutsche Idee, exekutiert unter sowjetischer Aufsicht, den Wissenschaftlichen Sozialismus von Marx, der verkündete, Hegels Philosophie vom Kopf auf die Füße gestellt zu haben.
Fioretos: Kritisches Denken ist reine Gymnastik. Wo es für Hegel darum ging, auf dem Kopf gehen zu können, meinte Marx, mit den Füßen denken zu dürfen. Du kanntest die Zone, und zwar nicht nur als herablassenden Begriff.
Grünbein: Ich hatte keine große Wahl. Ich bin da aufgewachsen. Geboren bin ich in Dresden, Sachsen, also in einer Region, die immer viel auf ihre Kultur, ihren Kunstsinn gehalten hat. Nach den Bombenangriffen am Kriegsende war die Stadt eine einzige Barockruine, ein Trümmerfeld, über dem die Geigen wimmerten. Dieser Klagegesang lag noch in meiner Zeit in der Luft. Mit den Erinnerungen an einstige Größe und jähen Niedergang bin ich großgeworden. So lag es nahe, daß ich die Stilepochen und die Katastrophen in einem gewissen Zusammenhang sah. Und vielleicht rührt von daher auch meine Neugier auf die antike Literatur. Lesen war für mich immer ein Weg zurück, von einer Quelle zur nächsten. Und natürlich haben mich unter den Dichtern des zwanzigsten Jahrhunderts vor allem die Quellensucher interessiert, die Spürhunde der Tradition. Ich weiß noch, wie ich eines Tages auf Ezra Pound stieß und sofort alles um mich herum vergaß, gerade weil ich zunächst viel mehr ahnte, als ich verstand. Heute ist Pound mir wie ein sehr ferner Kontinent, den ich vielleicht nie wieder mit derselben Inbrunst besuchen werde. Aber geblieben ist doch die Vorstellung, daß Dichtung vorwegnehmendes Wissen ist, das mit einer Ahnung beginnt.
Fioretos: Wie hast du Pound aufgespürt?
Grünbein: Ein Zufall. Es war ein Freund, der mir ein zerlesenes Taschenbuch mit den Cantos gab, eine zweisprachige Ausgabe. Alles daran kam mir merkwürdig vor, zunächst mal der Name. Ich habe dann irgendwann in einem Lexikon nachgeschlagen, daß Pound ein geistig umnachteter amerikanischer Dichter gewesen sei, das war die offizielle Erklärung im Osten. Pound war da eine Art dichtender Irrer mit einem Hang zum italienischen Faschismus, die Pisaner Cantos ein geistiges Zerfallsprodukt. Die erste Überraschung war doch, daß Wahnsinn und Amerika überhaupt zusammengingen. Ich war gewiß naiv, aber für mich ist der Zusammenhang immer Gesundheit und Amerika gewesen, Neuland und Industrie, ein Ende der stickigen europäischen Verhältnisse. Jedenfalls hat mich das Buch selbst so sehr verrückt gemacht, daß ich weitergeforscht habe. Chinesische Schriftzeichen, griechische Originalzitate, überall Verweise auf die klassischen Texte… was sollte das Ganze? Vielleicht, dachte ich, ist er wirklich krank gewesen. Das Gedankenprotokoll eines dissoziierten Gehirns könnte so aussehen. Aber das Beste war, daß sich in dieser Dichtung, in diesem unerträglichen, stinkenden Redefluß das ganze Jahrhundert wiederfand. Am Ende ergab sich ein Tableau, das so anspielungsreich, so bis in alle Zeitentiefen hinein gestaffelt war, daß man sich in ihm verlieren konnte. Es war der gesamte Western and Eastern Canon, der dort vorüberzog. Hinzu kam die Verblüffung, daß eine Form in ihrer völligen Zerbrochenheit noch derart unmittelbare Bewußtseinsschübe auslösen konnte. Was ich vor mir aufgeschlagen sah, war eine riesige Landkarte, viel zu groß für einen einzelnen Menschen, und doch hatte ein Dichter sie zu zeichnen versucht. Alle Kritiker Pounds haben immer nur in irgendeiner Ecke dieser Landkarte Halt gemacht.
Fioretos: Will man die Seelenruhe bewahren, muß man wohl in der Provinz bleiben.
Grünbein: Gerade an Pound kann man studieren, wie eine Kritik aus der geistigen Provinz funktioniert… selbst wenn sie scharfsinnig ist und von Joseph Brodsky kommt. Die romantische Kritik war immer auf die Vollendung des Kunstwerkes aus. Vielleicht hätte Schlegel die notwendigen Kommentare zu Pound verfassen können. Realistische Kritik oder der Scharfblick der metaphysischen Dichter unseres Zeitalters sieht nur die Schwächen des Werkes. Aphasie, Dogma, Inkonsistenz. Dabei ist Pound selbst der Provinzler als Kosmopolit, sozusagen die ubiquitäre Kartoffel. Seine grenzenlose und boshafte Naivität nahm wie ein Schwamm alle anderen Kulturen auf.
Fioretos: Mit Pound verbinde ich merkwürdigerweise eine ähnliche Erfahrung. Als Neunzehnjähriger saß ich, wie alle jungen Männer damals schwarzgekleidet und schwermütig, fast jeden Abend in der amerikanischen Bibliothek in Athen. Neben Plath und Sexton, daher wohl die Melancholie, las ich auch Pound. Was mich sofort angesprochen haben muß, denke ich, waren die harten Fügungen. Dies schien ein Dichten zu sein, das von der Unterbrechung lebte – der des Tons, der Thematik, der Syntax, des Bildes. Alles konnte ins Gedicht eingehen, ohne vorher seine Fremdheit, wie einen Mantel, in dem schmalen Vorzimmer zwischen Titel und erster Zeile ablegen zu müssen. Vielleicht war es ein Synthetisieren ohne Synthese. Ich weiß nicht genau. Interessant fand ich wenigstens die Unbändigkeit. Als Teenager legt man seine Ehre in sowas. Pounds Poesie schien hauptsächlich aus Fremdteilen zu bestehen. Dies war Prothesen- statt Protestlyrik. Im Gegensatz zur Eliotschen Methode, wo es darum ging, fremde Teile im Namen einer vorgeblich einheitlichen geistigen Tradition zu konsolidieren (die daher immer von den Humanisten unter uns bevorzugt wurde) zeigte seine Poesie, daß die Situation des Dichters nicht eine natürliche sein konnte. Das Beispiel nahm die entscheidende Rolle ein, nicht die Illustration mit ihrem Anspruch von Allgemeinheit. Das gefiel mir als jemand, der, in Schweden geboren, halb Grieche, halb Österreicher war. Im Raum, der in Pounds Schreiben geschaffen wurde, war die Poesie nie in situ, sozusagen, sondern immer nur in parasitu. Sie befand sich an einem Ort, wo die Worte nunmehr als entstellt und entstellend denkbar waren. Seitdem ist die parasitäre Literatur – oder, kürzer, die Paraliteratur – die für mich prägende gewesen, eine Literatur, die unter anderem ihren eigenen Mangel an Verankerung zum Gegenstand nimmt. Es würde mich nicht wundern, wenn das Interesse dafür eine Folge der familiären Lage eines Immigrantenkindes war. In meinem Elternhaus wurde meistens Schwedisch gesprochen, es war aber keine normierende Sprache. Andererseits waren weder Griechisch noch Deutsch Muttersprachen, obwohl ich sie natürlich spreche, vor allem Deutsch. Eigentlich kann ich keine der drei Sprachen als „meine“ betrachten. Heute ist das nichts, was ich bedaure. Statt einer eigenen Sprache habe ich mehrere Fremdsprachen. Entfremdung dient der Bereicherung.
Grünbein: Für mich lag in den Cantos die ganze Landschaft des Kalten Krieges ausgebreitet, in einem frühen Stadium. Es ist doch enorm, daß Pound sich im Gefängnis eine russische Grammatik kommen ließ, um einen Brief an Stalin zu schreiben. Er schrieb auch Briefe an Churchill und Roosevelt. Seine Idee war, daß der Dichter als exemplarischer Einzelner mit den Entscheidungsträgern dieser Welt kommunizieren müsse. Die kommende Blockbildung, die Tektonik des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit, das alles ist bei Pound schon vorgeprägt. Und noch eins: die Konstellation Pound-Hölderlin, die Erinnerung an die Götter in einer Welt ohne Götter:
What thou lovest well will remain…
Zeilen wie diese haben mich auf die Spur gesetzt. Pound zu entdecken, kam einem Dammbruch gleich, einer totalen Öffnung. Alles Aufgestaute begann nun zu fließen. Eine späte Zeile von Hölderlin faßt diese Erfahrung wie ein Orakel zusammen:
Wie Bäche reißt das Ende von Etwas nicht hin, welches sich wie Asien ausdehnet…
Die zerfallenden Weltbilder, ihre Auflösung in ungeheure geographische Räume, das war es, was mich als einen Bewohner der Zone nach Draußen rief. Grauzone, morgens war das erste Buch. Die beiden Hauptelemente sind die Farbe Grau und der Tagesanbruch, der immerwährende Morgen in einer Gesellschaft, die auf der Stelle tritt. Im Grau steckt der Übergang, das Retardieren aller chromatischen Möglichkeiten. Aus der Sicht des Westens war der Osten immer grau. Komischerweise war das auch mein Empfinden, obwohl ich selbst den Kontrast gar nicht kannte. Für mich ging es darum, die Kontrastlosigkeit zu benennen. Alles hatte sich mit dieser grauen Schicht überzogen. Die größte Angst war die, zu erblinden, ästhetisch, moralisch, politisch, in jeder Hinsicht. Dabei stand Grau aber auch als Begriff, als ein Codewort für die subversiven Möglichkeiten des Gehirns. Denn das Gehirn, diese „graue Substanz“, konnte jederzeit alles um sich herum verwandeln. In seinem Gehirn wohnte man wie in einem eigenen Bau, mit vielen Geheimgängen und Vorratskammern. Das Gehirn war ein utopisches Labyrinth, aus dem einen niemand so leicht vertreiben konnte. Es gab immer diesen Doppelsinn von Grau, die Farbe der Tarnung wie beim Bunker, die Farbe des lauernden Gehirns und das Ende aller Signale, die Auslöschung, der Graue Star. Das Erstaunliche im Osten war ja zuallererst die Monotonie des Alltagslebens, von der jeder Tourist sich in fünf Minuten ein Bild machen konnte. Eigentlich hätte der Minimalismus als Kunstform im Osten aufkommen müssen. Was im sozialistischen Großreich passierte, war letzten Endes der Versuch, Elemente, die seit Jahrhunderten zur Gesellschaft gehörten, abzuschaffen, stillzustellen. Ging es im Westen darum, die Winde zu disziplinieren – Arbeitslosigkeit zu regulieren, juristische Abläufe und steuerliche Verkehrsformen zu installieren – so war der Osten die ganze Zeit über mit der Abschaffung des Windes beschäftigt. Die Utopie war, den Wind grundsätzlich, ein für allemal, abzuschaffen.
Fioretos: Die DDR als Windschatten.
Grünbein: Und daher die Hysterie nach dem Mauerfall. Was wir jetzt hören, ist das Jammern der vielen Seelen, die geglaubt haben, daß der Wind abzuschaffen war. Jetzt müssen sie damit leben, daß er von allen Seiten hereinpfeift. Die Zone als ein Land jenseits der Winde, als hyperboräische Region ist nun Vergangenheit. Wenn man vom Osten in den Westen kam, war es, als wäre man in einen anderen Aggregratzustand eingetreten. Hier ging alles schneller, das Geschehen war irgendwie dichter, auch älter, erwachsener. Der Sozialismus arbeitete mit dem kindlichen Bild, daß die Menschheit eine lange Reise hinter sich gebracht hätte, und nun endlich sei der Hafen gefunden, in dem das neue Zeitalter beginnen mußte. Vielleicht erklärt das auch den starken Bezug zur Antike, den man in der DDR-Literatur findet. Überall Aufbruchs- und Gründungsmythen, von der Ausfahrt der Argonauten bis zu den Drecksarbeiten des Herakles. Nach langer Irrfahrt war die Menschheit im Sozialismus angekommen. Der Ort war vielleicht etwas schäbig und heruntergekommen (das war das Erbe des Kapitalismus), aber es war ein neuer Baugrund, jetzt konnten die Fundamente gelegt werden. Du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Menge an Enttäuschungen es gebraucht hat, bis dieses Bild durch ein anderes ersetzt wurde: das einer toten Bucht, einer historischen Müllhalde. Wieviel Sarkasmus es brauchte, bevor man das ganze Fiasko ausdrücken konnte. Zum Schluß war es nur noch eine Frage der Sichtbarmachung des Offensichtlichen. In einem Gedicht wie „Nachruf auf eine verbotene Stadt“ habe ich nur noch zu benennen versucht, was jeder sehen konnte, aber in einer Weise, als ginge es um irgendeine altgriechische Provinz. O weh, soviel verlorener Geist der Utopie.
Fioretos: Den grauen Göttern sei Dank, habe ich das Privileg gehabt, nie die Uhr nach einer Zeit stellen zu müssen. Seit Jahren führe ich diese bürgerliche Zigeunerexistenz Amerika, Deutschland, Dänemark mit Feuer am Parkett und die Regale voller geklauter Bücher. Es wäre aber zu viel gesagt, ich fühle mich ohne Wurzel; ungebunden reicht. Ich befand mich früh in einer Grauzone, angenehm anders als deine. In meinem zweiten Buch, Das graue Buch, habe ich versucht, Bilder dieser ganz anderen DDR einzufangen: Die Diffuse Region. Sie bot einen Schwellenbereich an, in dem Unsicherheit herrschte. Die Koordinaten waren vieldeutig, und von Zentralsteuerung konnte keine Rede mehr sein. Ich entdeckte auch, daß Grau für mich die Farbe der Langsamkeit war. Daher ihre Begehrlichkeit. Denn im Grau zu leben, hieß in einer parallelen Zeit zu leben, die der Unabgeschlossenheit eingedenk blieb. Mit der blauen Blume oder roten Rose konnte ich wenigstens nie viel anfangen. Sowohl romantische Sehnsucht als auch organisiertes Engagement scheinen mir für die Literatur vermessene Ansprüche zu sein: sie erreicht weniger und bedeutet mehr. „Es träumt sich nicht mehr von der blauen Blume“, heißt es bei Benjamin.
Wer heute als Heinrich von Ofterdingen erwacht, muß verschlafen haben.
Demnach könnte Grau mit einer gewissen Wachsamkeit verbunden werden, eine Erfahrung der Trägheit der Zeit. Jeder, der schlaflos gelegen hat, weiß, daß die Zeit ungeheuer langsam vergeht. Das graue Buch enthielt die konservierten Früchte der Insomnie. Ich habe versucht, die nächtliche Trostlosigkeit zu skandieren. Trotz ihrer offenbaren Armut besitzt die Farbe jedoch einen geradezu unheimlichen Reichtum. Schichten und Schattierungen werden durch die elementarste Form der Trennung möglich: die zwischen Schwarz und Weiß. Für mich ist Grau merkwürdigerweise die Farbe der Kontraste.
Forschungen eines Hundes
Grünbein: Ich hatte immer das Gefühl, daß das Leben in der Zone nur auszuhalten war, wenn man Soldat war. Bürgerliche Kultiviertheit oder aristokratische Exzentrizität konnten dagegen überhaupt nichts ausrichten. Individualismus war die verkehrte Überlebensstrategie. Das System war nur durch innere Disziplin zu überlisten. Der Soldat ist ja nicht nur ein kriegerisches Wesen, der gehorsame Destrukteur, seine Stärke ist auch die Unscheinbarkeit. Gegen das Militärische hatte ich dieselben Vernunftgründe wie jeder andere, aber ich wußte: Ich muß sorgfältiger lesen.
Auch, ich komme um den Wehrdienst nicht herum. Die Situation war ungefähr so wie in Israel. Es gab den wehrhaften Staat, und sein Gesetz ist die Paranoia. Man legt einen Eid ab und schon ist man im tiefsten Konflikt. Mimikry ist die einzige Chance, die man noch hat. In der Rolle des Soldaten habe ich unendlich viel über mich gelernt, über mein Anpassungsverhalten, meine Beobachtungsgaben, meinen Überlebenstrieb. So wurde ich, ganz körperlich, jenseits aller intellektuellen Vorbehalte, ein Teil des Systems.
Fioretos: Auch Viren sind systemisch, egal wie harmlos oder gefährlich sie sind.
Grünbein: Dabei hatten sie in mir den geborenen Deserteur. Bei Kriegsausbruch hätte ich sofort versucht, auf die andere Seite zu gelangen. Geblieben ist davon bis heute dieses komische Soldatengefühl. Als wäre ich infiziert, erscheint mir der Alltag in vieler Hinsicht als Zivilleben… reizvoll und exotisch wie in Kriegszeiten der Urlaub im friedlichen Hinterland. Als in Polen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, war plötzlich klar, worum es im Osten die ganze Zeit ging. Das heimliche Ideal war noch immer der Kriegskommunismus, den Lenin einst proklamiert hatte. Der Ausnahmezustand war die wirkliche konkrete Utopie, die Administration in Staat und Wirtschaft sein schwacher Abglanz. Alles was nachher unter dem Namen Realsozialismus ablief, was schon Verfall, Dekadenz, kleinbürgerlicher Biedermeier. Im Grunde lief es auf die schöne Formel von Baudelaire hinaus:
Die Revolution bestätigt den Aberglauben durch Opfer.
Dabei ging es um Menschenopfer, Opfer an Besitz, Bewegungsfreiheit, privater Zeit. Durch das Opfer wurde der revolutionäre Prozeß legitimiert, bis hinein in die jeweilige Psyche. In diesem Zusammenhang wurden für mich die Theorien Pawlows wichtig, denn die Nahtstelle der Abhängigkeit, das Scharnier in den Diktaturen war der Bedingte Reflex. Pawlow hatte da eine Entdeckung gemacht, zuerst an den Hunden, die sich leicht auf den Menschen übertragen ließ, was sein Schüler Bechterew dann auch tat. Im Jahr der Oktoberrevolution 1917 erschien sein Buch über Kollektive Reflexologie, eine Art Sozialtheorie der Bedingten Reflexe. Das Interessante ist die Rolle dieser Biologen in der Revolutionszeit. Pawlow wurde von Lenin persönlich gefördert, der ihn in den Hungerjahren mit Sonderrationen versorgte. Und Bechterew war der Mann, von dem sich Stalin in den Zwanziger Jahren untersuchen ließ und der dem Diktator eine ausgewachsene Paranoia bescheinigte. Stalin soll seine Vertrauten gefragt haben „Paranoia – was ist denn das?“ Kurz darauf wurde Bechterew krank und starb unter mysteriösen Umständen. Geschichten wie diese kommen natürlich aus einer anderen Sphäre als die Erzählungen des Wiener Nervenarztes Sigmund Freud. Das Leben jenseits des Eisernen Vorhangs ließ sich, das war meine kleine These, eher begreifen mit der Reflextheorie Pawlows als mit der Neurosenlehre Freuds, die besser zu einer bürgerlichen Gesellschaft paßt. Verdrängung und Wunsch schienen ebenso abgeschafft wie die sexuellen Traumata, die ödipalen Konflikte in der Kleinfamilie. Was zählte, war der indirekte Reiz, die Befehlsstruktur, die kollektive Konditionierung. Das Körperliche dominierte das Symbolische.
Fioretos: In Moskau und Dresden war mit anderen Worten ein sarkastischer Ansatz gefordert, während in Wien oder London der ironische genügte?
Grünbein: Was war denn das „Unbehagen in der Kultur“ nach einer Revolution? Die alte Kultur war ja untergegangen. Hier steckte man in einem großangelegten Tierexperiment. Eines der Hauptprobleme bei Pawlow war die Tatsache, daß man den Hund von der Umwelt isolieren mußte, um die Versuche ungestört durchführen zu können. Die Tiere wurden in schalldichten Räumen gefangen gehalten, das Labor hieß „Der Turm des Schweigens“.
Fioretos: Eine Verkehrung des Turmes zu Babel: keine Vielfalt der Sprachen mehr, keine Verwirrung…
Grünbein: Nur so erklärt sich der Mauerbau, die Abschließung des Ostblocks. In der isolierten Zone herrschten die idealen Bedingungen zur Arbeit am Neuen Menschen. Leider gab es eines Tages eine Überschwemmung in Pawlows Labor, das Wasser stand den Hunden bis zum Bauch. Nach dieser Katastrophe hatten sie alle Bedingten Reflexe wieder vergessen.
Fioretos: Vielleicht sind die Hunde der Kapitalisten besser geraten? Denk an die Wachhunde in Beverly Hills. Durch elektrische Zäune gedrillt, die man später entfernt, bleiben diese disziplinierten Kreaturen stets innerhalb ihres grünen Rasenreservats. Perfekte, saubere Wesen, die nur dann gefährlich werden, wenn der Garten von illegalen Einwanderern betreten wird, die nicht gelernt haben, daß privater Besitz nicht immer durch Gitter markiert werden muß. Davor aber: welche Stille.
Grünbein: Gegenüber von Alteuropa ist Amerika ein ähnlicher geographischer Großraum wie Rußland, und damit auch ein anthropologisches Neuland. Es ist klar, daß dort, in genauer Entsprechung zu den Vorgängen in Rußland, so etwas wie der Behaviorismus aufkam. Zwei große Industriegesellschaften beginnen von Pawlow zu lernen, jede auf ihre Weise. Die amerikanische Variante ist dann die Fließbandproduktion, die Taylorisierung der Arbeitsabläufe. Überall erwachte in den Zwanziger und Dreißiger Jahren plötzlich das Interesse an Verhaltensbiologie. Es gab Fachzeitschriften zur Psychotechnik. Ergonomie war das neue Zauberwort. Erforscht wurde die optimale Ausnutzung der Körper, die Grenze seiner Belastbarkeit im Produktionsprozeß. In dem Maße, wie die Innenwelten, die psychischen Interieurs und Boudoirs Freuds ausgeräumt wurden, drang nun der kalte Blick in die letzten Winkel. Die neue Sachlichkeit löste den Menschen in das Bündel seiner Reflexe auf. Im Zeitalter der Statistik trat Kontrolle anstelle der Therapie, das Bewegungstraining anstelle tiefenpsychologischer Analysen. Der Lügendetektor ist ein Apparat ganz aus dem Geiste des Behaviorismus. Und das emblematische Wesen dieser kollektiven Epoche, das Leittier in den nachbürgerlichen, industrialisierten Gesellschaften schien mir immer der Pawlowsche Hund. Es ist erstaunlich, wieviel Bedeutung er anziehen kann. In ihm kreuzen sich die fatalen Lernprozesse, all die Methoden von Überwachen und Strafen, Diät und Erziehung. Er ist das Totemtier des neuen Kults, der Selbstentfremdung… ein Produkt aus Instinkt und wissenschaftlichem Aberglauben. Langsam dämmerte mir, welche ungeheure Sonderstellung der Hund in der Literatur des Zwanzigsten Jahrhunderts einnimmt. Durch das ganze Zwanzigste Jahrhundert streunen die Hunde.
Fioretos: Vielleicht sollte man nicht vom Kanon, sondern vom Kennel der Moderne sprechen. Am Eßtisch der Familie Kafka, um nur den Kronzeugen der ersten traurigen Jahrhunderthälfte zu nehmen, gab es großen Krach, als der Sohn zugab, er verbringe seine Zeit mit dem Leiter des jüdischen Theaters, Isaak Löwy. „Wer sich mit Hunden zu Bett legt“, schrie der Vater, „steht mit Wanzen auf“. Der „Hund“ war natürlich eine antisemitische Bezeichnung. Bei engerem Kontakt mit diesem Menschentier konnten alle möglichen Parasiten übertragen werden. Löwys Truppe bestand aus Juden, aber nicht nur das, es waren Ostjuden, und nicht nur Ostjuden, sondern noch dazu ostjüdische Künstler. Eine dreifache Verfluchung: Kunst, Osten, Judentum. Da hilft nichts mehr.
Grünbein: Ein Schlüsseltext sind die „Forschungen eines Hundes“, eines der merkwürdigsten Prosastücke, das mir je untergekommen ist. Keine Allegorie, keine Parabel, eher das Protokoll von Beobachtungen in einer Parallelwelt. Seht her, sagt Kafka, so sieht dieses Leben aus, wenn man die Perspektive eines alten erfahrenen Hundes einnimmt, eines einzelgängerischen Verhaltensforschers im Hundereich. Die abartigsten Gewohnheiten werden verzeichnet, doch das Abstruse ist Ausdruck einer Rationalität inmitten der Wahnsinnsnormen. Infolge zuvieler Regeln und verschlissener Bräuche ist die Welt wieder so unverständlich geworden wie sie am Anfang, im Naturzustand, war. Die zweite Natur, unser Zivilisationsspektakel, wird zum Rätsel, das auch Akribie immer nur scheinbar löst. „Ergründe die Menschennatur…“ heißt es einmal bei Kafka, eine sarkastische Ermunterung, weil jeder Weg nun in die Irre führt. In den Cantos von Pound gibt es dazu einen salomonischen Spruch. Während im Westen der Hund seinem Herrn vorausgeht, folgt er ihm im Osten mit Abstand. Vielleicht war das ein chinesisches Gleichnis.
Fioretos: Natürlich… In Kafkas Text geht es auch um die Disziplinierung des Körpers. Zwar sucht sein Hund „in das Wesen der Hunde einzudringen“, nur müssen diese Forschungen am eigenen Körper beglaubigt werden. Zuletzt entzieht sich dieser Gelehrte, der in Paradoxen so gut beschlagen ist wie ein Talmudist, deswegen der Hundegesellschaft, geht in die splendid isolation und beginnt zu fasten. Für Kafka war die Frage des Wissens immer mit der Nahrung verbunden. Um das Wesen der Hunde ergründen zu können – und nur so kann sein Hund überleben – muß er sich von äußeren Reizen abschirmen. Aus purer Not fängt der Hund an, die eigenen Knochen zu kauen. Zuletzt führt seine reductio ad corporem canis zu einer seltsamen Inversion der Eucharistie. „Das ist der Hunger“, heißt es, „und wenn ich mir erkläre: ,Das ist der Hunger‘, so war es eigentlich der Hunger, der sprach und sich damit über mich lustig machte“.
Grünbein: Hätte der Pawlowsche Hund reden können, vielleicht hätte er Sätze wie diesen gesagt…
Fioretos: Was Kafkas Hund erfährt, ist die Wahrheit jenes Prinzips, das bei Feuerbach einmal als Gegensatz sowohl zum Gott wie zum Cogito vorgeschlagen wurde: a ventre principum – nur vom Magen her sind wir. Sein metaphysisches Tier sucht sozusagen des Pudels Kern… der sich dann in etwas so seltsam Konkreten wie dem Hunger begründet sieht. „Ein sehr reelles, weil empfindliches Nichts“, wie Feuerbach schreibt. Hunger verweist auf die Notwendigkeit von etwas, das sich außerhalb des Körpers befindet. Wir existieren nur als Aggregate des Verlangens. Unsere Körper sind Notanlagen. Im selben Maß wie es die Hunde in der Literatur gibt, gibt es auch eine Literatur des Hungers. Vielleicht heißt Schreiben nichts anderes, als Hunger zu artikulieren.
Grünbein: Essen und Schreiben scheinen sich, wenigstens bei Kafka, in fataler Weise auszuschließen.
Fioretos: Kafka war eine Weile ein Anhänger von Horace Fletcher, the great masticator, obwohl dessen „Lehre vom tüchtigen Kauen“, der Fletcherismus, eigentlich der Gegensatz zur anorektischen Hungerkunst war, wie sie in Kafkas Werk vorkommt. Unterschiedliche Arten von Nahrung sollten verschieden oft gekaut werden. Die Speisen wurden tabellarisch erfaßt: Knödel soundsoviele Male, Schnitzel soundsoviele. Dementsprechend mechanisiert konnte ein Abendessen durch 2.500 Mal Kauen in einer halben Stunde erledigt werden. Für Fletcherl war der Höhepunkt dieser Kautechnik erreicht, wenn das Essen wieder ausgespuckt wurde. Nur der Geist des Essens, die Nahrung, sollte erhalten werden, der stumme, immer im Weg stehende Leib aber nicht. Mit dem Körper konnte Fletcher genauso wenig anfangen wie Kafka. Ätiologisch gesehen war dies aber eher eine bulimische Kunstform. Nichts wurde metabolisiert. Alles ging rein, kam jedoch gleich wieder raus. Bei Kafka sah es anders aus. Am besten sollte man sich mit etwas so Ausgesuchtem wie einer Zitronenscheibe begnügen. Denk an den Hungerkünstler, der den Körper in ein reines leeres Zeichen zu verwandeln versucht. Das ist die definitive „Verwandlung“. Der Körper bleibt aber eben ein Zeichen, was folglich heißt, daß es unmöglich ist, eine Hungerkunst je zu vollenden. Das Tragische an Kafkas Held ist, daß er das Zeichen dem Bezeichneten gleichstellt. Denn auch wenn der ideale Zustand erreicht worden ist, braucht de Hungerkünstler noch seinen Körper – dieses leere Zeichen, die Null – um die Vollendung darzustellen. Seine Kunst erreicht nur ihr Ziel, wenn sie form- und gegenstandslos geworden, das heißt, endgültig verschwunden ist.
Knochenkunst
Grünbein: Du hast so etwas wie eine graue Trilogie geschrieben: Das Buch der Teilung, Das graue Buch und zuletzt Ein Buch über Phantome. Im ersten geht es um das Vergessen des Gelebten, um den Verlust einer Liebe und um den Verlust dieses Verlusts, im zweiten um das, Verschwinden, wenn man so will, das Entkörpern. Und im dritten befaßt du dich mit den bloßen Erscheinungen. Wie aber kommt es zu dem Schock, zur Erfahrung von Vergeblichkeit und Vergängnis, wenn der Körper doch längst abhanden gekommen ist?
Fioretos: Erinnerst du dich an Goethes Farbenlehre? Da gibt es seltsame Stellen, metaphysische Untiefen. Laut Goethe war das Licht pur und unfaßbar wie der absolute Geist. Um sichtbar zu werden und Kontur geben zu können, muß das Licht in die Materie eindringen. Daraus entstehen die Farben und Formen. Unsere Welt erfordert die Mischung. Der erste benennbare Farbton, der durch diese gigantische Kopulation geschaffen wurde, war ein „glänzender Schatten“, in dem Licht und Finsternis zusammengerührt worden sind. Grau ist dementprechend nicht irgendeine Farbe, sondern die Grundfarbe des Mischens überhaupt, ein Sinnbild des Geschaffenen und somit auch die Farbe der Endlichkeit. In der „grauen Trias“, der ich die letzten Jahre gewidmet habe, geht es um die verschiedenen Aspekte dieser Endlichkeit. Und also durchaus auch um den Körper. Paradoxerweise ist er ja das Endliche, und nicht etwa das, was mit Geist oder Seele gemeint ist. Ich weiß nicht so genau, was die Seele ausmacht, aber mit Ausnahme einiger Knochen und Goldzähne hat der Körper die Angewohnheit, seinen Betriebszustand nach Jahren aufzugeben. Es ist Staub, Luft und Zeit, die einen Umriß bekommen haben. Wir alle sind nur Silhouetten, in denen das Sterben seine Arbeit verrichtet.
Grünbein: Deine Bücher folgen so der guten alten aristotelischen Ordnung. Nach dem Tableau aller Wissenschaften und Künste kommen die Bücher der Metaphysik. Was folgt, ist die Spekulation, die Beschäftigung mit der Trennung, dem Grauen, der Welt der Phantome. Vermutlich lebst und denkst du gern in Büchern. Das Danach spielt für dich die größte Rolle. Meinst du, ideal sei erst der Text, der kein Leben mehr braucht?
Fioretos: Gerade das wollte Das graue Buch in Zweifel ziehen. Über das Leben zu triumphieren ist eine Unmöglichkeit (wenn nichts anderes, zeigt Kafkas Hungerkünstler dies), auch wenn Texte organlos sind, soweit ich weiß. Aber vielleicht habe ich tatsächlich Nach-Bücher geschrieben, so wie es Nach-Bilder gibt, Erscheinungen, die auf der Netzhaut weiterflimmern. Möglich sind solche Bücher erst, seit die Trennungslinien zwischen den Gattungen verwischt sind. Wenigstens bemühen sie sich nicht mehr sonderlich, zwischen literarischer und kritischer Sprache sauber zu trennen. Diese Kontamination ist mir vorgehalten worden. Ich beklage, daß ich kein Purist bin. Jedoch stelle ich mir vor, man muß „diese Scheiß Sterblichkeit“ feiern. Es klingt paradox, aber wahrscheinlich geht es mir um eine unendliche Endlichkeit. Das Ende kann ja eigentlich nie aufhören zu enden. Unser Gedächtnis ist ein riesiges Depot, das die Spuren einer Vielfalt von Verschwinden aufbewahrt. Stets kommen neue hinzu. Und immer zieht der Wind des Vergessens durch die Räume. Insofern ist es wichtig, daß es sich nicht um eine Trilogie handelt, sondern um eine Trias. Die drei Bücher sind nicht, wie etwa bei Aristoteles, Teile einer durchdachten, anatomisch disponierten Komposition, sondern Elemente einer Konstellation, die vom Zufall geprägt ist. Ein Konglomerat aus lauter Tics und Idiosynkrasien. Meine Absicht war nie, etwas zu komponieren. Für mich waren es sehr einsame Bücher. Erst mit dem Buch über Phantome wurde mir klar, daß sie etwas miteinander zu tun haben könnten. Erst zusammen ergeben sie eine De-Komposition. Sie sind der Versuch, dem, was einen Körper zum Körper macht, sprachlich nachzugehen. Man spricht oft vom Text als einem Corpus, was vielleicht stimmt, aber er ist eben nie lebendig gewesen – wenigstens nicht so, wie wir es gewesen sind. Als Begriff, um Geschriebenes zu charakterisieren, bleibt „Lebendigkeit“ eine bloße Metapher. Die einzige Verkörperung eines Textes, die ich mir sozusagen leibhaftig machen kann, ist die, die in der Figur Lazarus wiederkehrt. Was mit ihm geschieht – diese ungeheure Herausforderung, Veni foras, Lazare… – beim Lesen wird sie wiederholt. Lazarus steht nicht zu einem neuen Leben auf, sondern er ist einer, der den Tod ins Leben einführt. Er ist der gestaltgewordene Tod. Wenn Das graue Buch irgendwo zu Hause ist, dann vielleicht zuletzt in einem siècle lazaréen.
Grünbein: Dann gibt es also nicht einmal den idealen Abstieg innerhalb eines Textes?
Fioretos: Ich gehöre wahrscheinlich zu denen, die sich an den Gitterstangen ihrer grauen Zeile festklammern, ungefähr so wie in Kafkas „Urteil“ die Hauptfigur sich am Geländer „wie ein Hungriger die Nahrung“ festhält. Danach läßt er sich fallen. Soweit bin ich noch nicht gekommen. Aber auch bei mir gibt es ein gnawing to be gone, um mit Beckett zu sprechen.
Grünbein: Das kann schon etwas sehr Komisches haben. Ist Schreiben nicht eigentlich Slapstick?
Fioretos: Und was für einer. Als würde diese Zelle Freiheit beinhalten. Mein geheimer Wunsch ist, eine Literatur schreiben zu können, die wie Buster Keaton agiert. Tödlicher Ernst, verbunden mit dem Wissen um die lächerlich grandiose Zufälligkeit der Existenz. Deadpan. Aber gewiß bleibt dieser Wunsch ein Traum.
Grünbein: Wenn ich es richtig verstehe, sind deine Bücher auch der Versuch, einen schwebenden Augenblick festzuhalten, eine Intervention gegen den Fortgang in der Zeit.
Fioretos: Natürlich ist es ein Klischée – dieser Augenblick, in dem ein ganzes Leben angeblich Revue passieren soll. Mir ging es darum, die räumliche Tasche eines gewissen Jetzt zu erforschen und das zu verzeichnen, was die retinalen Revenants auf den Innenseiten meiner Augenlider austrugen. Natürlich machte es Spaß, die Fragmente, die auftauchten und gleich wieder verschwanden, zu drehen, zu verdrehen, ihnen stets neue Perspektiven abzugewinnen. Es war eine Art Spektralanalyse. Nur so kann ich mir die Möglichkeiten und Denkbilder, die da wiederholt werden, erklären, Einfälle, die an der Küste eines anonymen Bewußtseins sich brechen, um auf weiße Blätter gespült zu werden, wo ihre schäbigen Muster dann mit gelassener Gleichgültigkeit irgendwann ausgewischt werden.
Grünbein: Du arbeitest gern mit syntaktischen Drehungen und baust Sätze, die in viele Richtungen führen können. Deine Texte folgen den gegenläufigen Gedanken oft in kurzen Sprüngen.
Fioretos: Meine Reflexe sind durchaus bedingt. Wiederholung als solche interessiert mich wenig. Früher oder später wird sie eine Angelegenheit für die Ordnungspolizisten der Literatur, die Formalisten. Es klingt meschugge, aber vermutlich hat es damit zu tun, daß ich nie eine einzige Idee gehabt habe. Einfälle, Impressionen, sogar Eingebungen… all das ja, sogar oft. Aber Ideen? Der Ausgangspunkt ist für mich immer ein staubiges Fast-Nichts, in dem ich ein Muster zu erblicken versuche.
Grünbein: In Dantes Hölle gibt es Positionen, die sich so beschreiben ließen. Es sind gewisse Todeslagen, in denen die früheren Lebenslagen gespiegelt werden.
Fioretos: Wenn ich ehrlich damit umgehe, was natürlich selten passiert, bin ich immer mit einem aschigen Etwas konfrontiert. Ich sehe darin weder ein Vergnügen noch einen Abgrund. Es ist eher ein neutraler, eben endlicher Zustand. Vielleicht ist es eine Wand vor mir. Ich kann es nicht sagen. Erst im Moment, wo ich mich umdrehe, fängt das Schreiben an. Um entstehen zu können, muß die Schrift ebendiese Wand vergessen, eine Wand, an die sie sich aber stets zu erinnern versucht. Im besten Fall kann sie bleigraues Licht über dies und jenes werfen. Timofey Pnin nannte es einmal das grayboard. Vielleicht besteht meine wirkliche Sehnsucht aber darin, mich zuletzt nicht umzudrehen. Eine fabulöse, indifferente Verweigerung. Ungefähr wie bei Melvilles Bartleby: I would prefer not to… All dies liegt jedoch in der Vergangenheit. Seit einiger Zeit arbeite ich mit etwas ganz anderem. Es scheint ein Text ohne Grautöne zu werden. Soweit ich es beurteilen kann, gibt es keinen einzigen Grisaille-Effekt. Die Schwärze scheint so kapital zu sein, daß sie sogar Billigung bei Metallica finden könnte. Aber… nein, das ist eine andere Geschichte.
Grünbein: Die graue Region, von der du sprichst, könnte vielleicht so etwas wie ein Gehirnareal sein. Das Gehirn als Topos nimmt heute langsam dieselbe Bedeutungsfülle an wie das, was in früheren Epochen mit Seele bezeichnet wurde. Was war das, die Seele? Ein Steuerorgan vielleicht. Das Gehirn wird nunmehr als neue Zentraleinheit betrachtet, ein unbekanntes Zentrum, durch das alles hindurchmuß. Zugleich ist es auch eine Lichtung. Das meine ich, wenn ich „Gehirnhelligkeit“ sage.
Fioretos: Könnte die Seele nicht als organisierender Systemfehler betrachtet werden, ein Punkt, immer springend, immer unerreichbar, von dem aus der Körper sich organisieren läßt? Celan sprach einmal von einem „Seelen-Realismus“. Wenn man die Ohren genug spitzt, kann man immer ein Rauschen im Innern der Texte hören. Es ist ein Rest, der nicht in bestimmten Mustern aufgeht. Die totale Mobilmachung der Sprache in der Literatur scheint mir wenigstens unmöglich. Für den Seelenrealisten könnte die Aufgabe darin bestehen, dieses Rauschen zu protokollieren, die aphatischen Lichtungen aufzusuchen.
Grünbein: Erstaunlich, wenn man sich die Seele als etwas Immaterielles denkt… Als ihr äußerstes Gegenstück habe ich immer den Knochen betrachtet. Als Artefakt, als physiologischer und physiognomischer Rest, wandert er durch viele meiner Zeilen. Zum einen gibt er das Ziel an, die Reduktion. Zum andern hat er mit einer Ästhetik des Sarkastischen zu tun, mit der Austreibung des Expressionismus, der so tief in den deutschen Knochen steckt. Das Wort kommt vom griechischen sarkazein, „das Fleisch von den Knochen trennen“. In den frühen Epen, etwa bei Homer, wird geschildert, wie der Hauptheld bei Tisch das Amt des Vorschneiders innehatte. So wie er löst der Sarkast das Fleisch von den Knochen, trennt die Bedeutungen von den Gegenständen und diese von den Gefühlen. Denn der Knochen, das ist der Rest, was vom Körper übrigbleibt, nach Jahrhunderten ein Geschenk für den Paläontologen. Nichts vom Gewebe, den Eingeweiden, den Nerven bleibt wirklich erhalten. Dabei ist es aus unserer Sicht das Wichtigste, das Sichtbare des Körpers. Sentimentalisiert werden die Weichteile, die Schleimhäute, sie haben ihre Geschichte, ihren Kult, ihre Literatur. Dagegen glaube ich, daß Dichtung den Knochenbau skandiert, sie erkundet den Schädel von innen. Im Labyrinth des Gehörgangs ist sie zu Hause, Paukenhöhle und Cochlea sind ihre Echoräume. Für Hegel war der Schädelknochen „Wirklichkeit und Dasein des Menschen“, wie es in der Phänomenologie heißt. Das Sein des Geistes ist ein Knochen: zu diesem Schluß kommt er im Kapitel über Physiognomik und Schädellehre. Und nicht zu vergessen die uralte Geschichte von Hund und Knochen. Der domestizierte Hund ist das Tier, das am ausgiebigsten mit den Knochen spielt. Ich habe es mit mit Faszination beobachtet, wie Hunde am Knochen arbeiten, bis zuletzt nichts mehr dran ist. Der ideale Knochen ist demnach von Fleisch völlig befreit, nicht einmal ein Geruch bleibt, nur die Erinnerung. Immer wieder wird er beleckt und versteckt. Grawing to be gone. Der Hund wird zum Metaphysiker in dem Moment, wo er mit dem Knochen spielt. Es gibt dieses Spiel, das die Hunde unermüdlich spielen können. Sie zeigen dem Herrn ihren Knochen, bevor sie ihn verstecken. Den Knochen vergraben, nur um ihn Tage später mit einer Miene der Überraschung zufällig wiederzuentdecken…
Fioretos: Die Auferstehung des Knochens beim Wiederentdecken… Vielleicht gibt es so etwas wie einen Messianismus für Hunde?
Grünbein: Wo sind die Knochen in deinen Texten versteckt?
Fioretos: Wenn ich das wüßte. Ich neige dazu, den Körper erst wahrzunehmen, wenn ich mit einem Kater aufwache und das Gehirn in der knochigen Wiege meines Schädels schmerzhaft geschaukelt wird. Was allerdings oft passiert… Die Körper der andern beschäftigen mich viel mehr. Alles Schreiben ist sozusagen Hundearbeit: ein Umgehen mit den Knochen der Abwesenheit. In dem Literarischen, was ich mir bis heute vom Mund abgespart habe, ging es mir um die Körperlichkeit der Sprache. Aus irgendeinem Grund zieht mich das an, was nicht der Semantik zuzuordnen ist, die Materialität der Sprache – ihre Eigenheiten und Defekte. Ihre Knochigkeit, wenn du so willst. „Ich habe wie jeder Hund den Drang zu schweigen“, heißt es bei Kafka. Ich denke, man spielt nur mit den Knochen aus Mangel an Eßbarem… man schreibt… man schreibt, weil man nicht sprechen kann.
Dezember 1995, in: Akzente. Zeitschrift für Literatur, Heft 6, Dezember 1996
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb + ÖM +
Facebook + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Orden Pour le mérite + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein–Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


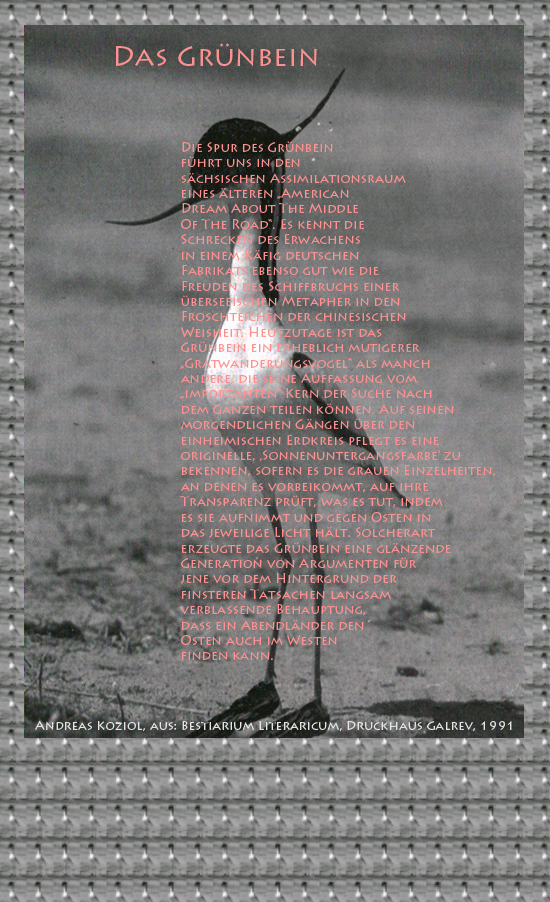
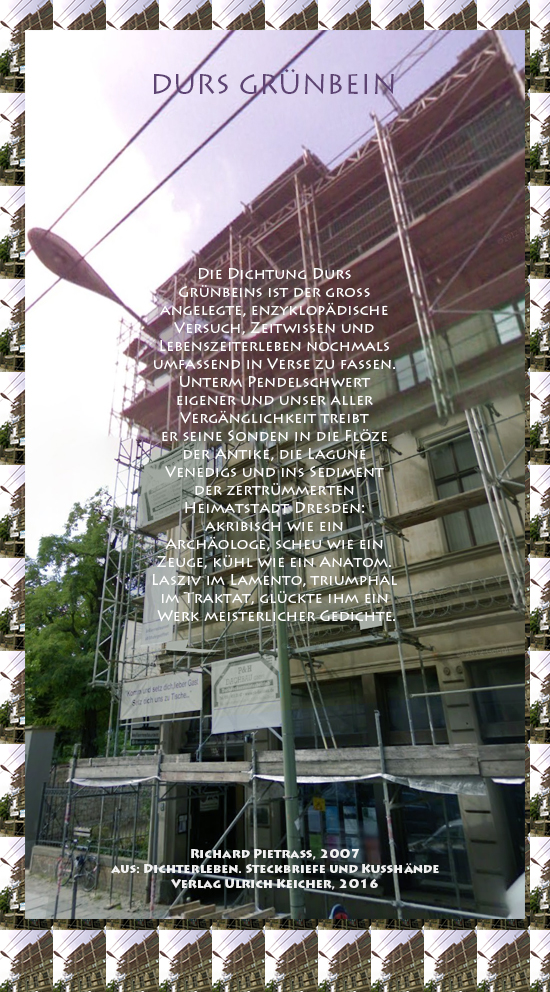












Schreibe einen Kommentar