Gerhard Falkner: Kanne Blumma
WEECHE ASSDÄ VÄNUMBFD
Iss kommunikhaddsionsharakiri
di infomaddsionsdiggdaddur
di mobbillidädsdirrhanai
di wäddschaffdswaggsdumsfollder
di arbaidsbladzäbressung
dä subbjeggdvälussd
woss weggsd Cindy roudn lisdn
woss schrumbfd Cindy waisn wesdn
woss blaibd Cindy fisdärn aussichtdn
WEGE AUS DER VERNUNFT
Das Kommunikations-Harakiri
Die Informations-Diktatur
Die Mobilitäts-Tyrannei
Die Wirtschaftswachstums-Folter
Die Arbeitsplatz-Erpressung
Der Subjekt-Verlust
Was wächst, sind die Roten Listen
Was schrumpft, sind die weißen Westen
Was bleibt, sind die finsteren Aussichten
In seiner ,Partitur‘
zu „Essdedigg“ (Ästhetik), „Redoorigg“ (Rhetorik) und „Dialegdigg“ (Dialektik) tischt Gerhard Falkner akustische Spezialitäten von archaischer Wucht auf, Lautgedichte, die immer wieder den Ton alter Zaubersprüche und Beschwörungsformeln wachrufen. Der Leser kommt in den Genuss verbaler Klangstücke von faszinierender Rätselhaftigkeit im Spannungsfeld sprachlicher Zerreißproben, überdehnter Emotionen und wunderbarer Absurditäten. Von poetischem Eigensinn, der nicht selten nach dem Entziffern der Worte seine Erhellung im Witz findet. Bei der Auflösung so mancher Sprachrätsel mag Franken wie Nichtfranken die Übersetzung im Anhang helfen. „Mä sachd ja niggs, mä redd ja blous!“
ars vivendi verlag, Ankündigung, 2010
Vom Meister der deutschen Gegenwartslyrik:
ein Ausflug in die fränkische Dialektlandschaft!
Mit seinen einzigartigen Sprachkompositionen gelingt Gerhard Falkner in Kanne Blumma das spannende Experiment, eine Verbindung von moderner Poesie und Mundart zu schaffen, wie es sie bisher nicht gab. So erprobt er die akustischen Mittel des Fränkischen am zeitgenössischen Gedicht – und hält dabei aus den Labyrinthen des Dialekts heraus doch immer den Blickkontakt mit der großen Dichtung wie auch den vielfältigen formalen Möglichkeiten der Moderne.
Bei diesen Gedichten handelt es sich nach Aussage des Autors „nicht vorrangig um lyrische Botschaften, sondern um Hörbeobachtungen, Klangstücke und akustische Spezialitäten, die oft auf minimalistischen Aussagen beruhen und ihre Eindrücklichkeit aus der Anlage und Kombianation ihrer Variationen schöpfen sollen.“
Das faszinierende Ergebnis sind Gedichte voller intertextueller Bezüge und Verknüpfungen, die nicht selten beim Entziffern der Worte ihre Erhellung im Witz finden. Und bei der Auflösung so mancher Sprachrätsel mag Franken wie Nichtfranken die beigefügte Übersetzung ins Hochdeutsche helfen.
Ein Genuß für Liebhaber geschliffenen, hintergründigen, präzisen Sprachwitzes auf dem Fundament dichterischen Ernstes, kunstvoll gestaffelter Bedeutungen und Doppelbödigkeiten – und eine Einladung für Grenzgänger, die sich auf das poetische Wagnis einlassen, Untiefen des Dialekts, unvermutete Potenziale der Mundart über dem Grund der Hochsprache auszuloten.
ars vivendi verlag, Presseinformation, 2010
Dei Gschmarre aaf a Budderbrood und de ganzä Wälld wiad sadd
Die Krise des Individuums ist der Grund für die Einflechtung des Dialekts in die Dichtung. Zumindest wenn es nach Adorno geht. Wie er in seiner Rede über Lyrik und Gesellschaft behauptet, verdankt die Lyrik dem Dialekt eine „kollektive Gewalt“, die zerronnene Subjekte wieder zusammenfließen lässt. So züchtet sich auch der Peter-Huchel-Preisträger von 2009 mit seinen Dialektgedichten eine Sprachchimäre, die in einem Universalgemisch ihres Landstrichs daherbabelt. Dialekt bindet den Leser in einen unmittelbaren Dialog ein und reicht dabei über das bloße Bedeuten hinaus. Für Sprecher tut er das durch seinen originären Gefühlsausdruck und durch abweichende Konnotationen; für Nichtsprecher durch Assoziationsreize oder durch Fehler bei der Entzifferung. Genau die provoziert Falkner mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Er versucht das Hörbare eins zu eins zu verschriftlichen und nimmt durch Falschschreibungen bewusst akustische und semantische Verschiebungen vor. Pittoresk erinnert sich das lyrische Ich in so einer Sprechweise:
A Moll
Hobby gsunga
In annärä Dur
Wäydä abbolo
Inder Freya nadduhr
nämlich
Einmal (Einst)
Hab ich gesungen
In einer Tour
Wie ein Apollo
In der freien Natur
In seinem Spiel mit der fränkischen Vorliebe für Redundanzen und Tautologien, die ziellos durchs Sprachlabyrinth irren und neue Auswege finden, macht sich Falkner zu einem Karl Valentin Frankens. Sein Sprachexperiment reicht von der Lautpoesie Jandls bis hin zur mathematischen Kombinatorik. Von Du sollsd dir Kain Bld machn, wo „Bld, Bld, Bld“ so lange angereichert wird, bis man sich an der „Bld Dzai Dung“ blöd liest, bis hin zum Titelgedicht Kanne Blumma, in dem die Lautstücke wild durchgeschüttelt und die Reime in allen Formen erwürfelt werden. Vom Kindergaggalagu gelangt der Leser schnell zum ausgewachsenen Dadaismus. Falkner verlangt einen aufmerksamen Leser und einen ebensolchen Hörer. Nicht zuletzt geht es ihm um Höreindrücke – sowohl des fränkischen Trommelrhythmusses, als auch von akustischen Verschiebungen wie bei „Mai schwadds hemmerd“. Was für den Franken „Mein schwarzes Hemd“ ist, klingt für den Nichtfranken selbstredend wie „Mein Schwatz(en) hämmert“.
Bei all dem missbraucht der Dichter den Dialekt nicht; er fängt die Eigenheiten eines Landstrichs immer noch liebevoll ein. Und dazu gehört auch der Menschenschlag, der mit dem Fränkischen einhergeht: seine Tendenz zum denunziatorisch Gestischen, das sich mittels der Sprache ausdrückt, sowie seine Selbstherrlichkeit und sein innergeographisches Rangeln.
Gschaide Leid
gibbdz ieberohl
Gscheide Broadwärschd
gibbdz blous in nämberch
Was man als O-Ton und demonstratives Ausstellen eines Habitus abtun kann, kommt leider öfter als Anbiedern daher. Wo Falkner in seinem Essay Dialekt und dialektisches Spiel in der Mundart als Möglichkeiten des nachmodernen Gedichts meint, es entwickle sich „in der Rückübersetzung (…) eine fast an den Minnesang gemahnende Simplizität und Reinheit“, da klopft sich das Gedicht selbstgenügsam auf die Schenkel. Hätte Falkner die Übersetzungen weggelassen, hätte er Nichtfranken öfter mit dem Rätseln am phonetischen Material und mit der Sinnsuche erfreut.
Walter Fabian Schmidt, poetenladen.de, 9.11.2010
Shannohie, wäy däa scho doddstäyd
− Mundart und Mentalität: Gerhard Falkner untersucht in seinem Gedichtband Kanne Blumma die Geheimnisse des Fränkischen. −
Unter den Himmeln des Hochdeutschen ist das Fränkische ein Gebiet abgrundtiefer Sümpfe. Wer sich einmal darin verirrt hat, kommt nicht mehr so schnell heraus. Weil es Mundart und Mentalität zugleich ist, schleppen auch die, die es für immer hinter sich gelassen zu haben glauben, oft noch ein Stückchen fränkischen Morast mit sich herum. Genau genommen entwirft das Fränkische gegenüber der Standardsprache eine parallele Welt, die sich ihrerseits in viele parallele Unterwelten gliedert.
Seinem ebenso zupackenden wie brütenden Wesen nach teilt es sich mindestens in das Ober-, das Mittel- und das Unterfränkische auf, wobei schon der Weg ins Nachbardorf eine Ausdifferenzierung dieses so undifferenziert wirkenden Dialekts zutage fördern kann, die auch den Eingeborenen sofort zum Fremdling stempelt. Zwischen dem oberfränkischen Hof im hohen Norden und dem unterfränkischen Aschaffenburg im Süden, wo schon etwas Hessisches lauert, durchquert man die verschiedensten Galaxien – nicht nur, weil anfangs das Bier regiert und sediert, bevor der Wein rund um Würzburg hellere Lebensgeister weckt.
Jede Mundart hat etwas Unverblümtes. Das Fränkische aber besitzt eine Direktheit, die man nicht anders nennen kann als dodohl brudohl – total brutal. Härter sind auch nicht die Härtesten der verfeindeten Bayern drauf, obwohl sprachlich jeder stimmlose Plosiv unter den Konsonanten so aufgeweicht wird, dass aus dem nüchternen Fränkisch ein ordinäres Fränggisch wird und aus einem harmlosen Trottel ein hoffnungslos bescheuerter Droddl.
Um Letzteres richtig auszusprechen, muss man die Zunge ins gut gelockerte Maul legen und beim L lässig gegen die Zähne schieben. Es handelt sich, wie der Dichter Gerhard Falkner in einem Gespräch auf www.poetenladen.de erklärt, um „das von den Franken mit grausamer Wollust praktizierte und fast pornografisch als solches bezeichnete ex-labiale Waffel-L.“ Zu den besonderen Kennzeichen gehört außerdem das „unauslöschliche R“, das, wie der letztjährige Huchel-Preisträger weiß, „alle Franken aneinander verrät, selbst die Bestgetarntesten“.
Als Schriftsteller hat auch er sich bisher gut getarnt und geht nun doch mit einem zweisprachigen Gedichtband in die Offensive, der allein durch den Anspruch, die lautlichen Mittel des Dialekts mit den Möglichkeiten des zeitgenössischen Gedichts zu versöhnen, weit hinter sich lässt, was sonst in der Region auf Fränkisch geschrieben wird. Kanne Blumma trägt die Mehrdeutigkeit schon im Titel. Die simple Übersetzung lautet „Keine Blumen“, aber auch die Kanne Blumen ist gemeint und natürlich Kurt Schwitters’ inständig umworbene Anna Blume.
Dadaistische Sprengmeisterei gehört eigentlich nicht zu Falkners an sinnbewahrenderen Traditionen der Moderne geschulter Poesie. Doch hier, in phonetisch verwirrenden Gefilden, kurz bevor Lyrik in reine Lautdichtung übergeht, gelten andere Gesetze. Falkner, der aus dem mittelfränkischen Schwabach stammt und, wenn er sich nicht in seiner zweiten Heimat Berlin aufhält, im oberpfälzischen Weigendorf unweit von Nürnberg wohnt, lebt hier ein Temperament aus, das die mundartlichen Experimente der Wiener Gruppe um H.C. Artmann in den fatalistisch verlangsamten und immer zum Jammern über die vanitas mundi aufgelegten fränkischen Kosmos transportiert.
Ess woar graisly
I hobb goanedd hieschaua kenna
Drumm konnädä A ned soong
Woss gwehn iss, I hobb nämli
Waali nedd hieschaua hobb kenna
niggs gsehng
Wouhäri obber gwissd hobb, dassi
Nedd hieschaua konn, wenn, waali
Nedd hiegschaud hobb, niggs gsehn
Hobb kenna, wassi a nedd
Für Eilige:
Es war grässlich
Ich konnte gar nicht hinschauen
Darum kann ich dir auch gar nicht sagen
Was passiert ist. Ich habe nämlich
Weil ich gar nicht hinschauen konnte
Nichts gesehen
Woher ich allerdings wusste, dass ich
nicht hinschauen kann, weil ich, wenn ich
nicht hingeschaut habe, ja nichts gesehen
Haben kann, das weiß ich auch nicht
Kein Zweifel, dass das Original etwas anderes bedeutet als die Übersetzung. Das Fränkische verhält sich zum Hochdeutschen wie eine unbewusst arbeitende Sprachlogik zu deren gewaltsamer Offenlegung – ein Kampf zwischen Norm und Abweichung, der den Dialektsprecher nur unter seinesgleichen nicht völlig zum Affen macht.
Von daher lässt sich der humoristische Aspekt dieser verschlungenen Art des Denkens auch beim heißesten Bemühen nicht tilgen. Schriftsteller wie Fitzgerald Kusz oder Eberhard Wagner setzen denn auch stark auf kabarettistische Effekte – nicht zu vergessen der Sänger Günter Stössl, der mit seiner Anleitung „Nämberch english spoken“ schon Generationen von Touristen unter dem tosenden Gelächter von Einheimischen dazu gebracht hat, mit phonetischem Nonsense-Englisch Fränkisch zu sprechen.
Auch Falkner ist überwiegend lustig, aber eben auch existenziell zumute – bis hin zur Selbstverbrennung auf dem Nürnberger Plärrer in „ess kaladsion“ (Eskalation). Bei ihm marschieren Orest und Sulamith auf, Walther von der Vogelweides Mittelhochdeutsch wird mittelfränkisch umgetopft und Rilkes im Käfig herumtigernder „Panther“ – debandä – findet auch hier „hinndä dausnd schdanga kaine whelld“. Ist das überhaupt noch Fränkisch? Die Umschrift mutet oft türkisch oder chinesisch an, und was da mutwillig getrennt oder in Wörtern wie Allah (allein) oder Hobby (habe ich) über die Seiten hoppelt, ist letztlich eine Kunstsprache mit Ausreißern ins Oberpfälzische.
Diese hohe Kunst versteht sich indes auch aufs Fluchen. Schließlich besteht ein beträchtlicher Teil des fränkischen Vokabulars aus Schimpfwörtern.
Shannohie, wäy däa scho doddstäyd
wäy ä achäla, wendz blidzd
ä sua gschdell, su dahmischs
aldz obbsn hiegschissn häddn
allah scho dey bah, drimmär husn
und kann Ohsch drinn
Aus reinem Anstand lassen wir das jetzt mal so stehen.
Gregor Dotzauer, Der Tagesspiegel, 10.11.2010
Kanne Blumma – Gedichte in Mundart
− Autor Gerhard Falkner hat sich vor allem als Lyriker, Dramatiker und Essayist einen Namen gemacht. Nun hat er Gedichte in Mundart verfasst und als Buch herausgegeben. Seine neueste Monographie trägt den Titel Kanne Blumma. −
Die fränkische Lautpoesie stand für Falkner bei diesem Projekt an erster Stelle. Beim Dichten fränkischer Lyrik ging es Falkner vorrangig um den Klang des Dialekts und erst dann um den Inhalt. Daher klingen seine Gedichte im Fränkischen sehr rhythmisch, was im Hochdeutschen eine gewisse Einfachheit enthüllt. „Ich habe den Dialekt verändert, meinen Zielen angepaßt“, verrät Gerhard Falkner und fährt fort: „Dadurch kann er Dinge machen, für die die Hochsprache viel zu steif ist. Er kann vor allem klanglich ganz andere Dinge leisten als die Hochsprache.“
Mundartgedichte für Franken und den Rest Deutschlands
Die fränkischen Gedichte stehen stets auf der rechten Seite. Für die hochdeutsche Übersetzung muss der Leser einmal umblättern. Der Reiz des Gedichtbands besteht gerade in dem Zusammenspiel zwischen den fränkischen Gedichten, die den Leser zur Entschlüsselung auffordern und der Auflösung in der hochdeutschen Version. Mit seinen fränkischen Gedichten möchte Falkner den Leser anregen. „Hindn hedd ä henggl sai mäyn und vonna ä schnauzn. Drinna hedd ade sai mayn un däfuhr ä dassn“ bedeutet etwa: Hinten hätte ein Henkel sein müssen und vorn eine Schnauze. Drinnen hätte Tee sein müssen und davor eine Tasse.
Keine Fränkischvorkenntnisse erforderlich
Da seine Gedichte sehr unterschiedliche Ebenen des Verstehens bieten, so Falkner, könne man sie eigentlich auch ohne literarische Vorkenntnisse lesen und verstehen. Wenn der Hintergrund ein bisschen größer ist, vermehrt sich das, was die fränkischen Gedichte bieten, ergänzt er. Als Idealleser sieht der Autor die Franken, die den Dialekt und die Hochsprache gleichermaßen beherrschen. Inspirationen zu Kanne Blumma, seinem ersten Mundartwerk, holte sich Falkner übrigens im fränkischen Alltag auf der Straße.
Bayerischer Rundfunk, 28.9.2010
Made in Franken – Helden aus Franken!
Kaum glaublich: Lyrik-Teilzeitlesern ist Gerhard Falkner eher bekannt als Hohepriester des hermetischen Gedichts, verfaßt in sprachlichen Ausdrucksformen, die dem raschen Sinnsucher in der Regel kryptisch erschienen. Dennoch erschreib sich Falkner über die Jahre das Gütezeichen, einer der besten lebenden deutschsprachigen Lyriker zu sein. Mit seinem Roman Bruno (2008) verließ er freilich die hermetischen Pfade und präsentierte eine makellos klare Prosa. Und jetzt: Mundartgedichte in Fränkisch? Konkurrenz für Fitzgerald Kusz, einsamer Platzhirsch in Sachen unsentimentaler Frankenpoeme? Wiedergutmachung an der mittelfränkischen Heimat für die Exkurse ins Hochdeutsche? Weder. Noch. Falkner, der keineswegs ein Formalist des Kunstgedichtes ist, sondern immer noch auch „Herzblut“ als Schreibmotiv zuläßt, hat Mut, Neugierde und Risikofreude. Immerhin entstammt er einem sudetendeutsch-fränkischen Milieu in Schwabach, er ist sozusagen zweisprachig aufgewachsen. Das Fränkische lag ihm also stets im Ohr: und er erkannte plötzlich die poetischen Möglichkeiten des lautmalerischen Frankensounds. Was als Experiment begann, entwickelte sich dann zu einer Leidenschaft. Das Resultat: ein Gedichtband klangvoller, assoziationsreicher Poeme, denen Falkner jeweils auch eine hochdeutsche „Nachdichtung“ nicht nur als Hilfestellung beigefügt hat. Der Gefahr, Nonsens-Lyrik zu produzieren ist Falkner mühelos entgangen, obwohl er sich natürlich den surrealen Reizen fränkischer Wortbrocken nicht entzieht. Heimatgedichte sind es glasklar nirgendwo, dafür oft minimalistische Abtastungen mit maximaler Vieldeutigkeit, geschrieben in „A Moll“.
Jochen Schmoldt, Plärrer, 11/2010
Lüürig aff Fränggisch
„Ah Dsedd. Wäy? / Ah Dsedd!“ So beschreibt Gerhard Falkner in seinem neuen Lyrik-Band Kanne Blumma den allmorgendlich an Nürnbergs Zeitungskiosken vollzogenen Dialog, wenn der Kund „AZ“ nuschelt, der Verkäufer „Was?“ fragt, und der Kunde – nun um deutliche Aussprache bemüht – die gewünschte Zeitung bestellt.
Falkner hat sich erstmals ins Reich der Mundartlyrik gewagt, in seinem Fall der fränkischen. Für diejenigen, die des Fränkischen nicht ganz so mächtig sind, hat der Autor zu jedem Gedicht gleich noch die hochdeutsche Übersetzung mitgeliefert.
Der Leser ist in erster Linie mit Wortungetümen wie „waaler danngmaandhädd“ (zu deutsch: „weil er dann geglaubt hätte“) konfrontiert, die dazu führen, dass sich das Lesetempo verlangsamt.
Das ist durchaus notwendig, sind die Texte doch zumeist wunderschöne Beobachtungen von Alltagssituationen. Zudem haben die Gedichte auch eine klangliche Ästhetik, die sich jedoch erst herausschält, wenn man sich die Texte laut vorliest.
AZ Nürnberg, 13.11.2010
Nürnberger Kulturpreis für Gerhard Falkner
− Der Arbeiter an der Sprache. −
Als der Band vorlag, mag mancher Kenner von Gerhard Falkner im ersten Augeblick aufgestöhnt haben: Nicht der auch noch! Denn der Band hat den Titel Kanne Blumma und enthält „Gedichte fränkisch – deutsch“.
„Ade“, das kann in Franken auch „ein Tee“ sein: Der in Schwabach geborene Dichter Gerhard Falkner spielt in seinen neuen Versen mit der Mundart. Aber „ä weng“ anders als Fitzgerald Kusz.
„Kanne Blumma“ bedeutet also „keine Blumen“. Und die erste Strophe des ersten Gedichts mit dem Titel „Ade Kanna“ geht so:
Oma hedd a deggl
sai mäyn
und undn ä
buudn
hindn hedd ä heng.gl
sai mäyn
und vonna ä schnauzn
drinna hedd Ade
sai mayn
un däfuhr ä dassn.
Man kann das schlicht, aber mühsam entziffern und stolpert trotzdem über Formulierungen wie „heng.gl“ oder „Ade“. Da merkt man, dass es Falkner, wie üblich, dem Leser nicht einfach macht.
Die Umgebung kann so tröstlich sein
Noch komplexer wird es, wenn man Gerhard Falkners Essay zum Buch liest, der sich unter der Internet-Adresse „poetenladen.de“ finden lässt. Darin heißt es: „Die fränkische Rede, die stark von Redundanz geprägt ist und oft in auffälliger Absenz eines kausalen Plans oder einer Zielaussage geführt wird, erfüllt häufig die biologische Aufgabe des Stimmfühlungslauts, mithilfe dessen man sich der vollständigen, ähnlich gestimmten und somit tröstlichen Anwesenheit seiner Umgebung versichert und wird eher als physische Wohltat empfunden denn als Kommunikationsvorgang.“
Gerhard Falkner ist ein Autor, der erst denkt, dann noch lange nicht schreibt. Und wenn er geschrieben hat, dann denkt er das Geschriebene lange noch weiter und macht womöglich aus diesen Gedanken wiederum Text. Er ist ein Arbeiter an der Sprache, entsprechend ist er vor allem Lyriker, denn Lyrik modelliert die Sprache, erprobt ihre Grenzen, ihre Biegsamkeit bis hin zu ihrem Verstummen als Kommunikationsmittel. Also sind auch Falkners Mundartgedichte Programmlyrik. Er selbst spricht von Skulpturen und Partituren.
Es ist ein glücklicher Zufall, dass Falkner in dem Augenblick, da er sich erstmals auf das Idiom seiner Heimat einlässt, mit einem der wichtigsten Preise bedacht wird, den diese Heimat zu vergeben hat: dem „Preis der Stadt Nürnberg für Kultur und Wissenschaft“.
Man könnte sagen: endlich. Denn in den letzten Jahren ist der eine oder andere schreibende Zeitgenosse Falkners mit diesem Preis bedacht worden, obwohl – oder weil? – er es seinen Lesern viel bequemer macht.
Aber Gerhard Falkner war ja nie eine Stimme im fränkischen Literaturumtrieb. Aus dem hat er sich weitgehend herausgehalten. Er ist 1951 in Schwabach geboren. In Nürnberg hat er Buchhändler gelernt und in der Bahnhofsbuchhandlung gearbeitet, weil man mit Schreiben so mühsam Geld verdient.
Doch schon in seinem ersten Lyrikband so beginnen am körper die tage (1981) war der Tonfall so ganz anders, als man es aus Franken gewohnt ist. In diesen Gedichten war eine Ernsthaftigkeit am Werk, die nicht angestrengt schwitzte, auch wenn sie in der Spannung zwischen Ausdruck und Bedeutung manchmal vor geistiger Anspruchshaltung zu brechen drohte.
1989 ist Falkner die Lyrik dann als Last erschienen, die er abzuschütteln versuchte. In dem Gedichtband wemut verkündete er, dass dies sein letzter sei. Im Folgenden schrieb er Dramen: „Alte Helden“ und „Der Quälmeister“. Aber das waren selbstverständlich Meta-Dramen, die nicht allzu häufig gespielt wurden. Er arbeitete als Übersetzer und Herausgeber. Für das Nürnberger Musiktheater verfasste er 2000 ein Libretto mit dem Titel „A Lady Di’es“, das im Untertitel gleich wieder Falkners Arbeitsmaterial thematisierte: „Eine Oper der verbrauchten Sprachen“.
Im selben Jahr war er dann doch als Lyriker zurück: Endogene Gedichte hieß der Band, der einerseits zur konkreten Poesie tendierte, andererseits durchaus einmal den Schlussreim riskierte. Falkner zeigte Romantik hinter Stacheldraht. Auch in Prosa hat er sich inzwischen versucht. Bruno hieß die Novelle, die auf den Problembären anspielte, aber vom Schriftsteller handelte und davon, wie er die Welt in Sprache begreift.
Dialekt ist stärker als Deutsch
In Kanne Blumma hat Falkner seine Sprachfeile nun an die Mundart angelegt, hat noch in jener Rhythmisierung ihre Kraft bewiesen, die auf den Nonsens hinaus will. Denn alle deutschen Übersetzungen aus dem Fränkischen, die er ja mitliefert, blässeln gegen den Dialekt ab, auch wenn sie sich zum Teil selbst wieder zu Sprachklängen verkünsteln.
In der Übersetzung lauten die letzten Zeilen mehrdeutig „Es gibt eine ganze Welt voller Leute (Leid) / aber KEINE BLUMEN“. Aber es gibt auch einen Preis für Gerhard Falkner. Und sicher Blumen dazu.
Herbert Heinzelmann, Nürnberger Zeitung, 11.11.2010
„Franken ist eine Kostbarkeit ersten Ranges“
Heimatliche Gefühle, ketzerische Gedanken: Interview von Steffen Radlmaier mit dem Schriftsteller und Preisträger Gerhard Falkner.
− Gerhard Falkner, 1951 in Schwabach geboren, pendelt seit langem zwischen Franken und Berlin. Der Dichter und Denker gilt als einer der renommiertesten Vertreter deutscher Gegenwartslyrik. Einem breiteren Publikum wurde er durch seine Künstlernovelle „Bruno“ bekannt. Vor kurzem überraschte er seine Leser mit seinem originellen Dialektlyrik-Debüt „Kanne Blumma“. Am 15. November erhält er den mit 10.000 Euro dotierten Preis für Kunst und Wissenschaft der Stadt Nürnberg. Preisverleihung ist am 15. November, 19.30 Uhr, bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Nürnberger Tafelhalle. −
Steffen Radlmaier: Herr Falkner, Sie haben sich mit anspruchsvoller Lyrik international einen Namen gemacht. Welcher Teufel hat Sie geritten, dass Sie nun im reifen Alter ihren ersten Band mit fränkischen Mundart-Gedichten vorlegen?
Gerhard Falkner: Zunächst einmal war es die Idee, wenn ich „reifes Alter“ jetzt einfach mal so stehen lasse, mit dem Dialekt eine neue Form des Experiments zu erschließen. Ich dachte zuerst, da lässt sich ungestüme Lautpoesie mit der potentiellen Redlichkeit der Mundart verbinden. Oder das Nonsense-Gedicht mit dem Minnesang. Dass daraus während der Arbeit so viel mehr entstehen würde, hatte ich nicht erwartet. Der Dialekt entpuppte sich als Dickicht, als geheime Datei und als Klangkonto mit ungeahnten Möglichkeiten. Es wurde im Lauf der Zeit immer wilder zwischen den Buchstaben. Am Schluss sah es dann so aus, dass eher ich den Teufel geritten habe, als er mich.
Radlmaier: Was hat der Dialekt, was die Hochsprache nicht hat?
Falkner: Er besitzt eine andere Viskosität. An der gestrengen Hochsprache kommt man nur vorbei mittels Verballhornung, Neologismen, also Sprachneuschöpfungen, oder Metaphern. Das ist aber alles nach Joyce und Arno Schmidt oder auch Paul Celan ziemlich anstrengend. Man landet da (heute) unweigerlich bei den unvergnüglichen Pseudo-Avantgarden. Der Dialekt ist viel riskanter, jedenfalls in meinem Falle.
Radlmaier: Sind die Möglichkeiten der modernen Dialektlyrik nicht längst erschöpft?
Falkner: Das weiß ich nicht. Das hängt von denen ab, die das versuchen. Das Mundartgedicht hat ja nicht umsonst einen so schlechten Ruf, weil es eben so oft zur Blödelei tendiert oder ganz einfach Kitsch im Volkston darstellt. Beides habe ich versucht durch Ironie oder eine ehrliche Grundeinfachheit der poetischen Mitteilung zu unterlaufen.
Radlmaier: Haben Sie keine Angst, dass Kanne Blumma als peinlicher Ausrutscher aufgenommen und nicht ernst genommen wird?
Falkner: Warum sollte ich davor Angst haben? Irren (im Urteil) ist menschlich.
Radlmaier: War der Ausflug in die Dialektlyrik ein einmaliges Experiment? Oder können Sie sich eine Fortsetzung vorstellen?
Falkner: Natürlich kann ich mir das vorstellen, aber ich werde wohl nicht darauf zurückkommen. Experimente, wenn sie geglückt sind, muss man nicht wiederholen. Sie haben ihren Zweck erfüllt.
Radlmaier: Sie sind in den letzten Jahren international viel unterwegs gewesen. Was bedeutet (nicht nur literarische) Heimat für Sie? Was verbindet Sie noch mit Franken?
Falkner: Franken ist ja nicht meine literarische Heimat, von Kanne Blumma abgesehen eher im Gegenteil. Aber ich bin eben von hier. Ich bin hier aufgewachsen. Diese Herkunft hat sich tief eingeprägt, deshalb habe ich vorhin auch von einer „geheimen Datei“ gesprochen. Die Arbeit an diesem Buch kam durchaus einer Archäologie in vergrabene Bewusstseinsschichten gleich. Den stärksten „heimatlichen“ Bezug habe ich immer noch zur fränkischen Landschaft, den fränkischen Dörfern. Was die Städte angeht, da ziehe ich dann doch die ganz großen vor. Aber landschaftlich und ortschaftlich ist Franken eine Kostbarkeit ersten Ranges.
Radlmaier: Sie haben vom Opern-Libretto bis zur Künstler-Novelle verschiedene Gattungen ausprobiert, dennoch scheint die Lyrik, die sich kaum verkaufen lässt, Ihr Lieblingsmetier zu sein. Stimmt das? Warum schreiben Sie keine Romane?
Falkner: Im inzwischen berühmt-berüchtigten Nachwort zu meinem Gedichtband wemut von 1989 habe ich die Poesie: „die Kühnste unter den Künsten“ genannt. Diese Meinung vertrete ich nach wie vor, obwohl sie bei bemühten Dichtern durchaus auch zur „Dümmsten unter den Künsten“ verunglücken kann. Bei den Meistern aber ist die Lyrik eine Kurzstreckendisziplin, in der sprachliche und emotionale Höchstgeschwindigkeiten erreicht werden können, Bildrekorde, Spitzenleistungen der Reduktion. Nach dem Erfolg meiner Novelle Bruno bei der Kritik werde ich weitere Prosa sicher im Auge behalten.
Radlmaier: Sie selbst haben das Klischee vom armen Poeten wiederholt ironisch aufgegriffen und in Frage gestellt. Welchen Stellenwert hat der Dichter Ihrer Meinung nach in der modernen Gesellschaft? Wollen Sie mit der Poesie als stabiler Währung der Gesellschaft etwas heimzahlen?
Falkner: Nicht nur ironisch, auch polemisch! Vor allem in meinem Buch: Über den Unwert des Gedichts. Der Dichter hat in einer durch und durch materialistischen Gesellschaft den Stellenwert, den er verdient, nämlich keinen, und zwar deshalb, weil er nichts verdient. Er ist sozusagen ein wirre Gedichte produzierendes Nichts. Außerdem glaube ich nicht, dass sich einer Gesellschaft im gegenwärtigen Geisteszustand durch Poesie etwas heimzahlen lässt. Dazu müsste man sie erst „exkommunizieren“, das heißt, intelligentere Schichten aus der Totalmasse der durch die Kommunikationsraserei gehörlos Gewordenen und daher bei ununterbrochenen „Sport, Spiel und Spannung“ fröhliche Urständ feiernden herausbrechen.
Nürnberger Nachrichten, 13.11.2010
Gerhard Falkners Dialekt und dialektisches Spiel in der Mundart als Möglichkeiten
des nachmodernen Gedichts?
Gerhard Falkner: Poetik der Unschärfe. Vorbemerkung anlässlich der Lesung aus Kanne Blumma beim Projekt Unschärfe am Neuen Museum Nürnberg im Mai 2014.
Gerhard Falkner – Ein Dichter im Gespräch mit Ludwig Graf Westarp. Über Berlin und die Bedeutung kunstspartenübergreifenden Arbeitens.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Gregor Dotzauer: Seelenruhe mit Störfrequenzen
Der Tagesspiegel, 14.3.2021
Fakten und Vermutungen zum Autor + Laudatio + KLG + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Dirk Skibas Autorenporträts +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Gerhard Falkner liest auf dem XI. International Poetry Festival von Medellín 2001.


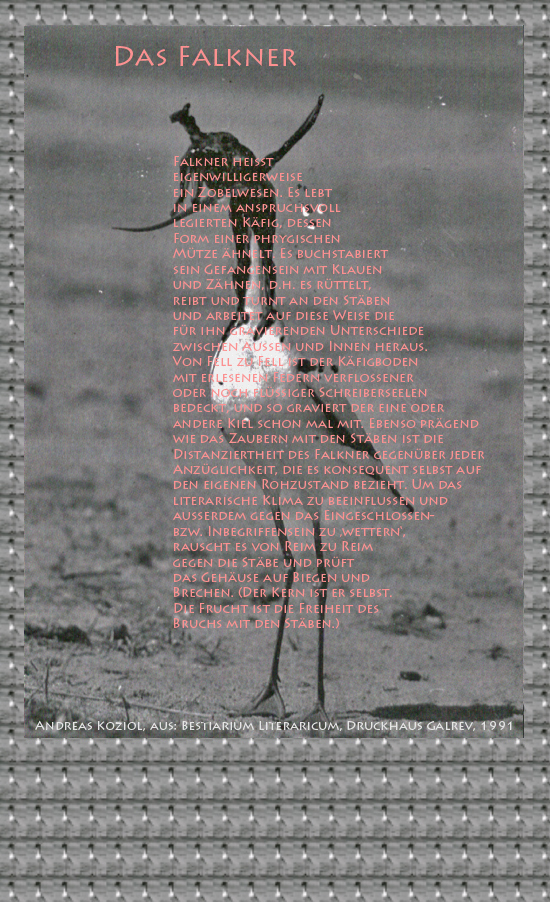












Schreibe einen Kommentar