Jan Wagner: Die Sandale des Propheten
DIE SANDALE DES PROPHETEN
Wann immer sich die Frage nach dem Einfluß stellt, den Gedichte heutzutage auf den Gang der Dinge haben können oder nicht, kommen mir zwei Begebenheiten in den Sinn. Beide mögen weniger bedeutsam sein, als ich es mir wünsche; trotzdem erscheinen sie mir erzählenswert. Ich denke zunächst an jenen Tag im Mai, an dem in Lviv, dem ehemaligen Lemberg im Westen der Ukraine, eine Tagung zu Ende ging und ich mich auf die Rückreise machte. Der kleine Flughafen von Lviv liegt weit außerhalb der Altstadt, die wie eine versunkene Karavelle zwischen den Hügeln ruht, und erinnert eher an ein etwas heruntergekommenes, doch noch immer stolzes Bahnhofsgebäude aus der Kaiserzeit. Überraschend für den an die funktionale Anonymität der Flughäfen des Westens gewöhnten Reisenden ist auch, daß es nur einen Schalter gibt, nur eine Schlange, in die man sich einzureihen hat, wenn man einen der wenigen Flüge erreichen will. Weder Gepäckaufgabe noch Förderbänder gibt es, so daß man seinen Koffer selbst durch die Kontrollpunkte tragen muß, um sie später auf den Gepäckwagen legen zu können; vorbei an der Flugscheinkontrolle, den Milizen mit ihren grünen Militärmützen, groß wie Pokertische, dann durch die Sicherheitsschleuse mit ihren Durchleuchtungsapparaturen. Genau hier endete meine Reise fürs erste, denn der mürrische Zöllner verlangte, das Innere meines Koffers zu sehen. In der Annahme er habe auf dem Röntgenbild die Flasche mit ukrainischem Wodka entdeckt, setzte ich zu Erklärungen an, doch er sagte „No“ und „that, that“ und deutete herrisch auf die Plastiktüte, die meine drei bis dahin publizierten Gedichtbände enthielt. Eine knappe Viertelstunde lang blätterte er nun mal in diesem, mal in jenem Buch, fixierte erst die Seite, dann wieder mich, der ich erst mein Flugzeug zu verpassen, dann weit Schlimmeres befürchtete, blätterte weiter, begutachtete mit finsterer Gründlichkeit Gedicht um Gedicht, Zeile um Zeile. Und so offensichtlich es war, daß der Mann nicht ein Wort Deutsch sprach, so deutlich spürte ich doch, daß ich eine hochbrisante, umstürzlerische Ware mit mir führte, und ich schwebte, getragen von dieser Gewißheit, zu meinem Sitz in der Fokker und auf ihm von Lviv über Warschau bis zurück nach Berlin.
Die zweite Geschichte trug sich in Griechenland zu. Mit zwei Malern und einem weiteren Dichter verbrachte ich eine Woche bei Kyparissia in Messenien auf dem Peloponnes. Unser Projekt war es, uns den uralten Olivenbäumen, die in weitläufigen Hainen längs der Küste wachsen, sich vielmehr dem ionischen Boden zu entwinden scheinen, mit den jeweiligen Mitteln zu nähern, die Maler mit Kaltnadelarbeiten, wir mit Worten. Ich hatte mir vorgenommen, einen Zyklus von Haikus zu schreiben, weil mir diese Form gebunden genug schien, dem Ganzen ersten Halt zu geben, und in ihrer Kürze offen noch für flüchtigste Impressionen. Allerdings hatte ich geschummelt, nämlich schon vor unserer Reise drei oder vier Siebzehnsilber geschrieben, auf gut Glück sozusagen und ohne die Umgebung, ohne auch nur irgend etwas gesehen zu haben – und natürlich ohne den anderen davon zu erzählen. Der folgende war einer davon:
sagt: welcher prophet
verlor die sandale dort,
aus der schon moos wächst?
Am vierten Tag unseres Aufenthaltes bat R., einer der beiden Maler, uns Schreibende, erste Gedichtentwürfe sehen zu dürfen, um sie in seine Kupferplatten einzuarbeiten – eine Bitte, der wir gerne nachkamen. Wir fuhren anschließend erneut zum Hain, um jeder für sich spazierenzugehen und sich an einem Platz seiner Wahl auf die eigene Arbeit zu konzentrieren, und sahen uns erst bei Sonnenuntergang wieder, als einer nach dem anderen beim Auto eintraf. „Du“, sagte R. und schlug mir auf die Schulter, „ich habe eben deine Sandale gesehen.“ Dies nun war ein Fund, der, nachdem ich die erste Überraschung verarbeitet hatte, einige überaus spannende poetologische Fragen aufwarf. Lag die Sandale nur deshalb dort im Hain, weil ich sie zuvor an meinem Tisch in Berlin beschrieben hatte? Und: Hätte es sie überhaupt gegeben, wenn ich nicht der Reise vorgegriffen und jene Zeilen aufs Papier geworfen hätte?
Die meisten Menschen werden sich einig sein, daß die Wirkung der Poesie dieser Tage eher gering ist. Dafür sorgt schon die überschaubare Zahl ihrer Leser. Wer eine Botschaft hat, ein politisches Anliegen, täte besser daran, in den Keller zu gehen und die Druckerpresse anzuschmeißen, denn jedes Pamphlet findet größere Verbreitung als ein Gedichtband. Und selbst wenn man die Verse auf Flugblättern abwürfe: Schon die Tatsache, daß etwas zu gebundener Sprache verdichtet ist, dürfte Freund und Feind gleichermaßen abschrecken. Auch ich habe von Pablo Nerudas Lesungen vor Abertausenden von Bergarbeitern gehört, und ich weiß, daß es in jedem Land Zeiten gibt, in denen Poesie und allgemeines Interesse sich verbünden können und müssen. Doch zumindest in dem Kulturkreis, in dem ich tätig bin, sieht man das Dichten gemeinhin als eine antiquierte Tätigkeit ohne jeden Bezug zum eigenen, alltäglichen Leben und betrachtet die Lyrik im besten Fall als einen liebenswerten Anachronismus, den sich exaltierte Diplomaten aus altem Adel oder labile Persönlichkeiten unter therapeutischer Aufsicht leisten.
Dennoch weigere ich mich, den Unkenrufern zuzustimmen, den Schwarzmalern, setze aber bescheidener an. Nein, ein Gedicht wird nicht den Hunger beseitigen, es macht in der Regel nicht einmal denjenigen satt, der es schreibt. Nein, ein Gedicht wird nicht die Welt verändern – dafür aber ist es selbst schon eine aufs erstaunlichste veränderte Welt, die man betreten kann oder auch nicht. Wer es unterläßt, verharrt im Hergebrachten. Wer den Schritt aber wagt, wird reich belohnt. Auf wenigen Quadratzentimetern bedruckten Papiers wird er einen unermeßlichen Raum entdecken, in dem zeitlich, geographisch und semantisch weit Auseinanderliegendes in Einklang, ins Klingen gerät, in dem widersprüchlichste Dinge und Paradoxien zusammenfinden.
Die Lyrik ist das trotzige Dennoch, das seine Kraft gerade aus der Tatsache bezieht, daß es nicht in die heutige Welt zu passen scheint, daß es unzeitgemäß ist – wobei man berechtigterweise die Frage stellen könnte, ob die Lyrik nicht zu jeder Zeit und immer schon unzeitgemäß war insofern, als sie sich nie dem Geist ihrer Zeit ergab, nie glatt in ihr aufging, ihr manchmal vielleicht gar voraus war. Fest steht: Sie läßt sich nicht unterbringen in einem reinen Kosten-Nutzen-Denken. Sie verweigert sich dem Warencharakter, dem Warenstrom, sie ist schlechthin unkonsumierbar und schon dadurch ein politischer Akt, selbst da, wo sie nicht vordergründig politisch gibt. Das Gedicht ist auf herrliche Art und Weise vollkommen nutzlos – so nutzlos wie ein Lachen nutzlos ist, ein jähes Glücks- und Hochgefühl, ein absichtsloses Spiel. Hier darf man an ein paar Worte W.H. Audens denken. Der schrieb einmal, daß die Poesie das Management an etwas erinnere, an das Manager stets erinnert werden sollten, daran nämlich, daß die von ihnen Gemanagten Leute mit Gesichtern seien, nicht anonyme Nummern, daß im homo laborans immer auch ein homo ludens stecke.
Es läßt sich also mit Fug und Recht behaupten, daß das Gedicht schon durch sein bloßes Dasein subversiv ist – indem es sich behauptet. Möglicherweise hatte der Grenzbeamte von Lviv allen Grund, mißtrauisch zu sein, als er in drei deutschen Gedichtbänden blätterte. Vielleicht war es nicht die fremde Sprache, die ihm verdächtig erschien, vielleicht erinnerte er sich vielmehr an die Zeiten des Kommunismus, in denen im Samisdat weitergereichte Gedichte tatsächlich als gefährlich galten, weil sie winzige Kapseln voller Freiheit waren.
Denn das sind sie heute noch, selbst wenn das in einer freien Gesellschaft weniger sichtbar sein mag. Auch da aber, nein, gerade da, wo sowohl Privilegien als auch Einschränkungen kaum noch wahrgenommen werden, wo das Außergewöhnliche zur Selbstverständlichkeit und schließlich zur traurigen Gewohnheit wird, tut man gut daran, sich der unbequemen Freiheit, dem oft schwierigen Spiel der Poesie zu öffnen. Ein Gedicht nimmt sich das Recht, die Dinge so zu denken und zu sehen, wie sie nie zuvor bedacht und gesehen worden sind, und lädt den Leser, seinen Partner, dazu ein, es ihm gleichzutun. Es verhilft dem geflissentlich Übersehenen zu seiner verdienten Aufmerksamkeit und läßt das nur scheinbar Banale leuchten oder, in den Worten von Shelleys Defence of Poetry, „lifts the veil from the hidden beauty of the world, and makes familiar objects be as if they were not familiar“. Indem es das tut, fügt es der Welt gleichzeitig etwas hinzu. Mit einer ausgelatschten Ledersandale fängt es an, schimmlig, moosbewachsen, vollkommen unbrauchbar. Aber damit hört es nicht auf.
Inhalt
– PROLOG: HUNDSTAGE
EINS: VOM PUDDING
– Die Sandale des Propheten
– Ins Unbekannte. Über neue Gedichte
– Lob der Unschärfe
– Avernische Vögel. Über Fakten und Poesie
– Das Wie in der Welt
– Vom Rotstift
– Vom Pudding. Formen junger Lyrik
– Das Stück Eis auf dem Ofen. Ein Gespräch
ZWEI: HIRN UND LEIERKASTEN
– Schwarze Schafe. Über Ernst Meister
– Seidenkleider aus Würmern. Über Wallace Stevens
– Merlinszeit. Über Wilhelm Lehmann
– Hirn und Leierkasten. Von Benn zu Williams und zurück
– Poker am offenen Sarg. Über Matthew Sweeney
– Der Camerado von Mannahatta. Über Walt Whitman
– Die Epiphanie im Scheinwerferlicht. Über John Burnside
– Nichts als Worte. Über Simon Armitage
– Karrengäule im Galopp. Über Becketts Chamfort
– Die Maske und der Spiegel. Über Georg Heym
DREI: NOTIZEN VOM PUNKT JENSEITS DER KARTE
– Vorstellung für eine Akademie
– Finnisches Leuchten
– Manntje, Manntje
– Hubble Gubble
– Notizen vom Punkt jenseits der Karte
– Anmerkungen zu den Texten
Wenn Jan Wagner Prosa schreibt,
schreibt er über Poesie. Wer nach Lektüre dieses, von Leidenschaft durchdrungenen Essaybandes nicht für die Sache der Lyrik gewonnen ist, muss taub und blind sein, oder schlimmer noch, hat nie Jan Wagners Gedichte gelesen.
Sollte nicht jeder Schriftsteller Gedichte schreiben, fragt man sich bei der Lektüre dieser Essays und Porträts, und freut sich an der glänzenden Prosa, die so deutlich von der Kunst der Verdichtung, von der sprachlichen Hellhörigkeit des Lyrikers geprägt ist. Mit Eleganz und Belesenheit widmet sich Jan Wagner poetologischen Fragen, zeichnet prägnante und sehr persönliche Kollegenporträts von Whitman und Heym, über Benn und Beckett zu Matthew Sweeney und Simon Armitage. In seiner Lyrik erweist sich Jan Wagner stets als grandioser Geschichtenerzähler; diese Gabe zeigt sich auch in seinen Essays. Der Abstecher in das stinkende Inferno der Hundeschau von Bratislava, die Taschenkontrolle am Flughafen von Lviv, der Schlagabtausch zwischen Wallace Stevens und Robert Frost – wer würde diese Szenen je wieder vergessen? Um viele wunderbare Anekdoten und Leseanregungen reicher, legt man schließlich die Sandale des Propheten aus den Händen, bereit, für die Lyrik durchs Feuer zu gehen, und durchdrungen von der Gewissheit, dass ein Leben ohne Poesie kein Leben wäre.
Berlin Verlag, Ankündigung
Die Poesie und der Eisblock
– Der Dichter Jan Wagner über den Aufschwung der Lyrik. –
„Beiläufige Prosa“ nennt Jan Wagner den Band, und das sollte man ganz wörtlich nehmen: Diese Prosa läuft beiher neben Wagners bedeutendem lyrischem Werk, für das er Ende November den Kranichsteiner Preis des Deutschen Literaturfonds erhalten wird und unter dessen Verdiensten nur erwähnt sei, dass er die schwierige Aufgabe meistert, rhythmisch vollkommen überzeugende Oden zu verfassen, wie man es sonst eigentlich nur aus der Antike kennt.
Hier also ist versammelt, was Wagner zum Thema Lyrik im Lauf der Zeit geschrieben und zumeist auch schon andernorts veröffentlicht hat, bei Preis- und Dankesreden, in SZ, FAZ, Frankfurter Rundschau, Tagesspiegel und sonstwo. Zusammen ergeben diese rund zwei Dutzend Stücke doch so etwas wie eine Poetik; Überlappungen stören kaum, da er stilistisch sehr leicht und knapp verfährt – beiläufig eben.
Wie steht es mit der Lyrik heute? Da kommt Wagner zu einem doppelten Befund: Erstens, sie nimmt in der literarischen Öffentlichkeit eine äußerst marginale Position ein. Zweitens, sie erfährt gegenwärtig eine erstaunliche Blüte. Da muss man Wagner wohl recht geben. Obwohl die meisten Leser unter Literatur fast ausschließlich dickleibige Romane verstehen, gibt es auf diesem Feld doch zurzeit nur wenige Überraschungen; vorzugsweise erzählen sie Selbsterlebtes, handeln vom Aufwachsen in der Ödnis der deutschen Provinz und von Gemütlichkeit wie Schrecken des Familienlebens, dabei oft in erstaunlich ambitionsloser Sprache; sie erfinden kaum etwas und sehen wenige Dinge neu.
Demgegenüber erblickt Wagner die zeitgenössische deutsche Lyrik in einer Phase des Aufbruchs. Wer es nicht glauben mag, dem zitiert er lange Gedichte von Marion Poschmann, Steffen Popp und Thomas Kunst, die es beweisen. Woher dieser Qualitätsschub der letzten zehn bis zwanzig Jahre? Wagner äußert sich hierzu eher kursorisch, lässt aber keinen Zweifel daran, dass dazu alte Frontstellungen, wie die zwischen Konvention und Avantgarde, narrativem und experimentellem Gedicht, haben verschwinden müssen. Nicht mehr führt ein übertriebener Formalismus in die Wüste und die Formlosigkeit in den Sumpf, sondern ein erfrischter Sinn für Traditionen in ein blühendes Land. Wagner geht etwa dem jüngeren Schicksal des Reims nach. Lange verteufelt als Brutstätte des Stereotypen, kehrt er heute in fruchtbarer Unreinheit zurück; es reime sich nicht mehr Herz auf Schmerz, sondern Kohle auf Koala oder Uppsala auf Obstsalat.
Wagner ist, obwohl er kein Aufhebens davon macht, ein überaus gelehrter Dichter. Seine eigenen Leuchttürme stehen vorwiegend auf angelsächsischem Boden. Von dort entlehnt er hübsche und einprägsame Formulierungen, zum Beispiel von W.H. Auden: Gedichte seien idealerweise wie Käse, „local, but prized elsewhere“, ein wunderbarer Ausdruck für die wünschenswerte Synthese aus Besonderem und Allgemeinem. Oder, die Wirkung betreffend: „Like a piece of ice on a hot stove the poem must ride on its own melting.“ Das stammt, nomen est omen, von Robert Frost. An solchen Stellen erkennt man blitzartig, wie viel der Lyriker dem Übersetzer Wagner verdankt: So schlank und witzig wollte er werden, wie es sonst nur das Englische vermag – und hat dem Deutschen damit einen großen Dienst erwiesen.
Die unvermeidliche Randständigkeit der Poesie sieht Wagner nach alldem entspannt. Von ihr könne man nun allerdings nicht leben; aber unmöglich ohne sie. „Das Publikum ist riesig, auch wenn es davon vielleicht noch nichts weiß oder wissen will.“ So dachten zum Beispiel auch die allerersten Christen.
Burkhard Müller, Süddeutsche Zeitung, 7.11.2011
Aus der Werkstatt des Dichters
Jan Wagner, Jahrgang 1971, gehört zu den besten deutschen Lyrikern, sein im vergangenen Jahr erschienener Gedichtband Australien, sein vierter, hat es auf eindrucksvolle Weise gezeigt.
Wagners Gedichte zeichnen sich durch kluge Beschränkung aus, durch eine poetische Zielgerichtetheit, die einen starken Sog erzeugt, sodass man sich nach dem Lesen immer wieder fragt: Was war da jetzt? Wie hat er das gemacht? Was hat mich hier so in Bann geschlagen?
Nun gibt es Gelegenheit, Antworten auf diese Fragen in Jan Wagners poetologischen Überlegungen zu suchen: In einem Sammelband, in dem neben seinen Untersuchungen der jüngeren deutschen Gegenwartslyrik und Selbstauskünften auch Porträts einiger von ihm geschätzter Dichter untergebracht sind, darunter viele englischsprachige, von Walt Whitman bis Simon Armitage, denn Wagner ist auch Übersetzer aus dem Englischen. Dazu Zeitungsartikel und Marginalien.
Die Texte sind – bis auf einen – in den letzten fünf Jahren entstanden und fast alle schon einmal veröffentlicht, beziehungsweise als Reden vorgetragen worden. Deshalb gibt es in den Aussagen einige Wiederholungen; es gibt mehrfach auftauchende Denkfiguren; es gibt starke und eher schwache Texte – ein Sammelband eben.
Dessen etwas disparater Charakter hat zumindest den Vorteil, dass sich im Lauf der Lektüre Jan Wagners Einstellung zur Welt der Poesie und zur Poesie in der Welt in einer Weise erschließt, als wandere man in einem Gebäude herum, von der Garage durch die Küche über die Schreibstube ins Ladenlokal, von oben nach unten, durch Zeiten und Poetiken, Abstraktion und Alltag. Ein interessantes, dabei ganz unprätentiöses Gebäude.
Im wohltuenden Gegensatz zu essayistischen Brillanzerzeugern, deren Texte immer etwas klüger klingen sollen, als sie wirklich sind, zeichnet sich Jan Wagner in seinen Aufsätzen eher durch intellektuelle Bescheidenheit aus:
Was kann das Steinchen über das Mosaik berichten? Wie beschreibt der Faden den Gobelin?
So charakterisiert er seine eigene Position in „Vom Pudding. Formen junger Lyrik“.
Interessant sind seine Einlassungen zur Formsprache, eindrucksvoll der Fundus, aus dem er schöpft. Und immer wieder stößt man darin auf Formulierungen, die selbst fast wie Gedichte klingen: In einem gelungenen Gedicht, das die Spannung zwischen Form und Regelverstoß hält, heißt es einmal, sei „neben dem Widerspruch auch der Bannspruch enthalten, der Zauberspruch, die Beschwörungsformel“. Form und Magie, die sich in dem Wort „Formel“ treffen: Da geht die Lust des Lyrikers an einem präzisen Wort mit dem Essayisten durch und für den Leser ist es eine Freude.
Solche Höhepunkte gibt es viele in diesem Buch; dass es auch schwächere Texte enthält, eher für den Tag und ein anderes Format geschrieben, verzeiht man ihm deshalb gerne.
Katharina Döbler, Deutschlandradio Kultur, 17.10.2011
Großartiges Buch
Was Jan Wagner mit diesem Buch abgeliefert hat ist außerordentlich gut. Lyrik braucht die Freiheit der Gedanken und keinen Status Quo, keine Fesseln um den Anschein zu erwecken, dass man es mit einer Geheimwissenschaft zu tun hat. Jan Wagners Wissen über die Gedichte im englischsprachigen Raum hat ihm eine deutliche Sprache gegeben, hat ihn frrei werden lassen, trotzdem auch er ein Meister der Form ist. Ich, der ich selbst Lyriker bin, gehöre ab jetzt zu seinen Bewunderern, denn ich konnte sehr viel über Lyrik lernen, obwohl ich dachte schon fast alles zu wissen. Bei Jan Wagner lerne ich immer wieder was dazu und das ist gut so. Danke Jan Wagner.
Hanno Hartwig, amazon.de, 5.7.2015
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Gisela Trahms: Göttlich ausgewogen
poetenladen.de, 28.11.2011
Frieder von Ammon: Wagner, Jan: Die Sandale des Propheten
Arbitrium, Heft 2, 2012
Sarah Scheibenberger: Jan Wagner: Die Sandale des Propheten
Cultura redesca, 2012
Angelika Overath: Vom Tagwerk des Dichters
Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 27. 11. 2011
Martin Zingg: Unwägbares
Neue Zürcher Zeitung, 18. 8. 2012
JAN WAGNER
Anweisung
Weg mit Pasteten
Her die Positive Lyrik
Brenn den Teufeln ein Frohgesicht
Zeig Jäger wie sie nirgends sind
Rück Wölfe in genehmes Licht
Und auf den Rücken
setz ein Kind
Peter Wawerzinek
Denis Scheck trifft Jan Wagner in Druckfrisch.
Jan Wagner liest bei faustkultur.
Poetry Crossings: Jan Wagner, Monika Rinck, Alistair Noon und Adrian Nichols lesen im Studio Niculescu am 15.4.2011 ausgewählte Gedichte und übersetzen sich gegenseitig.
Salon Holofernes – mit Jan Wagner. Judith Holofernes spricht mit Künstlern über das Kunstmachen.
Ein Gedicht und sein Autor: Ursula Krechel und Jan Wagner am 17.7.2013 im Literarischem Colloquium Berlin moderiert von Sabine Küchler.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Homepage +
KLG + AdWM + IMDb + PIA +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Arno-Reinfrank-Literaturpreis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett 1 + 2 +
Dirk Skibas Autorenporträts
shi 詩 yan 言 kou 口
Jan Wagner liest in der Installation Reassuring Synthesis von Kate Terry aus seinem neuen Gedichtband Australien im smallspace, Berlin.


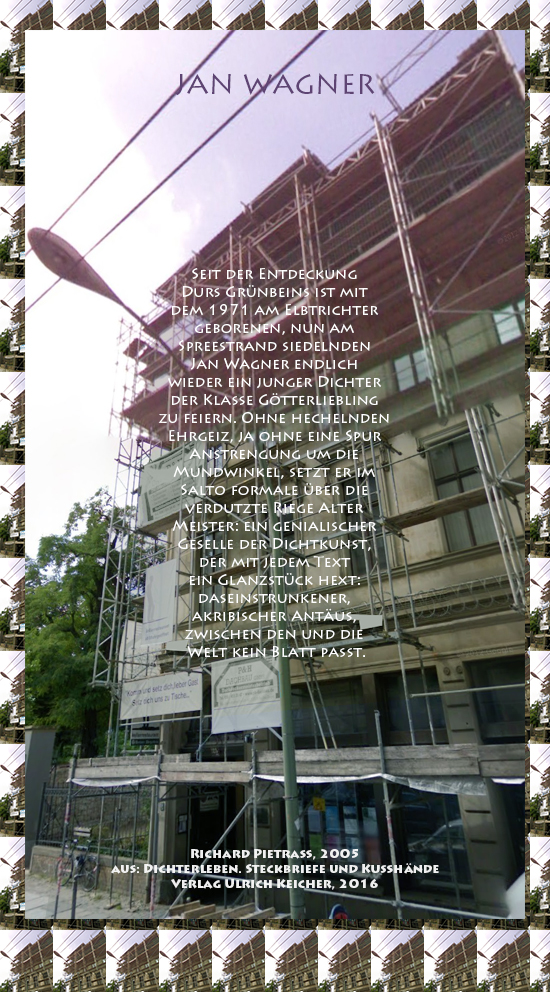












Schreibe einen Kommentar