Text+Kritik: Jan Wagner – Heft 210
QUALLE UND KILLER
– Eine Einführung in das Schreiben Jan Wagners. –
Sprechen wir vorerst nicht von Jan Wagner. Sprechen wir von Theodor Vischhaupt, von Anton Brant und Philip Miller, drei Verborgenen, deren Spuren ein Herausgeber namens Jan Wagner nachgegangen zu sein und deren verschüttetes Werk er wieder freigelegt zu haben behauptet. Derart überzeugend werden sie uns vorgestellt, mit allem, was dazugehört – biografischen Angaben, Fußnoten, Bibliografie –, dass Grund zu der Annahme besteht, sie existierten tatsächlich. Da aber der Band im Buchhandel unter dem Verfassernamen Jan Wagner erhältlich ist, ja sogar als dessen Buch rezensiert worden ist, steht zu befürchten, dass dieser selbst eine Fiktion ist, erdacht von den drei Herren Vischhaupt, Brant und Miller.1
Im Jahr 2013 allerdings hat dann jemand, der sich als Jan Wagner ausgab, in öffentlichen Vorträgen historisch und systematisch über das Erfinden von Dichtern nachgedacht und über die Werke dieser Dichter, die man dann ja gleich dazu erfinden müsste.2 Auch über sich selbst hat er gelegentlich gesprochen, zum Beispiel in der Selbstvorstellung vor der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung 2010:
Sich vorstellen – das tut man, nicht wahr, zuallererst mit seinem eigenen Namen. Darf ich mich vorstellen, sagt man und läßt jene Kombination von Lauten folgen, die man sich nicht aussuchen konnte und die einem doch in allen Registern bis zum Schluß treu bleiben wird. Mir selbst lag mein Name lange Zeit wie fremd auf der Zunge. (…) wahr blieb (…), daß weder mein Vor- noch mein Nachname sonderlich originell und selbst ihre Kombination in keinem Telefonbuch eine Seltenheit ist. An einem Winterabend in Berlin, als es klingelte und ich zum Hörer griff, wurde aus dieser Gewißheit ein Augenblick geradezu existentiellen Schreckens. „Hier ist Jan Wagner“, sagte ich, nur um am anderen Ende der Leitung eine mir unbekannte Stimme antworten zu hören: „Hier auch“.3
Geboren und aufgewachsen ist dieser vorgebliche Träger des Namens dort, wo die Hansestadt Hamburg aufhört und Schleswig-Holstein anfängt: 1971 in Ahrensburg, im Schatten eines schönen weißen Schlosses. Er studierte in Hamburg, am Trinity College in Dublin und in Berlin, lebt in Berlin und bis vor Kurzem auch in München, ist zu Hause in einem „Australien“, das nicht auf der Landkarte zu finden ist, und hat seine Sache ganz auf die Poesie gestellt, die Landessprache dieses fremden Kontinents: als Lyriker, als Lyrikkritiker, als Übersetzer von Lyrik aus dem Englischen, unter anderem von Charles Simic, Simon Armitage, Matthew Sweeney und James Tate. Denn ein Leben ohne Poesie, das hat er selbst einmal geschrieben, „nein: Das ist undenkbar.“4
Er ist dafür, schon vor dem Preis der Leipziger Buchmesse und nach ihm wieder, mit diversen Stipendien und Preisen ausgezeichnet worden, die hier aufzuzählen nicht nötig ist. Die Titel der Bücher aber, die unter seinem Namen erschienen sind, will ich doch nennen. Von 1995 bis 2003 gab er mit Thomas Girst eine Serie von insgesamt elf ,Literaturschachteln‘ heraus, Loseblatt-Anthologien zur zeitgenössischen Weltpoesie, unter dem (zufällig gefundenen) Titel Die Aussenseite des Elementes. Mit seinem Dichterfreund Björn Kuhligk unternahm er eine poetische Harzreise, deren Ergebnisse in dem Buch Der Wald im Zimmer nachzulesen sind. Mit Probebohrung im Himmel erschien 2001 sein lyrisches Debüt, es folgten Guerickes Sperling 2004, Achtzehn Pasteten 2007 und Australien 2010. 2011 veröffentlichte er seine gesammelten Essays zur Poesie, Die Sandale des Propheten, 2012 folgten Die Eulenhasser in den Hallenhäusern – verfasst nicht von Jan Wagner, sondern, wie gesagt, von den Herren Vischhaupt, Brant und Miller, und 2014 der bis dato größte Erfolg, die Regentonnenvariationen.
Das heikle Ich – doch, das gibt es oft in all diesen Texten; immer wieder sagt hier jemand oder etwas Ich. Nur ist es so wenig mit Jan Wagner zu verwechseln wie der gleichnamige Anrufer am anderen Ende der Leitung. Was hier Ich heißt, ist oft weniger Voraussetzung des Gedichts als vielmehr sein Effekt (so wie der Dichter in seinen Versen auch, sogar leitmotivisch wiederkehrend, Tanten, Freunde und Kollegen erwähnt, deren Existenz außerhalb dieser Texte sehr zweifelhaft, aber vermutlich auch unschärfer ist). Dieses Ich zeigt sich, indem es sich verbirgt;
when asked
t’ give your real name…
never give it5
Es zeigt sich verborgen zum Beispiel in toten Malern und Dichtern wie Strindberg und Velázquez, in Zirkusartisten und namenlosen Passanten, in Tieren, und in diesen sogar mit besonderer Vorliebe. Ein „selbstporträt mit bienenschwarm“ steht am Ende der Regentonnenvariationen wie eine Signatur. Es zeigt eine Art portrait of the artist as a beekeeper, ganz und gar bedeckt von den Bienen, die ihn kleiden und schützen wie das lange Haar die nackte Maria Magdalena oder wie die Rüstung den Ritter; so aber ist es „wirklich sichtbar erst mit dem verschwinden“.6 Der Dichter im Bienenschwarm, der seine Züge trägt, indem er ganz Bienenschwarm ist: dieses Schlussbild erscheint wie ein Emblem der Pflanzen- und der Tierporträts. Es gibt ungemein genaue, anrührende und einfühlsame, oft komische Gedichte von Jan Wagner über Murmeltiere und Rohrdommeln, über Ottern und Dachshunde, über Austern oder jene Qualle, die er in einem hier exemplarisch zu zitierenden Gedicht so anredet:
Qualle
gefräßiges auge,
einfachste unter den einfachen –
nur ein prozent trennt sie von allem,
was sie umgibt.
stoße dich weiter vor
ins unbekannte: ein brennglas, geschliffen
von strömungen und wellen; eine lupe,
die den atlantik vergrößert.7
Um Erkenntnis, Entdeckung, ja Bereicherung und Vergrößerung der Welt geht es, mithilfe der Sonde des Gedichts, das zugleich auch Lupe sein kann oder Teleskop. Vor allem aber: Das so erkenntnislustige Gedicht ist selbst das handelnde Subjekt, das äugend, schmeckend, strudelnd durch die Welt schwimmt, Jan Wagners Gedicht ist wie die Qualle ,ganz Auge‘, und das Gedicht mit seiner Aufforderung „stoße dich weiter vor“ in Wahrheit ein Selbstgespräch. Als er 2006 nach seinem Verhältnis zur damals zeitweise modischen ,Poesie der Fakten‘ und nach seiner Ansicht über das Verhältnis von Poesie und exakten Wissenschaften gefragt wurde, hat Jan Wagner geantwortet: Der Lyriker sei ja „per se ein Eklektizist, ein Sammler, der nimmt, was sich ihm bietet, und es mit dem verknüpft, was er bereits hat. Als solcher wird er die Kluft zwischen den Kulturen nicht schließen, kann sie aber bewohnbar machen. Vielleicht auch haben die recht, die sagen, er könne von den Naturwissenschaften nicht nur Material erhoffen, sondern sich auch zu einer Präzision des Denkens, des sprachlichen Aufbaus, der genauen Bildbearbeitung ermutigen lassen, die eine gefühlige Schwammigkeit von vornherein ausschließen.“8
So sehen wir ihn selbst, den realen Autor, in den Rollen- und Maskenspielen seiner Verse nur so, wie wir in den Gemälden seiner neuen Bildgedichte den Maler sehen oder im Thriller von David Lynch den Killer: indem wir aus dem Blick, den wir unter dem Zwang der Kamera teilen, rückschließen auf den Menschen, dem diese Augen gehören müssen. Er selbst hat in seiner Münchner Rede zur Poesie, im Lyrik Kabinett, die Lyrik mit dem Kriminalroman verglichen, das Gedicht und die Aufklärung eines Verbrechens. Beiden gemeinsam sei, so sagt er, unter anderem das Vergnügen am Denken, an der Denkaufgabe, die zugleich ganz Spiel ist und in der es doch um Leben und Tod geht.9 Und die uns lehrt, die Welt, die wir zu kennen glauben, für die Dauer der Lektüre aus den Augen von Leuten zu sehen, die wir nicht sind und im wirklichen Leben vermutlich auch niemals sein wollen: Qualle oder Killer.
Gedichte seien Instrumente der Entautomatisierung von Sprache und Wahrnehmung, hat der russische Dichter und Theoretiker Viktor Sklovskij zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschrieben. Wir dichten, sagt er, um „den Stein steinern zu machen“,10 damit wir das, was uns umgibt, sehen und nicht bloß wiedererkennen. In einem frühen Essay unter dem mit fast religiösem Pathos auftretenden Titel Die Erweckung des Wortes (1914) beklagt er:
(…) wir haben die Empfindung der Welt verloren; wir sind wie der Geiger, der den Bogen und die Saiten nicht mehr fühlt, wir sind nicht mehr Künstler unseres Alltags, wir lieben unsere Häuser und unsere Kleider nicht und trennen uns leicht von einem Leben, das wir nicht empfinden. Nur die Schaffung neuer Formen in der Kunst kann dem Menschen das Erlebnis der Welt zurückgeben, die Dinge erwecken und den Pessimismus töten.11
Das könnte, das Pathos abgerechnet, beinahe von Jan Wagner sein.
Denn der zitiert an der einen Stelle zustimmend Ezra Pounds in dieselbe Richtung weisenden Imperativ „Make it new“[footnote]Jan Wagner: „Das Stück Eis auf dem Ofen. Ein Gespräch“, a.a.O., S. 93 und an anderer die nur scheinbar widersprechende Forderung Robert Frosts, das Gedicht solle seinen Lesern nichts Neues zeigen, sondern das, was sie schon kennen – was sie aber eben nur wiedererkennen und nicht sehen.12 Damit aber die Sehweise anders wird, damit wir die Empfindung der Welt wiederfinden, muss die Sprechweise anders werden. Die Poesie ist nicht nur ein, sondern das einzige Mittel, die Sprache in Bewegung und damit unsere sprachlich konditionierten Wahrnehmungen und Denkweisen am Leben zu erhalten; dies ist ihre -Bestimrnung., als Begriff wie als Aufgabe. Poesie ist darum nicht nur ein Lebens-, sie ist ein Überlebensmittel. Ohne sie hört der Stein auf, steinern zu sein, ohne sie verliert der Frühling sein Aroma, ohne sie verlieren die Vokale ihre Farben.
Spinnefeind ist Jan Wagner, dessen literarisches Credo ich damit gewiss nur unzulänglich zusammengefasst habe, dem Dogmatismus und der Etikettierung von Schulen, Bewegungen, Gruppen, den Verboten und Ausschlussverfahren. In einem Essay über die junge deutsche Gegenwartslyrik hat er bemerkt, es sei „nicht länger Glaubenssache, auf welche Schule man sich beruft“. Und er hat, entschieden zustimmend, hinzugefügt:
Über fast die gesamte jüngere Lyrik (…) ließe sich sagen, was Émile Zola einst über den experimentellen Roman bemerkte: Sie bewegt sich du connu a l’inconnu, ins Unbekannte, Unerhörte, Neuartige, wohin jedes gelungene Gedicht zielt, schon immer zielte.13
An genau diesem Übergang sehen die tanzenden Mücken, diese beweglichen Schriftzeichen wie auf dem „stein von rosetta, ohne den stein“, auf einmal aus wie „schatten, / die man aus einer anderen welt // in die unsere wirft“, und das dunkelste Objekt dieses Blicks über eine beschattete Schwelle ist das unauffälligste:
man14
Das „Unbekannte, Unerhörte, Neuartige, wohin jedes gelungene Gedicht zielt“ – das ist die uns vermeintlich schon bekannte Welt. Und so können auch die Instrumente des Vorstoßes die sehr alten Formen sein. Nur dürfen sie nicht pedantisch reproduziert werden. Gelingt es aber, sie ihrerseits aufzufrischen, zu verfremden, dann kommen so unmerklich kunstvolle, so schöne und welterschließende Gebilde heraus wie seine Villanellen und sein kompletter Sonettenkranz, seine Oden und Sestinen. Und etwa auch der Reim? Ja, auch der Reim. Nur etwas anders, als wir ihn erwarten. Denn auch der Umgang mit ihm folgt der Maxime „Make it neu“.
Das, was man in der angelsächsischen Welt slant rhymes nennt, ist für Jan Wagner elementarer Ausdruck und Grundbaustein dieser auffrischenden Begegnung der Gegenwart mit den Traditionen. Als „Reim in Schräglage“ übersetzt Jan Wagner den Ausdruck, und er verbindet ihn mit den Halb- und „Parareimen“ – für die er auch sogleich wunderbare Beispiele gibt (seine eigenen Gedichte sind voll davon, sie sind ihr auffallendstes Merkmal): „Wie steht es denn mit“, fragt er seine gegenüber dem Reimen argwöhnischen Leser, „Konsonanzen (…), bei denen (…) nicht die Vokale der Partnerwörter, sondern ihre Konsonanten entscheidend sind“? So reimt er zu Anschauungszwecken „Holz“ nicht nur auf „Stolz“, sondern auch auf „Hals“ und entdeckt – ein besonders spielfreudiges Beispiel – die „Konsonanten- und Lautfolge b-l-m-r-t-s“ sowohl in dem Wort „belämmertes“ als auch, genau identisch, in den Worten „Blaue Mauritius“, welch ein Reim! Und wir müssen nur, dazu ermutigt er uns ausdrücklich, „etwas mehr Beweglichkeit in den Buchstabengelenken“ trainieren und „schon finden Sensen zu Pferdebremsen, Alabaster zu Wasser (…) Kohle auf Koala, Locken auf Laokoon und Papier auf Papaya“.15 Neuerdings sind Entdeckungen wie „knauser-“ auf „canossa“ hinzugekommen,16 in der bekanntesten ,Single-Auskoppelung‘ des neuen Bandes „giersch“ auf „garage“ und „geräusch“17 oder, mit einem auch geografisch verblüffenden Enjambement, „prärie“ auf „bayri-“.18 Der schönste dieser Wagner’schen Reime, fanden meine Studenten, sei „Uppsala“ auf „Obstsalat“.19
Und notabene – wenn er will, reimt er klassisch rein und glatt, weil ja auch der slant rhyme nicht zum neuen Automatismus werden darf. Wenn sich in den Regentonnenvariationen tatsächlich wieder „baum“ auf „traum“ reimt, sieht das abgebrauchte romantische Paar aus wie frisch verliebt. Schon in einem früheren Rollengedicht, es bewegt sich mit Shackletons Polarexpedition auf einer einsamen treibenden Eisscholle durch tödliche Kälte und Erstarrung, war zu lesen:
es frißt sich von den rändern bis zum herzen
der scholle stetig vor. dort kauern wir,
vom ruß verklebt, wie lettern nach dem schwärzen.
die blanke fläche. dieses blatt papier.20
Es sind die letzten Worte seines Gedichtbuchs Guerickes Sperling.
Weil dieser Vorrat an Spielformen in den Jahrhunderten und Jahrtausenden der Weltpoesie so unerschöpflich ist und weil er sich jederzeit weiter entwickeln, weiter transformieren lässt: deshalb geht es Jan Wagner, noch einmal mit seinen eigenen Worten, um „die genaue Kenntnis der Tradition, der Traditionen, die technisches Unvermögen und Naivität vermeiden hilft, und die Unverkrampftheit im Umgang mit einst unvereinbaren Gegensätzen, die zu einer neuen Offenheit und Spielfreude geführt hat“.21 Ob das für das ganze weite Feld der jüngeren deutschen Lyrik gilt, weiß ich nicht (möchte jedoch gern Jan Wagners Optimismus folgen). Auf seine eigene Dichtung aber passt es wie angegossen.
Auch die auf den ersten Blick bloß verspielten Anagrammgedichte Theodor Vischhaupts, mit dem wir anfingen – wir erinnern uns, er ist der Erfinder Jan Wagners –, zeigen auf den zweiten Blick, wie sich das Experimentieren mit nichts als dem reinen Buchstabenmaterial zu einem Instrument der sprachlichen Welterschließung machen lässt. Eine Ausgangszeile legt die Buchstaben fest, aus denen dann jede weitere Zeile durch Umstellungen hervorzugehen hat; eine strikt mechanische Regel also – und was für ein Zauberstab in den Händen dieses Magiers! So lautet beispielsweise ein erster Vers:
Mein Herz ist ein Doge, gefangen in seiner Pracht.
Und dann eröffnet die Serie der Vertauschungen und Umstellungen uns Einsichten in Märchen- und Traumwelten, die uns bislang verschlossen waren und in die wir nun verwirrt und bezaubert hineinschauen:
Mein Herz ist ein Doge, gefangen in seiner Pracht,
Ein Herr mit eigenen Zofen, dreißig Nachtpagen,
(…)
Gemeine Hofnarren, innig scherzend, Tipigäste,
Einige gerne ringende Zampanos, ihr Teint fesch,
Zartere Geishas, Nietendoggen in Minipferchen;
(…)
Ein Doge ist mein Herz, in seiner Pracht gefangen.22
So gefangen wie die Sprache in diesem Anagramm-Kerker, und zugleich so grenzenlos frei. Denn die Welt, die durch diese zugleich artistische und (der Ausdruck sei erlaubt) demütige Poesie entdeckt wird, die für uns durch die Poesie zu entdecken ist: Diese Welt hat in der Tat keine Grenzen. Wer mit zwei einsamen Windrädern eine „Probebohrung im Himmel“ vornehmen kann, der kann sich auch mit derselben staunenden Neugier hinunterbeugen zum Fenchel – dem im selben Band ein Gedicht gewidmet ist – oder beim Waldspaziergang einer Schar von Champignons begegnen, als sehe er sie zum ersten Mal und als seien sie fremde Ritter, die ihm auf seiner Aventiurenfahrt begegnen, der kann alle, die er in einer auf einmal still gewordenen Welt vermisst, als sei wie in Büchners grausigem Märchen „Alles tot (…) Alles tot“,23 mit einem Blick hinauf am Stamm der „blutbuche“ wiederfinden:
im innern dann das helle
lachen über mir, das vollgepackte
geäst, als ich nach oben sah. und da saßen sie alle.24
Wenn die poetische Qualle, Jan Wagners zart schwebende Schutzheilige, die ganz Brennglas, ganz Auge ist, in die Gewässer ewig lichtloser Höhlen eintaucht, dann sieht sie mit nicht nachlassendem Staunen auch noch den Grottenolm, dieses armseligste aller Tiere: als ein Wesen, das sich ganz aus der Welt zurückgezogen hat, augenlos und in sich ruhend. Und noch ihn, das genaue Gegenteil ihrer selbst, sieht Jan Wagners poetische Qualle mit einem Staunen, das mit Liebe leicht zu verwechseln ist. Da beide, Qualle und Olm, die beiden Enden des Erlebensspektrums markieren, das diese Gedichte umfassen, sollen auch diese Verse zitiert werden:
in einem reich ohne licht
und ohne farben, ohne wind,
sitzt der olm, der keine feinde
außer der sonne hat, zarter als die arbeit
von glasbläsern ist, kaum schwerer als ein brief
und leichter als ein schluck wasser.
weiß er nichts von unserer welt
oder weiß er alles? mit einer haut,
so durchlässig, daß sie nichts verwehrt
und alles aufnähme an giften,
an reichtümern, beschränkt er sich
aufs wenige, verzichtet aufs essen,
sogar auf den eigenen schatten.25
Es ist schon einige Jahre her, dass Jan Wagner zusammen mit Björn Kuhligk die viel diskutierte Sammlung Lyrik von Jetzt herausgab (2003 und 2008). Aber noch immer gelten seine Neugier, seine Offenheit, seine Liebe zur Poesie den unterschiedlichsten Formen des Schreibens. Weil es so weit geöffnete Augen hat, darum macht es bei jedem Wiederlesen die Augen weit, darum öffnet es das, pardon, Herz und den Verstand. Seine Freude, seine Dankbarkeit dafür, dass es das alles (und dass es all diese Gedichte und Stimmen und Schreibweisen) gibt, seine Feier der Vielfalt (die Kritik und Skepsis nicht ausschließt, sondern im Gegenteil voraussetzt: nur wer die Spreu vom Weizen so sicher trennen kann wie er, kann dann den Weizen so schmackhaft zubereiten): diese Freude und Dankbarkeit sind ansteckend.
Ich sage das aus Erfahrung: Wer Jan Wagner liest, der ist schon dabei, sein Leben zu ändern. Denn er lebt in seiner eigenen Welt, als sei sie ganz neu und fremd, voller Drohungen, die so handfest und unfassbar sind wie die Gier im Giersch, und voller Wunder, die so groß sind wie die Koalas in Australien, diese „zerzausten stoiker, // verlausten buddhas“.26 In seiner schon zitierten Selbstvorstellung vor der Deutschen Akademie hat er seinen realen Nachnamen an dessen Etymologie angeknüpft: den Wagenmacher. Also, nehmen wir Platz hoch auf dem Wagen Jan Wagners, wer immer das sein mag, und lassen uns hineinkutschieren in die unbekannte Welt.
Heinrich Detering
Inhalt
– Jan Wagner: Neue Texte
– Heinrich Detering: Qualle und Killer. Eine Einführung in das Schreiben Jan Wagners
– Ernst Osterkamp: Die stillen Helden der Kunstautonomie. Über Jan Wagners Die Eulenhasser in den Hallenhäusern
– Gustav Seibt: Des einzelnen fröhlich. Zwei Exkurse zu Jan Wagners Gedicht „nach canaletto“
– Walter Hettche: Unterwegs im Moorarchiv. Zu Jan Wagners Gedicht „torf“
– Michael Braun: Das regungslose Zentrum vom Gesang. Zwei Fußnoten zur Dichtkunst Jan Wagners
– Mirjam Springer: Selfie mit Bienen. Jan Wagners Spiegelblicke
– Holger Pils: Mit literaturbetrieblicher Wucht. Das Echo auf die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse an Jan Wagner
– Robin Robertson/Matthew Sweeney: On Being Translated by Jan Wagner
– Iain Galbraith: Die Außenseite der Innenseite des Gedichts. Jan Wagner übersetzen
– Simone Ketterl: Auswahlbibliografie
Biografische Notiz
Notizen
Jan Wagner
ist einer der interessantesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Lyriker seiner Generation – und das nicht erst, seit ihm 2015 der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen wurde. Seitdem steht er im Zentrum der öffentlichen Diskussion über Lyrik: einer Diskussion, die kontrovers geführt wird und bei der Grundfragen der Gattung berührt werden.
Jan Wagners Werk umfasst Gedichtbände und Essays, Kritiken und Reden, Anthologien und Übersetzungen zeitgenössischer englischsprachiger Lyrik. Im vorliegenden Heft wird eine erste Bestandsaufnahme unternommen.
Dabei steht die Lyrik Wagners im Vordergrund, aber auch seine Tätigkeit als Übersetzer findet Berücksichtigung.
edition text + kritik, Klappentext, 2016
Das Werk: Jan Wagner Lesung von Jan Wagner mit dem Gesprächspartner Frieder von Ammon unter der Moderation von Joachim Kalka am 6. April 2016 im Literarischen Colloquium Berlin
Zeitschriftenlese
Es gehört wohl zu den stärksten Passionen junger, selbstbewusster Zeitschriftenmacher, die jeweils amtierenden Literaturpäpste zu grimmigen Bannflüchen zu reizen. Auch im Falle von Heinz Ludwig Arnold, dem Erfinder der Zeitschrift Text + Kritik, kam es zu Verwerfungen, als der junge Germanistikstudent im November 1962 den großen Friedrich Sieburg, seines Zeichens Chefkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, um ein existenzsicherndes Inserat für seine neue Zeitschrift anging. „Sie scheinen nachgerade an einem hoffnungslos gewordenen Qualitätsbegriff festhalten zu wollen“, so komplimentierte Sieburg artig den jungen Editor, um anschließend die Peitsche zu zücken: „Sie nennen für die erste Nummer drei Namen, die mir alle drei gleich widerwärtig sind, nämlich Günter Grass, Hans-Henny Jahnn und Heinrich Böll. Das ist … eine trübe Gesellschaft, dem deutschen Waschküchentalent entstiegen und gegen alles gerade Gewachsene feindselig gesinnt.“ Zwei Jahrzehnte später, so behauptet die Legende, war es Sieburgs Nachfolger Marcel Reich-Ranicki, der mit derben Beschimpfungen der „Schweine-Bande“ um „Arnold-Dittberner-Kinder“ nicht geizte.
Der so Attackierte ließ sich nicht einschüchtern. Der damals 22-jährige Arnold setzte in seinen ersten beiden Heften unverdrossen auf seine Hausgötter Grass und Jahnn – und es gelang ihm scheinbar mühelos das, was bei Rainer Maria Gerhardt, dem heute vergessenen Literaturgenie der Nachkriegszeit, noch in astronomisch hohen Schulden und einem tragischen Freitod geendet hatte. Unter dem ursprünglich von Arnold gewünschten Zeitschriftentitel fragmente hatte Gerhardt schon 1951/52 in seinem großartigen literarischen Journal dem restaurativen Nachkriegsdeutschland die Leviten gelesen, war aber an notorischem Geldmangel und ästhetischer Kompromisslosigkeit schon früh gescheitert.
Heinz Ludwig Arnold und seine frühen Mitstreiter Gerd Hemmerich, Lothar Baier und Joachim Schweikart hatten mit Text + Kritik mehr Glück. Das Konzept, sich in kritischen Aufsätzen immer nur einem wichtigen Gegenwartautor zu widmen, schien zunächst nur auf ein germanistisches Fachpublikum zu zielen. Nachdem er aber auf listige Weise beim Chefmanager von HAPAG-Lloyd eine Spende von 1000 DM rekrutiert hatte, begann Arnold mit seinem neuen Literaturblatt von Göttingen aus die literarische Welt zu erobern. Das Debütheft über Günter Grass, ein 32 Seiten-Heftchen, ist noch heute, in stark erweiterter und aktualisierter Fassung, zu haben. Für den Eröffnungsbeitrag, eine „Verteidigung der Blechtrommel“, hatte Arnold den Brüsseler Germanisten Henri Plard gewinnen können, den er während seiner literarischen Lehrjahre als Sekretär Ernst Jüngers kennen gelernt hatte. Auf sein literarisches Adjutantentum bei Ernst Jünger, das von 1961 bis 1963 währte, blickte Arnold später mit einigem Ingrimm zurück, zuletzt in seinem Text + Kritik-Heft zu Jünger, das die schärfste Kritik am Anarchen aus Wilflingen enthält, die jemals aus literaturwissenschaftlicher Perspektive geübt wurde.
Die Lust an der literaturkritischen Auseinandersetzung zeichnet ja nicht nur das Jünger-Heft, sondern viele andere Projekte der edition text + kritik aus, die 1969 im juristischen Fachverlag Richard Boorberg ein festes verlegerisches Fundament gefunden hatte und dort ab 1975 als selbständiger Verlag agieren konnte. Text + Kritik war nie ein Forum für urteilsschwache Germanisten, die jede interpretative Wendung mit einem Überangebot an Fußnoten absichern, sondern ist bis heute die bevorzugte Schaubühne für philologische Feuerköpfe, die cum ira et studio für oder gegen einen Autor und sein Werk eintreten. So muss jeder Autor, dem die Ehre zukommt, in einem Text + Kritik-Heft analysiert und seziert zu werden, mit kritischen Dekonstruktionen des eigenen Werks rechnen.
Mittlerweile hat die öffentliche Aufmerksamkeit nachgelassen, aber die angriffslustige Essayistik ist auch nach insgesamt 157 Heften das Markenzeichen von Text + Kritik geblieben. In Neuauflagen und Aktualisierungen wurden veraltete Urteile revidiert, beim Wechsel der Denkschulen und Interpretationsmethoden aber auch so mancher Purzelbaum geschlagen. In der 5. Auflage des Ingeborg Bachmann-Heft exponierte sich z.B. eine schrille feministische Literaturwissenschaft, der Sonderband Nr. 100 über „Literaturkritik“ publizierte massive Attacken auf Marcel Reich-Ranicki. Einem euphorischen Sonderheft über „die andere Sprache“ der „Prenzlauer-Berg-Connection“ folgte mit der Nummer 120 alsbald die Selbstkorrektur im desillusionierten Blick auf den Zusammenhang von „Literatur und Staatssicherheitsdienst“. Die subtilsten, stilistisch funkelndsten Schriftsteller-Entzauberungen haben in den letzten Jahren Hermann Korte und Hugo Dittberner verfasst. Über Sarah Kirsch, in der Nummer 101, findet man z.B. die wunderbare Sentenz, die Dichterin schreibe „Gedichte, die durch forcierte intellektuelle Unterbeanspruchung langweilen“. Diesen Königsweg literaturkritischer Unruhestiftung will Text + Kritik nicht mehr verlassen.
Michael Braun, Saarländischer Rundfunk, April 2003
Fakten und Vermutungen zu TEXT+KRITIK
Jan Wagner – Autoren zu Gast bei Albert von Schirnding
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber
Denis Scheck trifft Jan Wagner in Druckfrisch.
Jan Wagner liest bei faustkultur.
Poetry Crossings: Jan Wagner, Monika Rinck, Alistair Noon und Adrian Nichols lesen im Studio Niculescu am 15.4.2011 ausgewählte Gedichte und übersetzen sich gegenseitig.
Salon Holofernes – mit Jan Wagner. Judith Holofernes spricht mit Künstlern über das Kunstmachen.
Ein Gedicht und sein Autor: Ursula Krechel und Jan Wagner am 17.7.2013 im Literarischem Colloquium Berlin moderiert von Sabine Küchler.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Homepage +
KLG + AdWM + IMDb + PIA +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Arno-Reinfrank-Literaturpreis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett 1 + 2 +
Dirk Skibas Autorenporträts
shi 詩 yan 言 kou 口
Jan Wagner liest in der Installation Reassuring Synthesis von Kate Terry aus seinem neuen Gedichtband Australien im smallspace, Berlin.


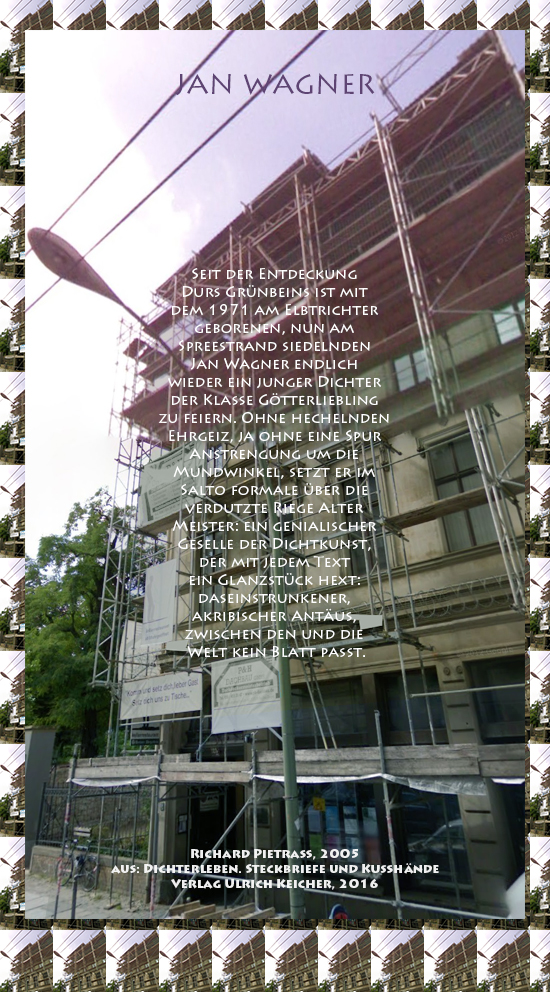












Schreibe einen Kommentar