Kurt Bartsch: Poesiealbum 13
BERNAUER STRASSE
die nächtliche stadt; im stacheldraht
der posten zählt die zigaretten.
noch sind es dreizehn, sieben sind schon rauch;
und jede war ein kurzer frieden.
Nicht die donnernde Scheltrede,
nicht die moralisierende Ballade gedeihen auf Bartschs poetischem Feld: hier redet einer kurz und gründlich, zuweilen grob, und unverschämt treibt er seine angespitzten Wörter unter die Haut der Vergeßlichen, Denkfaulen, allzu Zufriedenen. Aber er kann auch sanft sein: dann kommt er uns als Gaukler, als Spaßmacher entgegen, und so verschiedenartige Gewänder er sich auch überwirft, der Vergleich mit dem Chamäleon hinkt, denn Farbe bekennt Bartsch allemal.
Bernd Jentzsch, Verlag Neues Leben, Klappentext, 1968
Beitrag zu diesem Buch:
Günther Deicke: Die bissigen Humoristen
Neue Deutsche Literatur, Heft 7, 1969
Gespräch mit Kurt Bartsch
– Das Gespräch mit Kurt Bartsch führte Hans Ester am 12. September 1985 in Nijmegen, als der Autor bei Gelegenheit der Veröffentlichung seines Romans Wadzeck in niederländischer Übersetzung die Niederlande besuchte. –
Hans Ester: Herr Bartsch, Sie haben am Johannes-R.-Becher-Institut für Literatur in Leipzig studiert. Welche Bedeutung hatte Georg Maurer als Lehrer an diesem Institut für Sie?
Kurt Bartsch: Maurer war ein stiller Lehrer, ein Weiser mit unendlichem Humor. Er saß, Zigarre rauchend, von mehreren Stapeln Bücher umgeben, in unserer Mitte und hörte zu. Wir lasen ihm, mehr oder weniger selbstbewußt, unsere Gedichte vor. Er kommentierte/kritisierte sie nie direkt; er verglich sie mit den Gedichten der Weltliteratur. Das war manchmal schon sehr entmutigend, wenn er unsere eigenen, unfertigen Produkte denen von Goethe oder Brecht, Rimbaud oder Majakowski gegenüberstellte. Wobei er natürlich nicht verlangte, wir sollten wie Goethe oder Majakowski dichten. Im Gegenteil: Er haßte Epigonen, verzieh uns jedoch Epigonales. Ohne die vorhandene gibt es keine eigene Sprache, sagte er sinngemäß.
Ich habe im Literaturinstitut einen Wandspruch angebracht: Vom Maurer-Lehrling zum Frei-Maurer. Dieser Spruch galt für viele DDR-Lyriker. Adolf Endler und Sarah Kirsch, Helga M. Novak, Volker Braun und Karl Mickel waren seine Schüler, von denen er, wie er beim abendlichen Rotwein sagte, etwas lernen konnte. Er lernte und trank gern. Das war unsere zweite Gemeinsamkeit.
Ester: Poesie war in der DDR besonders während der sechziger und siebziger Jahre sehr populär. Welche Bedeutung kommt in diesem Rahmen der Reihe Poesiealbum zu?
Bartsch: Das Poesiealbum, von Bernd Jentzsch herausgegeben, war eine Lyrikreihe, die man am Zeitungsstand kaufen konnte. Die Hefte, dreißig bis vierzig Seiten stark, kosteten je 95 Pfennig und waren für Schüler und Studenten erschwinglich. Ihre Auflagen (zehntausend und höher) entsprachen ihrer Beliebtheit. Jedes Heft war mit Zeichnungen und einer farbigen Umschlaggrafik, die oftmals von einem jungen DDR-Künstler stammte, versehen. Vorgestellt wurden die Dichter/Grafiker der Welt, sowohl die Klassiker als auch die jüngeren, bis dato unbekannten Dichter. (Das Poesiealbum 13 war meine erste Lyrikpublikation.) Die Hefte wurden wie kleine Magazine in Bussen und Untergrundbahnen gelesen. Man konnte Dichter entdecken. Dichter verwerten. Da die Hefte billig waren, konnte man sie bei Nichtgefallen auch in den nächsten Papierkorb werfen.
Ester: Die Lyrikerin Sarah Kirsch erscheint wiederholt in Ihrem Werk. Was schätzen Sie an ihr?
Bartsch: Mit Sarah Kirsch verbindet mich seit über zwanzig Jahren eine persönliche Freundschaft, die nicht frei von Erotik war/ist. Vielleicht ist es diese Erotik, die meine Gedichte auf Sarah Kirsch verweisen. Ich habe Gedichte über sie und für sie geschrieben; ansonsten sehe ich wenig Ähnlichkeit. Während sie als Lyrikerin mehr aus sich selbst schöpft, schöpfe ich aus der Literatur. Ich bin ein Asphaltliterat, der gern mit anderen Dichtern korrespondiert, sie parodiert usw. Sarah Kirsch und Kurt Bartsch sind Gegensätze, die sich anziehen.
Ester: Für Ihre ersten Werke gilt, daß in ihnen die Solidarität mit der DDR als sozialistischem Land im Mittelpunkt steht. Wann kam der Bruch mit der DDR als Ideal?
Bartsch: Als ich zu schreiben anfing, Ende der fünfziger Jahre, war ich froh, in der DDR zu leben. Hier war es undenkbar, daß ein Mann wie Globke, der die Nürnberger Rassengesetze mitentworfen hatte, Staatssekretär wurde. (Dies nur ein Beispiel; in Westdeutschland gab es zahllose Nazigrößen, die in höchste Regierungsämter aufstiegen.) Insofern war/ist die DDR ein antifaschistischer Staat, zumindest was die Parteiführung betrifft. Honecker saß, wie Sie wissen, 10 Jahre im Zuchthaus; andere „führende Köpfe“ waren im Spanienkrieg oder in der Emigration.
Natürlich war es nicht einfach, in „Deutschlands besserer Hälfte“ (wie ich die DDR nannte) den Sozialismus aufzubauen, d.h. eine Gesellschaftsordnung, in der es kein Oben und Unten mehr geben sollte (klassenlose Gesellschaft). Immerhin bestand die Bevölkerung der DDR zu über 90 Prozent aus ehemaligen Nazis, großen und kleinen Mitläufern/Mitmachern. Demgegenüber standen etwa zweitausend Kommunisten, die KZ und Emigration überlebt hatten. Zweitausend gegen 18 Millionen! Das konnte nicht gutgehen.
Die Kulturfunktionäre, mit denen ich als Schriftsteller in den sechziger Jahren zu tun hatte, reagierten überempfindlich auf jedwede Kritik. Kleinliche Debatten wurden geführt; über Kafka und die Expressionisten wurde der Bannfluch verhängt. (Die sogenannte Formalismusdebatte nahm schon in den dreißiger Jahren in Moskau ihren Anfang; sie war Mitte der sechziger Jahre noch immer nicht ausgestanden.) Es kam also nicht zum plötzlichen Bruch zwischen mir und den Kulturfunktionären, es kam zu Reibereien und Streitigkeiten. Der Bruch, von beiden Seiten herbeigeführt, lag später, Ende der siebziger Jahre.
Ester: Fünf Jahre lang waren Sie Mitglied des Schriftstellerverbandes der DDR. Wie funktionierte während dieser fünf Jahre die Zusammenarbeit mit dem Verband?
Bartsch: 1974 war ich in den Schriftstellerverband der DDR eingetreten. Dazu waren, neben literarischen Veröffentlichungen in Buchform, zwei Bürgen nötig. Meine hießen: Sarah Kirsch und Günter Kunert. Im Verband setzten sich die kleinlichen Streitereien zwischen Kulturfunktionären und Schriftstellern fort. Bücher wurden, weil man ihre Wirkung überschätzte, verboten oder „auf Eis gelegt“. Einige dieser geächteten Bücher – auch meine – erschienen daraufhin im Westen, in der Bundesrepublik Deutschland. Geld- und Gefängnisstrafen wurden angedroht. Die Bücher erschienen dennoch, einige Geldstrafen wurden verhängt. Stefan Heym z.B. mußte zehntausend Mark Strafe zahlen. Als wir – neun Schriftsteller der DDR – öffentlich dagegen protestierten, wurden wir 1979 aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. Ich beschloß daraufhin 1980, von Ost- nach Westberlin „überzusiedeln“. Ich folgte gewissermaßen meinen Bürgen, Sarah Kirsch und Günter Kunert, die diesen Schritt schon vollzogen hatten.
Ester: In Arbeiten über Sie ist die Rede vom „plebejischen Blick“ als Kennzeichen Ihres Werks. Dieser plebejische Blick wird als Erbschaft Brechts gesehen. Welche Legitimität hat dieser Ausdruck?
Bartsch: Ich stamme aus dem Proletariat; meine Eltern waren Arbeiter und Kommunisten. Daneben gab es in meiner Familie sehr viele Kriminelle bzw. Prostituierte. Der Hang zur Freiheit war auf beiden Seiten groß. Ich stand lange zwischen den Fronten und schwankte, ob ich Künstler oder Krimineller werden sollte. Ich entschied mich, dank Brecht, für das erstere. Ich entdeckte Brecht 1954, besuchte fast täglich sein Theater. Er machte mir bewußt, daß der plebejische Blick ein begehrlicher Blick ist. Daher die Angst der Besitzenden weniger vor den Kriminellen als vor den Kommunisten, Sozialisten etc.
Ester: Die Verlogenheit der Gesellschaft bildet ein wichtiges Thema Ihres Werks. Ist diese Verlogenheit Ihrer Meinung nach vom gesellschaftlichen System abhängig?
Bartsch: In beiden deutschen Gesellschaftsordnungen sitzt die Lüge am Tisch. Hüben muß sie das Geld, drüben die Ideologie hüten. Im Kapitalismus: Korruption. Im Sozialismus: Religion.
Ester: Frauen sind bei Ihnen oft Perspektivfiguren, die den ideologischen Schleier entfernen. Warum gerade Frauen?
Bartsch: Frauen werden doppelt unterdrückt. Zum einen von der Gesellschaft, die ja eine Gesellschaft von Männern ist, zum andern privat, von den eigenen Ehemännern. Beispiel: Eine Frau, die tagsüber als Verkäuferin arbeitet, arbeitet abends als Hausfrau: Sie muß die Kinder, den Haushalt, den Mann versorgen. Und wehe, wenn sie dabei nicht schön aussieht! Und wehe, wenn sie am nächsten Morgen müde, unausgeschlafen zur Arbeit kommt! An den Kämpfen, den Niederlagen der Frauen kann man die Widersprüche der Gesellschaft deutlicher aufzeigen.
Ester: In welcher Beziehung steht bei Ihnen die Parodie zu geschichtlichen Prozessen?
Bartsch: In der DDR schrieb ich Parodien, um „Staatsschriftsteller“ zu kritisieren. Es sind dies Leute, die, da sie dem Staat zum Munde reden, stets mit Samthandschuhen angefaßt werden. Im Westen schreibe ich Parodien, um Modeschriftsteller zu kritisieren. Es sind dies Leute, die sich hauptsächlich mit der eigenen Seele befassen, wo es doch so schöne andere Organe gibt.
Ester: Was haben Parodie und Aufklärung miteinander zu tun?
Bartsch: Parodie, soweit sie nicht nur ästhetisch daherkommt, ist Aufklärung. Sie muß ihren Gegenstand, also die Literatur, von verschiedenen Seiten betrachten/angreifen, also auch von der politischen/ideologischen Seite. Parodie, die nur den Stil, nicht aber den Inhalt aufs Korn nimmt, ist bloßer Ulk (siehe meine schwächeren Parodien).
Ester: Gibt es positive Aspekte der Kulturpolitik in der DDR? Ist Kulturpolitik nicht besser als ein kulturpolitisches Vakuum wie im Westen?
Bartsch: Die positiven Aspekte der Kulturpolitik der DDR sind gleichzeitig ihre negativen Aspekte. Das hört sich wie ein Widerspruch an, ist aber keiner. Wenn in der DDR ein Buch (Film, Theaterstück) aus ideologischen Gründen kritisiert wird, hat es den allergrößten Erfolg beim Publikum. Es wird, obwohl meist in niedriger Auflage verbreitet, von Hand zu Hand weitergegeben, also von zehntausenden Menschen gelesen. Ohne diese staatliche Kritik, die ein Verbot zur Folge haben kann, wäre die Aufmerksamkeit für ein Kunstwerk weniger groß. Im Westen, wo ich seit nunmehr fünf Jahren lebe, wird das ganz deutlich: Hier kann ich zwar alles sagen, aber es hört keiner zu. Insofern ist die Wirkung (und auch der Ruhm) eines Schriftstellers in der DDR größer als hier. Der Westen ist eine Art literarischer Supermarkt, auf dem Bestseller zählen. Bestseller werden nicht geschrieben, Bestseller werden gemacht (Public Relation).
Ester: Ist eine Utopie noch denkbar? Gibt es eine Zukunft für die Welt?
Bartsch: Ich habe keine Utopie anzubieten, deshalb bin ich so heiter. Wenn ich an eine Zukunft glaubte, würde ich angestrengter aussehen. Ich genieße die Gegenwart und hoffe, daß sie sich lange hinzieht. Darum auch mein Wohlwollen gegenüber der Ökologie- und Friedensbewegung. Diese sind möglicherweise fähig, die Gegenwart zu verlängern.
Ester: Hat das Christentum Bedeutung und Zukunft für Sie?
Bartsch: Ich bin Atheist. Mein Lieblingsbuch ist dennoch die Bibel.
Ester: Ihr Roman Wadzeck ist diese Woche in niederländischer Sprache erschienen. Ist dieser Roman eine glückliche Wahl für eine Übersetzung?
Bartsch: Ob mein kleiner Roman Wadzeck in Holland verstanden wird, kann ich nicht sagen; zumal er in einer Art Umgangssprache, zum Teil mit Berliner Dialekt, geschrieben ist. Da ich der holländischen Sprache leider nicht mächtig bin, kann ich die Güte der Übersetzung nicht beurteilen. Ansonsten bin ich der Meinung, daß man jedes Buch, auch wenn es im afrikanischen Busch spielt, durchaus übersetzen bzw. bekanntmachen sollte. Also auch meine Bücher.
Aus: Gerd Labroisse und Ian Wallace (Hrsg.): DDR-Schriftsteller sprechen in der Zeit. Eine Dokumentation. Rodopi BV., 1991
KURT BARTSCH
Jetzt pflücke ich Blumen
Jetzt trag ich den Korb
Jetzt fasse ich die Klinke
Jetzt frage ich Warum Wieso
Jetzt merke ich den Trug
Jetzt sehe ich durch
Jetzt bin ich froh
Jetzt habe ich genug
Jetzt tu den Wolf ich sehn
Jetzt tut die Faust mir weh
Jetzt hau ich ab auf leiser Zeh
Jetzt schlage ich mich durch den Wald
Jetzt wird mir heiß
Jetzt wird mir kalt
Jetzt ich weiß
Jetzt nahen die Jäger
Jetzt krieg ich einen Schreck
Jetzt rettet mich ein Hosenträger
Jetzt falle ich auf Seidenkissen
Jetzt ist auf vorher gut geschossen
Jetzt bin ich raus aus dem Dreck
Jetzt rufe ich zu Hause an
Jetzt spreche ich mit meinem Mann
Jetzt will der mit mir streiten
Jetzt höre ich Neuigkeiten
Jetzt hat der Wolf nichts zu fressen
Jetzt Schweinshaxe statt dessen
Peter Wawerzinek
Fakten und Vermutungen zum Poesiealbum + wiederentdeckt +
Interview
50 Jahre 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Fakten und Vermutungen zum Autor + IMDb + KLG + Archiv +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: deutsche FOTOTHEK


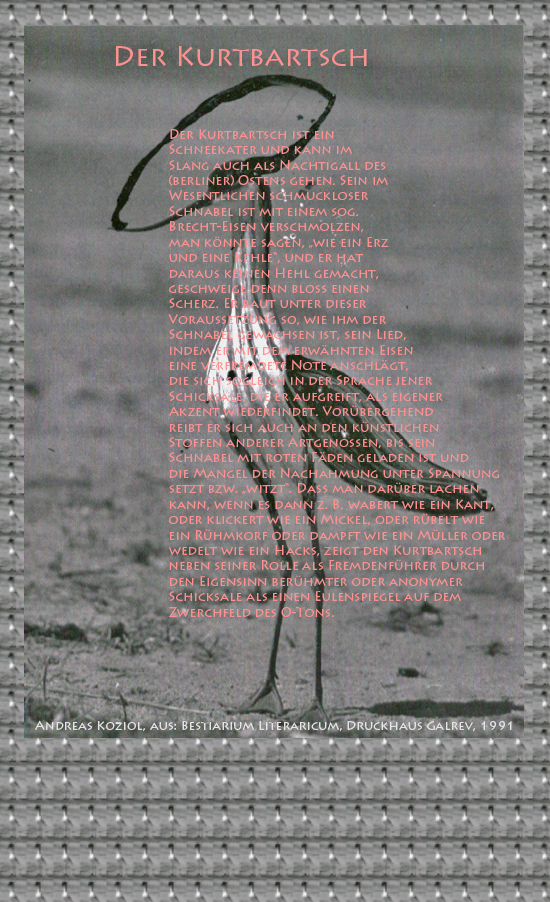












Schreibe einen Kommentar