Wilhelm Bartsch: Übungen im Joch
CANTO NACH EZRA POUND (CXX)
Ich habe versucht, den Wind nachzudichten
In seinen verwirbelten Winkeln, aus welchen die Welt
Zusammengenäht wird mit den krakeelenden Nadeln
Der Krähen, Fetzen, von Möwen im Fluge verknotet.
Aber der Wind war niemals ein Dichter, aber die Welt
Wurde ein weites Windheim genannt. Aber
I have tried to write Paradise.
Ich habe zu atmen gewagt und zu warten,
Daß sich die Worte in Möwen und Krähen verwandeln
Auf dem Fels meiner Zunge. Let the Gods forgive what I
Have made: monsunene Schwingen der Lungen,
Ebben und Fluten des Bluts, einzehige Zyklone
Von Solarplexus aufkreiselnd und dreißig
Bis zwanzig krächzende Schornsteine wie Zähne.
Ich habe versucht, den Atem nachzudichten.
Den Kreisel aus baumlosen Blättern peitschte ich auf und wies
Auf den rauschenden Grund des Trichters, wo
Auch nichts ist oder das Gesetz des bebenden Blatts,
Das sein Abgefallensein zeigt. Aber ich versuchte,
Selber ein Blatt, einen Baum darzustellen.
Laßt es nun fallen, dieses Gedichtblatt. Do not move
aaaaaaaaaaLet the wind speak
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaathat is paradise
Gedichte wie Atemübungen
Wilhelm Bartschs erster Gedichtband – wenn man Poesiealbum Nr. 208 nicht rechnet – ist alles andere als ein Erstling im üblichen Sinne. Dieser Autor, der mit 36 Jahren an die Öffentlichkeit tritt, darf mehr erwarten als ein Schulterklopfen; in seinen Texten steckt die Frucht eines halben Lebens, einer historischen Generationserfahrung, einer vieljährigen Kunstübung. Es fällt nicht schwer, im Band Grundzüge und Tendenzen unserer Lyrik in den achtziger Jahren zu bemerken: Auch bei Wilhelm Bartsch finden wir den Gestus hartnäckigen Fragens nach Frag- und Befragungswürdigem unserer Zeit, nach geschichtlichen Haltungs- und Verhaltensmöglichkeiten des einzelnen als Individuum, Ent-Täuschung als notwendigen Vorgang schärferen Hinsehens auf Dinge und Prozesse, damit sie aus ihrer Vermitteltheit (Weltaneignung mehr über Wissen als über Erfahrung) herausgerissen und begreifbarer werden; wir finden das Lebensgefühl und Bewußtsein der Menschheitsbedrohung, das nicht in Fatalismus sich zu ergehen bereit ist, sondern aufschrecken will, gerade indem es mögliche katastrophale Konsequenzen menschlichen Handelns an die Wand malt; wir finden angesichts solcher Situation den inständigen Versuch neuer Standort- und Verhaltensbestimmung des lyrischen Subjekts und das Ringen um den notwendigen langen „Atem“, historisch wie künstlerisch gesehen.
Mit letzterem ist eine zentrale Besonderheit von Bartschs poetischer Produktivität benannt, sowohl thematisch als auch strukturell: das Gedicht begriffen als „Atemübung“ in mehrfachem Sinn. Wir kommen darauf zurück.
Wie bei anderen begegnen wir auch hier künstlerischen Verfahren, die mit dem Simultaneitäts- und Montageprinzip arbeiten, deren Handhabung immer auch viel über die Qualität von Haltung und sprachlicher Gestaltung verrät. Bartschs Muse rafft nicht die Widersprüchlichkeit der Welt in beliebiges Arrangement kleiner Schocks zusammen oder demonstriert Betroffenheit lediglich mit hilflos heruntergeklappter Kinnlade, der die Bilder halt- und formlos entfallen. Diese Texte, selbst da, wo sie apokalyptische Vorgänge beschwören, verfallen weder in hektische Fassungslosigkeit noch in statische Melancholie. Die Kraft des poetischen Talents erweist sich in der Gestaltung, die nicht bloße Formgebung bleibt, sondern jedesmal neu erworbene, zu erwerbende Bemühung um Gestaltbarkeit menschlicher Verhältnisse überhaupt, nicht nur des Kunstgegenstands im engeren Sinne, einschließt.
So wird man bald gewahr, daß das Motto von Erich Fried „Die Welt / macht mir angst / Sie ist schwächer / als ein Gedicht“ – keineswegs klagende Kapitulation vor einem Status quo oder gar Selbstbescheidung des Dichters, sondern ein großes antreibend-forderndes Motiv darstellt, eine Herausforderung auch an die Adresse des Lesers in doppelter Weise: als Bürger dieser Welt und als Empfänger der Texte, die diesem Motto produktiv zu begegnen suchen.
Die Weisen, auf die das geschieht, sind uns nicht unbekannt – Bartsch kommt ohne Neuerungssucht aus und leistet, vielleicht gerade deshalb, Neues –: Begegnung mit Landschaft als Begegnung mit Geschichte; das Heraufrufen historischer oder mythischer Gestalten. Wie bei anderen auch – Namen und Beispiele müssen hier nicht aufgezählt werden – meint das mehr als Auffinden historischer Spuren in Natur und Landschaft; mehr als das Aufblicken oder distanzierte Hinblicken zu großen Vor-Bildern. Bartsch ist zu wach und zu kunstbemüht, um dabei der Gefahr bloßen Vorzeigens und nivellierenden Aufreihens zu erliegen. Gedichte über, auf, an Landschaften sind bei ihm zum allerwenigsten Abschilderung von wie auch immer gesehener Natur. Wenn auch Gedichttitel oft wie Titel zu Werken der bildenden Kunst anmuten oder solche sogar zitieren (z.B. „Reinharz“, „Der Oybin. Caspar David Friedrich. Petrarca“, „Bauernkirche in Leubnitz“, „Saale bei Kröllwitz“, „Die Doppelkapelle in Landsberg“, „Uchtspringe“, „Der schiefe Baum“, „Wüste Mark Maltritz“ aus dem ersten Teil; „Hercules Seghers: Landschaft mit dem Wasserfall“, „Babesnauer Pappel“, „Im Hiadelske sedlo“, „Der Hauptmannsberg bei Feldberg“, „Mit der Brigade in Erfenschlag“, „Novembernacht in Ahrenshoop“ aus dem zweiten Teil), so erzeugen sie doch kaum ein visuelles Bild von der Architektur einer Landschaft, wenngleich sie oft von intensiver visueller Wahrnehmung und Beobachtung ihren Ausgang nehmen. Der durchdringend-sinnliche „Malerblick“ ist zu spüren; dennoch entspringen ihm keine „malerischen“ Bilder. Nicht mit visueller Evidenz will uns der Autor Geschichtlichkeit von Landschaft vorführen, hinter die das Subjekt gewissermaßen zurücktritt, sondern lyrische Subjektivität bekundet sich gerade im reflektierend-reflektierten Ergebnis intensiven Landschaftserlebens. Gegenstand ist das präzis ins Wort gebannte subjektive, auf Objektivierung ausgehende Verhältnis des lyrischen Subjekts zur Landschaft, ihre mehrseitige, vielschichtige Bewertung und damit zugleich mehr als Geschichtsträchtigkeit von Landschaft: Verarbeitung durch das historisch denkende Individuum, das sich um Begreifen seiner selbst als historisches Wesen bemüht, und zwar nicht nur als Gattungs- und soziales Wesen, sondern eben individuelles. Daher die Ferne zur Malerei bei aller scheinbaren Verwandtschaft mit ihr; daher auch die herausfordernde Wirkung auf den Leser, sich selbst als ein historisch Gewordener und Werdender zu konkreter Natur und menschlich „durchgearbeiteter“ (Braun) Landschaft – was oft heißt: zerstörter, gefährdeter – ins aktive Verhältnis zu setzen, ohne daß die Texte etwa dies verbal verlangten. Diese eigentümliche Wirkung scheint aus eben der Haltung zu resultieren, die das lyrische Subjekt selbst sehr ernsthaft und nachdrücklich, ohne jede Didaktik, bezieht, und sie stellt sich auch nicht sofort bei erster Lektüre ein, sondern eher leise, mit allmählich wachsender Unausweichlichkeit.
Bartsch gelingt es (damit ist nicht so sehr Vollendung gemeint als vielmehr Kraft ausdauernden Bemühens), Geschichtlichkeit von Individuum und bearbeiteter Landschaft als mehrschichtigen Wechselprozeß zu artikulieren, der nicht auf erwünschte Zwecke und Resultate, Endpunkte und Ergebnisse hinläuft, sondern stets neue Möglichkeiten produziert, die, vom Menschen durch sein Tun erzeugt, ihm und der Natur zum Guten wie zum Bösen auszuschlagen vermögen. Dadurch wird menschliche Verantwortung für Natur und sich selbst streng fühlbar als Verantwortung der Gattung Mensch wie des einzelnen Individuums und als Frage nach dessen Vermögen und Unvermögen, Macht und Ohnmacht. Auf diese Weise zwingen die Texte, jenseits von Idyllisierung wie von linearem Erfolgs- und Zweckdenken, jede Art von Folgen menschlichen Handelns in, an und mit Landschaft zu bedenken; so auch stellt sich der globale Aspekt noch des kleinsten räumlichen Ausschnitts her, der weit über bloße Reflexion von Ökologie hinausreicht.
Das große und wichtige Gedicht „Wüste Mark Maltritz“, das mit Schillers „Spaziergang“ Zwiesprache hält und zugleich den Titel für den ersten Teil des Bandes abgibt, rekurriert auf den biblischen Propheten Jeremia. Das Gedicht „Hercules Seghers: Landschaft mit dem Wasserfall“ (70f.) aus dem zweiten Teil legt dem Maler am Schluß in den Mund: „Ins / Rote Vlies des / Abends der Erde / sah ich und sah: / Das Baufeld war Wüste“, wozu eine Fußnote ausdrücklich auf Jeremia 4,26 verweist. Die Stelle im Alten Testament lautet:
Ich sah, und siehe, das Gefilde war eine Wüste; und alle Städte darin waren zerbrochen…
Nicht der „Zorn des Herrn“ aber, sondern der Mensch mit seiner Tätigkeit macht sein eigenes „Baufeld“ zur „Wüste“. Darüber wird nicht bloße Klage geführt, sondern der Gestus inständiger Warnung beherrscht die Gedichte dieser Art in beiden Teilen. Die Kunst hat sich dem „Abgrund“, der selbstgeschaffenen „Vorhölle“, dem „Brachfeld“, das doch Freiheit versprach, zu stellen und sie genau zu benennen. Auch wenn die barocke Vanitasformel zitiert wird – „Alles war schon mal da, nichts Neues / Unter der Sonne kann uns verbergen, / Daß auch der Fortschritt am Ende / Vor allem das Alter ist“ (43) – der Anspruch, nach Ursachen und Änderungsmöglichkeiten zu fragen, wird nicht preisgegeben:
Sollen wir deshalb… sagen:
Alle Kunst sei eitel?
Auf Zuständigkeit des Menschen für seine Verhältnisse wird insistiert:
Wir stehen
Auf dem Berg und halten die rauchgeschwärzten
Zerbrochenen Tafeln der Landschaft fest
In den unsichren Händen, die Inschrift
Ist unleserlich, das alte Gesetz
Ist bekannt: Es ist unser Sündenregister. (43)
Das Eröffnungsgedicht des Bandes „Erstes Refugium“ (9f.) beginnt erst scheinbar idyllisch, dann scheinbar nostalgisch erinnernd:
Weit hinten in der Kindheit, längst versunken,
Gab es drei Weiher und die kleine Wiese
Im Rufabstand. Sie sind im Wald ertrunken.
Dann fiel der Wald und wuchsen die Verliese
Der Wohnstadt. Ich war anderswo verlassen
Als dort, wo wir es, manchmal, Heimat nennen.
So mußte alles, selbst das Leid verblassen
Und fällt es schwer, sich heimwärts zu bekennen.
Wer will, mag hier Rilkesche Töne, Bechersche Verse mithören. Und es endet, nach der Reflexion neugierig-grausamer Knabenspiele („jeder von uns Mitleidlosen / Der Liebe… / Hat hier gewartet auf Undine“):
Drei Bombentrichter und ein Fliegergrab, die Lichtung:
So spielte ich und muß es seither wagen,
Am Rand des Tods zu lieben. Keine Schlichtung
Hilft mir seither, solch dünne Haut zu tragen.
Was dem Kinde die „drei Weiher und die kleine Wiese“ waren, in denen es im Tierreich nach den Geheimnissen der Liebe forschte, sind dem Manne Folgen kriegerischer Geschichte:
drei Bombentrichter und ein Fliegergrab.
Nicht bei den Molchen, sondern den Wasserwanzen hat er entdeckt, was auf ihn, den Menschen, verweist: den Liebestanz „stumm vor Traurigkeit und ungeheuer, vor Freund und Feind“, zwischen „Flugzeug Vogel“ und „Wasserpanzer Frosch“ – das Wagnis der Liebe am Rande des Todes. Nicht mehr an Rilke oder Becher erinnern Gestus und Ton der letzten Strophen, eher an Rimbauds „Schläfer im Tal“; die scheinbare Landschaftsidylle der Kindheit war schon Folge eines verheerenden Krieges; scheinbar natürliche Landschaftsform ist – erst dem Erwachsenen sichtbar – verdeckte Verheerung von Mensch und Landschaft, und die Verheißung künftiger Liebe ist schon im Bilde erfahrener Tierwelt, die zur Metapher hinüberwächst, als tödlich gefährdet vorgezeichnet gewesen. Wer solches inne wird, trägt eine „dünne Haut“, von keiner „Schlichtung“ zu beruhigen. „Wahrlich, / Welche Zeit heilt Wunden, wenn die Zeit in Wunden / Eilt“, heißt es in „Der Oybin. Caspar David Friedrich. Petrarca“ (16), einem Gedicht, das selbst die „Schlichtung“ des Reims durch Zeilenbrechung vermeidet.
Der Autor ist auch anderer Töne mächtig; so lohnte es nachzufragen, welche neuen Möglichkeiten er in der Rezeption antiker Autoren, z.B. der Episteln und Epoden des Horaz, entdeckt – Texte, die nicht so sehr Themen, Figuren, Motive als vielmehr Redestrukturen, Gesten und Formen für heutigen dichterischen Umgang erneut brauchbar machen; wie das elegische Versmaß des Distichon, ja sogar die Vergilsche Ekloge neu in poetischen Dienst genommen werden; oder wie mit dem japanischen Haiku, mit Mythologemen der nordischen Edda gearbeitet wird.
All dies übergreift beide Teile des Bandes, schafft Verklammerungen und Verweise verschiedener Texte aufeinander. So macht der Aufbau des Bandes sichtbar, daß sein Autor zäh immer wieder einige große Themen von neuen Seiten auf jeweils andere Weise angeht, weil sie ihn nicht in Ruhe lassen und er sie nicht abgearbeitet weglegen kann. Auch das bleibt nicht ohne Herausforderung an die Welthaltung des Lesers. So ist auch der Titel des zweiten Teils „Übungen im Joch“ übergreifend und folgerichtig als Gesamttitel gewählt. Das „Joch“ einer auferlegten, auf sich genommenen, auszubalancierenden schweren Last, zugleich die „Verbindung“ (etymologische Verwandtschaft mit „Yoga“; lat. „iugum“) wird zu einer Großmetapher, die mehrere Texte verknüpft: „Atemübung“ mit „Übungen im Joch“, aber auch mit „Lauchhammers Heldenrede“ und „Höllenfahrt. Nach Vergil, Dante, Marx“, Die Metaphernverflechtung von „Joch“ mit einerseits „Atem“ und andererseits „Feuer“ eröffnet den Gedichten einen ästhetischen Spielraum, der sie zu großer menschheitlicher Bedeutsamkeit befähigt. Solcher Versuch eines lyrischen Welt-Bildes verdient besondere Beachtung in einem Moment, da manchem die Welt noch immer mittels einiger herkömmlicher Bilder und Begriffe als im Wort meisterbar erscheint, anderen in Sprachlosigkeit zu versinken, in Partikeln zu zerfallen droht.
Das Gedicht „Atemübung“ (90) erscheint wie ein Gegenentwurf zu Rilkes Dinggedicht vom Panther. Auch hier ist die Faszination intensiven Anschauens gebändigter Kraft ins Bild gebracht. Nur daß es bei Bartsch in die Zucht des nur selten durchbrochenen Blankverses genommen ist und es sich um den „Löwen“ handelt, zwischen dem und dem als Ich ins Gedicht geholten Menschen allerdings keine „Stäbe“ zu bemerken sind. Die Gebärde des Tieres ist auch nicht Vergeblichkeit, sondern Kraftübung im Atemholen:
Ich seh den Löwen an, er mich, er sieht
Durch mich hindurch und von mir ab…
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… er steht
Und schweigt eine geschwungene Linie lang,
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… sein Blick
Wird mild. Er hebt sein Haupt, und fernes Donnern
Rollt an: Die Panther ducken sich,
…
Der Löwe wird zu Bronze, und von weither,
Aus ungeschlachtem Erz, fliegen heran
Posaunen: Ooommm!!, der Löwe atmet und übt
Den Löwen, seine einzige Asana,
Ooommm!!
…
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Die Hunde
Im Umkreis vieler Kilometer heulen
In ihren Hütten, blecken noch lange
Die Zähne, wenn der Löwe wieder liegt und halbschläft
Ein Auge, voller Ruh, auf uns gerichtet.
„Om“ ist Formel der grundlegenden Atemübungen des Yoga. Eine Fußnote vermerkt, daß diese Silbe in Indien auch feierliche Briefanrede ist. So klingt der Schrei des Löwen wenn er seine einzige Haltung (Asana) übt: er selbst zu sein. Nicht Wildheit wird als seine Eigenschaft herausgekehrt; „sein Blick wird mild“, wenn er das Haupt hebt und ruft. Aber seine „Anrede“ ertönt wie „Posaunen“ eines Jüngsten Gerichts, „Panther“, „Hyänen“ und „Hunde“ fühlen sich noch lange aufgeschreckt. Die Blickrichtung kehrt sich um, das Subjekt wird zum „Wir“: Während am Beginn das Ich den Löwen ansieht, behält er am Ende „uns“ im Auge; „wir“ sind feierlich angesprochen; der Löwe hat uns, atmend, gezeigt, was er zu sein vermag. Auch die Umkehrung des Betrachtenden zum Betrachteten findet sich bei Rilke; allerdings ist es hier nicht ein Kunstwerk, das „uns“ ansieht sondern ein mächtiges Lebewesen, der „Herrscher“ der Tiere.
„Atemübung“ ist hier, wie im Yoga, Probieren der Lebenskräfte, Sammeln des Vermögens, zugleich Korrespondenz mit der Welt, dem All (das Göttliche als religiöser Hintergrund des Yoga wird ganz ins Weltliche geholt). Indem der Löwe die Atemübung absolviert, tut er etwas, was nur der Mensch tut, sein Bild transportiert also mehr als zoologische Abschilderung: Übung einer mächtigen Kraft, die auch angewandt werden kann. Der intensive Blickaustausch zwischen lyrischem Subjekt und dieser Kraft, von keinem Gitter behindert, hat weniger an Drohung als an magischer Aufforderung.
„Übungen im Joch“ (108) führt im Rollen-Ich ungenannt Prometheus vor, „am Felsen zwischen Ost und West, / An der Kette zwischen Nord und Süd“. Ein- und Ausatmen mit der Silbe „Om“ und Yogahaltungen, darunter Totenstellung, Sonnengruß, Löwe, werden geübt. Auch hier geht es um Erproben und Wachhalten der eigenen Kräfte, diesmal des lyrischen Rollen-Ichs selbst: Reinigung der „Nüstern“ „in des Weltmeers Schale“ von der „Brandluft aller Welt“ beim Ausatmen; „Mut“zuwachs und „Ruh“ beim Einatmen: „Ich lebe.“ Das lyrische Ich vergewissert sich seiner selbst:
Mir und ewig hör ich zu,
Und mein Sonngeflecht, und, wolkenlos,
Klarheit wählerischer Wege: mein!
Wenn aber dieser Prometheus „entfesselt“ wird, bedeutet das „Selbstmord“ der „Abendhelden“; „dann hängt klirrend der Ring und leer: die Welt.“ Doch ihm ist viel Zeit gegeben für seine „Übungen im Joch“. Nicht Qual seiner Gefangenschaft, sondern Ausdauer im Üben der Kräfte ist Tenor des Gedichts; das Rollen-Ich wird dabei immer erneut seiner vielfältigen Kräfte gewahr. Seine Lage erscheint sogar als Bedingung für dieses Innewerden seiner selbst. Dasselbe Lebensgefühl artikuliert sich im Gedicht „Lauchhammers Heldenrede“ (101f.), in dem sich das Rollen-Ich – der Titel deutet es schon an – als Kollektivsubjekt darstellt. Es nennt sich einen „Ringer aus der Riege Laokoon“:
Mir fährt über die Schultern, würgt und zerrt
Das Röhrngewirr der alten Schlange.
Diesem Helden erscheint die von Ausbeutung befreite Arbeit keineswegs bereits als Reich der Freiheit; die Bedingungen der Industrie halten „den verstoßnen Schmiedegott“ im Würgegriff. Aber, er schafft sie sich selbst; sie sind, wie sie sind, Ausdruck seines Vermögens:
Doch irdisch-hinkend göttlich ist er immer noch,
Soweit er umwälzte das Erdenreich, sein Joch,
Und soviel Feuer hat er, als er angeblasen
In seinen Kokereien. Alle Straßen,
Wohin auch immer und woher in allerZeit,
Gehn nur durch uns. Wir bleiben immer, und bereit
Für nichts als uns. Das ist die Wahrheit, nackt wie Kohle,
der Dreck uralten Feuers…
Im Bild der Arbeit wird die „Atemübung“ dessen, der das „Joch“ trägt, Synonym für feuerentfachendes Leben.
Doch „Feuer“ – das ist auch, in dem poemhaften Gedicht „Höllenfahrt. Nach Vergil, Dante, Marx“ (104f.) der Handel, der sich „entfacht“ hat „mit eisigen Lohen“. Über die Rezeption von Vergils Aeneis, Dantes Göttlicher Komödie und Marx’ Kapital baut sich eine Metaphernkette auf, die den Weg von Menschheitsgeschichte als „Höllenfahrt“ zu markieren sucht. Dante „fand heraus: Der Weg aus der Hölle geht mitten hindurch.“ Und von Marx heißt es, sein Dante-Motto des Kapitals aufgreifend:
… so
ging er durchs selbe
Türchen hinein wie Dante in die höllische Welt
und der Schlüssel… lag im Schlüssel selbst: Er war eine Ware…
Bemerkenswert ist, daß die Dichter und der Gesellschaftswissenschaftler gleichermaßen in eine Ahnenreihe gegenseitigen Gebens und Nehmens gestellt werden; ihr Geschäft wird damit der menschheitlichen Zuständigkeit und Verantwortung nach als verwandt begriffen. Marx nun „fand gegen Dante: Die Welt war vor allem / ein Ort nicht der Betrachtung: Sie war eine seltsame Mischung… von Himmel und Hölle, man mußte sie nicht / auseinanderhalten wie Atlas mit Arbeit und Dante / mit Denken. // Dem Eingangsvers also folgte am Ende der Ruf: Wacht auf, Verdammte dieser Erde!, hier bring ich euch Licht in das Dunkel / eurer Sache, der Hölle…“
Die auch in sozialistischer Lyrik bereits traditionelle prometheische Feuermetapher erscheint hier nicht mehr nur als licht- und erkenntnisspendend, als Feuer revolutionären Kampfes; das „Feuer“ ist die „höllische Scheiße“, durch die der Mensch arbeitend, hindurch muß, ehe „später einmal, wenn die Welt eine Welt ist / … jeder der Menschen mit aufrechten Schultern mit erhobenem / Kopf allein noch den Himmel zu tragen haben“ mag.
Mit solchem Geschichts- und Gegenwartsverständnis zeigen sich Bartschs Gedichte eingestellt auf den „langen Atem“ historischer Prozesse, deren Verläufe zwar voraus-, aber nicht absehbar sind. Mit bloßer Euphorie über ausbeutungsfreie Verhältnisse ist dem poetisch nicht mehr beizukommen, was uns heute zu tun bleibt; und was dem Menschen selbsterzeugte Hölle ist, muß als solche dichterisch benannt werden, um hindurch- und herauszufinden.
Dorothea Gelbrich, aus Siegfried Rönisch (Hrsg.): DDR-Literatur ’86 im Gespräch, Aufbau Verlag, 1987
Unerhörte Nachrichten
– Wilhelm Bartsch: Übungen im Joch, Uwe Kolbe: Bornholm II, Volker Braun: Langsamer knirschender Morgen. –
Die in der DDR-Lyrik der achtziger Jahre ausgesprochenen Befindlichkeiten, die getroffenen Befunde über das Leben in unserer Gesellschaft, die Erkundungen des geschichtlichen Gattungszusammenhangs reflektieren in letzter Hinsicht miteinander verzahnte Spannungsverhältnisse, aus denen in je besonderer Weise Bilder von „Zwischensituationen“ – des Menschen der Sozietät, der Menschheit – gezogen werden. Das neuartige Bewußtwerden der Verknüpfung von Einzelschicksal und Menschheitsentwicklung ist viel nachdrücklicher als noch vor Jahren in die Texte eingeschrieben. Dies bedeutet gleichzeitig, daß die lyrische Äußerung nicht allein als Reflex unmittelbar in diesem Land gemachter Erfahrungen betrachtet werden kann. Das generell veränderte Lebensgefühl und das neuartige Zeitbewußtsein modifiziert auch den Gestus lyrischer Redeweise: Die Sprache wird zwingender nicht dadurch, daß sie appelliert und aufklärt, sondern dadurch, daß sie den Adressaten mit allen seinen Sinnen in den Diskurs einzurechnen versucht. Sie wird geschmeidig und vermeidet Eindeutigkeiten, setzt spielerisch verschiedenste Diskursformen gegeneinander und betont das Performative gegenüber dem Abbildenden, um dadurch weniger Beruhigungsmöglichkeiten, beispielsweise über den Schein trügerischer Katharsis, für den Leser zu lassen. Jedwede Gelassenheit wird abgewiesen. Die DDR-Lyrik in dieser Zeit weicht den „ungeheuren Widersprüchen unserer Epoche“ nicht aus, denen, wie Wolfgang Heise konstatierte, „Extreme der Erfahrung des Menschenmöglichen“ entsprechen:
Im Produktiven und Destruktiven, Human-Solidarischen und Bestialischen, in aktiver Gestaltungs- und Tatkraft einerseits, der Leidensfähigkeit und -geduld bis zur puren Opfer- und Objekthaltung andererseits, der Versteinerungs- und Erneuerungsfähigkeit.1
In diesen Spannungsfeldern tragfähige Sinnorientierungen zu gewinnen, die in Handlungsbewußtsein münden können, fordert vielfach ein radikales Neubedenken der Lebenskonzeptionen, der philosophischen, politischen, ethischen und ästhetischen Vorstellungen und Werte. In diesem Sinne versucht die Lyrik eingreifendes Denken zu stimulieren, freilich nicht aus der Gebärde überschauender Selbstgewißheit heraus – die mannigfachen Zeichen bohrender Ungewißheiten, tiefgreifender Unsicherheiten sind kaum zu überlesen; sie zielt aber wesentlich auf die Beförderung und Ausbildung von Konfliktfähigkeit. Es äußert sich in je eigenständiger Ausrichtung und individueller Verfassung vor allem „der einer Totalität der menschlichen Lebensäußerung bedürftige Mensch. Der Mensch, in dem seine eigne Verwirklichung, als innere Notwendigkeit, als Not existiert.“2 Nicht mit großem Kraftaufwand (wie noch in den sechziger Jahren), wenig durch eine „Allgemeine Erwartung“ (so ein Gedichttitel Volker Brauns aus den frühen siebziger Jahren) getrieben, eher tastend, zögernd, suchen die lyrischen Subjekte in den Gedichten Selbstverständigung im Spannungsfeld zwischen gemachten Erfahrungen und dem erhobenen Glücksanspruch, der Sehnsucht nach ungeteilter Sinnlichkeit, dem Plädoyer für menschliche Würde. Genauer wird deshalb geprüft, was die grundlegenden gesellschaftlichen Umwälzungen im einzelnen für die Weise des Zusammenlebens der Menschen erbracht haben; tiefenschärfer wird das Verhältnis von Erreichtem und Nichterreichtem im persönlichen und sozialen Leben, von Weltanschauung und täglich (d.h. im Alltag) geforderter Humanität, von kulturell-sozialen Bedingungen und moralischer Verantwortlichkeit beleuchtet. Beispielsweise signalisieren Gedichte Beunruhigungen darüber, daß durch das Gefühl sozialer Geborgenheit, grundsätzlicher Geregeltheit des Lebens unter Umständen die Fähigkeit zur kreativen Selbstbestimmung verkümmern kann, Gleichgültigkeit, Langeweile, Motivations- und Sinnverluste Einzug halten. Gedichte melden Einsprüche an gegenüber einseitigen Wertorientierungen an „abrechenbaren“ Leistungen zuungunsten der Ausbildung von Lebenskunst, Gefühlskultur, moralischer und ästhetischer Sensibilität. Bei alledem sind in der Dichtung der letzten Jahre mehr und mehr Fragen in den Mittelpunkt gerückt, die die Vermittlungen zwischen Subjekterfahrung, Gesellschaftsentwicklung und Weltprozessen betreffen: Welche Werte sind aufzurufen für ein Denken in Epochezusammenhängen, ein lebhaftes Durchfühlen der menschlichen Schicksalsfragen, ein Tätigwerden gegen die Vernichtungsgefahr? Die Erfahrung, daß die Geschicke des einzelnen unablöslich mit den Menschheitsfragen verbunden sind, spiegelt sich in einer Vielzahl von Gedichten nunmehr als unmittelbares Betroffensein, das auch die Betrachtung alltäglicher Dinge, das Denken an den geliebten Menschen, das Anschauen des gewohnten Lebenskreises verändert. Diese Öffnung zur Welt in der neueren DDR-Lyrik ist mit einer geistigen und moralischen Herausforderung – Robert Weimann sprach in diesem Zusammenhang von einer notwendigen Neubestimmung des Verhältnisses von Klassenidentität und Menschheitsschicksals3 – verbunden, die mit provinziellen Maßstäben nicht zu bestehen ist. Wenn z.B. Gedichte die Tatsache problematisieren, daß Welterfahrung zum großen Teil nur medial vermittelt ist und diese Vermittlung neben dem Hunger nach unmittelbarer Erfahrung auch die Gefahr der Überreizung, Abstumpfung, Manipulation zeitigt, sind die Texte doch gleichzeitig auch als Versuche zu lesen, Wissen, soziale Phantasie und Gewissen so zu aktivieren, daß ein Mehr an Halt gesucht werden kann im Strom einflutenden Geschehens, Halt aber auch gegen ein Aufreiben im Alltag.
Drei Lyrikbände, die jüngst publiziert wurden, sind uns willkommener Anlaß, diese aus gemeinsamer Forschungsarbeit bei der Sichtung der DDR-Lyrik in den achtziger Jahren erwachsenen Verallgemeinerungen zu überprüfen und darüber hinaus das Angebot der Lyriker so zu befragen, daß ihre „arbeitende Subjektivität“4 als unverwechselbare und unverzichtbare Stimme in den Meinungs- und Wertbildungsprozessen kenntlich gemacht werden kann.
Peter Geist / Christel und Walfried Hartinger / Klaus Werner, aus Siegfried Rönisch (Hrsg.): DDR-Literatur ’87 im Gespräch, Aufbau Verlag, 1988
I
Die Mitteldeutsche Tiefebene bietet sich dem Reisenden in der Gegend um Halle als industrielandschaftliches Flachland dar, rauchfahnengeschmückt und durchschnitten von schaumgekrönten Wasserläufen; unfeierlichem Gemüt wird also wenig Trost gespendet. Hier sind die Orte, denen der Wanderer Wilhelm Bartsch die topographischen Zeichen seiner Gedichtlandschaft entnimmt. Orientierungszeichen für den Leser, die den Einstieg in den Text erleichtern. Gedichtüberschriften lauten z.B. „Werktagsbus Zeitz – Halle“ (Übung im Joch, S. 29), „Saale bei Kröllwitz“ (S. 22), „Die Doppelkapelle in Landsberg“ (S. 43). Diese Texte beginnen so: „Die Hölle schon nicht mehr erwartend, / Macht sich’s die Seele in der Vorhölle gemütlich“ (S. 29); „Der Pegel der Lethe, Genossen: / Am Hals. Doch glaubt nicht, mir allein“ (S. 22); „Alles und letztlich zu Tode Erhobne / Hat seinen Ab-Grund“ (S. 43), und ebenda, einige Verszeilen weiter, heißt es:
Aber vielleicht
Ist schon die Halle des Hades gewachsen
Bis dicht unters schüttere Erdgrün der Landschaft
Voller vergeblicher Pumpen, und morgen schon
Bricht der erste der Ahnenden ein in die Stürme
Der Finsternis unter uns…
Zwischen Halle und Zeitz der Dantesche Limbus, die verdreckte Saale als Totenfluß Lethe, der Hades unter Landsberg – die Fläche wird Raum, da die Tiefe hinzutritt, und der Raum wird zugleich Projektionsraum der entwerfenden Subjektivität, die tief hinabgeht ins Dunkle: der Mythen, der Geschichte, des eigenen Ichs. Bartsch setzt immer wieder traditionsbeladene Symbolzeichen als „Wegemarken“. Er fügt sie in Entgegensetzungen zu relativ fest umrissenen Bedeutungskonstellationen, die emblematischen Charakter tragen. Die stets gegenständlich konkret und philosophisch verallgemeinernd evozierte Dimension der Höhe bzw. Tiefe fixiert er an Topospaaren wie Aufstieg – Fall, Arkadien – Hölle, Erhobensein und Zugrundegehen: „Das Erhobne geht / Zu Grund“ (S. 16) lesen wir, und in „Dressur“:
Die sich übern Abgrund neigen
Spürn, was Kunst vermag. (S. 23)
Aufschlußreich für die poetologische Konzeption ist der längste Text des Bandes, eine „Ekloge am Karfreitag“ (S. 31). In kunstfertig gemessener Rede wird ein Dialog zwischen dem „Dichter“ und dem „Versucher“ heraufgeführt. Der eine zunächst auf der Suche nach einem heutigen Arkadien, der andere als mephistophelischer Begleiter, der jenem karfreitags nicht die Reiche und Herrlichkeit der Welt, sondern das teatrum mundi mit seinen Schreckensarsenalen und ökologischen Realien vorhält. Er weist auf die gräsernen Hügel, „die sich eröffnen dem Wort, / Die einem Knopfdruck gehorchen wie / Drehbühnenscheiben und weichen: / Aufsteigt ein eiserner Wald mit eines Fixsterns / Macht!“ (S. 32), weist auf die „reinweißen / Schollen des Flusses, / Die nun Leuna verschickt zu dem arkadischen Fest“ (S. 35). In dieser Konfrontation, sehend, wie gleitend die Übergänge von der Idylle zur tödlichen Gefahr, wie sich „Verhängnis und lautere Zukunft“ (S. 36) vermischen, läßt Bartsch seine Redefigur für eine Poesie plädieren, der es um eine illusionsfreie schonungslose Durchleuchtung des Weltzustandes zu tun ist, die das Bedrückende, Schmerzhafte in diesem Erkannten, aber auch den Spaß am Wort nicht verleugnet. Übungen im Joch, das ernsthafte Spielen als Widerstand gegen die Ergebung ins Fatum, gegen Gesichtsverlust durch Geschichtslosigkeit, als Überlebensanstrengung (S. 36) auch. Das Dichten wird mithin weder als Erlösungsakt angesehen, noch das Gedicht als Ort, an dem sich epochale und existentielle Spannungen ins Erträgliche abmildern ließen. Das erste Gedicht des Bandes endet mit den Versen: „So spielte ich und muß es seither wagen, / Am Rand des Tods zu lieben. Keine Schlichtung / Hilft mir seither, solch dünne Haut zu tragen“ (S. 10), und der Bogen spannt sich tatsächlich bis zu den Schlußzeilen des letzten Gedichts, die das Hohelied Salomo paraphrasieren:
Denn im Maß noch Blut und Samen aufschäumen in
Meeren,
Steigt auch die Liebe hinauf, bleibt sie so stark wie der
Tod. (S. 111)
Nun könnte die Vorliebe Bartschs, den Erfahrungs- und Denkrohstoff in Gegensätze und lexikalisch in antinomische Wortsignale zu zerfällen, dem Eindruck konstrukthafter Dürre Vorschub leisten, zumal den Texten allemal anzusehen ist, wie bewußt sie gebaut worden sind. Gedichte, deren poetische Aussage zu einem Spiel mit einerseits – andererseits verschnitten ist, bekunden in der Regel die Einfallslosigkeit ihrer Verfasser und erzeugen gemeinhin Langeweile. Nicht so bei Bartsch. Denn die Wegzeichen können zwar freundlich Orientierungen erleichtern, doch um so mehr wird dann im Verslabyrinth das grimmige und heitere Spiel mit Wortbedeutungen, mit literarischer Tradition, immer mit dem Leser betrieben und also auch mal kräftig geirrlichtert wie in „Harzreise im Winter. Frei nach Goethe und Grog“. Man folge der Empfehlung, lese bei Goethe nach und werde mit einigem Spaß belohnt. Goethes „Harzreise im Winter“ hebt an:
Dem Geier gleich,
Der auf schweren Morgenwolken
Mit sanftem Fittich ruhend
Nach Beute schaut,
Schwebe mein Lied.5
Bartschs bösfröhliche Reminiszenz entbehrt nicht des parodistischen Elements, geht allerdings, hintersinnig, in der Parodie nicht auf:
Einem Schraubkampfhuber gleich,
Der über Sperrland und Niemandsgebiet
Mit herrschenden Fittichen donnernd
Auf Sichrung und Ordenheit achtet,
Liedre mein Kreis! (S. 40)
Dieser Erzpoet versteht es in der Tat, gedankliche Schärfe und wuchernde Sprachphantasie, prosodische Strenge und opulente Metaphorik, verstechnische Raffinesse und spielerische Leichtigkeit zu vereinen. Hier hat Dichtung mit Dichte zu tun, wobei stets noch der sinnliche Glanz nachvollziehbarer Wirklichkeitsverweise erhalten bleibt, aber verbunden mit philosophischer Tiefenprüfung, literarischer Anspielung und reflexiv-assoziativer oder metaphorischer Entgrenzung. Deshalb wird, wer nach sentenziösen Einhelligkeiten sucht, enttäuscht werden müssen. Souverän bedient sich der Autor eines weitgefächerten verstechnischen Instrumentariums: Im Band finden sich Sonett, Haiku und einfache Strophenformen, starr trochäisch gefüllte Zwei- und Dreiheber (S. 23), Distichen, Hölderlinsche Odenstrophen (S. 38), ausgreifende Langzeilen, der Vers libre… Souverän meint dabei vor allem das gründliche Auskosten aller Möglichkeiten von Metrum, Rhythmus, Euphonie, im Unterstützen oder Unterlaufen (z.B. S. 56–59, 65) der Semantik jene Vielschichtigkeit der poetischen Botschaft herzustellen, die erst ihren Reiz bestimmt. Auch darin liegt wohl begründet, daß Bartsch die Gratwanderung zwischen Pathos und Ironie, heiterer Gelassenheit und existentiellem Ernst fast immer gelingt. Hierin hat er durchaus etwas mit dem poeta doctus der DDR-Lyrik, Karl Mickel, gemein, und nicht beiläufig zitiert der Jüngere aus „Inferno XXXIV. Für Kirsten“ in seinem Großgedicht „Höllenfahrt. Nach Vergil. Dante. Marx“, um hinzuzusetzen:
Der
Weg aus der Hölle geht mitten hin-
durch. (S. 104)
Zahlreiche Gedichte des Bandes konfrontieren denn auch mit den neuen und alten Schreckensgründen der Menschheit und des Menschen, eben damit „sichs die Seele“ nicht schon „in der Vorhölle gemütlich“ (S. 29) mache. Da keimt im sonntäglichen Kleinstadtidyll aus Sinnleere und Langeweile die Bereitschaft zur Teilhabe an jedwedem Verbrechen (S. 92), da wird aber auch eiskalter Schrecken aufgezeichnet, den schlaflose Nacht gebiert:
Nacht, in der du nicht schlafen kannst, Nacht,
Da dein Fleisch Furcht heißt, erkaltetes
Fett im Laken, wenn du lauschst mit Fledermausohren
Dem Echo deiner unsichtbaren Schreie (S. 37).
Hier wie in anderen Stücken gaukeln sich die heidnischen Gottheiten aus nordischen Sagas in den Imaginationsraum des sprechenden Ichs. Über diese Nachtmahren wird z.B. in „Novembernacht in Ahrenshoop“ (S. 109f.) das eigentlich Unfaßbare, das Weltende in der atomaren Hölle, als direkt körperlicher Schauder bis in die Fingerspitzen hinein spürbar. Der Tod, der kollektive wie der des einzelnen, erhält in diesen Gedichten ein Gesicht, so verfratzt es auch mitunter erscheinen mag. Daß die eingangs vorgesetzte Maxime „am Rand des Tods zu lieben“ kein deklamatorischer Vorsatz bleibt, beweist sich insbesondere in jenen ganz unspektakulären Gedichten des Bandes, die so etwas wie Nekrologe auf Menschen darstellen, die manchmal schon zu Lebzeiten vergessen werden.
So kam mein Onkel mit den sanften Augen
Hinterm grellen Aspik seiner Brille
Zu mir und klopfte an die Tür
Zum Dienstraum dieses Gedichts (S. 21),
heißt es in „Vom Tod des Onkels“, das der Würde (auch im Tod) anderen Lebens Sprache gibt, ohne die Trauer, auch Distanz des Sprechers zu verschweigen, die sich im Bedenken eines ereignisarmen und fast austauschbaren Daseins herstellt. Enjambement und das eingefügte Adverb „auch“ unterlaufen in den Eingangsversen behutsam eine bloß kontemplative Einfühlung, gleiten jedoch nicht in Zynismus ab:
Nach dem Tod meines einsamen Onkels blieb
Nichts. Sein Haushalt auch über der Erde
Wurde aufgelöst. (S. 20)
Oder es flicht der penibel Berichtende in kaum noch überschaubare Satzkonstruktionen Metaphernkaskaden Poescher Abkunft („Der Tod aus Heiligenbeil. Käthe Jahn zum Gedenken“ (S. 25), daß es kalt den Rücken herunterlaufen kann. Und immer wieder gerät jene „Vorhölle“ zwischen Buna und Halle ins Blickfeld, wobei Bartsch sehr wohl weiß, daß larmoyantes Beklagen der Naturzerstörung in der Literatur auch seinen modischen Aspekt haben und also das aufnehmende Gemüt im schnell erzielbaren Konsens beruhigen kann. Er findet einen Ton beherrschten Ingrimms, in dem das Groteske ins Schauerliche changiert, sei es über originelle Alliterationen (S. 22), sei es über – im Sinne des Wortes – gespenstige Attribute und Umstandsbestimmungen:
Abends quoll manchmal ein Rauch giftiger Mücken heran
Aus dem schon stockenden Brei abgeschlagener Arme des Flusses.
Kalkweiß warn Weiden erstarrt, grabhoch verblutete Mohn.
Auf der silbernen Hölle zuckten die Flammen Verlaßner
In den Ruinen zur Nacht. Hier war die Heimat, sein Heim,
Ehe er abging, sagte der Kerl mit der brennenden
Antwort (S. 57).
Das Wort „Heimat“ taucht im übrigen mehrfach auf, immer in Verbindung mit ihrem wirklichen (S. 46, 24) oder befürchteten Verlust. Aber so, wie die Gefahr eines Endes der Natur mit der eines Endes der Geschichte zusammengedacht werden muß, weitet sich die Heimatvorstellung notwendig ins Menschheitliche. Wilhelm Bartsch liefert in einer Reihe von Gedichten (S. 80, 95, 104, 109) Epochenbefunde, indem er ineinanderstürzende Bilder von geschichtlichen, heutigen und mythischen Höllen und ihren wechselnden Fürsten beschwört. Im „Römisch-Irischen Dampfbad. Nach Dante“ zwingen sich dem Sprecher nicht nur die verschiedenartigsten Peinsamkeiten an Danteschen Straforten, die Geschichte von Menschheitsverbrechern (S. 96) in die Behaglichkeit des Dampfbades, es ist auch ein Wechselbad zwischen Entsetzen und dem Ergetzen, letztlich nicht nur heil, sondern gereinigt entronnen zu sein. (S. 97) Nun, die Ironie ist kaum zu überlesen, und aus ihr spricht das Wissen um die jahrhundertelang ausgebildete Fähigkeit zum Vergessen und Verdrängen, die sich potenziert in der teilweise gelungenen Absorbierung des Schrecklichen durch die Unterhaltungsindustrien des zwanzigsten Jahrhunderts. Und doch: „Da ist keinerlei Hinterland mehr auf / Der Erde (und sie bewegt sich doch!) / Da gibt es kein Entkommen, keinen / Gott aus dieser Maschine: Die feurigen Eisenwände / Rücken auf uns, und selbst die Grube, selbst das Pendel / Sind keine Erlösung mehr“, heißt es in „Die Inquisition. Nach Prokofjew, 3. Sinfonie c-moll“. Ich meine, hier liegt auch einer der Gründe beschlossen, warum Bartsch immer wieder auf die großen literarisierten Schreckensorte als höchst aktuelle Sinnbilder zurückgreift. Denn der Hades (vgl. z.B. den Orpheus-Mythos, die Begegnung des Odysseus mit den Schatten), der Golgatha-Weg Christi oder die Danteschen Höllenkreise sind nicht nur Orte der Verdammnis, sondern gleichermaßen solche der Erkenntnis, der Läuterung, der Warnung. Insofern sprechen die Texte auch auf jene Hoffnung zu, die nur in uns selbst liegt und begonnen hat, mit dem „Wacht auf, Verdammte dieser Erde!“ „Licht in das Dunkel / eurer Sache, der Hölle“ (S. 105), zu bringen. Bartschs Kunst-Stücke sind Übungen im Joch, und das heißt auch: Spielübungen, um Handlungsräume zu erweitern, ohne die Grenzen zu verkennen. Zudem ist das Wort „Joch“ mit einer Doppelbedeutung belegt (im Kontext asiatischer Denkwelt im Sinne von Yoga = Verbindung mit dem Göttlichen, vgl. auch das gleichnamige Titelgedicht und die Meditationstexte S. 89, 90), die auf die in hiesigen Gefilden wenig sorgsam erprobten individuellen Möglichkeiten aufmerksam macht, bei Sinnen zu bleiben, nicht im Überdruck der Verhältnisse vollends das Gleichgewicht zu verlieren. Als ginge es nicht um die Lotung aller Chancen, das Menschliche zu befördern – in der Erweiterung des eigenen Freiraums der Sinnerfüllung wie im gemeinschaftlichen Widerstand gegen den Untergang. Das Gedicht „Die Inquisition“ endet programmatisch:
Aber schon einen Schritt vor uns
Beginnt das Paradiso, und es endet erst
Einen Schritt hinter uns.
Hier meine Hand, Edgar Allen, und hier, Sergej,
Meine andere für eine Kette aus Menschen.
Peter Geist, aus Siegfried Rönisch (Hrsg.): DDR-Literatur ’87 im Gespräch, Aufbau Verlag, 1988
In rauchverzehrter Ferne
– Dankesrede zur Verleihung des Walter-Bauer-Preises. –
Sie werden es einem, der von Haus aus vor allem Lyriker ist, gewiß gestatten, sogleich mit einem Gedicht zu beginnen, zumal es, ganz en vogue, aus dem ersten Sommer dieses neuen Jahrtausends ist, trotzdem aber glatt fast ein Jahrhundert überspringt, um jemandem die Hand zu reichen, der uns hierher gerufen hat an einen Ort, der schrecklich und gut genug war für einige seiner besten und beständigen Gedichte. Mit meinem folgenden Gedicht grüße ich Walter Bauer:
ZEITSPRUNG
Der erste Kraftwerkschornstein von Trotha knickte
da hatte er eins in sein Knie und krisch mit der Lunge
und klackerte tausendezieglicht die Rauchsäule runter
den zweiten durchröntgte ein Blitz und er knallte und brüllte
was Aufrechtes raus aus der toppschwarzen Rußflüstertüte
er spie einen häßlichen Sprechpilz dann war er gleich ganz weg
Nummer drei aus Beton und mit Eisen bereift grunzte nur
indem er zwei Superbeben durchstand aber abends
um sechs und ohne Claqueure fiel er das Zifferblatt
des Himmels gen Morgen durchmessend von selbst aus der Zeit
als erleuchteter Zeiger der Länge nach hin und da kroch gleich
ein ganzer Gebirgszug aus Quadern und Fesseln er schoß noch
vom bebenden Boden eine pompöse Salve aus Qualm ab
bis über die Stadt und da war für mich jäh auch das neunzehnte
Jahrhundert vorbei und im einundzwanzigsten stand ich
Bleiben wir ein wenig bei jenem „Zeitsprung“, den ich beim Schreiben des Gedichtes neu erfahren hatte. Was ist da eigentlich alles in diesem Gedicht passiert, außer daß ich ein mit den Jahren untrügerisches gutes Gefühl dafür hatte, es sei mir geglückt, ja nahezu widerfahren? Ich nahm es also genauer unter die Lupe, und das heißt, ich begann mit der Feinarbeit der Korrekturen. Die Helden dieses Gedichtes, soviel war ja mal klar, sind Schornsteine, sehr bekannt gewesene Schornsteine. Sie gehörten als ein Stück wenn auch problematischer Heimat und als mehr oder weniger bewußt wahrgenommene Zeichen zum Erfahrungshorizont jedes Bewohners des mitteldeutschen Zentrums Halle. Ihr Verschwinden trägt alle Merkmale einer Hinrichtung. Was da abläuft wie ein Film, ist auch ursprünglich ein Film gewesen, einer, den ich vor Ort des Geschehens auf Video gebannt habe und erst vier Jahre danach in dieses Gedicht. So herum läuft das heute ja oft. Was der Film allerdings nicht zeigen kann, steht in den letzten beiden Gedichtzeilen geschrieben:
… und da war für mich jäh auch das neunzehnte Jahrhundert vorbei und im einundzwanzigsten stand ich
Die Exekution der Trothaer Kraftwerk-Schornsteine fand nun aber im Juli 1996 statt, also noch im 20. Jahrhundert. Welche menschliche Wahrheit ganz im Sinn Walter Bauers soll denn in dieser Unschärferelation, um einen Begriff der Quantenphysik zu gebrauchen, nun liegen? Zumal der lyrische Erzähler, den man, um bei der Wissenschaft zu bleiben, auch den Beobachter oder den Leiter der Versuchsanordnung nennen könnte, hier nur ein einziges Mal „ich“ sagt, und dieses „ich“ wird auch noch von der daktylischen Kette der letzten Zeile so gut wie verschluckt, es kommt also gar nicht richtig dazu, überhaupt „ich“ zu sagen. Aber: Dieses „ich“, es ist immerhin das letzte Wort dieses Gedichtes. Es verkündet nämlich seinen Standpunkt. Es macht, oder besser: es erfährt einen Zeitsprung, und zwar einen ganz kolossalen. Ein ganzes Jahrhundert wird da mit der Sprengung der Trothaer Schornsteine, so kommt es nämlich dem „ich“ vor, einfach übersprungen. Genauer gesagt, sind es die 52 Jahre einer historischen Falle, einer Sackgasse der Geschichte, in der auch der mitteldeutsche Raum, sonst ein Gebiet der Neuerungen und Revolutionen, sich so lange befunden hatte und selbst in dieser Sackgasse noch seine alte Innovationskraft nie ganz verloren hatte. Und wenn man jetzt, wie man es mit einem Videofilm dieser Art ja auch oft tut, zurückspult und das Ganze öfters in Zeitlupe abspielt, dann merkt man, daß diese drei Schornsteine nicht nur Sinnbilder erfolgreicher, aber auch für Land und Leute folgenreicher Arbeit gewesen waren, sondern noch in ihrem Sterben auch von jenem Geist oder Ungeist und von jenen Ideologien ihrer Bauherren und Betreiber zeugten, die ihren Urgrund schon im 19. Jahrhundert zeigten. Besonders Schornstein Nummer drei hat einen pompösen Abgang durch fast die Hälfte des ganzen Gedichtes in siebeneinhalb Zeilen, und wenn das Gedicht schon aus ist, dann schwebt noch seine abgeschossene Qualmwolke lange über der Stadt, vielleicht weitere siebeneinhalb Zeilen lang, diesmal allerdings in unsichtbaren Leerzeilen, und die befinden sich nun, wenn das Gedicht seine Sache gut gemacht hat, in Ihren Köpfen. Was sehen Sie da noch bei dieser Gelegenheit? An welchem Geschehensrand steht denn zur Zeit Ihr „ich“? Haben auch Sie Abrißarbeiten getan oder hinnehmen müssen, weil dies doch anscheinend so unabWENDbar hinzunehmen war? Sind Sie nun wirklich die Damen und Herren über die Arbeit Ihres eigenen Lebens geworden in den letzten zehn Jahren oder haben noch Hoffnung, es zu werden? Aber in Wirklichkeit, geben wir es zu, haben wir vor allem getan, was man, wie man so schön sagt, „sich durchschlagen“ nennt, und das klingt immer nicht gerade brüderlich im Sinne Walter Bauers.
Das ist ungefähr, aber nicht von ungefähr, der Stand der Dinge, Genossen. Oder wie unser aller Freund Joseph Freiherr von Eichendorff so schön sagte:
Auf dem verfallenen Schlosse
Wie der Burggeist, halb im Traum,
Steh ich jetzt ohne Genossen
Und kenne die Gegend kaum.
So steht es jedenfalls auch in jenem berühmten Gedicht, das jeder, allerdings nur zwei Strophen lang, kennt, und das, Sie wissen schon, immer an der folgenden Stelle abgebrochen wird: „Und seitdem in allen Landen / Sah ich nimmer die Welt so schön!“ Das Gedicht heißt übrigens, was ja auch kaum einer weiß, „Bei Halle“.
Aber ich war immer noch nicht fertig mit dem Nachdenken „auf dem verfallenen Schlosse“ einer abgedankten Fabrik, und „wie der Burggeist halb im Traum“ wieder verschwindet, senkten sich die Rauchschleier, und dahinter wurde zumindest eine Frage sichtbar, eine Frage, um die sich alles, auch dieses Gedicht, dreht, und jetzt komme ich endlich auch bei Walter Bauer an, um ihm die Hand zu drücken.
Haben Sie nicht zum Beispiel auch, wenigstens einmal zwischen den Zeilen und vielleicht ganz unbewußt, vielleicht ab der dritten Schornsteinsprengung, das Signal eines Sprengmeisters gehört? Oder in der unbenannten und rauchverzehrten Ferne Männer mit Schutzhelmen gesehen? Es ist wie mit einem Vexierbild, das den ganzen Rahmen überlebens-, ja wahrlich überlebensgroß sprengt. Es ist die nun, im 21. Jahrhundert, verdämmernde Gestalt des Arbeiters. Und wenn Walter Bauer als ein nahezu singulärer Fall in der modernen deutschen Literaturgeschichte die menschliche Tragödie einer aus dem Boden förmlich hervorgestampften chemischen Industrie geschrieben hatte – Hier würde die Erde vernichtet, um sie dann zu düngen, meinte Joseph Roth in seinem Mitteldeutschen Tagebuch –, so sehe ich heutzutage niemanden, mich natürlich eingeschlossen, der auch die Tragödie schreiben könnte von der Abdankung des Arbeiters, von seinen letzten Arbeiten, die darin bestanden, sein eigenes Feld zu beräumen bei einer traurigen Arbeit, die schon teilweise wieder Arbeitsbeschaffungsmaßnahme hieß und aber Arbeitsabschaffungsmaßnahme bedeutete, so in Leuna, so in Buna, so in Bitterfeld und Wolfen und so in radikaler Weise im gesamten Mansfelder Land. Das Epos dieser verlorenen Generationen der Arbeiterklasse hat noch keiner geschrieben, am ehesten kommt dem noch der frischgebackene Georg-Büchner-Preisträger Volker Braun nahe. So nämlich ist das eigentlich mit diesen Zeitsprüngen. Der unverkennbare Fortschritt, das teilweise Wiederaufblühen der mitteldeutschen Erde und Landschaft, wie es so selbst Helmut Kohl nicht erahnt haben dürfte, hat auch einen hohen, mittlerweile sogar tragischen Preis. Wenn Walter Bauer hier und heute leben würde – und das ist bei einem so geradlinigen Dichter und Menschen wie ihm keine Spekulation –, würde er mit seinem Wort auf der Seite der nun Zehntausenden Herausgefallenen stehen, und er würde sie auch gar nicht herausgefallen nennen, sondern: ausgestoßen. Dessen bin ich mir sicher wie nichts.
Er würde auch jene heulenden Horden mit dem Stiefeltrittkodex der Berserker als die schwarze Gefolgschaft des Sturmstaffelgottes wiedererkennen, als jene Wilde Jagd auf alles Andersgeartete, ja Lebendige überhaupt, auf das Herbstlaub der Kultur und der Sitten. Es sind vor allem die Kahlschläge und Ödfelder nach dem unwiederbringlichen Sommer der Arbeit, wo der einäugige Gott mit seinen Totenstaffeln auf Jagd zu gehen pflegt.
Würde Walter Bauer heute noch dieses schöne und uralte Land im gebeutelten Herzen Deutschlands preisen, das er einmal so geliebt und auch in bleibenden Versen und Worten beschrieben hatte? Würde er es tun können mit seinen schlichten Worten, in jener „literarischen Anständigkeit“, die der sonst sehr kritische Karl Krolow einst so zu rühmen wußte? Würden solche Worte heute noch helfen gegen diese katalaunischen Brüder im kalt gewordenen Himmel auf Erden und vor allem gegen all die vielen Biedermänner und -frauen an ihren heimischen Herden, die ihnen die Brandsätze liefern? Ich glaube, ja. Vielleicht sogar mehr denn je.
Aber vor allem und zuallererst würde er wiederum die Stimme sein der schuldlos auf die Abstellgleise der Gesellschaft Abgeschobenen, so, wie er einstmals die „Stimme aus dem Leunawerk“ war.
Und er würde trotz alledem nicht ohne Hoffnung sein angesichts der neuen Glaspaläste des Reichtums und es mit der großen Ricarda Huch halten, die einmal, auf Halle, aber somit auf ganz Mitteldeutschland bezogen, gesagt hatte:
Der Prunk der Höfe hielt sich in Halle nicht; es war eine Stadt der Arbeit und ist es geblieben.
Manchmal hat es allerdings den Anschein, daß heutzutage Leute mit Grundsätzen und Idealen wie Walter Bauer ebenfalls zu einer untergegangenen Klasse gehören. Aber manchmal lese ich auch schon dieser Tage wieder Sätze, die mich aufhorchen und auch an den kanadischen Literaturprofessor Walter Bauer denken lassen, etwa wenn ich im jüngst erschienenen Buch des Österreichers Christoph Wilhelm Aigner, es ist eine Poetologie und gleichzeitig eine Art Tagebuch in Sachen Lyrik, folgendes lese: „Ein Dichter steht auf der Seite der Hilflosen, ob er will oder nicht, oder er ist kein Dichter.“ Hätte ich Ihnen nun gesagt, dieser Satz stünde bei Walter Bauer, sie hätten es hundertprozentig geglaubt. Und wären sogar damit noch im Recht gewesen. Freilich: Dichter und Autoren mit alten, aber keinesfalls überflüssig gewordenen Grundsätzen haben es schwer in dieser Spaß- und Konsumgesellschaft, in der scheinbar nur noch das Götzenbild des Erfolgreichen zählt, und manchmal in dieser Zeit der Neuen Beliebigkeit und Unübersichtlichkeit gehen die Bücher und Worte von Wert sehr seltsame und manchmal sogar wundersame Wege.
Davon will ich Ihnen zum Schluß eine Geschichte erzählen, aber zuvor will ich Ihnen, natürlich mit den Worten Walter Bauers, zeigen, wie seltsam es schon zugehen kann, bis ein Buch überhaupt entsteht:
Ein Manuskript war nicht nur eine größere Anzahl von beschriebenen Blättern. Es war etwas Lebendiges. Tage und Nächte waren hineingegangen, Gedanken, aufblitzende Bilder, Gesichter, Stimmen. Ein unbeschriebenes Blatt glich einem leeren Feld, in das man eine Art von Saat warf; die Samenkörner waren die Worte. Ein Satz bestand aus mehreren oder vielen Worten, die sich einem bestimmten Rhythmus unterwarfen, er war ein Organismus, der atmete und sich bewegte, und Atem und Gang veränderte, wenn man gewisse Worte umstellte. Ein Satz konnte wie ein Gesicht Freude und Trauer zeigen, er konnte flüstern, singen, schreien, und stumm werden. Plötzlich schien aus einem Satz alles Leben entwichen zu sein; er wurde zu einer leeren, grauen Hülle. Dann saß man vor dem Blatt und suchte nach dem Wort, das die Hülle wieder mit Leben füllte. Man mußte manchmal suchen, um die richtigen Worte zu finden, mit denen man das Morgenlicht über einem See, die Farbe von Blättern im Herbst, das Donnern eines Waldbrandes fassen konnte. Schreiben war schwere Arbeit, es war Freude, Erschöpfung, äußerstes Wachsein und zugleich eine Art Traum; und dann war alles beendet, das Manuskript abgeschlossen und abgeschickt; ein Freund war gegangen.
Das alles hatte er in den vergangenen Monaten angefangen zu begreifen. Um gut zu schreiben, mußte man etwas von Worten wissen, und je mehr Worte man besaß, um so besser war es für ein Buch. Immer wieder las er in dem Wörterbuch der englischen Sprache, das er jetzt besaß, er schrieb sich Worte in ein kleines Notizbuch, die er in Zeitschriften und Büchern fand. Er wurde des Lebens von Worten bewußt und war davon so fasziniert, daß er einmal seinen Federhalter aus der Tabakdose füllen wollte. Was für ein Jäger war er geworden!
Soweit Walter Bauer, und jetzt die Geschichte, und zwar wieder eine mit Videos. Vor knapp zwei Wochen holte ich aus der Videothek den neuen Film von Richard Attenborough. Er heißt Grey Owl, und den Hauptdarsteller dieses Films kennen Sie alle, es ist der neue 007-Mann, der Superstar Pierce Brosnan. Grey Owl, also Grau-Eule, ein Ojibwa-lndianer, war in den zwanziger, dreißiger Jahren einer der ersten Vorkämpfer des Umweltschutzes. Eigentlich war er aber gebürtiger Engländer, nichtsdestotrotz rechnete ihn die nordamerikanische Indianerbewegung ganz selbstverständlich zu den Ihren, so, wie der gebürtige Merseburger Walter Bauer schließlich ganz selbstverständlich ein kanadischer Staatsbürger geworden war. Sehen Sie sich diesen Film mit Ihren Kindern an. Sie werden es Ihnen ebenso danken wie für alle vier Harry-Porter-Bände, die Sie ihnen gekauft haben. Einige Tage später sah ich 007 Pierce Brosnan in einer Buchhandlung wieder, nämlich auf einem Buchtitel, natürlich Grey Owl, Sie wissen schon, diese Mode seit einigen Jahren, auch das Buch zum Film zu liefern, die ich eigentlich nicht mitmache. Dann sah ich eher zufällig, und zwar ungewöhnlich klein gedruckt, nur so groß wie die Augenbraue von Pierce Brosnan, den Namen des Verfassers. Da habe ich mein erstes Buch zum Film überhaupt gekauft. Es ist von Walter Bauer. Die Stelle über die Arbeit des Schreibens, die ich Ihnen vorgelesen habe, ist aus diesem Buch. Ich fand sie bereits beim Aufblättern in der Buchhandlung. Ich danke Walter Bauer dafür, daß er mir seit nunmehr zwei Jahrzehnten geholfen hat, in dieser Region eine Heimat zu finden.
Wilhelm Bartsch, neue deutsche literatur, Heft 536, März/April 2001
WILHELM BARTSCH
Hilfestellung
„Was soll ich da drauf sagen?“
„Nix. Außer daß sie groß sind.“
„Ja bloß. Ich hab nichts davon, so zu antworten.“
„Brauchst Geld? Ist es das? Sinds die Schulden?“
„Ich brauch was für uns. In dieser Zeit. Etwas Kuschliges zwischen kalten Bäumen.“
„Du hast Fieber.“
„Ich hab dich oft belogen. Das hab ich.“
„Bist nicht der für den ich dich halte?“
„Bin kein anderer.“
„Bald bin ich 21. Dann baue mir ein Nest.“
„Nest?? Bin Sozialist!!“
„O bleib liegen. Du darfst dich nicht erheben.“
„Muß. Wir sind mir nie einerlei. Raus aus dem Museum. Rein in den Kommunismus.“
„Ich würde ja gerne. Aber.“
„Ums verrecken kein Aber.“
„Darin einiget uns die Einigkeit.“
„Will Kartoffelsalat. Los.“
„Ich bin für Würstchen zuständig hier.“
„Geb sie um des Himmels willen. Mit Scharfsenf.“
„O wie lustig es uns kitzelt.“
„Ja. So soll es ewig bleiben.“
„Laß mich. Nicht schon wieder.“
„Ich will mit uns richtig dich verlunchen du.“
„Nicht wehtun. Hörst du mir uns warnen.“
„Es soll mir am wir nichts fehlen. Wehtun gibt es am Dönerstand zum halben Preis.“
Sagt es und versucht einen säuerlichen Aufstoß zu zügeln.
Peter Wawerzinek
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Christian Eger: Alles spricht
Mitteldeutsche Zeitung, 2.8.2020
Fakten und Vermutungen zum Autor
Porträtgalerie: deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口


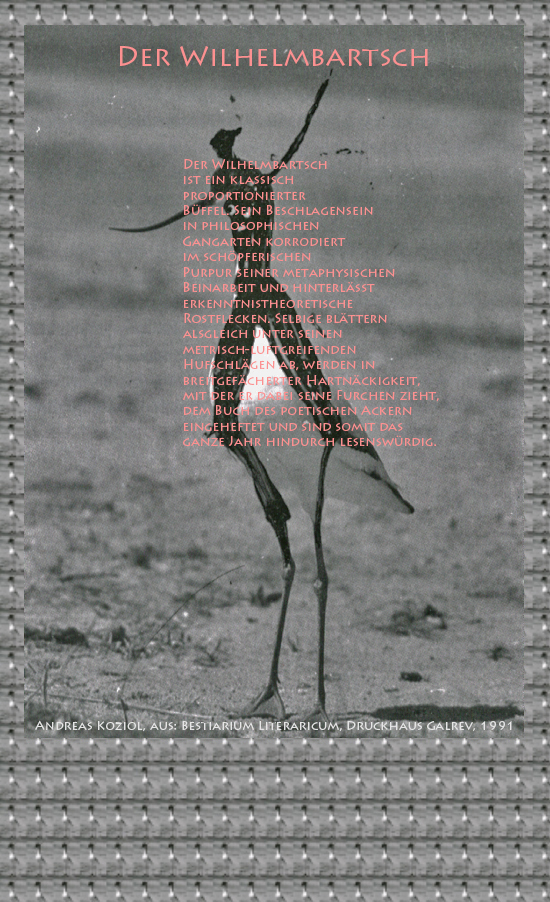












Schreibe einen Kommentar