Kurt Drawert: Zweite Inventur
DAS SONETT
Gereimte Thesen quergestellt,
Aus eins mach zwei, dann füg’s zusamm’,
Mit List und Leim und Schleim und Schlamm,
Damit’s am Ende feste hält.
Ach all die Regeln, all die Norm,
Die baun zur Harmonie den Müll,
Der letztlich niemals passen will
Und doch sich biegen läßt zur Form
Durch den Betrug von höhrer Art,
Als ließe sich die Welt verwalten,
Als Ganzes in den Händen halten.
Ein Spiel, ein Trick, die Form Verrat,
Denn alles Leben will sich spalten,
Will Brüche, Löcher, Kanten, Falten.
Lektüre
1
Er ist, wie ich, Dresdener und lebt, wie ich, in Leipzig. Kennen lernten wir uns 1983 in dem kleinen Dorf Wuischke in der Oberlausitz, wo er eine namhafte Dichterin besuchte, es aber auch nicht versäumte, einmal bei mir hereinzuschauen. Es geschah, was nicht immer geschieht: Wir waren uns sympathisch, was zur Folge hatte, daß mich Kurt Drawert auch weiterhin gelegentlich besuchte. Was er mir vortrug, waren meistens Lesefrüchte, und ich bemerkte: der Mann, der eine Zeitlang als Bibliothekar an der Sächsischen Landesbibliothek gearbeitet hatte, war ungeheuer belesen. Geschenkt, daß es sich dabei in der Regel um Schriftsteller handelte, die ich bisher nicht zur Kenntnis genommen hatte und die nicht zu meinem Leseprogramm gehörten. Auch in dieser Tatsache markierte sich der Unterschied der Generationen, der wir beide angehören, und der mir mit einem Male bewußt wurde.
2
Drawerts Gedichte, die er mir nach und nach zeigte, forderten mich heraus. Ich, der ich mit der Lyrik der Beat-Generation oder Rolf Dieter Brinkmanns nicht sehr gut vertraut war, bekam von ihm Nachhilfeunterricht, indem er mir Texte jener Autoren brachte, die sein Schreiben modifiziert hatten. Nicht mehr Brecht oder Huchel waren seine Vorläufer, obwohl er auch diese Autoren nicht verschmähte und gerade an Eich einen Text adressiert hat, der nun zum Titel dieses Gedichtbandes geworden ist. Und nicht das Erlebnis einer brennenden Heimatstadt hatte das Bewußtsein des 1956 geborenen geformt, sondern eine Gesellschaft, die mit überkommenen und neuen Widersprüchen zu leben hat.
3
Widersprüche also, die sich in Drawerts Gedichten wiederfinden: Bilder des üblichen Lebens, Formen, die Bestand haben oder sich aufzulösen beginnen, Bilder des Lebens, die zeigen, wie es ist und nicht, wie es sein soll. Wer, wie Drawert, nicht mehr die Utopie in der Form des schönen Scheins bestätigen will, muß nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten suchen und kann sich mit versifizierten, abgerundeten „Aussagen“ nicht mehr zufrieden geben. Daß mich Drawerts Gedichte nicht mehr bestätigten und ich meine eigenen Erfahrungen in ihnen nicht ohne weiteres wiederfand, irritierte mich zunächst. So hatte ich Mühe, aus Drawerts umfangreichen Manuskripten eine Auswahl zu treffen, die meinen Vorstellungen von Lyrik entsprach. Erst die zornige Kritik des gemeinsamen Freundes Adolf Endler an dem von mir zusammengestellten Manuskript veranlaßte Drawert, selbst Entscheidungen zu treffen und die Gedichte so auszuwählen und zu ordnen, wie sie dem Leser nun vorliegen.
4
Die Sache, die Drawert in seinen Gedichten verhandelt, ist seine eigene, von der er sagt:
Merkst
du nun, daß es sich hier um ein Gedicht
handelt?, um eines, das nicht vorgibt,
mehr als es selber zu sein und schön
einfach nur das Sichtbare sichtbar machen
will, ganz einfach, wie einfach einen
Raum zu verlassen, in dem die Luft knapp
ist.
Was paradox erscheinen mag: Drawert setzt auf die ihm gemäße Weise fort, was die Dichter der DDR, die heute um die Fünfzig sind, in den sechziger Jahren oder noch früher begannen. Nur liegt zwischen ihnen und ihm die Distanz jener von der Welt vermittelten und von den Dichtern auf ihre Art erworbenen Erfahrungen, die sich nicht von den Sätzen, die das Bewußtsein erreichen, und von den Bildern, die die Netzhaut berühren, trennen lassen.
5
Wer Drawerts Gedichte liest, muß sie befragen. Drawert macht dem Leser nichts mundgerecht, liefert nicht wiederverwendungsfähige Zitate noch Verse, die wie Öl über die Zunge gehen. Seine Gedichte verkünden keine Programme („Kommt uns nicht mit Fertigem…“: Volker Braun) und bieten keine Lebenshilfen frei Haus. Wer sich mit diesem Dichter treffen will, muß seine eigenen Probleme mitbringen und mit der Kenntnis von Realität und Leben seine Texte lesen. Denn um Texte im Sinne von miteinander verspannten und mit- und gegeneinander arbeitenden Wörtern und Sätzen handelt es sich. Gedichte, wie die von Drawert, sind nicht Abbilder von Gegenständen, sondern selber Gegenstände.
Ihre Komplexität verwahrt sie gegen ihre Konsumierbarkeit: Lektüre wird nicht zu einem Erlebnis, das sich summa summarum unter den Strich bringen läßt.
6
Akzeptiert man das Leben auch als einen Balanceakt ohne Netz und doppelten Boden, so besitzen Drawerts Texte die Eigenschaft, einen solchen Gang übers Seil nachzubilden. Zu seiner Biografie gehört nicht mehr die Tatsache, etwas von der Realität des Faschismus, von Krieg und unmittelbarer Nachkriegszeit persönlich erfahren zu haben. Seine Erfahrungen setzen dort ein, wo sich das Leben unter den Kennwörtern „Schwebezustand“, „Verletztsein“ und „Verzeihen“ zu erkennen gibt. Ein Dozent des Literaturinstitutes, das Drawert von 1982 bis 1985 besuchte, glaubte ihn als „Literaten“ bezeichnen zu müssen. Er ahnte wohl nicht, daß er ihm damit eine Ehre erwies.
7
Nun ist freilich der Schlüssel zu Drawerts Gedichten auch nicht dort zu suchen, wo der Moder des Geheimnisses west. Es genügt, in diesem Buch zu blättern, um Verse zu finden, die genau das sagen, was Lyrik in sich wandelnden Formen und sich verwandelnder Sprache „schon immer“ gesagt hat. Nicht in dem langen, programmhaften „Gedicht im Juni, Juli, August“ oder in diesem Gedicht verwandten Texten fand ich jenes Bild, das metaphorisch alles in sich einschließt, was Drawerts Art, die Welt zu sehen, ausmacht, sondern in den fünf Zeilen „Augenblick“:
Ein großer Zwerg
mit meinem Hut,
geht über die Kreuzung,
nachts und allein.
Schnee fällt.
Mir scheint jedoch, ohne die Kenntnis des einen und der anderen Texte Drawerts würden seine Erfahrungen nicht kommensurabel. Der Blick auf die nächtliche Kreuzung allein wäre kein Anlaß einzuhalten, um Drawerts Erstaunen über die Leidensfähigkeit des Menschen zu erkennen. Es ist kein Zufall, daß in den Texten häufig Katzen vorkommen. Sie scheinen so etwas wie der ins Bild gebrachte Vergleich zu sein, mit dem Drawert seine Erfahrung fixiert, Zukunft bestehe auch darin, daß man nach einem Sturz noch immer die Chance hat, wieder auf die Füße zu kommen.
8
Mit Dichtern wie Drawert hat sich eine Generation angesagt, die, schriebe sie nicht auf dem Boden der DDR, anders oder gar nicht schriebe! – Sensibilität und Irritierbarkeit, wie ich sie in der Person Drawerts sehe, schließen Mut zur Konfliktbereitschaft ein. Auch wenn sich Drawert extrem auf sein Ich zurückzuziehen scheint, lese ich seine Texte als Beiträge zu einer kollektiven Verantwortung, die unter der Kruste von dem, was Leben auch ist, mit Genauigkeit und der dem Wort gegenüber gebotenen Verantwortung arbeitet.
9
Meine Begegnung mit den Gedichten Kurt Drawerts vollzog sich in der Form einer Triade: ich lernte seine Gedichte kennen, sie interessierten mich; als ich in sie eindringen wollte, verwirrte mich Drawerts gänzlich unpathetische Sicht auf die Dinge, seine zunächst unlyrisch erscheinende Diktion, die dem „Angebot der Gegenstände“ entspricht, „schön / einfach zu sein, denn das brauchen wir / so sehr“. Erst nachdem der Dichter selbst für seine Gedichte eine innere Ordnung gefunden hatte – und damit auch für sich selbst −, die sein Wesen schärfer konturierte – „(man weiß doch was würde / wollte jeder jedem / nur Wahrheiten sagen.)“ −, bemerkte ich, daß hier eine Lyrik vorliegt, in der die Vergangenheit bereits als „ein in den Brunnen gefallenes Kind“ von einem Dichter erkannt werden kann, der „nicht der Gebügelte und Gescheitelte“ sein will, „innen wie außen“.
Ich wünsche, es möge dem Leser ähnlich ergehen wie mir!
Heinz Czechowski, Nachwort, Juli 1986
Erste Revision
Debütanten wollen und sollen auch gelobt werden. Das ist eine der vornehmsten Aufgaben verantwortlicher Kritik. Im Fall der Zweiten Inventur hat dies bereits Heinz Czechowski getan, der dem Band eine Expertise nachstellte. „Gedichte, wie die von Drawert“, schreibt er, „sind nicht Abbilder von Gegenständen, sondern selber Gegenstände. Ihre Komplexität bewahrt sie gegen ihre Konsumierbarkeit.“ Das Czechowskische Formular stellt sich schützend vor Drawerts Texte, indem es, da „Konsumierbarkeit“ abwertend verstanden ist, dem Leser mögliche Kritik als Unsensibilität unterstellt. Das geht mir, verehrter Heinz Czechowski, an den Nerv.
Der Band beginnt mit dem umfänglichen „Gedicht in Juni, Juli, August“. Es wird Bilanz gezogen, ein Dilemma benannt.
Die Gegenwart
war fertig, die Zukunft, die Revolution,
die Antworten waren fertig.
Drawert konstatiert einen „Literaturverstand, der die Zeichen / für die Bedeutungen hielt“.
Die Worte gehörten mir nicht,
kalt lagen sie unter der Zunge als
nicht gemachte Erfahrung.
Es werden Leerstellen eingefügt, die dem Leser schon in der ersten Ebene kreativen Raum lassen, sich eigene Wörter ein- und hineinzubilden. Sozusagen Lyrik zum Selbstbauen.
„Meine historischen Träume
blieben ohne Begriffe. ……….,
wenn ich einmal sagen soll, wie ich jetzt
darüber denke, wo ich aus den Antworten
raus bin.“
Es geht Drawert also um das Benennen seiner Wirklichkeit jenseits weltvermittelnder Erkenntnis. Dieses poetische Programm wird in „Einfaches, Gedicht“ weiter erläutert:
ein Gedicht
(…), das nicht vorgibt,
mehr als es selber zu sein und schön
einfach nur das Sichtbare sichtbar machen
will,
(…) wie einen Raum zu verlassen, in dem die Luft knapp ist.
Das lyrische Ich will nichts hinter dem Sichtbaren sehen, ein Text soll nur für sich stehen, Bedeutungsfülle nehme den Atem. Soweit, so traurig. Kehrt man die Formeln um, ergibt sich: Oberflächlichkeit, das nicht reflexiv abgefederte Sprachdokument, und die Tatsache, daß ein „traditioneller“ Poet einen großen Atem braucht, um die Räume der Bedeutung mit Sinn zu füllen. Dieser Verzicht auf Arbeit am Material äußert sich am augenfälligsten in der Behandlung der Form. In beiden genannten und vielen anderen Gedichten verzichtet Drawert auf die Möglichkeit, Verse zu gestalten. Er ordnet nicht rhythmisch-sinnhaft, sondern teilt die Verse nach der Länge seiner Fingerknöchel und schiebt, meist nach jeder vierten Zeile, eine Leerzeile ein. Texte, die In die Uniform eines rein visuellen Erscheinungsbildes gesteckt werden, müssen damit leben, daß das Zeilenende zur optischen Sollbruchstelle degradiert wird. Das ehemals Formschöne wird zur Dekoration, in der sich alles abspielen mag. Der sprachliche Vorgang ist vom lyrisch-rhythmischen abgelöst und hält sich nur noch zufällig, weil er nicht weiß, wo er sonst hin soll, in Kulissen auf, die einmal Lyrik konstituierten. Diese satztechnische Hülse signalisiert jenen Bedeutungsverlust, den Drawert zur Rechtfertigung seiner exaltierten Subjektivität anzeigt. Die Befreiung des Textes vom „Schönen“ verlangt, daß das Was in sich neue Schönheit erzeugt. Der Vers als Mimikry eines Bewußtseinsstroms ist auch der gestischen Haltung entbunden. Er trägt keinen Inhalt; ihm wurde ein optisches Erscheinungsbild übergeworfen. Dieser Ästhetik der Beliebigkeit entspricht auch die geistige Konzeption von dem, das ehemals Inhalt war. Der Autor sperrt sich gegen ihm „aufgezwungene“ Sichtweisen und behauptet seine Individualität in der Feier seiner Subjektivität.
Diese Rettung des Humanistischen in einer entfremdeten Welt, die mich bisher nur in der westlichen Avantgarde froh und traurig und befremdet stimmte, wird nun von Drawert für seinen radikalen Selbstausdruck genutzt. Im schlimmsten Fall hört sich das so an:
So wie ich die Dinge
nicht sehen will nur um mir
sagen zu lassen wie ein an-
derer sie sieht.
(„Schließe die Augen“)
Nicht nur, wenn der Autor darangeht, die Gedankengänge über Gebühr zu verwirren, auch wenn er schlicht sagt:
mein Leben aus zweiter Hand
bleibt unbewiesen
(„Wunsch“),
waltet in den Texten ein Erfahrungsdefizit. Seine
Worte, die die Worte
der anderen sind
(„Innenmuster“),
versuchen sich, zu Texten geballt, den gängigen Rezeptions- und Vereinnahmungsmustern zu entziehen. Das lyrische Ich leidet wörtlich und will nicht wörtlich genommen werden.
Das macht betroffen. Die Kluft zwischen Zeichen und Bedeutung tut sich auf, wenn im „Freitagsgedicht“ vom Händezittern gesagt wird:
Von Übermüdung
bis Parkinson
ist alles möglich,
der Unterschied liegt in den Worten.
Solche Augenzeugenberichte aus dem Jenseits der Wirklichkeit sind, durchdrungen von einem zuweilen uneleganten Irrationalismus und kraft der Autorität des Subjekts, nicht dem besten, sondern dem erstbesten Einfall geschuldet. Lyrik wird in eine sprachliche Handlung verwandelt, die ihre sinnstiftende Autorität leugnet und Un-Sinn stiftend, nicht mehr als Gesang, sondern als ernst zu nehmendes Vorstellungsangebot existiert. Erst wenn der Leser den Texten seine eigene Erfahrung unterlegt, kommt er auf seine Kosten.
Diese inszenierte Anarchie kommt dem modernen Bewußtsein entgegen und bindet es in den lyrischen Prozeß ein. Folgerichtig heißt es im Gedicht „Satz, Poetik betreffend“:
ich weiß nicht
was ein Gedicht ist.
–
Ein einfacher
Satz, er stürzte, auf dieses hilflose Klein-
wild, hernieder in den Abgrund zwischen Gedanken & Zeichen.
Der aufklärerische Impuls, den Sinnproduktion vorteilhaft auszustellen vermag, wird aufgegeben. Dem Logos ex machina wird der Auftritt versagt, was nicht das schlechteste wäre, wenn Darsteller und Dargestellte ohne ihn auszukommen verstünden.
Daneben enthält der Band wichtige Texte, was immer man nach dieser Werteverwirrung auch darunter versteht. In „Vorwärts rückwärts wir machen weiter“ heißt es:
Auch ohne uns
so scheint es vollzieht sich
Geschichte: na das ahnen wir doch
bereits seit der Schulzeit.
In „Spiegelarbeit“ wird heftiges Grimassieren zum Ausdruck des Uneinsseins mit sich selbst und zum Schutzschild vor den Anforderungen und/oder Anfeindungen der Umwelt. Ich las Dokumente einer Weltfremdheit, die nur zum Teil dem Autor anzulasten ist. Wo dem Kunstschönen der Dienst versagt wird, übernimmt eine radikale Ehrlichkeit seine Funktion. So in Berichten über den Schmerz, den schulische und elterliche Erziehung erzeugten. Es geht Drawert um die Erfahrung, daß übertriebener Schutz Unfreiheit, daß Schulmeistern das Verhindern von Lernvorgängen bedeuten kann. Es finden sich Texte, in denen das lyrische Ich den Verhältnissen, die wohl auch gesellschaftlich sind, wehrlos ausgeliefert ist. Mit den Devotionalien beendeter oder eben enden wollender Liebesbeziehungen wird Beziehungslosigkeiten, Aufbrüchen und Mißverständnissen nachgeforscht. Wo die Semantik nicht zur Mantik erblüht, liegt die Möglichkeit, nicht über die Texte, sondern mit ihnen zu sprechen. Gedichte, die Trauer atmen, bezeugen Einsamkeit und den Wunsch nach Geborgenheit. Einige beachtenswerte Stücke sind über den Band verstreut: „Romanze“, „Gedicht“, „Tagebuch 2“, „Weg. Schritte“, „Befriedigung“, „Abwesenheit“, „Für O’Hara“. Leben wird in Verlusten umrissen; das lyrische Ich erfährt sich in der Abwesenheit: Es ist sich fremd und leidet an dieser Fremdheit, die sich auf die Welt des Kurt Drawert überträgt. Wenn es die Grunderfahrung seiner/meiner Generation ist, keine einschneidenden geschichtlichen Umbrüche erlebt zu haben, so ist dies nicht eben der günstigste Ausgangspunkt für große Literatur. So vertieft sich der Autor auf der Suche nach Gegenständen in die Inventur seines Bücherschranks. Seine besten Gedichte scheinen mir die, in denen er Vorbildern nacheifert. Es sind besonders die Lyriker der Beat-Generation zu nennen: O’Hara, Robert Greeley, aber auch Altmeister William Carlos Williams, dessen inellektuelle Klarheit der Alltagsbilder Drawert zum Beispiel in „März“ auf sein Material überträgt. Auch das Frühwerk von Rolf Dieter Brinkmann wird genutzt. Wo aber Brinkmann sich einen naiven Blick auf die Details bewahrt hat, versucht Drawert oft private highlights querzusetzen, den Text aus der Sphäre der Realität, in der sich Innenleben manifestiert, herauszuheben. Oft entstehen dann Texte, die nur noch sich selbst repräsentieren und in denen die Aneignung von Sprache, zuweilen auch von schlechtem Deutsch, die Aneignung von Unwirklichkeit ist. Die nordamerikanischen Lyriker mißtrauten der Sinnaufladung und Bedeutungsfülle und gingen einen Schritt zurück, um sich im Vertrauen auf präzise Alltagsbeobachtungen Wirklichkeit neu zu erobern. Kurt Drawert streckt sich mehr nach der vorbildlichen Decke, als daß er damit DDR-Spezifika in ihren für mich spannenden Blößen entdecken kann.
Anders im Herangehen die geballte, an die Lyrik Eva Strittmatters gemahnende Kraft der Gedanken in „Außerhalb“:
Wer liebt, ist immer auch verloren,
An jenes Glück, das man gewinnt
Als Sand, der durch die Hände rinnt –
–
Das Nichts im Sein, der Tod im Leben,
In Leidenschaften mischt sich Qual.
Es findet sich auch eine Variante zu Mickels „Hofgeschrei“, in der das Kind „käse probieren“ soll, wobei nicht ganz einzusehen ist, warum das Kind, nachdem es bei Mickel den Ball holen sollte, nun auch noch Käse essen muß.
Was Drawert an Modernem (oder auch Modischem) in sein poetisches Welt- und Schriftbild adoptiert, etwa Formexperimente der Elke Erb, ist erfahrenswert als Angebot für einen Streit um die Zukunft von Poesie; von Poesie, die den Zustand humaner Werte human bezeichnet. So scheint mir die epigrammatische Kürze und der Verzicht auf Pointen ein kleiner epischer Fluß zu sein, ein Rinnsal in Großaufnahme, wobei sich dann zeigt, ob das vergrößerte Detail mit Bedeutung belastbar ist, die der Leser ihm beibringt. In diesem kommunikativen Konzept erhält er die vom Autor verschenkte Freiheit, den Stab der Bedeutung über den Text zu brechen. Die Auflösung des konsumierten Textes in ein Erfahrungspuzzle, in ein Assoziationshallygally verhindert aber nicht, daß die in uns wohnende Sehnsucht nach Sinn zuweilen stärker ist als der Text.
Es scheint, als ließe sich die ausgerufene Kluft zwischen Zeichen und Bedeutung mit einem Synonymwörterbuch überbrücken. Die Kluft, will ich damit sagen, ist wohl eher ein Mangel an Textarbeit als eine Nachricht vom Einbruch der Entfremdung in die geheiligten Bezirke, in denen sich der Mensch noch einigermaßen darauf verlassen kann, daß er auch versteht, was er denkt.
Volker Dietzel, neue deutsche literatur, Heft 433, Januar 1989
Brief
Die Rezension von Volker Dietzel zu Kurt Drawerts Gedichtband Zweite Inventur (NDL, Heft 1/1989) fordert nicht deshalb zu einer Entgegnung heraus, weil sie ein kritisches Verhältnis zu den Texten ausstellt, sondern dies mit Abstrafungen verbindet, die an einigen Stellen geradezu ins Denunziatorische ausschwingen. Das geschieht mittels solcher Stempelwörter wie „exaltierte Subjektivität“, „inszenierte Anarchie“ oder „uneleganter Irrationalismus“, und die Berechtigung hierzu wird aus schlaksig hingeworfenen Verunglimpfungen beigebracht: Mit einem, der „sozusagen Lyrik zum Selbstbauen“ fabriziert, der gar „die Verse nach der Länge seiner Fingerknöchel“ teile, mit einem, der „Augenzeugenberichte aus dem Jenseits der Wirklichkeit“, „Erfahrungspuzzle“, „Assoziationshallygally“ liefere oder schlicht und einfach „Un-Sinn“ stifte, muß man offensichtlich nicht fein umgehen. Ein solcher Stil ist beredt genug, opportun finde ich ihn trotz der eher erheiternden Eigentore („Augenzeugenberichte aus dem Jenseits der Wirklichkeit“) dennoch nicht. Immerhin geht die Rede bei Volker Dietzel selbst gleich zu Beginn von „verantwortlicher Kritik“. Dies freilich, um erst einmal einen kleinen Seitenhieb auf Heinz Czechowski loszuwerden. Wieso aber Heinz Czechowski, wenn er sich gegen „Konsumierbarkeit“ von Lyrik wendet – ich denke, er meint damit vor allem eine gefühlig-gedankenlose Rezeption –, „dem Leser mögliche Kritik als Unsensibilität unterstellt“, bleibt mir unerfindlich. Gehört es nicht zu „den vornehmsten Aufgaben verantwortlicher Kritik“, Vorsicht bei solcherart Ableitungen walten zu lassen? Aber das Vorgehen hat Methode, und die finde ich nun mehr als fragwürdig. Da wird aus wenigen Gedichtzeilen geradlinig ein „poetisches Programm“ herausgelesen, welches dann noch in einem anderen Gedicht „weiter erläutert“ werde. Danach ginge es „Drawert also um das Benennen seiner Wirklichkeit jenseits weltvermittelnder Erkenntnis“. Abgesehen davon, daß ich Schwierigkeiten mit der Begrifflichkeit (Was ist „weltvermittelnde Erkenntnis“?) habe, werden falsche Antinomien konstruiert, die mit der Gedichtaussage nicht viel zu schaffen haben.
Der Rezensent versucht sodann seine Vermutungen mit Zitaten aus dem Text „Einfaches Gedicht“ zu erhärten. Trotz auffälliger Signale (schon bei einem Gedichttitel „Einfaches Gedicht“ müßte man doch eigentlich stutzen) im Gedicht scheint ihm entgangen zu sein, daß Ironie obwaltet, wo er ein „poetisches Programm erläutert“ sieht, daß ein semiotisches Verwirrspiel im Auseinanderreißen von Signifikat und Signifikant abläuft (an dem ich im übrigen auch durchaus Vergnügen haben kann), wo er, banale Logistik glaubt anprangern zu können. Es werden sogar „Formeln“ (?!) im Text gefunden, die der Rezensent nun seinerseits, wie in der Mathematik üblich, für sich umkehrt: Und siehe da, „kehrt man die Formeln um, ergibt sich: Oberflächlichkeit, das nicht reflexiv abgefederte Sprachdokument, (…) Verzicht auf Arbeit am Material“. So einfach ist das. Die aufgeführten Einwände kommen im übrigen bekannt vor; sie wurden insbesondere in der Auseinandersetzung mit bestimmten Spielarten der „Neuen Subjektivität“ in den siebziger Jahren ins Feld geführt, und dies sicher nicht zu Unrecht. Der Haken ist nur, daß das intentionale Zentrum der Lyrik Drawerts ganz woanders zu suchen ist; der erste Blick muß noch nicht Einblick nach sich ziehen. Im Unterschied zu Wondratschek, Krechel, Kiwus, Ritter, Fels usw. versucht Drawert erst gar nicht, so zu tun, als ließe sich eine poetische Unschuld durch radikale Verringerung der Kluft zwischen Alltags- und Literatursprache, durch Metaphernscheu und Verzicht auf symbolisches Sprechen sprachlich wiedergewinnen, als könne sich allein durch die getreuliche Aufzeichnung von Wahrnehmungspartikeln, Erlebnissen und Gemütszuständen tatsächlich eine unverwechselbare Individualität in die Gedichte einzeichnen. Statt dessen problematisiert er in seinen Texten immer wieder die Erfahrung, daß bereits die Art und Weise, sinnliche Erlebnisse zu verarbeiten, ein Gespräch zu führen usw., über vorprogrammierte Arrangements verlaufen kann, über bereits vorfabrizierte Bilder, Gesten, Redensarten, die in der industriell hergestellten Lebenssimulation (zum Beispiel TV) eben nur scheinbar Individualität bezeugen. Vielmehr sieht sich der Sprecher in vielen Gedichten umklammert von Rollen- und Sprachzwängen, die einen „authentischen“ Zugriff auf Realität durch das Subjekt mehr und mehr verhindern. Insofern kann denn auch die „gefangene Stimme“ (Drawert), die spricht, keinesfalls mit der eines womöglich in Sprachnot geratenen jungen Lyrikers verwechselt werden. Die Aufmerksamkeit wird auf die täglich erlebbare Manipulationsfähigkeit von Sprache gelenkt, nämlich unter anderem, über das tatsächliche Auseinanderfallen von Bezeichnendem und Bezeichnetem hinwegtäuschen zu können; bloßgelegt werden das Funktionieren und die Konsequenzen eines „ferngelenkten“ oder auch nur gedankenlosen Sprachgebrauchs. Indem Drawert Mechanismen von Bewußtseinsbildung einsehbar macht und Kommunikationsstörungen signalisiert, steuert er aber auch kommunikative Impulse zum Aufbrechen alltagsneutorischer Verkrustungen und zum Ausgang aus der Unmündigkeit ein. Dabei räume ich ein, daß – betrachtet man den Band insgesamt – längst nicht alle Gedichte zwingend in ihrer Anwesenheit sind, es gibt Redundanzen und auch mal mißglückte Gedichte.
Also: Mitnichten sehe ich in dieser Lyrik eine „exaltierte Subjektivität“ oder die „Feier seiner Subjektivität“, vielmehr ist sie ein Versuch, diese – „Subjektivität“ – überhaupt erst wiederzugewinnen, sich von Fremdbestimmungen zu lösen. Die von Dietzel monierte Konstruktion „satztechnischer Hülsen“ wäre dann in der offenbarten Mechanik als Funktion der Aussage erkennbar. Beispielsweise. Aber mit der beckmesserischen Elle, die immerfort das sogenannte „Formschöne“, das „Kunstschöne“ oder überhaupt das „Schöne“ verlangt und vom Gedicht „Gesang“ erwartet, ist das freilich kaum einsehbar. Aber immerhin hat der Revisor schlußhin auch Lob auszuteilen, entdeckt er doch in einem Gedicht „die geballte, an die Lyrik Eva Strittmatters gemahnende Kraft der Gedanken“. Vielleicht beherzigt der Autor diesen Hinweis, aber da dürfte er wohl nicht mehr soviel an „Modernem (oder auch Modischem) in sein poetisches Welt- und Schriftbild“ adoptieren, „etwa Formexperimente der Elke Erb“. Kein Kommentar. Im übrigen hält der Rezensent zu guter Letzt noch einen Patentvorschlag bereit, auf den alle diejenigen Lyriker, die in ihren Texten sprachkritisch arbeiten, nur noch nicht gekommen zu sein scheinen: „Es scheint“, schreibt er, „als ließe sich die ausgerufene Kluft zwischen Zeichen und Bedeutung mit einem Synonymwörterbuch überbrücken.“ Na denn!
Peter Geist, neue deutsche literatur, Heft 438, Juni 1989
Meine Zweite Inventur
Als mein erster Gedichtband 1987 im Berliner Aufbau-Verlag unter dem, wie ich auch heute noch finde, gelungenen Titel Zweite Inventur erschienen war, lagen Jahre des Wartens, ob ja oder ob niemals, und vielfache, dem jeweils neuesten Textstand angepaßte Veränderungen des Manuskriptes hinter mir. Zwischenzeitlich glaubte ich schon, daß ich in einem Land, in dem ein Autor nachweislich bis zum Rentenalter als literarischer Nachwuchs durchging und entsprechend behandelt wurde, ewig an einem Buch schreiben werde an dem Buch eben, das vielleicht zwanzig oder dreißig andere in sich aufnehmen würde. 1984 war es dann soweit, daß eine Publikation zum ersten Mal ernsthaft in Aussicht stand. Immerhin war ich, trotz negativer Gefühlskonditionierung, durch die aus Fortschrittlichkeitspathos, Geschichtspessimismus und aus erwarteter Fröhlichkeit dem sozial realistischen Leben gegenüber eine gedrückte Grundstimmung wurden, angehender „Hochschulschriftsteller“ des in mehrfacher Hinsicht legendären Leipziger Institutes für Literatur mit dem mir immer ein wenig peinlichen Beinamen „Johannes R. Becher“. Eine Pattsituation. Zumal die meisten meiner Gedichte keine vordergründigen politischen Inhalte hatten, dann aber gerade im radikalen Rückzug auf private, innere Räume und im monologischen Gestus ihres Sprechens ideologisch subversiv wirkten und durchaus politisch verstanden werden mußten. Ich polarisierte die Meinungen und wurde, was sich im wesentlichen auch nicht mehr ändern sollte, zum Streitfall. Aber auch meine Autorenfreunde der Leipziger Jahre, Heinz Czechowski und Adolf Endler, gerieten meinetwegen in eine heftige Kontroverse. Czechowski, der mich zunächst protegierte und öffentlich für mich eintrat, sollte nun auch im Auftrag des Verlages ein Gutachten schreiben und als Herausgeber meiner Gedichte erscheinen. Was er aber nach fast einem Jahr lieferte, war leider unbrauchbar. Eine magere Auswahl von dreißig eher zweitrangigen Texten aus einem Fundus von etwa dreihundert und ein fast schon meinungsneutrales Gutachten, das meine damalige Lektorin für ihre Zwecke, eine bekanntermaßen hysterische Kulturbehörde zu überzeugen, unmöglich verwenden konnte. Allein Adolf Endlers euphorisches Zweitgutachten und eine komplett veränderte Auswahl, die meinen Intentionen entsprach, retteten das Buch, das dann kurz darauf auch wirklich erschien – und tatsächlich so, wie ich es mir vorgestellt hatte: mit einem Umschlag, auf dem ein Bild meines vom Kunstbetrieb der DDR suspendierten Freundes Dietrich Gnüchtel abgebildet wurde, mit zwei für mich programmatischen Vorbemerkungen von Foucault: „… man muß weiterreden, man muß Wörter sagen, solange es welche gibt; man muß sie sagen, bis sie mich finden, bis sie mich sagen…“, und Mallarmé: „Mit dem Nichts an Geheimnis, unerläßlich, das, auch ausgedrückt, ein wenig bleibt“, und, was natürlich die Hauptsache war, mit so ziemlich allen mir wichtigen Gedichten. Selbst das wie zur Versöhnung mit Endler und mir geschriebene Nachwort von Czechowski, in dem er offen von seinen Wegen und Umwegen der Annäherung an meine Lyrik berichtet, fand ich sympathisch, auch wenn mir die Geste der Rechtfertigung des einzelnen vor dem als moralische Hochinstanz zwangsinaugurierten Kollektiv schon damals auf die Nerven ging. Kurz: für den Moment war ich glücklich. Kaum aber war das schmale Buchgeschöpf da, wurde es auch schon heftig verrissen. Eine im übrigen gar nicht unattraktive Kulturfunktionärin vom Zentralkomitee der SED, sehr blond, glaube ich, stahlblaue Augen, tauchte eines Tages im vierten Stock meiner Leipziger Bruchbude auf, wischte mit einer den unbesiegbaren Schmutz der Arbeiterklasse symbolisch verachtenden Geste liegengebliebene Katzenhaare vom Sesselpolster, ehe sie sich mehr vorsichtig als entschieden und auch nur mit der vorderen Hälfte ihres Hinterteils setzte, und fragte, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten: Wieso lesen Sie eigentlich so viel Günter Eich und alle diese spätbürgerlichen, und, wie soll ich es sagen, problematischen Naturen? Und wo kommen nur diese Schwermut und diese tiefen, wie soll ich es nennen, Verstörungen her? Sie sind doch jung und gesund, oder? Und obwohl sie kaum nennenswert älter war als ich, fügte sie doch tatsächlich noch hinzu: Was haben wir da nur falsch gemacht mit der Jugend? Es war nur furchtbar, und mir wurde, was jetzt durchaus glaubhaft sein sollte, schlechter und schlechter. – Gern würde ich fortfahren, ohnehin schon vom Tonfall des Berichtens in den des Erzählens geraten, weil, was ich vielleicht gern auch vergessen hätte, so klar vor meinen Augen liegt, aber mein Zeichenkontingent für diesen Anlaß geht allmählich zu Ende. Und ich habe mich, wie es mir immer wieder geschieht, in Abschweifungen verirrt und womöglich verfehlt, was meine Aufgabe war: zu sagen, wie ich mein Debüt heute, ein Vierteljahrhundert später, empfinde. Nein, gar nicht peinlich! Im Gegenteil. Allein ein sehr frühes Gedicht, das beginnt: „Ich bin, was ich in meiner Sprache bin, / Was ich in den Worten bin, die ich mir / über mich mache“, nimmt schon vorweg, was meine literarische Arbeit bis heute kontextuiert: immer auch an der Glaubwürdigkeit der Sprache zu zweifeln und sie in ihren auf sich selbst bezogen bleibenden Bewegungen und Abhängigkeiten ebenso zu beobachten wie die Dinge und Sachen und Verhältnisse, die mit ihr beobachtet werden. Dieser ganz und gar die literarische Moderne aktualisierende Sprachskeptizismus, der naturgemäß zur Kritik an den Zuständen des Sprechens und damit der Gesellschaft wird, war, was ich zu dieser Zeit vielleicht so genau gar nicht sehen konnte, ein viel fundamentalerer Angriff auf die herrschende Ideologie, als auf der Ebene der Inhalte zwar Kritik anzubringen, das Kritisierte aber gerade dadurch, daß sich die Sprache opportunistisch zu ihrem Gegenstand verhält, eher noch zu stabilisieren, als zu schwächen – Adorno läßt grüßen. Tatsächlich und von daher erklärbar, waren die sogenannten „Experimentallyriker“ unter den jungen Poeten, die den Wortkörper selber angriffen und mehr oder weniger gekonnt permutierten, auch jene, die am feindseligsten behandelt wurden, gleichviel, wie tatsächlich begabt oder erschreckend harmlos sie waren. Auf mich traf das so nicht zu; meine Gedichte waren immer auch, bei aller sprachkritischen Selbst- und Fremdreflexion, narrativ; ich wollte Aussagen machen und etwas erzählen – am meisten von meinem Unglück, am Leben zu sein. Gewiß, lese ich heute die Gedichte meiner Zweiten Inventur, die 1989 in erweiterter Auflage unter dem nicht weniger prononcierten Titel Privateigentum bei Suhrkamp erschienen sind, dann sehe ich schon einige Vorbilder hinter den Buchdeckeln winken. Aber ich sehe auch den anderen und sehr eigenen Ton, der die besonderen Verhältnisse dieser Zeit im Gedicht festgehalten hat und auch fünfundzwanzig Jahre später noch wirken läßt, als wären sie eben erst, in dieser Sekunde, vergangen. Und ich sehe mich wieder in meiner Leipziger Wohnung über das Vorgelände des Bahnhofs und durch die Rauchsäulen der Schornsteine in einen immergleichen gelbgrauen Himmel blickend zu mir selber sagen: … und jeder Tag wird ein Montag sein. Und so wird es bleiben.
Kurt Drawert, aus: Renatus Deckert (Hrsg.): Das erste Buch, Suhrkamp Verlag, 2007
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Jürgen Engler: „Kurt Drawert: „Zweite Inventur“
Weimarer Beiträge, Heft 6, 1989
Tilo Köhler: Poesie der ,schwankenden‘ Bedeutung
Neues Deutschland, 31.3./1.4.1990
Elsbeth Pulver: Rückblende
Neue Zürcher Zeitung, 9.3.1990
Hans-Jürgen Schmitt: Die neuen Ich-Gefühle
Süddeutsche Zeitung, 4.4.1990
Wulf Segebrecht: Die privateigene Empfindung
die tageszeitung, 10.4.1990
Einstand: Kurt Drawert
In Drawerts Texten wiederholen sich die Erfahrungen seiner Generation, die, vielleicht zweifelnd, nach einem poetischen Neuansatz sucht: „begraben wir die Begrabenen / der ein oder anderen // Revolution“, heißt es am Schluß eines Gedichts, das mit den Wörtern „Vorwärts rückwärts“ beginnt. Das erinnert an Marx’ bekannten Satz aus der Einleitung zum „18. Brumaire“. Die Richtung, die das schreibende Individuum Drawert einschlägt, ist dennoch nur schwer zu bestimmen. Wie Sprachinseln gibt es in seinen Gedichten Textstellen, die ahnen lassen, worum es ihm geht. „Gnade ist Weitermachen“, heißt es einmal. Oder im gleichen Gedicht („Tagebuch 1“) der Satz: „Wie Halt / an einer Klinge gesucht“; aber auch – das Gedicht beschließend – ein „Ich werde / mich wehren“. Ein anderer Text wirkt wie dahin gesprochen, der Monolog eines Mannes, der sich Mut zuspricht.
Was hilft Kurt Drawert, dem 1956 Geborenen, Elektrofacharbeiter, Abiturient einer Abendoberschule, Bibliotheksangestellter, Fachtheoretiker für Jugendarbeit an einem Jugendzentrum und zur Zeit Student am Literaturinstitut Johannes R. Becher, sich im Dickicht der Literatur zurechtzufinden? Vorbilder, die er nennt, können uns helfen, Drawert zu erkennen: Eich, Williams, O’Hara, Brinkmann, Mickel. Eine wie auch immer geartete Gegenständlichkeit scheint seine Sache nicht. Der Satz, mit dem ein kleiner Aufsatz von ihm beginnt, gibt darüber zurückhaltend Auskunft:
Die Dinge sind, was sie von sich zeigen; wenn wir die Oberfläche verstehen, also das Schwierigste, verstehen wir auch das Wesen; die Rückseite des Mondes ist auch nur der Mond.
Spukt hier Immanuel Kant? Aufklärerische Sentenzen aber sind Drawerts Gedichten fremd. Der Leser bekommt kein fabula docet geliefert, sondern muß sich mit dem Selbstverständnis des Autors auseinandersetzen. Wie einen umgestülpten Handschuh bietet der Autor die Innenseite seines Wesens dar. Das aber ist nur ein scheinbarer Widerspruch zu dem, was die Dinge von sich zeigen. Daß sich Drawerts Texte nicht aufs Wort festlegen lassen, erscheint als ihre Schwäche, aber mitunter auch als ihr Vorzug. Der Ansatz, der sich in seinen für mich gelungensten Gedichten zeigt, besteht in der Formulierung jener Art von Interesse an der Gesellschaft, das sich im Sinne dieses Wortes noch als ein „Dazwischensein“ markiert. Drawert, unbelastet von bestimmten historischen Erfahrungen, geformt von anderen, unbewältigten, empfindet sich als Spiegel, der wiedergibt, indem er das Ich transformiert. Für diese Haltung spricht das Gedicht „Spiegelarbeit“. In anderen Texten wird der Leser vielleicht entdecken, wie „die Worte… / wirklich wirklich gewesen sein / werden“.
Heinz Czechowski, Neue Deutsche Literatur, Heft 7, Juli 1984
Kurt Drawert: Zweite Inventur
„Gedicht im Juni, Juli, August“ ist der über sechs Seiten reichende Text betitelt, der Kurt Drawerts Debütband einleitet. Er ist mehr als eine Einstimmung in die poetische Welt des Lyrikers; in gewisser Weise sind in ihm schon die Eigenheiten des Bandes versammelt. Das aus drei Abschnitten bestehende Gedicht setzt ein mit der Schilderung eines staubigen Sommertages; notiert wird, was die Sinne dem lyrischen Ich zutragen.
… Warenlager, Wirtschafts-
eingänge, Leergutkästen, Container.
Schleimhäutige Holzkübel, in denen
heiße Brühknochen liegen, dünner
sich nach oben kräuselnder Dampf.
Rotierende Eismaschinen, verbrauchte,
in die Ecke gestellte Kochtöpfe, flink
flüchtende Ratten, die in die Schatten
verschwinden. Dumpf nachhallende Rufe
von Köchen, Kindern, Verkäufern,
Hausfraun. Geruch nach Vanille, Katzen-
pisse und Kaffee. Lieferfahrzeuge… (S. 9)
Mit der Erwähnung der „Lieferfahrzeuge, die kommen und vorbei sind wie die Sätze, mit denen man sich seine eigene Geschichte erzählt“, wird das eigentliche Thema angeschlagen: die Frage und Suche des lyrischen Ichs nach seiner Identität. Teil 2 konfrontiert uns mit dem Herausfallen des Ichs aus der Welt der Gewöhnungen, Sicherheiten und tradierten Werte.
Heute bin ich aus den Ansprüchen
raus, die auf dem Hofpflaster liegen,
aus den Empfindungen raus, aus den Büchern… (S. 10)
Die sich derart ergebende Freiheit ist negativ bestimmt:
… hier war ich und war gefangen in den
Grenzen des Trotzes mit Gewohnheiten,
die auf den Kopf gestellt die Gewohnheiten
waren der andern… (S. 12)
– eine trotzige Freiheit als Reaktion auf eine „deklinierte Welt“, in der die Anwesenheit des Ichs ebensogut eine Abwesenheit ist.
Die Geschichte war fertig. Die Gegenwart
war fertig, die Zukunft, die Revolution,
die Antworten waren fertig. Mein Außen- und
Innenleben war fertig, ein Schnittmusterbogen
auf der letzten Seite der Wochenendbeilage… (S. 12)
Ohne Geschichte zu sein heißt aber, ohne Erfahrungen, zu sein.
?War ich nicht ein Hätschelhund
mit geordneten Zähnen und geregelter
Zukunft; der auf dem Schoß saß der
Geschichte, die eine Geschichte ohne mich
war? ?War mein Verstand nicht ein die
Erfahrungen der anderen aufsaugender
Schwamm? Ein Nachrichtenverstand. Ein
Schulbuchverstand. Ein Vater- und Mutter-
verstand. Ein Zeitschriftenverstand. (S. 13)
Das Motiv des Gedichtanfangs – „Staub überall, feiner, blasser / im Raum tanzender Staub“ – wird am Schluß wieder aufgegriffen, nun als Metapher für die Konsistenz des Subjekts:
Staub, sagte ich,
Staub in mir drin, und vielerlei Grün
für die nähere Zukunft nach nichtmathematischen Regeln. (S. 15)
Ein Gedicht, das Welt anschaut – „ohne Weltanschauung“ (sehen wir diese zuvorderst als geistigen Ausdruck geschichtlicher Zusammenhänge und Bewegungen als in diesem Sinn gefestigte Sicht auf Welt). Die Hoffnung auf eine „Zukunft nach nichtmathematischen Regeln“ erinnert an Volker Brauns Wendung „Gegen die symmetrische Welt“. Diese Assoziation stößt uns aber zugleich auf die Differenz zwischen der Lyrik Drawerts und einem Typus von Poesie, die nicht nur nach der Situation des Individuums, sondern stets auch nach seiner Aktion fragt und diese im geschichtlichen Raum zu behaupten sucht.
Geschichts- und damit Erfahrungslosigkeit zeitigen Konsequenzen für den „Begriff“ von Wirklichkeit. Die Faktizität, an die sich das lyrische Ich zu halten sucht, bleibt phänomenologisch. Sicher ist der Blick, mit dem hier Realität präzis aufgenommen wird, poetisch: Er durchbricht die Stereotypien gewöhnlichen Erlebens. (Dieses läßt die Menschen, agieren und reagieren sie doch zuerst und zumeist auf ihre partikulären Zwecke hin; ihre Wirklichkeit zu einem gut Teil als Kulissenwelt aufnehmen.) Doch wird dieser Blick von nur punktuellen geistigen Absichten gelenkt, zielt er nicht auf die Erhellung diachroner und synchroner Zusammenhänge, dann verflüchtigt sich Wirklichkeit als unvermittelte Ansammlung sinnlicher Daten ins Unwirkliche.
Diesem Schwund kann zunächst mit dem Wissen darum begegnet werden daß Wirklichkeit nicht nur das Greifbare, sondern ebenso und mehr noch das Verborgene, das insgeheim Wirkende in sich einschließt:
Verse, Namen, Philosophien, die auftauchten
und verschwanden und wieder auftauchten
wirklicher, als es die gemietete Wirklichkeit
da vorne je war… (S. 10f.)
Doch insofern das Ich keinen Grund in der Gegenwart findet, bleibt ihm auch in der geistigen, fast schon geisterhaften Wirklichkeit kein Halt: „farblos“ hängen im „harten, blattlosen Gestrüpp“ die „Träume, Utopien, Botschaften“ (S. 11). Das „vielerlei Grün“, das in den Schlußversen des Gedichts hoffend beschworen wird, bleibt Verlautbarung, der man glauben kann oder nicht, leuchtet doch im Text selbst das Grün unter dem Staub des Identitätszweifels nicht hervor.
Wirklichkeit ist bewirktes und wirkendes Sein: Was (oder wer) nicht wirkt wird unwirklich. Zu dieser unwirklich werdenden Wirklichkeit in Drawerts Gedicht zählt das Subjekt selbst, es bildet nur eine „hauchdünne Haut“, durch die Osmose geschieht von „Außen und Innen, Bewegung und Kontemplation“ (S.10). Dieses lyrische Ich ist vorzugsweise eines der Kontemplation, es registriert nicht nur die Empfindungen und Wahrnehmungen, auch die Gedanken denen wohl prinzipiell kein höherer Wert als den Sinnesdaten zukommt, geschehen ihm gleichsam.
Drawerts Lyrik kann zu den „ungewohnten Erscheinungen in einer Literatur“ gezählt werden, „deren Gesamtentwicklung bisher wesentlich in der Tradition eines realistischen sozialen Engagements stand“.1
Ich denke, daß das Gedicht die geeignetste Form ist, spontan erfaßte Vorgänge und Bewegungen, eine nur in einem Augenblick sich deutlich zeigende Empfindlichkeit konkret als snap-shot festzuhalten.2
Ein Vergleich von Drawerts Gedichtband mit Wilhelm Bartschs Übungen im Joch (Berlin und Weimar 1986) vermag die erheblichen Unterschiede in gegenwärtigen Poetiken zu verdeutlichen. Bei Bartsch übt der Dichter als repräsentatives Subjekt gleichsam ein Gattungsgeschäft aus, er setzt die Aufgabe der Dichter vergangener Generationen fort, das Leben in gültigen und bleibenden Bildern und Gestalten zu deuten. Die Arbeit mit tradierten Formen und Metren ist bewußte Konsequenz: Übungen im Joch. Das Ich in Drawerts Gedicht dagegen legt es nicht darauf an, seinen empirischen Status zu verlassen; das Gedicht will nicht als zweite und höhere Natur, als Über-Leben in pointiertem Sinn und essentieller Form erscheinen, sondern gleichsam als Äußerung des Lebens auf der Stufe des Lebens selbst.
(Notwendiger Einschub: Diese Rezension sucht ästhetische und poetologische Grundfragen zu erörtern. Das hat freilich zur Folge, daß der einzelne Text vor allem als deren Beleg denn in seiner mehr oder minder geglückten sprachlichen Gestalt betrachtet wird. Das Problematische des Verfahrens, nämlich über „Einzelheiten“ wie sprachliche Nachlässigkeiten hinwegzusehen, sei deshalb ausdrücklich eingestanden. Von ihnen aber ist gerade eine poetische Praxis bedroht, die das Gedicht gleichsam als kunstlose Lebensäußerung auszugeben trachtet. Um einige Beispiele zu bringen: Eine laxe Formulierung wie „Heute bin ich aus den Ansprüchen raus, die auf dem Hofpflaster liegen…“ mißfällt mir. Ein Geschmacksurteil? „Die Worte, die um den Verstand kreisten / wie Insekten ums Licht, ohne selbst Licht zu sein.“ „?War ich nicht ein Hätschelhund // mit geordneten Zähnen und geregelter / Zukunft, der auf dem Schoß saß der / Geschichte, die eine Geschichte ohne mich / war?“ Sind solche Bildsprünge legitim oder poetische Willkür? Sicher, man weiß, was gemeint ist, aber man erwiese dem lyrischen Handwerk wohl einen schlechten Dienst, wenn man den ästhetischen Wert der Bildlogik zugunsten einer von der sprachlich-gedanklichen Gestalt schnell geschiedenen „Aussage“ geringschätzt. Daß in bezug darauf Purismus einerseits und sprachliches Laissez faire andererseits die Scylla und Charybdis des kritischen Geschäfts sind, daran wird man von vorliegendem Band durchaus erinnert.)
Heinz Czechowski sucht in seinem Nachwort „Lektüre“ den Unterschied von Drawerts Gedichten zu denen seiner Generation zu markieren: „… Bilder des Lebens, die zeigen, wie es ist und nicht, wie es sein soll.“ (S. 134) „Seine Gedichte verkünden keine Programme… und bieten keine Lebenshilfen frei Haus.“ (S. 135) Diese Feststellung kann nur eine erste Orientierung sein, generationsspezifischen Eigenarten von Drawerts Lyrik auf die Spur zu kommen. Denn nicht zu übersehen ist, daß ein anti-utopischer Impetus, zwischen produktiver Ent-Täuschung und Zukunftszweifel sich bewegend, auch in der Lyrik der Generation Czechowskis auszumachen ist. Lyrikern mit einem hohen geschichtsphilosophischen Anspruch war das Weitergehen der sozialistischen Revolution im mondialen wie lokalen Maßstab, das Verhältnis von Fortgang und tiefgreifender – offensichtlicher wie verborgener – geschichtlicher Wandlung zum Problem geworden.3 Gerade dies muß jeden, der nicht normativ, sondern geschichtlich zu urteilen sucht, zur Aufgeschlossenheit gegenüber den lyrischen Befunden der „Nachfolger“ anhalten (gerade auch dann, wenn sie nicht nachfolgen). Drawerts Klage über Geschichtslosigkeit – doch scheint „Klage“ fast zu dramatisch formuliert, wenngleich die Sehnsucht nach einer das Ich bestätigenden und fordernden Geschichte nicht abgeschrieben scheint – ist eine weitere Variante des „Hineingeborenseins“ in die entwickelte sozialistische Gesellschaft. Diese wird als stabiles Bedingungsgefüge erfahren, das der Aktivität des Ichs von vornherein enge Grenzen zu setzen scheint. Nun darf nicht übersehen werden, daß die Lyriker der Generation Drawerts (Drawert ist Jahrgang 1956) durchaus unterschiedliche Bilder davon zeichnen, „wie das Leben ist“. Über Steffen Mensching (Jahrgang 1958) ist in der Ästhetik der Kunst zu lesen, daß er das „Hineingeborensein“, gleichsam als Einpassung des Subjekts in fertige Verhältnisse, nicht als das Grunderlebnis seiner Generation akzeptieren kann.
Er erlebt den realen Sozialismus vor allem als konfrontierten Sozialismus, der sich im internationalen Widerspruchsfeld der Systemauseinandersetzung behaupten muß, daraus ergeben sich bestimmte Anforderungen, auch Beschränkungen, auch Konflikte verschiedener Art.
Aktuelle und künftige Konfliktverarbeitung und Daseinsbewältigung sei deshalb „nicht ad hoc, ohne historische Vergewisserung zu leisten“.4 Solcherart historischer Vergewisserung ist zugleich eine „universalistische“ Tendenz eingeschrieben, der Drang zum Erfassen von Welt und Ich in intensiver Totalität. Ohne Zweifel ist in dieser Intention ein wesentliches Charakteristikum realistischer Bemühungen in der Lyrik zu sehen. Sie trägt freilich auch die Gefahr in sich, dem Leser eilfertige Verallgemeinerungen zu offerieren, die „großen Wahrheiten“ nur als äußerlich zu übernehmen, nicht aber als empfundene und erarbeitete. Der Verweigerung rascher Synthesen kommt realistischer Sinn zu, in gewissem Maße auch unabhängig davon, auf welche Motivationen sie sich im einzelnen beruft.
Bei Drawert muß historische Vergewisserung als bewußter Akt ausbleiben, weil die geschichtlichen Spannungen einer Warte-Situation5 sich bereits in der „Spannungslosigkeit“ punktueller Wirklichkeits- und Ich-Erfahrung gelöst haben. Schwächen wie Stärken der Zweiten Inventur hängen damit zusammen. Hatte Günter Eich in seinem Gedicht „Inventur“ (1945) in seiner „Stunde Null“ eine Bestandsaufnahme des ihm Verbliebenen vorgenommen, als Ausdruck einer existentiellen Situation mit hohem zeitgeschichtlichem Symbolwert,6 so bietet Drawert die „zeitlose“ Wahrheit flüchtigen. Daseins:
Mein Vorteil ist die Anwesenheit
von Gegenständen, die mir vertraut sind,
die mir vertraut sind wie die Erfahrung,
sie wieder verlieren zu können,
endgültiger. (S. 70)
Zu bestreiten ist solcher Befund nicht, ihm kommt die Evidenz einer existentiell-privaten Erfahrung zu. Sie ist die Reaktion auf „neue schwierige Widersprüchlichkeiten. Individuelle Lebenszeit und die Zeit der sich bewegenden historischen Veränderung fallen nicht unbedingt zusammen. Erfahrungen der einzelnen Körper, ihre lebendige Sinnlichkeit, scheinen nicht selten einem Bewußtsein der Realität und der historischen Möglichkeit der Produktivitätsentfaltung zu widersprechen. Das führt zu einer anderen, intensiveren Beschäftigung mit dem konkreten Individuum. Von seinen Wünschen, seinem Begehren, seinen Verletzungen, seinen Träumen aus wird auf die Welt geblickt.“7 Rückt eine solche Beschäftigung mit dem Individuum in das Sinnzentrum der geistigen Inventur Drawerts, so ist das ein Reflex auf „zweigeteilte Welt“ und „zweigeteilte Zeit“, ohne daß noch wie bei Hans-Eckardt Wenzel, aus dessen Chiron-Essai8 die zitierten Begriffe stammen, an einem geschichtlich-utopischen Anspruch festgehalten wird.
Nichts im Sinn „historischer Vergewisserung“ wird also in Drawerts Lyrik über Zeit-Geschichte und Geschichtszeit „ausgesagt“; wohl aber reflektiert sie das, „was wir fahrlässigerweise Leben benennen“ („Café Uhland“), das In-denTag-Hineinleben mit seinen Gewöhnungen, das „tödliche Dazwischen“, die „Umrißlosigkeit“ („Wieder ein Abend von denen“), die lautlosen Erschütterungen und trivialen Tragödien. Drawerts Gedichte zeichnen sich durch mikroskopischen Spürsinn aus für die Unsicherheiten und Unstimmigkeiten, die Unrichtigkeiten und Unaufrichtigkeiten in den menschlichen Beziehungen, den Partnerbeziehungen zumal. Gesten und Abläufe, die nichts (menschlich Substantielles) bedeuten, werden vermerkt, „Geschichte, die als Komödie fortfährt“ („Theater“), Rollenspiel, bei dem das Innen Geheimnis bleibt – aber vielleicht gibt es gar kein Innen – („Mannequin“), durch Verbiegung und Verkrümmung erreichte Harmonien („Spiegelarbeit“), das bloße „Mittun“ als Phänomen lediglich von Statisterie und Statistik („Pinien“). Alptraumhaft trennen Glaswände vom Leben („Projektion“), unter der Oberfläche des Vertrauten lauert Fremdheit auch in der Beziehung zwischen Mensch und Dingen.
Das Erschrecken über das Vergehen der Zeit – der Lebenszeit – weitet sich zu lyrischen Meditationen über trügerische Dauer und die Erfahrung des Flüchtigen. Die Obsession des Lyrikers: die Kurzlebigkeit, das Vergehen der Dinge, ihr Vergangensein – davon wird Notiz genommen:
Als er, der Schneemann, dann den Weg aller Auflösung ging, gegangen war, haben recht lange noch die Äste und Kohlestückchen, Arme Augen Nase Mund, dagelegen, bis auch die und sehr plötzlich verschwunden waren. (S. 53)
Wirklichkeit wird in starkem Maße im Modus des Verschwindens wahrgenommen (vgl. zum Beispiel „Tagebuch“, S. 42). Zumal in der plötzlichen Wahrnehmung der Abwesenheit der Partnerin – ein häufiges Motiv bei Drawert (‑ „Abwesenheit“, „Morgen, ohne dich“, „Dich zu begehren“) –, wird dem lyrischen Ich deren Bedeutung für das eigene Dasein erst recht bewußt. Aus solcher Konstellation mag man wiederum die Kritik eines Alltagslebens herauslesen, in dem sich hinter Vertrautheit Gewöhnung und Entfremdung verbergen. Einmaligkeit und Kostbarkeit des Lebens sowie die ständige Gefahr, es zu verfehlen, werden in Drawerts lakonischen, deshalb gefühlsintensiven Texten beschworen, ohne daß irgendwelche Anleihen bei Sentiment oder Pathos genommen werden. (Das poetische Verfahren, das dem lyrischen Subjekt wichtige Gegenüber gerade durch die Reflexion seiner Abwesenheit aufzurufen verdankt Drawert sicher wesentlich dem französischen Lyriker Stephane Mallarmé, von dem eines der beiden Motti des Bandes stammt. Das „Nichts“ Mallarmés bedeutet – platonisch – höchste Fülle; die Dinge nicht zu nennen, sondern sie metaphorisch zu umkreisen hieß für den Lyriker, in totaler Abwendung von bourgeoiser Nützlichkeitsideologie eine „Aneignung“ der Dinge zu versuchen, die nicht Besitz ist.)
Anwesenheit als sinnerfülltes Sein zu erlangen, darauf richten sich die Reflexionen und Hoffnungen des lyrischen Ichs:
Anwesend sein
einen Moment nur, ehe der Tod
als die Gewißheit vom Gegenteil
mir durch den Sinn geht. (S. 74)
Die Erfahrung ungewisser Identität und die der Flüchtigkeit des Daseins steigern sich gegenseitig. Das lyrische Ich sucht in den Dingen seine Bedeutung („Innenmuster“, S. 75), will auf eine „eigene Umlaufbahn“ gelangen („Mißglückt“, S. 92), betreibt hartnäckig die Suche nach Identität im Wechselspiel von Ich und anderen. „Ich bin, was ich in meiner Sprache bin“, beginnt das Gedicht „Zwischenzeitlich“ (S. 64), aber da diese ja zunächst und zuerst die Sprache der anderen ist, artikuliert sich sofort auch die „Angst in den Worten immer ein anderer zu sein“ („Gedicht“, S. 61). Und:
Mein Name,
mein Leben aus zweiter Hand
bleibt unbewiesen, eine Vermutung
der andern. („Wunsch“, S. 74)
Hier kann und muß gefragt werden, inwieweit von einer Dialektik des Ich und der anderen überhaupt gesprochen werden kann, wenn über die informellen mikrosoziologischen Beziehungen nicht wesentlich hinausgegangen wird. Das Ich kann nur im alltäglich-praktischen Leben, nur am angenommenen und nach eigenen Maßstäben verwandelten anderen seine Identität finden. Wird nicht nach den sozialen und politischen Formen und Inhalten (auch Scheinformen und -inhalten) dieser Dialektik gefragt, reduziert sie sich schnell auf rhetorisch-metaphorische Leerformeln. Wer aber ist Ich und wer sind die anderen?
Die Widersprüche der Identitätssuche schlagen sich auch im Verhältnis zur Sprache nieder. In einem Statement äußert Drawert seine hohe Auffassung von der (dichterischen) Sprache. Ihr wird die „Überschreitung der durch den Determinismus des praktischen Denkens gesetzten Grenzen“ aufgegeben, die Erreichung der Wahrheit „als Totalität von Erfahrung“, als Einheit von Wort und Schweigen (S. 84). Das Gedicht ist der „Raum…, in dem man sich begegnet“ (S. 95). Ereignet sich alles in Sprache, so ist Geschehen vor allem sprachliches Geschehen („Satz“, „Poetik betreffend“, „Freitagsgedicht“). Humanismus ist Kampf gegen Spracharmut und Sprachlosigkeit. Wo jemand nicht zu Worte kommt, sich nicht artikulieren kann, drohen Aggression und Gewalt gleichsam als „Körpersprache“ („Geständnis“). Im Gegensatz zu diesem Gedicht erweist sich in dem Text „Geschichte, seitenverkehrt“ ein Ende als der Anfang einer Liebe, insofern der Partner die richtigen Worte findet, sagt er auch nur:
Ich kenne mich schlecht aus in den Sätzen, die man braucht, um zu sagen, daß ich neben dir bin. (S. 129f.)
Doch bleibt in Sprache gefundene Identität prinzipiell bedroht, gelingt es nicht, von Sprache das Fremde als Ausdruck geordneten und verordneten Lebens abzustreifen. Das Problem reicht noch tiefer; das andere Motto des Bandes, von Michel Foucault stammend, enthält in nuce die ganze Problematik der Identitätssuche durch Schreiben, wie sie in der Literatur dieses Jahrhunderts durch Franz Kafka in ihren tragischen Aporien gelebt wurde:
… man muß weiterreden, man muß Wörter sagen, solange es welche gibt; man muß sie sagen, bis sie mich finden, bis sie mich sagen…
Natürlich liegt die Identität des Schreibenden im Schreiben. Aber wofür und wozu wird der „Determinismus des praktischen Denkens“ überschritten? Dieses Schreiben kann gleichsam Spitze des Lebens sein, Ausdruck eines auch außerhalb des Schreibens lebenden und handelnden Subjekts, oder es ist das eines Subjekts, das sich allein als schreibendes entwirft und sich in ausschließlicher Orientierung auf sprachliche Leistung endlich als Leistung der Sprache wiederfindet. Derart verbleibt es im Banne der Entfremdung, verabsolutierter Arbeitsteilung; ein Schreiben, das sich selbst schreibt; ein Text, der sich selbst genügt, insofern er jede über sich hinausweisende Botschaft verweigert.
Drawerts Lyrik ist der Versuch menschlicher Sinngebung in einem geschichts-, daher zusammenhang- und sinnlosen Zeit-Raum. Selbstvergewisserung kann so nur etwas Momentanes sein, sie verdankt sich, wie im Gedicht „Für O’Hara“ vorgeführt, einer von Konvention, Ordnung, Struktur befreiten schönen Gelegenheit:
Eine Gelegenheit kommt,
liegt auf der Couch und
beginnt, sich zu öffnen.
Sie zu lieben bleibt
einfach, solange die
Grammatik im Schranke steht,
ein Buch, das die Gefühle
zerschneidet zu schwarzen,
sinnlosen Stücken… (S. 51)
Um dem „grammatikalisch“ geordneten Dasein zu entkommen (damit auch der Reflexion und dem Bewußtsein – Falltüren in die Zeit), richtet sich Begierde auf das Spontane und leibhaft Augenblickliche: Wir haben „nur unsere Körper um die Zeit zu verlassen“ („Gedicht“, S. 61). Scheu vor Fest-Stellung und Fest-Legung – die zu Wiederholung und Gewöhnung als schlechter Dauer führen – schlagen sich nieder in einer immer wieder neu zu beginnenden Utopie des Offenen:
Leben ist eine Frau,
die an einem vorbeigeht in einer Gegend,
die noch nicht definiert ist. („Positive Zahl“, S. 65)
Den komplizierten und unsicheren menschlichen Beziehungen wird das Sehnsuchtsbild „einfachen Lebens“ entgegengestellt:
Abläufe, die keine Wiederholung kennen
und ganz einfach sind in einem Leben,
das neue Nahtstellen hat. („Ein Anfang ist das, ein Roman“, S. 66f.)
Die Formel vom „einfachen Leben“ findet ihre Entsprechung in der Form des „Einfachen Gedichts“, „… das nicht vorgibt, / mehr als es selber zu sein und schön // einfach nur das Sichtbare sichtbar machen / will…“ (S. 29)
Natürlich sind Drawerts „einfache“ Gedichte keine naiven, sondern sentimentalische mit ihrer Sehnsucht, einfach den Verwirrungen des Lebens entkommen zu wollen. Die Intention des Lyrikers geht aber dahin, so weit wie möglich ihren Charakter als unmittelbare Lebensäußerungen zu erhalten beziehungsweise dem Leser sie als solche suggestiv darzubieten. Soll das Gedicht gleichsam eine lebendige, spontane, dem Augenblick offene Kundgabe von Leben sein, so ist damit die Ablehnung tradierter Formen und ihrer Vor-Schriften vorausgesetzt. Drawerts Gedicht „Sonett“ beargwöhnt die Sonettform als Vergewaltigung von Wirklichkeit, als „Betrug von höhrer Art“, der „zur Harmonie den Müll“ zu fügen trachtet (S. 107). (Freilich wird das Sonett ironisch in der Form des Sonetts selbst kritisiert, seine Lehre – eine Lehre über ein Grundgesetz der Welt: „Denn alles Leben will sich spalten“ – mithin durch die Art seiner Mitteilung desavouiert.) Nicht zufällig gilt die Kritik dem Sonett es begünstigt in gewissem Maße die vom Textganzen ablösbare, pointierte Lehre und Moral. Gegen solche Abziehbild-Wahrheiten, gegen eine Sinnpräsentation, in der man ruhen und ausruhen kann, richtet sich Drawerts Verweigerung eines bequem faß- und beschreibbaren Sinnganzen.
Da nun die überkommenen Formen unter generellen Harmonie- und Hierarchieverdacht stehen, wie er sich pars pro toto gegenüber dem Sonett äußerte, lyrische Sprache andererseits immer geformte Sprache ist, muß es als konsequente Lösung angesehen werden – die andere wäre die völlig spontane Gruppierung des Wortmaterials nach Empfindungsschüben und Reizkurven beziehungsweise Atemperioden –, wenn Drawert eine gleichsam mechanische Gliederung der Worte und Sätze vornimmt. Nicht nur, daß sich bei ihm nichts reimt – Reim suggeriert Sinn –, generell birgt Form hier keinen vorgegebenen Gehalt in sich; sie wird – insofern ist diese Lyrik ihren Prämissen gegenüber ehrlich – deutlich als Willkür ausgestellt. So besteht die Hälfte der Gedichte Drawerts aus zwei-, drei- oder vierzeiligen Strophen – dieser Begriff wäre freilich nur dann verwendbar, wenn sich damit nicht die Vorstellung relativ geschlossener Sinneinheiten verbindet – besser also: aus Versblöcken. Unabweisbar stellt sich die Frage: Handelt es sich tatsächlich um Gedichte? Können diese Texte nicht ebensogut als Prosa gelesen werden? Es entspricht doch die Wortfolge der Sätze weitgehend alltagssprachlich Üblichem, und überdies fehlen alle einem Versschema geschuldeten Inversionen und Verkürzungen.
Nun sind die Grenzen zwischen Lyrik und Prosa fließend, insofern letztere durchaus mehr oder minder rhythmisch strukturiert sein kann. Doch anders als bei der Aufnahme von Prosa schärft die Versgliederung die Aufmerksamkeit des Lesers beziehungsweise Hörers für rhythmische Zusammenhänge. So wäre in einer Feinanalyse der einzelnen Texte zu prüfen, ob bestimmte Versfüße dennoch dominieren oder ob in deren relativ regelmäßigem Wechsel ein gewisses rhythmisches Organisationsprinzip entdeckt werden kann. Unabhängig davon, welche Ergebnisse durch eine solche Analyse erbracht werden, konstituiert vor allem die Zäsur, am Ende des Verses wiederkehrend, eine Art rhythmisches Element, und es ist eine solche in einem relativ geringen Zeitraum erfolgende Wiederkehr, die zum Begriff von Dichtung beiträgt. Wenngleich Edgar Allan Poe von der Zäsur innerhalb des Verses spricht, kann doch seine Bemerkung als genereller Hinweis auf deren Bedeutung genommen werden: Die Zäsur „ist ein vollkommener Versfuß – der wichtigste in der Poesie überhaupt und besteht aus einer einzigen langen Silbe; die Länge dieser Silbe ist jedoch unterschiedlich“.9Die Vers- und Strophenzäsuren fordern zu einem skandierenden Sprechen auf, das auf besondere Weise äußere Gliederung mit dem inneren Geschehen der Texte in Korrespondenz treten läßt: Der Kontrast von Unsicherheit, zag-suchenden Bewegungen, flüchtigen Äußerungen menschlichen Lebens und Erlebens einerseits und strengem Formkorsett andererseits, das gleichsam das „Haltlose“ des Inhalts stützen soll, erweist sich als wesentliches Moment ästhetischer Mitteilung. Zudem werden die alten vertrauten Strophenformen vom Lyriker in seinen Versblöcken polemisch erinnert; noch indem er sie verwirft, nimmt er sie in Dienst.
Das alles bedeutet aber, daß Drawerts polemische Lyrikkonzeption wie -praxis dennoch einem vertrauten Begriff von Kunst genügen. Um an den Vergleich seines Gedichts mit dem von Bartsch zu erinnern: Deren Gegensätzlichkeit ist keine starr ausschließliche, sondern eine tendenzielle. Wie zurückgenommen das Subjekt bei Drawert auch sein mag, in seinem Zusammenhalt von Auflösung bedroht, es ist – als Kommunikationspartner des Lesers – im Raum des Gedichts anwesend; die Verweigerung eilfertiger Sinnsynthesen geht immer noch davon aus, daß Kunst- und Lebenswirklichkeit unterscheidbar und sinnvoll aufeinander beziehbar sind. Und das als selbstverständlich Ausgegebene bleibt im Gedicht nicht selbstverständlich, die einfachen Bilder von der Oberfläche des Lebens gewinnen durch die Assoziations- und Akkumulationskraft der lyrischen Sprache eine Tiefendimension. Zum anderen: Auch dort, wo von vornherein einem Text – wie bei Bartsch – die Absicht von Sinnrepräsentation anzumerken ist, stellt diese doch, eignet dem Text die Qualität des Künstlerischen, nichts schlechthin Gegebenes dar, sondern immer ein Aufgegebenes.
Freilich operiert Drawert an der Grenze der Lyrik: Wenn die Gleichsetzung von Leben und Kunst unter radikalem Absehen von wie auch immer gearteten Ideal-Ansprüchen erfolgte – hier artikulieren sie sich als Utopie des „einfachen. Lebens“ in den Gelegenheiten glücklichen Einverständnisses von Mensch und Welt –, drohte die Gefahr, daß das in Zusammenhängen denkende und sie herstellende, das von Gestaltungs- und Veränderungswünschen gegenüber der Realität beseelte Subjekt verschwindet, zum Vorgang unter anderen, zum Ding unter anderen wird, zum die Dinge lediglich registrierenden Ding. Doch endgültig verschwindet das Subjekt erst dann, fallen Kunst und Leben unterschiedslos ineinander, wenn sich jener postmodernistische Standpunkt behauptet, der das durch jeweilige Sprachmedien und Mediensprachen vermittelte Bild der Welt mit der menschlichen Lebenswelt gleichsetzt. Dann erst entsteht jener Pluralismus, der das Subjekt innerlich aushöhlt und als Hülle zurückläßt.
Jürgen Engler, Weimarer Beiträge, Heft 6, Juni 1989
In Rufweite zum Schweigen
– Eine Fußnote zu Kurt Drawerts Poetik. –
Dass wir im Zeitalter des Epilogs leben, dahintreiben in einer überraschungslos gewordenen Welt voller Reprisen, ist ein diagnostischer Evergreen der modernen Kulturkritik. Bereits vor über einem halben Jahrhundert hat der Anthropologe Arnold Gehlen das „Posthistoire“ ausgerufen, einen Zustand der „Kristallisation“, in dem alle Grundentscheidungen der Kunst und Kultur gefallen sind. Was am Ende einer „sinologischen Kunstgeschichte“ noch bleibe, so Gehlen 1963 in seinem Essay „Über kulturelle Kristallisation“, sei eine große Erschöpfung, ein „Synkretismus des Durcheinanders aller Stile und Möglichkeiten“.10 Diese Diagnose der Erschöpfung, aufgeladen noch mit einem Degout an den Wucherungen der Internet-Sphäre, wird in den Essays des Schriftstellers Kurt Drawert aufgenommen und kulturkritisch noch weiter verschärft. Der 1956 geborene Drawert ist, soweit ich sehen kann, der einzige deutsche Autor von Rang, der mit großer Entschlossenheit und begrifflicher Konsequenz an die Einsichten der französischen Meisterdenker Lacan, Foucault, Deleuze und Barthes nicht nur anknüpft, sondern sie erkenntnistheoretisch umsetzt in eine stringente ästhetische Theorie. Die Terminologien des französischen Strukturalismus und Poststrukturalismus haben seinen eigenen Stil in einer Weise imprägniert, dass die stilistische Artistik seiner Essays fast enigmatisch wirkt, in ihrer totalen Verweigerung der geschmeidigen Meinungsfreude.
Drawert will heraustreten aus den Oberflächlichkeiten des Literaturbetriebs und aus den medialen „Entleerungsdiskursen“, indem er die kulturellen Symptome der Erschöpfung in ihrer Unerträglichkeit bis in ihre Mikrostrukturen hinein analysiert. Dabei ist für ihn die Überführung der Kultur in die digitale Sphäre der absolute Sündenfall, sieht er hier doch „die kulturelle Erschöpfung in ihrer finstersten Erschöpftheit“ realisiert.11 Bereits in seiner so ambitionierten wie lehrreichen Studie Schreiben (2012), einer subtilen Psychoanalyse der Literatur und ihrer Schreibwerkzeuge, interpretierte Drawert die unendliche Freiheit der Netz-Kultur als Verfallsgeschichte:
Online-Sein heißt immer auch Verflüchtigung, Dispersion (…). Für unsere Texte, die Literaturtexte sind, bedeutet ein Auftritt im Internet immer Verlust.12
Seine unter dem Titel Was gewesen sein wird versammelten Essays setzen diese Analysen des „verlorenen Signifikanten“ fort, kreisen um die „Entrückung des Realen in einen Hohlraum von Realität“ und vermelden den Zusammenbruch der Kultur, „weil der leere Signifikant zum Repräsentanten einer entleerten, von Surrogaten umstellten Lebensrealität geworden ist“.13 Diese grimmigen Invektiven gegen die Kultur der „gelöschten Zeichen“ haben eine lange Vorgeschichte. Sie beginnen nicht erst mit den essayistischen Anverwandlungen des französischen Strukturalismus, sondern bereits in Drawerts lyrischem Erstling Zweite Inventur, der im Titel einen poetischen Schlüsseltext Günter Eichs aufnimmt. Diesem Gedichtbuch von 1987 sind bereits Motti von Drawerts Hausgöttern Michel Foucault und Stephane Mallarmé vorangestellt. Und das allererste Gedicht des Bandes, die Rolf-Dieter-Brinkmann-Hommage „Gedicht im Juni, Juli, August“, enthält die poetologische Grundformel, an der sich das Schreiben dieses Dichters seither orientiert:
Die Worte gehörten mir nicht,
kalt lagen sie unter der Zunge als
nichtgemachte Erfahrung, Formulierungen,
die zu klein waren für die Ideen
und dahintrieben wie bauschige Wolken14
Und dieses Ungenügen an den Wörtern, dieses Grundgefühl, über keine taugliche Sprache zu verfügen, ins Verstummen getrieben und damit ausgeschlossen zu sein, ist die innere Tätowierung, die in Texten dieses Autors immer wieder sichtbar wird. Es ist die zentrale Grundfigur der modernen Lyrik, seit Hugo von Hofmannsthals Chandos-Brief, in dem das schreibende Ich sein Unbehagen artikulierte, dass ihm die Worte im Mund zerfallen „wie modrige Pilze“. Und nun Kurt Drawert:
Was macht die Sprache mit uns, und was machen wir mit der Sprache? Wo repräsentiert sie uns und unser Begehren und wo redet sie unser Begehren nur ein?15
Diese Grundfragen, die der 2012 gehaltene Vortrag „Diktatur der Sprache. Sprache der Diktatur“ aufwirft, sind wie schmerzhafte Urszenen, auf die Drawerts Werk immer neu reagiert. Welche unmittelbare Erfahrung der Gewalt mit der Begegnung mit der Sprache verbunden war, hat Drawert in dem essayistischen Roman Spiegelland von 1991 beschrieben, den er später als sein persönlichstes Buch bezeichnete:
Denn außer in meinen Gedichten ist kein Textkörper so sehr durchdrungen von existenzieller Verzweiflung.16
Spiegelland handelt von den Traumatisierungen, die dem Jugendlichen widerfuhren, der von seinem Vater in die Dunkelheit des Kellers gesperrt wurde. Die Alphabetisierung erlebte der Junge als fortdauernden Schrecken. „Die Worte drangen wie vergiftete Pfeile ins Fleisch“, heißt es an einer Stelle, und das ganze Leben des Schriftstellers Drawert erscheint als der Versuch, aus dieser repressiven Ordnung der Sprache, die nur die Ordnung des Vaters repräsentierte, herauszutreten. So blieb dies eine immer neu beschworene Konstante seines Schreibens: Das Nicht-Sprechenkönnen als Kind und Jugendlicher, die Sehnsucht nach einem Sprechen, zu dem dann immer die passenden Worte fehlen.
Zur Identifikationsfigur und zum symbolischen Kronzeugen von Drawerts Lyrik wird nicht zufällig ein rätselhafter Fremdling, der sich in die Welt der Sprache erst zögernd hineintasten musste. Es ist der Findling Kaspar Hauser, der im Mai 1828 urplötzlich auf einem Marktplatz in Nürnberg auftauchte und den die überraschten Zeitgenossen sogleich den Maximen ihrer Lebenswelt anpassen wollten. Der stumme Kaspar Hauser, der aus seiner lichtlosen Höhle heraustritt und sich plötzlich einer neuen Ordnung unterwerfen muss – das ist ein Zentralmotiv, das uns in unterschiedlichen symbolischen Repräsentationen und Variationen in den Gedichten Drawerts immer wieder begegnet. Kaspar Hauser, der in die Menschenwelt Hineingetriebene, träumt noch einmal im gleichnamigen Gedicht von der glücklichen Zeit „jenseits der Sprache“, da er noch geborgen war in der „Geschichte der Stille“. Der Verlust dieser Stille, das Hineingeworfenwerden in die herrschende Sprachordnung, ist das Trauma, das dann der Schriftsteller zu bearbeiten hat.
KASPAR HAUSER
Wenn er jetzt, versehentlich
in der Welt, an die Zeit
im Kamin denkt,
jenseits der Sprache
und im glücklichen Spiel
mit seinen Zehen,
als da nichts war
außer den flinken,
fröhlichen Mäusen
zur wunschlosen Stunde
und die Wärme
im Schatten des Namens
tief war im Körper,
wo jetzt die Klinge
hart bis zum Schaft
ihren Platz hat….,
wenn er jetzt, den Mund
voll von Blut, den Beamten
des Fortschritts
die Geschichte der Stille
erzählt, dann bereut er
noch einmal
die Entdeckung des Lichts,
das erste Öffnen der Tür,
und wie er im zu guten Glauben
a gesagt hat.
Der Eintritt in die Menschenwelt und ihr kommunikatives Handeln wird hier zum fatalen Ereignis. Das „A-Sagen“ – es ist die Einweihung in das Regelwerk einer Gesellschaft, die sich den Einzelnen systematisch unterwirft.
Wie in diesem „Kaspar Hauser“-Denkbild entwerfen viele Gedichte Drawerts die Szene einer abgrundtiefen Fremdheit des Subjekts, die sich am fragilsten Ort des Sozialen, nämlich in der sprachlichen Verständigung, manifestiert. Kaum beginnt das Subjekt zu sprechen, zerfällt die Ordnung der Dinge. Es vollzieht sich sogleich eine Spaltung von Name und Ding, die Sprachzeichen verfehlen die von ihnen bezeichneten Gegenstände, die Bedeutungen entfernen sich immer weiter ins Diffuse.
In ihrem innersten Kern handeln fast alle Gedichte Kurt Drawerts von diesen Erfahrungen der elementaren inneren Spaltung und Trennung, vom Verlust des Sprachvertrauens und dem Ausgesetztsein eines Sprechenden, der seine Identität durch die gewaltsam verfügte Sprachordnung bedroht sieht.
„Ich rede davon“, so resümiert Drawert denn auch in dem fesselnden Meisterstück seines Essaybuches, einer überaus luziden Studie über Flaubert, „wie mir die Sprache erschienen ist: als ein Instrument der Disziplinierung und der Vereinnahmung, mit ihr und durch sie hindurch eine Ordnung, auf die ich keinen Einfluss mehr hatte, nicht nur anzuerkennen, sondern sprechend auch zu bestätigen und neu zu begründen, (…) und diese Sprache zu verlassen war eine Entscheidung des Körpers, ehe es zu meinem Denken wurde, es war, hilflos genug, Rebellion, und wie ein Delinquent nahm ich die Züchtigungsrituale entgegen, die immer gut gemeint waren, im Namen der Liebe.“17 Wie Drawert diese Ordnungen der Sprache aufbricht, wie er Flauberts Strategien zu seinen eigenen macht, wie er in großer stilistischer Virtuosität einer Poetik folgt, um „mit einem entleerten oder doch zumindest von Leere durchdrungenen Zeichenvorrat Bedeutungen zu schaffen“ – das ist ganz große Interpretationskunst. Diese Flaubert-Lektüre ist um vieles ertragreicher als die an Exempeln arme Generalabrechnung mit der „Zerstörung des Wertes der Zeichen“ oder der „alphabetischen Zeichen“, wie sie der Autor in seinem Traktat „Das Ende der Provokation“ zelebriert. Wer die Essays von Kurt Drawert liest, die schon im vertrackten Futur II des Titels „Was gewesen sein wird“ ein sprachreflexives Denken annoncieren, wird immer mit jener Aufbruchsbewegung konfrontiert, mit der sich dieser Autor aus den Stereotypien des Sprachsystems herausarbeitet. Eine Denkbewegung, die sich schon in der Sprach-„Inventur“ seines ersten Gedichtbands ankündigt. Dort findet man ein „Statement“, das in seiner in ambivalente Allgemeinbegriffe verwickelten Syntax die planen Behauptungen und Wahrheiten unterläuft und erste Schritte macht auf dem langen Weg, den „verlorenen Signifikanten“ wiederzufinden:
In der Überschreitung der durch den Determinismus des praktischen Denkens gesetzten Grenzen, dargestellt in der Hierarchie der Bedeutungen, erscheint Wahrheit als die Totalität von Erfahrung, wie sie in den Zeichensystemen gespeichert ist und aus ihnen hervorzugehen vermag und über sie hinaus; Bewegungen in Richtung des Schweigens.18
Bewegungen „in Richtung des Schweigens“ – das sind die ästhetischen Schritte, die auch der späte Günter Eich vollzog („Sprache beginnt, wo verschwiegen wird“),19 als er die Begrenztheit der naturmagischen wie auch aller anderen poetischen „Inventur“-Konzepte erkannte. Kurt Drawert ist über Eichs Konzept weit hinausgegangen – aber in seinen Gedichten und Essays immer in Rufweite zum Schweigen geblieben.
Michael Braun, aus TEXT+KRITIK: Kurt Drawert – Heft 213, edition text + kritik, Januar 2017
Drei Gedichte
I GLÜCKSFARBE
für Kurt Drawert
Keine fehlt
unter den täglichen farben meines glücks,
selbst das magdliche grau
kommt am abend zu ehren:
es klemmt sich den hexenbesen
zwischen die beine,
zieht sich das blaue tuch
meiner rauchenden freunde
über schultern und brust,
treibt über den tischen sein wesen –
wen stört da die asche,
die es auf uns verstreut.
(1985)
II MIT KURT DRAWERT AUF DEM LANDE
Die jungen spielen fußball,
die mädchen spielen köchin,
wir väter spielen dichter.
Was fehlt zur poesie?
Dass die frauen aus dem haus träten
schwanger und schön;
dass das brunnenwasser rein wär
und die bäume gesund;
dass wir keine angst hätten
vor krieg und vernichtung?
Zur poesie fehlt alles:
zur poesie fehlt nichts,
als dass wir, Kurt,
als dass wir
bessere menschen wären.
(1987)
III AUFRÄUMEN IM ALTER
(beim wiederlesen von Kurt Drawerts gedicht Aufräumen)
Ich brauch keine ordnung
ich muss nichts mehr suchen
ich muss nichts mehr finden
kein besucher betritt mein sauberes zimmer.
Was ich war,
treibt mir schamröte ins gesicht,
ich ändere nichts am schicksal
der verratenen
und nichts an meinem.
Die alten briefe
fallen mir aus der hand,
die tagebücher zerfallen.
Ich räume nicht auf
ich habe die hände frei:
dürftig gerät die umarmung.
(2016)
Jürgen Israel
Joke Frerichs: Deutsche Zustände
Fakten und Vermutungen zum Autor + DAS&D + KLG
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA
Video Porträt: Ute Döring & Kurt Drawert.
Keine Antworten : Kurt Drawert: Zweite Inventur”
Trackbacks/Pingbacks
- Kurt Drawert: Zweite Inventur - […] Klick voraus […]



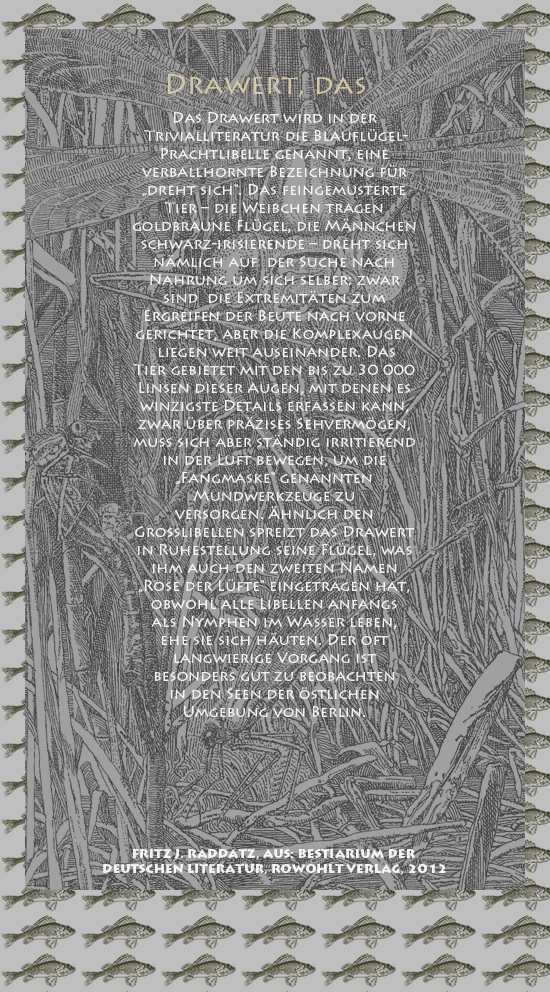












Schreibe einen Kommentar