Kurt Drawert: Der Körper meiner Zeit
VIII
Ich habe beschlossen, nur an mir selber zu scheitern,
aaaaadas
ist mein letztes Privileg. Dann sollen die Hunde
aaaaakommen
und den Rest in die Erde verscharren mit schmutziger
Pfote. Es ist keine Frage der Zeit, wie viele Texte ich
noch leben werde, sondern eine der Zuversicht und
aaaaades ab-
nehmenden Mondes über dem leeren Horizont. Wir müssen
zu lange mit ansehen, wie der Saft aus dem Stamm treibt
und nutzlos im Brachfeld erkaltet, das macht misanthropisch.
Ich beschwöre nicht das Schwarze unter dem Fingernagel
der Zukunfts-/losigkeit, ich bin auch nicht der apokalyp-
tische Reiter des Augenblicks, der die gezinkten Karten
der Profiteure hart auf den Tisch knallt, ich stecke mir
nur keine Blume ins Knopfloch, das ist alles. Alter
befreit, höre ich sagen, und darauf möchte ich warten,
hier, in dieser Ödnis am Rande der gewünschten Betäubung.
Zwischendurch ein Gespräch mit einem Wesen an meiner Wand,
von dem ich keine Vorstellung habe und keinen Namen.
Ich habe so wenig gelernt von den Dingen, die nutzlos sind,
das beschämt mich am meisten. Die falschen Bücher,
und wir gehen verloren wie eine Meldung des Tages
im Munde des Nachrichtensprechers. Zu überleben aber
ist eine Variante der Rache, daran können wir glauben
und halten uns fest, wie der Ertrinkende klammert an einem
kleinen Stück Treibholz, das er für den Rettungsring hält.
Wenn zwei Verirrte sich suchen, finden sie nie zueinander.
Also muss einer bereit sind, dem anderen einen Ort zu er-
finden, der ihn empfängt. Ein Phantasma, vielleicht, doch
gültig bis auf Widerruf aus den Zentralen der Geheimnislosigkeit
(und meistens getwittert). Es fällt mir schwer,
dir zu sagen, wie ich daran glaube, dass es uns gibt,
und möglich ist auch, dass der lange Atem der Rede
nichts als diese Bestätigung sucht. Am Ende geht es
immer nur um ein Wort, das gerade fehlt, und darum
sprechen wir zu viel. Der goldgelbe Käfer, der mir
Gesellschaft leistet und diskreten Abfall auf meinem
Schreibtisch zurücklässt, über den er flaniert, nicht
ohne Stolz, als wäre hier alles schon bereit für die Druck-
maschine und seine Spur eine Träne des Endverbrauchers,
wer sagt, er sei weniger wert als die kühnste Metapher,
der schönste Satz, der reinste Gedanke? Und wer meint,
dass er nicht lesen kann, nur weil er in den Schmutzecken
der Küche gezeugt worden ist? Sind wir nicht alle aus einem
Kübel gezogen, den uns ein demiurgischer Gott zurückließ
im ewigen Fluch? Verdammt und für schuldig befunden
ohne Amnestie? Wenn überhaupt, dann glaube ich an die Kraft
der Hoffnungslosigkeit, aber darum geht es auch gar nicht,
sondern um die Vergiftungsgefahren durch Schriften, die wir
inhalieren wie Gras oder zwangsweise einatmen müssen.
Ich lege die Papiere zur Seite und will sehen, wo mein Art-
genosse schläft. Dass er gewöhnlich wie Dreck ist, lässt
meine Ehrfurcht nur wachsen. Und ein kleiner Rest Nach-
sicht mit der eigenen Entbehrlichkeit bleibt auch noch
erhalten und wird zusammengekehrt, wenn es soweit ist.
Die Liebe ist die einzige Marktlücke, die nicht gefüllt
werden kann, doch darüber will ich / nicht schreiben.
LXXXVIII
Nichts ist mit sich selber identisch. Eine Bemerkung zu meinen
Gesamtschwierigkeiten. Nachwort + Gebrauchsanweisung.
Um die Logik des Denkens in ihrem Ursprung zu finden, kann
es kein zweites Narrativ geben, das nachträglich zugeschaltet
wird und den Primärtext kommentiert. Jeder spätere Eingriff in die
Wahrheit des Gedankens, die so vorübergehend ist wie die Sache,
der er sich widmet, ist der Lüge näher als jede Aporie. Nicht die
Motivwiederholung und mögliche Zufälligkeit ist ein Defekt der
Struktur, sondern deren Revision wäre es. Denn sie beugt sich
dem Vorurteil des Sehens, zerstört, was der Geist erschaffen hat,
ist die Krawatte, wo der Körper noch nackt ist. Mir sagt mein
Gedicht nicht mehr und nicht weniger, als jedem anderen auch,
nämlich etwas. Identisch mit sich selbst ist nichts, und eben
deshalb kann es auch wahr sein. So habe ich es versucht, gute
2 Jahre hindurch. Und niemals etwas nicht auszusprechen, das
im Blick aus dem Fenster, innen + außen, geschah. Deshalb
auch die Serie der Bilder, die ich Blicke auf nichts genannt habe
und die eine Erzählung der Erzählungen sind, so, wie es auch
Träume gibt, die sich selbst bewusst werden können. Sie sagt mir,
wann es geschah und wo es die Orte des Denkens tatsächlich gab.
Darüber hinaus waren die Tage, alle, zerrissen. Das Gedicht also
hat, neben vielen Motiven und Gefühlswirklichkeiten, privaten
und politischen, erlebten und reflektierten, ein Thema grund-
sätzlich: Wie viele Verletzungen hält ein Mensch aus, die allein
dadurch entstehen, dass er sich tatsächlich ansieht? Auch das
sind die Blicke auf nichts – eine Beglaubigung des Sehens im
Augenblick der Trennung von Phantasma und Logos. Denn wir
sehen nichts mehr ursprünglich, sondern werden angeschaut von
zerschnittenen Körpern in einer erfundenen, effizienzgenerierten
Perfektion. Die Welt ist ein technologischer Effekt und damit für
sich selbst nicht erreichbar. Im Buch Mose war es die Sintflut,
heute flutet uns das Reale. Und ich weiß jetzt, was Ich ist: näm-
lich nicht lediglich ein anderer, sondern ein Möbiusband in der
Sprache, das Wirklichkeit und Erfindung unendlich ineinander
verschiebt. Die Poesie ist der einzige mögliche Ausgang. Noch
eine Bemerkung zu den Namen und zur Topographie: Ich habe
gut recherchiert und herausgefunden, dass es Städte wie Ístanbul,
Paris oder Zürich, Aarau oder Lenzburg, aber auch Crautenbach
tatsächlich gibt. Das ist mir erstaunlich. Ebenso gibt es laut
deutschem Telefonbuch aus dem O-/denwaldkreis mehrmals
eine Frau Müller. Das ist mir ebenso erstaunlich. Jetzt ist es
16 Uhr 47. In diesem Moment gebe ich die Verantwortung an
der Verschriftung meiner Gesamtschwierigkeiten ab an den O-
denwald und seine wahrhaft schöne, stumme, dunkle Natur. Und
bitte jetzt auch keine Nachfragen mehr, wie etwas gemeint war.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa– „Ich weiß es nicht.“
Die Verteidigung des Subjekts in seiner Auflösung
– Zu Kurt Drawerts Gedicht Der Körper meiner Zeit. –
„Schreiben ist immer eine psychophysische Durchdringung von Stoff (…). Man muss etwas zulassen können, was andere blockieren, zensieren, verdrängen. Nur so entstehen literarische Texte, die neue Räume eröffnen, überraschend, irritierend, denkwürdig – also des Denkens würdig – sind“, sagte Kurt Drawert in einem Interview mit Barbara Zeizinger auf die Frage, ob er bestimmte Erwartungen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seiner Darmstädter Textwerkstatt hätte (Bawülon 4/2015, Pop Verlag). Es ist eine klare Absage an Harmlosigkeiten, vor allem aber ist es ein Bekenntnis zur schonungslosen Aufrichtigkeit mit sich selbst. In einem Interview mit Walter Fabian Schmidt (Poet, Nr. 11) formulierte Kurt Drawert eines seiner grundsätzlichen Anliegen so:
Ein Text, der nicht irritiert oder schmerzt oder zu neuen Sichtweisen zwingt, ist sinnlos für mich, für mein Verständnis von Literatur.
Poetologische Positionen (oder vielleicht eher: Dispositionen) von Autorinnen und Autoren sind eng mit persönlichen Grunderfahrungen verknüpft, die meist in der frühen Kindheit liegen werden. In seinem essayistischen Roman Spiegelland. Ein deutscher Monolog (zuerst veröffentlicht im Jahr 1992) erzählt Kurt Drawert von einer traumatisierenden frühkindlichen Erfahrung: Wenn der Vater, ein hoher Kriminalbeamter der DDR, mit dem jungen Kurt Drawert redete, spürte dieser, dass es gar nicht der Vater war, der sprach, „sondern etwas Fernes, Fremdes, Äußeres (…), etwas, das sich lediglich seiner (…) Stimme bediente.“ So erfuhr Kurt Drawert, dass es einen Unterschied gab zwischen dem Mitgeteilten (also dem, was gesagt wurde) und der Mitteilung (dem, was gemeint war) und er konzentrierte sich fortan darauf, herauszufinden, was „auf der anderen Seite des Sprechens“ lag. Diese Erfahrung mag der Ursprung für Kurt Drawerts psychoanalytischem, von den Schriften Jacques Lacans geprägtem Blick auf die Literatur gewesen sein, der engen Verbindung von Körper, Sprache und Text, die hinter allen seinen Arbeiten spürbar ist und auch Grundlage seines neuen Langgedichtes ist, das den treffenden Titel Der Körper meiner Zeit trägt. In diesen Worten schwingen die Auswirkungen der politischen und privaten Gegenwart auf den Körper des lyrischen Ich mit – und das bis an den Rand der Auslöschung. Zum Beispiel weil keiner mehr zuhört.
Im letzten Textabschnitt, der in einer Überschrift die Begriffe „Nachwort + Gebrauchsanweisung“ enthält, legt Kurt Drawert seine Arbeitsmethode für die Zeit der Arbeit am Gedichtband dar, die – bei allem Schutz, den das lyrische Ich bietet – darin besteht, „niemals etwas nicht auszusprechen, das im Blick aus dem Fenster, innen + außen, geschah.“ Was verändert sich dadurch, dass etwas ausgesprochen wird? (Zum Beispiel der Satz „Ich liebe dich“) Es verschiebt das Subjekt des Satzes in seiner Beziehung zur Umwelt auf eine unberechenbare Weise. Dies gilt auch dann, wenn der Satz nicht ausgesprochen, aber gewünscht oder erwartet wird. Die Sprache ist es, die Menschen gleichzeitig trennt und verbindet. Das Ich stellt sich heraus als „Möbiusband in der Sprache, das Wirklichkeit und Erfindung unendlich ineinander verschiebt“, wie Kurt Drawert im Nachwort schreibt.
Aber wovon handelt eigentlich dieses rund 200 Seiten umfassende Gedicht? Es geht hier – im wahrhaftigen Sinn – um alles, und die Themen, Motive und sprachlichen Herangehensweisen entwickeln sich in jedem der 90 Teile, aus denen das Langgedicht, aufgeteilt auf fünf Bücher, besteht, im Prozess des Schreibens immer neu und an verschiedenen Orten, sei es im Odenwald, in Istanbul oder in der Schweiz. Logisch zu werden oder gar analytisch, das merke ich jetzt, wo ich damit anfange, wird dem Gedicht nicht gerecht. Ich könnte etwas vom Tonfall schreiben, von den Stimmungen zwischen Plauderton, Melancholie, Sarkasmus, Verzweiflung, dann plötzlich wieder Witz und Humor [„Entschuldigung wegen gestern. Heute geht es schon besser“, XVI], ich könnte ein paar Techniken aufzählen (Beobachtung, Assoziation, Reflexion, Erinnerung, Gedankensprung, ein Bild, Erzählung, Essay, Selbstunterbrechung, Bewertung des Geschriebenen, Zitate, Selbstzitate, Anmerkungen zur Rechtschreibung und unglaublich gute Dialoge) oder Themen (dazu gleich). Ständig überschreibe ich meine Notizen und Überlegungen für diese Rezension, wie ein Palimpsest. Ich nehme das Buch wieder in die Hand und lese es plötzlich anders, entdecke einen Gedanken neu, streiche meine bisherigen Notizen, die mir nun banal erscheinen. Mein Aufwerfen und Verwerfen von Gedanken beim Nachdenken über das Buch ist in der Struktur des Buches angelegt, denn dessen wesentliches Element liegt in einer Verweigerung und damit in der Tradition von Herman Melvilles Figur Bartleby. „Mein T-Shirt mit der Meldung // I would prefer not to hängt nass auf der Leine.“ Ein Gedichtteil, Nummer LIII, besteht fast nur aus einer Verweigerung, ich schreibe „fast“, weil eine komplette Verweigerung in einer Publikation nicht möglich wäre: „(Hier steht nichts.)“ (…) „(Und hier könnte jetzt auch Ihre Werbung stehen!)“ Sex sells, wissen wir, aber auch da macht Kurt Drawert nicht (immer) mit und schwärzt eine heiße Passage in Gedicht Nr. LXXX.
In jedem, wirklich jedem Gedichtteil wird irgendein Aspekt aus dem Bereich der Wirtschaft erwähnt, und das Buch wimmelt nur so von zitierfähigen, klugen und originellen Sentenzen, aus allen Bereichen. Es wirkt fast zwanghaft, wie das lyrische Ich seine Einbindung in die Ökonomie wahrnimmt und ablehnt, und andererseits – wir befinden uns in der Nachwendezeit – doch nicht anders kann als Teil zu sein einer Verwertungsindustrie.
Die Liebe ist die einzige Marktlücke, die nicht gefüllt
werden kann, doch darüber will ich
nicht schreiben.
So heißt es in Buch (1), VIII. Bald darauf, in Buch (2) beginnt dann aber eine Liebesgeschichte, deren Reflexion für den Rest des Langgedichtes ein zentrales Thema sein wird.
„I cannot make it cohere“, schrieb Ezra Pound in seinen Cantos. Ich kann es nicht zusammenfügen. Das Langgedicht steht eher in der angloamerikanischen Tradition, weniger in der deutschsprachigen. Thesen und Überlegungen zum Langgedicht der 1960er Jahre haben Hans Bender und Michael Krüger in dem Band Wohin geht das Gedicht? zusammengetragen. Walter Höllerer sprach vom Sichtbar-Werden im Langgedicht; nach William Carlos Williams kommt es vor allem auf die Energie innerhalb der Form an. Durch die enorme Vielfalt in Inhalt und Form wirkt Kurt Drawerts Langgedicht energetisch fein ausbalanciert und es steckt voller Spannung und Unberechenbarkeiten. Im Jahr 2013 erschien im Luxbooks Verlag eine von Matthias Göritz und Uda Strätling erarbeitete Übersetzung von John Ashberys Langgedicht Flow Chart. Ich erinnere mich daran, dass mir Kurt Drawert erzählte, dass er das Buch gelesen habe und sehr begeistert davon war. Eine Lektüre, die spürbar ist, im Hintergrund.
Der Körper meiner Zeit ist auch eine Reflexion über die Grenzen klassischer Werte in einer Welt, die immer unberechenbarer zu werden scheint. Inwieweit tragen Bildung und Intelligenz zu einem erfüllten (Liebes-)Leben bei? In der Türkei und am Ende aller Illusionen kommt es zu einer Begegnung mit einem Straßenhund, der sich vorübergehend dem lyrischen Ich anschließt und dessen Aufmerksamkeit sucht.
Yaris
weiß nicht, dass er nichts weiß, und das macht ihn mir über-
legen.
Die zur Reflexion fähige Intelligenz scheint zu scheitern. Gegen Ende des Buches heißt es:
Mein Unterbewusstsein ist klüger als mein
Wissen vom Wissen.
Und, gerichtet an Klara, am Ende der Liebe:
Mit dir
zu sein, war eine Metapher. Ich hätte es wissen können. Aber
ich wollte das Buch.
Das unterbewusste Wissen hat das lyrische Ich also nicht daran gehindert, eine Erfahrung zu machen, von der es ahnte, dass es Grundlage eines Buches werden würde.
Das lyrische Ich behauptet sich, immer wieder, indem es sich verflüchtigt. Es entzieht dem Interpreten den Boden durch Sätze wie „Wenn ich ehrlich bin, muss ich gestehen, dass ich immer nur lüge.“ Das Gedicht lässt sich nicht fassen, nicht festlegen, schon windet es sich und entzieht sich – und darin liegt seine subversive Kraft.
Es gibt nur einen Ort, sich selbst nie zu treffen, und das ist
die Sprache.
Der Lesende bewegt sich wie in einem Zug, der in einer Möbiusschleife zwischen Erfindung und Wirklichkeit gefangen ist. Ich saß in diesem Zug, ich las eine Sammlung mit Kurzgeschichten von James Salter. Das Buch hieß Letzte Nacht, und in der Geschichte mit dem Titel „Die Gabe“ taucht ein Dichter mit dem Namen Des auf, der eine wichtige Rolle spielt, und auf etwa einer Seite wird der Inhalt des Gedichtbandes beschrieben, der Des bekannt gemacht hat und durch den sich die Erkenntnis zieht, „dass du etwas gehabt hast, dass du es immer haben wirst, es aber nie haben kannst.“ Es sind Sätze, die nur dann widersprüchlich klingen, wenn man sie logisch betrachtet. Der Körper meiner Zeit ist ein Langgedicht, das Maßstäbe setzt. Ein Zusammenbruch, und gleichzeitig ein Fest des Intellekts. Es ist ein Text, der sich selbst vollkommen genügt. Und doch, er sucht den Austausch. Ein Meisterwerk.
Martina Weber, Ostragehege, Heft 83, 1.3.2017
Das zersprungene Ich
– Die eigene Existenz singen: Kurt Drawert erprobt mit Der Körper meiner Zeit eine lyrische Form, an die sich die Gegenwartsdichtung kaum noch herantraut. –
„Ich bin das Unglück von beiden Seiten seiner / Wirkungsgeschichte“: Wer mit solchen Versen die poetische Vermessung der Welt beginnt, der hat wenig Aussichten auf die Leichtigkeit des Seins. Wie viele große Lebensbücher der Moderne entfaltet Kurt Drawerts Langgedicht Der Körper seiner Zeit den Versuch eines gefährdeten Ichs, den Abgrund der eigenen Existenz auszuleuchten. Ein zersprungenes Subjekt besichtigt den „Scherbenhaufen“ des eigenen Lebens und topografiert mithilfe poetischer Ortserkundungen die eigene Misere.
Die Lebensreise des prekären Ichs beginnt im Odenwald, führt über Istanbul in die Schweiz und nach einer elementaren Erschütterung schließlich wieder zurück ins Provinz-Refugium. „Ich hatte immer vom Dunklen ins Helle zu gehen“, heißt es in einem frühen autobiografischen Text Drawerts, „und es war immer ein Gehen wie von der zweiten, zweifelhaften und gefährdeten Seite der Existenz in die geordnete, vernünftige und überschaubare Seite der Existenz.“
Dieses Oszillieren zwischen den verschiedenen Polen der Existenz, diese gegenläufigen, oft paradoxal gefügten Versbewegungen, die sich aus einer Negativität heraus ins Offene tasten, bilden auch in seinem neuen Buch die Grundfigur seines Schreibens. In Der Körper meiner Zeit erprobt Drawert eine lyrische Form, an die sich die Gegenwartsdichtung – mit den aufregenden Ausnahmen von Paulus Böhmer und Ann Cotten – kaum noch herantraut.
In fünf großen Kapiteln spielt er die Möglichkeiten des langen Gedichts durch und lädt seine erzählerisch weit ausschwingenden Sentenzen mithilfe klassischer Versmaße auf mit einer eminenten Musikalität. Die Bewegung „vom Dunklen ins Helle“ pendelt hin und her zwischen sarkastischen Alltags-Notaten, dem hohen Ton des Liebesgedichts und einer skeptischen, an französischen Meisterdenkern wie Jacques Lacan und Michel Foucault geschulten Sprachphilosophie. Jedes Kapitel wird von einer Reihe von Schwarz-Weiß-Fotografien flankiert, in dem das beobachtende Ich „Blicke auf nichts“ wirft. Um eine angemessene Sprache für die Existenz im metaphysischen Vakuum zu finden, wechselt Drawert immer wieder die Tonlage und lässt die Bilder und Sprachgesten hart aufeinanderprallen.
Elegie, Sarkasmus, Pathos und Lakonie, Aphorismus und Kalauer sind mithilfe des Daktylus eng ineinander verflochten. So wechseln die einzelnen Versblöcke zwischen einem ruhigen, fließenden und dann wieder stockenden Rhythmus. Am Ausgangspunkt des Gedichts sitzt ein mit sich überworfener Dichter in einem abgeschiedenen Refugium im Odenwald und wird zum Protokollanten des eigenen Scheiterns:
Ich habe beschlossen, nur an mir selber zu scheitern, das
ist mein letztes Privileg.
Aber mitten in der Seelenödnis ereignet sich plötzlich das Unerhörte: Im Zuge einer Reise nach Istanbul erscheint die Möglichkeit einer absoluten Liebe, die erwartungsgemäß bald der Ernüchterung weicht:
Das wohl gehört auch zur Apo-
rie der Liebe, dass sie sich selbst kein Wort glaubt.
Um nicht einer Larmoyanz des enttäuschten Liebenden Raum zu geben, setzt Drawert immer wieder Bildbrüche in den Fluss der poetischen Rede und zeigt seinen Liebenden als komischen Antihelden. Als unerträgliches Begleitgeräusch taucht an zwei Stellen auch die Pegida-Bewegung auf, der die Verachtung des lyrischen Ichs sicher ist.
Am Ende zerfallen dem Subjekt nicht nur die Illusionen der Liebe, sondern jede Aussicht auf eine verlässliche soziale Bindung:
Mein zer-/sprun-
genes Subjekt erkannte mich wieder und sah zu, wie ich mir sel-
ber ein Streitfall ohne Auflösung war.
Der große Existenz-Gesang des Dichters Kurt Drawert verkehrt Hölderlins Hoffnung in ihr Gegenteil. Seine poetische Rede strebt aus den Begrenzungen und Starrheiten heraus, aber nirgendwo wächst das Rettende:
Komm!, ins Geschlossene, Freund-/in!
Michael Braun, Der Tagesspiegel, 3.3.2017
Das größere Ganze
Ich lese keine Gedichte. Wenn es aber doch einmal geschieht, dann eher aus Versehen. Es ist, als müsste man sie mir unterjubeln. Umso erstaunter bin ich dann über das besondere Glück, das mir beim Lesen von Lyrik manchmal widerfährt. So auch mit dem Gedicht von Kurt Drawert, Der Körper meiner Zeit, das ich als eines der mutigsten, sprachlich und inhaltlich ausgezeichnetsten und dabei zutiefst berührenden Werke dieser Tage wahrgenommen habe.
Heute überlege ich gar, ob Drawert mit seiner Lyrik nicht überhaupt die einzig geeignete Form gewählt hat, um es sprachlich/literarisch mit einer Zeit aufzunehmen, die es unlängst aus der Narration herausgerissen hat. In einem Raum von Gleichzeitigkeit, in der wir die Welt heute erfahren, fehlen die verbindlichen Koordinaten, um Geschichten daran zu verankern. In dieser lyrischen Form jedoch, gelingt Drawert ein ganz eigenes Erzählen. Der Körper meiner Zeit ist gewiss kein Gedicht im üblichen Sinne, das sich in einigen, sorgfältig abgezählten Versen mit Ausschnitten von einem größeren Ganzen befasst. Mit seinen über zweihundert Seiten IST ES das größere Ganze.
Dieses Langgedicht erzählt eine Zeit, aber es erzählt nicht von einer Zeit: es erzählt aus der Zeit heraus, es spricht in die Zeit hinein. In unverbrauchten, eindrücklichen Sprachbildern, die sich schon beim ersten Lesen in mir einnisten und nachklingen, sodass ich den Text beim zweiten Mal nach ihnen absuche, wie nach den Pretiosen eines geliebten Schatzes, beschreibt Drawert die Sehnsucht nach Orten, nach dem Eigenem im Anderen, nach einer größeren Liebe. Er unterlegt das Verlangen mit dem tiefen Wissen, dass seine Liebe das Scheitern von Anbeginn in sich trägt, dass ihr der Verlust und der Schmerz und die Unmöglichkeit, diesem Schmerz zu entkommen, immer schon eingeschrieben waren.
Seine Sprache ist reich an unkonventionellen, dabei immer stimmigen, teilweise überraschenden Bildern. Seine Beobachtungen sind intelligent, tiefgründig und vielschichtig. Oft wird sein Ton davon melancholisch, manchmal sarkastisch, manchmal humorvoll, als überrasche er sich damit selbst, ohne jedoch dabei heiter zu werden.
Seine Bilder stimmen etwas an, setzen etwas in Bewegung. Mit feinen Beobachtungen und berührender Aufrichtigkeit, verbindet Drawert die Chronik seiner scheiternden Liebe mit dem Wechsel zwischen den Aufenthaltsorten der letzten Jahre, die zu Sinnbildern werden für eine Welt, die an allen Orten in sich selbst und somit auch in uns einzustürzen droht, seit die Orte ohne Anfang und Ende, und beliebig geworden sind in ihrer Gleichzeitigkeit.
Diese Leere der Orte dokumentiert der – im übrigen vom C.H. Beck Verlag fein gestaltete Band – fotografisch in einer Aneinanderreihung von Blicken aus dem Fenster am Schreibtisch des Schreibenden. Es scheinen die Ausschnitte selbst zu sein, die vorbeiziehen, während der Rahmen den Blick des Schauenden festhält, der auf sich selbst zurückgeworfen – zwischen Odenwald, Bosporus, einem Flüchtlingscamp an der Türkisch-Syrischen Grenze und der Schweiz – schon immer weiß, dass er nirgendwohin entkommen kann.
Während ich in diesem Gedicht lese, immer wieder meine innere Ungewissheit: mag ich jetzt lachen oder doch lieber weinen…? Am Ende tue ich beides und denke, dass es wohl Schöneres gibt, als das Schönste und Schlimmeres als das Schlimmste, und dass es nur einer so herausragenden Lyrik wie dieser gelingen kann, dafür eine Sprache zu finden, eine Sprache, für das, was sich nicht sagen lässt, für das Unaussprechliche.
Kurt Drawert dechiffriert in seinem Langgedicht die radikalen Umbrüche unserer Zeit, ohne sie unmittelbar zu benennen und dadurch weitere, ungenannte auszuschließen. Er tut das, indem er diese Brüche ins Private übersetzt, Metaphern findet für ein größeres Unglück, das sich im Individuum zusammensetzt aus den Partikeln eines verlorenen Glücks.
Für mich ist Der Körper meiner Zeit nicht nur das Gedicht unserer Zeit, es ist für mich ein Buch, das in seiner glänzenden, herausragenden Sprache diese Zeit transzendiert und zugleich durch die Zeitlosigkeit einer großen, künstlerischen Dichtung weit über diese hinausweist.
Thommy, amazon.de, 24.10.2016
Linien im zersplitterten Glas
– Zu Kurt Drawerts Der Körper meiner Zeit.1 –
In Gedichten wie „Matrix Amerika“2 hatte sich bereits angedeutet, dass das geläufige Gedicht als Notat, kursorische Einlassung auf einen Lebensmoment oder als Reflexionsverdichtung nicht mehr hinreichen könnte, um das komplexe innere Geschehen im Zeichen der Selbstvergewisserung zu erfassen. Nun hat Kurt Drawert die Vermutung wahr werden lassen und 2016 einen Gedichtband der Öffentlichkeit übereignet, der ein durchkomponiertes Opus in Versen bereithält: Ein Langgedicht in fünf „Büchern“ und mit lateinischer Nummerierung der untergeordneten Gedicht-Kapitel, vornehmlich in drei- und vierstrophigen Daktylen und Anapästen daherkommend und damit grob Ordnung heischend.
Um es gleich zu sagen: Es ist ein Schmerzensbuch, das dem Leser gewiss einiges abverlangt. Die Pfade seines ästhetischen Vergnügens scheinen nämlich mal abschüssig zu sein, dann wieder ziemlich steil bergan zu laufen, und sie sind dornenhecken- und steinübersät. Es versteht sich, dass dahinter anstößige Absichten stecken.
Nicht, dass der Autor es an Wegemarken hätte fehlen lassen: Wir erfahren, wann – vom Sommer 2014 bis zum Frühjahr 2016 – und wo – an wechselnden Orten, vorzugsweise aber in einer Odenwalder Kemenate und in einer Istanbuler Stipendiatenwohnung – jeweils Strophen des Langgedichts entstanden, mehr noch: Den Strophen sind unter dem Titel „Blicke auf nichts“ Fotos vom jeweiligen Arbeitsort beigegeben. Auch verheißen jahreszeitlich charakteristische Himmels- und Wetterbeobachtungen Orientierungspunkte ebenso wie Notate des Weltgeschehens, die im kollektiven Gedächtnis der Europäer als verankert gelten dürfen: die Gemetzel in Syrien, die unaufhörlichen Flüchtlingskatastrophen, die Pariser Attentate im Herbst 2015, beispielsweise. Das war es aber schon an verlässlichen Auskünften.
Denn alle Naturerscheinungen geraten in der Reflexion des sprechenden Ichs zu symbolischen Signa der Verfehlung, das Bezeichnende und Bezeichnete noch irgendwie in sinnerfüllte Beziehungen zu setzen:
Die Wolken sind Kontinente der Sprache, ihr Weg Sätze,
ihre zer-/reißende, zer-/fließende Substanz zeigt uns
die Leere zwischen den Wörtern, die wir sprechen und die
wir nicht gesprochen haben3
Damit nicht genug, apostrophiert der Sprecher gleich eingangs des Langgedichts:
die Seele, ein Splitter-/paradies, ein Scherben-/haufen4
Unter diesen Auspizien wachsen die Dornenhecken und erwachen die Normen, denen im Verlauf des Gedichtes noch schicksalhafte Bedeutung zukommen wird.
Festzuhalten, dass das Gedicht eine einzige groß angelegte Selbstvergewisserung ist, mag auf den ersten Blick als Allgemeinplatz erscheinen; dass diese aber sich weitet zur Befragung des Menschseins in dieser Zeit, ist die eigentliche Leistung dieses ambitionierten Vorhabens. Wie gelingt dies?
Das sprechende Ich konfrontiert unablässig und absichtsvoll einlaufende Informationen aus der Außenwelt mit der inneren Befindlichkeit: Die konzentrierte und konzentrisch ablaufende Kontemplation kollidiert mit den auf keinen Nenner mehr zu bringenden Außenreizen, was im Übrigen immer wieder zu semantischen Irrläufern – „Wenn der krude, / kranke Kutter nicht sinkt, und nichts stinkt zum Himmel“5 – führt. Nur geht es hier nicht um Alliterationen, sondern um die Denotate abgesoffener Flüchtlingsschiffe, die deren gedanklich-sprachliche Verarbeitung unterminieren. Diesen Vorgang der Sprachverstörung führt das Langgedicht ein um das andere Mal vor. Indem das Notat von Wahrnehmung immerfort enggeführt wird mit der Not der Sprachfindung – „Einmal kein Wort für etwas, das wäre alles, / mein Herz“6 –, entsteht notabene ein Geflecht von Nöten, existenzieller, philosophischer und sprachlicher Natur. Der beiläufig hingeworfene Satz „Mein Spiegelland ist abgebrannt“7 in diesem Zusammenhang verweist ja nicht nur auf ein eigenes Buch („Spiegelland“),8 sondern auf eine Heimatlosigkeit, die Drawerts Texte von Beginn an auszeichnete, nun aber einen Furor schieren Entsetzens entfaltet, der dem Furor globalkapitalistischer Auslöschungspraxis antwortet:
Hochgerechnet ist man, zum
Probanden der Fabrikanten geworden, schon tot, während
man testet, weil der letzte Subjektrest abgestellt wurde (und
dann nicht mehr erscheint). Bleibt nur, eine hohe Rendite,
und man kauft sich, was fortwährend gestohlen wird, zurück:
Uhren9
Der lyrische Diarist hat die gesellschaftlichen Krisen- und Zerfallsprozesse in Europa ebenso zur Kenntnis zu nehmen wie die Flüchtlingsströme aus dem Nahen Osten oder die islamistischen Terroranschläge im Herbst 2015 – allenthalben auch Zeichen der Verwerfung und Entwurzelung. Dieses Sich-Aussetzen liest sich deshalb so beklemmend, weil Drawert es versteht, ein engmaschiges Sprachgeflecht von Verweisungen, Korrespondenzen und Spiegelsituationen zu überantworten. Es ist ja nicht nur „das leere Rauschen der Fortschrittsversprechen“,10 oder dass „der Glaube an die Beständigkeit / der Welt“11 abhanden gekommen ist, sondern auch eine nietzscheanische Wiederkehr-Erfahrung mit der Ahnung, wie sich die Maschen zuziehen dem „Kreis-/gänger, die Wieder-/holung der Wieder-/holung er- / tragend“.12 Und „Am Ende / wird alles ein Kreis gewesen sein, der sich vollendet, und was / in Liebe nicht zerlegt werden konnte, war aus Stein“.13 Was bleibe, sei „das Nichts / und seine Ewigkeit“.14 Diese „Gedanken in Schleifen, die unendlich kreisen / und am Grunde immer rätselhaft sind“,15 lassen nicht nur Denk-Aporien und Bild-Paradoxa zuhauf zutage treten, sie sind auch getrieben von der Angst des Verstummens:
Wenn der Strom der Erzählungen abreißt, dann
lässt sich fühlen, wie einsam der Mensch ist, und davon
handeln fast alle Reden. Den Provokationen des Schweigens
folgt Angstschweiß, der die Gesichter der Prediger zeichnet.16
Dass der Ich-Sprecher in Drawerts Langgedicht alle Welt- und Sprachverungewisserung auf seine Kappe nimmt, führt notgedrungen an die Grenzen des Ertrag- und Sagbaren. Dass dies ohne Bramarbasieren und Larmoyanz erfolgt, ist der Kunstfertigkeit geschuldet, mit der der Autor seine Vorgangsfigur durch die Untiefen der Existenz, des Denkens und Fühlens zu führen versteht. Passagen der Introspektion folgen Lockerungsübungen tiefschwarzen Humors oder skurrile Alltagsnotate. Doch nie wird dabei das titelgebende Generalthema aus den Augen verloren: „Der Körper meiner Zeit“ inkludiert im Kern nichts anderes als die Kollisionen von geschichtlicher und eigener Lebenszeit, von Gesellschaftskörper und dem sterblichen eigenen. Diese ertragen zu können und nicht an ihnen zu verzweifeln, gar zugrunde zu gehen, bedarf es unabdingbar der Fähigkeit zur Liebe, denn „sie ist der einzige Stoff, der uns bindet an-/einander“.17 Wissend um ihre Endlichkeit und Fehlbarkeit, ist dem Sprecher doch eines gewiss:
denn wir folgen keinem Leitbild und keinem Gesetz, sondern
dem Wissen des Körpers und seinem Begehren, begehrt und
von anderen umschlossen zu sein, wie auch jedes Wort seine
Bestimmung nie im Mund dessen, der es sprach, wiederfindet18
Aber, da hilft auch die Beschwörung der Alraune nicht, auch die Liebe ist „haltbar nur wie Wasser (…), das kalt uns durch die Hände gleitet“.19 Das Gedicht verhandelt im Übrigen sehr nahegehend die Kasteiungen einer Liebestragödie, die in der Aufschreibzeit sich ereignete. Auftritt der Normen.
Drawerts Langgedicht ist auch deshalb eine Herausforderung, weil es absichtsvoll und konsequent aus der eigenen Erfahrung und ihrer Protokollierung heraus die Illusionen destruiert, noch irgendwie auf der „sicheren Seite“ des Behaustseins auf Erden sich zu wähnen. In der Klimax des Zerbrechens einer Liebe muss der Sprecher sich eingestehen:
(…) Denn nicht nur die Flüchtenden, von denen die Meere
sich nähren und die ersticken wie Vieh im Viehtransport über
die Grenzen, die es nur noch in Atlanten alter Jahrhunderte gibt,
sind ruhelos und auf der Flucht, nicht nur die Schwarzen, nicht
nur die Elenden – wir, alle, haben einen Ort verloren, den kein
anderer ersetzt. Daran ändert auch die Ewigkeit nichts, mit der
die Ingenieure des Fortschritts wie im Fieberwahn verhandeln.
(…)20
Die „transzendentale Obdachlosigkeit“,21 die Georg Lukács vor einhundert Jahren in der Theorie des Romans für das bürgerliche Individuum diagnostizierte, erfasst indessen alle Klassen und Schichten und globalisiert sich. Es sind die Konsequenzen dessen, was die „Ingenieure des Fortschritts“ in ihrem neoliberalen Globalisierungsfuror in den letzten Jahrzehnten ins Werk setzten und das nun als Zerstörungswerk von Heimaten, Lebensgrundlagen, kulturellen Identitäten noch längst nicht endigt. Dieses Unheilsgeschehen in packenden Bildern und Sequenzen zur Sprache gebracht zu haben, ist ein Verdienst mehr des Drawert’schen Langgedichts, das sich in diesen Passagen zu einer Menschheitsklage weitet: „Wenn jeder auf der Flucht ist, ist die Flucht keine Flucht mehr“,22 konstatiert der Sprecher zutreffend und bitter. Und die Obdachlosigkeiten sind sicher nicht mehr allein transzendentaler Natur. Der Sprecher sieht sich an der türkisch-syrischen Grenze dantesk mit Vergil auf den Limbus eines Flüchtlingslagers schauen und empfindet „das paradoxe Gefühl, Opfer eines grandiosen Betruges der Bilder zu sein und / einer Szene von obszöner Harmonie. Denn nur zwanzig Kilome- // ter von diesem Standort entfernt beginnt Syrien und damit das Reich des Krieges und der Toten“23
Kurt Drawert gelingt in seinem sechzigsten Jahr etwas, was große Dichtung auszeichnet: Eigene Befindlichkeiten stimmig mit den mondialen Aporien unserer Zeit zu verknüpfen, die Ich- und Welträtsel mit genauer Reflexion der schwierigen Relationen zwischen Ich, Sprache und Welterkenntnis. Hinzu tritt, dass das unausweichliche Parlando des Langgedichts wieder und wieder über die Dichtheit des semantischen Netzewerfens hinwegtäuscht. Oder wie der Sprecher resümiert:
Auch wenn am Ende alles endet am Anfang, folgt jeder Weg
anderen Wegen wie die Linie den Linien im zersplitterten Glas24
Peter Geist, aus TEXT+KRITIK: Kurt Drawert – Heft 213, edition text + kritik, Januar 2017
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Martin A. Hainz: „Gesammelte Gesamtschwierigkeiten“
fixpoetry.com, 27.9.2016
Johann Holzner: Ein neues Wintermärchen
literaturkritik.de, Dezember 2016
Timo Brandt: Das Buch der Allgemeinplätze und Selbstnischen
signaturen-magazin.de
Der Körper meiner Zeit
ist ein Langgedicht in fünf Teilen, eine fortlaufende lyrische Bewegung markierend, die die Jahreszeiten, bestimmte Orte und Themen miteinander verknüpft, das Begehren, die Liebe, das Nichts und den Tod. Und wie immer bei Drawert, die Möglichkeit des poetischen Sprechens überhaupt.
In erzählerisch weit ausholenden Versblöcken, in freier oder gebundener Rede, melancholisch, ironisch oder sarkastisch, bildstark und reflektierend, wird aus diesem Körper der Sprache ein Körper der Zeit. Er nimmt die Verwerfungen des Gegenwärtigen auf wie die Sehnsucht nach Dauer und Anwesenheit des sprechenden, lyrischen Ichs.
Ein starkes Motiv ist die Trauer um eine scheiternde, große Liebe, der im Innersten widerfährt, was auch in der Welt ist.
Fritz J. Raddatz, der Teile des Gedichts kannte, schrieb: „Kurt Drawert ist es gelungen, in makelloser Sprache, in brennenden Bildern zu bannen, was unser aller Existenz ausmacht: das Elend der Suche nach Glück.“ Beigeordnet ist eine Serie von Schwarz-Weiß-Fotos, die den Blick vom Schreibtisch auch zu einer Topographie des Textes werden lässt: „Blicke auf nichts“.
Verlag C.H. Beck, Klappentext, 2016
Nichts ist politischer als die Sprache
– Der Schriftsteller Kurt Drawert ist neuer Stadtschreiber von Dresden und erklärt, warum der Ort genau richtig für ihn ist. –
Widerspruch, Konflikt und Aufbegehren, das treibt die Texte des Schriftstellers Kurt Drawert an. Er schreibt Lyrik und Prosa und zählt zu den wenigen Autoren, die sich auch theoretisch zu ihrer Arbeit äußern. Der 62-Jährige verbrachte einen Teil der Kindheit und die Jugend in Dresden, war Hilfsarbeiter in einer Bäckerei, bei der Post und an der Landesbibliothek. In den Achtzigerjahren studierte er am Literaturinstitut Leipzig. Seit 1996 lebt er in Darmstadt. Dort leitet er das Zentrum für junge Literatur. Nun wird Kurt Drawert ein halbes Jahr lang mit einem Stipendium als Stadtschreiber in Dresden arbeiten.
Karin Großmann: Die alten Freunde im Osten sind unverständlich geworden, stellen Sie in einem Gedicht fest. In einem anderen Text beschreiben Sie die biografische Bindung an die DDR als einen fortwährenden Fluch. Warum kommen Sie dann zurück in den Osten?
Kurt Drawert:
Meine Freunde im Osten
verstehe ich
nicht mehr, im Landstrich
zwischen Hamme und Weser
kenne ich keinen.
Das steht in Ortswechsel, geschrieben Anfang der 90er-Jahre. Das ist nun wirklich nur noch historisch zu verstehen. Auch Gedichte, Texte werden einmal historisch. Sie archivieren Gefühle, die später abrufbar sind. Ein Geschichtsbuch kann sagen, was war, nicht aber, wie es war – das ist Sache der Literatur. Ich komme also ganz und gar nicht in den Osten zurück, wenn ich jetzt nach Dresden komme, sondern nach Dresden. Mich interessiert, was jetzt ist – und es ist natürlich immer auch eine Spur aus der Vergangenheit heraus und in Vergangenheit hinein. Die Geschichte ist gnadenlos, sie verfolgt jeden, bis zum Schluss.
Großmann: Was erwarten Sie?
Drawert: Arbeiten, schreiben zu können. Eine Spannung zu finden, die mich interessiert und bereichert.
Großmann: Gibt es etwas, woran Sie anknüpfen wollen?
Drawert: Ich weiß es nicht. Ich weiß nie sehr viel von den Dingen, die ich mir vorgenommen habe. Alles andere wäre mir langweilig.
Großmann: Woran werden Sie in Dresden arbeiten?
Drawert: An meiner Erinnerung.
Großmannn: Die Stadt hat gerade keinen guten Ruf. Warum haben Sie sich trotzdem um das Stipendium beworben?
Drawert: Die Welt an und für sich hat gerade keinen sehr guten Ruf, würde ich sagen, was soll da in Dresden schon anders sein. Natürlich liegen hier ein paar Nerven mehr blank, kommen Konfliktfelder zum Vorschein, die offensichtlich in der Gesellschaft produziert worden sind. Für mich als Schriftsteller ist der Konflikt das Interessante, der Riss, der Mangel. Warum sollte ich das meiden wollen? Einem Arzt würde man ja auch nicht sagen, er soll den Patienten, der bakteriell fiebert, am besten meiden, weil er sich anstecken könnte.
Großmann: Sie schreiben von Pegida, von Flüchtlingen in Heidenau. Ist es unter Schriftstellern nicht verpönt, Literatur mit politischer Meinung zu verbinden?
Drawert: Wo steht das denn? Nichts ist politischer als die Sprache – wie könnte es da einen Schriftsteller geben, der unpolitisch ist.
Großmann: In Ihrer Rede zum Kamenzer Lessing-Preis sagten Sie voriges Jahr: Die Welt verändert sich in einer Geschwindigkeit und Radikalität, für die es keine Sprache mehr gibt. Welche Folgen hat das für einen Schriftsteller?
Drawert: Nah am Verstummen zu sein, einerseits. Ebenso und andererseits arbeitet die Sprache stets mit, wird herausgefordert, das Zentrum der Konflikte zu finden und den Grund der situativen Verwerfung. Aber das Zitat muss richtig heißen, dass es für die Radikalität der Veränderung noch keine Sprache gibt. Das Unbewusste zu symbolisieren oder, poetischer, das Unaussprechliche zur Sprache zu bringen, das ist schon immer eine Funktion von Literatur gewesen. Eben weil sie sich dem Unbekannten, Fremden, Anderen zuwendet, vor dem konventionelle Texte – befangen in ihrer Vorstellung vom schon Bekannten – kapitulieren. Gewissheit aber ist das Gegenteil von Literatur, ihr Begräbnis sozusagen, ihr Tod.
Großman: Wie überzeugen Sie die Teilnehmer Ihres Literaturzentrums, in einer Krise weiterzuschreiben?
Drawert: Ich gebe ihnen keine Ratschläge. Wie auch sollte das gehen. Dann müsste ich ja Bescheid wissen über all das, was keinen Anfang und kein Ende, keinen Einschluss und keinen Abschluss findet, weil es ein andauernder, fortwährender Prozess ist – das Schreiben, das literarische Schreiben, das auch mir in seinem Wesen oft rätselhaft bleibt. Nicht als Produkt, sondern in seiner Genese, seinem Entstehungszusammenhang. Und eine Krise ist schließlich auch ein Text, er findet nur seine Schrift gerade nicht. Das ist eine hochinteressante Dialektik, finde ich. Reden und Schweigen. „Wir dürfen das Schweigen nicht brechen“, steht bei Abbé Dinouart, „außer wir haben etwas zu sagen, das besser als Schweigen ist.“ Ein Satz, den ich bemerkenswert finde, denn es wird viel zu viel geredet und viel zu viel geschrieben, wofür es am Ende gar keine Hörer oder Leser mehr gibt. Da kann es schon sinnvoll sein, die Worte fallen auch einmal aus. Nur so, als Warnung, kurz vor dem Ernstfall.
Großmann: Es wird nicht nur zu viel geredet, es wird auch brutal, anmaßend, ordinär geredet – wo sehen Sie Ursachen für diesen Sprachverfall?
Drawert: Ursachen gibt es viele. Eine Inflation der Zeichen, die für nichts mehr stehen, leer und verbraucht sind, ist ein Grund. Es gibt ja nicht nur eine Ökonomie der Waren und des Geldes, sondern auch eine der Sprache, die ebenso funktioniert. Worte werden verschlissen, konsumiert im rein materiellen, physiologischen Sinn, und plötzlich stehen sie für nichts mehr zur Verfügung. Dann kommt hinzu, dass wir von einer Präsenz der Bilder umgeben sind, die Sprache und Schrift mehr und mehr verdrängt, was mit Regressionen einhergeht und einer Verarmung der Sprache.
Großmann: Die Folgen sind allerdings fatal.
Drawert: Sprachverlust ist immer auch Erkenntnisverlust. In dieses Reale, nicht mehr Symbolisierte hinein drängt der Affekt. Primitive Sprachen sind affektbesetzter, weil sie keine Differenzen mehr haben, und damit auch aggressiver. Dann haben wir es mit medialen Formaten zu tun, die Sprache aus ihrem technologischen System heraus simplifizieren und naiv werden lassen. Wer hätte sich früher vorstellen können, dass man einmal Politik via Twitter betreibt? Das Weglassen, das Überspringen, die verlorene Spur der Erkenntnis – das sind gravierende Rückbildungen des Denkens und Sprechens, mit denen komplexe Systeme nicht mehr dargestellt werden können. Unsere Welt ist aber komplex, überkomplex geradezu. Auch hier hat Literatur etwas zu tun, Sprache beweglich zu halten, Worte vor ihrer medialen Vergiftung zu retten, vor ihrem Verschwinden.
Großmann: „Ich bin sehr gerne fremd und verstehe am liebsten kein Wort“, schreiben Sie – wo finden Sie so etwas wie Heimat?
Drawert: Gedichte sind empathische Momentaufnahmen und wahr allein dadurch, dass es diesen Moment einmal gab. Und wenn er zur Verallgemeinerung drängt, zur kollektiven Erfahrung, ist er auch von Bedeutung. Das Subjektivste wird dann das Objektivste zugleich. In diesem Fall war es Istanbul, wo ich für längere Zeit leben und arbeiten konnte, worauf sich diese Zeile aus meinem Langgedicht Der Körper meiner Zeit bezieht. Die Ironie wäre, könnte man die kontextuelle Einbindung lesen, wohl offensichtlich. So klingt es ein wenig nach ernster Behauptung. Aber es stimmt auch, dass ich mit einem Begriff von Heimat nicht viel anzufangen weiß.
Großmann: Warum nicht?
Drawert: Ich denke immer an bestickte Kissenbezüge dabei, warum auch immer. Für andere ist das anders, sie brauchen dieses in Wahrheit doch recht diffuse Gefühl, von Heimat umgeben – fast möchte ich sagen: behütet – zu sein, und das ist auch völlig legitim. Vielleicht ist dieser Ort des Anderen, Fremden für mich eine Bedingung des Schreibens, eine Perspektive des Außen die einzige Möglichkeit des Abstandhaltens. Man sieht ja nichts aus der Nähe, oder eben nur das, was man schon kennt.
Sächsische Zeitung, 21.6.2018
Laudatio auf den Lessing-Preisträger
2017 in Kamenz, den 21. Januar 2017
Es ist fürwahr eine weise Entscheidung, den Schriftsteller Kurt Drawert mit dem Lessing-Preis zu ehren. Sein gesamtes Schaffen ist stringent den hoch verwickelten Dialektiken von Selbst- und Welterkenntnis verpflichtet und damit auch dem Erbe aufklärerischen Denkens. Aufklärung nach den Fortschrittseuphorien des späten 18. und des 19. Jahrhunderts hatte seit Anbeginn der Moderne, so sie denn den Begriff noch sinnvoll mit Bedeutungen laden wollte, sich mit den „Rückseiten der Herrlichkeit“ (Drawert) ebenso ins Vernehmen zu setzen wie mit den Umwälzungen in Wissenschaften, wie der Physik, Psychologie, Semiotik, Soziologie, Anthropologie im 20. und 21. Jahrhundert. Kurt Drawert nahm sich dieser Sisyphos-Arbeit in bewundernswerter Intensität an, und dies in allen literarischen Gattungen. Von Beginn an empfand er es als „eine enorme Bereicherung, ein Objekt so drehen zu können, dass es immer auch seine Rückseite zeigt, sein abgewandtes, zweites System. Die Wahrheit hält immer auch ihr Gegenteil umschlossen, und deshalb besitzen wir sie nicht.“ Nicht Hybris, sondern Demut angesichts unserer Erkenntnisbegrenzungen dirigiert sein gerade deshalb hartnäckiges Insistieren auf ein Mehr an Durchschaubarkeit in schier undurchschaubaren, angsteinflößenden Verrückungen im Weltgefüge. Es bedarf allerdings einer mit Foucault und Lacan unterfütterten Erkenntnisarbeit, die die Dispositive der Macht ebenso einschließt wie die unbewussten Seiten politischen Verhaltens in Verhältnissen, um die damit verbundenen Kapriolen der Differenzen von Sprachbestand und Sprachverwendung bloßzulegen, mündend etwa im Topos vom „entleerten Signifikanten“. Das dünkt nun ziemlich theoretisch, bildet aber Denkgerüste aus, um scheinbar singuläre Ereignishaftigkeiten in Zusammenhänge zu binden und damit überhaupt erst geschichtlich zu verorten. Deshalb, liebe hoffentlich zahlreich zuhandene Freunde des Ballsports, erlaube ich mir zwei Abschweifungen in die unmittelbare Aktualität der Sportnachrichten nebst verallgemeinerbarer Ableitungen:
Nachdem, wie Sie alle mitbekommen haben, die Erbscheichs durch Stimmenkauf eine Fußball-WM in den katarischen Wüstensand gesetzt haben werden, sorgten sie nun im Verein mit einem ägyptischen Weltverbandsdiktator und Funktionärsblindheit zudem dafür, dass Millionen deutsche Handballfreunde in die nur noch im Sprachgebrauch vorhandene Röhre schauen dürfen. Die nackte Profitgier weniger Ultrareicher obsiegt nicht nur hier symbolisch, sondern handfest über das Handball-Fest, die bislang gültige Selbstverständlichkeit, eine Handball-WM fernseherisch verfolgen zu dürfen. Der Signifikant WM trudelt ins Leere, weil sich das Signifikat der Wahrnehmung genau jetzt entzieht. Auch die von der FIFA gerade verfügte Ausweitung der FußballWM-Teilnehmerzahl auf 48 Mannschaften gegen jede Vernunft gibt beredte Auskunft über die Entleerung von Sinngehalten, sprich: über die Herrschaftsübernahme weitgehend leerer Signifikanten. Sportpolitik auch semiotisch zu lesen habe ich nicht zuletzt bei Kurt Drawert gelernt. Ende der Abschweifung.
Es ist nötig, einmal mehr darauf zu verweisen, dass der Nukleus des Drawertschen Insistierens sich sehr früh ausbildete, in der Umgebung des verblichenen anderen deutschen Staates und familiärer Beladenheiten, die Fluch und Quell zugleich gewesen waren. Es war ein „Konfliktzentrum als die Schnittstelle von Macht, Körper und Sprache – wobei Sprache schon zur symbolischen Ordnung gehört, die Macht und der Körper indessen zum Realen und seiner Unerkennbarkeit, seiner Kontingenz. Diese Ströme zu beschreiben, wie sie zwischen Körper, der immer doppelt, also für sich und für andere, existiert, und Macht, die vergesellschaftet auftritt und natürlich dispositiv, also über ihre Positive (Hegel für Institutionen und Körperschaften) hinaus wirkt, gehört für mich zur höchsten Form eines politischen Handelns.“
Diese Trias Macht – Körper – Sprache bestimmte entschieden schon die Komposition des ersten Gedichtbandes Zweite Inventur, 1987 im Aufbau-Verlag veröffentlicht. Bereits das Eingangs-„Gedicht im Juni, Juli, August“, dessen Titel so unverfänglich brinkmannsch klingt, macht unmissverständlich klar, wie fertig dieser Autor hier bereits mit jedweder Art von ideologisch untermauertem Glücksversprechen war:
Fertigbedeutungen und Fertiggerichte.
Die Geschichte war fertig. Die Gegenwart
war fertig, die Zukunft, die Revolution,
die Antworten waren fertig. Mein Außen-
und Innenleben war fertig, ein Schnittmusterbogen
auf der letzten Seite der Wochenendbeilage
Wenige Zeilen weiter heißt es:
Die Realität kam auf Stelzen, eine gläserne
Vettel, die durch die Vorstellungen lief
mit der Aufschrift Vagina, dort, wo sie
geschlechtslos war.
Nachdrücklicher und treffender kann Distanz zum Herrschaftsdiskurs kaum formuliert werden. Insofern verwundert es wenig, dass der Epochenbruch 1989/90 keine ästhetische Zäsur zeitigte, „nur weil sich die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert hatten. Vielleicht habe ich mein Textbewusstsein mehr als zuvor auf seine Struktur hin entwickelt, auf die Art und Weise der Rede anstatt darauf, was die Rede selbst sagt oder zu sagen beabsichtigt. Mehr aber auch nicht.“ Wohl aber befeuerten die geschichtlichen Umbrüche dieser Zeit eine eruptive Produktivität, die in Gedicht, Essay, Prosa, Dramatik und Herausgeberschaften zu Buche schlug. In den neunziger Jahren fokussierten seine Arbeiten notwendig auf das Ausleuchten seiner Herkunftsgesellschaft, so etwa im Roman Spiegelland, in dem der Diarist bereits ahnt:
Wir sind mit Dutzenden von verlogenen Begriffen aufgewachsen, die wir im ehrgeizigen Alter der Kindheit unbedarft und schamlos vor uns hingesagt haben und die wir auswendig lernten wie fremde Vokabeln, ohne zu wissen, daß sie ein Leben und eine Existenz von innen heraus nur zum Scheitern bringen, wenn man sich ihrer nicht rechtzeitig entledigt so gut es geht, und vielleicht, denke ich, bedarf es eines ganzen Lebens, sich dieser Begriffe zu entledigen.
Wie kaum ein anderer deutscher Schriftsteller hat sich Kurt Drawert dieser lebenslangen Entledigungsarbeit verschrieben, genau und elegant. Was seinen Erkundungsgängen seit den neunziger Jahren eine bis heute bleibende Aktualität verleiht, ist die Fähigkeit, Gesellschafts-, Kultur- und Alltagsgeschichte, das Begehren des einzelnen und Sehwarmbewegungen von Menschengruppen, literarische Vibrationen, Psychologie und Semiotik miteinander zu verknüpfen. Und dies unter den Auspizien der alles bestimmenden Frage nach den Humanisierungsofferten zivilisatorischer Gesellschaftsverfasstheiten. Unter diesen nämlich erweist sich die bis zum heutigen Tag fortgeführte Kalte-Kriegs-Rhetorik im Namen der jede Differenzierungsintelligenz beleidigenden „Totalitarismus-Theorie“ als obsolet insofern, als Drawert die gegenseitige, auch projektive Bezüglichkeit beider Systeme in den Deutschländern des 20. Jahrhunderts herausschälte. Drawerts Hellsichtigkeiten in den neunziger Jahren, die wenig aufgegriffen worden waren, stellen indes Verständigungsangebote dar, die allerdings einen komplexen Reflexionshorizont erfordern. In dem den Zustand unserer Zivilisation ausleuchtenden Essay „Der Ausverkauf der Leere“ heißt es etwa:
Der Osten hat sich im Kollaps davongemacht und seine ruinösen Hinterlassenschaften an den Westen abgetreten; er hat sich in das Privileg seines Unterganges geflüchtet und sieht nicht ohne Siegermiene im Staub liegend zu, wie er den Westen mit seinen Trümmern kaputtmacht. Was er als Konkurrent nicht geschafft hat, schafft er als Leichnam mit seinen Giften. Es ist wie nach Ablauf eines Pachtvertrages, wenn die Deponien plötzlich zu sind, auf denen man seinen Sondermüll abkippen konnte. Jetzt kreist der Überschuß im eigenen System, und selbst wo er noch weiter in den Osten kanalisiert wird, wird er bald an seine Entstehungsorte zurückgeschwemmt werden. Ein elementares Gleichgewicht ist damit gebrochen; ein Gleichgewicht, das gerade aus einer Unvereinbarkeit zweier sich gegenüberstehender Systeme hervorgegangen war und das darin bestanden hat, im komplementären Gegenüber die explizite Funktion zur Sicherung der eigenen Wahrheit zu finden.
Da die Texte Drawerts stets der inhärenten Widersprüchlichkeit ihrer Gegenstände auf der Spur sind, sind auch seine Vorgangsfiguren in Prosa und Essay stets Spaltungsfiguren, Zerrissene. Gerade erst vor wenigen Wochen stellte er gesprächsweise als Zentrum seines Insistierens heraus:
Und damit bin ich bei mir, meiner Literatur, die mir selber völlig unvorstellbar wäre, würde sie nicht immer wieder, und immer wieder anders und neu, das gespaltene Objekt der Geschichte betrachten.
An dieser Stelle darf ich einflechten, dass vor der Betrachtung oftmals das Erfahrene im buchstäblichen Sinne steht: So reist er in den neunziger Jahren mit der Transsibirischen Eisenbahn durch Russland, er sucht in Polen Vernichtungslager auf, er ist mit Kafka in Prag, er macht sich mit „Emma“ auf den photographisch bebilderten „Weg“ zu Gustave Flaubert, er nutzt Stipendienaufenthalte in Istanbul oder New York für genaues Anschauen und Introspektion. Und er kehrt zurück mit hinreißender Prosa im Gepäck und intensiven Gedichten, wie jüngst Matrix America oder Der Körper meiner Zeit. Und immer wieder Essays: Ob Kurt Drawert über Büchner nachdenkt, ob er die Unsinnigkeit des literarischen Tagebuchs, die deutsch-deutschen Obliegenheiten oder die kulturellen Konsequenzen des Internet-Umgangs reflektiert, seine Essays sind nicht nur brillant geschrieben, sondern stets komplex in der Analyse und aufregend erkenntnisheischend, weil er es nicht bei Symptombeschreibungen belässt, sondern radikal, an die Wurzeln gehend, Strukturen in ihrem geschichtlichen Gewordensein analysiert. Gerade deswegen sind seine Interventionen in aktuellen Diskussionen nicht selten als spielverderberische Verstörung aufgenommen worden. So hat er wieder und wieder darauf verwiesen, dass die Herstellung der politischen Einheit Deutschlands nicht verwechselt werden darf mit mentalem Zusammenwachsen:
Das ist ja auch der latente Euphemismus der politischen Metapher: ,Es wächst zusammen, was zusammen gehört‘, der die Wahrheit verleugnet. Zwei bis in die Codierungen der Körpersprachen anders funktionierende Kultursysteme, wie es die des ehemaligen Ostens und des Westens nun einmal waren, können sich unmöglich innerhalb der Generationen, die dieser Spaltung ausgesetzt waren, vereinen im Sinne von ,zusammenwachsen‘. Im Gegenteil, die Verschiedenheit anzuerkennen, das Unzusammengehörige als souveränen Bestandteil des Anderen, wäre die einzig adäquate Position einer politisch aufgeklärten Kultur.
„Ostdeutsch verwundet / und westdeutsch verwaltet“, wie es in einem Gedicht von Drawert heißt, hatte der seit Mitte der neunziger Jahre in Darmstadt wohnende Autor diese Verschiedenheit auch in sich selbst auszutragen. Doch hat er diese „niemals als Defizit erlebt, diese Spaltung, diese Ortlosigkeit, sondern als eine sehr besondere Quelle der Kraft und Orientierung,“ Die Ost-West-Spaltung wird seit den neunziger Jahren überformt durch jene zwischen den kreatürlichen Bedürfnissen des Menschen und den neoliberalen Zurüstungen der Selbstverwertungsmonade Mensch, deutsche Ortlosigkeit durch globale Dystopisierungen. Zur Unersetzbarkeit insbesondere der Poesie gehört, dass sie Frühwarnsignalements auszusenden vermag von erst geahnten gesellschaftlichen Verwerfungen. Drawerts Gedichte sind angefüllt mit solchen Ahnungen. In dem Gedicht „Keine Zeit“, geschrieben um die Jahrtausendwende, heißt es etwa:
Mit dem Land
ginge es abwärts, heißt es.
Kein Fußball, kein Tennis, das durchzieht, es ist die reine
Aussicht auf gar nichts.
Jemand kratzt an der Haustür
und will, daß ich öffne.
Es kann nur der Tod sein
im Anzug eines Handelsvertreters
mit Rabattangeboten. Er stiehlt
Augenblicke und verkauft sie
als Uhren.
Das waren zu Beginn des digitalen Zeitalters fast prophetische Verse. Heute erscheinen die „Zeitdiebe“, die Michael Ende in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts noch als „graue Männer“ beschreiben konnte, weitgehend anonymisiert, womit sich neue Aspekte der gestohlenen Lebenszeit ergeben. Kurt Drawert 2016:
In der digitalen Moderne gerät auch das Narrativ der Welt in Gefahr, weil es im Unendlichen der Netze verschwindet. Globalisierung heißt ja auch, mit allen und allem gleichzeitig im Gespräch zu sein und demnach keines mehr wirklich zu führen. Das hebt die Zeit auf, sie dissoziiert, zerfließt, wie im Reich der Toten.
Der komplette Infarkt aller Zeichensysteme sei damit zu einem realen Problem geworden. Genau diese Problematik erhebt die jüngste Veröffentlichung des Preisträgers, das grandiose Langgedicht Der Körper meiner Zeit, zum Thema. Drawerts Vers-Opus ist auch deshalb eine Herausforderung, weil es absichtsvoll und konsequent aus der eigenen Erfahrung und ihrer Protokollierung heraus die Illusionen destruiert, noch irgendwie auf der „sicheren Seite“ des Behaustseins auf Erden sich zu wähnen. An zentraler Stelle geht die Rede:
… Denn nicht nur die Flüchtenden, von denen die Meere
sich nähren und die ersticken wie Vieh im Viehtransport über
die Grenzen, die es nur noch in Atlanten alter Jahrhunderte gibt,
sind ruhelos und auf der Flucht, nicht nur die Schwarzen, nicht
nur die Elenden – wir, alle, haben einen Ort verloren, den kein
anderer ersetzt. Daran ändert auch die Ewigkeit nichts, mit der
die Ingenieure des Fortschritts wie im Fieberwahn verhandeln.
Eine Welt, in der acht Menschen so viel besitzen wie die Hälfte der Menschheit, beginnt sich selbst aufzufressen, und seit gestern darf ein Kannibale Staatenlenker spielen in gods own country. Der Kapitalismus ist bei sich selbst angekommen und dem einzigen Fetisch, den er vergötzt: Der Profitrate, deren Klimax bereits vor 150 Jahren von einem englischen Gewerkschafter hellsichtig beschrieben und von Marx in einer Fußnote im Kapital übernommen wurde:
Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. 10 Prozent sicher, und man kann es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens. Karl Marx, Das Kapital, Band 1 (MEW Bd. 23, S. 788, Fußnote 250).
Wenn Gotthold Ephraim Lessing am Beginn des bürgerlichen Zeitalters hochgemut in Briefen die Humanität zu befördern gedachte, so hat sein Nachfahre es mit Endigungen zu tun, dem Infarkt an entleerten Zeichen wie der allmählichen Auflösung von Vereinbarungen über humane Werte. Was indes beide eint, ist die Lauterkeit der Wahrheitssuche, die Chuzpe, unbequem und mutig jeweilige Herrschaftsdiskurse in Frage zu stellen und nicht zuletzt eine mehrbödige Ironie, die diesen Unterfangen immer auch lustbetonte Momente der Befreiung beizugeben vermag.
Peter Geist, Ostragehege, Heft 83, 1.3.2017
Joke Frerichs: Deutsche Zustände
Fakten und Vermutungen zum Autor + DAS&D + KLG
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA
Video Porträt: Ute Döring & Kurt Drawert.



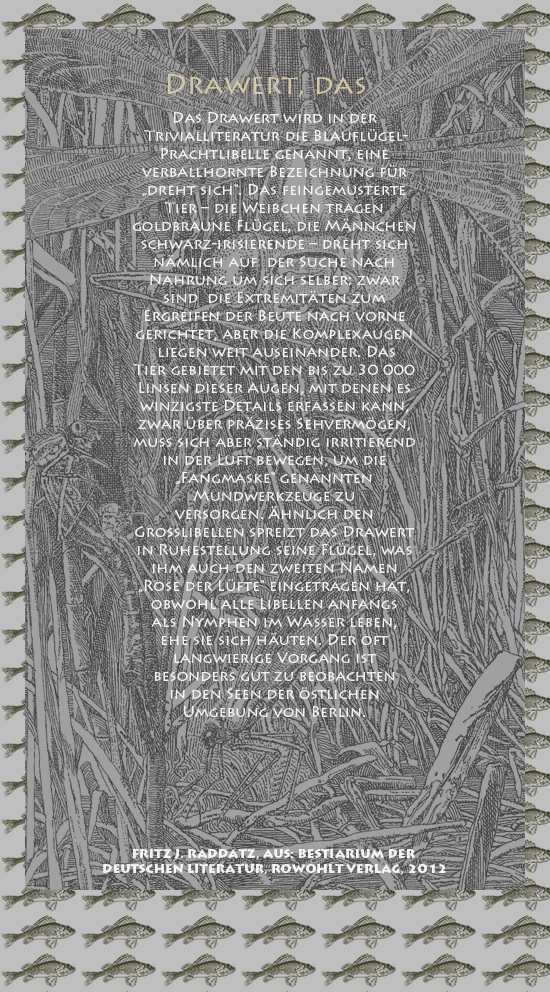












Schreibe einen Kommentar