Reiner Kunze: Vögel über dem Tau
NEUJAHRWUNSCH FÜR MEINE KRITIKER
Ich, Sträfling K.
in Zelle Lyrik,
bin auch am
Neujahrstag rührig,
dank allen, die geschrieben.
Wünsch euch,
ihr hohen Richter,
das neue Jahr
voll Dichter,
die euch lieben
Vögel über dem Tau (1959)
Nach dem Ungarnaufstand im Jahre 1956 wurden im Kontext eines von Ulbricht propagierten verstärkten Kampfes gegen Revisionismus, Dekadenz und Formalismus in Kunst und Literatur stellvertretend einige Literaturwissenschaftler und Schriftsteller öffentlich kritisiert und attackiert, so daß sich der Diskussionsspielraum spürbar verringerte. Als Hauptverantwortlicher für die Virulenz des sogenannten revisionistischen Gedankenguts wurde immer wieder Georg Lukács angegriffen. Blochs Konzeption eines „menschlichen Sozialismus“ bezeichnete man als „schädlich“, und Alfred Kantorowicz, mit Bloch eng befreundeter Literaturprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin und Herausgeber der auf Dialog und Grenzüberschreitung setzenden Zeitschrift Ost und West, wurde vom stellvertretenden Kulturminister Abusch und späteren Nachfolger Bechers als „schuftiger und zugleich jammervoller Verräter“ beschimpft. Abusch blieb es auch vorbehalten, die ideologische Offensive in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre anzuführen und die Methode des sozialistischen Realismus als „geschichtliche Notwendigkeit“ zu propagieren.
Während der international renommierte Hans Mayer vor unmittelbarer Verfolgung geschützt blieb, konnte sich der damals kaum bekannte Bloch-Schüler Gerhard Zwerenz der Verhaftung nur durch die Flucht in die Bundesrepublik entziehen. 1957 verließ auch Alfred Kantorowicz die DDR. Der Philosoph Wolfgang Harich und der Schriftsteller Erich Loest wurden verhaftet und zu hohen Haftstrafen verurteilt. 1959, als Reiner Kunzes Gedichtband Vögel über dem Tau im Mitteldeutschen Verlag erschien, verließen Heinar Kipphardt und Uwe Johnson die DDR. Im Rückblick hat Reiner Kunze das Jahr 1959 als „Stunde Null“ in seinem Leben bezeichnet, mit der bei ihm die „große politische Desillusionierung“ einsetzte und die noch genauer zu beschreiben ist. Doch abgesehen davon, daß es in der politischen Geschichte ebenso wie in der individuellen Lebensgeschichte eine wirkliche Stunde Null nicht geben kann, ist in Kunzes zweitem Gedichtband kaum etwas zu entdecken, das schon auf eine grundlegende poetologische, philosophische oder ideologische Neuorientierung hindeuten würde.
Die Gedichte des Bandes Vögel über dem Tau, dessen Untertitel „Liebesgedichte und Lieder“ das vermeintlich Unpolitische des Titels noch verstärkt, lassen sich in zwei Gruppen unterteilen, die sich sowohl inhaltlich als auch stilistisch deutlich voneinander unterscheiden. Der Band dokumentiert die „Dichtung einer Übergangszeit“, wie sie von Anneli Hartmann für die Lyrik der Jahre 1957 bis 1961 nachgewiesen werden konnte, und zeigt Kunzes Schwanken zwischen einer – wenn auch kleineren – Gruppe illustrativ-propagandistischer Gedichte, zu der auch das aus dem Band Die Zukunft sitzt am Tische übernommene Gedicht „Am Rande bemerkt“ zu zählen ist, und zahlreichen persönlichen, leisen Versen, die zumeist dem Thema Liebe gelten. Diese Zweiteilung des Bandes manifestiert sich allein schon in der Lexik. Einem semantisch überaus konkreten, dezidiert politischen Vokabular wie „Soldat“, „Bergmann“, „Arbeiterjunge“, „Proletariat“, „Gesellschaft“, „Partei“, „Republik“, „Klasse“, „Genosse“, „Arbeiter und Bauern“ stehen vieldeutige, traditionell lyrische Worte wie „Brunnen“, „Rose“, „Mond“, „Liebe“, „Traum“, „Vogel“, „Himmel“, „Stille“, „Schweigen“, „Brief“, „Augen“ oder „Blau“ gegenüber, auf die Kunze auch in seinen Gedichten der kommenden Jahrzehnte immer wieder zurückgreifen wird.
Dabei gelingen Kunze wie schon andeutungsweise in dem Band Die Zukunft sitzt am Tische einfach formulierte Liebesgedichte in traditioneller Bildsprache, die auf jede demonstrativ politische Botschaft verzichten. Der kleine Zyklus „Gedichte, die mein Mädchen schwieg“, enthält Texte, die Kunze noch 1986 in eine Auswahl von hundert seiner Gedichte aufgenommen hat. In einigen Liebesgedichten findet sich bereits die für die späteren Gedichte Kunzes so charakteristische Wendung der Introspektion „in uns“. Ferner dominiert in den Liebesgedichten die noch heute für Kunzes Selbstverständnis zentrale Kategorie der Stille, und Naturbilder und -symbole gewinnen wie in folgendem Gedicht aus dem Jahre 1956 an Bedeutung:
Rudern zwei
ein Boot,
der eine
kundig der Sterne,
der andre
kundig der Stürme,
wird der eine
führn durch die Sterne,
wird der andre
führn durch die Stürme,
und am Ende, ganz am Ende
wird das Meer in der Erinnerung
blau sein.
Gerade das Lied jedoch gerät Kunze zum Medium des Agitprop, zum Vehikel ideologischer Verlautbarungen. So lautet im „Lied vom Parteiergreifen“ das „den Arbeiterstudenten gewidmet“ ist, die Kritik des Arbeitersohnes an den Kommilitonen:
Manche scheun Opfer,
der Klasse zu dienen,
an deren Tisch sie essen.
Arbeiter, schenkt nicht
Studenten das Brot,
die die Opfer der Klasse vergessen.
In solchen Versen zeigt sich Kunzes redlich-naive Überzeugung, nicht aber das Kalkül jenes ängstlich taktierenden Autors, den Anna Seghers in ihrem mutigen Hauptreferat „Der Anteil der Literatur an der Bewußtseinsbildung des Volkes“ auf dem VI. Schriftstellerkongreß im Januar 1956 wie folgt beschrieben hat:
Er sieht unsere Weltanschauung, die Lehren und Anweisungen unserer Partei als Dogmen an, die er schematisch genau in der Kunst befolgt […] Anstatt genau so gründlich die Wirklichkeit zu studieren, geht er umgekehrt vor: Er sucht in der Wirklichkeit nach Teilen und Teilchen, die ihm geeignet erscheinen, um das vermeintliche Dogma zu illustrieren. Er denkt: dann kann mir nichts Schlimmes passieren.
In dem episch-balladesken Gedicht „Mein 25. Geburtstag“ versucht Kunze, seinem Hamonisierungsbedürfnis dadurch Ausdruck zu verleihen, daß er wie schon in „Das neue Gedicht“ eine Brücke schlägt zwischen Ich und Wir, Individuum und Gesellschaft, Künstler und Arbeiter. Das lyrische Subjekt, das bereits vor Tagesanbruch die Einsamkeit des Anglers gesucht hat, läßt er am Abend den (ideologisch) angestammten Platz unter den Arbeitern einnehmen:
Mit Bergleuten saß ich abends am Tisch.
Sie waren fünfzig Jahre alt.
Wir stießen an
auf meinen fünfundzwanzigsten Geburtstag.
Sie schlugen Erz seit neun,
seit zweiundzwanzig Jahren Kohle.
Wir tranken
auf meinen fünfundzwanzigsten Geburtstag.
Und selbst das in seiner dialogischen Struktur und seinen pointierten Schlußversen spätere Gedichte antizipierende Gedicht „Antwort“ aus dem Jahre 1956 ist letztlich bestimmt von dem Gedanken der Synthese, der Versöhnung zwischen den Generationen und der Beschwörung einer Harmonie zwischen Kunst und Leben, Liebeslyrik und Arbeitswelt.
ANTWORT
Mein Vater, sagt ihr,
mein Vater im Schacht
habe Risse im Rücken,
Narben,
grindige Spuren niedergegangenen Gesteins,
ich aber, ich
sänge die Liebe.
Ich sage:
Eben, deshalb.
Die Harmonisierungstendenz dieses formal beachtlichen, in seiner epigrammatischen Zuspitzung an Brecht geschulten Gedichts nennt Herbert Strickner eine „Rechtfertigungsstrategie“, hinter der sich das Bedürfnis des Ich verberge, mit dem Kollektiv, dem Ihr, übereinzustimmen. Auch im selbstbewußt formulierten Gedichtschluß vermag Strickner wenig künstlerische Selbstbestimmung zu erkennen:
Die Zurschaustellung seiner Herkunft als Arbeitersohn, um damit seine Liebesgedichte zu legitimieren, zeugt eher von Abhängigkeit als von Eigenständigkeit.
Poesie und Politik werden in den Gedichten des Bandes Vögel über dem Tau nur selten dialektisch in Beziehung gesetzt. Die politischen Verse sind geprägt von Affirmation und pädagogischer Deklamation. Die Liebesgedichte hingegen sind, von gesellschaftlichen Aspekten losgelöst, vor allem Kennzeichen einer Introspektion und eines Rückzugs in die persönliche Sphäre.
Kunzes besondere Affinität zur Musik führt ihn in dieser frühen Schaffensperiode zu einer folgenreichen Zusammenarbeit mit dem Komponisten Heinz Krause-Graumnitz, dem der Gedichtband Vögel über dem Tau gewidmet ist. Die Liedtexte Kunzes, oft Auftragsarbeiten des Rundfunks oder der DEFA, sind teilweise nichts anderes als durch Rhythmus, Reim und Refrain gefällig transportierte Ideologeme.
Im „Lied von der Sauberkeit“ wird Kindern sehr suggestiv die Notwendigkeit eines bewaffneten Friedens und die Möglichkeit eines gerechten Krieges vermittelt:
Wir sind friedliche Leute.
Wenn andre Mütter Flieger gebaren,
die einen Kupferschmied
und eine Alte, die sauber macht im Kindergarten,
umbringen sollen,
muß der Sohn des Kupferschmieds
und der Alten, die sauber macht im Kindergarten,
schießen lernen,
denn sie sind friedliche Leute.
Denkt man angesichts solch simplifizierender ,Argumentation‘ an das Kapitel „Friedenskinder“ aus dem Prosaband Die wunderbaren Jahre, wo Feindbilder in den Köpfen der Heranwachsenden als Resultat indoktrinierender Praktiken im Erziehungssystem der DDR entlarvt und gebrandmarkt werden, wird die inhaltliche Diskrepanz zwischen Kunzes schriftstellerischen Anfängen und seinen späteren gesellschaftskritischen Arbeiten deutlich sichtbar.
Im Jahr 1959 indes, als der Gedichtband Vögel über dem Tau erschien, schrieb Kunze, der „die sozialen und psychologischen Voraussetzungen mitbrachte, ein Lieblingskind der offiziellen Kulturpolitik zu werden“, ein epigrammatisches Gedicht, das zwar erst in den späten sechziger Jahren und nur in der Bundesrepublik veröffentlicht wurde, das aber neben zwei weiteren, lange Zeit unpublizierten Gedichten aus demselben Jahr als Schlüsseltext bezeichnet werden muß, in dem sich Kunzes dichterisches Vermögen und seine künstlerische Entwicklung bereits zu erkennen geben.
ETHIK
Im mittelpunkt steht
der mensch
Nicht
der einzelne
Dieses in der DDR niemals veröffentlichte Gedicht will gesellschaftliche Widersprüche nicht aufheben, sondern aufzeigen. Das erste Verspaar zitiert Artikel 2 der DDR-Verfassung, der den Menschen in den Mittelpunkt „aller Bemühungen der sozialistischen Gesellschaft und ihres Staates“ stellt. Das zweite Verspaar mißt den Verfassungstext an der gesellschaftlichen Realität und „enthüllt den Gegenatz zwischen dem allgemeinen Bekenntnis zu einem abstrakten Humanitätsideal und der Mißachtung der Rechte des Einzelmenschen.“ Die Harmonisierungstendenz der frühen Gedichte hat hier einer gesellschaftskritischen Haltung des Schriftstellers weichen müssen, der beabsichtigt, „das Phrasendreschen zu entlarven, indem er auf Ungereimtheiten aufmerksam macht.“
Das Gedicht „Ethik“ aber bleibt eine Ausnahme im Frühwerk Kunzes, der sich ab 1959 zwar verstärkt darum bemühte, sein Selbstverständnis als Schriftsteller in der DDR zu finden, sich bei diesem „Zu-sich-selber-Kommen“ aber zunächst vornehmlich an Johannes R. Becher, der kulturpolitisch maßgeblichen Figur jener Jahre, orientierte.
Heiner Feldkamp: Poesie als Dialog. Grundlinien im Werk Reiner Kunzes, S. Roderer Verlag, 1994
Vom Kollektiv zum Individuum
– Zur frühen Lyrik Reiner Kunzes. –
Mit diesen beiden Begriffen, Kollektiv und Individuum, soll der Weg des Schriftstellers Reiner Kunze von den ersten Lyrikpublikationen bis zum Gedichtband Widmungen aus dem Jahr 1963 gekennzeichnet werden. In ihrer Polarität wollen sie zugleich auf das Widersprüchliche dieser Entwicklung hinweisen: die Wandlung Kunzes vom Systemapologeten zum Ideologiekritiker, vom Parteidichter zum Vertreter einer subjektiven und autonomen Poesie – der Umweg Kunzes von der Verherrlichung des Kollektivs zum Plädoyer für den einzelnen Menschen.
1. Perspektive: Selbstgestaltung durch Orientierung am Kollektiv
Die Untersuchung der frühen Gedichte Reiner Kunzes, nach eigener Aussage „Produkte eines poetologisch, philosophisch und ideologisch Irregeführten“, will nicht in den Fehler des Hochmuts verfallen, besserwisserisch einem Autor dessen ,Jugendsünden‘ vorzuhalten. Vielmehr ist beabsichtigt, durch die Analyse des im Frühwerk zum Ausdruck kommenden Menschenbildes Kunzes spätere ästhetisch-weltanschauliche Position verständlich zu machen. Mit den Worten des Autors:
Auch wenn man heute nicht mehr dazu stehen kann, ist es etwas Gewachsenes, ein Stück Entwicklung.
Die Skepsis und Ideologiekritik, die in den ab 1960 entstandenen Texten – nach der „Stunde Null“ im Jahre 1959 – beobachtet werden können, wurzeln in Kunzes anfänglicher bedingungsloser Hingabe an die Ideologie von Staat und Partei der DDR, die wohl aus seiner Biographie zu erklären ist:
Der Sohn eines Bergmannes und einer Kettlerin, die sich mit Heimarbeit durchschlug, brachte die sozialen und psychologischen Voraussetzungen mit, ein Lieblingskind der offiziellen Kulturpolitik zu werden.
Der folgende Abschnitt nun versucht zu zeigen, wie Kunze den Forderungen einer „sozialistischen Volkslyrik“, „Volkstümlichkeit und Parteilichkeit“ nachgekommen ist.
1.1. Reiner Kunzes Referat „Über die Lyrik als dichterisches Heldendasein des Lyrikers und des Volkes“
In seinem 1959 gehaltenen Referat „Über die Lyrik als dichterisches Heldendasein des Lyrikers und des Volkes“ diskutiert Kunze das Problem der „Selbstgestaltung“ des Dichters und zitiert dabei aus Johannes R. Bechers Werk Verteidigung der Poesie:
„Für wen schreibst du?“ Nicht diese Frage ist es, die an den Dichter gerichtet wird, wie einige in der Dichtung unerfahrene Leute nach wie vor annehmen… „Wer bist du, der du schreibst?“ Diese Fragestellung geht tiefer und ist die eigentliche Lebensfrage jedes Dichters.
Weist diese Frage nach dem Ich des Dichters, die auch die Forderung nach Subjektivität und Autonomie der Dichtung enthält, auf Kunzes zukünftiges Schaffen voraus, so geht ihre Beantwortung doch in jene Richtung, die Becher zu Ende seiner Ausführungen eingeschlagen hat:
Der Dichter muß sich zu einem solchen ausbilden, daß all das, was ihn selbst freudig oder leidvoll bewegt, zugleich Glück und Not des ganzen Volkes bedeutet – alsdann wird er in der Selbstgestaltung das Höchste erreichen, was ihm gegeben ist: Spiegel der Seele, Ausdruck des Traumes und des Willens seines Volkes zu sein.
Die Ablehnung der Frage „Für wen schreibst du?“, die auf das Kriterium der Verständlichkeit und damit auf die Verinnerlichung des „Willens des Volkes“ abzielt, mündet für Kunze (noch) nicht in ein Plädoyer für die Freiheit des Dichters, über Auswahl und Gestaltung seiner Themen und Stoffe eigenständig zu verfügen. Die Außensteuerung des Schriftstellers verdeutlicht die folgende Passage seines Vortrags:
Ein progressiver Lyriker wird… vorwiegend solche Erlebnisse gestalten, die „etwas Großes und Bedeutendes“ aussagen, „das nicht nur den Dichter selbst oder einen engen Kreis von Menschen, sondern die breitesten Leserschichten interessiert.“
Eine „Macht des Lyrikers“, die „erkannt werden (muß), zuerst von ihm selbst“, sieht Kunze in der Identifikation des Lesers mit dem Aussagesubjekt der Lyrik:
In der Lyrik werden die Erkenntnisse über den Menschen und das Leben nicht durch eine fremde poetische Gestalt vermittelt. Der Leser geht selbst in die poetische Gestalt der Lyrik ein.
Doch impliziert diese „Macht des Lyrikers“ nicht die Auffassung einer subjektiven und eigenständigen Poesie. Vielmehr begibt sich Kunze mit seiner Fixierung auf die „Arbeiterklasse“ und das „Volk“ in die Funktion eines „,Erziehers‘ im Sinne der gewünschten Normen“.
Hat Reiner Kunze auch „bei Becher erste Ermutigungen für die Emanzipation von der standardisierten, veräußerlichten Auftragsliteratur im Sinne nirgends faßbarer Volksmassen“ gefunden, wie Manfred Jäger meint, in dem vorliegenden Referat drückt sich dies jedenfalls kaum aus. Die enge Nachbarschaft von „Lyriker“ und dem ideologisch besetzten Begriff „Volk“ im Titel deutet eher auf das Literaturverständnis des sozialistischen Realismus hin und somit auf Kunzes frühe Gedichtbände Die Zukunft sitzt am Tische (1955), Vögel über dem Tau (1959) und Aber die Nachtigall jubelt (1962; die in dieser Sammlung enthaltenen Texte stammen vorwiegend aus den fünfziger Jahren). Es zeichnet sich aber mit der Frage nach der Person des Dichters schon sein künftiges Selbstverständnis ab:
Dichtung ist nie Illustration vorgegebener Ideen…, sondern Dichtung ist immer – und ich betone immer, sonst ist es eben keine Dichtung – Selbstentdeckung, die uns etwas über das menschliche Leben aussagt.
1.2. Aspekte des Menschenbildes in den Gedichtbänden Die Zukunft sitzt am Tische, Vögel über dem Tau und Aber die Nachtigall jubelt
In dem 1959 gehaltenen Referat hatte Reiner Kunze – in Anlehnung an Johannes R. Becher – seine Poesieauffassung wie folgt formuliert:
Ein deutscher Dichter, der sich heute nicht auf die Arbeiterklasse orientiert, wird nie das Höchste in der Selbstgestaltung erreichen, weil ihre Träume die Träume des Volkes sind, weil ihr Wille der Wille des Volkes ist, gleich, ob sich die Menschen aller Schichten des Volkes dieses Umstandes immer bewußt sind.
Dieser programmatische Satz kennzeichnet auch die Position, die in Kunzes ersten drei Gedichtbänden zum Ausdruck kommt. Mit der Orientierung an der Arbeiterklasse stellt sich der junge Lyriker in den Dienst der Partei der Arbeiterklasse, der SED, und verschreibt sich damit den Forderungen des sozialistischen Realismus in der DDR nach „Parteilichkeit, Volksverbundenheit, Verständlichkeit, Fortschritts- und Technikgläubigkeit, positiven Helden, Optimismus, Kollektivbezogenheit und idealisierter Beschreibung der gesellschaftlichen Wirklichkeit“.
Bereits ein Überblick über den Wortschatz dieser Gedichte macht ihren parteilichen Charakter offenkundig. Als ein Grundthema der Texte wird die Zukunftsgewißheit des „Arbeiter-Bauern-Geschlechtes“ erkennbar. So versammelt sich um die zentralen Begriffe „Klasse“, „Partei“ und „allerwohllöblichste Staatliche Leitung“ die folgende Wortgruppe: „neue Zeit“, „Glück“, „Morgen“, „Blüten“, „Mai“, „Träume“, „Sonne“, „Lachen“, „sonnenfroher Himmel“, „Weltall“, „Schwung“, „Sieg“, „Freude“, „Genuß“, „Spaß“, „bauen“, „reifen“, „grün“, „für alle Zeit“, „erdenweit“. Für gestaltenswert werden hauptsächlich Menschen aus der Arbeitswelt erachtet. Als Zeichen des gesellschaftlichen Aufstiegs figurieren Maurer und Treppenbauer, und bei den Soldaten der Flieger. Diesen positiven Helden der „Arbeitermacht“ werden in dem Gedicht „Am Rande bemerkt“ aus Kunzes erstem Band Die Zukunft sitzt am Tische als Kontrast ein „Herr“ und eine „Dame“ entgegengesetzt:
Ich Arbeiterjunge
nahm Platz.
Am Wirtshaustisch saßen,
seelisch leidend,
eine Dame
(korpulent,
mit schwarzen Börstchen auf den Lippen),
schnitzelschneidend
ein Herr.
Ihm quollen über Kragenklippen
das Genick und Backenfleisch:
„Ich war früher auch nicht reich,
das heißt… direkt
war ich es nicht.“
Er wischte mit dem Taschentuch
prustend über sein Gesicht.
Und leiser:
„Doch das Proletarische…
ist nicht unsre Gegenwart.“
– Die Dame kaute. –
„Meine Art
ist auch die bessere Gesellschaft.“
Und sie schaute,
daß sie keiner höre,
als sie fragte,
ob wohl die Vergangenheit
nochmals wiederkehre.
Schon die Bezeichnungen „Herr“ und „Dame“ sollen die beiden dargestellten Personen als Vertreter, als Relikte der ,Ausbeutergesellschaft‘ kenntlich machen.
„Herr“ impliziert einen Knecht oder Diener und verweist damit auf ein Herrschaftsverhältnis. Die Aufhebung dieser dichotomischen Struktur im DDR-Sozialismus aufzuzeigen, hat sich das Lied „Weihnachtsmann, alter Bart“ aus der Weihnachtskantate „Halm und Himmel stehn im Schnee“ zum Ziel gesetzt:
Weihnachtsmann, alter Bart!
Warst der Knecht
Ruperecht,
mußtest tragen Sack und Stock
und zwei Ketten überm Rock.
Weihnachtsmann, alter Bart!
Herr und Knecht,
ist nicht recht.
Hast den Dienst ihm aufgesagt,
weil ihr nicht gemeinsam tragt.
Die verhinderte historische Situation kündigt der Anfang der Schlußstrophe an:
Weihnachtsmann, guter Bart!
Ist die Gestalt des „Herrn“ entworfen worden, um sie gegen Maurer, Lokheizer oder Bergarbeiter ausspielen zu können, so wird die „Dame“ mit der vorbildlichen römischen Gestalt der Cornelia, der Mutter der Gracchen, konfrontiert, die bei Kunze als äußeres Zeichen ihrer Emanzipation von der angestammten Frauenrolle „Mutter Cornelius“ heißt und im Dienst der Arbeiterklasse steht:
Die Nacht ist keine Zeitungsfrau.
Die Zeitung bringe ich,
Ich, Mutter Cornelius.
…
In meine Tasche passen
Nur Arbeiterblätter…
Während die positiven Helden ihrer Arbeit nachgehen, werden „Herr“ und „Dame“ als Essende präsentiert, was wohl auch den Verdacht des Schmarotzertums nahelegen soll.
Das Gedicht endet mit den Zeilen:
Ach, mir taten diese Menschen leid,
hatten nicht die Gegenwart,
nicht die Vergangenheit,
und auch die Zukunft
war nicht mehr die ihre,
weil sie lächelnd schon
am Tische saß.
Nicht Verständnis für „diese Menschen“ ist angestrebt, wie der als personifizierte Zukunft am Tisch sitzende „Arbeiterjunge“ versichern möchte, sondern Stärkung des Klassenbewußtseins durch Errichtung eines Feindbildes mittels ideologischer Schwarz-Weiß-Malerei.
Die aufgesetzte Identität des „Ich Arbeiterjunge“ läßt an Kunzes spätere Aussage, seine frühen Texte seien „Produkte eines poetologisch, philosophisch und ideologisch Irregeführten“, denken. Wohl an keinem anderen Gedicht kann diese Selbsteinschätzung besser beobachtet werden als an „Die Stufen des Treppenbauers“:
Das war so, Kinder:
Ich hab einen Buckel.
Das Leben hat den Spott im Blick.
Die Partei aber
Hat einen guten Charakter.
Durch meine Nickelbrille
Sah ich alles…
Ich baute noch mehr Treppen
Als zehn Treppenbauer
In der gleichen Zeit –
Und die Partei ernannte mich
Zum Helden.
Groß war dann eine Versammlung.
Auf allen Stühlen saß die Partei.
Ich wagte mich zum Rednerpult
– mit meinem Buckel –
Und ich sagte:
Nehmt mich!
Arbeiter halten zusammen!
Worauf mir die Partei zur Antwort gab:
Du baust für zehn!
Du trinkst für zehn…
Den Trinker aber brauch ich nicht.
Da sank die Decke auf mich nieder.
Schande! Schande!
Und ich fragte nur noch leise:
Also – keiner will mich?
Doch,
Sprach die Partei wie eine Mutter,
Ich.
Zahltags, Kinder,
Habt ihr oft geweint,
Denn zahltags trank ich.
Trinken ist schön,
Wenn man trinken muß
Wie die Treppe Stufen haben muß.
Nun nahm mich zahltags die Partei,
Wie ich euch früher,
Als ihr klein wart,
An die Hand
Und ging mit mir und Mutter
Ins Theater…
Das Gedicht (es folgen noch zehn weitere Versgruppen) schildert die ,sozialistische Menschwerdung‘ des „Treppenbauers“, seinen Aufstieg (siehe Titel: „Die Stufen…“) in die „Partei“: es schließt mit dem triumphierenden Ausruf „Heute hat mich / Die Partei / Genommen“. Die Vermenschlichung der Partei deckt das Defizit an eigener Persönlichkeit auf: die Identifikation der Partei mit der Mutter ist Ausdruck der Abhängigkeit und Schutzbedürftigkeit des Treppenbauers und des jungen Autors Kunze gleichermaßen. Wie jener, immer wenn er trinken will, von der Partei „an die Hand« genommen und ins Theater oder ins Konzert geführt wird, der Anstoß zur Veränderung damit allein von außen kommt, so verweisen die „familiär-anhänglichen Wendungen“ des Gedichts („Und, Kinder, die Partei kann lachen, / Kann die lachen!“) wie auch die fünfzehnmalige Nennung der „Partei“ auf die künstlerische Selbstpreisgabe eines Autors, der geglaubt hatte, durch gänzliche Hingabe an die Ideologie von Staat und Partei das „Höchste in der Selbstgestaltung (zu) erreichen“. Die Personalisierung der Partei, des Treppenbauers wie des Dichters Weg in ihre Arme geht einher mit einem Verlust an Eigenständigkeit der Person.
Die kritiklose Übernahme der Forderungen des sozialistischen Realismus nach Parteilichkeit und Kollektivbezogenheit zeigt sich in einer schablonenhaften Menschengestaltung, im Fehlen individueller Züge. So geraten die dargestellten Personen entweder zu Zerrbildern, wie der „Herr“ und die „Dame“ in „Am Rande bemerkt“, oder werden auf der anderen Seite stilisiert oder sogar verklärt, wie die Tätigkeit der Arbeiter im Steinkohlebergbau in „Das neue Gedicht“:
Ein Gedicht
Mit Worten
So hart
Wie die kohlegeätzten
Hornigen Hände der Häuer,
Die kühner und kühner besiegen und siegen.
Ein neues Gedicht!
Von Liebe so voll
Wie der Bergmann erfüllt ist
Von Liebe zu seinem Beruf…
Zum Abschluß soll ein frühes Gedicht vorgestellt werden, zu dem Reiner Kunze heute noch steht, was u.a. seine Aufnahme in den Auswahlband Brief mit blauem Siegel (1973) belegt. Die darin zum Ausdruck gebrachte Selbstbehauptung des Dichters wird aber durch eine gewisse Harmonisierungstendenz relativiert:
ANTWORT
Mein vater, sagt ihr,
mein vater im schacht
habe risse im rücken,
narben,
grindige spuren niedergegangenen gesteins,
ich aber, ich
sänge die liebe
Ich sage:
eben, deshalb
Aus dem dialogischen Charakter des 1956 entstandenen und in Vögel über dem Tau erstmals publizierten Textes ergibt sich die Einteilung in die beiden Versgruppen.
In Teil eins wird das „Ich“ von einem „Ihr“ gefragt, wie es zugehe, daß der Sohn eines von seinem Beruf gezeichneten Bergarbeiters Liebesgedichte verfaßt und nicht die harte, gefahrvolle Arbeit der Bergleute beschreibt, das heißt: die Verletzungen seines Vaters durch eben diese Tätigkeit. Indirekt wird an den Autor der Vorwurf gerichtet, nicht von den täglichen Problemen und Kämpfen einer sozialistischen Aufbaugesellschaft zu berichten, sondern das Schöne dem Häßlichen vorzuziehen. Dem „Ich“ wird vom „Ihr“ eine widersprüchliche Haltung unterstellt. Im zweiten Teil erfolgt die „Antwort“, die Rechtfertigung des „Ich“: gerade erst die Arbeit des Vaters (er steht stellvertretend für den werktätigen Menschen in der DDR) hat die Grundlagen einer Gesellschaftsordnung geschaffen, in der es möglich geworden ist, ohne zu beschönigen, Liebesgedichte zu schreiben. Der Leistung des Vaters, der Gründergeneration des neuen Staates DDR ist es zu verdanken, daß der Sohn, der die nächste Generation verkörpert, zum Dichter avancieren konnte. Der Aufstieg vom Bergarbeitersohn zum Schriftsteller ist – so die Synthese des Textes – nicht zuletzt ein Verdienst des Vaters. Das Gedicht versteht sich als Hymnus auf diesen Vater. Aber dessen Gestalt scheint lediglich eine Funktion zu erfüllen: die Argumentation des Autors, des Sohnes, zu stützen und den aufgestellten Widerspruch aufzulösen. Hinter dieser Rechtfertigungsstrategie verbirgt sich das Bedürfnis des „Ich“, mit dem Kollektiv („ihr“) übereinzustimmen. Die Zurschaustellung seiner Herkunft als Arbeitersohn, um damit seine Liebesgedichte zu legitimieren, zeugt eher von Abhängigkeit als von Eigenständigkeit.
Und doch: zum erstenmal artikuliert sich ein „Ich“, das als die Person des Dichters Kunze identifiziert werden kann. Die Formulierung des Widerspruchs, wenn auch mit Vorbehalt aufzunehmen, läßt erste Ansätze einer subjektiven Position erkennen. Neben seine Herkunft, auf die sich in früheren Gedichten allein das „Ich“ gestützt hatte („Ich Arbeiterjunge“), tritt sein Selbstbewußtsein als Dichter, das sich in der Verteidigung der Poesie manifestiert.
Trotz aller Harmonisierungstendenzen weist der subjektive Gehalt dieses Gedichts auf Kunzes späteres Werk voraus.
2. Perspektive: Subjektivität und Autonomie
Das Jahr 1959 stellt in Reiner Kunzes Biographie und Werk einen wesentlichen Einschnitt dar: Abbruch des Journalistik-Studiums an der Leipziger Karl-Marx-Universität kurz vor der Promotion, anschließend als Hilfsschlosser im Schwermaschinenbau tätig. Kunze hat rückblickend in einem Interview von 1974 dieses Jahr als „Stunde Null“ in seinem Leben bezeichnet. Gefragt nach den Gründen für die von ihm in den fünfziger Jahren angesetzte „große politische Desillusionierung, das furchtbare Erkennen, hintergangen und betrogen worden zu sein, der Zusammenbruch des inneren Wertsystems“, gab er diese knappe Antwort:
… es waren Systemfragen, Methoden der Menschenbehandlung und die ideologische Indoktrination, die mich haben hellsichtiger werden lassen.
Dieser Selbstaussage ist mit Skepsis zu begegnen, verweisen doch die in der Zeit seiner „Desillusionierung“ geschriebenen Gedichte eher auf eine „bei Aufsteigern… häufig anzutreffende heftige Identifikation mit dem sie begünstigenden System“. Andererseits zeigt die vorsichtige Formulierung einer subjektiven Position in dem Gedicht „Antwort“ und in dem 1959 gehaltenen Referat, daß Kunzes Entwicklung vom Parteidichter und Systemapologeten zum Ideologiekritiker nicht gleichsam über Nacht geschehen ist.
Bleiben die Hintergründe für seine menschlich, politische und poetische Umorientierung aufgrund der spärlichen Äußerungen zur Biographie auch im dunkeln, so schlagen die 1959 entstandenen Gedichte „Ethik“, „Hymnus auf eine Frau beim Verhör“ und „Am Briefkasten“ kritische Töne an, die bisher in Kunzes Werk noch nicht gehört wurden. Bezeichnend, daß alle drei Gedichte erst 1969 in dem in der Bundesrepublik erschienenen Band Sensible Wege zur Veröffentlichung gelangten.
2.1. Entdeckung des Ich: der einzelne Mensch
Kunzes Absage an das Kollektiv, die „Partei“, und seine Hinwendung zum einzelnen Menschen dokumentiert das später in den Zyklus „Kurzer Lehrgang“ aufgenommene Gedicht „Ethik“:
ETHIK
Im mittelpunkt steht
der mensch
Nicht
der einzelne
Dieser kurze Text verkündet kein allgemeines und deshalb abstraktes Humanitätspathos, sondern zielt ab auf ein konkretes Engagement für das Individuum.
Auch der in den Sensiblen Wegen benachbarte „Hymnus auf eine Frau beim Verhör“ ist ein „Bekenntnis zur Freiheit des einzelnen und eine Solidaritätserklärung mit den Unmächtigen und Ohnmächtigen“:
HYMNUS AUF EINE FRAU BEIM VERHÖR
Schlimm sei gewesen
der augenblick des
auskleidens
Dann
ausgesetzt ihren blicken habe sie
alles erfahren
über sie
Grundlegend für die Selbstwahrnehmung Reiner Kunzes, das heißt die Frage nach dem eigenen Ich, wird dessen Begegnung mit der Tschechoslowakei zu Anfang der sechziger Jahre. Die Begeisterung über das Zusammentreffen mit ihren Menschen, ihrer Landschaft und ihrer Dichtung klingt noch in dem genannten Interview von 1974 nach:
Was ich der Tschechoslowakei alles verdanke, kann ich vielleicht gar nicht ermessen. Sie bedeutete damals für mich eine Art menschlicher Auferstehung.
Das Eindringen in die dichterische und philosophische Welt, für die mir die tschechische Poesie das Tor war, bewirkte erst einmal, daß ich mit der Zeit wieder zu mir selbst fand, bewirkte das Einswerden als Schreibender und Seiender.
Ein erstes Resümee dieser neuen Erlebnisse und Erfahrungen zieht das 1960 entstandene und drei Jahre später in den Widmungen publizierte Gedicht „Philosophie“, dessen anspruchsvoller Titel zugleich einen ersten Entwurf eines neuen Wertsystems erwarten läßt:
PHILOSOPHIE
(für Elisabeth)
Wir ertragen den mittag,
wo das steinerne gesetz der ufer
die milde des grases walten läßt.
Die feuchtigkeit der felsen und das sonnengesprenkel,
das aus den blättern fällt,
sind salamander,
die auf unsren nackten rücken liegen
und dösen.
Das wassergras schweigt
unzählbare blüten.
Der nachbar nagelt um das wörtchen „mein“ vor den erdbeeren
einen zaun.
An der Thaya, sagtst du, überkomme dich
„undefinierbare sehnsucht“.
Gehn wir in den fluß,
die sehnsucht definieren.
„Philosophie“ ist ein Liebesgedicht und der (späteren) Ehefrau des Autors, einer Tschechin, gewidmet.
Der in Teil eins, der ersten Versgruppe, thematisierte Gegensatz von Vereinigung und Abgrenzung, von „wir“ (Einheit) und „mein“ (Trennung), wird in Teil zwei, den letzten beiden Versgruppen, aufzuheben versucht. Ein Liebespaar nimmt am Ufer der Thaya, einem Fluß in Südmähren, ein Sonnenbad. Gerade noch erträgliche Mittagshitze, Schweigen, Untätigkeit. Das Verhältnis der Liebenden zur Natur ist durch harmonischen Einklang gekennzeichnet. Sie scheinen ,eingebettet‘ in die umliegende Landschaft: Salamander, die sich sonst auf felsigem Grund sonnen, liegen auf den Rücken der beiden, auf den „nackten“, gleichsam im ,Naturzustand‘ befindlichen Rücken, und dösen. Diese traumartige Vereinigung der Liebenden mit der Natur, deren entgrenzenden Charakter noch die „unzählbaren blüten“ des „wassergrases“ betonen, wird gestört durch die mittägliche Arbeit des „nachbarn“, der mit lauten Hammerschlägen ein Stück Landschaft, Erde, ,seine‘ „erdbeeren“ eingrenzt und sich gleichzeitig von seinen nächsten Mitmenschen abgrenzt.
Auf die Überwindung der Realität der Abgrenzurgen, Trennungen, „zäune“ zielt im zweiten Teil die „sehnsucht“, versinnbildlicht durch den „fluß“ (gemeinsames Bad der Liebenden): das „undefinierbare“ der Sehnsucht wie die Bewegung des Fließens zeigen den Wunsch an, Grenzziehungen aufzuheben.
Die Grundfrage der Philosophie nach dem Sein und Sollen des Menschen wird in dem Gedicht „Philosophie“ am Beispiel der verschiedenen Lebensformen des Liebespaares und des Nachbarn diskutiert. Dazu folgende Wortgruppen und Bedeutungsfelder:
1) Philosophie, steinernes Gesetz, Ufer, nageln, mein, Zaun, definieren
2) Milde des Grases, Sonnengesprenkel, schweigen, unzählbar, undefinierbar, Sehnsucht, Fluß
Der ersten Gruppe ist der Nachbar zuzuordnen: seine Lebensform kann mit Merkmalen wie ,Begrenzung‘, ,Ordnung‘, ,Statik‘ versehen werden. Er verkörpert den Bereich der Realität, der Trennung und Entfremdung zwischen den Menschen. Dem Nachbarn, der auf das Possessivpronomen „mein“ Wert legt, steht das Liebespaar gegenüber: ihm ist die zweite Gruppe eigen mit den Merkmalen ,Grenzenlosigkeit‘, ,Lebendigkeit‘, ,Vielfalt‘, ,Offenheit‘.
Am Beispiel der Liebenden wird eine dem „steinernen gesetz der ufer“, die den von jeher als Zeichen für Lebendigkeit geltenden Fluß begradigen, entgegengesetzte Daseinsmöglichkeit angedeutet: ihrer Gestaltung im Text, erinnert sei an die traumartige Vereinigung des Liebespaares mit der umliegenden Landschaft (die Salamander auf den „nackten rücken“), wohnt das utopische Moment einer Durchbrechung der Grenzen der Realität inne. „An die / grenzen rühren“ lauten die Schlußverse des Ende der sechziger Jahre entstandenen Gedichts „Experiment“. Sinnfälliger Ausdruck der Entgrenzung, der Überwindung von Zäunen, mein und dein, ist die „undefinierbare sehnsucht“, eine Sehnsucht, die sich nicht „definieren“ läßt, die ,im Fluß‘ sich befindet, nicht endgültig bestimmbar.
Dieses Spannungsverhältnis zwischen Definition des dem Menschen Gemäßen und der „undefinierbaren sehnsucht“ verweist auf das Anliegen des Gedichts: es verweigert sich in der Frage nach dem Sein und Sollen des Menschen einer Festlegung. Diese „Philosophie“ kann sich auf keine Definition stützen. Der Sinn des Lebens kann im Mitmenschen erfahren werden, in der Liebe, der „undefinierbaren sehnsucht“, von jedem Menschen auf seine ihm eigene Art und Weise zu bestimmen: „Gehn wir in den fluß, / die sehnsucht definieren“ – ein offener Schluß.
Der Offenheit dieser „Philosophie“ entspricht auch die sprachliche Gestaltung, so die auf Entgrenzung hindeutenden Synästhesien („… das sonnengesprenkel, / das aus den blättern fällt“) und aloßischen Bildfügungen („Das wassergras schweigt / unzählbare blüten“).
Es ist bezeichnend, daß die einzige Definition in diesem Gedicht („Die feuchtigkeit der felsen und das sonnengesprenkel, / das aus den blättern fällt, / sind salamander, / die auf unsren nackten rücken liegen / und dösen“) gewissermaßen eine ,Anti-Definition‘ darstellt, „jenseits des begrifflich Definierbaren“ liegt. Der Einfluß des tschechischen Poetismus macht sich bemerkbar, man denke an Vítězslav Nezval, der sein poetisches Programm umschrieb als „prachtvollste Zerstörung“, „nämlich die Zerstörung jeglicher Konvention, die Welt, das Leben, die Dinge zu sehen, um nach dieser Entzauberung frei zu sein für seine – neue Verzauberung“.
„Philosophie“ thematisiert die Selbstverwirklichung des einzelnen (das erste und letzte Wort des Textes ergeben: „Wir… definieren“) und negiert ,Definitionen‘, das heißt Ideologien, die einer Entfaltung des Lebens hinderlich sind („un-zählbar“, „un-definierbar“). Der Text muß als Absage an eine geschlossene Weltanschauung gewertet werden.
Die Analogie von Unbegrenztheit der Natur („unzählbare blüten“) und Freiheit des Menschen („undefinierbare sehnsucht“) kennzeichnet auch das wiederum der Ehefrau Elisabeth gewidmete Gedicht „In der Thaya“:
Den himmel zerteile ich, wälder
im steinkühlen wasser der Thaya,
auf dem sich die stille spiegelt.
Angenehm knackt das rückgrat
und streckt sich.
Erinnerungen streife ich ab…
Ich höre den schrei einer möwe.
Ist’s nicht ein echo in mir?
…
Ich schwimme dir entgegen.
Neben die Fluß-Metapher treten als Zeichen der Entgrenzung Himmel und Vogel. Das Erlebnis der tschechischen Landschaft und die Begegnung mit dem ,Du‘ wirken in gleichem Maße befreiend auf das von den „fiebernächten“ noch gezeichnete ,Ich‘ ein. Sich selbst im Mitmenschen finden, „klären“, dies wird im Zusammenfluß von Elbe und Moldau in „Nach einem Regen in Mělník“ angedeutet:
Bei Melnik lädt die Moldau
ihr stück himmel in die Elbe ab,
die es in schnellem bogen auffängt
(hin und wieder nur bricht eine ecke blau
am weinberg aus,
der die splitter den weinstöcken gibt).
Die Elbe, erdbraun von den bergen kommend,
klärt sich in der scherbe himmel,
die in ihr versinkt.
Die von den Bergen kommende Elbe, eine Anspielung auf Kunzes Herkunft als Bergarbeitersohn, „klärt sich“ in der tschechischen Moldau. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an Kunzes Ausspruch über die Tschechoslowakei: „Sie bedeutete damals für mich eine Art menschlicher Auferstehung“ – womit auch seine tschechische Frau gemeint sein könnte. Die bestimmten Personen geltenden Widmungen der Gedichte drücken zugleich eine neue Qualität der menschlichen Beziehung aus. Die Erfahrung des eigenen Ich in der Begegnung mit dem Mitmenschen umfaßt eine größere Sensibilität für den anderen. Wurden in Kunzes früheren Texten die zu gestaltenden Personen durch die Orientierung des Autors an der ideologischen Klassifizierung der Gesellschaft typisiert, so kennzeichnet jetzt die konkrete und differenzierte Wahrnehmung des Individuums das Menschenbild der Gedichte. Die realistische, das heißt unstilisierte, unheroische Darstellung arbeitender Menschen dokumentiert das Gedicht „Trinkgeld“, gewidmet „Den freunden im gasthof ,Zur Post‘ in Tisa“:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa„Der felsen hat einen goldenen fuß.“
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa„Ein dankbares fleckchen hier…“
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(aussprüche von hotelgästen)
Noch nie war der fuß des felsens golden
…
Immer schon haben das gold die füße erlaufen
…
Noch nie war der fuß des felsens dankbar
…
Immer schon haben den dank die füße erlaufen
…
Doch schmerzen im gasthof zu Tisá, am fuße des, felsens,
die füße um mitternacht,
und ein tag wird verrechnet vom leben,
sind das gold und der dank
münzen.
Und nichts ist geblieben
von so vielen menschen.
aaaaaTisá, d. 30. januar 1962
(auf das weiße tischtuch gelegt, in die ecke,
in die man das trinkgeld streicht)
Das Gedicht handelt von der Trauer darüber, daß Kellnern bzw. Kellnerinnen, deren Tätigkeit ausschließlich vom Umgang mit Menschen geprägt ist, „nichts“ von diesen zurückbleibt außer „münzen“, zudem in einem Gasthaus, dessen Name „Zur Post“ auf Kommunikation und Kontakt hinweist. Die Widmung eines Gedichts anstelle der Zahlung eines Trinkgelds läßt die Bedeutung ermessen, die Kunze der Poesie zuschreibt: „Das Gedicht als bemühung, die erde um die winzigkeit dieser annäherung bewohnbarer zu machen“ – formuliert in der „2. Nachbemerkung“ zu seinem Band Zimmerlautstärke von 1972.
Kunzes Engagement für den Menschen, das sich in den Widmungen (und auch in den zukünftigen Texten) findet, kann mit den Worten benannt werden, die dem Gedicht „In meiner Sprache“ vorangestellt sind: „Der einzige fanatismus, den wir anerkennen sollten, ist der, mensch sein zu wollen. Und das bedeutet unter anderem, kein fanatiker zu sein.“
Zuletzt sei noch das dem Sohn gewidmete Gedicht „Von der List, im Kreis zu gehen“ erwähnt, in dessen zentralem Begriff „eigensinn“ sich dieses Menschseinwollen manifestiert:
…
Man klagte in der krippe,
du seiest ein garstiges kind.
Du wolltest nicht im kreise gehn.
Bös, mit bockiger stirn,
bliebest du auf dem sandplatz stehn.
…
Du habest fäustchen geballt.
Und lasse man dich trotzen,
zöge dein eigensinn
dich wieder zur burg auf dem sandplatz,
zur unvollendeten, hin.
Mein sohn, mein lieber junge,
wer könnte dich besser verstehn,
als ich, dein vater, der heimlich –
während andre im kreise gehn –
flieht, um gedichte zu schreiben.
Ich trotzte wie du ihren runden
(ich wollte ich selber bleiben):
sie schritten im kreis mich in wunden…
Geh mit den füßen im kreise
…
Mit den gedanken doch reise
hoch unterm himmel! Brich leise
den regenbogen schon ab
(das burgtor)!…
Der Text ist, darin dem Gedicht „Philosophie“ verwandt, durch den Gegensatz Ordnung („im kreise gehen“) und Freiheit („Mit den gedanken doch reise / hoch unterm himmel“) strukturiert. Die eigene Erfahrung des ideologischen Gerädert-Werdens („sie schritten im kreis mich in wunden“) sensibilisiert den Vater für die frühe Reglementierung des Sohnes im Kindergarten. So gestaltet sich dieses Gedicht zu einem Plädoyer für das Recht den einzelnen, sich selbst zu verwirklichen, einen ,eigenen Sinn‘ zu entwickeln. Während dem immer gleichen und beschränkten ,im-Kreise-Gehen‘ als Zeichen der Vielfalt und Entgrenzung „regenbogen“ und „himmel“ gegenübergestellt werden, bezeichnet die „burg“ einen Schutzraum für den Menschen, symbolisiert ihre Errichtung die Festigung des Charakters. Das Gedicht erweist sich als „orientierungspunkt“ für den Sohn auf dessen Weg Zu einer eigenständigen Persönlichkeit.
2.2. Freiheit und Unabhängigkeit der Kunst
Bei der Analyse der im voraufgegangenen Abschnitt versammelten Gedichte ergab sich als gemeinsames Merkmal die Frage nach dem Individuum. Das Thema der Selbstwahrnehmung wurde in der Analogisierung von Freiheit des Menschen und Unendlichkeit der Natur dargestellt, wobei „Himmel“, „Fluß“, „Vogel“ und „Regenbogen“, Metaphern für das Unbegrenzte, als Negationen der ,Ordnung‘ fungierten (siehe dazu auch in dem Gedicht „In der Thaya“ den Gegensatz von „rose“ und „ordnung“).
Mit der Problematik der Selbstverwirklichung, der Entwicklung eines vielfältigen Charakters, ist eng verknüpft die Forderung nach Eigenständigkeit der Kunst, das heißt konkret: Freiheit und Unabhängigkeit des Dichters von äußeren, parteiamtlichen Normen des Schreibens. Dieses Grundbedürfnis des Schriftstellers lernt Kunze in der Tschechoslowakei kennen: hier „erfährt das Selbstverständnis Kunzes als Dichter eine Radikalisierung, indem er sich vom Diktat des sozialistischen Realismus löst und zur Kompromißlosigkeit in der Kunst findet“.
Als eine Auseinandersetzung mit literaturfeindlichem Dogmatismus versteht sich das in den Widmungen veröffentlichte programmatische Gedicht „Horizonte“, zugeeignet dem mährischen Dichter Jan Skácel, dessen Lyrik Reiner Kunze ins Deutsche übertragen hat:
HORIZONTE
Ich bin des regenbogens angeklagt,
und die großen farben Schwarz und Weiß
sitzen in vielen häusern
meiner stadt
Der himmel ihrer fenster erstarrt,
wenn ich die straße betrete.
(Als das kümmerliche etwas,
das auf meiner hand lag,
wie ein regenbogen schimmerte
und die großen farben Schwarz und Weiß erschreckte,
sagte ich: einmal wird es blühen.
Und ich schloß die hand.
Nun wissen sie, ich trage es bei mir.)
Auf ihrer rotationsmaschine neben meinem schlaf
vervielfältigen sie für den kommenden tag
das verschweigen.
(Denn unheimlich ist den großen farben Schwarz und Weiß
das lebendige.
Die poren, mit denen es atmet,
verschließen sie.
So kann es nicht aufblühn.)
Zwischen den großen farben Schwarz und Weiß aber
ist eine große lücke.
Durch diese lücke floh ich.
Nun weiß ich:
viele möglichkeiten hat die rose.
Der Text kann dreigeteilt werden. In Teil eins, der ersten Versgruppe, wird das Thema vorgestellt; der Gegensatz von Poesie und Macht, versinnbildlicht im Kontrast von „regenbogen“ und den „großen farben Schwarz und Weiß“. Die Konfrontierung der Macht, die die Poesie auf ihre Ordnungskategorien „Schwarz und Weiß“ festlegen will, mit dem Dichter („ich“), der auf das gesamte Farbspektrum der Dichtung, den „regenbogen“, Wert legt, gelangt im zweiten Teil, den Versgruppen zwei und drei, zur Ausführung, kulminierend zu Abschluß der zweiten Versgruppe, wenn „sie“ („die großen farben Schwarz und Weiß“) und „ich“, nur durch ein Komma getrennt, nebeneinander stehen. Im letzten Teil wird den „großen farben Schwarz und Weiß“ die „große lücke“ entgegengesetzt: sie bedeutet Öffnung, „Horizont“ – Erweiterung, Ausbruch des „ich“ sowohl aus der Enge der Stadt wie auch aus den Zwängen des sozialistischen Realismus in der DDR in die Landschaft und Poesie der Tschechoslowakei. Der letzte Vers nimmt Bezug auf ein Gedicht Jan Skácels mit dem Titel „Gelegenheiten hat die Rose viele“.
Der antithetischen Struktur des Textes entsprechen folgende Wortgruppen und Bedeutungsfelder:
– ich, Regenbogen, Himmel, kümmerliches Etwas, schimmern, blühen, das Lebendige, atmen, Lücke, fliehen, Schlaf, viel, Möglichkeiten, Rose
– sie, schwarz, weiß, erstarrt, Rotationsmaschine, vervielfältigen, verschweigen, verschließen
Die große Angst der Macht vor dem „kümmerlichen etwas“ äußert sich in einer Hypertrophie der Überwachung: „… die großen farben Schwarz und Weiß / sitzen in vielen häusern / meiner stadt“. Dieses Mißtrauen gegenüber dem „lebendigen“ zeigt an, welch großer Stellenwert der Poesie im öffentlichen Leben zuerkannt wird. Der Versuch der Macht, den Facettenreichtum einer freien Kunst auf die „farben Schwarz und Weiß“ einzuschränken, geht bis in den Schlaf des Dichters: „Auf ihrer rotationsmaschine neben meinem schlaf / vervielfältigen sie für den kommenden tag / das verschweigen.“ In diesen Zeilen kündigt sich zugleich das Thema der Sprachregelung an: die auf der „rotationsmaschine“ produzierte ideologische ,Schwarz-Weiß-Malerei‘ der Zeitungen „verschweigt“ in ihrer „vervielfältigten“ Eintönigkeit alle anderen Farben, das heißt Meinungen, auf denen eine freie Publizistik und erst recht eine unabhängige Kunst besteht. Vielfalt und Vervielfältigung markieren die beiden Pole, kennzeichnen den Unterschied zwischen dem „regenbogen“, der Poesie, die mit der „hand“ geschrieben wird, und den „großen farben Schwarz und Weiß“, der Druckerschwärze der „rotationsmaschinen“.
Die letzte Versgruppe dokumentiert in der Gewißheit der „vielen möglichkeiten“ der „rose“, wie der „regenbogen“ eine Metapher für die Vielfalt der Poesie (vgl. „In der Thaya“: „Ist nicht jedes blatt der rose anders? Seht nur! / Und wie viele sie hat!“), das in der Begegnung mit der tschechischen Dichtung gewonnene Selbstbewußtsein des „ich“. Eine Absage an außengesteuerte Literatur ist dem Motto dieses Gedichts zu entnehmen: „Das bedürfnis des dichters, nach außen hin etwas zu gelten, bricht in dem augenblick zusammen, in dem er begreift, was poesie ist.“ Das in diesem Statement zum Ausdruck kommende Plädoyer für die Subjektivität und Autonomie der Kunst bedeutet eine endgültige Ablehnung der im Referat von 1959 aufgeworfenen Frage „Für wen schreibst du?“.
Die Bedeutung des Aufenthalts in der Tschechoslowakei für Reiner Kunzes Leben und Werk kann mit den folgenden Zeilen aus dem Gedicht „Ankunft in meiner Stadt“ zusammengefaßt werden:
Von einem brunnen weiß ich im süden Mährens,
der einschläft,
das moos unterm arm.
Der „brunnen“ in Südmähren, der Heimat von Kunzes Ehefrau, schließt ein sowohl das Motiv des Jungbrunnens wie auch den „Quell der tschechischen Poesie“:
… der Brunnen schlief ein, in der Achselhöhle Moos
lautet ein Vers Jan Skácels, des Dichters aus Mähren.
Herbert Strickner, aus: Heiner Feldkamp (Hrsg.): Reiner Kunze. Materialien zu Leben und Werk, Fischer Taschenbuch Verlag, 1987
Biermann und Kunze – zwei, an denen die DDR zerbrach
Der Dichter Harald Gerlach in Erfurt antwortet auf die Vertreibung Wolf Biermanns und Reiner Kunzes aus der DDR mit einem Theaterstück über den 1723 in Jena gestorbenen Dichter Johann Christian Günther, dessen In Tyrannos einst so lautete:
Ihr traut der Höh’, bedenkt den Fall,
Ihr trinkt aus Silber und Kristall
Gott weiß wie bald den letzten Tropfen!
Die Uraufführung von Gerlachs Stück über Günther, der seine Wahrheit rigoros bis in den Untergang lebte, wurde am Erfurter Theater am 22. April 1979 verboten. Die Staatssicherheit notierte, was einer ihrer Spitzel ihr aus einer Diskussion unter Freunden Gerlachs zugetragen hatte:
Gerlach erklärte, daß dieses Stück die kulturpolitische Szene in der DDR der Jahre 1977/78 widerspiegeln würde. Aus Gründen der Sicherheit hätte er die Fabel des Stückes in die Zeit der Frühaufklärung zurückverlegt. Es wird hierin die Geschichte eines jungen Dichters behandelt, den die gesellschaftlichen Verhältnisse zwingen, das Land zu verlassen. G. nannte hierzu als Parallelen Biermann und Kunze. Weiterhin ist er der Auffassung, daß jeder kritisch denkende Theaterbesucher die gesellschaftspolitische Aktualität seines Schauspiels erkennen könne. G. erklärte, daß er mit seinem Stück das Ziel verfolge, dem einfachen Bürger verständlich zu machen, daß ein DDR-Schriftsteller nur die Wahl hätte, sich den hiesigen politischen Verhältnissen unterzuordnen oder sich ausbürgern zu lassen.
Das Jahr 1976 gilt heute im öffentlichen Verständnis als der Anfang vom Ende der DDR. Und jenes Jahr ist einzig und allein verbunden mit dem Namen Wolf Biermann, der damals nach einem Konzert in Köln vom SED-Regime ausgebürgert worden war. Die Auflehnung gegen die Ausbürgerung Biermanns verdeckt eine wesentliche Komponente des Widerstands im Jahr 1976, in dem Reiner Kunzes Buch Die wunderbaren Jahre, Abgesang auf die DDR, in der Bundesrepublik erschien. Ein Buch, das den Autor in den Augen der SED zum Staatsfeind machte, den es mit allen Mitteln der Stasi fertigzumachen galt.
Reiner Kunze saß nicht auf dem „Präsentierteller“ Berlin, der unter der fürsorglichen Beobachtung des Westens stand. Reiner Kunze saß seit 1962 im thüringischen Greiz, war 1968 aus Protest gegen die Zerschlagung des „Prager Frühlings“ aus der SED ausgetreten und hatte sich seitdem – mit kurzen Unterbrechungen – der „Zersetzungsmaßnahmen“ der Stasi zu erwehren. Im Süden der DDR konnte das SED-System gegen diejenigen, die sich ihm nicht beugten, schalten und walten, wie es wollte. Mit Ausnahme der Westjournalisten Karl Corino und Jürgen P. Wallmann schaute sonst kaum einer hin.
Es ist Harald Gerlach, Jahrgang 1940, der schon früh mit seinem Stück über Johann Christian Günther auf die Gleichrangigkeit des Widerstands von Biermann und Kunze aufmerksam macht. Die DDR zerbricht letztlich nicht an einer, sondern an zwei Symbolgestalten.
Es war Reiner Kunze, der dafür sorgte, daß sich der allen Zumutungen der Ideologie widersetzende Gerlach mit 32 Jahren endlich als Dichter sichtbar wurde. Kunze gewann Bernd Jentzsch dafür, den im schlesischen Bunzlau geborenen, nach dem Krieg in Römhild aufgewachsenen Lyriker in der Reihe Poesiealbum mit achtzehn Gedichten 1972 vorzustellen.
Harald Gerlach sagt in meinem neuen Buch Zu Hause im Exil – Dichter, die eigenmächtig blieben in der DDR über Reiner Kunze:
Wie sich da jemand nicht hat beugen lassen, wie er standgehalten hat dem Druck bis in die Todesgefahr hinein, das hat mich in meinem Weg bestärkt und mir geholfen.
Welche Bedeutung Reiner Kunze für den literarischen Widerstand im Süden der DDR gehabt hat, wurde mir im vollen Umfang erst deutlich bei den Recherchen zu diesem Buch über bewundernswerte Dagebliebene, die noch immer nicht nach 1989 genügend beachtet sind und die doch die geheimen Verbündeten jener widerständigen Autoren um Václav Havel in der Tschechoslowakei waren.
Den Blick auf diesen Widerstand hat Reiner Kunze als Übersetzer und Vermittler tschechischer Literatur geschärft. Und Kunze wäre in Greiz geblieben, hätte ihn das SED-System nicht an den Rand des Todes getrieben. Die Kunst, für die er im Süden Vorbild wurde, moralisiert nicht, sie hat Moral. Das Streben der Hoffnungen wird gelebt, mitgelebt, mit denen, die im Lande blieben und die sich doch ihre Sensibilität bewahrt hatten. Auch das Müde- und Sprachloswerden ist als Bedrohung erkannt. Heimat ist im Kunzeschen Denken kein miefiger Veranstaltungsort, sondern ein Ort, an dem man die Richtschnur seines Lebens gefunden hat.
Jürgen Fuchs, 1950 in Reichenbach/Vogtland geboren und aufgewachsen, erlebt den Dichter aus Greiz 1966 bei einer Lesung in der Schule, dann im Heimatmuseum: „Er hat mich sehr früh extrem bestätigt im Schreiben.“ Fuchs denkt zurück an die Verfolgungszeit Kunzes, in der dieser nicht aufhörte, Menschen, die mit Fragen zu ihm kamen, zu beraten:
Das Defizit menschlicher Zuwendung war ja in der DDR groß. In der Menschenberatung hat Kunze Übermenschliches geleistet.
Jürgen Fuchs, inzwischen in Jena, Utz Rachowski, 1954 in Plauen geboren und in Reichenbach aufgewachsen, sowie Arnold Vaatz, 1956 in Steinsdorf bei Greiz geboren, Autor eines Lyrik- und Prosabands mit dem Titel Schafskälte, der nie erschien, tragen Kunze Geschichten für sein Buch Die wunderbaren Jahre zu. Sie alle sind vereint in der offen gezeigten Ablehnung des Einmarsches der Trupppen des Warschauer Paktes in die ČSSR. ZU ihnen gehört auch der 1946 in Greiz geborene Günter Ullmann, der seine Lyrik an Kunze ausrichtet.
Jürgen Fuchs, den Wolf Biermann aus dessen Bedrohung durch die Stasi in Jena mit dem Umzug zu Robert Havemann in Grünheide bei Berlin befreit glaubt, wird im November 1976 verhaftet, und nach neunmonatiger Haft nach Westberlin abgeschoben und ausgebürgert. Reiner Kunze verläßt im April in gesundheitlich desolatem Zustand die DDR. Günter Ullmann protestiert in einem Schreiben ans SED-Zentralkomitee gegen die Vertreibung von Biermann und Kunze und erlebt nun, was das System mit jemandem macht, der völlig unbekannt ist und noch dazu im Süden der DDR lebt. Die Stasi treibt Günter Ullmann mit ihren Vernehmungen in den Wahnsinn, ohne ihn brechen zu können: Verrücktsein als ein Versuch, in der Wahrheit zu leben.
Utz Rachowski wird im Oktober 1979 verhaftet, weil er Lieder von Biermann, Gedichte von Kunze und Fuchs verbreitet hat. Er wird wegen „staatsfeindlicher Hetze“ zu 27 Monaten Gefängnis verurteilt und nach vierzehn Monaten Haft in den Westen abgeschoben. In Waltersdorf bei Greiz gerät der Viehpfleger und Dramatiker Klaus Rohleder, Jahrgang 1935, ins Visier der Stasi, die in ihm einen „zweiten Kunze“ heranwachsen sieht. Rohleder, heute wieder Bauer auf seinem angestammten Land, kommt ohne Haft davon, mehr denunziert als gelobt als „Beckett vom Bauernhof“, einzig mit einem Theaterstück zu Endzeiten der DDR gespielt.
Als Reiner Kunze am 28. Januar 1990 erstmals wieder Greiz besuchte, schrieb Günter Ullmann das Gedicht:
mitten am tage
im herzen des dichters
trägt die wahrheit
einen regenbogen
in den augen
der hörenden.
Was bleibt vom Beispiel Reiner Kunzes in der DDR: eine Dichtung des Unterholzes, eine Dichtung an der Lebensquelle, eine Dichtung unten, wo die Menschen lebten und wo die Diktatur Durchblick zu schaffen versuchte, ein Schußfeld für ihre Schergen. Zwei Dichter schreiben gegen die Zerstörung des Unterholzes an, wehren sich als Romanciers gegen den Anschlag auf ihre Phantasie exemplarisch: Harald Gerlach mit Windstimmen (1997) und Jürgen Fuchs mit Magdalena, zwei Bücher, die Zeit brauchen und eine andere Generation, die deren absoluten Wert für die deutsche Dichtung des 20. Jahrhunderts erkennt.
Klaus Rohleders lyrische Theaterstücke sind Verteidigungen des Unterholzes in anderer Weise wie die Erzählungen Utz Rachowskis und die Gedichte Günter Ullmanns, der der Zerstörung sein Kindheitsparadies entgegensetzt. Und da ist Georg Seidel, geboren 1945 in Dessau, ein Dramatiker von Büchnerschem Format, der im Juni 1990 in Berlin stirbt und eine Prosa hinterläßt, die mehr als eine Fortsetzung von Kunzes Die wunderbaren Jahre ist und gleichrangig neben dem 1976 erschienenen Buch steht.
Es sind nicht nur diese Werke, die zeigen, was Reiner Kunze neben dem eigenen Werk in der DDR bewirkt hat.
In einem Gedicht Ulrich Schachts aus dem Jahre 1971, das Reiner Kunze gewidmet ist, heißt es:
Laßt uns hinabsteigen
in das Verlies
unserer Träume –
es wird
ein Aufstieg
sein.
Jürgen Serke, aus: Marek Zybura (Hrsg.): Mit dem wort am leben hängen… Reiner Kunze zum 65. Geburtstag, Universitätsverlag C. Winter, 1998
Das unersetzbare Gedicht
– Verleihung des Hanns-Martin-Schleyer-Preises am 14. Mai 1991 in Dresden. –
Lassen Sie mich meiner Rede bitte ein Medaillon über das Dasein als Schriftsteller voranstellen.
Als wir zu Beginn der sechziger Jahre nach Greiz in Thüringen gezogen waren, sagte eines Morgens die Briefträgerin: „Was die Leute so reden, Herr Kunze.“ Sie wollte sich nicht nur der Post entledigen, und ich ermutigte sie.
„Sie hätten eine so tüchtige Frau“, sagte sie.
„Stimmt“, sagte ich.
„Jeden Morgen halb sieben geht Ihre Frau auf Arbeit, und sie bleiben zu Haus.“
„Stimmt auch“, sagte ich.
„Sie müßten doch von etwas leben!“
Auch das stimmte.
Mit anderen Worten: Mein Ansehen bei den Nachbarinnen war denkbar gering. (Es besserte sich mit den Jahren, als ausnahmslos ich die Fenster putzte.) Was die Briefträgerin nicht wußte, und was noch heute gilt: Meine Unabhängigkeit als Schriftsteller verdanke ich der Kameradschaft meiner Frau.
Das unersetzbare Gedicht
Eine Anthologie, herausgegeben in Form einer Rede
Christine Busta
DIE WASSERAMSEL
Nur einmal
hat sich die Wasseramsel gezeigt.
Es strahlte
das Weiß an ihrer Brust.
Wo sie hinabgetaucht ist,
kann uns der Fluß
nie wieder dunkel werden.
Wo ein Gedicht wie dieses in uns hinabgetaucht ist, kann uns die Seele nie wieder dunkel werden.
Guillaume Apollinaire
Aus: „Zone“
Eiffelturm Hirt der Brücken hör wie sie blökt heute früh deine Herde
Welch eine Intensität der Wahrnehmung – der Eiffelturm ein Hirt, die Brücken des morgendlichen Paris eine blökende Herde! Das Unüberschaubargewordene, die riesige Großstadt, wird samt Aufbruch aus dem nächtlichen Pferch, samt Herdenhaftem und Scheinbehütetsein in einem einzigen Bild in unsere Vorstellung geholt.
Juan Rámon Jiménez
NOCTURNE
STERNE, SÜSSE STERNE,
traurige, ferne Sterne.
Seid ihr Augen von toten Freunden?
– Ihr blickt so starr! –
Seid ihr Augen von toten Freunden,
die der Erde gedenken
– ach, Lichtblumen der Seele! –
bei Einzug des Frühlings?
Uns der eigenen Vergänglichkeit erinnernd, schaudert uns: die starr blickenden Sterne – Augen von toten Freunden, die der Erde gedenken bei Einzug des Frühlings… Ein Schauder, der dem Leben in die Arme treibt.
Ernst Jandl
vater komm erzähl vom krieg
vater komm erzähl wiest eingrückt bist
vater komm erzähl wiest gschossen hast
vater komm erzähl wiest verwundt wordn bist
vater komm erzähl wiest gfallen bist
vater komm erzähl vom krieg
Und noch einmal Jandl:
SOMMERLIED
wir sind die menschen auf den wiesen
bald sind wir menschen unter den wiesen
und werden wiesen und werden wald
das wird ein heiterer landaufenthalt
Stets meint das Gedicht das eine einzige Leben, das jeder hat und das zu leben uns niemand abnehmen kann, weder der Staat noch Gott.
Jan Skácel
KLEINE BAHNHÖFE
Gegenden gibt’s, da winken die kinder
aaaaaden zügen noch.
Immer ist in uns ein hauch von traurigkeit
auf kleinen bahnhöfen,
wo niemand wartet.
Plötzlich ist in uns die weiße seele
aaaaades holunderbaums,
plötzlich ist in uns zuviel vom menschen.
Das Gedicht ist Fassung des erlebten Augenblicks und verleiht ihm Dauer.
Ilse Aichinger
BRIEFWECHSEL
Wenn die Post nachts käme
und der Mond
schöbe die Kränkungen
unter die Tür:
Sie erschienen wie Engel
in ihren weißen Gewändern
und stünden still im Flur.
Wenn der junge Mensch von Gefühlen überwältigt wird, versucht er nicht selten, ein Gedicht zu schreiben. Der Text trägt dann meist nur die äußeren Merkmale eines Gedichts – er entbehrt jedes originären poetischen Einfalls –, aber das Mädchen oder der Junge spüren, daß sich das, was in ihnen vorgeht, nur im Gedicht sagen ließe. Und sie halten ihre Verse geheim, denn sie ahnen auch: Ein Gedicht zu schreiben heißt, sich auszuliefern.
An keinem Ort ist der Dichter ungeschützter als im Gedicht.
Das Gedicht ist der äußerste Punkt eines Zugehens auf Menschen.
Else Lasker-Schüler
Aus: „Meine Mutter“
Wäre mein Lächeln nicht versunken im Antlitz,
ich würde es über ihr Grab hängen.
Wer mit solchen Bildern lebt, wem auch nur bewußt wird, daß es Vorstellungen gibt wie „ein Lächeln über ein Grab hängen“, dessen Empfindsamkeit eröffnen sich nie gekannte Bereiche.
Sarah Kirsch
Aus: „Wiepersdorf“
Dieser Abend, Bettina, es ist
Alles beim alten. Immer
Sind wir allein, wenn wir Königen schreiben
Denen des Herzens und jenen
Des Staats. Und noch
Erschrickt unser Herz
Wenn auf der anderen Seite des Hauses
Ein Wagen zu hören ist.
Mit „Dieser Abend, Bettina“ überbrückt Sarah Kirsch mehr als ein Jahrhundert und projiziert über diese Entfernung hinweg zwei Einsamkeiten aufeinander, die eigene und die der Bettina von Arnim. Nicht nur der Ort, Schloß Wiepersdorf, verbindet: „Immer / Sind wir allein, wenn wir den Königen schreiben / Denen des Herzens und jenen / Des Staats.“
Und das verbindet nicht nur, es verbündet.
„Und noch / Erschrickt unser Herz / Wenn auf der anderen Seite des Hauses / Ein Wagen zu hören ist.“ Hier berührt das Gedicht zudem die Einsamkeit all derer, die sehnsüchtig hoffen oder gehofft haben, die oder der eine werde plötzlich in der Tür stehen, und die Einsamkeit jener, die zu Zeiten politischer Diktatur bei jedem Anhalten eines Autos unter dem Fenster aufgeschreckt sind – die Einsamkeit der Nadeshda Mandelstam, nachdem sie Ossip verhaftet hatten, oder der Gertrud Kolmar vor ihrer Verschleppung aus Berlin 1943.
Sarah Kirsch
Aus: „Trauriger Tag“
Ich bin ein Tiger im Regen
Wasser scheitelt mir das Fell
Tropfen tropfen in die Augen
Ich schlurfe langsam, schleudre Pfoten
die Friedrichstraße entlang
und bin im Regen abgebrannt
Ich hau mich durch Autos bei Rot
geh ins Café um Magenbitter
freß die Kapelle und schaukle fort
…
Aber es regnet den siebten Tag
Da bin ich bös bis in die Wimpern
Ich fauche mir die Straße leer
und setz mich unter ehrliche Möwen
Die sehen alle nach links in die Spree
Und wenn ich gewaltiger Tiger heule
verstehn sie: ich meine es müßte hier
noch andere Tiger geben
In keiner literarischen Ausdrucksform spricht das Ich so ausschließlich und so ausschließlich originär, also in nur eigenen Metaphern und Schlüssen von sich selbst wie im Gedicht, und nirgendwo sonst nimmt der Seelenzustand des Einzelnen so unmittelbar literarische Gestalt an – im Extremfall die eines gewaltigen Tigers im Regen, der Magenbitter trinkt und nach anderen Tigern heult.
Antonio Machado
IM MEER DER FRAUN
Im Meer der Fraun
scheitern wenige bei Nacht,
viele im Morgengraun.
Ernst Jandl
LIEGEN, BEI DIR
ich liege bei dir, deine arme
halten mich. deine arme
halten mehr als ich bin.
deine arme halten, was ich bin
wenn ich bei dir liege und
deine arme mich halten.
Das Gedicht ist stets auf existentielle Wahrheit aus, denn der poetische Einfall, der aus dem Unbewußten aufsteigt, ist ein Überlebensakt. Unser Unbewußtes weiß bekanntlich mehr als wir und vergleicht ständig unsere Eindrücke mit dem, was dem Bewußtsein entfallen oder nie in ihm aufgeschienen, an Menschheitserfahrungen aber in uns ist. Dem Bewußtsein einen Bildeinfall zuzuspielen, der nicht in irgendeiner Weise von existentiellem Belang ist, hätte das Unbewußte keinen Grund, und wenn es für die Gattung Mensch überhaupt verzichtbar wäre, sich der Welt über Bildvorstellungen zu vergewissern, gäbe es kein Bilddenken, und der Dichter wäre der Natur nicht eingefallen.
Wären die beiden Gedichte von Machado und Jandl schon immer auf der Welt gewesen und würden sie nicht irgendwann vergessen werden – sie wären als gültig empfunden worden von Anbeginn und würden als gültig empfunden werden bis ans Ende der Menschheit.
Indem der Leser im Roman oder in der Erzählung auf die vom Autor erdachten Gestalten und Geschehnisse trifft, im Gedicht dagegen auf die innere Wirklichkeit des Autors selbst, genauer: auf das, was an dieser inneren Wirklichkeit von existentiellem Interesse ist – auch in der Poesie ist die Persönlichkeit, die hinter dem Werk eines Künstlers sichtbar wird, nicht mit dessen von ungezählten Belanglosigkeiten behafteter tatsächlicher Persönlichkeit identisch (kein Dichter denkt die meiste Zeit seines Lebens in dichterischen Bildern) –, wird das Gedicht zu einem Ort mehr oder weniger unmittelbarer seelischer Begegnung, zum Ort der Begegnung zweier Ichs, und das Risiko trägt vor allem der Dichter, denn der Leser bleibt anonym.
Das Gedicht ist das extreme Gegenteil von Vermummung, es zeigt nicht nur das Gesicht, sondern gewährt Einblick in den Menschen.
Das Gedicht ist eine Gegenwirklichkeit zur Waffe.
Indem der Dichter im Gedicht die inneren Entfernungen bis zur Schutzlosigkeit verringert, ermutigt er den Leser, seinerseits innere Entfernungen aufzugeben.
Das Gedicht hebt Einsamkeit auf und bewahrt vor Vereinsamung. In einem Gedicht Else Lasker-Schülers heißt es:
Ich habe zu Hause ein blaues Klavier…
Es steht im Dunkel der Kellertür,
Seitdem die Welt verrohte…
Alles, was die Empfindsamkeit steigert, schwächt die Fähigkeit, brutal zu sein. Gedicht und Verrohung schließen einander aus (ich spreche von Dichtung, nicht von in Verse gekleideten vorgegebenen Ideen, die Stiefel tragen).
Ebenso schließen Gedicht und Lüge einander aus; nicht weil der Dichter ein besonders ehrlicher Mensch wäre – er ist hoffentlich so ehrlich wie jeder andere ehrliche Mensch auch –, sondern weil der poetische Einfall kein taktisches Kalkül kennt und der Dichter nicht gegen die dem Einfall innewohnende Konsequenz dichten kann, ohne das Bild oder das Paradoxon zu zerstören. Apollinaire: „Die Dichter [ich füge ein: und Dichterinnen] sind nicht nur die Männer [und Frauen] des Schönen. Sie sind auch und vor allem die Männer [und Frauen] des Wahren, soweit es das Eindringen ins Unbekannte erlaubt.“ Natürlich muß der Dichter, wie es in einem Brief Hölderlins heißt, „oft etwas Unwahres und Widersprechendes sagen, das sich aber… im Ganzen, worin es als etwas Vergängliches gesagt ist, in Wahrheit und Harmonie auflösen muß“.
Alles Originäre wirkt der Geringschätzigkeit des Individuums, wirkt seiner Negation entgegen. Im Gedicht tritt die Unwiederholbarkeit des einzelnen Menschen in unwiederholbarer Brechung zutage.
Das Gedicht ist antiautoritär in seinem Wesen, also unabhängig davon, wovon es spricht. Was nicht heißt, es könne nicht auch direkt politisch anklagen oder Diktatur und Demokratie zum Thema erheben. Anklagenderes wider den totalitären Staat als in dem Zweizeiler „Was zu sagen wäre“ von György Petri habe ich kaum gelesen:
Mein Blick fällt auf die Schuhe. Schnürsenkel darin.
Das hier ist kein Gefängnis, nein, das kann nicht sein.
Und ich kenne keinen utopischeren und zugleich vorwärtsweisenderen, da auf uns selbst verweisenden Entwurf eines freiheitlichen Gemeinwesens als René Chars Gedicht „Es lebe!“:
Dies Land ist nur ein Wunsch im Geist,
ein Gegen-Grab.
In meinem Land zieht man die zarten Beweise des Frühlings und die dürftig gekleideten Vögel den Fernzielen vor.
Die Wahrheit harrt der Morgenröte neben einer Kerze. Das Fensterglas ist trübe. Was kümmert’s den Wachsamen.
In meinem Land stellt man einem Erschütterten keine Frage.
Kein hämischer Schatten fällt auf das gekenterte Boot.
Halbes Willkommen kennt man in meinem Land nicht.
Man leiht nur, was man vermehrt zurückgeben kann.
Blätter, viele Blätter haben die Bäume meines Landes. Den Ästen steht’s frei, keine Früchte zu tragen.
Der Redlichkeit des Siegers traut man nicht.
In meinem Land sagt man Dank.
Denken Sie nun aber bitte nicht, ich wüßte nicht auch, wie wenig Menschen das Gedicht zum Leben brauchen. Mein Selbstbewußtsein übersteigt bestimmt nicht das Selbstbewußtsein Günter Eichs:
Günter Eich
ZUVERSICHT
In Saloniki
weiß ich einen, der mich liest,
und in Bad Nauheim.
Das sind schon zwei.
Das, was das Gedicht zu bewirken vermag, ist ein Fast-Nichts.
Reiner Kunze
Peter Hamm: Zur Situation der jüngsten DDR-Lyrik, Merkur, Heft 205, April 1965
SELBSTPORTRÄT FÜR REINER KUNZE
An Bitternis mein Soll hab ich geschluckt
Und ausgeschrien an Trauer was da war
Genug gezittert und zusammgezuckt
Das Kleid zerrissen und gerauft das Haar
Mein Freund, wir wolln nicht länger nur
Wie magenkranke Götter keuchen ohne Lust
Von Pferdekur zu Pferdekur
Mit ewig aufgerissener Heldenbrust
Du, wir gehören doch nicht zu denen
Und lassen uns an uns für dumm verkaufen
Es sind ja nicht des Volkes Tränen
In denen seine Herrn ersaufen
Wir wolln den Streit und haben Streit
Und gute Feinde, viele
Von vorn, von hinten, und zur Seit
Genossen und Gespiele
Es ist schön finster und schön licht
Gut leben und gut sterben
Wir lassen uns die Laune nicht
Und auch kein Leid verderben
*Refrain des Liedes
„Ach, du, ach das ist dumm –
Wer sich nicht in Gefahr begibt,
der kommt drin um.“
Wolf Biermann
EINE BEGEGNUNG
für Reiner und Elisabeth
Bist du ein gast oder ein bote?
fragt der engel des westlichen fensters
und das gras verstummt
der stein duftet nach schwere
Wer bin ich eigentlich?
Wer bist du?
Wer sind wir?
Von dem treffen berührt wie vom regen
Die wege sind uralte spuren der feuer
Zerschmolzene glocken der flüsse läuten
Näher und näher ist der wind:
der anker der stille
vernarbt zur schönheit
Die fenster eures hauses
sehen das alles
viel transparenter
Milena Fucimanová
Übertragen von Jiří Munzar
Michael Wolffsohn: REINER KUNZE – der stille Deutsche
In Lesung und Gespräch: Reiner Kunze (Autor, Obernzell-Erlau), Moderation: Christian Eger (Kulturredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, Halle). Aufnahme vom 17.01.2012, Literaturwerkstatt Berlin. Klassiker der Gegenwartslyrik: Reiner Kunze. Wenn die post hinters fenster fährt blühn die eisblumen gelb.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Harald Hartung: Auf eigene Hoffnung
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.1993
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Katrin Hillgruber: Im Herzen barfuß
Der Tagesspiegel, Berlin, 16.8.2003
Lothar Schmidt-Mühlisch: Eine Stille, die den Kopf oben trägt
Die Welt, 16.8.2003
Beatrix Langner: Verbrüderung mit den Fischen
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.8.2003
Sabine Rohlf: Am Rande des Schweigens
Berliner Zeitung, 16./17.8.2003
Hans-Dieter Schütt: So leis so stark
Neues Deutschland, 16./17.8.2003
Cornelius Hell: Risse des Glaubens
Die Furche, 14.8.2003
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Michael Braun: Poesie mit großen Kinderaugen
Badische Zeitung, 16.8.2008
Christian Eger: Der Dichter errichtet ein Haus der Politik und Poesie
Mitteldeutsche Zeitung, 16.8.2008
Jörg Magenau: Deckname Lyrik
Der Tagesspiegel, 16.8.2008
Hans-Dieter Schütt: Blühen, abseits jedes Blicks
Neues Deutschland, 16./17.8.2008
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Jörg Bernhard Bilke: Der Mann mit dem klaren Blick: Begegnungen mit Reiner Kunze: Zum 80. Geburtstag am 16. August
Tabularasa, 18.7.2013
artour: Reiner Kunze wird 80
MDR Fernsehen, 8.8.2013
André Jahnke: Reiner Kunze wird 80 – Bespitzelter Lyriker sieht sich als Weltbürger
Osterländer Volkszeitung, 10.8.2013
Josef Bichler: Nachmittag am Sonnenhang
der standart, 9.8.2013
Thomas Bickelhaupt: Auf sensiblen Wegen
Sonntagsblatt, 11.8.2013
Günter Kunert: Dichter lesen hören ein Erlebnis
Nordwest Zeitung, 13.8.2013
Marko Martin: In Zimmerlautstärke
Die Welt, 15.8.2013
Peter Mohr: Die Aura der Wörter
lokalkompass.de, 15.8.2013
Arnold Vaatz: Der Einzelne und das Kartell
Der Tagesspiegel, 15.8.2013
Cornelia Geissler: Das Gedicht ist der Blindenstock des Dichters
Berliner Zeitung, 15.8.2013
Johannes Loy und André Jahnke: Eine Lebensader führt nach Münster
Westfälische Nachrichten, 15.8.2013
Michael Braun: Süchtig nach Schönem
Badische Zeitung, 16.8.2013
Jochen Kürten: Ein mutiger Dichter: Reiner Kunze
Deutsche Welle, 15.8.2013
Marcel Hilbert: Greiz: Ehrenbürger Reiner Kunze feiert heute 80. Geburtstag
Ostthüringer Zeitung, 16.8.13
Hans-Dieter Schütt: Rot in Weiß, Weiß in Rot
neues deutschland, 16.8.2013
Jörg Magenau: Der Blindenstock als Wünschelrute
Süddeutsche Zeitung, 16.8.2013
Friedrich Schorlemmer: Zimmerlautstärke
europäische ideen, Heft 155, 2013
Zum 85. Geburtstag des Autors:
LN: Sensible Zeitzeugenschaft
Lübecker Nachrichten, 15.8.2018
Barbara Stühlmeyer: Die Aura der Worte wahrnehmen
Die Tagespost, 14.8.2018
Peter Mohr: Die Erlösung des Planeten
titel-kulturmagazin.de, 16.8.2018
Udo Scheer: Reiner Kunze wird 85
Thüringer Allgemeine, 16.8.2018
Jochen Kürten: Sich mit Worten wehren: Der Dichter Reiner Kunze wird 85
dw.com, 16.8.2018
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Lothar Müller: Widerstand in Jeans
Süddeutsche Zeitung, 15.8.2023
Cornelia Geißler: Dichterfreund und Sprachverteidiger
Berliner Zeitung, 15.8.2023
Antje-Gesine Marsch: Greizer Ehrenbürger Reiner Kunze feiert 90. Geburtstag
Ostthüringische Zeitung, 16.8.2023
Ines Geipel: Nachwort. Zum 90. Geburtstag von Reiner Kunze
S. Fischer Verlag
Ines Geipel: Mit dem Wort am Leben hängen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.2023
Gregor Dotzauer: Mit den Lippen Wörter schälen
Der Tagesspiegel, 15.8.2023
Hans-Dieter Schütt: Das feingesponnene Silber
nd, 15.8.2023
Stefan Stirnemann: Ausgerechnet eine Sendung über Liebesgedichte brachte Reiner Kunze in der DDR in Nöte – und mit seiner späteren Frau zusammen
Neue Zürcher Zeitung, 15.8.2023
Christian Eger: Herz und Gedächtnis
Mitteldeutsche Zeitung, 15.8.2023
Matthias Zwarg: Im Herzen barfuß
Freie Presse, 15.8.2023
Marko Martin: Nie mehr der Lüge den Ring küssen
Die Welt, 16.8.2023
Josef Kraus: Mutiger Lyriker, Essayist, Sprachschützer, DDR-Dissident, Patriot – Reiner Kunze zum 90. Geburtstag
tichyseinblick.de, 16.8.2023
Erich Garhammer: Das Gedicht hat einen Wohnort: entlang dem Staunen
feinschwarz.net, 16.8.2023
Volker Strebel: Ein deutsch-deutscher Dichter
faustkultur.de, 29.8.2023
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG + IMDb + Archiv +
Kalliope + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Rede + Interview 1, 2 & 3
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Reiner Kunze – Befragt von Peter Voss am 15.7.2013.


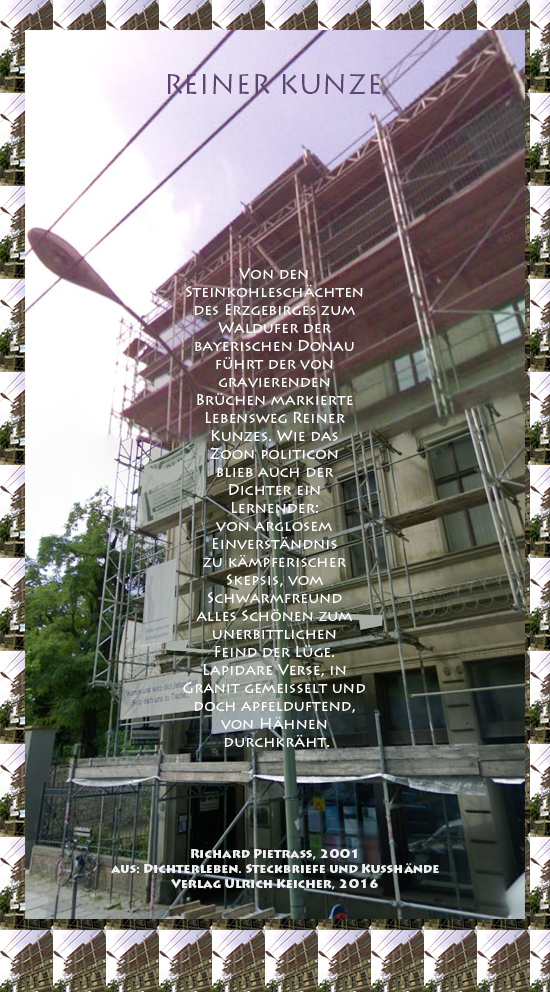












noch ein Beitrag zu Kunzes 80.:
http://signaturen-magazin.de/jayne-ann-igel–unversiegelte-botschaften.html
Liebe Jayne, Vielen Dank für die Info. Wenn Reiner Kunzes „Ein Tag auf dieser Erde“ freigeschaltet wird, ist der Artikel mit dabei.