Reiner Kunze: zimmerlautstärke
ZUFLUCHT NOCH HINTER DER ZUFLUCHT
(für Peter Huchel)
Hier tritt ungebeten nur der wind durchs tor
Hier
ruft nur gott an
Unzählige leitungen läßt er legen
vom himmel zur erde
Vom dach des leeren kuhstalls
aufs dach des leeren schafstalls
schrillt aus hölzerner rinne
der regenstrahl
Was machst du, fragt gott
Herr, sag ich, es
regnet, was
soll man tun
Und seine antwort wächst
grün durch alle fenster
Diese neuen,
oft nur aus wenigen Zeilen gebildeten Gedichte des DDR-Lyrikers Reiner Kunze sind aphoristische Notizen, spruchartige Gebilde, Merkgedichte, Monologe (mit der Tochter), in Zimmerlautstärke gesprochen, aber doch in einem unüberhörbaren Ton.
S. Fischer Verlag, Klappentext, 1972
Reiner Kunze zu den Gedichten zimmerlautstärke
Das Motto, welches Reiner Kunze an die Spitze der Gedichte gestellt hat, die unter dem Titel Zimmerlautstärke erschienen sind, sagt (nach Seneca):
… bleibe auf deinem Posten und hilf durch deinen Zuruf; und wenn man dir die Kehle zudrückt, bleibe auf deinem Posten und hilf durch dein Schweigen.
Zwischen Zuruf und Schweigen – das ist der Ort dieser Gedichte.
Reiner Kunze stammt aus einer Arbeiterfamilie; er ist 1933 geboren in Oelsnitz, im Erzgebirge. In Leipzig studierte er Philosophie und Journalistik, wurde wissenschaftlicher Assistent; er verließ dann die Hochschule und arbeitete in einer Maschinenfabrik. Seit 1962 lebt er als Schriftsteller in Greiz, Deutsche Demokratische Republik, Kreis Gera. Er ist verheiratet mit einer Tschechin. Sein erster Gedichtband ist 1955 erschienen. Unter den Bänden, die folgten, haben besonders zwei dem Namen des Autors Gewicht gegeben: Widmungen (1963) und Sensible Wege (1969).
Durch den Band Sensible Wege ist ein Strafverfahren gegen Reiner Kunze ausgelöst worden. Fritz J. Raddatz teilt mit (in seinen „Materialien zur Literatur der DDR“), man habe Kunze wegen „Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit“ zu einer Geldstrafe von fünfhundert Mark verurteilt. Und weiter: aus einem vom Verlag Neues Leben vorbereiteten Bande mit Nachdichtungen zu László Nagy wurden Kunzes Beiträge herausgenommen: Kunze stimme mit den kulturpolitischen Zielen des Verlages nicht mehr überein. Was hätte man von dem Lyriker gern erfüllt gesehen? Im Zusammenhang mit der Sammlung Lyrik der DDR ist es gesagt worden:
Die Subjektivität der Lyrik bewährt sich nach unserer Ansicht in ihrer Wahrheit und Notwendigkeit. Auch das Schöne eines Gedichtes ist nur schön, wenn es zugleich wahr und gut ist, das heißt zur Verwirklichung des historisch Notwendigen beiträgt.
Gefragt sind: „volksverbundene“, „realistische“, „aktiv parteiliche Gedichte“. Solcher Forderung hat Reiner Kunze nicht genügt – wie Wolf Biermann nicht, wie Peter Huchel nicht. Aber Reiner Kunze und seinesgleichen sind keine Feinde der Gesellschaft, in der sie leben; sie sind Kommunisten und möchten den Kommunismus in der Praxis so bereinigt sehen, wie er es in der Idee ist, die sie von ihm haben. So spricht einer aus Kunzes Generation, Volker Braun (geboren 1939 in Dresden), für die meisten andern, wenn er sagt:
Wir schreiben nicht mehr gegen die bestehende Gesellschaft, sondern für sie, für ihre immanente Veränderung.
Der Schreiber hat in seinem Schreiben Anteil am Heranwachsen der sozialistischen Gesellschaft zu sich selbst. In manchen Fällen artikuliert sich dieses Anteilhaben als Kritik, als Widerstand. Werner Brettschneider sagt (Zwischen literarischer Autonomie und Staatsdienst):
… Die Generation derer, die als junge Menschen in den sozialistischen Staat hineinwuchsen und das Neue als das Ihre mit Enthusiasmus begrüßten, ist, zur Enttäuschung der führenden Alten, welche diesen Staat unter Schmerzen schufen, zu einem kritischen Selbstbewußtsein erwacht, sieht sich in gesellschaftliche Zwänge und Forderungen verstrickt und setzt sich zur Wehr…
Die Generation setzt sich aber nicht gegen, sondern für den sozialistischen Staat zur Wehr. Was damit an Qual des Denkens und an Trauer verbunden ist, in was für Listen sich die Heiterkeit und der Scherz da begeben: an manchen Gedichten aus der Deutschen Demokratischen Republik ist es abzulesen. Auch an Gedichten Reiner Kunzes – an diesem Reden zwischen Zuruf und Schweigen.
Die erste Gruppe der Gedichte Reiner Kunzes in der Sammlung Zimmerlautstärke ist überschrieben: „Monologe mit der Tochter“. Monolog heißt Selbstgespräch; Monolog mit jemandem – Selbstgespräch mit jemandem: ich rede vor mich hin, und dieses Vor-mich-hin-Reden ist ein Anreden, doch das Gegenüber, das ich anrede, ist leibhaft nicht da. Selbstgespräch mit jemandem ist das Lautwerden – nicht der Einsamkeit, sondern des Schlimmeren: des Alleinseins. Das Anreden ohne leibhaftes Gegenüber ist ein Laufen durch maßlose Entfernungen.
„Monologe mit der Tochter“: ob Tochter oder Sohn, das ist so nicht wesentlich; Tochter oder Sohn stehen für ein Dasein, welches von mir ausgeht und von mir am gründlichsten mitbestimmt ist – das mir Nächste. Und Selbstgespräch mit dem mir Nächsten, das macht das Alleinsein durch den Anschein der Vertraulichkeit schlimm.
Das erste Stück in der Reihe „Monologe mit der Tochter“ heißt:
MEDITIEREN
Was das sei, tochter?
Gegen morgen
noch am schreibtisch sitzen, am hosenbein
einen nachtfalter der
schläft
Und keiner weiß vom anderen
In diesem Gedicht sind die Leerzonen redend: zwischen dem Titel „Meditieren“ und der erinnerten Frage „was das sei, tochter?“ ist die gegenwärtige Frage des Kindes „Was ist das, Meditieren?“ Hat das Kind aber so gefragt, so daß man die Frage erinnernd wiederholen kann? Oder fragt man sich selber so und wünscht sich ein Gegenüber, das die Frage hörte und ihr ein Ziel, einen Sinn gäbe? Das alles ist in den Leerstellen des Gedichtes untergebracht. In der Nacht sind die Gedanken wach mit einem und um einen gewesen; da der Tag näher kommt, da die Leute aufstehen, da der eine dem andern zum Gegenüber werden könnte: da verweigern die Gedanken den Flug – sie haben sich beim Suchen des andern erschöpft. Auch der Denkend-Sinnende und seine Gedanken haben sich aneinander erschöpft – „und keiner weiß vom anderen“.
Der Schluß ist die Antwort auf den Anfang: Meditieren? Das ist nicht nur ein Fördern, sondern auch ein Aushalten der weiteren Erfahrung, daß keiner vom andern weiß: wie sehr er sucht, wie sehr er wartet.
Das Gedicht „Meditieren“ ist in seiner Bildlichkeit nicht metaphorisch entworfen; aber das Reden in seinen Leerstellen setzt der Bildlichkeit zu und macht sie metaphorisch durchlässig, im Einfachsten sinn-reich.
Zu den Gedichten „Monologe mit der Tochter“ gehört auch dieses:
NACH DER GESCHICHTSSTUNDE
Die damals, der
Tamerlan war der
grausam: zehntausende seiner gefangenen ließ er
binden an pfähle, mit mörtel und lehm
übergießen lebendig
vermauern
Tochter, die teilweise ausgrabung
jüngster fundamente
wird bereits
bereut
Da braucht die Sprache Zeit, bis sie sich findet und sagen kann, was gesagt sein will. „Die damals, der / Tamerlan war der / grausam“: die Wörter erscheinen herumgejagt; sie suchen verstört ihre Stelle im Satz, in der Zeile; sie laufen am Doppelpunkt auf, ergießen sich breit in die Mitteilung. Ein Wort scheint sich, Halt suchend, nach dem anderen umzusehen (das eine „lebendig“ ist rückwärts und vorwärts gebunden, an „übergießen“ und an „vermauern“). Mehr und mehr versickert dann die Sprache im Schrecken, bis auf den Rest „vermauern“, und danach ganz. Ein Zurückweichen ins Schweigen. Dasselbe Zurückweichen zeigt die Sprache in der Schlußgruppe des Gedichtes, nun aber kein Zurückweichen vor dem Gräßlichen des Damals, sondern ein Zurückweichen nach dem Blick auf „jüngste fundamente“, nach dem Einblick in den Grund, auf dem man steht. Im Schriftbild des Gedichtes sind keine graphischen Machenschaften; das Schriftbild selbst entspricht dem Gestus der im Schrecken versickernden Sprache.
Von Schrecken reden die Gedichte Reiner Kunzes in Zimmerlautstärke, nicht aber vorsichtig, sondern unverhüllt in der kritischen Zone des Leidens zwischen Zuruf und Schweigen. Von was für Schrecken? Es gibt nur den einen, in welchem alle andern zusammenlaufen: der Schrecken darüber, daß das redende Ich in seiner Einzigkeit von der Gesellschaft nicht nur nicht verstanden, sondern abgelehnt, ausgestoßen und in die Innerlichkeit verbannt werden könnte – damit es sich dort verzehre, ohne Beziehung zur Gesellschaft, für die es doch denkt und wirkt. Dahin gehören Sätze eines Mannes aus der Generation vor Reiner Kunze, Sätze René Schwachhofers:
Nichts kann ich euch bieten
als den mageren Sand
meiner Worte –
mit Wünschelruten
geht ihr
durch meine Wüste.
Ich aber bin
unendlich und
hoffnungslos.
Nichts kann ich euch bieten
als den Durst und
den mageren Sand meiner Worte.
Aber die Generation Reiner Kunzes reklamiert nicht nur Integration in die sozialistische Gesellschaft, sie reklamiert Integration in die Welt. „Es lebe das Weltbild“ – Reiner Kunze sagt es bitter; in der Bitterkeit scheinen die Wörter wider von Trauer, Sarkasmus, Enttäuschung und Hoffen. „Weltbild“, das heißt: Summe erfahrener Gegenden und gefundener Menschen. Und „Weltbild“ heißt: Weltanschauung, in System und Dogma gefangenes Denken, welches einen hindert, jene Welt zu gewinnen; Denken, durch Vor-Entscheidungen behindert. Davon redet Reiner Kunze im Gedicht mit dem Titel „Siebzehnjährig“:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWir sind jung
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadie welt ist offen
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(lesebuchlied)
Horizont aus Schlagbäumen
Verboten
der grenzübertritt am bildschirm ein bild
von der welt sich zu machen es lebe
das weltbild
Bis ans ende der jugend
Und dann?
Reiner Kunzes Texte in der Sammlung Zimmerlautstärke lassen einen nachprüfen, was das heißt: „Gedicht als stabilisator, als orientierungspunkt eines ichs.“ Und was das heißt: „Gedicht als akt der gewinnung von freiheitsgraden nach innen und außen.“ Reiner Kunzes Texte sind nicht nur bedeutende Meldungen aus der Literatur der Deutschen Demokratischen Republik; es sind Beispiele von Zeitgenössischem, das über seine Daten hinausweist. Kunst des verbindlich redenden, des geprüften und prüfenden Menschen.
Werner Weber, Neue Zürcher Zeitung, 18.2.1973
Zimmerlautstärke
In den finsteren Zeiten
Wird da auch gesungen werden?
Da wird auch gesungen werden
Von den finsteren Zeiten
Bertolt Brecht
Auf dem VI. Kongreß des Schriftstellerverbandes der DDR, der vom 28. bis 30. Mai 1969 in Ost-Berlin stattfand, attackierte der Vizepräsident Max Walter Schulz den Lyriker Reiner Kunze mit ungewöhnlicher Schärfe. In dem wenige Wochen vorher im Rowohlt Verlag erschienenen Band Sensible Wege drücke sich der „nackte vergnatzte, bei aller Sensibilität aktionslüsterne Individualismus“ aus, der mit dem „Antikommunismus, mit der böswilligen Verzerrung des DDR-Bildes kollaboriert“. Dieser Angriff war der Beginn eines Versuchs, den Dichter zur Persona non grata zu erklären. Zunächst verweigerte man ihm jegliche Veröffentlichungsmöglichkeit in der DDR, beschlagnahmte Buchsendungen und Briefe, belegte ihn mit Geldstrafen bei Publikationen in der Bundesrepublik und versuchte, ihn ähnlich wie Peter Huchel in eine immer tiefere Isolation zu treiben. Auf der anderen Seite meldeten sich in der Bundesrepublik Stimmen, denen Reiner Kunze nicht mehr in das Klima einer gesamtdeutschen Entspannung paßte. Der soeben bei S. Fischer erschienene Gedichtband Zimmerlautstärke wurde von zwei namhaften westdeutschen Verlagen – z.T. ohne daß man vorher das Manuskript kannte – abgelehnt. Zumeist verschanzte man sich hinter vordergründigen Argumenten: der Lyriker habe sich in einen provinziellen Schmollwinkel zurückgezogen, die Gedichte seien ästhetisch mißglückt, der Autor würde sich selbst schaden usw.
Gegen diese moralisch höchst bedenkliche Haltung, welche die Maßnahmen der DDR-Zensur in der Bundesrepublik sanktionieren hilft, war schon früh der Artikel von Yaak Karsunke in der Zeitschrift Konkret (30.6.1969) gerichtet. Auf Kunzes grundsätzliches Einverständnis mit einem menschlichen Kommunismus sollte angesichts des neuen Gedichtbandes eindringlich hingewiesen werden. Der Dichter zählte bis vor fünf Jahren zu den ersten Repräsentanten der jungen Garde der DDR-Literatur. So bezeichnete das Leipziger Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller Kunze noch 1967 als einen Autor, der versuche, „das Lebensgefühl seiner am Aufbau des Sozialismus teilnehmenden Generation auszudrücken“. Deutlich hebt das Nachschlagewerk seine Verdienste in der „satirischen Abrechnung mit fortschrittshemmenden Kunstauffassungen und unkünstlerischen Praktiken“ hervor. Erst das Erscheinen des Rowohlt-Bandes führte offensichtlich zu einem Kurswechsel in der Beurteilung des Dichters. Um zu einer gerechten Einschätzung der Gedichte Kunzes zu kommen, scheint es notwendig, seinen Weg als Sozialist und Schriftsteller zu kennen, der – grob skizziert – in vier Phasen zu den Reduktionsgedichten der beiden letzten Bände führte: Die Aufbau-Hymnen wurden noch vor 1960 durch liedartige Texte vor allem für Kinder abgelöst. Nach der Entdeckung der absoluten Metapher und ihrer Aktivierung in Gedichten von extremer Länge und Bildfülle fand der Dichter schließlich zu Texten von ungewöhnlicher Kürze und Doppeldeutigkeit.
Kunzes Anfänge unterscheiden sich kaum von der staatsoffiziellen Literatur der fünfziger Jahre. Auffällig ist lediglich, daß er sich im ,Bann der Tradition‘ zu Majakowski hingezogen fühlte. Sein Gedicht „Das Lob des Hausherrn“ aus dem mit Egon Günther geteilten Band Die Zukunft sitzt am Tische (1955) ist ohne Majakowskis Poem „Erzählung des Gießers Iwan Kosyrow vom Einzug in die neue Wohnung“ nicht denkbar. Bei Kunze steht nicht ein Gießer, sondern ein Bergarbeiter im Mittelpunkt. Nicht die funkelnden Wasserhähne in der neuen Wohnung werden gerühmt, sondern ein vom Staat finanzierter Urlaub am Meer. Im Unterschied zu den roten Gartenlaubenpoeten der damaligen Zeit wie Kurt Barthel und Louis Fürnberg ist Kunzes Ton ungekünstelt und erfrischend. Man spürt, daß der Autor aus einer Bergarbeiterfamilie stammt und die Proklamationen des neuen Staates, eine gerechte und bessere Welt auf deutschem Boden zu schaffen, vorbehaltlos glaubte: Er nahm alles wörtlich, erst später entdeckte er die Doppelbödigkeit in jedem offiziellen Satz.
Kunzes theoretische Äußerungen aus dieser Zeit verraten eine ausführliche Beschäftigung mit Bechers Verteidigung der subjektiven Poesie, die damals zwar offiziell gedeckt war, aber in Wirklichkeit – was der Dichter damals nicht durchschaute – in krassem Gegensatz zur geforderten Austauschbarkeit der kommunistischen Requisitenliteratur stand. 1960 erklärte Kunze in seinem Essay „Über die Lyrik als dichterisches Heldendasein des Lyrikers und des Volkes“, daß der Lyriker nichts als sein Inneres offenbare, daß sich dieser Prozeß jedoch durch die Wirkung objektiviere:
Verurteilt der Lyriker, verurteilt im Ich des Lyrikers der Leser, vorausgesetzt, daß die lyrische Verurteilung überzeugend ausgesprochen ist… Diese Macht des Lyrikers muß erkannt werden, zuerst von ihm selbst.
Kunze ist bis heute von dieser – in unseren Augen – überschätzten Wirkung von Literatur überzeugt, auch die SED-Funktionäre, die eben darum mit lauter Aufgeregtheit auf die „leisen Töne“ der Sensiblen Wege reagierten.
Schon Ende der fünfziger Jahre stand für Kunze die Frage nach der Kommunikation im Mittelpunkt, er schrieb Lieder, Texte zu Puppenfilmen und dergleichen. Die Arbeiten der zweiten Phase sind zum Teil immer noch affirmativ wie das „Lied des Jungen“ aus dem DEFA-Puppenfilm Der verschwundene Helm:
Der Soldat braucht einen Helm.
Wozu braucht ihn der Soldat?
Der Helm schützt seinen Kopf,
und der Kopf ersinnt die Tat,
die den Kindern der Welt
alle Blumen erhält
und das Glück, und das Glück
unsrer Republik.
Wenn man bedenkt, daß Kunze dieses Gedicht nicht als ,glatte Auftragsarbeit‘ verstand, sondern in einem nahezu naiven Glauben von der Wahrheit seiner Aussage überzeugt war, dann wird der dramatische moralische Protest einsichtig, den der Dichter nach dem Einmarsch der DDR-Truppen in die Tschechoslowakei erhob. Doch auffällig ist schon kurz vor 1960 ein Ausweichen auf ,unpolitisches Terrain‘. Kunzes Texte entdecken immer mehr den privaten Bereich (Haus, Kinder) und entziehen sich damit der staatlichen Verfügbarkeit; eine Wende bahnte sich an, die folgerichtig zur Kritik an den herrschenden Zuständen führte. 1960, etliche Jahre vor der offiziellen Entstalinisierung durch Chruschtschow, nahm er über den Umweg der Kinderlieder Elemente der Tierfabel auf, die schon von der Tradition her alles andere als ornamental und spielerisch ist und über eine starke aufklärerische Didaktik verfügt. Das Gedicht „Prolog“, das zum erstenmal in dem Band Aber die Nachtigall jubelt (1962) publiziert und später unter dem Titel „Das Ende der Kunst“ bekannt wurde, greift unmittelbar in die Auseinandersetzung mit der starrdogmatischen Kulturpolitik der SED ein.
„Du darfst nicht“, sagte die Eule zum Auerhahn,
„du darfst nicht die Sonne besingen.
Die Sonne ist nicht wichtig.“
Der Auerhahn nahm
die Sonne aus seinem Gedicht.
„Du bist ein Künstler“,
sagte die Eule zum Auerhahn.
Und es war schön finster.
Wie ist es zu diesem Umschlag gekommen? Der tschechische Kritiker Luboš Příhoda grenzte Kunze einmal gegen Kunert ab, dessen Methode in der „dialektischen Notiz des gedanklichen Prozesses“ bestünde, während bei Kunze die Emotion vorherrsche. Das ist vermutlich eine richtige Beobachtung, die auch noch für die jüngsten Gedichte gilt. Nicht durch die Aufklärung der kritisierten Theorie ist Kunze zur Neuorientierung gekommen, sondern durch unmittelbare Erfahrungen: Ihm, der mit einfachen Liedtexten das Volk erreichen wollte, mußte mit der Zeit auffallen, daß nur bestimmte Verhaltensweisen ausgesprochen werden durften, daß das Lied nicht zur Befreiung des einzelnen, sondern zu dessen Reglementierung diente. Er begann, Sprache und Sprachregelung zu unterscheiden. Erstaunt entdeckte er immer neue bürokratische Hindernisse wie Briefzensur und Reisebeschränkungen, die zur offiziellen Rede von ,sozialistischer Brüderlichkeit‘ und ,Freiheit‘ in verletzendem Widerspruch standen. Kunze geriet so Ende der fünfziger Jahre als Assistent an der Leipziger Karl-Marx-Universität in immer heftigeren Konflikt mit der Partei, die ihn schließlich zur ,Bewährung‘ in den Produktionsprozeß schickte. Als Hilfsarbeiter im Schwermaschinenbau und später in der Landwirtschaft öffnete sich ihm die gesellschaftliche Wirklichkeit: Die von ihm seinerzeit erfundenen Worte des Bergarbeiters aus dem „Lob des Hausherrn“ enthüllten sich ihm als Lüge. An Stelle des Requisitenwelt entdeckte Kunze das Besondere und Unverwechselbare anderer Menschen und fand sich selbst.
Diese Ich-Erfahrung wurde durch eine schwere Krankheit vertieft, die ihn zu einem längeren Erholungsaufenthalt in der ČSSR zwang. Dort kam er 1961/62 mit einem reichen literarischen Leben in Berührung, das im Unterschied zur DDR einige ,Freiheitsgrade‘ mehr besaß; persönliche Freundschaften entwickelten sich. In zahlreichen Gedichten aus dem Band Widmungen (1963) sowie u.a. in dem Kurzgedicht „Einladung zu einer Tasse Jasmintee“ aus den Sensiblen Wegen (1969) hat Kunze später dieses Aufenthalts gedacht:
Treten Sie ein, legen Sie Ihre
traurigkeit ab, hier
dürfen Sie schweigen.
Der Kontakt mit dem tschechischen Surrealismus, der durch die Person Nezvals auch während der Stalin-Ära eine gewisse Kontinuität wahren konnte, löste Kunze sprachlich von den letzten Relikten des sozialistischen Realismus. Die absolute Metapher, die er zu einem Zeitpunkt adaptierte, als sie in der Bundesrepublik fragwürdig zu werden begann, war ein politischer und existentieller Befreiungsakt. Ein Gedicht wie „In der Thaya“, das in der DDR nicht publiziert werden konnte, erregte noch 1968 den Kritiker Adolf Endler: „Der Dualismus von Rose und Ordnung mußte in die Irre führen und konnte nur ein verwirrtes Gedicht hervorbringen.“ In dem Augenblick, in dem sich Kunze der Widerspiegelungstheorie des sozialistischen Realismus entzog, wurde sein Gedicht ,realistisch‘ und damit für die etablierten Funktionäre gefährlich; denn „es sind nicht die äußeren Formen, welche den Realisten ausmachen“, wie schon Brecht wußte. Für Kunze war die kalkulierte Bild-Verwirrung jedoch nur ein Durchgangsstadium. Schon das 1960 – also vor dem ČSSR-Aufenthalt entstandene Gedicht „Das Ende der Kunst“ weist auf einen ganz anderen Einfluß, ohne den Kunzes weitere Entwicklung kaum denkbar ist.
Um 1960 setzte im Rahmen einer allgemeinen Emanzipation der DDR-Literatur eine erneute Diskussion um das Werk Brechts ein, das zu seinen Lebzeiten nur äußerst zögernd und oft widerwillig rezipiert worden war. In Analogie zum Theater – man denke an Peter Hacks, Heiner Müller, Helmut Lange – kam es in der Lyrik zu einer Mischung zwischen Brechtschen Techniken und einer eigentümlichen Reprivatisierung mit sentenzenhaftem Verweisungscharakter. Brechts listige Kurzpoeme mit ihrer doppeldeutigen Bildsprache wurden wie für Kunert auch für Kunze damals vorbildlich, wobei freilich der Einfluß der naturmagischen Dichtungen Huchels nicht unterschätzt werden darf. 1962 wurde Huchel als Chefredakteur der Zeitschrift Sinn und Form entlassen; kurz vor seinem Publikationsverbot konnte er noch das Gedicht „Der Garten des Theophrast“ veröffentlichen, in dem es heißt: „Sie gaben Befehl, die Wurzel zu roden.“ In dem Titelgedicht der Sensiblen Wege griff Kunze wenig später das Thema Huchels auf:
Sensibel
ist die erde über den quellen: kein baum darf
gefällt, keine wurzel
gerodet werden
Die quellen könnten versiegen
Wie viele bäume werden
gefällt, wie viele wurzeln
gerodet
In uns
Mit diesem Gedicht hat Kunze jene „künstlerische Umsetzung“ erreicht, die er 1960 in seinem Essay gefordert hatte. Die Verse sprechen zwar noch von Natur, setzen sich jedoch von Huchels magischer Bildlichkeit ab, und der Autor beherrscht bereits vollkommen die Brechtsche Technik, die Wahrheit verhüllt und unverhüllt zugleich zu sagen. Nur der Eingeweihte, der das Zitat kennt, kann den Vorgang – die Ausschaltung Huchels – identifizieren. Doch auch der Nicht-Eingeweihte kann seine Schlüsse ziehen: Ein Auseinanderklaffen von Verlautbarung und Wirklichkeit wird sichtbar; am Leser liegt es, den Widerspruch poetisch auszudeuten.
Es scheint mir wichtig, Kunzes Herkunft und Quellen zu kennen, um der Legende vorzubeugen, hier tarne sich eine ,westliche Stimme‘. Auch in dem neuen Band Zimmerlautstärke spricht ein Sozialist und DDR-Bürger in einer Weise, die zunächst ausschließlich aus den besonderen Verhältnissen der ostdeutschen Bürokratie zu erklären ist. So dürfen seine Naturgedichte nicht als harmlos-behagliche Idyllen mißverstanden werden, er entzieht sich mit ihnen vielmehr – ähnlich wie die hermetische Naturdichtung im Dritten Reich – dem Zugriff des Apparats. Auch bei Kunze spielt wie bei Huchel und Bobrowski eine gewisse slawische Thematik hinein, sein ,Sarmatien‘ liegt jedoch nicht in historischer Ferne, sondern ist die konkret erlebte Landschaft der Tschechoslowakei. In einer Vorbemerkung zu einem von ihm übertragenen Band tschechischer Lyrik notierte er:
Wer die tschechische poesie sucht, muß eine grüne wiese suchen. Sie ist immer eine wiese. Sie grünt zwischen schornsteinen und unter dem schmerz aller zeiten. / Sie grünt durch die gegenwart. / Sie hat es nahe zur erde.
Natur (als unantastbares Reservat) und tschechische Poesie (als noch nicht verdorbenes Sprachgut) werden analogisiert. Doch beide Bereiche sind in den Augen Kunzes – ähnlich wie Bobrowskis Sarmatien – durch historische Schuld bedroht. Dabei bedient sich der Lyriker nicht einer historischen Verkleidung, sondern nennt die Ereignisse von 1968 beim Namen. In dem Text „Der Weg zu euch“ permutiert er ein Gedicht von Jan Skácel, in dem es am Ende heißt:
… die finsternis wie eine volle fuhre heu
vor sich hinschieben
und statt der achsen
im traum die vögel stöhnen hören.
Es ist so leicht, den weg zu uns zu finden.
Kunze setzt mit der Schlußzeile von Skácel ein und wendet sie in die Vergangenheit, die Finsternis-Metapher wird aufgenommen, doch im Sinn des Auerhahn-Gedichts als moralische Verdunkelung verstanden, denn, „statt der achsen hörte man / im schlaf die menschen stöhnen. //Nun ist es schwer den weg zu euch zu finden.“ Die historische Tatsache der von der DDR mitverschuldeten Invasion, die eigene Erfahrung der böhmischen Landschaft und das ,unschuldige‘ Gedicht Skácels als literarische Folie durchdringen sich zu einem intimen Gedicht mit öffentlicher Sprengkraft. Das Gedicht „Angeln an der Grenze“ ist von ähnlicher Wirkabsicht bestimmt, doch Kunze vermeidet auch hier geschickt den Eindruck einer Geheimsprache. Das Wortspiel am Ende – Fisch heißt. im Tschechischen ,ryba‘, Fehler ,chyba‘ – ist wie die Permutationstechnik im vorhergehenden Gedicht alles andere als preziös. Der ,Formalismus‘ Kunzes gewinnt durch die Einbeziehung politischer Verhältnisse den Charakter eines Dokuments:
Bis auf den flußgrund stacheldraht den nur
der fisch durchschwimmt
Der blick durchforstet das gebüsch bevor wir
sprechen
Wovon?
Ähnlich klingen auf tschechisch die wörter
fisch und fehler
Entschlüsselt heißt das: Die angeblichen Fehler, die Ideen des Prager Frühlings bzw. gewisse linksliberale Vorstellungen aus der Bundesrepublik dringen trotz der Sperrmaßnahmen in den Gesprächs- und Denkbereich der DDR-Bürger, die Kunze in der Überschrift listig als ,Angler‘ auftreten läßt.
Zuweilen bleiben für Leser der Bundesrepublik Deutschland einige Bezüge nicht nachvollziehbar, weil der Bildungshorizont bei uns ein anderer ist. Die Verse über den Brief einer vierzehnjährigen Sowjetrussin, in dem lediglich vier Denkmäler, die von Lenin, Tschapajew, Kirow und Kuibyschew erwähnt werden, sind nur durch ein Vertrautsein mit der Geschichte des bolschewistischen Rußland verständlich. „Schade, daß sie nichts erzähle / von sich // Sie erzählt / von sich, tochter“. Auch hier benutzt der Autor wieder die überraschende Schlußpointe, um die Bedingungen der Gesellschaft aufzudecken, unter denen der einzelne leidet. Während die beiden erstgenannten denkmalswürdigen Personen eine unumstrittene Biographie aufweisen können, ist das Schicksal von Kirow und Kuibyschew ungeklärt: Beide sind vermutlich in den dreißiger Jahren ermordet worden.
Im Unterschied zu den Sensiblen Wegen gibt es in dem neuen Band zahlreichere Gedichte, in denen die Lehre von den Lesern nicht mehr gesucht werden muß. Kunze zeigt sie unmittelbar und verzichtet dadurch nicht nur auf künstlerische Zwischentöne. Er vermeidet auch, sich durch ,perfide Doppeldeutigkeit‘ zu schützen, um von der Partei mißverstanden werden zu können. Diese direkten Attacken man denke etwa an das Titelepigramm, an „Gebildete Nation“ oder an „In memoriam Johannes Bobrowski“ – sind für die DDR-Literatur ungewöhnlich. Während Brecht mit einer Ausnahme in den Buckower Elegien die Wahrheit unausgesprochen ließ oder maskierte – in dem Gedicht „Heißer Tag“ kostümierte er z.B. die neue Funktionärsclique mit klerikalen Gewändern –, setzt Kunze oft die Verurteilung, wahrscheinlich weil für ihn, ähnlich wie für Solschenizyn, der moralische Anspruch wichtiger ist als der taktische Kompromiß. Die Zeitgedichte Kunzes sind intimer und zugleich öffentlicher als die des späten Brecht, sie markieren die endgültige Befreiung von abgelebten Vorbildern und stehen damit stellvertretend für die Lebendigkeit der DDR-Literatur. Ihr dokumentarischer Charakter entspricht gewissen Tendenzen der objektbezogenen Dichtung in der Bundesrepublik und erschüttert Hans Mayers These von den zwei deutschen Literaturen nicht unerheblich.
Hans Dieter Schäfer, Neue Rundschau, Heft 4, 1972
Bleibe auf deinem Posten
Reiner Kunze, im Leipziger Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller 1967 noch als Lyriker und Übersetzer gerühmt, kann seit dem Herbst 1968 in der DDR nichts mehr veröffentlichen. Der heute 39jährige Kunze, der im thüringischen Greiz lebt, war im Westen mit der im Frühjahr 1969 bei Rowohlt erschienenen Lyriksammlung Sensible Wege bekannt geworden: Sie zeigt ihn als einen Mann, der gegen die Stagnation der Revolution ankämpft, der die Rechte des einzelnen verteidigt, als einen engagierten Sozialisten, der sich in kritischer Liebe zu seinem Land bekennt, es aber verbessern, das Leben in ihm menschlicher für die Menschen machen möchte.
Aber man hat in der DDR nicht sehen wollen oder können, daß die Bekenntnisse kritischer Individualisten mehr Gewicht haben als alle wohlfeilen und lautstarken Loyalitätsbekundungen ergebener Polit-Poeten. Kunze wurde auf dem VI. Schriftstellerkongreß im Mai 1969 in Ost-Berlin von Max Walter Schulz zunächst öffentlich angegriffen; danach versuchte man (und versucht es bis heute), seine Arbeit zu behindern, ihm Publikationen unmöglich zu machen, seinen Namen im Bewußtsein der Öffentlichkeit auszulöschen. Kunzes Texte wurden aus Anthologien entfernt, Übersetzungsaufträge wurden ihm entzogen, für Veröffentlichungen im Westen wurde er mit empfindlichen Geldstrafen belegt.
Wird man jetzt, nachdem soeben bei S. Fischer (Frankfurt/M.) Kunzes Gedichtband Zimmerlautstärke erschienen ist, in der DDR wieder versuchen, Reiner Kunze als einen Gegner des Sozialismus und als verbitterten Querkopf hinzustellen, oder wird man merken, daß hier einer spricht, der vom Standpunkt sozialistischer Humanität aus Anspruch und Wirklichkeit in seinem Lande kritisch miteinander vergleicht?
Eines der neuen Gedichte Kunzes trägt den Titel „Gebildete Nation“ und spielt damit an auf den lange Zeit in der DDR propagierten kulturpolitischen Slogan „Auf dem Wege zur gebildeten Nation“:
Gebildete Nation:
aaaaaaaaaaaaaaaPeter Huchel verließ die Deutsche Demokratische Republik
aaaaaaaaaaaaaaa(Nachricht aus Frankreich)
Er ging
Die zeitungen meldeten
keinen verlust
Der jetzt 69jährige Peter Huchel, den das DDR-Schriftstellerlexikon noch 1967 „in die erste Reihe der deutschen Lyriker des 20. Jahrhunderts“ gestellt hatte, lebte jahrelang in geistiger und physischer Quarantäne bei Potsdam, als „Staatsfeind“ geächtet und überwacht. 1971 endlich hatte er, nach Intervention des PEN und durch die persönliche Initiative Heinrich Bölls, in den Westen ausreisen können. Der Weggang des mit Reiner Kunze befreundeten Dichters war von der Presse der DDR weder gemeldet noch kommentiert worden. Der Name Peter Huchel wurde seit Jahren in der DDR totgeschwiegen – mit dem Erfolg, daß sein Werk heute unter Schülern und Studenten der DDR nahezu unbekannt ist. Dieses skandalöse Faktum – daß es sich nämlich eine auf Bildung erpichte Nation leistet, einen ihrer bedeutendsten Schriftsteller zu verschweigen und seinen Weggang nicht zu diskutieren –, behandelt Kunze in seinem Gedicht, das in seiner Aussage unangreifbar und in seiner Konfrontation von Anspruch und Realität nicht zu widerlegen ist.
Derartige Gedichte machen deutlich, daß die Dinge, die Kunze bedrücken, keine Ausflüsse privater Neurosen sind, sondern konkrete Realität. Die diffamierende Behauptung, Kunze sei ein überängstlicher Psychopath, wird von interessierter Seite in der DDR verbreitet und ist bedauerlicherweise auch gelegentlich schon in der Bundesrepublik nachgeplappert worden: so wurde etwa am 26. September 1970 in der Frankfurter Rundschau unwidersprochen Max Walter Schulz mit seiner Behauptung zitiert, Kunze habe sich „als pathologischer Fall angstpsychologisch mit lyrischem und persönlichem Stacheldraht umgeben“. Bei derartigen Äußerungen sollte man sehr hellhörig werden, könnten sie doch eine durchsichtige Methode sein, die Öffentlichkeit auf eine mögliche künftige Zwangsbehandlung in psychiatrischen Anstalten nach sowjetischem Vorbild vorzubereiten. In Wirklichkeit trifft auch für Reiner Kunze zu, was Jean Améry so formulierte: „Ich weiß, was mich bedrängt, ist keine Neurose, sondern die genau reflektierte Realität…“
Es ist nachweisbar unsinnig, das Bild eines verbitterten und psychopathischen Reiner Kunze zu lancieren. In den drei letzten Jahren hat Kunze die heiter-freundlichen Kindergeschichten des Buches Der Löwe Leopold und das Kinderbuch Der Dichter und die Löwenzahnwiese veröffentlicht. Seine bitteren – nicht verbitterten! – Gedichte stehen also in einem biographisch-literarischen Kontext, dessen Tenor Freundlichkeit und Humor ist. Und übrigens finden sich auch in dem neuen Band Zimmerlautstärke leichte, gelöste Gedichte, die durchaus keine Verbitterung zeigen.
Ferner: Verbitterung frustriert. Kunze aber hat in den vergangenen Jahren mehrere Bücher mit Lyrik und Übertragungen im Westen veröffentlicht, in westdeutschen Zeitschriften, Almanachen und Anthologien publiziert, hat Hunderte von Versen der Lyriker Illyés und Novomeský übersetzt, und er hat in der DDR auf zahlreichen Veranstaltungen vor Tausenden von Menschen, Studenten vor allem, gesprochen und aus seinen Arbeiten gelesen – freilich unter äußerst schwierigen Bedingungen für diejenigen, die Kunze einluden. All dies spricht für eine ungebrochene schöpferische Aktivität und straft all jene Lügen, die das Märchen von dem verbittert und resigniert im Thüringer Wald hockenden Dichter Reiner Kunze kolportieren.
Ein weiteres zentrales Thema neben der DDR-Wirklichkeit ist in Reiner Kunzes neuen Gedichten die Tschechoslowakei. Ein ganzer Zyklus unter dem Titel „wie die dinge aus ton“ ist ihr gewidmet. Diesen Gedichten ist ein Zitat von Jean Améry vorangestellt:
Ohne das Gefühl der Zugehörigkeit zu den Bedrohten wäre ich ein sich selbst aufgebender Flüchtling vor der Wirklichkeit.
Für Kunze, der mit einer tschechischen Ärztin verheiratet ist, sind die Bedrohten all die Freunde in der ČSSR, die sich seit dem 21. August, seit der Okkupation der Tschechoslowakei, immer stärkeren Repressionen unter dem Vorwand der „Normalisierung“ ausgesetzt sehen. Kunzes Gedichte über die ČSSR sind nicht lyrische Argumentationen und Aggressionen eines Revisionisten, sondern Seismogramme der Erschütterung über das, was 1968 jenem Land angetan wurde, zu dem er besonders enge Beziehungen hat und dem er viel verdankt.
In den sechziger Jahren, als er in der DDR nur wenige Publikationsmöglichkeiten hatte, war Kunze ständiger Mitarbeiter tschechischer Zeitungen; viele seiner Gedichte erschienen zuerst auf Tschechisch im Druck. Kunze war häufig Gast von Kongressen in der ČSSR und konnte in Heimen des Tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes zu Arbeits- und Erholungsaufenthalten sein. 1965 wurde er mit einem hohen Staatsorden ausgezeichnet, und im Frühjahr 1968 erhielt er den Preis für Nachdichtungen des Tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes. Zahlreiche Rundfunksendungen und abendfüllende Veranstaltungen im Theater der Poesie stellten Kunzes Werk dem Publikum in der ČSSR vor.
Reiner Kunze hat, mit Erfolg, versucht, das Vertrauen der Tschechen für die jüngere deutsche Generation zu gewinnen – durch die eigene Lyrik, durch Nachdichtungen von Lyrik, Dramen und Hörspielen. In der ČSSR und in der DDR hat er viele Vorträge über die ČSSR-Literatur gehalten. Seine Mittlerrolle ist oft anerkannt worden, nicht nur offiziell, sondern auch von den Lesern und Kritikern.
Als einem subtilen Kenner der Verhältnisse war es Kunze also möglich, die Entwicklung in der ČSSR zu verfolgen. In seinen Gedichten spricht er als ein unmittelbar Betroffener – als ein Deutscher aus der DDR, deren Panzer in das Land seiner Freunde einrückten, als einer, der mitgeholfen hat, ein Vertrauen aufzubauen, das dann so jäh zerstört wurde. Dies erklärt die Intensität der Reflexion der Ereignisse im Jahre 1968 in Kunzes Dichtung, erklärt die Tiefe der Emotion. Das Gedicht „wie die dinge aus ton“ beispielsweise spricht davon, wie der Glaube und das Vertrauen einer ganzen Generation endgültig zerbrochen worden ist. Es ist verständlich und nur logisch, daß Reiner Kunze – gerade als engagierter Sozialist – den Einmarsch in die Tschechoslowakei im August 1968 verurteilen muß. Nur nebenbei sei erwähnt, daß er sich damit in bester (auch kommunistischer) Gesellschaft etwa der KP Italiens und Frankreichs – befindet. Hier sein Gedicht
„Der Weg zu Euch“:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaEs ist so leicht, den weg zu uns zu finden (Jan Skácel)
Es war so leicht den weg zu euch zu finden
Aus wolken und wäldern die
aus den nähten platzten fanden sie ihn
noch nachts
Über kimme und korn
kürzten sie ab, die tore standen
angelweit, verwunderung
bis an die schwellen
In der finsternis, die sie
vor sich herschoben,
verirrten sie sich
Sie richteten sich ein
auf den brücken
Und statt der achsen hörte man
im schlaf die menschen stöhnen
Nun ist es schwer den weg zu euch zu finden
Schließlich noch zu einem weiteren Themenkomplex in der jüngsten Lyrik Reiner Kunzes: der Sowjetunion und dem Schicksal des Schriftstellers Alexander Solschenizyn. Solschenizyn gilt das Gedicht „8. Oktober 1970“, das sich auf das Datum bezieht, an dem Solschenizyn der Nobelpreis für Literatur zuerkannt wurde:
Ein tag durchsichtig bis
Rjasan
Nichtverbannbar nach Sibirien
Die zensur kann ihn
nicht streichen
(In der ecke glänzt
das gesprungene böhmische glas)
Ein tag der die finsternis
lichtet
Der ans mögliche erinnert:
Immer wieder einen morgen
auf sein gewissen nehmen
In der DDR ist das Werk Alexander Solschenizyns niemals publiziert worden, und als dem russischen Romancier der Nobelpreis zuerkannt wurde, da verstand man das in der DDR nicht als eine hohe Auszeichnung für die sozialistische Literatur der Sowjetunion. Am 29. Oktober 1970 veröffentlichte das Neue Deutschland eine Erklärung des DDR-Schriftstellerverbandes, in der es heißt:
Wenn wir unseren guten Wille sehr bemühen, können wir die diesjährige Entscheidung der Schwedischen Akademie einen groben Irrtum nennen; was dann immer noch bleibt, ist die Wirkung ihres Schrittes: Er hat einer weitgespannten antisowjetischen und antisozialistischen Kampagne Vorschub gegeben; der Entspannung – und damit auch der Literatur, denn die eine gedeiht durch die andere – wurde ein übler Dienst erwiesen.
Zu dieser Stellungnahme des Schriftstellerverbandes sagte Reiner Kunze damals in einem Gespräch:
Wenn Literatur durch Entspannung und Entspannung durch Literatur gedeiht – und ich wende mich gegen eine Entscheidung, durch die humanistische Literatur geehrt wird –, kann nur ich es sein, der der Entspannung und der Literatur einen üblen Dienst erweist… Und ,weitgespannte antisowjetische und antisozialistische Kampagne‘? Dagegen wüßte ich ein besseres Mittel, als Solschenizyn den Nobelpreis nicht zu verleihen. Ich würde seine Werke drucken. Allerdings nicht aus diesem Grund. Sondern der Wahrheit wegen. Denn Entspannung gibt es nicht ohne Wahrheit. Ohne Wahrheit gibt es höchstens Schein-Entspannung. Und Schein-Literatur.
In der Nobelpreisverleihung an Solschenizyn sieht Reiner Kunze ein Ereignis, das „die finsternis lichtet“, das hilft, die Wahrheit über Solschenizyn und seinesgleichen sichtbar zu machen und damit die Barrieren einer sonst allmächtigen Zensur zu überwinden. Diese Preisverleihung signalisiert für Reiner Kunze eine Hoffnung – die Hoffnung, daß eine unheilvolle Vergangenheit bewältigt wird und es auch keine Zukunft mehr gibt für diese Vergangenheit, von der Kunze in seinem als Gespräch mit der Tochter angelegten Gedicht „nach der geschichtsstunde“ spricht:
Die damals, der
Tamerlan war der
grausam: zehntausende seiner gefangenen ließ er
binden an pfähle, mit mörtel und lehm
übergießen lebendig
vermauern
Tochter, die teilweise ausgrabung
jüngster fumdamente
wird bereits
bereut
In einer der drei kurzen Nachbemerkungen zu seinem Gedichtband Zimmerlautstärke nennt Reiner Kunze das Gedicht einen Stabilisator, einen Orientierungspunkt des Ich; das Gedicht ist für ihn ein „akt der gewinnung von freiheitsgraden nach innen und außen“. Und er bezieht sich damit auf ein Zitat von Alexander und Margarete Mitscherlich, die schreiben,
daß es nicht leicht ist, Anweisungen des Kollektivs zu widerstehen, die bald Strafdrohungen sind, bald primitive Triebbefriedigungen enthemmen. Hier in kritischer Distanz zu bleiben, setzt Kaltblütigkeit, also einen hohen Grad stabiler Ich-Organisation voraus; noch schwerer ist es, die durch Kritik gewonnenen Einsichten dann auch als Richtlinien des Verhaltens beizubehalten.
Und zu seiner Bemerkung, daß Gedichte ebenso mißbrauchbar seien wie die Macht mißbrauchbar ist, zitiert Reiner Kunze Heinrich Böll:
Es gibt Künstler, Meister, die zu bloßen Routiniers geworden sind, aber sie haben – ohne es sich und den anderen einzugestehen aufgehört, Künstler zu sein. Man hört nicht dadurch, daß man etwas Schlechtes macht, auf, ein Künstler zu sein, sondern in dem Augenblick, in dem man anfängt, alle Risiken zu scheuen.
Reiner Kunze gehört nicht zu den Künstlern, die das Risiko scheuen. Mit seinem Werk und mit seiner Existenz steht er ein für seine Überzeugungen und Erkenntnisse. Seinem Gedichtband Zimmerlautstärke hat er ein Wort von Seneca vorangestellt:
… bleibe auf deinem Posten und hilf durch deinen Zuruf; und wenn man dir die Kehle zudrückt, bleibe auf deinem Posten und hilf durch dein Schweigen.
Peter W. Gerhard, Deutsche Zeitung, 29.9.1972
Entfremdung im Sozialismus
zimmerlautstärke – der Titel von Reiner Kunzes neuem Gedichtband ist auf eine beredte Weise doppeldeutig. Denn er suggeriert einerseits den Sachverhalt nachbarschaftlicher Rücksichtnahme, andererseits aber eine hochbrisante politische Szene, die so beschaffen ist, dass die Menschen nicht frei und offen miteinander zu reden wagen, sondern mit ihren Meinungen in ihren vier Wänden bleiben müssen, in denen sie ihre Gedanken wie Kassiber auszutauschen gezwungen sind:
Was ich verwahre hinter schloss und siegel?
Keine konspiration nicht einmal
pornografie
Vergangenheit, tochter
Sie zu kennen kann
die Zukunft kosten.
Kunze, Arbeitersohn und ursprünglich auf eine selbstverständliche, fast naive Weise solidarisch mit dem Staat, in dem er heranwuchs, will auch heute keine andere Freiheit als die Erlaubnis, seine spontanen Empfindungen und seine (in freier Assoziation zutage tretenden) Ansichten äussern zu können. Da war zunächst und da ist bis jetzt keinerlei umstürzlerische Idee oder Ideologie mit im Spiel. Da gibt es lediglich einen Drang, in einem Lebensrhythmus zu existieren, der nicht in die persönliche Sphäre hinein vorprogrammiert ist. Kunze möchte ein autonomer Mensch sein, der nicht nur Anspruch auf soziale und ökonomische Gerechtigkeit hat, sondern zugleich auf Entfaltung des Psychisch-Immanenten sowie auch auf gelegentliche Missfallensbekundungen. Doch der Staat, in dem er lebt, ist allergisch gegen alles Private, Nichtöffentliche. Und er ist empfindlich für Kritik, sofern diese nicht den Charakter von individueller Selbstkritik von Verleumdung der – aus dem normativen Rahmen herausfallenden – Nebenmenschen besitzt. Kritik lediglich als Mittel der Machtkonsolidierung. Als ein Mechanismus, mit dessen Hilfe der Produktionspegel angehoben werden soll. Reiner Kunze versteht den Einzelnen nicht nur als funktionales Teilstück der Sozietät. Er sieht in Ihm auch das gesellschaftliche Subjekt, auf dessen Bedürfnisse die Massnahmen der Kollektivführung zugeschnitten sein müssen, wollen sie nicht humanistischer Purismus bleiben. Nicht das mythologisch verbrämte Wir also, das die Parteibarden besingen, sondern das Du, der Partner des Ich, ist Kunzes intentionaler Bezugspunkt:
AUF DICH IM BLAUEN MANTEL
(für Elisabeth)
Von neuem lese ich von vorn
die häuserzeile suche
dich das blaue komma das
sinn gibt
Anders als das Gros der DDR-Lyriker war Kunze nicht bereit, Lippenbekenntnisse abzulegen, wo es Differenzierteres zu sagen und „Sensible Wege“ einzuschlagen galt. Doch jeder Schritt, den der Dichter in Richtung Individuation unternahm, verstrickte ihn zunehmend in äussere Konflikte und dadurch in innere Schwierigkeiten. Und schliesslich hatte er einen Zustand erreicht, in dem ihn die Starrheit der Gebote und die Unsinnigkeit der meisten Tabus allein durch die Tatsache ihres blossen Vorhandenseins zum Widerspruch herausforderten – mit dem Resultat, dass die Gegensätze wie Abgründe aufklafften, einfach nur deshalb, weil hier ein menschliche Stimme sprach, die nicht berücksichtigte, was der Agit-Prop-Mann im ideologischen Souffleurkasten an amtlichen Parolen vorlispelte:
Alles
durchdringe die mathematik, sagt
der lehrer: medizin
Psychologie
sprachen
Er vergisst
meine träume
In ihnen rechne ich unablässig
das unberechenbare
Und ich schrecke auf wenn es klingelt
wie du.
Der Umstand, dass Kunze die Signale des Unbewussten im Sozialismus mitgarantiert wissen will, hat ihn seit langem derart verdächtig gemacht, dass man seine Post zensiert, seine schriftstellerische und übersetzerische Tätigkeit unterbindet, jede seiner Publikationen im Ausland mit Geldstrafen belegt und ihn dazu zwingt, sich Verleger in der Bundesrepublik zu suchen. Hier allerdings zeigt man sich, anders als im Falle Huchels, recht betreten darüber, dass es mit Kunze das konkrete Beispiel eines unterdrückten und nervlich permanent terrorisierten DDR-Poeten gibt, der sich – von der metaphorischen Qualität, seiner Sprache ganz abgesehen – geradezu im Bereich faktischer Deskription bewegt, wenn er sagt:
Bis auf den flussgrund stacheldraht den nur
der fisch durchschwimmt.
Verse wie diese, weil sie aus so authentischem Munde kommen, nehmen die westdeutschen Marxisten (und leider auch die – als unabhängig und ideologiefrei firmierenden – bundesrepublikanischen Verleger) nicht gern zu Kenntnis.
Da hat zum Beispiel Dieter Schlesak am 26. September 1970 in der Frankfurter Rundschau anlässlich des Erscheinens von Kunzes Der Löwe Leopold einige grundsätzliche Ueberlegungen publiziert, die unter der bezeichnenden Ueberschrift „Das Märchenbuch von der autoritären DDR“ vorgetragen wurden:
Seine eigene Lage, seine Neurose wirkt wie ein akutes Krankheitssymptom der deutschen Lage… Das gesellschaftliche Bewusstsein liegt brach… Durch verhinderte Oeffentlichkeit, manipulierte Oeffentlichkeitslosigkeit entsteht eine neue machtbedingte Innerlichkeit, ein isoliertes Ich als Staatsbürger, als unpolitischer Ordnungs- und Ruhebürger wie eh und je in der urbürokratischen deutschen Geschichtstradition… Kunzes dichterisches Psychogramm ist das Ausdruck gewordene Pathogramm dieser neuen, erzwungenen inneren Bürgerlichkeit des DDR-Privatmenschen und der aufgezwungenen, jedoch altbekannten deutschen Provinz.
Schlesak, der nur dem Anschein nach ein gewisses Verständnis für die Situation Kunzes aufbringt, instrumentalisiert mit einer trockenen und hinterhältigen Dogmatik den Dichter kaum weniger als die Kulturfunktionäre Ostdeutschlands. Schlesak, der die eigentliche Schuld für die innenpolitische Misere im kommunistischen Deutschland in der Weigerung der Bundesrepublik sieht, „die DDR als neues deutsches Gesellschaftssystem und souveränen Staat anzuerkennen“, setzt freilich die Akzente besonders raffiniert. Er lässt den Wunsch nach einem persönlichen Zentrum, einem privaten Reservat, nicht als elementares menschliches Bedürfnis gelten, sondern diffamiert alle introvertierten Intentionen leichthin und in gewohnter, die Sachverhalte umfunktionierender Weise als Neurose und Innerlichkeit. Er führt Sensibilität ausschliesslich auf falsche Politik zurück und erkennt nicht, dass sich Kunzes tragische Situation aus dem Zusammentreffen von zwei getrennten, wenn auch unglücklicherweise miteinander kollidierenden Faktoren ergibt: dem primären Vorhandensein eines Interesses für das Menschlich-Private und einer masslosen Ueberpolitisierung, welche die Entfaltung des Lebens durch phantasielose Formalisierung behindert.
Reiner Kunze macht in seinen Gedichten den Technikern staatlicher Macht eine individualistische Gegenrechnung auf, wenn er ein „Psychogramm“ der Instanzen liefert, die in ihrem eigenen Herrschaftsbereich jenen Zustand geistig-emotionaler Entfremdung verursachen, den es der orthodoxen Lehre nach ausschliesslich im Umkreis des Kapitalismus geben dürfte:
Wir sind jung
die welt ist offen
(lesebuchlied)
Horizont aus schlagbäumen
Verboten
der grenzübertritt am bildschirm ein bild
von der welt sich zu machen es lebe
das weltbild
Bis ans ende der jugend
Und dann ?
Hans-Jürgen Heise, Die Tat, 14.10.1972
Vax humana im Kammerton
Der Verseschreiber Reiner Kunze, als Sohn eines Bergarbeiters 1933 im Erzgebirge zur Welt gekommen und neuerdings ansässig in der thüringischen Kreisstadt Greiz, gehört – wie Wolf Biermann und Robert Havemann – zu jenen politisch verfänglichen Autoren, die zwar in der DDR leben, dort aber nicht veröffentlichen dürfen, während der Westen, der sie druckt, aber nicht legal honorieren kann, in ihnen entweder die Opfer eines repressiven Regimes oder aber die Kronzeugen für das wachsende kulturelle Prestige eben dieses Regimes (oder auch beides zugleich) erkennen will. Kunze ist bei uns seit Ende der sechziger Jahre einigermaßen bekannt (1969 erschien sein Gedichtband Sensible Wege, 1970 sein Märchenbuch Der Löwe Leopold), aber erst in jüngster Zeit, vor allem durch die neue, soeben vom S. Fischer Verlag veröffentlichte Sammlung Zimmerlautstärke ist sein künstlerisches und menschliches Format ganz deutlich geworden.
Wo ein Biermann trotz aller provozierenden Keckheit, mit der er seine Bonzenbeschimpfung betreibt, immer doch der systemimmanente Kumpel bleiben will, da sieht man den andern den Weg der Vereinzelung einschlagen, und zwar um jener Freiheit des Gedankens willen, die bei uns im Westen von sogenannten progressiven Intellektuellen gerne als spätbürgerlicher Ladenhüter denunziert wird. Man sieht ihn aufs Ganze gehen und Beobachtungen zu Papier bringen, die das System moralischerweise aus den Angeln heben: so daß es denn ein Ende hat mit der sozialistischen Gemütlichkeit und gründlich vorbei ist es mit dem ideologischen Mief, den der Biermann ja bis heute nicht losgeworden ist.
Zimmerlautstärke: Was will Kunze damit sagen? Dieser Titel scheint ein Programm zu enthalten: Absage an die Hypertrophie des Öffentlichen, die totale Vergesellschaftung der Angelegenheit Mensch, die der sozialistische Realismus verlangt hatte, und Rückzug, wenn das ein Rückzug ist, in diejenige Sphäre, die man die „private“ nennen kann.
Schon in seinen frühen Gedichten (aus den fünfziger Jahren) hatte er, wiewohl im Thematischen und Formalen noch unsicher, zu verstehen gegeben, daß sein Enthusiasmus für politische Lebensordnungen sich in Grenzen hält. Seine Motive sucht er im persönlichen „Erlebnis“, zum Beispiel in einer für ihn epochemachenden Reise in die Tschechoslowakei (die zur Eheschließung mit einer tschechischen Zahnärztin führte); sein Stilwille orientiert sich an einem vorgefundenen Kanon des volkstümlich Schönen, aber auch des symbolträchtig Erlesenen: „Rose“, „Vogel“, „Wunde“, „Brunnen“ sind Leitworte dieser Kunstübung. Mit der Liebe hat er es sehr ausgiebig („Gedichte die mein Mädchen schwieg“), und die Liebe setzt er gegen den Verstand, gleichwie er – naiv, aber zwingend – das Bild der Rose ausspielt gegen die „Ordnung“. „Von einem brunnen weiß ich im süden mähren“, das ist die Erinnerung, mit der er 1961 in sein kahles Deutschland zurückreist.
Neun Jahre später, in einem Gedicht zu Ehren Alexander Solschenizyns, findet sich der Passus: „In der ecke glänzt / das gesprungene böhmische glas“. Gesprungen – warum? Weil zwischen dem Damals von 1961 und dem Heute von 1970 der 21. August 1968 liegt, die Zerstörung des Prager Frühlings, die Vergewaltigung der Tschechoslowakei durch den sowjetischen Imperialismus.
Man muß diese beiden Stellen kontrapunktisch aufeinander beziehen: den mährisch-märchenhaften Locus amoenus, der jenseits der Grenzen des Gesellschaftlich-Politischen liegt, und die feine Glasmetapher, die politische Betroffenheit erkennen läßt, Zorn und Schmerz. Dann begreift man, daß hier nicht ein unpolitischer Bruder Sorgenfrei sich hinter seiner poetischen Lizenz als Rosen- und Liebesdichter aus der Affäre zieht, sondern daß hier jemand versucht, das Öffentliche und das Persönliche miteinander zu vermessen, das heißt, auf öffentliche Fragen persönliche Antworten zu geben und in der Zimmerlautstärke der Vox humana das Kriterium der Wahrheit zu finden.
Seine Sprache ist mit den Jahren immer „prosaischer“, wortkarger geworden, sie hat eine starke Dosis Brecht, späten Brecht in sich verarbeitet, hat jenen offenbar unumgänglichen Ausnüchterungsprozeß durchlaufen, der auch in Westdeutschland in letzter Zeit bei so vielen verschiedenen Autoren zu beobachten war, daß man wohl von einer allgemeinen („gesamtdeutschen“) Entwicklung sprechen darf. Das Ergebnis ist eine eigene, Kunzesche Version des Sinn- und Spruchgedichts, die allenfalls mit weniger als einem Dutzend Wörter auskommen kann. Diese lyrische Aphoristik will nicht mehr singen oder träumen, sondern: zeigen, Nachdenklichkeit artikulieren, Pointen setzen. Ihre geläufigste Spielart ist das dialektisch pointierte Bonmot, das mit vielsagenden Aussparungen arbeitet, das heißt, den Leser zur kritischen Mitarbeit herausfordert.
Das Muster ist auch bei uns im Westen wohlbekannt, denn hüben wie drüben gibt man sich ja heute mit Vorliebe dialektisch. Der Unterschied liegt darin, daß diese Art von systemkritischer Zielübung bei uns billig zu haben ist und noch literarische Lorbeeren einbringt, drüben aber kostet es die „Existenz“ (im doppelten Sinne): Man kann nicht veröffentlichen, lebt mehr oder weniger mittellos und ständig überwacht, muß sich von den Sicherheitsbehörden Dummheiten an den Kopf werfen lassen, muß für jeden mit einem westdeutschen Verleger unterschriebenen Vertrag Geldstrafe zahlen, und wenn dann die Belegexemplare kommen, werden sie vom Zoll nicht herausgegeben, weil es – so Kunze kürzlich in einem Interview mit dem westdeutschen Wochenblatt Stern – „wahrscheinlich gefährlich ist, wenn ich lese, was ich geschrieben habe“.
Der neue Band enthält vier Gruppen von Texten; die erste heißt „Monologe mit der Tochter“ und zeigt den Autor in der Rolle des Vaters, der einem sehr jungen Menschenkind Auskunft gibt über die Bedeutung von Worten, Erfahrungen, Situationen, die ohne ein gewisses Maß von kritisch-dialektischer Beschlagenheit nicht zu verstehen sind. Eine Art pädagogischer Kasuistik sieht man sich da entfalten, bezogen auf Situationen wie: „nach der geschichtsstunde“, „erster Brief der tamara a.“, „nach einer unvollendeten mathematikarbeit“, „siebzehnjährig“, „selbstmord“ unter anderem: freundlich bis zärtlich im Ton, aber kühl und scharf durchdacht in der Sache, denn die politischen Druckverhältnisse, denen dieser Vater mit seiner Tochter ausgesetzt ist, erlauben keinerlei Fahrlässigkeit im Denken und Verhalten.
Die zweite Gruppe nennt sich – in Anlehnung an eine briefliche Äußerung des tschechischen Dichters Jan Skácel – „wie die dinge aus ton“ und ist Überlegungen gewidmet, welche die schon erwähnte 68er Katastrophe der ČSSR betreffen, direkt oder indirekt („Rußlandreise 1968“, „Rede auf Rußland“), jene mit sanft-grimmiger Ironie apostrophierte „Historische Notwendigkeit“, deren düsterer Sinn sich in zwei Worten zusammenfassen läßt: „also / panzer“. Der dritte Teil steht gewissermaßen im Zeichen des kritischen Vermittelns zwischen öffentlichen und persönlichen Angelegenheiten, er enthält ein paar höchst unzahme Xenien an die Adresse der Machthaber, dialektisch zugespitzte Solidaritätserklärungen für schreibende Zeit- und Leidensgenossen wie Biermann, Huchel und den verstorbenen Johannes Bobrowski, eine Szene mit den Eltern, Mitmenschliches aus erster Hand.
Den stärksten Eindruck machen mir diejenigen Stücke, in denen die ausgesprochen „kritischen“ Denkschemata abgelöst und überspielt erscheinen durch poetische Figuren höheren Ranges: Bilder, Gleichnisse von jenem Zauber, durch den etwas Unableitbar-Ursprüngliches zu uns spricht. „Meditieren“, so behauptet (zum Beispiel) das Eingangsgedicht, sei folgendes:
Gegen morgen
noch am schreibtisch sitzen, am hosenbein
einen nachtfalter der
schläft
Und keiner weiß vom anderen
Das ist entzückend, ein Einfall von „japanischer“ Delikatesse, aber wie kommt er darauf? Nicht durch das dialektische Kalkül. Merkwürdig auch das Gedicht „Grenzkontrolle“, vor allem dessen letzte vier Zeilen:
Zwischen front- und heckscheibe des wagens
im blickfeld des wachturms:
mikroben unterm mikroskop
erreger mensch
Hier allerdings ist der dialektische Impuls, wiewohl gleichsam absorbiert in der Bildkraft eines metaphorischen Volltreffers, nicht zu überhören, und hier erreicht die kritische Aggressivität des Autors sogar ihre äußerste Schärfe. Mit zwei Worten bezeichnet er das ganze Ausmaß der im Namen des Sozialismus möglich gewordenen Selbstentfremdung der menschlichen Person: nicht zur „Ware“, sondern zum Ungeziefer sieht sie sich degradiert. Diesen Mikrobenstatus des Menschen umzudeuten in den Ehrenstand des mündigen Subjekts, das aufgrund seines Freiseins von allen „Erregern“ der erregendste ist, das ist für Kunze die Aufgabe des Gedichts. „Das gedicht als stabilisator“, so lautet eine seiner theoretischen Notizen am Schluß des Bandes, „als orientierungspunkt eines ichs. Das gedicht als akt der gewinnung von freiheitsgraden nach innen und außen.“
Letzte Frage: Freiheit in dieser Lage, was ist das? Es ist die Freiheit, die aufdringliche Lebensordnung des Animal sociale auf sich beruhen zu lassen und zum Beispiel in die elementare Schwärze des Waldes unterzutauchen:
Im ohr das rauschen der fichten: das tonband das
im kopf schrillt, wird
gelöscht
Es ist die Freiheit, „Zuflucht noch hinter der Zuflucht“ zu suchen. Zuflucht steht hier für das Begreifen von Sinn, der nun schlechterdings nicht mehr gesellschaftlich interpretiert werden kann: also nicht einmal das „private“ Gefühl, mit dem man einer Frau seine Liebe beteuert, sondern etwa „dahinter“. So ist es in dem Vierzeiler „Auf dich im blauen Mantel“ nicht eigentlich die angeredete Elisabeth als Person, die Zuflucht bietet, sondern ihre Epiphanie oder Signatur, der blaue Mantel, der „alles“ sagt:
Von neuem lese ich von vorn
die häuserzeile suche
dich das blaue komma das
sinn gibt
Parallel dazu das Schlußgedicht: wieder ein Du, aber ein größeres, wenn man will, ein noch geheimnisvolleres, und anstatt der Liebeserklärung haben wir die Situation des – Gebets. Der Name Gottes wird zum ersten und einzigen Male genannt: Gott, der sich in einer Regenlandschaft offenbart. Ihm gegenüber der sinnsuchende Menschensinn: „Herr, sag ich, es / regnet, was / soll man tun“. Das ist vor dem allgemein geläufigen Problemhorizont der systemkritischen Gesellschaftsspiele eine ganz unerhörte, eine beinah sensationelle Frage. Eine Frage hinter dem Wortlaut des Fragens. Wie wird die Antwort sein? Hier ist sie:
Und seine antwort wächst
grün durch alle fenster
Unerhört auch dieser Schlußeffekt, dicht verrätseIt und vielsagend wie jener schlafende Nachtfalter am Hosenbein, aber ein sanguinischer Ton von Hoffnung und Freiheit ist darin: Zuflucht hinter der Zuflucht. Ein großartiges Finale.
Hans Egon Holthusen, Die Welt, 9.11.1972
Zimmerlautstärke
Jedes Kunstwerk hat es in sich,
daß es wahrgenommen werden will.
Es will, wie monologisch es auch
ausfallen mag, jemand ansprechen.
(Max Frisch)
Auf der 4. Tagung des ZK der SED im Dezember 1971 äußerte Erich Honecker in seiner Schlußrede jene berühmt gewordenen, häufig zitierten, aber unterschiedlich interpretierten Worte, die landläufig als Beginn einer liberaleren, zumindest bis zur Ausbürgerung Biermanns im November 1976 dauernden Kulturpolitik in der DDR verstanden werden:
Wenn man von der festen Position des Sozialismus ausgeht, kann es meines Erachtens auf dem Gebiet von Kunst und Literatur keine Tabus geben. Das betrifft sowohl die Fragen der inhaltlichen Gestaltung als auch des Stils – kurz gesagt: die Fragen dessen, was man die künstlerische Meisterschaft nennt.
Ohne Auswirkungen blieb diese angekündigte, bewußt von der „festen Position des Sozialismus“ ausgehende Enttabuisierung jedoch noch auf Kunzes Gedichtband Zimmerlautstärke, der im Herbst 1972 – wie der Band Sensible Wege – wiederum nur in der Bundesrepublik erscheinen konnte. Eine Veröffentlichung des Bandes in der DDR, das belegt schon Kunzes 1973 bei Reclam in Leipzig erschienener Auswahlband Brief mit blauem Siegel, war nicht nur zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, sondern, wie es in der betreffenden Stasiakte heißt, wegen der darin aufgespürten „antisozialistischen Haltung des Kunze zur DDR und zur Sowjetunion“ wohl prinzipiell ausgeschlossen. Aber auch in der Bundesrepublik waren Kunzes Publikationsmöglichkeiten trotz der von der Literaturkritik sehr positiv rezensierten Bücher Sensible Wege und Der Löwe Leopold keineswegs günstig, wie Karl Corino kritisch feststellt:
Es ist bezeichnend für die literarische und politische Blindheit in der Bundesrepublik zu Beginn der siebziger Jahre, daß Kunze große Mühe hatte, für die Zimmerlautstärke einen Verlag zu finden. Wegen seiner Gedichte für Alexander Solschenizyn nannten ihn westdeutsche Lektoren einen Reaktionär, wegen des thüringisch-vogtländischen oder böhmisch-mährischen Lokalkolorits in seinen Versen warf man ihm Provinzialismus vor.
Diese Publikationsschwierigkeiten in einer sich durch die neue Ostpolitik nur zögernd der DDR zuwendenden Bundesrepublik hatten zur Folge, daß Kunzes dritter außerhalb der DDR veröffentlichter Gedichtband wiederum von einem anderen Verlag, dem S. Fischer Verlag in Frankfurt, herausgebracht wurde. Das Amt für Urheberrechte in Ost-Berlin verweigerte für die Veröffentlichung des Bandes Zimmerlautstärke die Genehmigung, so daß Kunze infolgedessen erneut eine Ordnungsstrafe zu zahlen hatte. Die ihm zugesandten Belegexemplare wurden wie bereits beim Kinderbuch Der Löwe Leopold von der Grenzbehörde der DDR zurückgehalten. Von den abenteuerlichen Wegen der Manuskriptbeförderung in den Westen und der Überbringung von zwei Exemplaren eines gedruckten Gedichtbandes in die DDR hat Reiner Kunze in seiner Münchner Poetik-Vorlesung am 31. Januar 1989 in der Großen Aula der Münchner Universität berichtet.
Die 42 Gedichte des schmalen Bandes Zimmerlautstärke sind ausnahmslos nach dem gewaltsamen Ende des Prager Frühlings, in den Jahren 1968 bis 1971 entstanden. Nicht nur die Anzahl der Gedichte ist gering, sondern auch deren Umfang. Nur ein einziges Gedicht umfaßt mehr als eine Druckseite. Viele Gedichte sind auf weniger als zehn Zeilen komprimiert, viele Zeilen enthalten nur ein Wort. Den in vier Kapitel gegliederten Texten sind drei knappe, bis heute gültige poetologische Standortbestimmungen Kunzes in Form von Nachbemerkungen angefügt. Wegen seiner ästhetischen Einheitlichkeit, seiner durchgängigen und variantenreichen dialogischen Strukturierung, seiner Konzentration auf wenige Themen und Motive und seiner prägnanten und diskursiven Autorpoetik kommt dem Band Zimmerlautstärke im lyrischen Werk Reiner Kunzes eine herausragende Stellung zu. Reiner Kunze selbst teilt diese Einschätzung, denn er hat in seine Auswahl eigener Hundert Gedichte 1956-1981 nicht weniger als 25 Gedichte der Zimmerlautstärke aufgenommen.
Setzt man die Titel der Gedichtbände Sensible Wege und Zimmerlautstärke miteinander in Beziehung, so zeigt sich bereits hier eine deutliche Akzentverschiebung. Ästhetisch hat Kunze mit dem Band Zimmerlautstärke einen Ziel- und Endpunkt erreicht, den Wulf Koepke als „äußerste Defensivposition“ bezeichnet hat. Diese Endposition schließt ein Unterwegssein, eine ständige Konfrontation mit der Außenwelt aus, wie es im Kapitel „hunger nach der welt“ des Bandes Sensible Wege zumindest noch anvisiert war. An die Stelle von Reisen und Bewegung, von relativer Freiheit und Freizügigkeit sind im Band Zimmerlautstärke Zurückgezogenheit, Bedrängnis, Enge und Zuflucht getreten. Das beherrschende Gefühl des Eingesperrtseins in einem Zimmer, des Zurückgeworfenseins auf sich selbst hat zu größter Aussparung und zu einem „retizenten Sprechen“ geführt. Das lyrische Subjekt erfährt die Welt „wie ein sensibler / in der zelle“.
Das Wort „Zimmerlautstärke“, das als Titel des Gedichtbandes und eines Gedichts sowie als Überschrift eines Kapitels deutlich exponiert ist, bleibt vieldeutig. Die Beschränkung der Kommunikation auf Zimmerlautstärke kann sowohl ein Akt freiwilliger Rücksichtnahme als auch Ausdruck von Verängstigung und Bedrohung sein: Es ruft das unter Strafe gestellte illegale Mithören des Feindsenders im Zweiten Weltkrieg in Erinnerung, das in der DDR in den Jahren ideologischer Verdammung des Westhörens und Westfernsehens erneut Realität geworden war. Zimmerlautstärke ist überdies Name für das ästhetische Programm eines Autors, der, ganz im Gegensatz zu Biermanns ebenfalls 1972 publizierten Hetzliedern, darauf vertraut, „daß Dichtung nicht laut sein müsse, wenn sie sich Gehör verschaffen will; daß sie inmitten des Lärms paradoxerweise intensiver wirkt und klarer vernommen wird, wenn sie weder schreit noch auftrumpft.“
Kunzes Gedichte der Jahre 1968 bis 1971 wollen, wie es das Seneca-Motto des Bandes zum Ausdruck bringt, verstanden werden als Texte „zwischen Zuruf und Schweigen“.
ZIMMERLAUTSTÄRKE
Dann die
zwölf jahre
durfte ich nicht publizieren sagt
der mann im radio
Ich denke an X
und beginne zu zählen
Das Titelgedicht „Zimmerlautstärke“ hat Kunze als 22. Text genau in der Mitte des Gedichtbandes plaziert, und viele andere Gedichte stehen thematisch und motivlich in engem Zusammenhang mit ihm. Es ist 1968 entstanden, als Wolf Biermann seinen Band Mit Marx- und Engelszungen in der Bundesrepublik, Christa Wolf den Roman Nachdenken über Christa T. und Jurek Becker den Roman Jakob der Lügner in der DDR veröffentlichte und als in der Tschechoslowakei für viele Schriftsteller eine Zeit erzwungenen Schweigens einsetzte.
In der ersten Versgruppe des antithetisch strukturierten Gedichts wird in protokollarischer Manier die direkte Rede eines Autors zitiert, der, so legt es die durch Inversion und Repetition betonte Temporalangabe nahe, während der zwölf Jahre des Hitler-Faschismus zum Schweigen gezwungen war. Diese Retrospektive in die jüngere deutsche Geschichte durch einen vermutlich antifaschistischen und dadurch das Selbstverständnis der DDR-Literatur idealtypisch repräsentierenden Schriftsteller findet im Rundfunk gezielte Verbreitung. In der offiziellen Literaturgeschichte der ehemaligen DDR wurde dieser antifaschistischen Tradition, wie folgendes ausführliche Zitat zeigt, höchste Bedeutung beigemessen, und sie wurde gezielt gegen die (imperialistische) Bundesrepublik ausgespielt:
Die Literatur der antifaschistischen Widerstandskämpfer, die zwischen 1933 und 1945 im Exil oder in der Illegalität entstand, war in Deutschland nahezu unbekannt. In den Nachkriegsjahren war es deshalb von großer Bedeutung, für ihre Verbreitung und Aneignung zu sorgen. Ihr kämpferischer antifaschistische Geist und ihre realistische Menschen- und Gesellschaftsdarstellung mußten für die Demokratisierung, für die geistige Erneuerung und den Kampf gegen die Naziideologie genutzt werden. In der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands wurden deshalb sofort nach der Befreiung besonders die Werke der entschiedensten antifaschistischen Schriftsteller publiziert […]
Viele der emigrierten Schriftsteller kehrten aus dem Exil in die Heimat zurück und nahmen, geleitet von ihrer politischen Erfahrung und ihrem Vertrauen in den Sozialismus, ihren Wohnsitz in der Sowjetischen Besatzungszone. Johannes R. Becher, Anna Seghers, Friedrich Wolf, Ludwig Renn, Willi Bredel und Erich Weinert, auch Bertolt Brecht und Arnold Zweig, die etwas später zurückkehrten und demzufolge die gegensätzliche Entwicklung im Osten und im Westen Deutschlands schon klar vor Augen hatten, bekannten sich durch ihre persönliche Entscheidung zur deutschen Arbeiter- und Bauern-Macht.
Diesem Anspruch der ehemaligen DDR, sowohl im Gesellschaftlichen als auch im Literarischen die Tradition des „anderen“, des antifaschistischen und demokratischen Deutschland fortzusetzen, antwortet das Gedicht „Zimmerlautstärke“ in seinem zweiten Teil. Die zitierte Rede des „Mannes im Radio“ und die Gegenrede des lyrischen Subjekts treffen aufeinander wie Vergangenheit und Gegenwart. Aber die Kommunikationssituation ist asymmetrisch. Das lyrische Ich kann nicht direkt reagieren, es kann seine Meinung in den Medien der DDR nicht artikulieren. Dem offiziell verbreiteten Wort steht der monologische Widerspruch in Zimmerlautstärke gegenüber, der als Gedicht, das ausschließlich in der Bundesrepublik veröffentlicht wurde, einem Kassiber gleicht. Nicht direktes Benennen und lauter Protest, sondern Anspielungen und Unbestimmtheitsstellen kennzeichnen die Verse. Geradezu versteckt sind die klanglichen Relationen der Reimwörter („dann“, „mann“ und „an“), die Rede und Gegenrede untermauern; ebenso steht der „d“-Alliteration des Gedichtanfangs der „z“-Stabreim des Endes gegenüber, welcher wiederum auf den Gedichttitel verweist. Auch angesichts dieser ästhetischen Zurückhaltung ist der auftrumpfenden Deutung Wulf Koepkes zu widersprechen, der im Gedicht „Zimmerlautstärke“ den Vorwurf zu erkennen meint, die DDR sei „faschistoid“. Kunzes Gedicht will auf ein Mißverhältnis zwischen kulturpolitischem Anspruch und politischer Realität aufmerksam machen. Die Unbekannte X, die Kunze auch in anderen Texten benutzt, kommt einer Aufforderung an den Leser gleich, an ihre Stelle Namen zu setzen und nach Namen in anderen Gedichten Kunzes zu suchen. Eine erste Identifikationsvorgabe leistet das Gedicht selbst durch die Wiederholung des Personalpronomens „ich“. Wie der Mann im Radio von sich selbst spricht, so könnte auch das lyrische Subjekt von sich sprechen, mit dem X sich selbst meinen. Eine ebenso naheliegende Identifikation ist durch das dem Titelgedicht unmittelbar auf der gegenüberliegenden Seite folgende Gedicht angezeigt:
WOLF BIERMANN SINGT
Im zimmer kreischt die straßenbahn,
sie kreischt von Biermanns platte,
der, als er die chansons aufnahm,
kein studio hatte
Er singt von Barlachs großer not,
die faßt uns alle an,
denn jeder kennt doch das verbot
und hört die straßenbahn
Das Publikationsverbot zwang Biermann, seine Platten in Privaträumen aufzunehmen; der Lärm der Straße aber übertönt die Lautstärke im Zimmer, das beziehungsreich gleich in der ersten Gedichtzeile genannt wird. Wiederum ruft das Gedicht, welches als einziges des Bandes Zimmerlautstärke – in bewußter Entsprechung zum „Barlach-Lied“ Biermanns – Endreime und ein jambisches Metrum aufweist, die Zeit des Nationalsozialismus in Erinnerung, als man Ernst Barlach als „ostisch“ anfeindete, seine Plastiken in der Münchner Ausstellung als „entartete Kunst“ brandmarkte und die Aufführung seiner Stücke verbot.
Anders als im Gedicht „Lied vom Biermann“, in dem Kunze für Biermann Partei ergreift gegen eine Vereinnahmung durch die Medien in der Bundesrepublik, solidarisiert er sich hier mit dem infolge von Auftritts- und Publikationsverboten in der DDR isolierten Künstler. Obwohl Kunze und Biermann in ideologischen und ästhetischen Fragen keineswegs übereinstimmten, war ihr literarisches Engagement füreinander in der DDR der sechziger und siebziger Jahre unüberhörbar. Das Lied „Selbstportrait für Reiner Kunze“, das Biermann 1972 in seinen Band Für meine Genossen aufgenommen hat, ist Erwiderung auf Kunzes Gedicht „Wolf Biermann singt“ und ein anspielungsreiches und kämpferisches Lied der Ermutigung für einen Freund:
SELBSTPORTRAIT FÜR REINER KUNZE
An Bitternis mein Soll hab ich geschluckt
Und ausgeschrien an Trauer was da war
Genug gezittert und zusammengezuckt
Das Kleid zerrissen und gerauft das Haar
Mein Freund, wir wolln nicht länger nur
Wie magenkranke Götter keuchen ohne Lust
Von Pferdekur zu Pferdekur
Mit ewig aufgerissener Heldenbrust
Du, wir gehören doch nicht zu denen
Und lassen uns an uns für dumm verkaufen
Es sind ja nicht des Volkes Tränen
In denen seine Herrn ersaufen
Wir wolln den Streit und haben Streit
Und gute Feinde, viele
Von vorn, von hinten, und zur Seit
Genossen und Gespiele
Es ist schön finster und schön licht
Gut leben und gut sterben
Wir lassen uns die Laune nicht
Und auch kein Leid verderben
Biermann formuliert in diesem Selbstporträt seine Ästhetik des „Ausschreiens“ und seinen klassenkämpferischen Standpunkt, dessen Ziel das Ende der Klassengesellschaft ist, das „Ersaufen der Herrn“. Bemerkenswert ist die Wendung an den Freund, nicht an den Genossen, Reiner Kunze, dem sich Biermann vor allem in der Verteidigung künstlerischer Freiheit an die Seite stellt. Sein Lied variiert die Schlußzeile von Kunzes Gedicht „Das Ende der Kunst“, die „Und es war schön finster“ lautet, indem er sie ins Präsens wendet und sie dialektisch ,aufhellt‘: „Es ist schön finster und schön licht“. (Hervorhebungen vom Verf.)
Im Gedichtband Zimmerlautstärke solidarisiert sich Reiner Kunze erneut mit Peter Huchel und verzichtet dabei auf die Verschlüsselungen des Gedichts „Sensible Wege“. An die Stelle kryptischer Zitate ist ein Benennen und entlarvendes Zitieren getreten, denn Huchel konnte die DDR 1971 verlassen und war dadurch den jahrelangen politischen Pressionen entronnen. Mit Huchel wird ein weiterer Name genannt, der die Unbekannte X im Titelgedicht ersetzen kann und ersetzen soll.
GEBILDETE NATION
aaaaaaaaaaaaaaaaaaPeter Huchel verließ die
aaaaaaaaaaaaaaaaaaDeutsche Demokratische Republik
aaaaaaaaaaaaaaaaaa(nachricht aus Frankreich)
Er ging
Die zeitungen meldeten
keinen verlust
Der Verzicht auf poetische Bilder ist hier nicht, wie Hans-Dietrich Sander behauptet, „das krasseste Beispiel“ eines „ästhetischen Verlusts“, sondern Kennzeichen einer politischen Spruchdichtung, die sich lakonisch und epigrammatisch, benennend und sarkastisch zu Wort meldet. Mit Bitterkeit kommentiert Kunzes Gedicht den Weggang Peter Huchels aus der DDR und beklagt dies als großen menschlichen und künstlerischen Verlust. Der von Johannes Bobrowski, Paul Celan und Günter Eich verehrte Lyriker blieb in den Medien der ehemaligen DDR auch nach seiner Ausreise ungenannt, und seine Rehabilitierung bahnte sich erst kurz vor dem Ende der DDR an. Gegen dieses (ein Vierteljahrhundert währende) Totschweigen des Dichters Peter Huchel protestiert das Gedicht „Gebildete Nation“, indem es den kulturpolitischen Slogan „Auf dem Weg zur gebildeten Nation“ einer falschen Dialektik überführt, die Kunze bereits in einem früheren Spruchgedicht beklagt hatte:
DIALEKTIK
Unwissende damit ihr
unwissend bleibt
werden wir euch
schulen
Für die Unbekannte X steht schließlich auch der Name Alexander Solschenizyn, dessen Werk in der ehemaligen DDR nie erscheinen durfte. Als Solschenizyn 1970 der Literatur-Nobelpreis zuerkannt wurde, kommentierte dies der DDR-Schriftstellerverband im Neuen Deutschland mit einer ideologischen Zurückweisung, in der es heißt:
Wenn wir unseren guten Willen sehr bemühen, können wir die diesjährige Entscheidung der Schwedischen Akademie einen großen Irrtum nennen; was dann immer noch bleibt, ist die Wirkung ihres Schrittes: Er hat einer weitgespannten antisowjetischen und antisozialistischen Kampagne Vorschub gegeben; der Entspannung – und damit auch der Literatur, denn die eine gedeiht durch die andere – wurde ein übler Dienst erwiesen.
Solch ausschließlich politisch motivierter Kommentierung durch den Schriftstellerverband, dem er bis zu seinem Ausschluß im Oktober 1976 angehörte, widerspricht Kunze mit dem Pathos biblischer Licht-Finsternis-Metaphorik in einem Gedicht, das das moralisch-ethische Literaturverständnis Solschenizyns zum persönlichen Maßstab erhebt:
8. OKTOBER 1970
(verleihung des Nobelpreises an
Alexander Solschenizyn)
Ein tag durchsichtig bis
Rjasan
Nicht verbannbar nach Sibirien
Die zensur kann ihn
nicht streichen
(In der ecke glänzt
das gesprungene böhmische glas)
Ein tag der die finsternis
lichtet
Der ans mögliche erinnert:
Immer wieder einen morgen
auf sein gewissen nehmen
Wiederum fällt in diesem Gedicht das Tabuwort „Zensur“, und abermals ruft es das Datum des 21. August 1968 ins Gedächtnis. Das Bild vom „gesprungenen böhmischen Glas“ in den Zeilen sieben und acht trennt das Gedicht in zwei gleiche Hälften, geht als Riß durch es hindurch. Das Dennoch, das sich in den beiden Schlußversen artikuliert, ist subjektiv und existentiell begründet; es ordnet der Instanz des Gewissens alle ideologischen Ansprüche unter.
In seiner Arbeit über „Literarische Bezugsfiguren in der Lyrik der Gegenwart (1960 bis 1979)“ weist Winfried Woesler nach, daß Reiner Kunze sich oft und mit Vorliebe in seinen Gedichten auf andere Autoren bezieht. Einige Motive, die Woesler für die Entstehung von „Autorengedichten“ anführt, gelten auch für die Gedichte des Bandes Zimmerlautstärke. Die Gedichte an und für Biermann, Huchel oder Skácel sind als ermutigende Zurufe Ausdruck von Solidarität mit den bedrängten Kollegen. Wegen seiner Unbeugsamkeit und seines moralischen Anspruchs an die Literatur wird Alexander Solschenizyn für Kunze zu einer Identifikationsfigur. Unter den Autorengedichten des Bandes hat das Gedicht über Johannes Bobrowski einen besonderen Stellenwert, weil es sich nicht mit der Person oder dem Werk des Autors auseinandersetzt, sondern die verspätete DDR-Rezeption Bobrowskis aufzeigen will.
IN MEMORIAM JOHANNES BOBROWSKI
Sein foto
an den anschlagsäulen
Jetzt
Der nachlaß ist
gesichtet, der dichter
beruhigend tot
Über den speziellen Fall Bobrowski geht das Gedicht aber hinaus und beklagt die verhinderte oder behinderte Rezeption kritischer, beunruhigender, ästhetisch autonomer Schriftsteller, die man zu Lebzeiten zwingt, zu schweigen oder allenfalls in ,Zimmerlautstärke‘ zu sprechen. Zwischen Zuruf und Schweigen ist gemäß dem Seneca-Motto der Standort der Gedichte der Zimmerlautstärke zu bestimmen. War das Titelgedicht ein solidarischer Zuruf an verfemte und bedrohte Kollegen, so spricht das Eröffnungsgedicht von einem Schweigen, das nicht erzwungen, sondern Bedingung der Möglichkeit von Poesie ist:
MEDITIEREN
Was das sei, tochter?
Gegen morgen
noch am schreibtisch sitzen, am hosenbein
einen nachtfalter der
schläft
Und keiner weiß vom anderen
Als erstes Gedicht des Bandes und einer Gruppe von elf Gedichten, die „monologe mit der tochter“ überschrieben ist, läßt das Gedicht „Meditieren“ exemplarisch jene dialogische Struktur erkennen, die in diversen Erscheinungsformen den meisten Gedichten in Zimmerlautstärke zugrundeliegt. Kunzes Gedichte suchen das Gespräch, wollen sich mitteilen, sind unterwegs. Das Gedicht bleibt aber als Monolog oftmals nur versuchtes Gespräch. Die evozierten Kommunikationssituationen sind, wie im zuvor analysierten Titelgedicht, asymmetrisch, oder die Verständigung bleibt; wie im Eingangsgedicht, erinnert und erwünscht. Selten nur ist ein Gedicht des Bandes realer, sich vollziehender Dialog, so wie das weiter unten interpretierte Gedicht „Zuflucht noch hinter der Zuflucht“.
Wie das Titelgedicht besteht auch das Eröffnungsgedicht aus nur 21 Wörtern, die in ihrer Dreiteilung eine von Kunze bevorzugte emblematische Struktur konstituieren, vergleichbar dem an früherer Stelle analysierten Gedicht „Dezember“. Die Gedichtüberschrift, im Sinne des Emblems die inscriptio, nennt ein Verb, das Aktivität impliziert und auch als Aufforderung an den Leser zu deuten ist, sich den Gedichten – eingedenk eines Rezeptionswunsches von Günter Eich – meditierend anzunähern. Die erste Gedichtzeile stellt die Frage nach dem Wesen des Meditierens in den Kontext eines Dialogs. Der Konjunktiv und die unpersönliche Anrede „Tochter“ lassen dabei erkennen, daß es sich um einen vergangenen oder um einen erwünschten Dialog handelt. Mit Werner Weber ist deshalb zu fragen:
[…] zwischen dem Titel ,Meditieren‘ und der erinnerten Frage ,Was das sei, tochter?‘ ist die gegenwärtige Frage des Kindes ,Was ist das, Meditieren?‘ Hat das Kind aber so gefragt, so daß man die Frage erinnernd wiederholen kann? Oder fragt man sich selber so und wünscht sich ein Gegenüber, das die Frage hörte und ihr ein Ziel, einen Sinn gäbe?
Die erste Gedichtzeile knüpft aber auch an den Titel der Gedichtgruppe „monologe mit der tochter“ an. Die Gedichte dieser Gruppe sind keine „monologe mit der tochter“ an. Die Gedichte dieser Gruppe sind keine Gesprächsprotokolle, sondern poetische Antworten auf mögliche und bedrängende Fragen junger Menschen in der damaligen DDR. Zu beachten ist somit auch die autobiographische Dimension dieser Monologe. Reiner Kunzes Tochter Marcela konfrontierte den Vater mit ihrer Erlebniswelt, mit ihren Erfahrungen in der DDR – Gesellschaft, vor allem mit den Erziehungs- und Bildungsprinzipien der Schule und mit dem ideologischen Freiraum in der Jungen Gemeinde der evangelischen Kirche. Die Authentizität persönlicher Erfahrungen wird in den Monologen jedoch ins Überindividuelle und Exemplarische transponiert. Infolgedessen verzichtet der Autor auch bewußt auf die namentliche Apostrophe und wählt die stilisierende Anrede „Tochter“.
Beachtenswert an diesen „monologen mit der tochter“ ist ferner die Situation des lyrischen Subjekts. „Tochter und Sohn“, schreibt Weber, „stehen für ein Dasein, welches von mir ausgeht und von mir am gründlichsten mitbestimmt ist – das mir Nächste. Und Selbstgespräch mit dem mir Nächsten, das macht das Alleinsein durch den Anschein der Vertraulichkeit schlimm.“
Auf die Frage (der Tochter) nach dem Wesen des Meditierens antwortet in Form eines Bildes (pictura) der zweite Teil, der in seiner lokalen (Arbeitszimmer) und temporalen (Morgendämmerung) Konkretheit eine meditative Situation der Stille, Konzentration und Versunkenheit evoziert. Wie der Gedichttitel das Bild des in seinem Zimmer am Schreibtisch sitzenden Nachtarbeiters erklärt, so wird die beschworene Situation zum Modell des Meditierens selber. Darüber hinaus ist das poetologische Stichwort „Schreibtisch“ in Verbindung zu setzen mit dem Seneca-Motto des Bandes; der Schreibtisch ist der zu behauptende „Posten“ und, wie es die erste Nachbemerkung formuliert, der „Orientierungspunkt“ des Dichters.
Das gedicht als stabilisator, als orientierungspunkt eines ichs. Das gedicht als akt der gewinnung von freiheitsgraden nach innen und außen.
War im Frühwerk Kunzes die (jubelnde) Nachtigall zum Inbegriff der Poesie geworden, so ist im Gedicht „Meditieren“ der Nachtfalter Sinnbild für neue Qualitäten der Poesie, für Schweigen und für Verletzlichkeit. Im Schlußvers (subscriptio), der durch die unspezifische Konjunktion „und“ eingeleitet wird, mit der Kunze häufig einen Vers, einen Gedanken oder eine Pointe am Ende eines Gedichts akzentuiert, wendet sich das Gedicht vom konkreten poetischen Bild (pictura) in epigrammatischer Zuspitzung wieder dem Allgemeinen, Überindividuellen zu und lenkt dadurch die Aufmerksamkeit zurück auf den Gedichttitel und die Anfangszeile, so daß wiederum eine von Kunze bevorzugte Ringstruktur entsteht.
„Und keiner weiß vom anderen“ – dieser Aussagesatz ist zu beziehen auf Vater und Tochter, auf das lyrische Subjekt und den Nachtfalter, aber auch, im Sinne einer existentiellen Grundaussage, auf den Menschen und den Mitmenschen. Die existentielle Dimension entspräche dabei dem Grundmotiv allen Meditierens, nämlich nach dem Sinn menschlichen Daseins zu suchen. Entscheidend für die Deutung des Gedichts ist ferner, ob man der Konjunktion „und“ in bezug auf das Gesagte eine konzessive oder eine kausale Bedeutung zuschreibt. Trotz der meditativen Konzentration und Bemühung bliebe am Ende das Fazit eines Erschöpften, zu keinem anderen Ergebnis gekommen zu sein als dem der existentiellen Fremdheit des Menschen in dieser Welt, die unaufhebbar und durch keine soziale Utopie überwindbar zu sein scheint. Diese erste konzessive Deutung würde vor allem der emblematischen Struktur des Gedichtes entsprechen. Andererseits ist die Offenheit des Gedichts so groß, daß auch ein kausaler Zusammenhang zwischen Gedichttitel und Schlußvers bestehen könnte, daß nämlich die monadische Existenz des Menschen Ausgangspunkt aller meditativen Anstrengung und jeder schriftstellerischen Arbeit ist. Die Isolation zu überwinden, ist ständiger und maßgeblicher Impuls für den, der schreibt. Eine kausale Deutung entspräche vor allem der Tatsache, daß „Meditieren“ den Gedichtband Zimmerlautstärke einleitet und daß es sich in programmatischer Weise an den Leser wendet. Auch wenn keiner vom anderen weiß, so ist in der Existenz des anderen die Möglichkeit, von ihm wissen zu können, gegeben. Ganz im Sinne eines solchen ,Minimalprogramms‘ ist auch die zweite poetologische, einer ökologischen Ethik verpflichtete Nachbemerkung des Bandes zu verstehen:
Das gedicht als äußerster punkt möglichen entgegengehens des dichters, als der punkt, in dem auf seiner seite die innere entfernung auf ein nichts zusammenschrumpft. Das gedicht als bemühung, die erde um die winzigkeit dieser annäherung bewohnbarer zu machen.
Den Glauben an die Möglichkeit des Gedichts und des Dichters, den anderen erreichen zu können, teilt Reiner Kunze mit Paul Celan, der sein Poesieverständnis in verschiedenen Reden auf poetische Weise dargelegt und in zahlreichen metapoetischen Gedichten thematisiert hat. Motivlich korrespondiert Celans Gedicht „Nacht“ mit Kunzes Gedicht „Meditieren“. Es nimmt seinen Ausgang im existentiellen Dunkel der Nacht und in kosmischer Leere, um sich dann umso radikaler dagegen aufzulehnen. Durch Worte des Zuspruchs und durch Bilder der Zuwendung hält es – fast wider besseres Wissen – an der Möglichkeit fest, vernommen und verstanden zu werden.
NACHT
Kies und Geröll. Und ein Scherbenton, dünn,
als Zuspruch der Stunde.
Augentausch, endlich, zur Unzeit:
bildbeständig,
verholzt
die Netzhaut –:
das Ewigkeitszeichen.
Denkbar:
droben, im Wettgestänge,
sterngleich,
das Rot zweier Münder.
Hörbar (vor Morgen?): ein Stein,
der den andern zum Ziel nahm.
Beide poetologischen Gedichte bekennen sich zu einer Dichtung, die unterwegs ist, die den andern zum Ziel hat und die für den Dialog optiert. Während Kunzes Gedicht seine Bildwelt gleichsam bis auf die Größe eines Genrebildes verengt, greift Celans Gedicht mit großer Sprachgebärde ins Kosmische. Dem Bild vom Nachtfalter am Hosenbein des Schriftstellers steht das Liebesbild vom Rot zweier Münder im Weltgestänge gegenüber. Kunzes Sprache hat wie die Celans einen Reduktionsprozeß durchlaufen; aber während Celans Sprache immer (mehr) zum Hermetischen tendiert, vertraut Kunze weitestgehend auf Verständlichkeit.
Sarah Kirsch, wie Kunze der Generation Volker Brauns zuzurechnen, veröffentlichte unter dem Titel „Wiepersdorf“ einen Zyklus von elf Gedichten, dessen neuntes Gedicht wegen seiner Motivverwandtschaft mit Kunzes Gedicht „Meditieren“ geeignet ist, in der vergleichenden Gegenüberstellung weitere strukturelle und thematische Besonderheiten beim Eröffnungsgedicht des Bandes Zimmerlautstärke aufzuzeigen.
Dieser Abend, Bettina, es ist
Alles beim alten. Immer
Sind wir allein, wenn wir den Königen schreiben
Denen des Herzens und jenen
Des Staats. Und noch
Erschrickt unser Herz
Wenn auf der anderen Seite des Hauses
Ein Wagen zu hören ist.
Hier wendet sich das lyrische Subjekt an ein Gegenüber, das nicht gegenwärtig ist, nicht gegenwärtig sein kann. Angesprochene ist, wie der Zyklustitel „Wiepersdorf“ und die Nennung des Vornamens Bettina anzeigen, die Schriftstellerin Bettine von Arnim, die längere Zeit auf dem märkischen Gut Wiepersdorf lebte und dort auch begraben liegt. Bis 1978 war das Arnimsche Gut ein volkseigenes Erholungsheim für DDR-Schriftsteller. Sarah Kirsch war hier wiederholt zu Gast, und nach ihrer eigenen Aussage ist der Zyklus der elf Wiepersdorf-Gedichte dort auch entstanden.
Im fiktiven Dialog mit der romantischen Schriftstellerin sinniert das metapoetische Gedicht wie Kunzes „Meditieren“ über Inhalte und Bedingungen des Schreibens. Verlassenheit und Alleinsein bestimmen auch hier die Situation des Schreibenden. Im Gegensatz zur elliptischen Sprache und Konzentration auf ein einziges poetisches Bild im Gedicht Kunzes ist Sarah Kirschs versuchter Dialog wortreicher, narrativer und diskursiver. Er setzt sich in Beziehung zur Welt, zu einer Persönlichkeit der literarischen und politischen Geschichte und zur gesellschaftlichen Realität der ehemaligen DDR.
Geschichte und Gegenwart, Individualsphäre und gesellschaftliche Bedingungen, Liebesgedicht und politische Lyrik werden korreliert. Eine Datierung ist nur ante quem vorzunehmen; das Gedicht ist vor der Ausbürgerung Wolf Biermanns entstanden, gegen die Sarah Kirsch dann zusammen mit elf anderen bekannten DDR-Schriftstellern in einem Offenen Brief an Erich Honecker protestiert hat.
Bettine von Arnim hatte, auch darauf spielt das Wiepersdorf-Gedicht an, in ihrer Kampfschrift Dies Buch gehört dem König in Form eines fiktiven Gesprächs mit der Mutter Goethes politische Freiheit, Beseitigung der Armut und sogar Abschaffung der Privilegien gefordert und sich mit diesen Forderungen an König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen gewandt.
Der Schrecken, von dem Sarah Kirschs Gedicht am Schluß spricht, bleibt ambivalent. Das Bild vom Wagen, der vorfährt, ist bedrohlich und erfreulich zugleich. Offen bleibt, ob sich dadurch ein ersehnter oder ein befürchteter Besuch ankündigt, ob der „König des Herzens“ oder der „König des Staats“ kommt. Wie Kunze schreibt auch Sarah Kirsch eine dialogische, um Verständlichkeit bemühte Lyrik, in der für den Leser noch Spielraum sein soll. Wie viele Autoren der Generation Volker Brauns reflektiert sie über das eigene literarische Tun in der Auseinandersetzung mit der literarischen Tradition (Bettine von Arnim, Annette von Droste-Hülshoff), während Kunze seine poetologische Standortbestimmung stärker im Diskurs mit der literarischen Gegenwart (Huchel, Skácel, Solschenizyn) vornimmt. Auch Sarah Kirsch hat sich wie Reiner Kunze maßgeblich an der sogenannten Rehabilitierung des Ich in der Literatur der DDR beteiligt, aber sie geriet nicht in einen andauernden Konflikt mit der Kultusbürokratie der DDR. Im Gegensatz zu Kunze, der sich in den ersten fünf Jahren nach dem Ende des Prager Frühlings in der DDR kaum artikulieren konnte, hatte Sarah Kirsch in diesen Jahren mit ihren Gedichten großen Erfolg.
Von solcher Isolierung spricht, wiederum in Verbindung mit dem Namen Peter Huchels das Schlußgedicht des Bandes Zimmerlautstärke, das Reiner Kunze einmal als eines seiner „wesentlichen Gedichte“ bezeichnet hat. Wegen seines Umfangs und seiner Narrativität ist das fünfzehnzeilige „Zuflucht noch hinter der Zuflucht“ untypisch für den schmalen Gedichtband, und in ihm kündigt sich bereits die Überwindung der darin dominierenden Techniken der Aussparung, Reduktion und Zuspitzung an.
ZUFLUCHT NOCH HINTER DER ZUFLUCHT
(für Peter Huchel)
Hier tritt ungebeten nur der wind durchs tor
Hier
ruft nur gott an
Unzählige leitungen läßt er legen
vom himmel zur erde
Vom dach des leeren kuhstalls
aufs dach des leeren schafstalls
schrill aus hölzerner rinne
der regenstrahl
Was machst du, fragt gott
Herr, sag ich, es
regnet, was
soll man tun
Und seine antwort wächst
grün durch alle fenster
Der Gedichttitel ist zugleich Überschrift der vierten und letzten Gedichtgruppe der Zimmerlautstärke, die nur aus zwei Gedichten besteht und die in der Sukzession der 42 Einzeltexte zur Klimax wird. Das andere Gedicht des vierten Kapitels ist Reiner Kunzes bekanntes politisch-philosophisches Liebesgedicht „Auf dich im blauen Mantel“, das stilistisch in der Tradition des späten Brecht steht und das sich als Liebesgedicht in besonderer Weise der Frage nach dem Sinn zuwendet, die nach Albert Camus die dringlichste aller menschlichen Fragen ist.
Das Gedicht „Zuflucht noch hinter der Zuflucht“ widmet sich der Sinnfrage auf einer existentiellen, politischen und religiösen Ebene. Der änigmatische Titel des 1971 entstandenen Gedichts wiederholt das Wort „Zuflucht“, das zu den Leitworten der alttestamentlichen Psalmen gehört und das Kunze in seiner Lyrik vorher nur ein einziges Mal verwendet hat. In der Wortwiederholung des Titels kündigt sich bereits die antithetische Struktur des Gedichts selbst an, und durch die Widmung „für Peter Huchel“ bekommt es sogleich eine politische Dimension, denn es setzt den lyrischen Dialog mit diesem in der DDR Jahrzehnte lang totgeschwiegenen und von Reiner Kunze verehrten Dichter fort.
Der erste Gedichtteil, die Zeilen 1 bis 9 umfassend, setzt sich aus vier Versgruppen zusammen, denen ein zweiter Teil mit drei Versgruppen (Zeile 10 bis 15) folgt, wobei den Zahlen, wie sich bei genauer Analyse erweisen wird, nicht nur numerische, sondern auch symbolische Qualität zukommt. Die Zahl vier als Zahl der Erde und der Welt sowie die Zahl zwei als Zahl der Zweiheit und Dualität kennzeichnen den ersten Teil:
Hier tritt ungebeten nur der wind durchs tor
Hier
ruft nur gott an
Mit der anaphorischen Doppelung des Lokaladverbs „hier“ setzt die Bestimmung des Zufluchtsortes als Ort der Abgeschiedenheit und Menschenferne ein, wodurch gleichzeitig ein unausgesprochenes „dort“, dem das lyrische Subjekt (bewußt) entflohen und wo seine Freiheit bedroht ist, mitschwingt. Wie in anderen Gedichten Kunzes kündigt sich bereits im dritten Wort der Anfangszeile, im Modaladverb „ungebeten“ auf verhüllte Weise an, daß es sich bei diesem Gedicht selbst um einen Psalm handelt, um eine „Anrufung Gottes“. Explizit ist davon erst in der zweiten Versgruppe die Rede. Seit dem Gedicht „Frage“ aus dem frühen Band Vögel über dem Tau hatte Kunze das Wort „Gott“ in seinen Gedichten nicht mehr ausgesprochen. Unmißverständlich hieß es dort:
Was ist über den Sternen?
Kein Gott.
Im Gedicht „Zuflucht noch hinter der Zuflucht“ werden Existenz Gottes und Gotteserfahrung nicht mehr ausgeschlossen. Die sprichwörtliche gottverlassene Gegend ist nur ein Zufluchtsort vor den Menschen, nicht vor Gott. In der Welt werden zwei Welten, das Hier und das Dort, erfahren. Die Welt des Verfolgten, der sich hierher in die Natur zurückgezogen hat, wird konfrontiert mit der Welt der namenlosen Verfolger, die herkommen können. Und mit Hans Dieter Schäfer ist festzuhalten, daß der naturlyrische Text nicht einem Eskapismus in die harmlos-behagliche Idylle das Wort redet, sondern mit ihm entzieht sich ein Verfolgter und Bedrängter dem „Zugriff des Apparats“. Politische und existentielle Dimension sind somit schon in den Anfangszeilen nicht mehr voneinander zu trennen, und durch die Dimension des Religiösen verstärkt sich der Dualismus des Gedichts: diesseits und jenseits, oben und unten, Mensch und Gott:
Unzählige leitungen läßt er legen
vom himmel zur erde
Vom dach des leeren kuhstalls
aufs dach des leeren schafstalls
schrill aus hölzerner rinne
der regenstrahl
Verbindungen werden hergestellt zwischen weit auseinander liegenden Realitäten. Die Sprache ist durch alliterierende Verbindungen zwischen den Wörtern und durch die Häufung der Liquide („l“, „r“) fließender geworden. Die Atemlosigkeit und das Neben- und Gegeneinander der Anfangszeilen ist überwunden. Der auf sich selbst zurückgeworfene einzelne, der physische Zuflucht in der Natur gesucht hat, macht eine die Natur transzendierende metaphysische Erfahrung. Dafür wählt Kunze eine ebenso naheliegende wie kühne Metapher, die die Mehrdeutigkeit des Wortes „anrufen“ nutzt und die das Wortfeld „Telefongespräch“ mit der Sprache der Natur verknüpft. Der Regen, dessen monotones und monologisches Prasseln das Alleinsein und die (doppelt benannte) Leere in deprimierender Weise bewußt macht und der in der Horizontalen, also von „dort“ nach „hier“, von Mensch zu Mensch (schützende) Trennwände errichtet, wird plötzlich zur Möglichkeit eines (vertikalen) Dialogs zwischen Gott und Mensch. Die exzeptionelle Naturerfahrung wird zur Möglichkeit einer Gotteserfahrung, der, so impliziert es das Wort „schrillen“, ein Aufschrecken vorausgeht. Alle Vorbereitungen für das nun folgende Gespräch, den zweiten Gedichtteil, sind getroffen:
Was machst du, fragt gott
Herr, sag ich, es
regnet, was
soll man tun
Und seine antwort wächst
grün durch alle fenster
Keine asymmetrische Kommunikationssituation wie im Titelgedicht „Zimmerlautstärke“ und kein fiktiver Dialog wie im Eröffnungsgedicht „Meditieren“ liegt hier vor, sondern im letzten Gedicht des Bandes kommt es zu einem essentiellen Gespräch zwischen Fragendem und Antwortendem. Eröffnet wird es durch die Frage Gottes an den Menschen. Von Gott, der bereits in der dritten Versgruppe die Voraussetzungen für den Dialog schuf, geht – ganz im Sinne der religiösen Existenz eines Kierkegaard – die Initiative aus. Es ist die Frage des Schöpfers an sein Geschöpf. Sie erinnert an die Frage „Wo bist du?“, die Gott nach dem Sündenfall an Adam stellt, und an den Ruf Gottes in den prophetischen Berufungsgeschichten des Alten Testaments. Auch die Herr-Anrede gilt als biblischer Topos. Durch sie leitet der Mensch seine (verlegene) Gegenfrage ein, in der sein Schwanken zwischen Resignation und Engagement, seine Suche nach sinnvollem Tun und nach erfüllter Existenz zum Ausdruck kommen. Das Indefinitpronomen „man“ ist Indiz für eine überindividuelle Perspektive, und das Gedicht mündet in eine Frage nach dem Sinn menschlicher Existenz überhaupt. Eine Antwort darauf geben die letzten beiden Gedichtzeilen in einem synästhetischen Bild:
Und seine antwort wächst
grün durch alle fenster
In der siebten Versgruppe werden der erste und der zweite Gedichtteil in Entsprechung zur Symbolzahl sieben, in der die Zahl vier als Zahl der Welt und die Zahl drei als Zahl Gottes aufgehoben sind, zusammengeführt. Auf diese Schlußverse mit ihrer verheißungsvollen Antwort läuft die Bewegung des ganzen Gedichts, ja die des gesamten Gedichtbandes zu. Die Konjunktion „und“, mit der sie eingeleitet werden, wird zum Bindeglied zwischen den Gedichtteilen, aber auch zwischen unten und oben, innen und außen, Ich und Du, Immanenz und Transzendenz. Die Natur als Ort der Zuflucht wird transparent für eine „Zuflucht noch hinter der Zuflucht“. Die zahlreichen Bilder der Bedrängnis und die Bitterkeit vieler Verse im Band Zimmerlautstärke enden nicht in resignativem Schweigen, sondern im stummen Zuruf der Natur. Am Schluß des Eingangsgedichts stand der desillusionierende und herausfordernde Vers „Und keiner weiß vom anderen“, am Ende des letzten Gedichts steht ein Bild der Hoffnung, das vom anderen weiß und und das sich durch seinen Widerstand gegen Resignation und Verzweiflung an diesen richtet. Als Bild vegetativer Kraft ist es Aufforderung an das Ich, die Passivität zu überwinden, aus der Isolation herauszutreten, den Dialog zu suchen und den Posten „zwischen Zuruf und Schweigen“ zu behaupten. Mit einem ähnlichen Bild der Beharrlichkeit beginnt bekanntlich Kunzes 1965 entstandene Gedicht „Dreiblick“:
Greiz grüne
zuflucht ich
hoffe
Diesem Gedicht der Selbstvergewisserung und Selbstbehauptung fehlt noch die Dimension der Transzendenz und das namentliche Engagement für einen anderen. Im Gedicht „Zuflucht noch hinter der Zuflucht“ will Kunze einem anderen Mut zusprechen, wie Wolf Biermann es in seinem ebenfalls Peter Huchel gewidmeten Lied „Ermutigung“ getan hat. Auch dessen Schlußstrophe setzt gegen das Schweigen den Hoffnungsruf eines Naturbildes:
Wir wolln es nicht verschweigen
In dieser Schweigezeit
Das Grün bricht aus den Zweigen
Wir wolln das allen zeigen
Dann wissen sie Bescheid
Biermanns unverkennbar sozialutopisch motivierte Ermutigung hat Reiner Kunze ins Existentielle und, was bei Biermann undenkbar wäre, sogar ins Metaphysische transferiert. Dazu könnte ihn Jan Skácels Gedicht „Was vom Engel übrigblieb“, das Naturerfahrung auf eine dahinterliegende Wirklichkeit zurückführt, inspiriert haben:
Es ist grün,
und das ist alles, was vom Engel übrigblieb.
Während die Transparenz der Natur auf Metaphysisches in Kunzes „Zuflucht noch hinter der Zuflucht“ erfahren wird, schließt Peter Huchel sie aus. Deshalb stellt sich die Frage, ob Kunzes Ermutigung nicht zur Kenntnis nimmt, daß in Huchels Lyrik, nachgerade in den späten Gedichten, Naturerfahrung immer und in desillusionierender Weise Immanenzerfahrung bleibt und den Menschen stets auf sich selbst verweist. Gottesferne ist ein zentrales Thema Huchels, das sich in Bildern der Vereisung und Verfinsterung durch sein ganzes Werk zieht. Dennoch trifft Kunzes Widmungsgedicht, insbesondere das synästhetische Schlußbild von der durch alle Fenster wachsenden „grünen Antwort“, ins Zentrum eines Werks, das, wie Axel Vieregg überzeugend dargelegt hat, auf eine „Privatreligion“ zurückgeführt werden kann:
Wie alle großen Rebellen gegen Gott, sei es Nietzsche, der das intensiv gelebte Leben zum obersten Gut erhob, sei es Camus, für den es die im Dienste des Mitmenschen geleistete Arbeit war, schafft sich Huchel einen Ersatzgott […] Huchels Privatreligion ist die Vorstellung einer als göttlich verstandenen gerühmten Erde, nicht im pantheistischen Sinne, sondern als eines sein Prinzip allein aus sich selbst heraus empfangenden Weltverlaufs, der aber nicht, wie der christliche oder wie Hegels Weltverlauf, linear ist, sondern zyklisch.
Huchels Privatreligion ist ebenso wie Kunzes Rede von Gott mit der Position eines konsequent orthodoxen Marxismus nicht vereinbar. Auch innerhalb der Generation Volker Brauns, deren Autoren sich dem Sozialismus verpflichtet fühlten, blieb ein Gedicht wie „Zuflucht noch hinter der Zuflucht“ eine Ausnahme. Deshalb scheint es nur folgerichtig, daß ein Autor wie Günter Kunert sich in seinem „Herben Gedicht“ kritisch mit Kunzes Gedicht auseinandersetzt. Daß Kunert dies in einem poetischen Text tut, muß vor dem Hintergrund einer zeitweise totalen Rezeptionsverweigerung von Kunzes Gedichten in den Medien der ehemaligen DDR gesehen werden. Die Literatur selbst wurde für die DDR-Autoren zum einzigen Forum für diesen Diskurs. Kunerts „Herbes Gedicht“ beginnt mit folgenden Zeilen:
Zuflucht noch hinter der Zuflucht
wo habe ich das gelesen
oder erlebt. Das Dasein erweist sich
gemischt
mit Realität hin und wieder und wider
besseres Wissen und guten Willen.
Gegen Kunzes Rede von einer metaphysischen Zuflucht setzt Kunert die Realität des „täglich verschütteten Glücks“, und sein Gedicht beschließt er mit einem Bild der menschlichen Vanitas: Ein Solitär / aus verdichteter Keinmaligkeit“. In seinem Aufsatz „Autor und Publikum in der DDR“ hat sich Kunert schon früh mit der existentiellen Thematik in der DDR-Lyrik als einer Folge der völligen Säkularisierung und Religionsfeindlichkeit im sozialistischen Staat beschäftigt. In den Gedichten der Generation Volker Brauns erkennt Kunert Reflexe auf „das Bedürfnis nach Sinnerkenntnis, nach Sinngebung, eines Sinns, der nicht in allgemein-gesellschaftlichen und ökonomisch-produktiven Funktionen sich erschöpft“. Die explizit religiöse Dimension eines Gedichts wie „Zuflucht noch hinter der Zuflucht“ fordert seinen lyrischen Widerspruch heraus, aber an der Notwendigkeit, im Gedicht die Dinge der Welt zu transzendieren, hält er angesichts einer „leeren Transzendenz“ dennoch fest.
Das Menschen- und Gesellschaftsbild, das in den Gedichten des Bandes Zimmerlautstärke erkennbar wird, resultiert in besonderem Maße aus der Tatsache, daß in ihnen häufig Lebenserfahrungen junger Menschen zu Wort kommen. Im Gedicht „Nach einer unvollendeten Mathematikarbeit“, einem 1971 entstandenen „Monolog mit der Tochter“, stehen sich das schulisch vermittelte „sozialistische Menschenbild“ und das des lyrischen Subjekts unvereinbar gegenüber:
NACH EINER UNVOLLENDETEN MATHEMATIKARBEIT
Alles
durchdringe die mathematik, sagt
der lehrer: medizin
aaaaaaaaaapsychologie
aaaaaaaaaasprachen
Er vergißt
meine träume
In ihnen rechne ich unablässig
das unberechenbare
Und ich schrecke auf wenn es klingelt
wie du
Die Berechenbarkeit des Menschen, seine körperliche („medizin“), seelische („psychologie“) und geistige („sprachen“) Verfügbarkeit stehen in einer Gesellschaft „wissenschaftlich-technischer Revolution“ außer Zweifel. Die Gegenposition des lyrischen Ich (Tochter), das sich mit den Erfahrungen des lyrischen Du (Vater) identifiziert, beharrt auf dem Freiraum und der Unverfügbarkeit des Individuums („unvollendet“, „unablässig“, „unberechenbar“). Der Traum wird zum Gegenbegriff eines verabsolutierten Rationalismus und Funktionalismus, zum Inbegriff des Subjektiven. In seiner Rede vor dem Schriftstellerkongreß der DDR im Jahre 1978 hat Stephan Hermlin sich zum Anwalt dieser subjektiven Position gemacht und sie als einen spezifisch künstlerischen Standpunkt verteidigt:
Es ist das Vorrecht der Dichter, vernunftlos zu träumen. Es ist das Vorrecht der Vernünftigen, sie zu verlachen. Aber die Träume gehen weiter, unbeschadet des Gelächters, das um sie her erschallt.
Selten sind Kunzes Gedichte der Zimmerlautstärke Artikulationen eines Traumes oder einer Utopie. Vielmehr zeigen sie eine gesellschaftliche Realität, die sich von einem demokratischen Sozialismus entfernt und in der das Vorrecht der Dichter und der jungen Menschen auf den Traum verteidigt werden muß. Dies zeigt sich auch in jenen drei Gedichten des Bandes, in denen der Name Lenin fällt. An die Stelle des in den Sensiblen Wegen trotzig formulierten Bekenntnisses zur DDR („eingesperrt in dieses land / das ich wieder und wieder wählen würde“) ist im Band Zimmerlautstärke die resignative Reminiszenz an Lenin getreten, der 1916 in seinen Thesen „Die sozialistische Revolution und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen“ geschrieben hatte:
Wie der siegreiche Sozialismus, der nicht die vollständige Demokratie verwirklicht, unmöglich ist, so kann das Proletariat, das den in jeder Hinsicht konsequenten, revolutionären Kampf um die Demokratie nicht führt, sich nicht zum Siege über die Bourgeoisie vorbereiten.
Lenins revolutionäre Vision einer Einheit von Sozialismus und Demokratie konfrontiert Kunze im Gedicht „Appell“ mit dem von jungen Menschen erlebten „real existierenden Sozialismus“ in der DDR Anfang der siebziger Jahre:
APPELL
1
D., schüler der siebenten klasse, hatte
versehen mit brille und dichtem haupthaar
das bildnis Lenins
Öffentlich
So
in gefährliche nähe geraten
der feinde der arbeiterklasse, der imperialisten ihr
handlanger fast, mußte er stehn
in der mitte des schulhofs
Strafe:
aaaaatadel, eingetragen in den schülerbogen der
ihn begleiten werde
sein leben lang
2
Du fragst warum
sein leben lang
Lenin kann ihm nicht mehr helfen, tochter
Reiner Kunze, der wie Wolf Biermann zu jenen Autoren der Generation Volker Brauns gehörte, für die ein Sozialismus ohne mehr Demokratie, Freiheit und Humanität kein Sozialismus war, führt im Gedicht „Appell“ mittels Montage und entlarvendem Zitieren den Verlust an Humanität in einer Gesellschaft vor Augen, die einen Siebtkläßler, der aus Unwissenheit oder aus mangelnder Vorsicht ein Lenin-Porträt in ein Trotzki-Bildnis verändert hat, mit paramilitärischen Methoden maßregelt. Das Bild vom sensiblen, schöpferischen und freien Menschen ist bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. Nicht der junge Mensch, sondern die politisch Verantwortlichen haben das Bild Lenins, des ideologischen Vordenkers und Revolutionärs, entstellt. Lenins 100. Geburtstag im Jahre 1970 feierte die DDR mit der Enthüllung eines Lenin-Denkmals auf dem Berliner Lenin-Platz, mit der Kunstausstellung „Im Geiste Lenins – mit der Sowjetunion in Freundschaft unlösbar verbunden“ und mit einer Gemeinschaftsausstellung der Akademien der Künste aus der UdSSR und der DDR unter dem Motto „Ein neuer Mensch – Herr der neuen Welt“. In der Manier Bertolt Brechts kommentiert Kunze die Feierlichkeiten mit einem epigrammatisch zugespitzten Gedicht, das im Jubiläumsjahr 1970 entstanden ist:
NACH EINER LENINEHRUNG
Selbst wenn sein wille es gewesen wäre
so
geehrt zu werden, ihm
geschähe unrecht
Die mehrfache Nennung Lenins im Band Zimmerlautstärke ist Indikator eines Utopieverlustes, nicht Indiz für Utopiegewißheit. Unter den 42 Gedichten des Bandes finden sich nur sehr wenig heitere und ironische Verse. Bedrängnis, Bitterkeit und Desillusionierung überwiegen. Die große politische Ernüchterung, die im Tschechoslowakei-Kapitel „wie die dinge aus ton“ sichtbar wird, führt zu einem Übergewicht existentieller Themen und Fragestellungen, die ein Menschenbild erkennen lassen, das Franz Fühmann folgendermaßen skizziert hat:
[…] Literatur geht in Ideologie nicht auf, weil der Mensch in Ideologie nicht aufgeht. Der Mensch, dies merkwürdige Geschöpf, ist eben nicht nur ein gesellschaftliches Wesen, er ist von der Gesellschaft wie von der Natur her bestimmt, eine widersprüchliche, doch unauflösbare Einheit, die eben nur in der Einheit dieses Widerspruchs den ganzen Menschen ausmacht mit all seiner Lust, all seinem Glück und all seinen Qualen, mit seinen Schmerzen, Verzückungen, Ängsten, Sehnsüchten, Träumen, Besessenheiten.
Ende der sechziger Jahre sah sich Reiner Kunze bei der Lektüre von Jean Amérys „Bewältigungsversuchen eines Überwältigten“, die unter dem Titel Jenseits von Schuld und Sühne 1966 in der Bundesrepublik erschienen waren, mit einem Leben konfrontiert, in dem der „Mitmensch als Gegenmensch“ erfahren wurde. Amérys existentielle Erfahrung der Folter, sein daraus resultierendes aufklärerisches Engagement und sein philosophischer Agnostizismus haben Kunze nachhaltig beeindruckt, was nicht nur die Motti zu zwei Kapiteln des Bandes Zimmerlautstärke belegen. Ebenfalls während der Entstehungszeit dieses Gedichtbandes rezipierte Reiner Kunze erstmals Albert Camus, dessen Werke in der DDR unterschlagen wurden. So kam es auch bei Kunze zu außergewöhnlichen Rezeptionsbedingungen:
Er […] liest Camus. Camus ist verboten. Er schreibt ihn ab. Den ganzen Mythos von Sisyphos. Mit der Hand. Nachts.
Auch wenn der Name Camus in Zimmerlautstärke nicht genannt ist, so zeugt ein spezifisches Vokabular („Gewissen“, „Seele“, „Hoffnung“, „Tod“, „Sinn“) von Kunzes insistierendem Fragen nach dem Sinn menschlicher Existenz. In einem 1974 geführten Gespräch mit Ekkehart Rudolph beruft sich Reiner Kunze erstmals und mit Entschiedenheit auf Camus’ Version existentialistischer Philosophie:
Auge in Auge mit dem Nichts zu leben und im Bewußtsein der Absurdität dieses Daseins Mensch sein zu wollen, sich als Mensch zu erweisen – das ist es, weshalb ich mich auf Camus berufe. In der Pest sagt der Arzt Bernard Rieux: „was mich interessiert, ist, ein Mensch zu sein.“ Und er versteht darunter erstens, zu wissen, ob zwei und zwei vier ist, und nicht, welche Belohnung oder Bestrafung auf dieses Wissen steht, und zweitens, solidarisch zu handeln. Während Sartre das politische Engagement betont, ,Geschichte machen‘ will, bescheidet sich Camus damit, im einzelnen zu helfen, im Kleinen wie im Großen kein Unrecht unwidersprochen hinzunehmen, auch nicht, wenn seine Aufdeckung das heroischere ,Geschichte machen‘ kompliziert. (Und es hat sich erwiesen, was für eine unsichere Geschichte es ist, Geschichte zu machen, ohne die Geschichte bewältigt zu haben.) „Der absurde Mensch sagt ja und hört nicht auf, sich anzustrengen.“
Es ist jedenfalls keine Verabsolutierung und irrationalistische Verklärung der aus „Faschismus und Krieg herrührenden Angst und Unsicherheit vieler Menschen“. wie eine offizielle DDR-Definition des Existentialismus lautete, sondern ein den Menschen in seiner Gefährdung und in seinem möglichen Scheitern ernstnehmendes Verständnis, das sich in Kunzes Gedichten spiegelt und zu außergewöhnlichen Dialogen (im Innern des einzelnen) führt:
NOCTURNE
Schlaf du kommst nicht
Auch du
hast angst
In meinen gedanken erblickst du
den traum deinen
mörder
Trotz aller Bedrängnis und Daseinsangst finden die Gedichte der Zimmerlautstärke immer wieder Spuren der Lebensbejahung und versuchen, auf „das Absurde und den Selbstmord“ eine Antwort zu geben, ein „Dennoch“ zu formulieren:
SELBSTMORD
Die letzte aller türen
Doch nie hat man
an alle schon geklopft
Von der Literaturkritik in der Bundesrepublik, in Österreich und in der Schweiz wurden die Authentizität, die existentielle Relevanz und die ästhetische Qualität der Gedichte des Bandes Zimmerlautstärke nahezu einhellig heraus- und noch über die des Bandes Sensible Wege gestellt. In der Neuen Zürcher Zeitung schrieb Werner Weber:
Reiner Kunzes Texte sind nicht nur bedeutende Meldungen aus der Literatur der Deutschen Demokratischen Republik; es sind Beispiele von Zeitgenössischem, das über seine Daten hinausweist. Kunst des verbindlich redenden, des geprüften und prüfenden Menschen.
Für die Beurteilung der ideologischen Position Kunzes durch die meisten Rezensenten ist Hans Dieter Schäfers Einlassung paradigmatisch:
Auf Kunzes grundsätzliches Einverständnis mit dem menschlichen Kommunismus sollte angesichts des neuen Gedichtbandes eindringlich hingewiesen werden.
Um diese Annahme zu begründen, rekurrieren die Autoren immer wieder auf Kunzes Gedicht „Dreiblick“ aus dem Jahre 1965, unterlassen es aber, dafür nach Belegen im Band Zimmerlautstärke selbst zu suchen. Aus heutiger Sicht war eine solche ideologische Konzession Ergebnis einer im Kontext der Entspannungspolitik und der Unterzeichnung des Grundlagenvertrages vollzogenen Fehleinschätzung, denn die Gedichte Kunzes aus den Jahren nach dem 21. August 1968 dokumentieren, daß von der konkreten Utopie eines „menschlichen Kommunismus“ nur noch die Desillusion übrig geblieben ist.
Mit dem Gedichtband Zimmerlautstärke ist Reiner Kunze in der deutschsprachigen Literatur des Westens der künstlerische Durchbruch gelungen, was wiederum nicht ohne Folgen war für seine schwierige Situation als Schriftsteller in der DDR. Im Juli 1973 verlieh die Bayerische Akademie der Schönen Künste Kunze als erstem Autor aus der DDR ihren Literaturpreis, nachdem sie im Vorjahr Jean Améry ausgezeichnet hatte, und betonte damit ausdrücklich den künstlerischen Rang des Bandes Zimmerlautstärke. Für den in der DDR isolierten Autor bedeutete diese Auszeichnung, wie aus einem seiner Briefe an Hans Bender zu ersehen ist, Ermutigung und persönlichen Schutz:
Doch mache ich immer wieder die Erfahrung, daß Publizität und Öffentlichkeit helfen und schützen, wenn die eigene Arbeit oder Fakten für sich sprechen. In seltenen Fällen wirkt das Faktum, ans Licht der Öffentlichkeit gehoben, sogar vernunftfördernd.
Heiner Feldkamp: Poesie als Dialog. Grundlinien im Werk Reiner Kunzes, S. Roderer Verlag, 1994
„Zimmerlautstärke“
Das Lyrikbändchen Zimmerlautstärke (56 Seiten) mit selten zehnzeiligen Gedichten wurde ein großer Erfolg. Kunze kam im Jahr 1977 nach Westdeutschland. Die Taschenbuchausgabe erschien im Februar 1977. Das 64.-70. Tausend kam im September 1980 heraus. Es war der kritische Versuch eines jungen DDR-Deutschen, sich im Westen bemerkbar zu machen.
Der erste Zyklus ist „Monologe mit der tochter“ überschrieben. In ihm steht das Gedicht „Erster brief der Tamara A.“ Tamara schreibt, daß in ihrer Stadt vier Denkmäler stehen: Lenin, Tschapajew, Kirow, Kuibyschew. Die Tochter bemerkt: „Schade, daß sie nichts erzähle von sich“. Und der Vater gibt zurück: Sie erzählt von sich, Tochter. Ein weiteres Vater-Tochter-Gespräch:
Nach einer unvollendeten
mathematik arbeit
Alles
durchdringe die mathematik, sagt
der lehrer: medizin
aaaaaaaaaapsychologie
aaaaaaaaaasprachen
Er vergißt
meine träume
In ihnen rechne ich unablässig
das unberechenbare
Und ich schrecke auf wenn es klingelt
wie du
Das Unberechenbare, das in die Träume eindringt, enthält die Meldung: Ich werde abgeholt.
Der zweite Zyklus hat die Überschrift „Zimmerlautstärke“. Man darf das Radio nicht so laut stellen, daß es den Nachbarn stört. Aber der Kommentar kommt aus einer Stimme im Radio: „Dann die zwölf Jahre durfte ich nicht publizieren / sagt der mann im radio“. Auch bei einem Gespräch über das Gedichteschreiben geht es um etwas sehr Schwerwiegendes:
Sie vergessen, sagte er, wir haben
den längeren arm
Dabei ging es
um den kopf
Ein Gedicht ist dem Andenken des großen DDR-Dichters Johannes Bobrowski gewidmet:
Sein foto
an den anschlagsäulen
Jetzt
Der nachlaß ist
gesichtet, der dichter
beruhigend tot
Das Gedicht sagt gleich, was den Ausschlag gibt für die positive Bewertung des Poeten: „der dichter (ist) beruhigend tot“. In dieser Welt gibt es nur eine Hoffnung, die in dem Gedicht „Fast ein frühlingsgedicht“ zum Ausdruck kommt. Der Text, von dem hier die Rede ist in einem Brief, dessen Briefmarken „aufblühen“, heißt:
Nichts
währt
ewig
Auf den toten Bobrowski folgt ein Gedicht mit dem Titel „Auch eine hoffnung“:
Ein grab in der erde
Hoffnung aufzuerstehen
in einem halm
(Grabplatte keine
Nicht noch im tod
scheitern an stein)
Ein weiteres Gedicht trägt die ironische Überschrift:
GEBILDETE NATION
aaaaaaaaaaPeter Huchel verließ die
aaaaaaaaaaDeutsche Demokratische Republik
aaaaaaaaaa(nachricht aus Frankreich)
Er ging
Die zeitungen meldeten
keinen verlust
Es soll mit diesem Beitrag daran erinnert sein, welchen Widerhall diese Gedichte hatten. Mit ihren blutigen Pointen lieferten sie ein anschauliches Bild von dem Terror auf der anderen Seite der Mauer. Ich möchte Reiner Kunze meine herzlichen Glückwünsche zu seinem Festtag übermitteln.
Werner Ross, aus: Marek Zybura (Hrsg.): Mit dem wort am leben hängen… Reiner Kunze zum 65. Geburtstag, Universitätsverlag C. Winter, 1998
Drei Stationen des Werks
Der Vater Bergarbeiter im Erzgebirge, die Mutter Heimarbeiterin der Strumpfindustrie, Eltern also aus der Klasse des Proletariats – günstigere Voraussetzungen für die Übereinstimmung der Interessen von sozialistischem Staat und jungem Schriftsteller lassen sich kaum denken. Der Schriftsteller findet Wohlwollen und die besten Startbedingungen vor, die Kulturpolitik des Staates rechnet mit seiner Zustimmung und Linientreue. Im Falle des 1933 geborenen Reiner Kunze schien diese Rechnung zunächst aufzugehen.
Denn eine erste Phase zeigt Kunze noch ganz aufgehoben in der staatlichen Förderung von Arbeiterkindern, die ihn zum Abitur führt. So stark ist noch das Maß der Konformität, dass Kunze schon als Sechzehnjähriger in die SED eintritt (1949). Der Prozess der Abnabelung beginnt wohl mit dem Studium in Leipzig, an einer Universität, an der noch ein Geisteswissenschaftler wie der Autor des mehrbändigen Werks Geist der Goethezeit, H.A. Korff lehren durfte und der Philosoph Ernst Bloch und der Literaturwissenschaftler Hans Mayer, beide aus dem Exil zurückgekehrt, mit ihren Vorlesungen einen weiten Horizont aufrissen (und schließlich dann von der marxistischen Orthodoxie in den Westen getrieben wurden).
Kunzes Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent in der Journalistischen Fakultät, zunehmend von einer neuen Freiheit des Denkens bestimmt, stößt auf die Entrüstung der ideologischen Hardliner; er fällt in Ungnade. Dieser erste eklatante Bruch im Verhältnis zum System der DDR hat tiefgreifende Folgen. Kunze wird aus dem Lehrkörper der Universität verstoßen und in die Verbannung geschickt, zur Arbeit als Hilfsschlosser im Maschinenbau (1959–1961). Aber immer noch ist er formell Mitglied der SED. Was wie Inkonsequenz scheinen mag, ist wohl ein Tribut um der Literatur willen. Dem jungen Autor, der 1959 seinen ersten Gedichtband veröffentlicht und sich 1962 ins Risiko des freien Schriftstellers eingelassen hat, kann an einer totalen Konfrontation noch nicht gelegen sein. Dieser entscheidende zweite Bruch mit dem Regime wird unaufschiebbar, als im August 1968 die Bewegung des „Prager Frühlings“ von 1968, die Bewegung eines „humanen Sozialismus“, von den Truppen des Warschauer Pakts, auch der DDR, niedergewalzt wird. Kunze, seit 1961 mit einer tschechischen Ärztin verheiratet, protestiert und erklärt seinen Austritt aus der SED.
Eine totale Vereisung der Beziehung zwischen Regime und Dichter ist die Folge. Der autoritäre Staat und sein Instrument, die Staatssicherheit, schließen das Netz der lückenlosen Überwachung. Verschärft wird die Situation, weil es Kunze gelungen ist, in der Bundesrepublik einen Verlag für einige Bücher zu finden. Zum Signal werden die Veröffentlichung des Bandes Die wunderbaren Jahre (1976), der Ausschluss aus dem Schriftstellerverband der DDR und Kunzes Beteiligung am Protest gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns (1976). Kunze, längst zur unerwünschten Person geworden, antwortet seinerseits mit dem Antrag auf Entlassung aus der DDR-Staatsbürgerschaft und kann mit seiner Familie die DDR verlassen (1977). In der Nähe von Passau findet er ein Asyl.
Drei Bücher sind es vor allem, in denen der Zündstoff dieser Schriftstellerexistenz, das Daseinsbewusstsein und die Schreibtechniken Kunzes ihren exemplarischen Ausdruck finden: zimmerlautstärke, gedichte (1972), Die wunderbaren Jahre, Prosa (1976) und ein tag auf dieser erde, gedichte (1998).
zimmerlautstärke, gedichte (1972)
Die durchschaute Phrasenhaftigkeit der ideologischen Sprache In diesem Gedichtband versucht Kunze den Gegensatz zwischen politischem Anspruch und politischer Praxis vor allem mit den Mitteln der paradoxen Redeweise bloßzustellen. Die „monologe mit der tochter“ sind in Wahrheit Anreden an die Tochter, weil sie ihr Wissen und Erfahrungen weitervermitteln, die der Sprecher eigentlich „hinter schloss und riegel“ (13) verwahren müsste: so sind zur sagenhaften Grausamkeit des asiatischen Eroberers Tamerlan (Timur) durch die „teilweise ausgrabung / jüngster fundamente“ (12) alarmierende Parallelen entdeckt worden.
In der Schule steht beim Appell auf dem Schulhof ein Schüler der siebten Klasse ,am Pranger‘, weil er das Bildnis Lenins mit Brille und dichtem Haupthaar versehen hat. Dieser Makel wird Folgen fürs ganze Leben haben. Mit einer paradoxen Wendung wartet der Schluss des Gedichts auf, indem er voraussetzt, dass Lenin selbst so humorlos und ideologisch verbohrt nicht reagiert hätte:
Lenin kann ihm nicht mehr helfen, tochter (15).
Die Begründung der Schulleitung stellt den Schüler zu den Feinden der Arbeiterklasse und den Handlangern der Imperialisten. Kunze verfolgt beharrlich die Spur der Phrasenhaftigkeit der Funktionärssprache.
Das Gedicht „drill“ bringt eine Überlegenheitsgebärde zu Fall, und zwar in allgemeiner und in konkret satirischer Weise (16). Die Sprache der Fidschiinsulaner sei, so sage man, eine Sprache von niederer Kultur, weil sie auf dem einfachen Prinzip der Wiederholung beruhe („kere = bitten, „kerekere = betteln“). Am Ende werden zwei Sachverhalte kurzgeschlossen, die an sich nichts miteinander zu tun haben, im Gedankensprung zur Kulturlosigkeit der militärischen Kommandosprache:
Daher, tochter:
marschmarsch!
Das Versprechen des Lesebuch-Liedes, „Wir sind jung / die Welt ist offen“ im Gedicht „Siebzehnjährig“ (19), wird mit der politischen Wirklichkeit konfrontiert, dem „Horizont aus schlagbäumen“. Selbst in den Grenzflüssen wartet die Sperre:
Bis auf den flussgrund stacheldraht den nur
der fisch durchschwimmt (29).
Und doch behauptet sich die geheime, subtile Revolte der Lebenslust unter dem Zwangskorsett ideologischer Korrektheit im Gedicht „SONNTAG“ (17):
Zwanzig zentimeter überm knie
In Strümpfen
die blühen über den schenkeln in
strümpfen gezeichnet wie die schlange
in unsichtbaren strümpfen in
strümpfen geknüpft wie
strickleitern.
Im Vergnügen am erotischen Gedankenspiel immunisiert sich der Lyriker selbst gegen die Verführung durch den Ungeist, mit dem er im Handgemenge liegt.
Solidarität der Verfemten
Im Prosaband Die wunderbaren Jahre kann der Hinweis auf eine Reise Kunzes in die Sowjetunion – ausgerechnet 1968, im Jahr des Einmarsches der Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei – Befremden auslösen. Nicht aber in den zimmerlautstärke-Gedichten. Die Reise gehört in die Reihe jener mutigen Aktionen, durch die sich Kunze mit den literarischen Außenseitern, Abweichlern und Verfemten des „sozialistischen Lagers“ solidarisiert. Das Gedicht „RUSSLANDREISE“ 1968 bettet Details noch in ein poetisches Ungefähr ein:
„Irgendwo / hinter wäldern“ trifft man sich (31). Alexander Solschenizyn gewidmet aber ist die ‑ „REDE AUF RUSSLAND“. Damit bekennt sich Kunze als Bewunderer eines Autors, der 1947 zu acht Jahren Straflager in Sibirien verurteilt worden, nach sechs Jahren in bloße Verbannung entlassen und 1956 rehabilitiert worden war, aber ein Rebell blieb, 1967 in einem offenen Brief gegen die Zensur protestierte und im Herbst 1969 aus dem Schriftstellerverband der Sowjetunion ausgeschlossen wurde. Im Band zimmerlautstärke folgt der „REDE AUF RUSSLAND“ Kunzes – den Triumph nicht verbergendes – Gedicht „8. Oktober 1970 (Verleihung des Nobelpreises an Alexander Solschenizyn)“:
Nicht verbannbar nach Sibirien
Die zensur kann ihn nicht streichen
[…]
Ein tag der die finsternis
lichtet (33).
Es muss aber daran erinnert werden, dass Solschenizyn, nachdem 1974 der erste Teil seines Archipel GULag, der Dokumentation des sowjetischen Straf- und Arbeitslagersystems, im Westen erschienen war, ausgebürgert und in die Bundesrepublik abgeschoben wurde, wo ihn zunächst Heinrich Böll beherbergte. Ein Vergleich drängt sich auf. In eine ähnliche Lebenssituation sollte Reiner Kunze nur drei Jahre später geraten, als er aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen wurde und in der Bundesrepublik sofort in Heinz Piontek einen hilfreichen Freund fand.
Von Solidaritätsbekundungen geprägt wird vor allem der zweite Teil des Bandes zimmerlautstärke. Der erste Zuruf gilt dem Mann, gegen dessen Ausbürgerung Kunze 1976 protestierte, und zwar ohne diesen Protest halbwegs zu widerrufen, wozu sich andere später zwingen ließen.
Hier das Gedicht
WOLF BlERMANN SINGT:
Im zimmer kreischt die straßenbahn,
sie kreischt von Biermanns platte,
der, als er die chansons aufnahm,
kein studio hatte
Er singt von Barlachs großer not,
die fasst uns alle an,
denn jeder kennt doch das verbot
und hört die straßenbahn (39)
Ein anderes Gedicht setzt einem Vertreter der Kirche, einem wahren Christen, der seine Hilfe an keine Bedingung knüpft, einen literarischen Denkstein:
PFARRHAUS
Für pfarrer W.
Wer da bedrängt ist findet
mauern, ein
dach und
muss nicht beten (41)
Der Nachruf auf Johannes Bobrowski gilt einem Autor, der weder seine frühere Zugehörigkeit zur „Bekennenden Kirche“ verleugnete noch mythisierende Elemente in seinen Landschaften und Geschichtsdichtungen preisgab, der in der DDR zwar seiner Nähe zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus wegen geachtet, von den Hardlinern des „Sozialistischen Realismus“ aber beargwöhnt wurde. Er blieb ein Stiefkind der DDR. Ebendiese zwitterhafte Beurteilung Bobrowskis bringt das Gedicht „IN MEMORIAM JOHANNES BOBROWSKI“ mit jener Lakonie, die so viele Texte Kunzes auszeichnet, auf den Punkt:
Sein foto
an den anschlagsäulen
Jetzt
Der nachlass ist
gesichtet, der dichter
beruhigend tot (55)
Bissiger noch ist die Lakonie, mit der das Gedicht „GEBILDETE NATION“ Peter Huchels Übersiedlung in den Westen kommentiert:
Peter Huchel verließ die
Deutsche Demokratische Republik
(nachricht aus Frankreich)
Er ging
Die zeitungen meldeten
keinen verlust (56)
Huchel, zunächst vor allem als Lyriker bekannt geworden, hatte zwischen 1949 und 1962 auf hohem Niveau die Zeitschrift Sinn und Form herausgegeben. Er zählte zu seinen Mitarbeitern Autoren wie Werner Kraus, Ernst Bloch, Arnold Zweig, Hans Mayer, auch Bertolt Brecht, der ihn eine Zeitlang schützen konnte. Dann aber wurde er das Opfer dogmatischer Quertreiber. Seiner Ablösung folgten Jahre der Isolation und der öffentlichen Angriffe. Für jüngere Autoren wie Biermann, Kunert oder Kunze blieb er ein Leitbild. Und nach hartnäckigen internationalen Interventionen erlaubte ihm die DDR 1971 die Ausreise.
Kunzes Gedicht konstatiert nur die Nachricht aus Frankreich und das Verschweigen des Verlusts in der DDR. Den eigentlichen Zündstoff des Gedichts aber liefert der Titel. Er entlarvt den Anspruch eines Landes, das sich gern als eigenständige sozialistische deutsche Nation propagierte, als absurd; er offenbart eine Schande.
Der verlorene Sohn
Kunzes Mut, als Vertreter der Opposition erkennbar zu werden, blieb bei seinen Eltern ohne Verständnis. Dies ist die Kehrseite seines so wirksamen Schreibens. Man spürt seine Melancholie angesichts der zunehmenden Distanz. In zwei Gedichten wird die Entfremdung sichtbar, in beiden aus dem Blickwinkel der Mutter.
UMSTElGEN IN S.
Am bus
die eltern
Wir wollten dich nur sehn
Die Augen der mutter
randvoll mit vorwürfen gegen
den vater der
schweigt
Das leben leer
und tote strecken unter tage
Geblieben
der alkohol und
der sohn der
weiterfährt (44)
Die Begegnungen mit dem Sohn sind beschränkt auf Momente der Durchfahrt. Das eigentliche Problem ist hier das Elend des Vaters. Nach dem Ende seines Berufslebens im Bergwerk haltlos geworden, sucht er das Gefühl der Leere durch den Alkohol zu betäuben und ist süchtig geworden. Halt geben könnte der Familie nur noch der Sohn. Aber die rasche Weiterfahrt entführt ihn schon wieder. Er ist den Eltern zum verlorenen Sohn geworden.
Der zweite Text handelt von einer anderen Art der Entfremdung. Einige Verse des Gedichts „DAS KLEINE AUTO“ seien zitiert:
Fremd wie die welt eines tiefseefischs
ist das bücherschreiben des sohnes
Auf einer radiowelle
kommt sein name geschwommen
Doch:
Was bringt das ein
Andre söhne holen ihre eltern ab
im auto (45)
Abhandengekommen ist der Mutter ihr Sohn – und hier wird aus Anklage (gegen den Vater) der Seelenschmerz über den tieferen Riss in ihrer Beziehung zum Sohn. Sie hat keinen Anteil an der geistigen Welt des Bücher schreibenden Sohns; ihr bleibt nur die Frage nach dem materiellen Wert der Arbeit, der sich auch in der DDR schon nach dem Besitz oder Nichtbesitz eines Autos bemisst. So wird die Entfremdung zwischen Mutter und Sohn total und führt in eine Hoffnungslosigkeit, für die die Anfangsverse dieses Gedichts nicht zu hoch gegriffen sind:
Seufzer gibt’s die
absplittern von der seele
(…)
Walter Hinck, aus Matthias Buth und Günter Kunert (Hrsg.): Dichter dulden keine Diktatoren neben sich, Verlag Ralf Liebe, 2013
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Helga Abret: ,Verwahrte‘ Vergangenheit
(zu dem Gedicht „Gegenwart“)
Nouveaux Cahiers d’Allemand, Heft 2, 1984
Barbara Bondy: Einer spricht
Süddeutsche Zeitung, 21.4.1973
Günther Busse: Training Gedichtinterpretation
(zu dem Gedicht „Erster Brief der Tamara A.“)
1980
Hans-Jürgen Heise: Er vergißt meine Träume
Rheinischer Merkur, 29.9.1972
Uwe Herms: Zimmerlautstärke – abgehört
Stuttgarter Zeitung, 21.10.1972
Peter Jokostra: Kassiber von drüben
Westermanns Monatshefte, Heft 5, 1973
Yaak Karsunke: Griff an die Kehle
Nürnberger Nachrichten, 7.9.1972
Friedrich Kienecker: Es sind noch Lieder zu singen… Beispiele moderner christlicher Lyrik
(zu dem Gedicht „Zuflucht noch hinter der Zuflucht“)
1978
Heinz-Günther Klatt: Die letzte aller Türen
(zu dem Gedicht „Selbstmord“)
Heinz-Günther Klatt: Wenn die Zeit uns verläßt. Erfahrungen. Betrachtungen. Stimmen der Dichter, 1980
Otto Knörrich: Die deutsche Lyrik seit 1945
(zu dem Gedicht „Auf dich im blauen Mantel“)
1978
Manfred Leier: Kunzes gesammeltes Schweigen
stern, 24.9.1972
Hans Maier: Verstummende Musik
(zu dem Gedicht „Fahrschüler für Lastkraftwagen“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.9.1979
Später in: Marcel Reich-Ranicki (Hrsg.): Frankfurter Anthologie 5, Insel Verlag, 1980
Auch in: Günter Schnitzler (Hrsg.): Bild und Gedanke. Festschrift für Gerhart Baumann zum 60. Geburtstag, 1980
Hans Mayer: Vollständiger Lebenslauf
(zu dem Gedicht „Erster Brief der Tamara A.“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.12.1976
Später in: Marcel Reich-Ranicki (Hrsg.): Frankfurter Anthologie 3, Insel Verlag, 1978
Sigrid Mühlberger: Reiner Kunze. Zuflucht noch hinter der Zuflucht. Eine Interpretationsskizze
(zu dem Gedicht „Zuflucht noch hinter der Zuflucht“)
Zeit im Buch, Heft 2, 1984
Wolfgang Johannes Müller: Es gibt wieder einen Dichter
Bayernkurier, 24.3.1973
Walter Neumann: Wer da bedrängt ist…
Neue Westfälische (Bielefeld), 10.3.1973
Jost Nolte: Die innere Entfernung
Die Zeit, 23.2.1973
Bernt Richter: Auf der Suche nach Gesprächen
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 21.1.1973
Annemarie und Wolfgang van Rinsum (Hrsg.): Interpretationen Lyrik.
(zu dem Gedicht „Zimmerlautstärke“)
1986
Werner Ross: Leierspiel – west-östlich
Merkur, Heft 300, 1973
Werner Ross: Lyrik geht zu Fuß
(zum ersten Teil des Gedichts „Das kleine Auto“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.11.1974
Später in: Marcel Reich-Ranicki (Hrsg.): Frankfurter Anthologie 1, Insel Verlag, 1976
Hans-Dietrich Sander: Im Verlies der Abbreviatur
Deutschland Archiv, Heft 11, 1972
Helmut Scheffel: Mißbrauchbar wie die Macht
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11.11.1972
Gespräch mit Reiner Kunze
Jürgen P. Wallmann: Wie fühlt sich ein Schriftsteller in der DDR, der nur noch im Ausland gedruckt wird?
Reiner Kunze: Ich schreibe nicht für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Wenn ich durch mein Schreiben Menschen helfe, bestimmten Dingen gegenüber eine Haltung zu gewinnen, so ist es für mich ein glücklicher Umstand. Reaktionen, die ich aus der BRD und aus dem Ausland erhalte, deuten darauf hin, daß es auch dort Menschen gibt, für die meine Bücher nicht völlig ohne Belang sind. Die Dinge, hinter die ich schreibend kommen möchte, sind den Menschen in der DDR aber näher. Deshalb bedaure ich sehr, daß ich meine Bücher vorerst nur noch in der BRD und im Ausland publizieren kann.
Wallmann: Wie wirkt sich der Boykott gegen Sie heute in der DDR aus?
Kunze: In der Frankfurter Rundschau hieß es, von mir würden in Kürze zwei Bücher in der DDR erscheinen. Dafür gibt es im Augenblick noch keine konkreten Anhaltspunkte. Es gibt vorerst nur allgemeine Gespräche mit offiziellen Stellen, die bisher fast keine Auswirkungen hatten. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, daß man derzeit besondere Härte vermeiden möchte.
Wallmann: Eines Ihrer neuen Gedichte gilt Solschenizyn. Kann man sich als Schriftsteller in der DDR mit diesem Autor in fairer Weise auseinandersetzen?
Kunze: Sie wissen, daß Solschenizyns Werke in der DDR nicht publiziert werden. Ich halte es aber nicht nur für ein Recht, sondern für die Pflicht eines jeden Schriftstellers, in das Gespräch hineinzuhören, das die bedeutenden Geister seiner Zeit miteinander führen. Niemand wird Ihnen in der DDR verbieten, ein Buch von Solschenizyn zu lesen…
Wallmann: … wenn er eines in die Hand kriegt.
Kunze: Das ist Sache eines jeden einzelnen.
Wallmann: Solschenizyn ist in der UdSSR aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen worden. Das kommt einer Ächtung gleich. Wie groß ist Ihr Risiko, wenn Sie einem solchen Schriftsteller ein Gedicht widmen?
Kunze: Man wird nicht dadurch ein schlechter Autor, daß man einmal ein schlechtes Buch schreibt, sondern wird es in dem Augenblick, da man beginnt, jedes Risiko zu scheuen, wie Heinrich Böll einmal sagte.
Wallmann: Dennoch müssen Sie Ihr Risiko kalkulieren. Wo ist die äußerste Grenze?
Kunze: Ich bin zu vielen Kompromissen bereit, solange sie nicht an die Substanz gehen. Solschenizyn hat Furchtbares erlebt, und ein Mensch ist nur bis zu einem gewissen Grade psychisch und physisch belastbar. Ich habe Sorge um den Menschen Solschenizyn. Ihm in seiner jetzigen Situation keine Solidarität erweisen zu wollen, würde an die Substanz gehen.
Die Tat, 14.10.1972
Exportliteratur
Die DDR exportiert zweierlei Literatur: solche, deren Erscheinen sie im eigenen Staat zuläßt – etwa die Romane Hermann Kants –, und solche, die ihrer Zensur zum Opfer fällt, deren Publikation in der Bundesrepublik sie jedoch gestattet. Hier ist die ältere Generation mit Stefan Heym vertreten – sowohl sein Defoe-Buch Die Schmähschrift wie sein König David Bericht ist nur im Westen zugelassen; die jüngere der etwa Vierzigjährigen durch einige der besten Autoren, Reiner Kunze, Volker Braun, Günter Kunert, Wolf Biermann, um nur einige bedeutende Namen zu nennen. Hier wiederum ist ein Unterschied zu machen. Es gibt Autoren, von denen Werke, Aufsätze, Gedichte in der DDR erscheinen, während andere Ausfuhrgut bleiben, und Autoren wie Biermann nur im Westen gedruckt werden.
Über das Schicksal von Gedichtbänden Reiner Kunzes und eines bedeutenden Erzählbandes von Volker Braun – der erstgenannte bei S. Fischer, der zweite bei Suhrkamp erschienen, hat Fritz J. Raddatz öfter und unlängst Jürgen P. Wallmann in den Neuen Deutschen Heften ausführlich berichtet. Reiner Kunze, Sohn eines Grubenarbeiters aus dem Erzgebirge, also so proletarisch und volkseigen, wie nur ein Schriftsteller im Sozialismus sein kann, wird zuweilen der „Solschenizyn“ der DDR genannt. In Kunzes Gedichtband Zimmerlautstärke steht folgendes Gedicht:
Dann die
zwölf Jahre
durfte ich nicht publizieren sagt
der mann im radio
ich denke an X
und beginne zu zählen
Volker Braun hat seine Solidarität mit Kunze in einem Gedichtnamen „R“ bekundet, das 1965 auch in einem Band in Halle erschienen war. In einer neuen Anthologie, die beim DDR-Reclam in Leipzig 1972 erschienen ist, war die Widmung an Reiner Kunze gestrichen, und sogar der Titel „R“ wurde – so berichtet Wallmann – durch den Titel „Einer“ ersetzt. Nunmehr ist aber auch dieser Bericht zu ergänzen, denn inzwischen sind einige Gedichte des „Verfemten“ in Ostberlin erschienen, und in einem Kommentar wurde erwähnt, man müsse einen Dichter wie Kunze gar nicht erst vorstellen. Auf sowjetische Verhältnisse übertragen hieße das etwa: Solschenizyns Romane erscheinen im Westen, aber auf einmal sind wieder kurze Texte von ihm in Novy Mir zu lesen, und in einem Kommentar der Literaturnaja Gazeta stünde: „Solschenizyn muß unseren Lesern nicht erst vorgestellt werden.“ Gegenwärtig können wir uns eine solche Wende der sowjetischen Kulturpolitik nicht vorstellen; das bestätigt, wie differenziert wir die Problematik der Zensur in jedem Oststaat einzeln untersuchen müssen.
Bemerkenswert, daß die Westveröffentlichung verbotener Bücher nicht nur „toleriert“, sondern durch die DDR-Instanzen abgewickelt wird. Gebüßt werden nur jene Schriftsteller, die diese Instanzen umgehen, etwa ein Gedicht mehr in einen Band geben, als zuvor angemeldet. Die Zusammenarbeit kann noch enger sein, wie bei Brechts „Arbeitsjournal“, das im Ostberliner Brecht-Archiv vorbereitet worden ist. Wird dieses bedeutende Zeugnis in der DDR überhaupt erscheinen?
Diese Kulturpolitik hat zwei Gesichter: Einmal kann es für Sozialisten wie Braun und Kunze demütigend sein, daß sie vor allem im „kapitalistischen Deutschland“ erscheinen. Sodann aber muß man ihre Lage mit derjenigen anderer Schriftsteller des Ostens vergleichen, die kein „zweites Land“ in der eigenen Sprache als Hintergrund haben. Dann erkennen wir, daß die DDR-Autoren mit Zensurschwierigkeiten von ihren Kollegen anderer sozialistischer Staaten beneidet werden können. Wünschenswert bleibt allerdings, was Heinrich Böll beim Erscheinen von Stefan Heyms letztem Buch formuliert hat: daß die von der ganzen Welt anerkannte Literatur der DDR endlich von der eigenen Regierung anerkannt werde.
François Bondy, Die Weltwoche, 21.2.1973
Bayerischer Akademie-Preis für Reiner Kunze
Die Bayerische Akademie der Schönen Künste hat ihren diesjährigen Literaturpreis, der mit 8.000 Mark dotiert ist, dem in der DDR lebenden Lyriker Reiner Kunze verliehen. Kunze wurde in Oelsnitz, Erzgebirge, als Sohn eines Bergarbeiters geboren.
Reiner Kunze ist ein großer, der Sprache und der Gesellschaft gegenüber verantwortlicher, sensibler Lyriker und Schriftsteller. Die ideologische Literaturpolitik der DDR machte ihn leider zum „Fall“. Allerdings, so wurde am 1. März 1972 vom stellvertretenden DDR-Kulturminister Bruno Haid auf eine Journalistenfrage, ob das über Kunze in der DDR verhängte Publikationsverbot aufgehoben sei, geantwortet, gäbe es für Kunze „unter Umständen gewisse Möglichkeiten“. Doch sei ein „Minimum an staatsbürgerlicher Grundhaltung“ zu verlangen. Haid erklärte: „Wir wünschen nichts mehr, als daß Kunze in unserem Sinne in Verlagen der DDR publiziert.“
Nun hatte Kunze bis 1968 ja alle seine Manuskripte durchaus zuerst den DDR-Verlagen angeboten – bis man ihm mitteilte, sein Name werde in der DDR nicht mehr gedruckt, und die Verträge mit ihm annullierte. (Genaueres darüber in Jürgen P. Wallmanns sorgfältigem Aufsatz: „Der Fall Reiner Kunze“, Neue Deutsche Hefte 136, Jahrgang 19.) Das heißt, einerseits hatte man dem Autor Reiner Kunze, nach Erscheinen des Kinderbuchs Der Löwe Leopold – für das Kunze übrigens den Deutschen Jugendbuchpreis 1971 erhielt –, bedeutet, dieses Buch sei „antisozialistisch“, andererseits warf man ihm vor, er habe es dem S. Fischer Verlag angeboten, obwohl es, so Bruno Haid, auch in der DDR Chancen gehabt hätte, wenn es dort angeboten worden wäre. Das DDR-Büro für Urheberrechte – und damit also das Kulturministerium Bruno Haids – verurteilt also einen Autor und räumt ihm dann nachträglich Chancen fürs eben noch verurteilte, nur leider im Westen angebotene Produkt ein?
Wenn solche Schikanen einen Unbegabten träfen, dann (und das ist natürlich ungerecht, denn auch Unbegabte haben ein Recht auf Gerechtigkeit) würde man wahrscheinlich von alledem gar nichts erfahren. Nur: Kunze ist ein großer Autor. Ein Schriftsteller freilich, von dem die Frankfurter Rundschau weiß, er habe sich „als pathologischer Fall angstpsychologisch mit lyrischem und persönlichem Stacheldraht umgeben“ (so Walter Schulz am 26. September 1970; zitiert nach Jürgen P. Wallmann). Denn es gibt ja keine realen Gründe für Angst und Pathologie ausgerechnet in der DDR. Kunze wagt es, sich zu wehren. Es gibt von ihm, im Gedichtband Zimmerlautstärke kann man es nachlesen, die folgende lakonische Zusammenfassung in dem Gedicht „Auf einen Vertreter der Macht oder Gespräch über das Gedichteschreiben“:
Sie vergessen, sagte er, wir haben
den längeren arm
dabei ging es
um den kopf
Wirklich zu hoffen wagt dieser Künstler, und das ist wieder typisch für einen pathologischen Fall angstpsychologischen Stacheldrahtziehens, merkwürdigerweise nicht. Dabei hatte er doch nur Pech mit der Post, schrieb aber gleichwohl in dem Gedicht „Nach dem ersten verlorengegangenen Brief im neuen Jahr“ (für Heinz Piontek):
Wie das mißtrauen überfliegen?
Brieftauben?
Man würde den himmel mit netzen bespannen
Man würde den himmel mit leim bestreichen
Man würde die sonne löschen im meer
Für die sicherung der macht
auch ewige finsternis!
Der Preis der Bayerischen Akademie ist an einen Würdigen, einen Tapferen gefallen, an einen Künstler, dessen Ansehen dieser Preis hoffentlich stärkt und dessen unnachgiebige Hoffnung er hoffentlich beflügelt.
Süddeutsche Zeitung, 14.3.1973
Laudatio auf Reiner Kunze
In Reiner Kunze ehrt die Akademie einen Lyriker, der seinen geschichtlichen Standort als Bürger der DDR nicht nur nicht verleugnet, sondern auf freimütige Weise zum Thema gemacht hat. Dieser Dichter hat uns gezeigt, daß es möglich ist, mit unbeirrbarer Konsequenz den Weg der Vereinzelung zu gehen und eben dadurch der Pflicht zu mitmenschlicher Solidarität gerecht zu werden. Hatte er sich in seinen Anfängen an einem vorgefundenen Kanon des volkstümlich Schönen und symbolisch Erlesenen orientiert, so ist seine Sprache mit den Jahren immer sachlicher, präziser und trockener geworden und hat unter dem Einfluß des späten Brecht und anderer zeitgenössischer Meister einen Ernüchterungs- und Verknappungsprozeß durchlaufen, der für seine ganze Generation sowohl in West- als auch in Ostdeutschland charakteristisch ist. Mit der von ihm entwickelten Spielart des Sinn- und Spruchgedichts, die nicht nur dialektischen Scharfsinn, sondern auch ein außerordentliches Maß an moralischer und intellektueller Entschiedenheit, an Wahrhaftigkeit und Leidensfähigkeit erkennen läßt, hat er aber die meisten seiner Altersgenossen übertroffen und es zu einer Art von repräsentativer Bedeutung gebracht. In dem 1972 erschienenen Band Zimmerlautstärke erscheint das Gedicht, um mit des Autors eigenen Worten zu sprechen, als ein „Akt der Gewinnung von Freiheitsgraden nach innen und außen“. Hier wird versucht, das Öffentliche und das Persönliche miteinander zu vermessen, d.h. auf öffentliche Fragen persönliche Antworten zu geben, aber auch dem stummen Zuspruch der Dinge Gehör zu verschaffen und dem Numinosen, das aus ihnen spricht, Verehrung zu erweisen.
Hans Egon Holthusen, Ansprache vom 5. 7. 1973, in Jürgen P. Wallmann (Hrsg.): Reiner Kunze. Materialien und Dokumente, S. Fischer Verlag, 1977
Kunst ohne Kompromiß
Opposition, verstanden als starre Gegenhaltung, die es sich nicht leisten kann, sich durch Staunen verunsichern zu lassen, und die das Wenige an Objektivität, dessen der einzelne fähig ist, häufig unmöglich macht, ist poetischem Denken immer abträglich. Da unsere Zeit jedoch zu politischen Allergien inkliniert und sich diese auf die Chancen, in der Welt ein wenig mehr Vernunft durchzusetzen, verhängnisvoll auswirken können, bitte ich Sie, klarstellend sagen zu dürfen: Für mich gibt es in der Kunst, im Kunstwerk, keine Kompromisse. Wenn also in meinen Gedichten nicht nur von Licht die Rede ist, das die Fenster nachts nicht verschweigen müssen, sondern auch von Finsternis, die nicht verschwiegen werden darf, von Finsternissen in jenem Teil der Welt, der auch mein Teil der Welt ist, so können nur Poesieunkundige annehmen oder Böswillige unterstellen, ich schriebe aus Opposition. Meine Damen und Herren, die es angeht: Diese Gedichte entstehen nicht, weil ich – wie es des öfteren heißt – ein Oppositioneller bin, sondern sie entstehen, weil ich ein Schriftsteller bin oder mich zumindest bemühe, im Rahmen meiner Fähigkeiten und Möglichkeiten das zu tun, was nach meiner Meinung ein Schriftsteller tun sollte. Diese Gedichte entstehen, weil ich eben dort – und dieses ,dort‘ weist über die Grenzen der DDR hinaus – von meinem Herzen investiert habe. (Vielleicht wird dem einen oder anderen das Wort ,Herz‘ pathetisch klingen. Ich meine das Organ in seiner Sezierbarkeit und seine Funktion, die sich an Elektrokardiogrammen ablesen läßt.) Und: Diese Gedichte entstehen, weil nicht nur ich dort von meinem Herzen investiert habe, sondern weil vor allem viele andere Menschen von sich selbst investieren, Menschen, die ich kenne oder auch nicht kenne, deren Energie sich mir aber als menschliche Wärme mitteilt. Um es anders zu sagen: Hier nimmt kein Oppositioneller einen Preis für Opposition entgegen, sondern ich habe die große Freude, als Schriftsteller den Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste entgegennehmen zu dürfen, so, wie er gemeint ist, und ich danke mit einer Bewegtheit des Herzens, der zumindest die Internisten beider deutscher Staaten ihre Zustimmung nicht versagen könnten.
Reiner Kunze, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.7.1973
Jedes Wort steht allein
– Begegnung mit Reiner Kunze. –
Die Ansprache vom Vormittag hatte einen schwer beschreibbaren Eindruck hinterlassen. Da stand auf dem Podium Reiner Kunze, Empfänger des Literaturpreises der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Vor ihm hatte Hans Egon Holthusen als Präsident den Jahresbericht der Akademie gegeben; nach ihm sprach Adolf Portmann über „Grenzen des Wachstums“. Kunze sprach nur drei Minuten lang, sechs oder sieben Sätze. Er dankte für den Preis. Aber man spürte in seinen wenigen, freundlich-höflichen Sätzen einen harten Kern, etwas Unüberwindbares. Dieser Kern, das „Herz“, von dem er sprach, ist offenbar auch die Mitte seines Schaffens. Er schreibt nicht nur für ein In- oder Ausland, nicht für das Publikum oder für die Sterne, sondern für sich selbst… Seine Opposition, so ließ er durchblicken, sei keine Gegenhaltung, sondern Kompromißlosigkeit.
Im Gespräch mit Kunze verstärkt sich unser erster Eindruck. Er ist mit seiner Frau aus der DDR gekommen. Die Verleihung des Preises war im März bekanntgegeben worden, und man war gespannt gewesen, ob Kunze nach München kommen könne – ob er kommen dürfe. Er hatte also gedurft, sogar mit seiner Frau. Sie haben ein Kind, und das bleibt dort, das Kind ist das Pfand.
Wenn Kunze spricht, tritt ein dunkler Schimmer in die Augen, im Ton zittert Erregung. Kunze ist 40 Jahre alt. Als Huchel die DDR verlassen durfte, schrieb Kunze ein Gedicht in drei Zeilen:
Er ging
Die zeitungen meldeten
keinen verlust.
Die Überschrift des Gedichtes heißt „Gebildete Nation“.
Kunze erzählt wenig, und er braucht uns nichts zu erzählen. Auf die Frage, wovon er lebe (denn von Lyrik und ein paar Kindermärchen kann man auch dort nicht existieren), wirft er seiner Frau einen Blick zu: Sie ist Ärztin!
Das erinnert mich an jenes „Blaue, Blaue, das Sinn gibt“. Mit Übersetzungen könne er auch dort genügend verdienen, meint Kunze. Seine Artikulation ist deutlich und sorgfältig, zugleich frei und ohne Spur von Mißtrauen, so daß man sich der Gedichte erinnert: „Was machst du, fragt gott“. Die Antwort: „Herr, sag ich, es / regnet, was / soll man tun“.
Die Skelettierung der Mitte gibt Kunzes Spruchgedichten den Charakter sprachlicher Skulpturen. Und so wirkt auch der Mann, fest und dicht bei aller Freundlichkeit und Zartheit seiner Natur.
Jedes Wort steht da wie ein Block, eins getrennt vom anderen, und jedes erfüllt mit Gegenwart. Seine Gedichte sind ein Gegensatz zur melodischen Lyrik. Ihre Instanz ist das Gewissen, dieses „Gott helfe mir. Hier stehe ich und kann nicht anders“, das dem „Internisten“ nicht fremd ist. Diese Vokabel hatte Kunze vormittags, als er vom „Herzen“ des Schriftstellers sprach, benutzt, und jeder verstand sie. Kunze wehrt sich gegen das Schema. Er spricht von Finsternissen, die man nicht verschweigen darf. Er stellt das Radio auf „Zimmerlautstärke“ – das ist der Titel seines letzten Gedichtbandes. Zimmerlautstärke hatte im Dritten Reich einen ähnlichen Nebensinn, wie er ihn drüben heute noch hat. Jene Zeit dauerte 12 Jahre, während es jetzt heißt: „Ich denke an X / und beginne zu zählen“. Ein Ende ist nicht in Sicht.
Über Politik wird nicht gesprochen. Ihre Vordergründe sind allen klar. Das Volk ist nicht so dumm, wie es verkauft werden soll. Jedoch: „Nichts / währt / ewig.“ Da man die Worte liest wie Kunze, alle drei mit großen Abständen, begreift man die panische Angst der Funktionäre vor einer freien Literatur und begreift, warum Kunze durch einen Preis wie diesen drüben gestärkt wird. Der Schutz westlichen Ruhms, wie bei Solschenizyn, zügelt immerhin die politische Triebbefriedigung.
Curt Hohoff, Die Welt, 7.7.1973
„die schuld knien hören“
Auf dem Rücksitz klappert mein Koffer. Jeans, Hemden und Socken liegen begraben unter Schuhen und Schals. Nichts ist geräumt. Bücher und Thermoskanne hüpfen im Takt von Straße und Motor. Es scheppert ordentlich. Zu Hause hatte ich Zahnbürste, Rasierzeug und Wasser eilig in Einkaufstüten gestopft und bin einfach losgefahren. Jetzt liegt alles durcheinander. Der Mantel – neben mir auf dem Beifahrersitz, obenauf der Brief mit Adresse und Anfahrt.
Als der Rundfunksprecher im Radio von der Mater dolorosa der DDR spricht, von Reiner Kunze und Wolf Biermann, von den Aufrechten und den Kritischen, rufe ich Roland übers Handy an. Keine zehn Minuten sind vergangen, seit die Sendung begonnen hat. Roland Geipel, der Freund und der Seelsorger, schweigt beredt. Er will selbst hören. Wir vereinbaren, später erneut zu telefonieren.
Es ist ein lauer Frühlingstag, die Sonne strahlt blau und drückt etwas Kälte nach unten. Ich bin unterwegs nach Berlin. In den Ostteil der Stadt, um genau zu sein, auch wenn das für die meisten keine Rolle mehr spielt. Acht Grad über Null. Akteneinsicht – das zweite Mal. Vor zehn Tagen fand ich das Schreiben im Postkasten. Die Einladung mit dem Bundesadler in der Kopfzeile, der Absender getrennt in Dienstgebäude, Hausanschrift und Postfach, rechts der Name des Sachbearbeiters, darunter das Datum und links die fettgedruckte Betreffzeile: Verwendung personenbezogener Unterlagen…
Alles ist präzise formuliert, im Ton sachlich neutral. Ich könne jetzt kommen, heißt es, die Unterlagen seien gesichtet, chronologisch geordnet und vorbereitet, vorbereitet für mich. Mit freundlichen Grüßen – und so weiter.
Ich denke an Roland und ich denke an Kunze. Reiner Kunze. Zehn Mal habe ich ihn getroffen. In 37 Jahren vielleicht zehn Mal. Das ist nicht viel. Eher wenig. Was bleibt schon davon? Viermal sprachen wir einander bevor die Mauer zerbarst, sechsmal im vereinten Deutschland. Einige Briefe und Postkarten wechselten die Seiten. Hier und da ein Buch als Dankeschön für die eigene Sendung.
Zwei Daten fallen mir ein. Der 15. und der 19. November 1976. Dazwischen brach ein Stück der DDR: die Biermann-Ausbürgerung. Düster graue Novembertage – da war ich sechzehneinhalb Jahre. Superintendent Otto Adolf Scriba hatte am 15. November in der Goethestraße 1 in Gera eine halbprivate, halböffentliche Lesung mit Kunze einrichten können. Die wunderbaren Jahre waren im anderen Teil des Landes erschienen und Pfarrer Urbig von der Johanneskirche verteilte im Keller der Jungen Gemeinde im Halbdunkel zwischen Kerzen, Frank-Zappa- und Jimi-Hendrix-Poster Wachsmatritzenkopien aus dem Buch. Die Texte gab ich später meinem älteren Bruder, der sie nach Prora in die Kaserne mitnahm. Auch das steht fest vor den Augen in meiner Erinnerung.
Wer mich damals am 15. gegen 19 Uhr in die halbverfallene Jugendstilvilla mitgenommen hat, weiß ich nicht mehr. Vielleicht Andreas Bley, vielleicht Martin Morgner? Ich weiß nur, ich war über alle Maßen beeindruckt. Da hatte jemand Teile meiner eigenen Geschichte festgehalten. In Zeilen, kurz und knapp, wie ich sie im kleinen Land noch nicht gehört hatte. Wochen vorher war meine Delegierung zur EOS vom Kreisschulrat zurückgezogen worden, weil ich den Wehrdienst von drei Jahren abgelehnt und beim Musterungsgespräch die Bausoldaten als Alternative ins Gespräch gebracht hatte. Zuvor, im April 1976 war ich gemeinsam mit sieben Schulfreunden das erste Mal von der Stasi „zugeführt“ worden und dieser Kunze schien Kenntnis davon zu haben. Ich sprach ihn darauf an und bat ihn, mein schmales Reclam-Bändchen Brief mit blauem Siegel zu signieren. Vier Tage später reiste ich ihm nach. Er las in der Katholischen Kirche in Greiz, keine fünfunddreißig Kilometer von Gera entfernt. Dass ich damals in Greiz gemeinsam mit Günter Ullmann Kunzes Worten lauschte, war mir nicht bekannt. Vor knapp zwanzig Jahren erfuhr ich es – erfuhr es aus den Akten.
Noch 150 Kilometer zeigt mir das Navigationssystem, „dann haben Sie Ihr Ziel erreicht“. Eineinhalb Stunden: ich werde zu zeitig eintreffen. Viel zu zeitig. Aber ich kann warten. Irgendwo in Mitte im Café oder andernorts. Wir werden sehen.
„Mit dem Tod von Christa W. ging eine Epoche zu Ende“, sagt der Sprecher im Radio, während ich nach der Thermoskanne mit Jasmintee fingere. Zwischen den Passagen spielt Helene Grimaud die Sonata No. 2 von Chopin. Mehr als drei Minuten schwebt ihr Piano sehnsüchtig verloren über der Autobahn. Blaue Schilder, weiße Schrift. Endlos gezogene Streifen begleiten uns, gesäumt vom Grün der Fichten und Tannen rechts und links der Fahrbahn. Dann fällt mir ein, dass die Pianistin Tonarten als Farben sehen könne. Irgendwer schrieb darüber im Feuilleton der ZEIT oder anderswo. Blau ist d-moll und G-Dur sieht sie grün.
Kunzes Texte hätten weiße Töne. Ein intimes und sanftes Weiß.
Ich fahre über die Bundesautobahn von Heilbronn in Richtung Nordosten. Nürnberg und Hof liegen hinter mir. Fast siebenhundert Kilometer sind es von Tübingen bis Berlin. Früher fuhr ich die Strecke öfters. Ich sehe die Landschaft an mir vorbeiziehen, das alte Chemiedreieck Leuna, Buna, Bitterfeld, dann Delitzsch, Wolfen, Dessau, den leicht blau verhangenen Himmel, und ich denke, dass ich mehr als zehn Jahre nicht hier in der Gegend gewesen bin.
Als ich die DDR verließ, nach acht abgelehnten Studienanträgen und nach 56 vergeblichen Ausreiseanträgen war Kunze im Gemeindezentrum Gera-Lusan ein fester Gast. Sonntags in den Predigten von Roland Geipel, Dienstag und Donnerstag im Arbeitskreis Literatur und in der Friedenswerkstatt, die ich damals leitete. Seine Zitate begleiteten uns wöchentlich. In der Kirche und in den Akten.
In Tübingen, fast eineinhalb Jahre vor jenem 9. November, trafen wir uns wieder. Er las im Hölderlin-Turm. Gute Freunde, die russischen Dissidenten Lew und Lydia Druskin waren mit mir gekommen. Ich hatte für Kunze geworben und ihnen Gedichte vorgelesen. In Hölderlins Exil mit Blick auf den Neckar sprachen wir über Poesie und über die Kunst des Übersetzens. Ein halbes Jahr später lud ich Kunze ein, in mein erstes DDR-Literatur-Seminar sollte er kommen, das ich damals, nicht wissend was kommen würde, im Sommersemester ’89 gemeinsam mit Jürgen Hauff gab. Liebvoll schrieb er zurück, dass wir einander an anderer Stelle im Tübinger Kupferbau sehen und sprechen könnten, weil er dort im April eine Poetikvorlesung halten werde. Das weiße Gedicht war in Vorbereitung und er rezitierte daraus. Seitdem schrieb ich ihm hin wieder, schickte die ersten Erzählungen in AGONIE, NDL oder OSTRAGEHEGE und bekam liebevoll knapp stets seine Antwort.
Im Radio jammert Neil Young. Ich kenne den Song von meines Bruders Plattensammlung. „Helpless“, heißt der Titel, ein stilles, verschwiegenes Lied. Grau-schwarzes Faltcover: After the Goldrush. Ein junger Hippie und eine zahnlose Alte auf dem Foto.
Dann sprechen erneut die Experten im Radio: „Sie konnte abweisend und unnahbar sein“, antwortet ein Journalist im Radio auf die Frage des Moderators „Wie Christa W. denn nun wirklich gewesen sei?“. „Abweisend, zu westlichen Journalisten“, betont er immer und immer wieder und erzählt von sich und wie ihm Unrecht getan worden sei von ihr mit den stets abgelehnten Anfragen fürs Interview. Gekränkte Eitelkeit, denke ich mir, nein schlimmer noch: gekränkte männliche Eitelkeit, während ich den beiden im Radio zuhöre. Sie philosophieren über die Nationalpreisträgerin und diskutieren darüber, wie nah sie dem Nobelpreis für Literatur tatsächlich gekommen sein könnte. Dann reicht er die Frage weiter zu Biermann, schließlich zu Kunze.
Bei der Hans-Sahl-Preisverleihung saß ich für Stunden neben ihm. In Berlin, nahe der Friedrichstraße an einem schönen Spätsommertag. Der Abend ließ Erinnerungen vor Augen treten. Die Goethestraße, Roland Geipel, Utz Rachowski, Lew Druskin und schließlich der Hölderlin-Turm.
Von Westafrika schickte ich meinen ersten Roman. Wie immer kam die Antwort rasch und es tat gut, seine Stimme aus den Zeilen zu hören.
Noch fünfzehn Kilometer bis zur Behörde. Das Ortsschild Berlin ist auf der Avus passiert und ich frage mich, ob ich in den Jahren in Afrika zu lange versucht habe, die Vergangenheit zu vergessen, ob es nicht längst an der Zeit ist, zurück zu blicken, auch wenn ich zu viel von der Wirklichkeit gesehen habe. Das Gefühl stark und nicht ohnmächtig zu sein kommt in mir auf und auch das verdanke ich Kunze.
VERS ZUR JAHRTAUSENDWENDE
Wir haben immer eine wahl,
und sei’s uns denen nicht zu beugen,
die sie uns nahmen
Karsten Dümmel, aus Matthias Buth und Günter Kunert (Hrsg.): Dichter dulden keine Diktatoren neben sich, Verlag Ralf Liebe, 2013
Bedrängnis und Hoffnung
– Politische Atemnot als ästhetisches Programm der Verknappung – Laudatio zur Trakl-Preis-Verleihung. –
Reiner Kunze hat menschliche Bedrängnis dieser Zeit in seinen Gedichten exemplarisch knapp formuliert, lautet die Begründung für die Zuerkennung des Georg-Trakl-Preises 1977 an ihn. Worin sieht Reiner Kunze die Funktion seiner Gedichte? Dazu er:
Das gedicht als stabilisator, als orientierungspunkt eines ichs. Das gedicht als akt der gewinnung von freiheitsgraden nach innen und außen. Das gedicht als äußerster punkt möglichen entgegengehens des dichters, als der punkt, in dem auf seiner seite die entfernung auf ein nichts zusammenschrumpft. Das gedicht als bemühung, die erde um die winzigkeit dieser annäherung bewohnbar zu machen.
Welcher Art ist nun die eingangs genannte Bedrängnis? Den Kern solcher Bedrängnis hat Reiner Kunze selbst so definiert:
Im mittelpunkt steht
der mensch
Nicht
der einzelne
Die bittere Ironie dieser Formel wird potenziert durch den Titel – „Ethik“.
Erschienen 1969, in seinem Buch Sensible Wege, bei Rowohlt, ist dieses Gedicht, überraschend, zehn Jahre früher datiert; 1959, das Jahr, als er, im Alter von 26, in der DDR seine erste eigene Gedichtsammlung herausbrachte, hier so gut wie unbekannt.
Sein Weg führte, entscheidend, in das Nachbarland ČSSR – Kunzes Aufenthalt 1961/62, Land seiner Freundschaften, bekanntlich, mit einer Anzahl von Dichtern, von ihm übersetzt; Herkunftsland seiner Frau, Tschechin, blaues Komma im vorletzten Gedicht, 1970 geschrieben, seines Buches zimmerlautstärke:
Von neuem lese ich von vorn
die häuserzeile suche
dich das blaue komm das
sinn gibt
Nun, da die äußerste Knappheit zum ästhetischen Programm gehört, findet sich immer noch, wie an dieser Stelle, Farbe, frappierendes Bild, Wortspiel, also Lust am Spiel mit der Sprache. Sie gibt auch dem kritischen Gedicht die Zündung:
DRILL
kere – bitten
kerekere – betteln
(wörter der fidschiinsulaner)
Die spräche der fidschi, heißt es, zeugt
von niederer kultur: sie beruht
auf dem prinzip der Wiederholung
Daher, tochter:
marschmarsch!
Ein Wort zum Formalen: man kann in einzelnen seiner Gedichte ein Gegenstück zur konkreten Poesie erblicken, mit dem Unterschied freilich, daß diese zur Entpersönlichung neigt, während bei Kunze auch das komprimierteste Gebilde sich gerade entgegengesetzt verhält. So gibt es, in den Sensiblen Wegen, eine Art Parabel, deren erster Teil, in seinem mechanischen Ablauf, ein Fortschreiten skizziert, aus dem Offenen ins Engere ins noch Engere bis ins Innere, während der zweite Teil statisch und punktuell ist, von zitternder Statik freilich, ein ins Ungewisse gesetzter Punkt.
Der einmal erfolgten Etikettierung – ich nannte es „den romantischen, singenden Dichter“ – mit einem Mal nicht zu entsprechen, ja offenbar umzuschlagen ins Gegenteil, mit spröden, wortkargen, kritischen Konstellationen, wird kein literarisches Publikum irgendwo irgendwem allzu leicht verzeihen. Ausgesperrt zu sein, über Jahre, von allen Möglichkeiten der Publikation, haben von Österreichs Dichtern nicht wenige, und nicht die schlechtesten, vor nicht allzu langer Zeit erfahren. Ihr Verhältnis zum eigenen Land – war es ein ähnlich hoffendes wie das Reiner Kunzes zu seinem? Oder zogen sie nicht, Österreichs neue Dichter, vielmehr voll Zorn in die innere und oft genug in die tatsächliche Emigration, während Kunze die Hoffnung aus dem schöpfte, was ihn umgab.
Davon berichtet er 1965 in einem Gedicht an die Stadt, wo er lebt, Graz in Thüringen:
Greiz grüne
Zuflucht ich
hoffe
ausgesperrt aus büchern
ausgesperrt aus zeitungen
ausgesperrt aus sälen
eingesperrt in dieses land
das ich wieder und wieder wählten würde
hoffe ich
mit deinem grün
Bedarf es noch ausdrücklich solcher Wörter wie: Standhaftigkeit, Mut?
Im nächsten Gedichtband, zimmerlautstärke, 1972 bei S. Fischer erschienen, sucht man vergebens nach einer Zeile von so drängendem Klang, „das ich wieder und wieder wählen würde“. Statt dessen, vorangestellt, ein Zitat von Seneca:
… bleibe auf deinem Posten und hilf durch deinen Zuruf; und wenn man dir die Kehle zudrückt, bleibe auf deinem Posten und hilf durch dein Schweigen.
Das Buch, durchzogen von Zitaten – Aneignung und Selbstentäußerung zugleich –, erscheint als ein Ganzes komponiert, also nicht als chronologische und/oder zufällige Aneinanderreihung von Gedichten, und ist darin verwandt bestimmten konkreten Praktiken.
Greiz grüne / Zuflucht ich / hoffe“ – das war 1965.
1970 erschien der Begriff „Hoffnung“ in verändertem Kontext und Ton:
AUCH EINE HOFFNUNG
Ein grab in der erde
Hoffnung aufzuerstehen
in einem halm
(Grabplatte keine
Nicht noch im tod
scheitern an stein)
April 1973, 150. Geburtstag von Petöfi, 3. Internationale Dichtertagung in Budapest, treffe ich Reiner Kunze erstmals, mit ihm Elisabeth. Ein lachendes Erkennen, Freunde seit je.
Hoffnung auf ein Buch Reiner Kunzes bei Reclam in Leipzig; September 1973 erscheint es, Brief mit blauem Siegel, die Auflage, 30.000, ist bereits vor Erscheinen vergriffen.
Kunze, in einem Brief:
Für mich ist diese Publikation natürlich von großer Bedeutung, aber ich wage nicht, von einer ‚Wende‘ zu sprechen. Alles ist sehr ungewiß und nicht zu Optimismus ermutigend.
Diese Stelle könnte wörtlich einem Brief des schottischen Dichters Ian Hamilton Finlay entnommen sein. – Drei Jahre später, Anfang Mai 1976, begegne ich ihm in West-Berlin wieder; eben ist er Mitglied der Akademie der Künste geworden. Schwierige Jahre liegen hinter ihm. Wir wollen uns wiedersehen, am gleichen Ort, im Herbst. Im Sommer kommt eine Karte: für die Herbsttagung habe er eingereicht, aber inzwischen werde ein neues Buch von ihm erscheinen – – – – – – ein langer Strich.
Das Buch erscheint. Reiner Kunze kommt nicht.
Ich bin K.
und wohne
hier
Der dichter
ist verzogen
Anschrift
unbekannt.
bereits ist diese Auskunft erschienen… Heute ist der Dichter Reiner Kunze bei uns. Also dürfen wir hoffen, auf Verringerung aller Bedrängnis, auf Helligkeit in neuen Gedichten.
Paul Jandl, Die Zeit, 11.2.1977
Innere Souveränität
– Verleihung des Georg Trakl-Preises an Reiner Kunze. –
… Solange die Frage nicht geklärt ist, ob die Wiedereinreisevisa der Deutschen Demokratischen Republik auch für Schriftsteller und Dichter Gültigkeit haben, so lange ziehe ich es natürlich vor, innerhalb der Grenzen unseres Landes zu bleiben.
Mit diesen sarkastischen Worten und mit dem Aperçu „Das Ausbürgern könnte sich einbürgern“ hatte Stefan Heym (Ost-Berlin) im November 1976, nachdem Wolf Biermann die DDR-Staatsbürgerschaft aberkannt worden war, eine geplante Lesung in West-Berlin abgesagt. Seitdem hat kein prominenter, insbesondere kein kritisch eingestellter Schriftsteller aus der DDR mehr den Westen besucht. Um so erstaunlicher war es, dass ausgerechnet Reiner Kunze es wagte, nach Oesterreich zu fahren und am 3. Februar, dem 90. Geburtstag Georg Trakls (1887–1914), den ihm zusammen mit Friederike Mayröcker (Wien) verliehenen Georg Trakl-Preis 1977 des Landes Salzburg entgegenzunehmen. Und nicht minder musste es erstaunen, dass man ihn reisen liess, dass ihm die DDR-Behörden ein für zehn Tage gültiges Visum ausstellten. Immerhin war Kunze ja wegen seiner Prosa Die wunderbaren Jahre aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen worden, hat faktisch Berufsverbot und ist täglich neuen Schikanen und Pressionen ausgesetzt. Selbst Pfarrer und Studenten, die nur losen Kontakt mit Kunze haben, werden allein deswegen stundenlangen Polizeiverhören unterworfen.
Die Tatsache nun, dass der von den Kämpfen der letzten Monate sichtlich gezeichnete Reiner Kunze reisen und auch wieder zu seiner Familie zurückkehren durfte, dass ihm die Ausreisegenehmigung innerhalb kürzester Zeit und – so Kunze – „mit dem grössten Entgegenkommen des Kulturministeriums“ erteilt worden war, hat freilich wenig mit einer Aenderung des kulturpolitischen Klimas in der DDR zu tun. Zwar sprach Kunze davon, vielleicht sei die DDR eben doch „wieder ein Stückchen zur inneren Souveränität vorgestossen“. Doch dürfte ausschlaggebend gewesen sein, dass sich die österreichische Regierung auf höchster Ebene ganz massiv bei den Ostberliner Behörden für Kunze eingesetzt hat. So hatte die Salzburger Landesregierung in Sachen Kunze u.a. an DDR-Kulturminister Hoffmann geschrieben und sowohl auf die Schlussakte von Helsinki als auch auf das kurz vor dem Abschluss stehende Kulturabkommen zwischen der DDR und Oesterreich hingewiesen. Hätte man Kunze in diesem Augenblick Schwierigkeiten gemacht, wäre dies in Wien als Affront verstanden worden und hätte womöglich aussenpolitisch unerwünschte Konsequenzen gehabt. Ganz gewiss nicht, weil er eingeschüchtert gewesen wäre, eher aus Rücksicht auf bestimmte Entwicklungen innerhalb der DDR-Führungsspitze und aus Takt gegenüber seinen österreichischen Gastgebern enthielt sich Kunze in Salzburg und Wien aller öffentlichen politischen Stellungnahmen, zu denen ihn die Journalisten drängen wollten. Nichts, was er hier sagte, kann ihm als DDR-feindliche Aeusserung zur Last gelegt werden. Freilich erwähnte er in dem einzigen Interview, das er gab – es wurde vom österreichischen Fernsehen ausgestrahlt –, die zahlreichen Beweise der Solidarität, die er in den letzten Monaten erhalten habe. Auch habe er viel Zeit und Kraft darauf verwenden müssen, „wenigstens die gröbsten Missverständnisse zurückzuweisen“ und sich gegen Verleumdungen zu wehren.
Zum Fall Biermann mochte sich Reiner Kunze nicht noch einmal äussern, weil eine solche Stellungnahme zu diesem Zeitpunkt weder hilfreich noch sinnvoll sei. Während der Ereignisse der letzten Monate allerdings habe es der menschliche Anstand verlangt, dass er sich äussere. Im übrigen aber bemühe er sich – so wie übrigens immer schon –, unnötige, nicht die Literatur betreffende Aeusserungen zu vermeiden. Nach Monaten, in denen er zu literarischer Arbeit kaum gekommen sei, wolle er nun endlich wieder zum Eigentlichen zurückkommen, zum Schreiben – und das sei kein Zeichen der Resignation, sondern im Gegenteil der ungebrochene Wille zur Produktivität.
Bei der Ueberreichung des Trakl-Preises erklärte der Vertreter der Landesregierung Salzburg, diese Preiszuerkennung an eine Oesterreicherin und an einen Bürger der DDR sei zu verstehen „als Symbol unserer Grenzen überwindenden, herzlichen Offenheit“. Weder die Jury (Hilde Domin, Ernst Jandl, Walther Killy, Walter Weiss) noch die Landesregierung hätten sich von politischen Ueberlegungen leiten lassen:
Dass Signale eines freien geistigen Höhenflugs aufgenommen und reflektiert werden, kann weder als Konzession noch als Provokation verstanden werden.
Nach der bemerkenswerten Laudatio von Paul Jandl, in der Kunze wie ein naher Verwandter der Konkreten Poesie erschien, dankte der Gast aus der DDR mit wenigen Sätzen für den Preis, der ihm mehr bedeute als lediglich eine Ehre, sowie mit einigen noch nicht in Buchform publizierten Gedichten. Wie in Salzburg, so lehnte Kunze auch später in Wien nach einer Lesung öffentliche Diskussionen ab und kehrte nach Ablauf der im Visum angegebenen Frist zurück in seine Heimatstadt Greiz in Thüringen: in jene Stadt, die er in dem vielzitierten Gedicht „Dreiblick“ seine „grüne Zuflucht“ genannt hatte, eine Zuflucht in jenem „land / das ich wieder und wieder wählen würde“. So hatte es Reiner Kunze 1965 gesagt. Doch diese eher optimistisch klingenden Zeilen hat er jetzt, entgegen anderslautenden Zeitungsberichten, in Oesterreich nicht vorgelesen. Auch dies dürfte kein Zufall gewesen sein.
Jürgen P. Wallmann, Die Tat, 11.2.1977
Reiner Kunze in England
Die zeitgenössische deutsche Lyrik hat im Ausland bislang stets nur eine recht geringe Resonanz gefunden. Umso mehr Aufmerksamkeit verdient darum die Tatsache, dass in diesen Tagen in England ein Buch mit Gedichten Reiner Kunzes erscheint, der im Vorwort als der vielleicht bedeutendste Dichter der DDR bezeichnet wird. Der Band mit dem Titel With The Volume Turned Down (Zimmerlautstärke) wurde von Ewald Osers in Zusammenarbeit mit dem Autor übertragen und enthält 44 Gedichte Kunzes aus den letzten zehn Jahren. Damit liegt zum erstenmal eine Sammlung von Gedichtübertragungen jenes Lyrikers vor, der wegen seines Eintretens für einen freiheitlichen Sozialismus in der DDR jahrelang verschwiegen und in seiner Arbeit behindert wurde. Aufsehen erregt hatte vor einiger Zeit die Mitteilung, dass im Herbst bei Reclam (Leipzig) ein Auswahlband mit Kunzes Lyrik Brief mit blauem Siegel erscheinen wird, der auch Texte aus dem 1972 bei S . Fischer (Frankfurt a.M.) verlegten Band zimmerlautstärke enthalten soll. Reiner Kunze, der im Juli den ihm kürzlich zuerkannten diesjährigen Literaturpreis der Bayerischen Akademie (München) erhält, wird dem englischen Leser als ein Dichter vorgestellt, der nicht Protestgedichte in konventionellem Sinne schreibt, sondern dem es gelingt, ein im Grunde „unpoetisches“ Vokabular poetisch einzusetzen. Ewald Osers, der als Uebersetzer hohes Ansehen geniesst und der schon mehr als 40 Bücher aus dem Tschechischen und Deutschen übertragen hat, schreibt, Reiner Kunzes Auseinandersetzung mit dem Regime betreffe nicht den Sozialismus – „er ist vielleicht ein besserer Sozialist als die meisten seiner offiziellen Kritiker“ –, sondern die Menschlichkeit, die Anständigkeit, die individuelle Freiheit und das Recht des Menschen auf Kommunikation mit anderen:
… er verwahrt sich dagegen, dass ihm einige, eben weil sie die Macht in Händen halten, einen Maulkorb anlegen oder dass sie ihn an die Leine nehmen.
Reiner Kunzes Band With The Volume Turned Down erscheint in den London Magazine Editions (30 Thurloe Place, London, SW 7)
J. P. W., Die Tat, 2.6.1973
R.
1
Er ist kein Krieger, kein Lohnsklave, kein Konzernschreiber
Und doch kennt er Kampf und Not und Qual
Er lebt unter uns. Sein Name ist bekannt.
Es betrifft diesen Einzelnen. Einen Menschen mit einem Namen.
Ist es erlaubt, von einem Menschen zu reden?
Er hat ein Herz, wie es die Liebenden malen
Zwei volle Bögen, die endlich einander begegnen:
Es pocht den vollen Bogen der Lust aus und den vollen Bogen der Ungeduld
Doch wir sagten ihm: dieser simple Hohlmuskel
Pocht bißchen viel Lärm aus sich!
Und wir wollten den Schlag der Hämmer nur hören und nicht den Herzschlag
Oder wir wollten, daß beides synchron erschalle
Den schnelleren Herzlärm wollten wir nicht begreifen.
Und sein Herz litt Not, kämpfte, quälte sich
Mitten unter uns, sein Name war uns bekannt
Und als sein Lärm ausblieb, mußte sein Herz
In die Obhut der Ärzte, dieser
Simple Hohlmuskel.
2
Darf auch nur ein Mensch
Allein treiben im Schiff seiner Lust?
Darf auch nur ein Mensch
Fliegen am Mast seiner Ungeduld?
Darf auch nur ein Mensch
Verlorengehn?
3
Hier?
Volker Braun
Michael Wolffsohn: REINER KUNZE – der stille Deutsche
In Lesung und Gespräch: Reiner Kunze (Autor, Obernzell-Erlau), Moderation: Christian Eger (Kulturredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, Halle). Aufnahme vom 17.01.2012, Literaturwerkstatt Berlin. Klassiker der Gegenwartslyrik: Reiner Kunze. Wenn die post hinters fenster fährt blühn die eisblumen gelb.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Harald Hartung: Auf eigene Hoffnung
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.1993
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Katrin Hillgruber: Im Herzen barfuß
Der Tagesspiegel, Berlin, 16.8.2003
Lothar Schmidt-Mühlisch: Eine Stille, die den Kopf oben trägt
Die Welt, 16.8.2003
Beatrix Langner: Verbrüderung mit den Fischen
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.8.2003
Sabine Rohlf: Am Rande des Schweigens
Berliner Zeitung, 16./17.8.2003
Hans-Dieter Schütt: So leis so stark
Neues Deutschland, 16./17.8.2003
Cornelius Hell: Risse des Glaubens
Die Furche, 14.8.2003
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Michael Braun: Poesie mit großen Kinderaugen
Badische Zeitung, 16.8.2008
Christian Eger: Der Dichter errichtet ein Haus der Politik und Poesie
Mitteldeutsche Zeitung, 16.8.2008
Jörg Magenau: Deckname Lyrik
Der Tagesspiegel, 16.8.2008
Hans-Dieter Schütt: Blühen, abseits jedes Blicks
Neues Deutschland, 16./17.8.2008
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Jörg Bernhard Bilke: Der Mann mit dem klaren Blick: Begegnungen mit Reiner Kunze: Zum 80. Geburtstag am 16. August
Tabularasa, 18.7.2013
artour: Reiner Kunze wird 80
MDR Fernsehen, 8.8.2013
André Jahnke: Reiner Kunze wird 80 – Bespitzelter Lyriker sieht sich als Weltbürger
Osterländer Volkszeitung, 10.8.2013
Josef Bichler: Nachmittag am Sonnenhang
der standart, 9.8.2013
Thomas Bickelhaupt: Auf sensiblen Wegen
Sonntagsblatt, 11.8.2013
Günter Kunert: Dichter lesen hören ein Erlebnis
Nordwest Zeitung, 13.8.2013
Marko Martin: In Zimmerlautstärke
Die Welt, 15.8.2013
Peter Mohr: Die Aura der Wörter
lokalkompass.de, 15.8.2013
Arnold Vaatz: Der Einzelne und das Kartell
Der Tagesspiegel, 15.8.2013
Cornelia Geissler: Das Gedicht ist der Blindenstock des Dichters
Berliner Zeitung, 15.8.2013
Johannes Loy und André Jahnke: Eine Lebensader führt nach Münster
Westfälische Nachrichten, 15.8.2013
Michael Braun: Süchtig nach Schönem
Badische Zeitung, 16.8.2013
Jochen Kürten: Ein mutiger Dichter: Reiner Kunze
Deutsche Welle, 15.8.2013
Marcel Hilbert: Greiz: Ehrenbürger Reiner Kunze feiert heute 80. Geburtstag
Ostthüringer Zeitung, 16.8.13
Hans-Dieter Schütt: Rot in Weiß, Weiß in Rot
neues deutschland, 16.8.2013
Jörg Magenau: Der Blindenstock als Wünschelrute
Süddeutsche Zeitung, 16.8.2013
Friedrich Schorlemmer: Zimmerlautstärke
europäische ideen, Heft 155, 2013
Zum 85. Geburtstag des Autors:
LN: Sensible Zeitzeugenschaft
Lübecker Nachrichten, 15.8.2018
Barbara Stühlmeyer: Die Aura der Worte wahrnehmen
Die Tagespost, 14.8.2018
Peter Mohr: Die Erlösung des Planeten
titel-kulturmagazin.de, 16.8.2018
Udo Scheer: Reiner Kunze wird 85
Thüringer Allgemeine, 16.8.2018
Jochen Kürten: Sich mit Worten wehren: Der Dichter Reiner Kunze wird 85
dw.com, 16.8.2018
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Lothar Müller: Widerstand in Jeans
Süddeutsche Zeitung, 15.8.2023
Cornelia Geißler: Dichterfreund und Sprachverteidiger
Berliner Zeitung, 15.8.2023
Antje-Gesine Marsch: Greizer Ehrenbürger Reiner Kunze feiert 90. Geburtstag
Ostthüringische Zeitung, 16.8.2023
Ines Geipel: Nachwort. Zum 90. Geburtstag von Reiner Kunze
S. Fischer Verlag
Ines Geipel: Mit dem Wort am Leben hängen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.2023
Gregor Dotzauer: Mit den Lippen Wörter schälen
Der Tagesspiegel, 15.8.2023
Hans-Dieter Schütt: Das feingesponnene Silber
nd, 15.8.2023
Stefan Stirnemann: Ausgerechnet eine Sendung über Liebesgedichte brachte Reiner Kunze in der DDR in Nöte – und mit seiner späteren Frau zusammen
Neue Zürcher Zeitung, 15.8.2023
Christian Eger: Herz und Gedächtnis
Mitteldeutsche Zeitung, 15.8.2023
Matthias Zwarg: Im Herzen barfuß
Freie Presse, 15.8.2023
Marko Martin: Nie mehr der Lüge den Ring küssen
Die Welt, 16.8.2023
Josef Kraus: Mutiger Lyriker, Essayist, Sprachschützer, DDR-Dissident, Patriot – Reiner Kunze zum 90. Geburtstag
tichyseinblick.de, 16.8.2023
Erich Garhammer: Das Gedicht hat einen Wohnort: entlang dem Staunen
feinschwarz.net, 16.8.2023
Volker Strebel: Ein deutsch-deutscher Dichter
faustkultur.de, 29.8.2023
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG + IMDb + Archiv +
Kalliope + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Rede + Interview 1, 2 & 3
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Reiner Kunze – Befragt von Peter Voss am 15.7.2013.


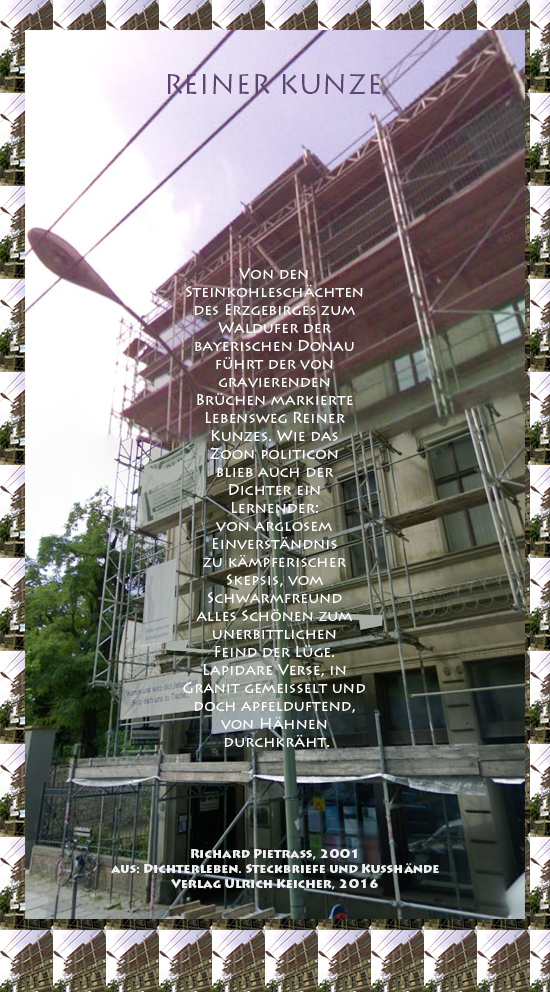












Schreibe einen Kommentar