Reiner Kunze: auf eigene hoffnung
RAUMFAHRT IM WAGEN DES GASTES
Noch dürfen wir nicht zurück zur erde, obwohl wir
an ihr haften
Noch ist das letzte ziel der kamera
nicht fotografiert
Die fliegende dämmerung überholen, das zielfoto
wird entscheiden
An der windschutzscheibe flügel
winziger erschlagener engel
Es war 1977,
als Reiner Kunze sein Land verlassen mußte. Das Erscheinen des Prosabandes Die wunderbaren Jahre im Herbst 1976 und der Weggang des Autors aus der DDR im Frühjahr darauf standen damals im Brennpunkt literarischen und kulturpolitischen Interesses. Welche Folgen für die Existenz des Schriftstellers würde die Konfrontation mit dem hiesigen neuen Deutschland haben? Welche Themen konnte es hier für ihn geben? Lag nicht das Verstummen ebenso nah wie die Verirrung oder die Verzweiflung? Fragen und Vermutungen dieser Art tauchten auf, wo immer der Name Reiner Kunze fiel.
Lange ließ er auf Nachricht warten. Entschlossen widerstand er den Verführungen und Bedrängungen zum raschen Publizieren. Er brauchte Stille und sammelte sie um sich, „die Erde fürs Gedicht“.
Jetzt legt dieser erste Band mit Gedichten, die unter den Lebensbedingungen hierzulande entstanden sind, Zeugnis ab von seiner ungebrochenen, ja durch neue existentielle Erfahrungen noch gesteigerten poetischen Produktivität. Das Gedicht bildet wie in der Vergangenheit für den Künstler den Stabilisator und Orientierungspunkt seines Ichs. Er verankert in ihm die seelische Instanz des Gewissens. Innerhalb welcher Grenzen wir leben, welche Wahrnehmungssensibilität und welchen Widerstand Reiner Kunze ihnen entgegensetzt, erfahren wir in diesen neuen Gedichten.
S. Fischer Verlag, Klappentext, 1982
Geduld und Demut
Nein, er ist noch immer nicht vernünftig geworden, Reiner Kunze, 48 Jahre alt, DDR-Schriftsteller bis 1977, mit viel Hallo und dem Büchner-Preis in der Bundesrepublik empfangen. In seiner Dankrede zitierte er damals das Wort eines ehemaligen Vorgesetzten, der die Mitteilung, sein junger wissenschaftlicher Assistent mache Gedichte, mit einem „Naja, auch Sie werden noch vernünftig werden“ quittierte. Zuerst hieß das:
Keine Gedichte schreiben. Später bedeutete es: Nur die Gedichte nicht schreiben, die ich schrieb.
Es dauerte nicht lange, da wurde aus dem Hallo ein kräftiges Halali. Die einen, und das waren noch die freundlichsten unter den Jägern, fanden, Kunze habe, da ja nun in Ehren und in Freiheit lebend, pflichtschuldigst sein Hauptwerk zu produzieren. Die andern verübelten ihm den Film, den er hierzulande nach seinem Buch Die wunderbaren Jahre drehte – und mehr als den Film den Bayerischen Filmpreis, den er dafür 1979 entgegennahm. Was, solange er drüben war, als poetische Mutprobe allerersten Ranges gepriesen wurde, nahm, als er hier war, auf einmal die schillernde Farbe des Opportunismus an. Anpassung hieß das bitterböse Wort. Reiner Kunzes neue Gedichte geben Antwort, vielfältige, auf diesen Vorwurf, eins davon unmittelbar:
ERSTES GELEIT
Ich passe mich an
Ich habe einen freund zu grabe getragen
Ich passe mich dieser wahrheit an
wie er sich nun anpaßt der erde
Die Verse sind Clemens Podewils gewidmet und beziehen sich auf dessen Begräbnis im August 1978. Podewils war in seiner Eigenschaft als Generalsekretär der Bayerischen Akademie der Schönen Künste 1974 nach Ost-Berlin gekommen, um dem an der Ausreise verhinderten Kunze die Mitgliedsurkunde der Akademie zu überreichen.
Das Gedicht ist gar nicht so unpolitisch, wie es sich gibt. Es sagt unter anderem auch: Freundschaften können stärkere öffentliche Wirkungen auslösen als Zugehörigkeit zu Gruppierungen. Podewils zitierte in seiner kurzen Ansprache in Ost-Berlin ein Gedicht von Kunze, das sich jetzt in der ersten Abteilung des Bandes findet- sie enthält die noch in der DDR entstandenen Stücke. Da erwidert der Dichter auf den Ausruf seiner Tochter „Schon wieder in der garage!“:
Wegen
der großen entfernungen, tochter
Wegen der entfernungen
von einem wort zum andern
Die Pointe beruht auf einer winzigen Verschiebung: Der heimatlose Romantiker mußte wandern von einem Ort zum andern; für sein Außenseiterschicksal entschädigte ihn seine Reimkunst. Inzwischen sind die Entfernungen, die der Dichter durchwandern muß, in die Sprache selbst eingedrungen, hier sind die Grenzen zu überschreiten oder zu ziehen.
Kunze nennt das auch – wieder mit seiner Kunst der neuen Nuancierung geläufiger Ausdrücke – den „freien vers“; er ist das „winzige reich“, in dem der Dichter keine Diktatoren neben sich duldet, keine Interessenvertreter, auch jene nicht, deren Interesse die Literatur und ihr Betrieb ist. Ideologenwunschbild hier wie dort wäre „Melde, schriftsteller K. / angetreten // Kopf bei fuß“; aber dieses Wunschbild äußert sich in sehr viel feineren Erwartungen, Verführungen. Immer noch haftet dem Dichter, besonders jenem, der – wie Kunze – seine poetische Sache so unbedingt auf Lyrik gestellt hat, ein Abglanz der Imago des Weisen an, die freilich schon sehr verblaßte Gloriole des Rhapsoden, der blind ist, weil er tiefer sieht.
In der DDR ist diese Rolle des Autors als Seher, Helfer viel stärker ausgeprägt, aber auch hier weiß der Dichter ein Lied zu singen über das, was von seinem Lied erhofft wird:
Siebzehn sei sie Und warum der mensch geboren werde
in dieses leben Und wenn auch der dichter
Ihr’s nicht sagen könne, wenn auch er nicht, dann –
Kunze hält solchen Forderungen sein Wissen entgegen, daß ein Gedicht warten kann. „Doch wie von diesem wissen abgeben, wie / abgeben davon“? Durch nichts als durch das Gedicht selbst, das der Ungeduld seiner Leser widersteht. Der Lyriker Kunze verliert niemals die Geduld – das ist kein passiver, sondern ein sehr schöpferischer Vorgang:
SCHREIBTISCH AM FENSTER,
UND ES SCHNEIT
Vögel sichern länger als sie
futter aufnehmen
Und wieder verharre ich
reglos
Euren tadel daß ich zeit vergeude
weise ich zurück
Stille häuft sich an um mich,
die erde fürs gedicht
Im frühling werden wir
verse haben und vögel
Wer hier Feierlichkeit, eine dichter-fürstliche Attitüde zu bemerken glaubt, täuscht sich gründlich. Demut ist neben der Geduld die andere Tugend, die in Kunzes Gedichten ihren leitmotivischen Ausdruck findet. Das Beschneiden der Apfelbäume im Winter führt in die Strophe „Mit den ihren / kappe ich alle zweige in mir die / hoch hinauswollen“.
Schnell fertig sind Kritiker mit dem Wort. Zugreifen, zuschlagen heißt die Parole. Ein neuer Band von Kunze, auf den man so lange warten mußte, – das ist gleich ein doppelter Anreiz für die immer sprungbereite Kritikerseele, ihr Reaktionsvermögen zu beweisen. Ob der Kranz, der dem Autor von seinem Zeitgenossen so flugs gewunden wird, eher aus Lorbeerblättern oder aus Dornen besteht, ist fast gleichgültig; Hauptsache, Hauptsache, er beugt die Stirn, macht Miene zum Spiel. Reiner Kunzes beharrliche Resistenz, die tiefer reicht als jedes Dafür- oder Dagegensein im Rahmen des Spielfelds, ist ein Ärgernis für alle, die es gut oder böse mit ihm meinen. Zugleich ist diese Unbestechlichkeit die poetische Substanz seiner neuen Gedichte.
Albert von Schirnding, Nürnberger Zeitung, 21.11.1981
Verlust der poetischen Unschuld
Es sind die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, die immer wieder minor poets vorübergehend den Stellenwert großer Dichter geben – einen Rang, mit dem sie und auch ihre Leser schließlich nicht fertig werden. Reiner Kunze, als Arbeitersohn ein Zögling des DDR-Staats, in dem er aufwuchs, hatte ein erkennbar förderungswürdiges Talent. Doch ein bornierter Kulturapparat glaubte, von allen Wortkünstlern klassenkämpferische Parolen einfordern zu können, ließ den jungen Poeten nicht schreiben, was dieser schreiben wollte: zarte Verse, in denen Naturbilder und Liebesstimmungen, oft beides in schöner Verquickung, zum Ausdruck drängten:
An der Thaya, sagst du, überkomme dich
„undefinierbare sehnsucht“.
Gehn wir in den fluß,
die sehnsucht definieren.
Nach den damaligen Vorstellungen der Kulturfunktionäre seines Landes sollte Kunze nicht einen solchen lyrischen Müßiggang betreiben, sondern Nützliches für den sozialistischen Aufbau leisten. Das brachte ihn in Opposition zu den politischen Linienrichtern, denen er, der arglose Landschafter, bald seine defensive Sentenz entgegenhalten mußte: „Ich bin des regenbogens angeklagt…“ Der weitere Verlauf der Dinge ist bekannt. Der Lyriker, der einfach ich und du, doch nicht wir sagen wollte, wurde durch den Druck von außen in die Haltung einer Gegnerschaft hineingezwungen, und in dieser Rolle ging er mehr und mehr auf – auch als das Schreiben von Natur- und Liebesgedichten längst keinem Tabu mehr unterlag.
Eine kräftigere Begabung hätte sich an diesem Punkt der allgemeinen Entwicklung wieder stärker auf sich selbst konzentrieren können. Doch Kunze nahm die Provokation als Dauerherausforderung an und erweiterte nun sein Repertoire um jene „externen“ Themen, mit denen er bald mehr von sich reden machte als mit seinen subtileren Arbeiten:
Im mittelpunkt steht
der mensch
Nicht
der einzelne
Solche Epigramme, wie sie auch Günter Kunert schrieb, enthielten die Diagnose von Sachverhalten, die an sich auf der Hand lagen; doch die Stupidität, mit der in der DDR politische Didaktik betrieben wurde, setzte Abwehrmechanismen in Gang. Und um der trockenen Lehrgangssprache der Parteikader zu begegnen, bemächtigten sich die Poeten des lakonischen Brecht-Stils, den sie inhaltlich lediglich umdrehten, um ihn zu einer Waffe gegen die Spruchbandverfertiger zu machen. Die Gefahr bei dieser Art von Dichtung bestand und besteht allerdings darin, daß sie sich im dauernden Clinch mit denen abnützt, die sie niederringen will.
Kunze verlor allmählich das poetische Augenmaß. In seinem Gedichtband Zimmerlautstärke von 1972 war seine Lyrik bereits bei einer Epigrammatik angekommen, die auf bedenkliche Weise zugleich kurzatmig und trivial war. Der Autor hatte seinen Feind, den DDR-Staat, und dieser hatte ihn. Doch beide vermochten sich schon längere Zeit nichts Neues mehr zu sagen: Schikanen, ständige Verletzungen des Postgeheimnisses und auch Bedrohungen dort; gereizte Antworten in lyrischem Stenogrammstil hier.
Dem Dichter Kunze bekam dieser unwürdige Zustand nicht. Während etwa Sarah Kirsch mittlerweile ihre vitalen und welthaltigen Gedichte in Dur wagte, verwandelte sich Kunze nach und nach in einen parolenhaften Anti-Parolendichter, über den sich hauptsächlich die Kritiker in der Bundesrepublik freuten, die sich nun ausführlich mit ihm beschäftigen konnten, ohne dabei schwierige ästhetische Fragen behandeln zu müssen.
Das Leichte, Zarte, mit dem der junge Poet seine – damals noch nicht sehr zahlreichen – Leser zu verzaubern gewußt hatte, verflüchtigte sich zunehmend. Und der Verfasser von Texten wie „Nach einem Regen in Mělník“, „Kinderzeichnung“, „Gruß F. P.“, „Dorf in Mähren“, „Einladung zu einer Tasse Jasmintee“, „Auf dich im blauen Mantel“ sowie den „Variationen über das Thema ,die Post‘“ verbiß sich in seine Widersacher, denen er – und das war seine Tragik häufig nichts literarisch Bemerkenswertes entgegenzuhalten wußte:
Die redner reden
das rot von den fahnen
Die erleuchteten fenstersimse der schule
unterstreichen bis in die nacht
Diese Miniatur mit dem Titel „Feiertag“ ist in ihrer angestrengten Parabolik typisch für viele Gedichte aus Zimmerlautstärke.
Dieser lyrische Marginalienstil setzt sich auch in Kunzes neuem Versband Auf eigene Hoffnung fort, in einem Buch, das jetzt mit fast zehnjährigem Abstand – und vier Jahre nach der Übersiedlung des Autors in die Bundesrepublik – erscheint.
Zum kurzen Poem gehört, will es nicht vertrocknen, sondern sich dauerhaft über aktuelle Anlässe hinaus behaupten, Bildhaftigkeit, die den Umraum illuminiert. Kunzes Dichtung aber ist bilderarm. Der Aphorismus, ja das bloße Aperçu beherrscht das Terrain; und man fragt sich unwillkürlich, wie diese Texte wohl wirken würden, läse man nicht sogleich die Umstände mit, deren hanebüchenem Vorhandensein der Autor einen wesentlichen Teil seines Ruhmes verdankt:
Ins geröll
springen
Oder es meiden
Das ist ein komplettes Gedicht, und sein Titel und Untertitel sind länger als die poetische Nichtigkeit selbst: „Amulett aus dem Gebirge (gegen äußere und innere Verletzungen)“.
Kunze ist mit den Jahren in die Pose eines Autors hineingewachsen, der jedes Wort, das er hervorbringt, für eine Offenbarung zu halten scheint. Aus einem ursprünglich höchst bescheidenen Menschen, der liebevoll und brüderlich mit den Erscheinungen der Welt umging, ist eine Art Seher geworden, ein Hoherpriester seiner selbst, der zwischen sich und seinem Publikum eine Sperrzone der eigenen Größe errichtet:
Und wieder verharre ich
reglos
Euren tadel daß ich zeit vergeude
weise ich zurück
Stille häuft sich an um mich,
die erde fürs gedicht…
Weil ihn die Kulturbürokraten der DDR einst nicht haben absichtslos singen lassen, mauserte sich dieser schlichte Lyriker zu einem gefeierten Verkünder, dem seine Bewunderer im Westen unentwegt Verse entlocken möchten. „Ich finde, es ist höchste Zeit, daß es wieder etwas Neues von Ihnen zu lesen gibt.“ Diesen und einen anderen gutgemeinten Brief von Marcel Reich-Ranicki stellt der Autor nicht ohne Eitelkeit als Motto einer Replik voran, in der er in lyrischem Zeilenbruch uns allen bedeutet:
Höchste zeit kommt von innen
Höchste zeit ist, wenn die kerne
schön schwarz sind
Und das weiß zuerst
der baum
Kunze hat seine poetische Unschuld verloren, diese Gabe, die ihn zu einem Medium seiner Eingebungen machte. Seine Person schiebt sich in den Vordergrund: „Sie kommen, den ruhm zu berühren.“ Oder: „Sie wollen nicht deinen flug, sie wollen / die federn.“ Es kann sein, daß der Autor den falschen Umgang hat. Denn sicher gibt es auch Leute, die vor allem „den flug“ von ihm zu sehen wünschen: das leichte hohe Gleiten durch die Lüfte. Doch Kunze führt die aeronautischen Künste seiner Imagination nur noch selten vor. Ist das aber wirklich unsere Schuld – oder ist es nicht vielmehr sein Problem?
Viele der Texte wirken wie ausgepreßt und enthalten dennoch keine Konzentrate, keine wertsteigernden Essenzen, sondern bloß Gedankenspelzen; und dieser Mangel an Themen verbirgt sich hinter einer großsprecherischen Gestik, die auffällig mit der poetischen Magerkeit kontrastiert.
Immer wieder gefällt der Autor sich in der Haltung des Moralisten. Und in einigen Gedichten wird die – auch schon früher angewandte – Methode praktiziert, einfache Vorkommnisse, die wenig poesieträchtig sind, in steifen konjunktivistischen Konstruktionen vorzutragen: „Betrunkene rowdys hätten versucht / unruhe zu stiften in K., meldete am morgen / die presseagentur der hauptstadt…“ Sogar völlig ungraziöse Prosasätze werden gelegentlich zu Versen zerhackt, sehr zum Schaden des freien Verses, der durch solche Beispiele von seinen zahlreichen Gegnern zu etwas wirklich leicht Mißkreditierbarem wird:
Niemand wird die entfernung hören
zwischen dem finger des orgelbauerlehrlings, der beim stimmen dem intonateur
die taste hält, und dem finger dessen, der sie anschlägt
im konzert…
Gewiß trifft zu, was der Verlag mitteilt: daß das Gedicht auch für diesen Autor „den Stabilisator und Orientierungspunkt seines Ichs“ bildet. Doch für den Leser ergibt sich aus der Lektüre von Kunzes neuen Gedichten nur ein vergleichsweise geringer Gewinn. Bestimmte religiöse Motive werden bei seelisch Gleichgestimmten zweifellos ein Gemeinsamkeitserlebnis auslösen, so wie das – auf anderer Ebene – bei den politischen Texten der Fall war und ist. Jenseits von Glaubenspostulaten stellt sich jedoch die Frage der künstlerischen Qualität. Kunze ist immer noch dort am überzeugendsten, wo er sich für die sensualistischen Angebote seiner Umwelt offenhält:
… von erinnerungen überredet
an den großen regen der unser
erstes gemeinsames dach war…
Oder, angesichts einer langen Schlange von Jets, die er auf dem Flughafen in Atlanta in Startposition sieht: „Sie stehen an / nach himmel.“
Die gelungenste Metapher des ganzen Bandes allerdings, scheint mir, stammt nicht vom Autor selber, sondern von seiner alten Mutter, die während eines Ausflugs in die Alpen, als die Gondel von einer Wolke eingehüllt wird, ausruft: „Wie wenn man einen kessel weißes wäscht und macht / die waschhaustür nicht auf.“ Daß diese unabsichtlich gesprochenen Worte am grünen Holz der Poesie gewachsen sind, steht Kunze selber vor Augen, denn er fügt hinzu:
Hättest du den weg verloren.
an ihren gleichnissen könntest du dich
nachhaustasten.
Hans-Jürgen Heise, Die Zeit, 18.9.1981
Verse ohne Wunde
Am 13. April 1977 mußte Reiner Kunze die DDR verlassen. Er kam nach München und wohnt seit 1978 über der Donau unterhalb Passau. Man hat lange auf neue Gedichte des deutschen Büchner- und österreichischen Traklpreisträgers gewartet. Aber Kunze brachte kein abgeschlossenes Manuskript im Koffer mit. Und ein Zugeständnis an den Literaturmarkt wollte er nicht machen.
Im Dezember 1978 schrieb ihm ein Redakteur:
Ich finde, es ist höchste Zeit, daß es wieder etwas Neues von Ihnen zu lesen gibt.
Der Redakteur wiederholt seine Bitte um ein neues Manuskript im Mai 1980. Kunze antwortet mit einem poetischen „Apfel“ für den Redakteur.
Höchste zeit kommt von innen
Höchste zeit ist, wenn die kerne
schön schwarz sind
Und das weiß zuerst
der apfel.
Und da wär’ es auch schon, das schmucklose, lakonische Gedicht Kunzes, der das Wort wörtlich nimmt, das Bild rundet, den Vers aphoristisch schleift und ihm, wenn möglich, eine metallisch gehärtete Ironie einschießt.
Kunze, das war zu erwarten, läßt sich von niemandem vereinnahmen, nicht von dem ihm wohlgesinnten Politiker, der am Telephon anfragt:
Könnten Sie, sagte die stimme,
nicht auch etwas schreiben
in unserem sinn?
Das poetische Protokoll entlarvt die komplizenhafte Zumutung. Ähnlich muß der Autor einen „geistlichen Würdenträger“ entlarven, der den „Künstlern ins Gewissen“ redet:
Er sagte nicht: seid
schöpfer
Er sagte: dient
dem glauben
So gering ist sein glaube
in die schöpfung.
Kunze hat sich keiner Wählergemeinschaft, keiner Kollegenschaft ehemaliger DDR-Autoren, keiner sozialistischen oder anderen Gruppe angeschlossen. Und er bekam es zu spüren. „Auch die landschaft, werden sie behaupten, dürfe / nicht mehr nur sein, auch sie / müsse dafür sein oder dagegen“ steht in einem lyrischen „Tagebuchblatt 80“. Ironisch meldet Kunze im „Ideologenwunschbild hier wie dort“:
schriftsteller K. angetreten, Kopf bei fuß.
Die erste Versgruppe, „des fahnenhissens bin ich müde, freund“, stammt noch aus den Jahren 1973 bis 1975 in der DDR. Da steht die schöne Huldigung an Bach.
Zu füßen gottes, wenn
gott füße hat,
zu füßen gottes sitzt
Bach,
nicht
der magistrat von Leipzig.
Die neuen Gedichte setzen, mit einem zeitlichen Sprung, 1978 ein. Sie stehen unter der bekennenden Überschrift „auch dies ist mein land“. Auf Nachrichten der Ankunft, der Orientierung, der Heimatsuche und des Befremdens über die grußlose Kälte folgen als Hauptkorpus Reisegedichte. Es sind Eindrücke, Betrachtungen, Bildvergleiche, Porträts, Kürzestberichte von Reisen nach England, Dänemark, Norwegen, den Vereinigten Staaten und Kanada und natürlich nach Österreich, Mähren, Prag. Der Genius loci, Passau, kommt zu poetischen Ehren. Aus den stärksten Reisegedichten spricht ein poetischer Maler. Er berichtet aus den schottischen „Highlands“:
Einmal, noch vor erschaffung des menschen
versuchte sich gott als kupferschmied
So entstand
der herbst in den Highlands…
Zum Lebens- und Glaubenssymbol wird die „Stabkirche zu Lom“:
Ihr maß ist der baum
Ein gewachsenes maß dem man
gewachsen war…
Kunze ist ein Dichter der Geduld und der Stille. „Stille häuft sich an um mich, / die erde fürs gedicht“, schreibt er poetologisch. Es ist kein Zufall, daß ihn in der Landschaft die Stille anzieht und die stärksten Landschaftsgedichte – nicht unähnlich Handkes Prosa – zu „friedensstiftenden Formen“ werden. Weniger beeindrucken mich die amerikanischen Straßen- und Autogedichte. Geschwindigkeit, Bewegung einzufangen ins Wort, ist Kunzes Sache nicht. Zu einem intensiven Naturanschauungsgedicht formt sich dagegen das „Beschneiden der Apfelbäume im Winter“. Vorgang, Beschreibung und humaner Sinn bilden ein klassisches Ganzes, während die demütig leuchtende „Silberdistel“ erbaulich gerät. Form und Sprechhaltung haben sich durch den Länderwechsel kaum verändert. Der geduldige Blick, der lange schaut, sucht den kürzesten Ausdruck. Kunze liebt den lyrischen Aphorismus, das Epigramm. Er treibt den Denksinn aus dem Bild. In seinen Gedichten muß nichts sprachlich aufgefüllt, angereichert, aktualisiert werden. Aus der Nähe zu Natur, Landschaft, Menschen spricht ehrfürchtige Distanz. Wortaskese und Wortironie, Wortatem und -hoffnung formen Kunzes unverwechselbaren Vers. Er bekennt provozierend in seinem „Credo an einem guten morgen“:
Es gibt ihn, den vers ohne wunde.
Paul Konrad Kurz, aus Paul Konrad Kurz: Zwischen Widerstand und Wohlstand. Zur Literatur der frühen 80er Jahre, Verlag Josef Knecht, 1986
„Dasselbe zu schaffen, das ein anderes ist“
– Reiner Kunzes polnische Gedichte. –
August 1944, Juni 1956, März 1968, Dezember 1970, August 1980, Dezember 1981 – der polnische politische Kalender ist voll von solchen geheimnishaften Erinnerungszeichen; Monatsnamen, die woanders gewöhnlich den Zeitablauf markieren, werden da zu einem geheimen Kode umfunktioniert. Wofür steht dieser Kode eigentlich, wenn nicht für einen wiederholten Alleingang der Polen gegen den Strich des politischen Kalküls?
Dieser politische Kalender polnischer Rebellionen scheint aber keine Renegatentermine für deutsche linke Intellektuelle überliefert zu haben. Uwe Kolbe, der Autor dieses Terminus, erinnert sich an sein Solidarność-Erlebnis, das auch bei ihm nicht dazu gereicht hat, sich vom „Traum und Utopie der reinen Lehre“ zu lösen:
Wir treffen den jungen Mann erneut nach Ostern 1981. Er ist eben aus Polen zurückgekehrt. (…) Und stolz erzählt er, was er weiß: etwas von der Wahrheit aus Polen. Er sagt: die Wahrheit. (…) Die Wahrheit des jungen Mannes sah aus wie ein Zwilling seiner Begeisterung. Begeistert ist er, wie sich Polen, ob nun in der neuen Gewerkschaft oder in der alten, ob Parteimitglieder oder nicht, zusammensetzten und überlegten, wie sie ihr Land aus dem sozialistischen Schlamassel holen, ohne daß sowjetische Panzer rollten. Er hatte das DDR-deutsche Kontingent für diese Option schon gesehen, Eisenbahnzüge voller Panzer in Frankfurt/Oder, bereit zum Einsatz im Osten. Er ist begeistert trotz der Irritation, was den Katholizismus betrifft, trotzdem ihm patriotische Emphase gar nichts sagt. Ein klein wenig denkt er schon historisch, sprich tolerant. Vor allem ist er Menschen begegnet. Aber auch das war es nicht. Es reichte nicht.
Ihre Wahrheiten aus Polen haben viele deutsche Dichter, nicht nur in Bezug auf die Solidarność-Bewegung, auf unterschiedliche Zwillingsformeln gebracht. Danzig und Thorn, auf die drei Gedichte Kunzes mit polnischen Bezügen rekurrieren, sind in vielen Texten deutscher Autoren Gedächtnisorte für die deutsch-polnische Begegnung und für die deutsche Geschichte. Im Raum zwischen Thorn und Danzig oder im benachbarten Masuren, in einer Gegend, die einst den Namen Ost- und Westpreußen trug, sind literarische Landschaften der deutschsprachigen Literatur auch nach 1945 zu finden, u.a. bei Johannes Bobrowski, Günter Grass und Siegfried Lenz, um nur ein paar Namen zu nennen.
In seiner in den 70er Jahren unternommenen Reise nach Gdansk suchte Volker Braun einen Ort auf, an dem der Zweite Weltkrieg seinen Anfang genommen hatte. Der Zwilling seiner Begeisterung für den als „meine mögliche Heimat“ apostrophierten Raum war das Leiden an der deutschen Geschichte, verschränkt mit dem Traum von einer zukünftigen Gemeinschaftsutopie, ein Traum, für den die Utopie Sarmatiens als einer vergangenen Gemeinschaft vieler Völker ein Vorbild abgab. Dieser Traum verdankte sich der Bobrowski-Lektüre, die ihn dann die „mit Zartsinn“ von den Polen wiederaufgebaute „Filmkulisse“ der berühmten, infolge des Krieges zerstörten Danziger Schmalhäuser als eine Voraussicht auf das Märchen von der „zukünftigen Welt aus Arbeit vieler“ wahrnehmen ließ.
Sein Versuch, sich Polen anzunähern, ist weitgehend in den der deutschen Kultur verpflichteten Denk- bzw. Sinnbildern befangen. Selten ging sein Blick über jene Konstrukte hinaus. Beim Spaziergang durch die Danziger Altstadt z.B. riß ihn zwar ein akustisches Signal für kurze Zeit aus seiner durch das Kulturgedächtnis vorgeprägten Illusion („Welche Laute hier, welch Volk“); in Folge dieses Intermezzos strömte jedoch wiederum eine von der Wahrnehmung der fremden Sprache ausgelöste Flut von Geschichtsbildern, und sein Blick wanderte wieder „an den alten Fleck“. Sich in die Polen gedanklich hineinzuversetzen bedeutete nun für ihn, sich aus Solidarität mit den Kriegsopfern selbst als polnisches Opfer zu imaginieren.
Diese Identifikation mit dem Polnischen als ein Sich-Hineinversetzen in das polnische Opfer hatte in vielen, in der DDR entstandenen Texten die Funktion eines wichtigen Sühnezeichens. Der Versuch, die Grenze zum Fremden aufzuheben, führte allerdings selten dazu, dessen Denkkategorien auch in denjenigen Bereichen zu reflektieren, die vor dem Hintergrund der eigenen Fragestellungen irritierten oder gar irrelevant erschienen. Auch wenn manche Autoren, wie Wolf Biermann, die DDR verließen, war ihr Interesse an den polnischen Belangen stets in den durch die deutschen Diskurse vorstrukturierten Wahrnehmungshorizont involviert, worin sie übrigens der Haltung ihrer westdeutschen Kollegen in nichts nachstanden. So ist auch Biermanns Plädoyer für die streikenden Arbeiter in Polen ein leidenschaftliches Parteiergreifen im linken deutschen Diskurs um die Sozialismus-Utopie.
Im 4. Kapitel seines Buches Verdrehte Welt – das seh’ ich gerne, betitelt „Gott in Polen“, gilt Biermanns Aufmerksamkeit sowohl dem Konnex: „Karl Marx und die Schwarze Madonna“ wie auch den linken deutschen Intellektuellen, deren Zurückhaltung nach der Einführung des Kriegsrechts in Polen er als eine „Einmischung auf seiten der Konterrevolution“ deutet:
Laß man! ja, laß!
Besser mit Gott im Herzen
Besser mit der Schwarzen Madonna Revolution gemacht
Als mit Marx im Arsch und zum Hohn
– die Konterrevolution
Als ein „Vorher“ steht diesem Bild vom menschlichen Körper, dessen Teilen eine symbolische Wertordnung eingeschrieben ist, eine mystisch bzw. religiös anmutende Naturidylle gegenüber. Die im Aufwind kreisenden Störche an den masurischen Seen, wie sie sich ins gleißende Licht hochtragen lassen, bis sie, ins Körperlose umflutet, sich den Augen entwinden, sind im Kontext der in den beiden deutschen Staaten geschriebenen Polenlyrik als eine Chiffre für „befristete Transzendenz des eigenen Daseins, Auszug aus der hiesigen Lebensordnung in das Abenteuer einer anderen“ auch aus der zeitlichen Distanz gut lesbar.
Erst vor den soeben flüchtig skizzierten Hintergund der gegenwärtigen deutschen Polenlyrik gestellt, zeigen die drei polnischen Miniaturen Kunzes ihre erstaunliche Unvoreingenommenheit, sprich: Toleranz, die den auf Polen gerichteten Blick dieses Dichters kennzeichnet.
Mit seinen, wie es Jürgen P. Wallmann einmal formulierte, „Seismogrammen der Erschütterung“ steht er zwar fest in jener Tradition der deutschen Lyrik mit polnischen Bezügen, seine völlig anders fokussierte Wahrnehmung des Polnischen entzieht sich jedoch dezidiert ihrem Zugriff.
DIE KÜSTE VON DANZIG
(Dezember 1980)
Daß in ihrer armbeuge
gewalt steckt,
wußten wir
Nun zeigt ihr ellenbogen
den arm der geschichte,
und furcht erfaßt uns nicht nur um jene,
die sich auf ihn zu stützen wagen
Die Wahrnehmung der Danziger Küste steht unter dem Primat des Polnischen. In der Anmerkung zu diesem Gedicht wies der Autor auf Streiks der Danziger Arbeiter im Dezember 1970 hin, die, wie man vielleicht ergänzen darf, ein tragisches Finale fanden, als unter den bis heute nicht restlos geklärten Umständen Polizei und Militär auf die Arbeiter schossen, die auf Appell der örtlichen Parteibehörde, um ihren guten Willen und ihre Kompromißbereitschaft zu zeigen, sich zur Frühschicht gemeldet hatten. Es gab mehrere Tote. Der im Untertitel des Gedichts und in der dem Text folgenden Anmerkung gegebene Hinweis lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers auf die beiden „polnischen Dezember“ als den primären geschichtlichen Kontext der Lektüre, ohne den September 1939 als einen weiteren Hintergrund für den Konnex: Gewalt, Geschichte, Furcht völlig außer Kraft zu setzen.
Sich in die Polen gedanklich hineinzuversetzen, ohne die Differenz zwischen „wir“ und „sie“, zwischen den Wahrnehmenden und den Wahrgenommenen zu verwischen, wird erst dann möglich sein, wenn nicht die Schrift des eigenen Kulturgedächtnisses als Kontext herangezogen, sondern das Wahrgenommene auf die ihm eingeschriebene Logik hin befragt wird – freilich in den von der eigenen Kultur vorgegebenen Interpretationsmustern. Das lyrische Subjekt, das im Namen seiner Gemeinschaft die Stimme erhebt, unternimmt keinen Versuch, sich selbst im polnischen Gewand zu inszenieren oder das Fremde in den eigenen Erwartungshorizont einzubinden. Die Erschließung des Fremden als „Betrachtung eines Bildes“, als ein Mit- und Weiterdenken in seiner inneren Logik führt, wenn auch auf Umwegen, zu einer weiteren Lesart des Polnischen, die Bobrowskis lyrischem Werk ebenfalls innewohnt. Das mehrfach kodierte metonymische Bild der Armbeuge in dem analysierten Gedicht zeigt auf der anderen Seite eine gewisse Ähnlichkeit mit der frühen DDR-Lyrik mit polnischen Bezügen auf, mit ihrem vorherrschenden Topos der Hände, die sich über die Grenze als ein Friedenszeichen strecken.
Worauf bezieht sich die in der ersten Gedichtzeile angesprochene Armbeuge? An die Innenseite des Ellenbogengelenks erinnert einerseits das Bild der Danziger Bucht auf der Landkarte, mit der Stadt als ihrem Ellenbogen. In Frage kann aber auch das Beugen der Arme im Liegestütz als ein möglicher Interpretationskontext kommen. In vielen Fernsehbildern schließlich war darüber hinaus ein charakteristisches Protestzeichen der streikenden Arbeiter übertragen. In die Armbeuge des linken Arms legten sie die rechte Hand, und bewegten dabei den erhobenen linken Unterarm heftig hin und her. In seiner aphoristischen Genauigkeit schließt das Gedicht keinen der drei möglichen Kontexte aus; alle drei führen in ihrer inneren Bewegung auf getrennten Wegen zu einem prägnant umrissenen Sinnzentrum hin.
Wird der Ausdruck „ihre Armbeuge“ auf die im Titel des Gedichts angesprochene Danziger Küste bezogen, so zeigt sich diese als ein Gleichnisbild. Die in ihrer Armbeuge steckende, vergangene (vgl. das Präteritum der letzten Strophenzeile) Gewalt läßt mit Hilfe der Anmerkung und des Untertitels an den polnischen Monatskalender denken, in dem die politischen Rebellionen verzeichnet sind, und in einem weiteren Schritt an die vorvergangene Gewalt der Weltkatastrophe, die in Danzig ihren Anfang nahm und im Endeffekt eine Gewaltordnung herbeiführte, gegen die sich die Küste, sprich: ihre Bewohner, in rhythmischen (Dezennium) Intervallen stemmt und nur mit Gewalt zurückgedrängt wird. Nun wird ein Versuch unternommen, die Logik der Gewalt zu umgehen, und den Arm der Geschichte als eine Stütze zu gebrauchen. Dies löst allerdings bei allen, bei den Zuschauern wie bei denjenigen, die jene schwere Übung durchführen, Angstgefühle aus. Die ganze Aufmerksamkeit der Betrachter wird nun auf die Stadt als den Ellenbogen der Küste, sprich: auf ihre Bewohner, gelenkt. Wird er halten? Oder muß sich der Arm der Geschichte wieder einmal beugen? Welche Folgen würde jener Sturz diesmal nach sich ziehen?
Weil das Gleichnisbild der Küste anthropomorphisch strukturiert ist, kann in der Lektüre ein geradezu nahtloser Übergang zum anderen Bild, dem der Turnübung, hergestellt werden. Der Ausdruck „ihre Armbeuge“ wird dann auf die Küstenbewohner, die streikenden Danziger Arbeiter, bezogen. In dem Liegestütz als Gleichnis für die zyklisch wiederkehrenden Erhebungen, die dann immer wieder in einer Niederlage münden, wird die innere Spannung zwischen der Gewalt und der Gegengewalt sichtbar. In den Liegestütz gehen, bedeutet nämlich keinen Zusammensturz; die innere Logik dieses Bildes von einer zyklischen Bewegung zwischen oben und unten weist auf beide Positionen als nur unter Aufbietung aller Kräfte aufrechterhaltbare Zustände hin. Im Bild des in der Armbeuge-Position liegenden menschlichen Körpers ist die Gewalt einerseits als eine von außen auf diesen Körper einwirkende Kraft denkbar (so daß dieser in der Position dicht über dem Boden bleibt und die aufrechte Haltung nicht mehr annehmen kann), und andererseits als die innere Kraft dieses Körpers, der sich gegen die äußere Gewalt wehrt (und dabei so viel Kraft aufbringen kann, daß er nicht zusammenbricht und nicht ganz zu Boden geht). Der springende Punkt dieses Kraft- und Machtgefüges, der Ellenbogen, zeigt „den arm der geschichte“. Auch da ist die Anthropomorphisierung kein im Leerlauf begriffener Kunstgriff, sondern Ergebnis einer genauen Überlegung.
Wer denn macht die Geschichte, wenn nicht die Menschen? Die Kraft jenes Armes der Geschichte setzt sich aus all den agierenden menschlichen Armen mit all ihrer Widersprüchlichkeit zusammen. Es nimmt sodann nicht wunder, wenn seine Bewegungen die Menschen mit Furcht erfüllen. In der letzten Strophe ist dieses Gefühl sowohl ein Zeichen der Anteilnahme (die Furcht um jene, die das Wagnis auf sich genommen haben, am Rad der Geschichte zu drehen, was ja nicht ungefährlich ist), als auch des Abstands, der Zurückhaltung (die Furcht eben nicht nur um jene).
Der Tatbestand schließlich, daß die meisten von uns ihre Bilder von den politischen Ereignissen in Danzig Anno 1980 nicht etwa einer unmittelbaren Berührung mit dem Geschehen, sondern vielmehr einer Vermittlung durch die Massenmedien zu verdanken haben, führt zu der dritten Interpretationsmöglichkeit der Bildlichkeit dieses kurzen Textes. Die Akzentverschiebung von der Armbeuge zu dem Ellenbogen erinnert an eine ebenfalls charakteristische Abfolge in den vom Fernsehen live übertragenen Bildern der Massenproteste. Das charakteristische Handzeichen der Protesthaltung (rechte Hand in der linken Armbeuge) wurde da allmählich von Berichten über langwierige Gespräche am Verhandlungstisch abgelöst mit dem ebenfalls charakteristischen Bild der ermüdeten Gesprächsteilnehmer, die ihre Köpfe oft auf den Arm stützten.
In den beiden dem ermordeten Priester Jerzy Popiełuszko gewidmeten Gedichten: „Die Verurteilten von Thorn“ und „Die Lehre von Thorn“ treten die Medienbilder unverhüllt als Textvorlage in den Vordergrund. Das erste wird mit einer Anmerkung versehen, in der im Stil einer Zeitungsmeldung berichtet wird, daß das Thorner Gericht die Geheimpolizisten für schuldig befunden hat, den Priester entführt und vorsätzlich getötet zu haben. Das Gedicht stellt eine Art Kommentar zu jener Nachricht dar. Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich eine dialogische Spannung, die dann im semantisch-syntaktischen Parallelismus der Strophen eine Fortsetzung findet. Die Strophen beziehen sich aufeinander; jede ist als eine Replik gedacht.
Der im Bild des „großen Landes“ sichtbare Anthropomorphismus erinnert an die im Gedicht „Die küste von Danzig“ untersuchte Rolle dieses Stilmittels in Bezug auf das Bild der Geschichte. Auch politische Handlungen werden von Menschen vollzogen, auch Politik beruht auf Entscheidungen, die von Menschen getroffen sind. Die Entscheidung der Politiker aus dem „großen Land“, auf die Verurteilung der polnischen Geheimpolizisten vorerst nicht zu reagieren, findet im Bild eines reglosen Körpers eine Umsetzung. In dieses Bild wird ein Paradox einmontiert. Indem das „große Land“ reglos bleibt, kehrt es dem Geschehen den Rücken zu. Trotzdem weiß jeder: „es liegt wach“. Auch der Ausdruck „Ihre Hoffnung“ ist doppelt kodiert. Es ist nicht nur die Hoffnung der Geheimpolizisten auf eine Einmischung des großen Landes in ihre Angelegenheit, die enttäuscht wird, sondern auch ein möglicher Grund für ihr Verbrechen.
Die dialogische Spannung im Gedicht „Die Lehre von Thorn“, dessen Vorlage ein Fernsehbild ist, ergibt sich aus dem Gegensatz zwischen der sprachlichen Mitteilung und der Körpersprache des berichtenden Beamten. Während er die Meldung erstattet, hat seine Hand aus der am Tatort vorgefundenen Schnur bereits eine Schlinge gemacht.
Die Wahrnehmung des Polnischen wird in den drei Miniaturen Kunzes nur in einem beschränkten Maß durch die Schrift des deutschen Kulturgedächtnisses konditioniert. Es ist kein Dialog vor der polnischen Kulisse mit der eigenen Kulturgeschichte, keine Geste der kulturellen Erinnerung an vergangene Berührungen mit dem polnischen Fremden, keine Reise in die deutsche Vergangenheit mit ihrer Last der geschichtlichen Schuld.
Seine Gedichte sind nichtsdestoweniger ein wichtiger Beitrag zum deutschen Polendiskurs. Sie stehen in jener wesentlich von Bobrowski mitgeprägten Tradition der deutschsprachigen Lyrik, innerhalb deren der Versuch unternommen wurde, sich dem polnischen Nachbarn dadurch zu nähern, daß man sich bereit zeigte, die Welt mit dessen Kategorien für eine Weile zu denken und sich nicht mehr allein von der Logik der von der eigenen Kultur hervorgebrachten Bilder leiten zu lassen. Der Dialog über Polen, das Land der größeren Freiheit und der größeren Hoffnung, ist in den drei analysierten Texten als Betrachtung der durch die Massenmedien übermittelten Bilder bewerkstelligt. Damit treten der Betrachter und sein Leser über die Schwelle des jeweils Eigenen hinaus. Der Dialog zwischen ihnen ist durch die Struktur der Texte begünstigt. Mit ihrer aphoristischen Genauigkeit und dialogischen Spannung, mit ihrer mehrfachen Kodierung der einzelnen Worte und Parodoxie der Bilder, die zugleich unbestimmt und präzise sind, laden diese Gedichte gerade zum Mit- und Weiterdenken in der Logik der angebotenen Bilder, so daß einzelne Lektüren miteinander kollidieren können.
Mit der Toleranz und dem Respekt gegenüber dem Leser, der in seinen Möglichkeiten durch keine „Logik der überdeutlichen Verhältnisse“ gestört oder eingeschränkt wird, korrespondieren die gleiche Toleranz und der gleiche Respekt in der Darstellung des Polnischen, das nicht in die Perspektive einer kulturellen Fremde gestellt, sondern in seinem menschlichen Format gezeigt wird, als dasselbe, das ein anderes ist.
Elżbieta Dzikowska, aus: Marek Zybura (Hrsg.): Mit dem wort am leben hängen… Reiner Kunze zum 65. Geburtstag, Universitätsverlag C. Winter, 1998
Laudatio auf Reiner Kunze, den Geschwister-Scholl-Preisträger
München am 24.11.1981
Loben ist schwer. Das Wort „Laudatio“, feierlich-lateinisch, weist auf ältere Zeiten, wo man das Rühmenswerte gerne sammelte und noch nicht auf kritisches Bewußtsein erpicht war: De laudandis nil nisi bene. „Zustimmung“, schrieb kürzlich ein jüngerer Kollege im SPIEGEL, „wirkt fast immer schwächlich.“ Der preisende Kritiker, so fuhr er fort, möchte am liebsten unsichtbar werden, verschwinden in einem auf das Werk weisenden Gestus; Hier! Das lesen! – Da macht zum Glück ein älterer Kollege Mut: „Was ich nicht loben kann, davon sprech ich nicht“, hat er unumwunden in den ,zahmen‘ Xenien erklärt (die ,bösen‘ Xenien hatte er längst hinter sich). In den Noten und Abhandlungen zum West-Östlichen Divan des gleichen Kollegen steht der schöne Satz, es sei der menschlichen Natur gemäß und ein Zeichen ihrer höheren Abkunft, daß sie das Edle menschlicher Handlungen und jede höhere Vollkommenheit mit Begeisterung erfasse.
Also – zwischen Bedenken und Ermunterung, packen wir’s an, hüten uns vor dem Dick-Aufgeschmierten und erwärmen uns an den Vorzügen, die standhalten, an dem, was Goethe „die höheren Vollkommenheiten“ heißt. Wenn „lobpreisen“ mit „Preis“ zusammenhängt, dann hat der Laudandus davon schon eine Fülle geerntet, seit 1968 einen tschechoslowakischen, einen bayerischen, einen schwedischen, einen schlesischen, einen österreichischen und den Georg-Büchner-Preis, der als der angesehenste unter den deutschen Literaturpreisen gilt. „Der hat doch schon so viele“, war denn auch eines der Bedenken, das dem Vorhaben, Kunzes letzten Gedichtband mit dem Preis der Geschwister Scholl auszuzeichnen, entgegenstand. Und, so setzen die Bedenklichen ihre Überlegungen fort, war dieser Preisregen auf den jungen Poeten nicht nur die Folge einer besonderen politischen Konstellation, seines Widerstandes gegen die Bevormundung in der DDR, seines Parteiergreifens für den Prager Frühling, seiner Absage und Ausreise? Hatte sich Kunze, eigentlich in der Sparte Naturlyrik eingetragen, nicht „nach und nach in einen parolenhaften Anti-Parolendichter verwandelt, über den sich hauptsächlich die Kritiker in der Bundesrepublik freuten, die sich nun ausführlich mit ihm beschäftigen konnten, ohne dabei schwierige ästhetische Fragen behandeln zu müssen“ (was dieser Rezensent offenbar nur sich selber zutraute). Der gleiche Kritiker begann seine Rezension mit dem zurechtrückenden Satz:
Es sind die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, die immer wieder minor poets vorübergehend den Stellenwert großer Dichter geben – einen Rang, mit dem sie und auch ihre Leser schließlich nicht fertig werden.
Dem will ich energisch widersprechen: Niemand ist auf den Gedanken gekommen, Reiner Kunze vorzeitig, auf Vorschuß in den Rang eines großen Dichters zu erheben. Ich rechne auf Ihre Billigung, wenn ich meine, daß das Prädikat „groß“ in der Lyrik der Nachkriegszeit mit Sicherheit nur den beiden Antipoden Benn und Brecht zukommt, vielleicht und versuchsweise Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Peter Huchel. Soviel poetae magni und maiores gibt es wahrhaftig nicht, als daß die Darmstädter Akademie jedes Jahr einen davon mit ihrem Preis auszeichnen könnte. Und außerdem: Zur Größe reift es sich heran!
Aber unser Dichter, so sagt sein Widersacher, ist nicht nur kleiner, als er zu sein vorgibt, er ist auch noch mager dazu.
Viele der Texte wirken wie ausgepreßt und enthalten dennoch keine Konzentrate, keine wertsteigernden Essenzen, sondern bloß Gedankenspelzen; und dieser Mangel an Themen verbirgt sich hinter einer großsprecherischen Gestik, die auffällig mit der poetischen Magerkeit kontrastiert.
Ein schmales Werk ist es in der Tat, drei Versbände, von denen zwei nicht mal die hundert Seiten erreichen, sparsam bedruckt, mal sieben Verse, mal zwölf Verse, auch schon einmal nur sieben Worte. Und seit den Sensiblen Wegen von 1969, murrt unser Kritiker, seien bis zum jetzt vorliegenden Band mehr als zehn Jahre vergangen, davon allein vier in der Bundesrepublik – dies so vorwurfsvoll gesagt, als verfüge die letztere unstreitig über den besseren Kunstdünger für Lyrik…
Ich sehe, ich bin dem Gesetz der Laudatio ganz untreu geworden, habe nicht das Rühmenswerte zusammengetragen, wie es sich gehört, und muß nun sehen, wie ich’s wieder geradebiege. Ich überlasse der Nachwelt, ob Kunze ein Maior oder Minor, und erörtere nicht, ob er nur mittelgroß oder überschlank ist, und sage nur: Er ist ein Dichter, und er will einer sein. Er nimmt das Wort ganz ernst, so ernst wie Hölderlin oder Baudelaire, und darum wäre nichts irriger, als in ihm so etwas wie einen Natur-, also Feld-, Wald- und Wiesen-Lyriker zu sehen, der aus Versehen in die hohe Politik geriet. Er nimmt eine Mission für sich in Anspruch, und zwar eine, die in gar keinem Fall einzuordnen ist in den Literaturbetrieb, in Markt und Messe, in das kulturelle Tagesgeschehen.
Hätte man den Kunze nur in Ruhe gelassen, wer weiß, wieviel Löwenzahn und Holderbusch er produziert haben würde zu unserer Freude – dieser Seufzer ist falsch. Kunze sah und fühlte von Anfang an Dichten als Widerstand gegen den Staat, gegen diesen Staat und seine Machthaber, den Dichter als den kleinen, womöglich auch noch schmalen David mit der Schleuder gegen den Koloß. Sein Naturtalent bediente sich der Natur, weil sie selbst widerständig ist, selb-ständig, ordnungswidrig mit ihrer Lebenskraft:
Greiz grüne
zuflucht ich
hoffe
Ausgesperrt aus büchern
ausgesperrt aus zeitungen
ausgesperrt aus sälen
eingesperrt in dieses land
das ich wieder und wieder wählen würde
hoffe ich
mit deinem grün
Das Grün in diesem Gedicht ist nicht das allegorische Hoffnungsgrün, nicht das alternative Polit-Grün, sondern die überwuchernde und überwältigende Kraft der Natur selbst – wie in dem Gedicht „Zuflucht noch hinter der Zuflucht“ aus dem Band Zimmerlautstärke, wo es von Gott, dem ratlos Befragten, heißt: „seine antwort wächst / grün durch alle fenster.“
Der Dichter, wie ihn Kunze versteht und verkörpert, ist der Widerständler schlechthin, die Gegen-Regierung schlechthin. Dazu gehören, je nach Land, verschiedene Sorten von Mut: der Mut gegen die Gewalt in der DDR, der Mut gegen die Verführung in der Bundesrepublik – und in beiden der Mut, bestimmte Tabuwörter wieder auszusprechen – zum Beispiel das Wort Gott.
Damit bin ich bei seiner letzten Gedichtsammlung, dem in der Bundesrepublik nach erst oder schon vier Jahren erschienenen Band Auf eigene Hoffnung. Die Bundesrepublik niemand wird es ihr verdenken – verzeichnet jeden namhaften von drüben zu ihr Gekommenen als Einnahmeposten. Aber Kunze ist auf der Hut:
Ein menschliches buch, sagte die stimme im telefon
Ich wartete ab
Trotz so vieler enttäuschungen
lag im ohr, der kleinen schmiede,
von neuem der steigbügel bereit
Könnten Sie, sagte die stimme,
nicht auch etwas schreiben
in unserem sinn?
Es klopft, in der Reihe der Werber, auch der geistliche Würdenträger an die Tür. Man hat läuten hören, daß Kunze der Religion nicht fern stehe. Und Kunze über ihn:
Er sagte nicht: seid
schöpfer
Er sagte: dient
dem glauben
So gering ist sein glaube
in die schöpfung
Sehr eilig – durchaus im mäzenatischen Sinne – hatte es ein anderer Dränger, der Mann von der Branche. Er fand, es sei höchste Zeit, Manuskripte zu schicken, man hat im Literaturbetrieb präsent zu sein. Kunze antwortete auf diese spezifischste aller Versuchungen für den Schreibenden:
Höchste zeit kommt von innen
Höchste zeit ist, wenn die kerne
schön schwarz sind
Und das weiß zuerst
der baum
Die Reifemetapher ist alt, aber, würde Kunze antworten, auch das Dichterhandwerk, der Dichterberuf, die Dichter-Berufung ist alt, und neu an meinem Gedicht ist nur eine etwas weiter getriebene Apfelkunde, das Wissen, daß die Apfelkerne erst bläßlich sind, dann bräunlich, ganz zuletzt schön, nämlich glänzend schwarz, und auf die Kerne, auf den Kern kommt es an. Dichten hat mit dem Kern, mit dem „Herz der Dinge“, mit dem „Alten Wahren“ zu tun und kann darum keine Rücksicht auf den Betrieb und nicht einmal auf die Kommandos des durchlauchtigsten aller Literaturkritiker nehmen. Kunze, heißt das, läßt sich auch nicht in Wohlwollen, in Wohlstand, in profitorientierte Erwartungshorizonte einspinnen.
Er hat in der DDR Mut bewiesen, zwar nicht den tollkühnen Mut der Geschwister Scholl, deren Köpfe fielen, aber doch den beständigen Mut des Widerspruchs, der zuerst die Stellung, dann die Stimme kostete. Er hat in der Bundesrepublik Mut gezeigt, als er, immerhin angewiesen auf Einkünfte aus literarischer Arbeit, sich nicht in München oder Hamburg oder Frankfurt, sondern bei Passau ansiedelte, das seine letzte bedeutende Rolle in der Literatur zur Zeit des Nibelungenliedes spielte, und als er es darauf ankommen ließ, daß das Establishment den Kopf schüttelte über seine altmodische, stifter-hafte Renitenz.
Dieser Mut nun hängt auf besondere Weise mit seiner Schreibweise, seinem Lakonismus, seiner ganz gegen die Suada der Zeit gerichteten Einsparung von Druckerschwärze zusammen. Wo Getöse ist, muß man lauter schreien, würde die schlüssige Empfehlung lauten. Kunze sagt: Wo die Verstärker aufgedreht werden, darf man höchstens in Zimmerlautstärke sprechen. Und auf die gleiche Weise setzt er gegen das Rauschen der Rhetorik die kurzen Sätze, die wiederhergestellten Wörter, die sich im Nach-Denken, nach dem Hören, entfaltenden Pointen.
Er hat das bei Brecht gelernt, er hätte es bei Günter Eich studieren können. Er könnte Erich Kästner zitieren, der kurz und bündig reimte:
Wer was zu sagen hat,
hat keine Eile.
Er läßt sich Zeit und sagt’s
in einer Zeile.
In diesem Sinne ist Kunzes Dichtungsstil durchaus nicht hölderlinisch, sondern eher lessingisch, nicht in Oden oder Elegien redend, sondern epigrammatisch. Das wäre an vielen Beispielen zu zeigen, die für den hier Vortragenden und sein Publikum zugleich den Vorteil hätten, daß sie kurz sind. Aber ich will zum Schluß ein etwas längeres Gedicht zitieren, zwölf Zeilen, eines, das von den Schwierigkeiten des dichterischen Redens berichtet und das gleichzeitig für diejenigen, die Kunze nicht oder nur flüchtig kennen oder über seinen Rang mit sich nicht ins reine kommen, bezeugen soll, was Kunze kann:
DIMENSION
Gern setze ich mich zum taubstummen, mit den lippen
wörter schälen
Zuhören kann fast nur noch der taube
Er will verstehen
Und nur der stumme auch weiß, was es heißt,
vergebens ums wort zu ringen
Hin und wieder ernennen wir uns durch zunicken
zu alten hasen (jeder im nacken
die meutefühlige narbe)
Gern setze ich mich zum taubstummen, mit den augen
hören, wenn ringsum sich die stimmen
überschlagen
Ein schönes und trauriges Gedicht. Ich möchte seiner tiefsinnigen Paradoxie nicht widersprechen, aber doch sagen: Hier irrt Kunze, zum Glück, zu seinem und unserem. Die Fähigkeit zuzuhören ist noch nicht ganz ausgestorben, auch unter den mit Normal-Gehör Versehenen; und vor allem die Jugend, das breite Publikum der Schüler, hat da, wo Kunze vor ihm liest, atemlos zugehört und begeistert Beifall gespendet. Es hat gefühlt, daß die kurzen Verse Kunzes die großen Oden und langen Reimereien früherer Zeiten würdig und wirksam vertreten – in der schlechten Zeit für Lyrik, in der wir leben, ein Zeichen der Hoffnung. So kann das „auf eigene Hoffnung“ Reiner Kunzes über Eigenes hinaus ein Zeichen unserer Hoffnung sein.
Werner Ross, aus: Heiner Feldkamp (Hrsg.): Reiner Kunze. Materialien zu Leben und Werk, Fischer Taschenbuch Verlag, 1987
auf eigene hoffnung (1981)
Schon der Titel auf eigene hoffnung, den er seinem ersten in der Bundesrepublik entstandenen Buch gab, weist in seiner programmatischen Subjektivität voraus auf den Gedichtband Eines jeden einziges Leben (1986) und auf den Interviewband Zurückgeworfen auf sich selbst (1989) und stellt Kunzes künstlerisches Selbstverständnis heraus, das sich dem „Gerede von der ,Endzeit‘“ widersetzt und im Sinne Max Frischs auf Hoffnung baut: „Ein Aufruf zur Hoffnung ist heute ein Aufruf zum Widerstand.“ Als letzten Gedichtband vor auf eigene hoffnung hatte Kunze vom DDR-Auswahlband Brief mit blauem Siegel abgesehen – unter schwierigen Publikationsbedingungen 1972 den Band Zimmerlautstärke veröffentlicht. Die zweiundvierzig Gedichte des schmalen, schmucklosen Taschenbuchs des S. Fischer Verlags, die zwischen 1968 und 1971 ausnahmslos in der DDR entstanden waren, hatten wegen ihrer thematischen und ästhetischen Einheitlichkeit und sprachlichen Präzision in der deutschsprachigen Literaturkritik und -wissenschaft große Beachtung gefunden.
Mit dem Band auf eigene hoffnung legte Reiner Kunze neun Jahre später und vier Jahre nach seiner Übersiedlung eine umfangreiche Sammlung von 87 Gedichten vor, die zwischen 1973 und 1981 entstanden und von denen 13 noch in der DDR geschrieben worden sind. Das Gros der Gedichte aber ist in der Bundesrepublik in den Jahren 1978 bis 1981 entstanden. Nicht nur der Umfang, sondern auch die Ausstattung und die Verlagspräsentation beider Bände unterscheiden sich auffällig voneinander. Die repräsentativ gestaltete Hardcover-Ausgabe von auf eigene hoffnung startete der Verlag mit einer Auflage von 15.000 Exemplaren, während die Startauflage von Zimmerlautstärke nur 4.000 Exemplare betragen hatte. Obwohl von auf eigene hoffnung innerhalb von fünf Jahren über 20.000 Exemplare verkauft wurden, fehlt dem Gedichtband neben der quantitativen Beschränkung auch die motivliche und künstlerische Geschlossenheit des Bandes Zimmerlautstärke.
In Auswahl und Gestaltung der Texte ist auf eigene hoffnung dem Gedichtband Sensible Wege ähnlicher. Der thematische und ästhetische Spielraum ist wieder größer geworden, was allein schon die Titel und die Länge der einzelnen Gedichte unter Beweis stellen. Formal knüpfen die Gedichte bruchlos an die Gestaltungsprinzipien der Bände Sensible Wege und Zimmerlautstärke an. Diese formale und thematische Kontinuität in der Lyrik Kunzes nach dem Staatenwechsel ist zunächst Bestätigung der Selbsteinschätzung eines Schriftstellers, der von sich sagt:
[…] mich trifft dieses Hinübergehn von einem ins andere Deutschland in meiner Substanz als Schriftsteller überhaupt nicht.
Diese Selbsteinschätzung bestätigt der amerikanische Germanistik-Professor Jay Rosellini, wenn er in seiner Analyse des Bandes auf eigene hoffnung schreibt:
Was die lyrische Form betrifft, stehen für den Kenner der früheren Bände keine Überraschungen bereit.
Die Verwendung spezifisch lyrischer Stilmittel wie Anapher, Epipher, Alliteration, Enjambement, Assonanz, Reim und Metrum ist für Reiner Kunze nach wie vor eine wesentliche Möglichkeit, Inhalten Form und Fassung zu geben. Darüber hinaus bleibt das metaphorische Sprechen, das sprachliche Ins-Bild-setzen für ihn von besonderer Bedeutung. Auch die Gedichte nach der Übersiedlung sind schon ihrer Form nach als Texte zu erkennen, die Antwort sein wollen auf dem Gedicht vorangestellte Zitate aus Briefen, Gesprächen oder öffentlichen Medien. Auch durch die bestimmten Personen gewidmeten Gedichte bekommt die Lyrik Kunzes einen Rufcharakter, der das Dialogische impliziert und intendiert. Viele der Gedichte des Bandes auf eigene hoffnung enden mit einer Frage oder einem fragwürdigen poetischen Bild oder auch in epigrammatischer Zuspitzung, so daß die Antwort des Lesers nicht nur rezeptiv bleibt, sondern zum Bestandteil des Gedichts wird. Charakteristisches Merkmal dieser Gedichte ist das Responsorische, das Fragen, Antworten und Weiterfragen.
Der Gedichtband auf eigene hoffnung soll hier jedoch nicht allein im Kontext des Werkes und der Entwicklung Reiner Kunzes gesehen werden, sondern durch eine Gegenüberstellung mit jenen Gedichtbänden genauer untersucht werden, die Günter Kunert, Bernd Jentzsch, Wolf Biermann und Sarah Kirsch nach ihrer Übersiedlung beziehungsweise befristeten Ausreise in die Bundesrepublik publiziert haben. Auch die genannten vier Lyriker aus der ehemaligen DDR haben nach dem Staatenwechsel ihre lyrischen Gestaltungsprinzipien nicht verändert und sich nicht für formale Innovationen entschieden. Ohne eine vorschnelle Gleichstellung dieser Schriftsteller mit den Autoren der deutschen Exilliteratur zu insinuieren, wie dies Fritz J. Raddatz 1977 unternommen hat, ist festzustellen, daß die in den siebziger Jahren aus der DDR in die Bundesrepublik gekommenen Autoren an bekannten und von ihnen lange praktizierten poetischen Verfahrensweisen festgehalten haben.
Bei genauerer Analyse der von ausgeprägtem Formbewußtsein und hohem Sprachsinn zeugenden Gedichte Reiner Kunzes begegne man im Gedichtband auf eigene hoffnung vielen aus früheren Gedichten Kunzes vertrauten Motiven und Schlüsselwörtern wie Baum, Brücke, Brief, Fluß, Fenster, Auto, Regen, Vogel, Hahn, Himmel und Erde. Viele bekannte und zentrale Themen wie Sprache und Sprachregelung, Individuum und Gesellschaft, Natur und Landschaft, Poesie und Politik werden von ihm wieder aufgegriffen und leicht verändert fortgeführt. Politische Verse formuliert Kunze vornehmlich in der Auseinandersetzung mit der Teilung Deutschlands und der Konfrontation mit der innerdeutschen Grenze. Kunst und Poesie bleiben als Thema relevant bei der Orientierung und Selbstbehauptung eines Schriftstellers im westdeutschen Literaturbetrieb. Verstärkt widmen sich einige Gedichte Kunzes religiösen Motiven oder sie rekurrieren auf religiös inspirierte Bilder in der Darstellung fremder Landschaften und Naturphänomene. Die Bedeutung des Persönlichen und Familiären spiegelt sich auch in den Texten nach der Übersiedlung in Liebesgedichten, Zueignungen und Porträtgedichten wider. Schließlich hat sich auch Kunzes Dichtungsverständnis erhalten, das nicht auf Agitation, Disput und Opposition basiert, sondern das auf Prinzipien der Vermittlung, Verständigung, Versöhnung, des Mahnens, Trauerns und Gedenkens beruht. Der Gedichtband auf eigene hoffnung ist im wesentlichen eine kontinuierliche Fortschreibung von charakteristischen Motiven und Themen mit versiert angewandten künstlerischen Mitteln. Angesichts dieser Kontinuität ist das Jahr 1977, das Jahr der Übersiedlung, nicht mit dem Jahr 1959, dem Jahr der großen politischen und künstlerischen Desillusionierung, zu vergleichen, das damals zu einschneidenden Veränderungen der Inhalte und Gestaltungsprinzipien führte. Der Band auf eigene hoffnung ist indes Dokument einer Selbstvergewisserung und Selbstbestätigung. Auf die Frage, was für ihn die angenehmste Überraschung nach seiner Übersiedlung gewesen sei, antwortete Kunze im Herbst 1980:
Ich kann wieder schreiben […] Seit einem knappen halben Jahr entstehen Gedichte, die in der DDR nie hätten entstehen können, sie kommen aus dem Erleben hier.
Für einige DDR-Autoren bedeutete der Wechsel in die Bundesrepublik vor allem, sich erneut und sehr bewußt als „poete des deux Allemagnes“ zu verstehen, als Schriftsteller eines in zwei Staaten geteilten, durch eine bewaffnete Grenze getrennten Landes. In seinem Lied „Und als wir ans Ufer kamen“ fragt Wolf Biermann:
Was wird bloß aus unsern Träumen
In diesem zerrissnen Land
Die Wunden wollen nicht zugehn
Unter dem Dreckverband
Und was wird mit unsern Freunden
Und was noch aus dir, aus mir –
Ich möchte am liebsten weg sein
Und bleibe am liebsten hier
– am liebsten hier
Ebenso lapidar, eindringlich und unmißverständlich formuliert es Bernd Jentzsch:
SCHNITTE
Der Schnitt ins eigne Fleisch.
Der Schnitt durchs Land.
Es ist ein Schnitter, heißt der Tod.
Der hat seinen Schnitt gemacht.
Auch Reiner Kunze greift das Thema der deutschen Teilung in mehreren Gedichten des Bandes auf eigene hoffnung auf und führt es aus veränderter Perspektive mit der bekannten Intensität fort. So heißt es im Gedicht „Nacht im Skagerrak“, das bezeichnenderweise als Reisegedicht die Reisebeschränkung derer reflektiert, die wie Kunze in der Zeit vor der Übersiedlung – Reisefreiheit nicht oder nur bedingt kennen:
Wir begünstigten, gebettet
über unseren autos
Bewohner von ländern deren grenzen sichtbar werden
in einer handbewegung die
erlaubt
Zwischen meinen gedanken
hocken im dunkeln
blinde passagiere,
und ich habe für sie kein licht
Nur der dichter durfte weggehn
über jene grenze die abdrückt
auch ohne hände
Das Erleben einer befreienden Gegenwart wird getrübt von Erinnerungen an eine Vergangenheit, die für viele bis zum Jahr 1989 bittere Gegenwart sein sollte. Die Grenzerfahrung der Gegenwart heißt für das lyrische Subjekt („den dichter“) Reisefreiheit und problemlose Grenzüberschreitung, aber diese Erfahrung wird begrenzt und relativiert durch die Vergegenwärtigung einer für viele Menschen jenseits der innerdeutschen Grenze unüberwindbaren Mauer.
Aber nicht nur Erinnerung und Retrospektive, sondern auch ein von diesen Erinnerungen bestimmter Blick in die Zukunft können zur Begrenzung gegenwärtiger Freiheit, zu Skepsis und Bedenken führen; wie in folgendem Gedicht, dessen erster Teil aus dem Jahre 1978 durch den zweiten aus dem Jahre 1980 in entscheidender Weise relativiert wird:
BEIM AUSPACKEN DER MITGEBRACHTEN BÜCHER
(nach Übersiedlung von der Deutschen Demokratischen
Republik in die Bundesrepublik Deutschland)
1
Hier dürfen sie existieren
unter ihrem namen
aaaaaaaaaaaMandelstam Nadeshda
aaaaaaaaaaaSolschenizyn
Den undurchsichtigen klebestreifen
von ihren rücken entfernend, entferne ich von meinem
den unsichtbaren sträflingsstreifen
2
Hier dürfen sie
existieren
Noch
Was zuerst als Befreiung erlebt wird, als Beendigung der vormals notwendigen Tarnung, des Versteckens, der unablässigen Bewachung und unterschwelligen Bedrohung, wird gleich darauf schon wieder eingeholt von der „Angst vor der Reprise“, die Günter Kunert nach seiner Übersiedlung ebenfalls als eine Art von Obsession diagnostiziert hat:
Auch wenn ein deutscher Autor nicht zwischen den Sprachen wählen und wechseln muß […], gelangt er dennoch in fast jedem Fall ins Unbekannte, in die Fremde, in welcher ,heimisch‘ zu werden ihm kaum jemals völlig gelingen wird. Einmal entwurzelt, wächst man so recht doch nie wieder an, und das kaum allein des Bodentauschs halber, sondern aus einem ganz anderen Grund. Dieser läßt sich ziemlich genau diagnostizieren: Es ist die endgültig gewordene Furcht, der Vorgang könne sich wiederholen.
Günter Kunerts erster Gedichtband nach seinem, von ihm selbst so bezeichneten, „Ortswechsel“ in die Bundesrepublik trägt den programmatischen Titel Abtötungsverfahren und dokumentiert aufs neue jene von Dieter E. Zimmer beschriebene „zunehmende Verfinsterung“ im Werk dieses Autors, das sich als Spiegel einer allgemeinen geistigen und psychischen Verfinsterung versteht. „Ich bin“, sagt Kunert, „auch bloß ein Seismograph, der fürs Erdbeben nicht verantwortlich zu machen ist.“
So unterscheidet sich das Gros der Gedichte des Bandes Abtötungsverfahren weder stilistisch noch thematisch von Kunerts vorausgegangenen, in der DDR entstandenen Lyrikbänden, in denen die Zerstörung des Planeten Erde und der Verfall seiner Bewohner lakonisch und illusionslos notiert wird. Die Erde erscheint unbewohnbar wie der Mond. In zum Verwechseln ähnlichen Sprachbildern werden apokalyptische Landschaften entworfen. Abschied von Utopia, Geschichtspessimismus, Hoffnungslosigkeit und Sinnleere sind die Botschaft von Kunerts lyrischen Monologen. Kollektiver Pessimismus geht einher mit individueller Ratlosigkeit. Das Monomanische dieser Lyrik kennt nur eine Perspektive: die Gewißheit des Endes. Kunerts Gedichte sind Befunde, Diagnosen und Resümees angesichts einer Welt und eines Ichs, deren Morbidität und Fatalität nicht mehr abgewendet werden können. Konsequenterweise befassen sich nur wenige Gedichte des Bandes Abtötungsverfahren mit dem konkreten Ortswechsel Kunerts in die Bundesrepublik im Herbst 1979. Eröffnet wird der Band von einem Gedicht, das diese biographische Zäsur als existentielle Irritation darstellt:
PLATZWECHSEL
Schmutzig der Stoff
an den Knien: Noch immer trage ich
die Hose so wie ich herkam
Tage gleich Jahreszeiten
morgens Sonne mittags Hagel
gehen geschäftig draußen vorüber
indessen ich nur
einen Schrank aufstelle Stühle rücke
Kisten öffne in denen mir
die Vergangenheit folgte
bruchsicher verpackt:
Nicht eine Erinnerung
wurde beschädigt
aber keine will mir mehr gehören
nachdem die Holzwolle sie
nicht länger verbirgt
Der „zeitweilige Ortswechsel“, der dann doch ein endgültiger werden sollte, wird in diesem Gedicht als eine die Identität gefährdende Erfahrung dargestellt und als ein irreversibler Verlust von Erinnerungen. Im Gegensatz dazu sind die Gedichte Kunzes nach der Übersiedlung („Beim Auspacken der mitgebrachten Bücher“ oder „Ich bin angekommen“) Manifestationen gefestigter Identität und gewonnener Freiheit. Trotz der schmerzlichen Erfahrung des Platzwechsels bleiben Kunerts Themen im wesentlichen konstant und werden durch lebensgeschichtliche Veränderungen wie den Umzug in die Bundesrepublik nicht entscheidend beeinflußt. Kunerts Programm bleibt das einer „heiteren Verzweiflung“ und melancholischen Gelassenheit in der Tradition eines Gottfried Benn, wo Aggressivität und hoffnungsvolles Engagement gegen diese Verzweiflung kaum spürbar werden.
PROGRAMM
Wir sind die vor und hinter Scheiben,
gewöhnt die Stille und den falschen Ton,
in einem sicher: Daß wir bleiben
dieselben immer wie uns selbst zum Hohn.
Die Menschentiere, die wir sterben sehen,
gejagt, erlegt am Ende des Berichts,
wie Wiederholung eines ewigen Geschehens:
Denn unsern Blick trifft nichts mehr. Nichts.
Das Bett. Der Tisch. Die trüben Tage.
Gebeine bilden unsern Lebensgrund
und geben keinen Anlaß mehr zur Klage:
Da hoffe du. Du hoffst dich wund.
Ein Gegenprogramm (in der Tradition Brechts) verkörpert Wolf Biermann, der zwar mit Günter Kunert viele biographische Erfahrungen teilt – beide entstammen jüdischen Familien –, der aber durch seine Lieder und Gedichte nicht nur verzweifelte Zustände registrieren, sondern der diese bekämpfen und auf gesellschaftliche und individuelle Veränderungen hinwirken will. Biermann hält im Gegensatz zu Kunze und Kunert noch lange an einer sozialistischen Sozialutopie, wie sie von Marx formuliert und von der Pariser Commune praktiziert wurde, fest. Biermann beruft sich auf die Rede von der „Heiterkeit der Leiden“ aus Hölderlins Hyperion und plädiert für ein dialektisches Verhältnis von Verzweiflung und Hoffnung. Kunerts Hoffnungslosigkeit fordert ihn zu folgendem Plädoyer für die gesellschaftspolitische Hoffnung heraus, die sich von der individuell begründeten Hoffnung Kunzes unterscheidet:
Meine Hoffnung kommt aus der Beobachtung der Wirklichkeit […] Aus der Beobachtung der Menschen, mit denen ich zu tun habe. Menschen, die sich wehren, wenn sie unterdrückt sind, Menschen, die oft nicht wissen, wo ein noch aus, und dennoch suchen und die nicht einfach in Selbstmitleid verfallen wollen.
In dem Band Preußischer Ikarus, seiner ersten Buchpublikation nach der Ausbürgerung im November 1976, hält Biermann an jener seine Arbeiten kennzeichnenden Einmischung in politische Verhältnisse und gesellschaftliche Prozesse fest. Seine Lieder und Gedichte stellen sich gezielt der politischen Auseinandersetzung. Nach seiner Ausbürgerung greift Biermann sofort in die Diskussion über aktuelle Themen ein: Stammheim, Gorleben, Sympathisantenfrage, Extremistenerlaß und Bundestagswahlkampf. Seine literarischen Nachrufe gelten Ernst Bloch und Rudi Dutschke, während Kunzes „Erstes Geleit“ dem Generalsekretär der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Clemens Graf Podewils, gilt.
Biermann agitiert gegen die Stasi-Methoden in der DDR und nennt Franz-Josef Strauß in polemischer Überspitzung einen „Kreuzfahrer mit Seppelhut“. Die politische Parteinahme und die direkte politische Einmischung, die bei Biermann von den künstlerischen Aktivitäten nicht zu trennen sind, sucht Reiner Kunze eher zu vermeiden. Der Unterschied wird deutlich, wenn man Biermanns „Vier Variationen zu Strauß“, mit denen er 1980 in den Wahlkampf des Kanzlerkandidaten der Unionsparteien eingreift, einem Gedicht Kunzes gegenüberstellt, in dem das Tagespolitische ins Kosmopolitische, das Konkrete ins Allgemeine überführt wird:
WAHLPROGNOSE
Kopf an kopf
Der Sieger wird
das ziel verkaufen, damit wir alle noch ein wenig
länger bleiben können
Falls nicht die sonne früher untergeht
Obwohl die ideologischen, ästhetischen und poetologischen Positionen Biermanns und Kunzes äußerst unterschiedlich sind, wurden von beiden nach ihrer Übersiedlung beziehungsweise Ausbürgerung Gedichte geschrieben, deren thematische und motivliche Kongruenz überrascht. Den alltäglichen Faschismus im Osten wie im Westen anzuprangern und zu entlarven, war eines der Hauptanliegen Biermanns, und eines seiner ersten Gedichte nach der Ausbürgerung drückt das Erschrecken über die Realität faschistischer Denk- und Verhaltensmuster aus:
HANSEATISCHE IDYLLE
Ja, es wird Frühling. Ich konnte heute
um die Ecke gehn zum Briefkasten, ohne
Mantel. Im Westen mein zweiter Frühling.
juuda verrekke!
biiermann!
root fronnt!
heil! moskau!
ess-ee-dee!
biiermann!
honnekkeer!
das isserdoch! oder?
root fronnt verrekke!
klar isser das!
So brüllte heute eine Meute Schuljungs
hinter mir her. Ihre Stimmen waren knapp
über dem Stimmbruch. Der vertraute, der
hamburger Klang. Sie genossen offenbar
die neuerworbene Tiefe ihrer Stimmen. Aber
mit wessen Stimmen grölten die? War es
die Stimme ihrer Väter? ihrer Großväter?
Ach, dachte ich,
aaawas für alte Männer
aaaaaada hinter mir auf der Straße!
In Reiner Kunzes lyrischem Werk indes ist das motivverwandte Gedicht „Fernsehübertragung im Gasthof zu E.“ sowohl wegen seines bayerischen Dialekts als auch wegen des Registrierens eines latenten Faschismus untypisch. Auf entlarvende Weise zitiert und gestaltet Kunze folgende Äußerung eines jungen Mannes während der Fernsehübertragung des Fußballänderspiels Deutschland gegen Holland, die ein ähnliches Erschrecken auslöst wie das „juuda verrekke!“ der Schuljungen in Biermanns Gedicht:
Den ham’s beim vag asn vagessn, sagt
der junge mann als der holländer
das tor schießt
Zwei andere, obendrein nahezu titelgleiche Gedichte von Biermann und Kunze aber, die nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten zudem den Wert historischer Dokumente haben, zeigen in der Gegenüberstellung, wie sehr die Perzeption der gesamtdeutschen Wirklichkeit und deren poetische Durchdringung bei beiden Autoren differiert.
Gedanken beim Flug
von Berlin nach Hamburg
das kann man schön sehn von oben:
im kleineren Deutschland
die großen Felder, die
kleineren Felder im größeren, Jungs!
so einfach
ist die Fliegerei!
Aus der Vogelperspektive zeigt Biermann die damals gegebenen politischen Unterschiede zwischen den beiden deutschen Staaten: in der DDR die Planwirtschaft, in der Bundesrepublik die Markwirtschaft. Das kleinere Deutschland, die ehemalige DDR, erscheint ihm, der von Berlin, seinem Wohnort vor der Ausbürgerung, nach Hamburg, seinem Geburts- und Wohnort heute, fliegt, als das ideell ,größere‘. Er wendet sich mit diesem Bild in salopp formulierter Apostrophe an politisch Gleichgesinnte und verkündet eine Moral, die mehr vom Spott als von ernsthaftem Appell bestimmt ist. Die gegensätzlichen politischen Systeme haben sich bereits topographisch verfestigt und scheinen in ihrer Divergenz unvereinbar.
Ein Flug von München, der Hauptstadt des Bundeslandes, in dem Reiner Kunze seit seiner Übersiedlung lebt, nach Berlin, dessen Ostteil ihm von 1977 bis 1989 verschlossen war, löst in Reiner Kunze, wie ein Gedicht aus dem Jahre 1979 zeigt, ganz andersartige Empfindungen und Gedanken aus:
BEIM ANBLICK DES THÜRINGER WALDES
VOM FLUGZEUG AUS
(München – Berlin)
Lieber über eure köpfe
hinwegfliegen, freunde, lieber
hinwegfliegen müssen über eure köpfe, als
hinwegschreiben
Kunzes Gedicht ist eine mittels Wiederholungen emphatisch formulierte Botschaft eines Schriftstellers an Freunde in der DDR, der seinen Weggang noch Jahre nach der Übersiedlung zu legitimieren versucht, indem er angesichts der trennenden Grenzerfahrung das Verbindende einer Literatur herausstellt, die der Wahrheit dienen, die verstanden und gehört werden will. Kunze betont nicht das äußerlich Trennende der politischen Systeme, sondern das Verbindende individueller und substantieller Beziehungen. Unausgesprochen, aber doch vernehmbar bleibt die Hoffnung auf ein Zusammensein mit den Freunden.
Als Bernt Engelmann, der damalige Vorsitzende des Verbandes deutscher Schriftsteller, am 13. Dezember 1981 auf der Berliner Begegnung zur Friedensförderung forderte: „Wir sollten uns endgültig trennen von allem, was auf den Wunsch nach Wiederherstellung eines deutschen Nationalstaates hinauslaufen könnte“, war dies einer der ausschlaggebenden Gründe für Reiner Kunze, im August 1982 seinen Austritt aus dem VS zu erklären. Mit Kunze solidarisierten sich damals unter anderem die ehemaligen DDR-Autoren Jürgen Fuchs, Frank-Wolf Matthies, Gerald Zschorsch, Gerhard Zwerenz und Horst Bienek. In einem Offenen Brief begründete Kunze seinen Austritt, und in einem Gespräch mit Rudolf Wolff gab Kunze im Januar 1983 dazu eine Erklärung, deren Integrität und Konsequenz heute, nach der politischen Vereinigung der beiden deutschen Staaten, noch deutlicher ist:
Ich weiß aber, und das gehört zu dem wenigen, das ich auch heute noch sicher weiß, daß viele Menschen in der DDR diesen Wunsch [nach einer Wiedervereinigung] hegen, weil sie in seiner Erfüllung die einzige Chance sehen, für sich oder ihre Kinder oder Kindeskinder die menschlichen Grundfreiheiten zurückzuerlangen: zum Beispiel die Grundfreiheit, nicht Tag für Tag und ihr Leben lang lügen zu müssen, um überleben zu können. Dabei wissen sie ebenso wie ich, daß eine solche Wiedervereinigung weder heute noch morgen möglich ist, und daß nur eine gewaltlose Wiedervereinigung wünschenswert sein kann.
Sarah Kirsch, die im August 1977 mit ihrem Sohn die DDR verließ, veröffentlichte 1979 den Gedichtband Drachensteigen, in dem sie zwar ihre Liebes- und Naturlyrik in der ihre Dichtung kennzeichnenden Mischung aus märchenhaft-entrückten und realistisch-kritischen Elementen fortsetzt, in dem aber auch aufgrund veränderter Lebensbedingungen neue Motive zu entdecken sind. Die zahlreichen Liebesgedichte werden in ihrem emotionalen Überschwang und in ihrem Zauber immer wieder relativiert durch die desillusionierenden Erfahrungen des Verlusts und der Vergeblichkeit. Nur wenige Gedichte in Drachensteigen haben die DDR zum Thema. Neun der vierzig Texte wurden noch in der DDR geschrieben. Politisches findet sich nur sporadisch und in poetische Bilder gekleidet. Auch nach dem Staatenwechsel gehört das direkte politische Gedicht nicht zum eigentlichen Lyrikrepertoire dieser Autorin. Mit nuancierten Beobachtungen reagiert sie auf die neuen gesellschaftlichen und topographischen Gegebenheiten. Nicht Reflexion und Didaxe, sondern Bilder und Emotionen dominieren. In Rom, wo Sarah Kirsch von Mai 1978 bis Mai 1979 als Stipendiatin in der Villa Massimo lebte, entstand folgendes Prosagedicht, das sich retrospektiv und sarkastisch mit dem Staat DDR, in dem sie fast vierzig Jahre gelebt hat, auseinandersetzt:
Dankbillett
Das ist ein schöner Tag. Ich setze mich in ihn hinein, die Eukalyptusblätter fliegen ab und auf, sehr lang auf, und seh ich den Baumleib nackt und weiß weiß ich was das ist ein schöner Tag. Die römischen Männer scharwenzeln vorüber, spucken hübsche Wasserstrahlen in Marmorbecken und die ganz scharfen Carabinieri – warum fällt mir das Militär immer noch ein – halten Wache mit Federhüten und rauchen; alles anders als in Preußen, selbst die Uhrzeit, und der Mond liegt quer – ach wie danke ich meinem vorletzten Staat, daß er mich hierher katapultierte.
Zurückhaltend und beiläufig stellt das lyrische Subjekt angesichts der sinnlich intensiv erlebten römischen und südländischen Welt die Frage nach der Selektion der eigenen, in anderer Umgebung geprägten Wahrnehmung. In der vermeintlichen Idylle werden Menschen und Dinge vergleichend wahrgenommen, ohne daß ein Erschrecken über die Unterschiede zwischen Preußen und Italien offenkundig würde. Dennoch erfährt sich das lyrische Ich als entwurzelt, in die Fremde verschlagen, als Spielball eines Staates, der es hinauskatapultierte. Das „Dankbillett“ bleibt bis in den Schlußsatz hinein, der eingeleitet wird durch das Schmerz und Erleichterung gleichermaßen ausdrückende Empfindungswort „ach“, ambivalent. Das Befreiende der Gegenwart („ein schöner Tag“) wird besonders intensiv erlebt, indem die zurückliegenden bitteren Erfahrungen in der Erinnerung gegenwärtig sind. Eine ähnlich ambivalente Erfahrung macht Reiner Kunze in einem Gedicht sichtbar, das 1979 entstanden ist und das zu den ersten lyrischen Texten zählt, die er nach seinem Weggang aus der DDR geschrieben hat:
IM NACKEN DIE VERGANGENHEIT
Spaziergang im Taunus
Mitten im wald, den keine
grenze teilt, stellt mich
die grenze:
aaaaaaaaader anstand des jägers ein
aaaaaaaaawachturm
An der Donau unterhalb von Passau
Die grenze, über die ich blicke
auf Österreichs burg und buchen, ist
nichts als ein fluß
Mitten in der Bundesrepublik, in einem Wald im Taunus, fernab von Staatsgrenzen bewirkt die innere, psychische Präsenz zurückliegender Grenzerfahrungen im lyrischen Subjekt ein Erschrecken – formal realisiert durch Kolon und Verseinrückung –, das auf einer optischen Täuschung bei der Wahrnehmung der äußeren Realität beruht. Der Hochsitz des Jägers wird fälschlicherweise als Wachturm der Grenzposten gesehen. Die „Angst vor der Reprise“, von der Kunert spricht, unterminiert die Perzeption der Außenwelt. Im Gedicht „Grenzkontrolle“ hatte Kunze schon 1971 für die bedrohliche und entwürdigende Grenzerfahrung ein zutiefst einprägsames Bild gefunden:
Zwischen front- und heckscheibe des wagens
im blickfeld des wachturms:
mikroben unterm mikroskop
erreger mensch
Vergleichbare Bilder und Erfahrungen sind im Spaziergänger des ersten Teilgedichts gegenwärtig und gehören nur scheinbar der Vergangenheit an. Was, wie es der Gedichttitel besagt, in seinem Rücken zu liegen scheint, liegt ihm plötzlich auf erschreckende Weise vor Augen und wird so zur verstörenden Drohung im Nacken.
Von einer entgegengesetzten Grenzerfahrung spricht das zweite Teilgedicht, wobei das deutsch-österreichische Grenzgebiet bei Passau, wo Reiner Kunze seit 1978 wohnt, zum Ort dieser Erfahrung wird. Die Staatsgrenze, die im Blickfeld des lyrischen Subjekts liegt, ist eine natürliche Grenze, ein Fluß. Dennoch wird ein Erschrecken auch hier sichtbar, weil die Identifizierung des Flusses als ,grüne‘ Grenze kaum für möglich, sondern eher wie im ersten Gedichtteil der Jägerhochsitz für eine optische Täuschung gehalten wird. Dieses skeptische Verweilen wird formal durch das Strophenenjambement zwischen vorletztem und letztem Vers gestaltet. Am Schluß des Gedichts „Im Nacken die Vergangenheit“ aber bleibt die Erkenntnis: Die Grenze ist ein Fluß, nicht anderes. Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Österreich ist die Grenze fließend, und der Blick auf „Österreichs burg und buchen“ ist ein Blick über Grenzen hinweg.
Wie Sarah Kirsch in ihrem Prosagedicht „Dankbillett“, so setzt sich auch Reiner Kunze im Gedicht „Im Nacken die Vergangenheit“ mit Realitäten der westlichen Welt auseinander, die – konfrontiert mit Erinnerungen an das Leben in der DDR – in einem anderen, befremdenden und zugleich befreienden Licht erscheinen.
Für beide Lyriker zählt das Naturgedicht zu den bevorzugten lyrischen Genres. Beide reagieren mit den für sie spezifischen poetischen Mitteln auf die Begegnung mit fremden Ländern und Landschaften des Westens. Sarah Kirsch tut dies in einer für ihre Lyrik typischen spielerischen, assoziativen Verknüpfung von Innen- und Außenwelt, von Vergangenheit und Gegenwart, Realität und Traum:
Die Toscana
Jeder Baum am richtigen Fleck. Man könnte sagen Felder gibts die mein Herz sind: blauer Weizen und Mohnblumen reingeworfen eins zu zwei. Kunst oder Welt fliegt davon. Den Markplatz von Siena habe ich immer gekannt. Neben dem Brunnen stehen, Kugeln das verschiedene fischgrätige Pflaster abrollen. Glocken, Tage später träum ich den Platz. Drauf stehen, die ich liebe, nun zwei und der Dom dieses sechzehnbeinige Zebra mit den Skalpen der Päpste zuckte sein Fell.
Reiner Kunze wählt sprachlich und ästhetisch einen anderen Weg, um fremden Landschaften Ausdruck zu verleihen; vor allem weite, menschenleere, einsame Regionen unter einem „großen Himmel“ veranlassen ihn immer wieder zu poetischen Reaktionen:
IN DEN HIGHLANDS
Einmal, noch vor erschaffung des menschen,
versuchte sich gott als kupferschmied
So entstand
der herbst in den Highlands
Dann verließ gott die einsamen berge für immer
Er war noch jung,
aber schon gott
In den kesseln
blieb ewiges wasser zurück
Du kannst die geduld wiederfinden,
die gott hier verlor
Um die Eigentümlichkeit des schottischen Hochlandes darzustellen, greift Kunze auf den Schöpfungsmythos der Genesis zurück. Die Rede von Gott, die in Gedichten Kunzes nach der Übersiedlung vermehrt begegnet, ist aber nur Mittel zum Zweck der Rede vom Menschen und von der Natur. Die Anthropomorphisierung Gottes dient dazu, von Gott menschlich reden, ihm menschlich und humorvoll begegnen zu können. Die Fehlbarkeit Gottes, seine menschliche Ungeduld beim Kunsthandwerk des Kupferschmieds wird zum Bild für die Schönheit einer von Gott verlassenen Welt, in der der Mensch seine Geduld wiederfinden kann. Biblischer Mythos und Darstellung einer konkreten Landschaft vereinigen sich zu einem Naturgedicht mit poetologischer Dimension.
In den naturlyrischen Gedichten von Sarah Kirsch verliert sich das Ich immer wieder in der Natur, versucht, obwohl es sich der Unmöglichkeit dieses Versuchs bewußt ist, mit dieser eins zu werden, sich als ein Teil der Natur zu empfinden und für Augenblicke die Trennung von Mensch und Natur zu überwinden. In Reiner Kunzes Naturlyrik hingegen bleibt die Distanz zwischen Mensch und Natur deutlicher sichtbar. Die Natur bleibt als Gegenüber stets Spiegel menschlicher Verfaßtheit, sie bleibt die Fremde, der der Mensch ausgesetzt ist, deren Sprache er allenfalls ,übersetzen‘ kann. Die Natur ist für Reiner Kunze ein Ort der Selbstbegegnung und ein Medium, sich anderen mitzuteilen. Das Gedicht „Tagebuchblatt 74“ ist exemplarisch für eine derartige ,Funktionalisierung‘ der Natur:
TAGEBUCHBLATT 74
(für Karl Corino)
1
Das waldsein könnte stattfinden
mit mir
(Nicht mehr bedroht sein
von allen äxten
Eine wasserader
unter den wurzeln)
2
Ich aber will nicht einstimmen
müssen
(Lieber immer neue äste treiben zu wehren
der axt
Lieber die wünschelruten der wurzeln
wieder und wieder verzweigen)
An diesem Gedicht „gegen Verlockungen“ und gegen eine bequeme Existenz der Anpassung, der Widerspruchslosigkeit und des Funktionierens bemängelt Jay Rosellini, daß der Wald als eine Bedrohung für den einzelnen Baum erscheine, nicht aber als Sinnbild für die gemeinsamen Interessen und die gegenseitige Fürsorge. Dabei läßt Rosellini außer acht, daß das Gedicht „Tagebuchblatt 74“ noch in der DDR entstanden ist und daß Kunzes Interesse auch nach der Übersiedlung unvermindert der Standortbestimmung des einzelnen gilt, vornehmlich in seinen Naturgedichten.
Als Bernd Jentzsch sich im November 1976 von der Schweiz aus in einem Offenen Brief an Erich Honecker mit dem ausgebürgerten Wolf Biermann und dem aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossenen Freund Reiner Kunze solidarisierte, war damit für ihn eine Rückkehr in die DDR ausgeschlossen. Zwei Jahre später veröffentlichte Jentzsch den Gedichtband Quartiermachen, dessen Titel symptomatisch ist für den Realitätssinn und die Prägnanz der Einzeltexte, die den Gedichten Kunzes thematisch und stilistisch sehr nahestehen. Wie Kunzes Gedicht „Tagebuchblatt 74“ ist auch Jentzschs Gedicht „Der Baum in der Brücke“ eine in Naturbildern gespiegelte Evokation der Widerstands- und Lebenskraft des einzelnen in „lumpiger Zeit“. Darüber hinaus ist es eines der Folgegedichte von Brechts lyrischem Vermächtnis „An die Nachgeborenen“ und eine Fortschreibung von Peter Huchels poetischem Testament „Der Garten des Theophrast“, in dem es heißt: „Ein Ölbaum spaltet das mürbe Gemäuer“.
DER BAUM IN DER BRÜCKE
In Olten die Alte Brücke, über die Aare
Trägt sie die schnelle Zeit, langsam
In ihrem Gemäuer, die Wurzeln im Untergrund,
Wuchs ein Baum und wuchs und
Sprengte den Stein mit der Zunge
Des Blatts, wuchs, widerstand
Der lumpigen Zeit, ein Lump,
Der sich nicht verbeugt vor dem Baum
Im Gemäuer, in der Mauer, ja
Die alte Lust, sich aufzubäumen.
Sowohl Kunzes alliterierende Verse „Lieber die wünschelruten der wurzeln / wieder und wieder verzweigen“ als auch Jentzschs zeitraffende Vergegenwärtigung „Wuchs ein Baum und wuchs und / Sprengte den Stein mit der Zunge / Des Blatts, wuchs, widerstand / Der lumpigen Zeit“ sind Variationen einer Utopie, die sich auf das Individuelle und Existentielle bezieht.
Wie sehr Reiner Kunzes Dichtung, ob in Ost- oder Westdeutschland entstanden, auf den Dialog und die Kommunikation zielt, stellt das Eröffnungsgedicht des Bandes auf eigene hoffnung unter Beweis, dem als Liebesgedicht auch eine poetologische Dimension eigen ist:
NACHTFAHRT
Ein licht vor sich herschickend, zufahren
auf ein licht
Auf die möglichkeit eines lichts
Auf einen lichtschalter der
nicht berührt werden wird
Unter dessen lampe
du schläfst
In diesem Tageszeitengedicht wird nicht vom Dunkel der Nacht oder von Ängsten gesprochen, sondern ausschließlich vom Licht und von Lichtquellen. Schon früh hat Kunze in seiner Dichtung die Licht-Finsternis-Metaphorik der Aufklärung adaptiert und sie wie in dem Gedicht „Das Ende der Kunst“ auf poetologische Aussagen angewendet. Seit diesem Gedicht aus dem Jahre 1960 wird der Poesie durch Kunze eine erhellende Kraft zugeschrieben; Licht und Gedicht werden miteinander identifiziert. Im Kontext des Werkes ist deshalb dem Eingangsgedicht des Bandes auf eigene hoffnung – in Entsprechung zum ersten Gedicht des Bandes Zimmerlautstärke – eine poetologische, die Rezeption thematisierende Dimension eigen. Das „Zufahren“ des Lichtes auf ein anderes Licht ist Bild für das Unterwegssein des Gedichts, das Paul Celan mit der Metapher von der Flaschenpost beschworen hat und das Ingeborg Bachmann in ihrer Rede zur Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden im Jahre 1959 zum entscheidenden Motiv für den Dichter erklärt hat:
Der Schriftsteller […] ist mit seinem ganzen Wesen auf ein Du gerichtet, auf den Menschen, dem er seine Erfahrung vom Menschen zukommen lassen möchte […] aber insbesondere vom Menschen, der er selber oder die anderen sein können und wo er selber und die anderen am meisten Mensch sind.
Von dieser ,Aus-Richtung‘ des Schriftstellers beziehungsweise der Dichtung spricht Kunzes Gedicht „Nachtfahrt“, indem es sich als Liebesgedicht explizit an ein Du wendet. Die Nachtfahrt, existentiell verstanden als Lebensreise, ist sinnvoll nur als zielgerichtete Bewegung, nicht als Irrfahrt. Das Du der geliebten Person wird zum Beweggrund und zum Zielpunkt für das lyrische Ich, das, wie Kunzes Sprachsinn es konnotiert, im Wort Licht implizit vorhanden ist.
In der Gegenüberstellung mit dem Gedicht „Nachtfahrt“ aus Günter Kunerts Band Abtötungsverfahren, das hinsichtlich des Welt-, Gesellschaft- und Menschenbildes dem titelgleichen Gedicht Kunzes diametral entgegengesetzt ist, werden die monologische Grundstruktur der Dichtung Kunerts und die dialogische Grundstruktur der Dichtung Kunzes besonders deutlich:
NACHTFAHRT
Mitten durch die Nacht mit dem Wagen
durch die Abwesenheit des Planeten
selber abwesenden Geistes
fleischliches Geschoß auf Rädern
das fünfte Mitglied der Apokalypse
durch bleiches Gewölbe das still
hinter dem Rücken zerfällt
Kosmisches Dunkel
wie vor der Schöpfung oder auch wie
danach: Verlorener Glaube
an Kathedralen und Tempel
an Bahnhöfe Brücken Paläste und nicht
einmal mehr
an die verworrene Höhle Lascaux
wo ich mich einst dem Gestein verband
Nur Nacht noch
und ein greller Splitter am Ende
meiner Mühsal
von hier nach da und wozu
nicht wissend
Am Ende alles wie geträumt:
Die ersten solitären Lampen
das Pflaster und seine Gegenwehr
die Grüfte links und rechts
all ihre Fenster schwarz versiegelt
und auch die Läden
gefüllt mit Finsternis:
Verbot der Illusion
erwacht zu sein
Gleich zu Beginn der ersten Versgruppe verläßt Kunerts Gedicht die individuelle Sphäre und nimmt mit deskriptivem Vokabular den Weltzustand ins Visier. Sub specie aeternitatis wird der Mensch in Anspielung auf die vier apokalyptischen Reiter (Pest, Krieg, Hunger und Tod) zum „fünften Mitglied der Apokalypse“. Der Mensch reiht sich als willenloses „fleischliches Geschoß auf Rädern“ in die Kette der Vernichtung ein, allerdings mit der sarkastischen Andeutung, daß er nur das fünfte Rad am Wagen sei. Die zweite Versgruppe evoziert das sprichwörtlich gewordene Tohuwabohu der Genesis. Die wüste, leere und finstere Erde des Schöpfungsbeginns ist nicht mehr Blick auf Vergangenes und Überwundenes, sondern Ausblick in eine nahe Zukunft. Was diesem Chaos am Beginn der Weltschöpfung folgte – die ,Schöpfungen‘ des Menschen, seine Aneignung und Unterwerfung der Erde – führt zurück ins Chaos des ersten Schöpfungstages. Die religiöse Baukunst und die profanen Bauwerke sowie die Malereien der Höhlenmenschen der Altsteinzeit, diesem Inbegriff der frühesten Kunst – sind dem Verfall preisgegeben. Die Nacht wird zum Sinnbild des Existentiellen schlechthin. Nacht als physische Mühsal, psychische Not und geistige Orientierungslosigkeit. Die Ziel-, Zweck- und Sinnlosigkeit des Daseins wird dem lyrischen Subjekt zur Gewißheit. Seine Nachtfahrt endet mit einer Ankunft in einer Nekropole. Die Häuser sind Totenkammern, die Fenster düstere Abgründe. Die Vereinzelung des Menschen ist hier – ganz im Gegensatz zur „Nachtfahrt“ Kunzes – umfassend und unausweichlich. In alptraumartiger Weise wird die „Welt als das Heillose schlechthin“ durchfahren. Aufwachen ist gleichbedeutend mit bösem Erwachen. Die Finsternis erfaßt das Individuum, die Gesellschaft, die Erde und den Kosmos. Kunerts Geschichtspessimismus ist wie der Gottfried Benns eine klare Absage an jede politische oder heilsgeschichtliche Utopie. In seinem Gedicht „Gesellschaft“ heißt es explizit:
Unerfüllt nach so langer Zeit
ist jede Hoffnung ausgebrannt
und an jedem Tag
das Dunkel darum unsere Gesellschaft
Die Zukunft
eine ferne Ruine am Horizont
unbewohnbar
Reiner Kunzes Gedichte hingegen hoffen (noch) auf Verständigung unter den Menschen und engagieren sich für eine bewohnbarere Welt. Dem Dunkel setzen sie ihr Licht entgegen. Kunzes „Nachtfahrt“-Gedicht ist ein Text expliziter Hoffnung auf das Du des geliebten Partners und auf das Du des Lesers.
Wolf Biermann, Bernd Jentzsch, Sarah Kirsch, Günter Kunert und Reiner Kunze haben nach ihrem Weggang aus der DDR ihre poetischen Verfahrensweisen und ihre thematischen Schwerpunkte im wesentlichen beibehalten, vor allem aber haben sie auch in der Bundesrepublik an der in der DDR hart erkämpften und kulturpolitisch umstrittenen subjektiven Authentizität und Rehabilitierung des Ich festgehalten. Schon viele Jahre vor der Ausbürgerung Biermanns hatten sie sich der kanonisierten realistischen Schreibweise durch eine schöpferische Rezeption der lyrischen Traditionen und der literarischen Moderne entzogen. Die Skepsis gegenüber einer sozialistischen Gesellschaft, wie sie in der DDR existierte, hat sich bei den genannten Autoren nach ihrem Staatenwechsel erhalten oder noch verstärkt. Ihr Selbstverständnis als deutsche Schriftsteller blieb bis zum November 1989, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, geprägt vom Bewußtsein, in einem geteilten Land zu leben. Die Übersiedlung haben sie nicht als Emigration empfunden, aber dem Staat Bundesrepublik Deutschland sind sie über Jahre hin mit Zurückhaltung und Skepsis begegnet.
Einen Grund für diese Skepsis nennt ein Gedicht Reiner Kunzes, das 1980 entstanden ist. Kunze wendet in diesem lyrischen Gesprächsprotokoll die von ihm in der DDR oft und überzeugend praktizierte Technik des entlarvenden Zitierens an, um den Konflikt zwischen Macht und Geist, heteronomem und autonomem Kunstverständnis zu demonstrieren.
POLITIKER, EINES MEINER BÜCHER
LOBEND
Ein menschliches buch, sagte die stimme am telefon
Ich wartete ab
Trotz so vieler enttäuschungen
lag im ohr, der kleinen schmiede,
von neuem der steigbügel bereit
Könnten Sie, sagte die stimme,
nicht auch etwas schreiben
in unserem sinn?
Als politischem Text fehlt dem Gedicht das in der Bundesrepublik durchaus kalkulierbare Risiko des Benennens und des Nennens von Namen. Kunze beläßt es aber bei dem Entlarven einer ihm aus der DDR wohlbekannten Haltung; eine bestimmte Person oder Partei nennt er nicht. Zudem verknüpft er dieses Entlarven zwar mit einem adäquaten Bild, aber der Konflikt zwischen Politiker und Dichter wird nicht ausgetragen oder gar zugespitzt. Zu fragen ist, ob die politischen Vereinnahmungsversuche. und Verlockungen, denen sich Schriftsteller in der Bundesrepublik ausgesetzt sehen, so offensichtlich und durchschaubar sind, wie es das Gedicht Kunzes darstellt, oder ob sie nicht subtiler und latenter erfolgen. Seit seiner Übersiedlung ist Reiner Kunze den Einladungen von politischen Parteien wiederholt gefolgt: 1978 wurde er von der SPD zu einer Tagung nach Bergneustadt eingeladen, 1984 von der CSU nach Wildbad Kreuth und von Bundeskanzler Kohl als Sondergast des Staatsbesuchs in Israel und 1985 von Außenminister Genscher als offizielles Mitglied der Delegation der Bundesrepublik zum KSZE-Kulturforum nach Budapest. 1984 wurde ihm vom damaligen Bundespräsidenten Karl Carstens das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen, und 1988 zeichnete man ihn mit dem Bayerischen Verdienstorden aus. Die Brisanz des Konflikts zwischen Politik und Poesie, die Kunze in der DDR fortwährend erlebte, existiert in der Bundesrepublik so nicht. Der erhebliche, nahezu fundamentale Unterschied wird sichtbar, wenn man dem Gedicht „Politiker, eines meiner Bücher lobend“ folgendes, 1971 in der DDR geschriebene, motivverwandte Gedicht
AUF EINEN VERTRETER DER MACHT
ODER
GESPRÄCH ÜBER DAS GEDICHTESCHREIBEN
Sie vergessen, sagte er, wir haben
den längeren arm
Dabei ging es
um den kopf
Aus der selbstgefälligen, repressiven Drohgebärde eines Repräsentanten politischer Macht in der DDR ist in der Bundesrepublik eine Geste der Verlockung geworden. Dennoch scheint zwischen dem Vokabular der politischen Vertreter beider Staaten eine größere Übereinstimmung zu bestehen als zwischen Kunzes Gedichten auf diese „Vertreter der Macht“. Auf die Frage eines westdeutschen Journalisten nach den gegen Kunze praktizierten Publikationsbeschränkungen in der DDR antwortete im März 1972 der stellvertretende DDR-Kulturminister Bruno Haid: „Wir wünschen nichts mehr, als daß Kunze in unserem Sinne in Verlagen der DDR publiziert.“ [Hervorhebungen vom Verf.] Für Kunze aber gilt als entscheidender Maßstab, was im Sinne der Kunst beziehungsweise des Künstlers ist:
Für eine bestimmte parteipolitische oder konfessionelle Richtung gibt es keine Kunst, wenn diese Richtung nicht die Richtung der Kunst ist.
In der DDR konnte Kunze nur publizieren, wenn dies ,im Sinne‘ der Herrschenden war, in der Bundesrepublik kann er veröffentlichten, ohne nach zensorischen Beschränkungen oder nach den Erwartungen der Regierenden fragen zu müssen. Auf diesen kulturpolitisch erheblichen Unterschied hat auch das vergleichende Kulturpolitische Wörterbuch von Langenbucher, Rytlewski und Weyergraf aufmerksam gemacht:
Das grundlegende Dogma der bundesdeutschen Ästhetik ist das von der Autonomie der Kunst […] Ein breiter Konsensus trägt den politischen Sinn dieses Dogmas. Der Staat verzichtet weitgehend auf Reglementierung des Kunstschaffens, garantiert die Freiheit der Kunst und hält seine Organe zu einer extensiven Auslegung des ästhetischen Freiraums auch dort an, wo diesem, wie im Fall der Pornographie, allgemeine Bestimmungen des Strafgesetzes entgegenstehen. Die faktische Einflußnahme des Staates oder einzelner seiner Organe auf Kunstproduktion und -verwertung durch Förderung, Preisvergabe und über die öffentlich-rechtlichen Medien ist unbestreitbar, jedoch der Idee nach balanciert. Ganz anders stellt sich die Situation in der DDR dar. Das Dogma der offiziellen Ästhetik lautet unverändert, daß Inhalt und Richtung der Kunstproduktion durch die Lenkungsorgane des Staates festgelegt werden. Der politisch-ideologische Führungsanspruch der SED schließt die Kontrolle der Kunstproduktion ein. Ästhetische Theorie ist daher von vornherein Auslegung der dialektisch-materialistischen Doktrin, die Aufgabe besteht in der Ausrichtung der ästhetischen Produktion an der Parteilinie.
Als Schriftsteller der DDR hatte Reiner Kunze über fünfzehn Jahre lang die Verteidigung der Poesie gegen den Anspruch der staatsoffiziellen Kunstdoktrin einer Funktionsästhetik zum zentralen Thema seines literarischen Werkes gemacht und sich für ein autonomes Kunstverständnis engagiert. Dasselbe Engagement wäre für einen Schriftsteller der Bundesrepublik, wo die Autonomie der Kunst als ein ästhetisches „Dogma“ gilt, risikolos und kaum mehr als affirmativ. Dennoch hat Reiner Kunze auch nach der Übersiedlung die Verteidigung der Poesie nicht aufgegeben. Als ehemaliger DDR-Schriftsteller hat er sich bis zum Ende der DDR für einer Liberalisierung der Kulturpolitik in der DDR und für dort unterdrückte Schriftsteller und Künstler engagiert. Als Schriftsteller der Bundesrepublik setzt er sich kritisch mit einer Kulturindustrie auseinander, in der der Warencharakter der Kunst und die Frage des Marktwertes dominieren. Auch gegen diese Zwänge gilt es, die Poesie zu verteidigen.
Bis zum Jahr der Übersiedlung war der bundesdeutsche Literaturbetrieb für Reiner Kunze kein Thema kritischer (poetischer) Stellungnahme; im Gegenteil: die Präsenz im Literaturbetrieb und in den Medien der Bundesrepublik hatte für den angefeindeten DDR-Autor eine nicht zu überschätzende Schutzfunktion. Der Film Die wunderbaren Jahre und dessen Ablehnung durch die Filmkritik veranlaßten Kunze zu einer stärkeren Distanzierung von den Mechanismen des Marktes und der Medien. Auch in Gedichten wird aus diesem Rückzug in die Distanz eine Verteidigung der Poesie mit den Mitteln der Poesie. Dadurch unterscheidet sich Kunze von Autoren wie Biermann, Kunert oder Sarah Kirsch, die sich mit dem Literaturbetrieb in der Bundesrepublik so nicht auseinandersetzen. Rolf Eigenwald hat 1983 mit Recht herausgestellt, daß ein Schriftsteller die Grenze zwischen zwei gegensätzlichen politischen Systemen nicht ohne Folgen für seine Veröffentlichungspraxis überschreitet:
Der bundesrepublikanische Literaturbetrieb duldet keine Atempausen, keine Schweigezeit; das Wechselspiel von Verheimlichung und Publikation poetischer Texte wird von ganz anderen Regeln beherrscht als in der DDR.
Daß Reiner Kunze dies schon bald nach seiner Übersiedlung erkannt hat und zu spüren bekam, zeigt seine Antwort auf die 1980 in einer Umfrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gestellte Frage, ob es in der Bundesrepublik politische oder gesellschaftliche Zwänge gebe, durch die er sich eingeschränkt oder behindert fühle:
Zum Beispiel die Annahme, daß sich ein Autor ständig öffentlich zu äußern habe. Ich hatte darum gebeten, auf meine Teilnahme an dieser Umfrage verzichten zu wollen. Die Folge: ein Brief, ein Telegramm und ein Anruf, der mich an meine Dankesschuld gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erinnerte und mir mit der Kündigung des freundschaftlichen Wohlwollens drohte. Eine Reaktion, die mir in der Bundesrepublik bereits ungezählte Male widerfahren ist. Ich meine aber nicht, immer etwas zu sagen zu haben, wenn andere glauben, daß ich etwas sagen müsse, und manches – es ist für mich das Wesentliche – kann ich bestenfalls in meinen Büchern sagen. Außerdem scheint es mir, daß viele der insistierenden Fragesteller – Herrn Reich-Ranicki nehme ich in diesem Fall aufrichtig aus – gar nicht hören wollen, was man denkt Sie wollen hören, was sie denken, und stehen die eigenen Erfahrungen dem entgegen, kann es geschehen, daß man hier von einer ebensolchen Woge politischer Verdächtigungen überspült wird wie in der DDR. Die publizistischen Methoden stehen an Infamie denen in der DDR mitunter in nichts nach. Ist es dann aber verwunderlich, daß man solcher Angriffe müde ist und sich auf das Eigentliche zurückzieht, das man doch gar nicht hatte verlassen wollen? In seinem Brief vom 3.9.1980 schreibt mir Marcel Reich-Ranicki: „Ich glaube, für vielerlei Verständnis zu haben, aber ich habe kein Verständnis dafür, daß ein Schriftsteller … sich in unserer Gesellschaft weigert, derartige Auskünfte zu erteilen. Ist denn dazu Mut nötig?“ Nein. Aber offenbar dazu, sie nicht zu erteilen und als Schriftsteller langsam, hartnäckig und mit einem möglichst großen Maß an Verantwortung an einem kleinen Buch zu arbeiten.
Mit einem leicht zu entschlüsselnden Gedicht aus dem Jahre 1980 wendet sich Reiner Kunze an den damaligen Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und gegen die Norm der tagespolitischen Aktualität für die Literatur:
APFEL FÜR M. R.-R.
aaaaaaaaaaIch finde, es ist höchste Zeit, daß es wieder
aaaaaaaaaaetwas Neues von Ihnen zu lesen gibt.
aaaaaaaaaa(M. R.-R., brief vom 12. dezember 1978)
aaaaaaaaaaBitte lassen Sie von sich hören und schicken Sie
aaaaaaaaaamir Manuskripte, denn es ist ja nun höchste
aaaaaaaaaaZeit, daß es in unserer Zeitung etwas von Ihnen
aaaaaaaaaazu lesen gibt.
aaaaaaaaaa(M. R.-R., brief vom 29. mai 1980)
Höchste zeit kommt von innen
Höchste zeit ist, wenn die kerne
schön schwarz sind
Und das weiß zuerst
der baum
Das antithetisch strukturierte Widmungsgedicht läßt den langen, redundanten und gezielt ausgewählten Briefzitaten aus einem Zeitraum von anderthalb Jahren einen fünfzeiligen, knappen, auf wenige Worte beschränkten poetischen Kommentar folgen. Kunzes Ablehnung eines Literaturbetriebes, der Literatur als Ware betrachtet, die sich den Gesetzen von Angebot und Nachfrage zu unterwerfen hat, ist humorvoll und versöhnlich formuliert. Als arrivierter Autor kann Kunze, ohne seinen ,Marktwert‘ zu gefährden, mit der traditionellen Reifemetapher gegen die Ansprüche des auf Aktualität fixierten Feuilletonchefs argumentieren. Verweigert hat sich Kunze seit seiner Übersiedlung der Presse und den Medien nicht – was unter anderem die Interviewbände In Deutschland zuhaus, Zurückgeworfen auf sich selbst und Begehrte, unbequeme Freiheit unter Beweis stellen -–, aber er hat vornehmlich und ausführlich in regionalen Zeitungen und Rundfunkanstalten Rede und Antwort gestanden. Auch wenn Kunze die Tätigkeit des Lyrikers emphatisch, definiert als eine die „allen Marktgegebenheiten hohnspricht“, so bleibt er im Umgang mit diesem Markt Realist und Pragmatiker:
Die Kriterien des Marktes; wären ja ebenso außerliterarische Kriterien, wie es die Kriterien der Ideologie sind. Aber ich kann nicht ohne den Markt leben. Ich muß also den Markt akzeptieren, ohne daß ich ihm auch nur den geringsten Einfluß zubillige auf die Substanz dessen, was ich tue.
Das Gedicht „Apfel für M. R.-R.“ ist das poetologische Programm eines Autors, der das Entstehen und Wachsen eines Gedichts, nicht aber dessen Machbarkeit und Verfügbarkeit gelten läßt. Kunze will sich im Literaturbetrieb der Bundesrepublik behaupten, aber nicht gegen, sondern in ihm. So bleibt beispielsweise die Frankfurter Allgemeine Zeitung für ihn auch weiterhin ein großes überregionales Forum, um Offene Briefe, Statements und Interpretationen zu veröffentlichen.
Allerdings ist festzuhalten, daß Reiner Kunze in den fünfzehn Jahren seit seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik (1977-1992), abgesehen von dem Band Wohin der Schlaf sich schlafen legt mit Gedichten für Kinder, nur zwei neue Gedichtbände publiziert hat. Abseits vom Markt der renommierten Literaturverlage hat er in der Edition Toni Pongratz, einem Ein-Mann-Verlag in Hauzenberg im Bayerischen Wald, viele kleine, oft auch bibliophile Bücher in geringer Auflage herausgebracht. Die Verbreitung, Rezeption und Anerkennung von Kunzes Büchern ist in Bayern besonders groß. Bereits 1973 wurde ihm der Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste verliehen, und seit 1974 ist Kunze Mitglied dieser Akademie. 1979 erhielt er den Bayerischen Filmpreis und 1981 den Geschwister-Scholl-Preis der Stadt München. Die Stadt Wangen verlieh ihm 1984 den Eichendorff-Literaturpreis. 1988 wurde Kunze mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Im Wintersemester 1988/89 übernahm er die Gastdozentur für Poetik an der Ludwig-Maximilians-Universität, und 1989 erhielt er den Kulturpreis Ostbayern. Schließlich nahm Reiner Kunze teil an einer vom bayerischen Kultusminister unterstützten und vom Arbeitskreis Literatur in der Schule veranstalteten großen Lesereise durch Schwaben und Oberbayern.
Für die Rezeption des Bandes auf eigene hoffnung, der in der DDR offiziell überhaupt nicht wahrgenommen wurde, ist indes eine starke Divergenz im Urteil der bundesdeutschen Rezensenten kennzeichnend. Neben abwägenden Urteilen von Joachim Kaiser und Peter Demetz steht die ablehnende Kritik von Hans-Jürgen Heise und die nachhaltige Zustimmung von Albert von Schirnding. Bemerkenswert bleibt, daß Werner Ross die Laudatio auf den Geschwister-Scholl-Preisträger 1981 zu einer Verteidigung des Dichters und des Bandes auf eigene hoffnung gegen die polemische Kritik Heises werden ließ.
Unbefangener, sachlicher und konstruktiver als die bundesdeutschen Arbeiten sind die in Frankreich und Amerika erschienenen Artikel und Aufsätze zu Kunzes erstem Gedichtband nach seiner Übersiedlung. So widmen sich Jay Rosellini und Françoise Ferlan ausführlich den sprachlichen, ästhetischen und thematischen Eigenheiten von auf eigene hoffnung und fragen sensibel und kritisch nach Kontinuität und Diskontinuität im Werk Kunzes. Beide kommen zu dem Ergebnis, daß dem Band in allen Bereichen Kontinuität zu bescheinigen sei, ohne dies dem Autor sogleich zum Vorwurf zu machen. Beide fragen auch nach der weiteren Entwicklung eines Schriftstellers, der nach dem Staatenwechsel verstärkt die vermittelnde und weniger die gesellschaftskritische Rolle der Literatur zu übernehmen scheint. Jay Rosellini kommt beim Vergleich der Gedichtbände Zimmerlautstärke und auf eigene hoffnung zu einem eindeutigen und bedenkenswerten Urteil, das allerdings in klarem Widerspruch steht zu Kunzes Selbst- und Kunstverständnis:
Der Dichter Kunze ist poetisch und gedanklich am überzeugendsten, wenn er sich herausgefordert fühlt, wenn er gegen etwas Stellung bezieht […] seine ,konstatierende Trauer‘ ist bei weitem nicht so effektiv wie seine trauernde Wut.
Heiner Feldkamp: Poesie als Dialog. Grundlinien im Werk Reiner Kunzes, S. Roderer Verlag, 1994
Lyrische Juwelen
Ungefähr das, was ein Diamantschleifer mit Rohdiamanten macht, das macht Reiner Kunze mit Worten und Gedanken. Sein Vorgehen ist präzise, behutsam, bedächtig und geprägt von meisterlichem handwerklichen Können. So entstehen lyrische Juwelen.
Manch einer glaubt vielleicht: So ein Gedicht ist schnell geschrieben. Ein paar Zeilen und fertig. Und dann gleich das nächste. Es gibt Leute, die schreiben so. Aber nicht Reiner Kunze. Sein Wesen ist geprägt von Demut und Ernsthaftigkeit. Wer ihn einmal „live“ erlebt hat anläßlich einer Lesung, wird das bestätigen können.
Das war ein unvergeßliches Erlebnis: Da steht dieser bescheidene, freundliche, stille Mann vor dem Publikum auf der Bühne und liest. Irgend ein wohlmeinender Veranstaltungshelfer springt herbei und will ihm einen Tisch und einen Stuhl bringen. Er lehnt es höflich, aber entschieden ab mit der Begründung, er stehe lieber. Und zwar aus Respekt vor den Menschen, die gekommen sind, um ihn zu hören.
Eine Lektion in Demut. Da ist man wie vom Donner gerührt. Es gibt so viele Wichtigtuer und Schwätzer, die wie Stars behandelt werden wollen. Dieser Mann aber hat Respekt vor seinem Publikum. Und vor seinen Lesern. Und so schreibt er auch. Keine Zeile, über die er nicht tausendmal nachgedacht hat. Kein leeres Geschwätz. Keine Phrasendrescherei. Sorgfältiges, vielleicht jahrelanges Suchen nach der richtigen Formulierung. Nach dem treffenden Wort. Nach dem richtigen Bild. Nach der Wahrheit. Was dabei herauskommt, hat Bestand und überdauert die Zeit.
Katja Wolff, amazon.de, 9.10.2004
Wenn Gedichte den Gedanken auf den Punkt bringen
Ich habe gerade Kunzes Gedichte Auf eigene Hoffnung gelesen. Gedichte sind sicher die persönlichste Form der Literatur. Ich lese sie nicht, um sagen zu können, „ich habe Kunze gelesen“, sondern auf der Suche nach Gedichten, die mich unmittelbar ansprechen, bei denen ich sage: „Ja, so ist es und es kann nur so, in dieser Form, als Gedicht, ausgedrückt werden.“ In diesem Sinne liessen mich die meisten von Kunzes Gedichten kalt. Zwei sprangen mich allerdings unmittelbar an. Das Gedicht „In Deutschland“ über den Reiseerlass der DDR von 1973. Kunze zitiert aus einem Brief aus Altenburg/Sachsen von 1979: „nur noch achtzehn Jahre…“ (bis zur Möglichkeit des Verwandtenbesuchs im Westen) und fährt dann fort: „Das grab herbeisehnen / um am tisch des freundes / eine tasse tee trinken zu dürfen“. Kann man die Konsequenzen der deutschen Teilung lakonischer und gleichzeitig herzzerreissender auf den Punkt bringen? Gibt es eine bessere Antwort an all jene, die die DDR verharmlosen? Ebenso präzise und überzeugend das Gedicht „Geistlicher Würdenträger, Künstlern ins Gewissen“:
Er sagte nicht: seid
schöpfer
Er sagte: dient
dem glauben
So gering ist sein glaube
in die schöpfung
Wegen dieser beiden Gedichte war Kunzes Band – für mich – der Lektüre wert.
Walter Stechel, amazon.de, 22.7.2012
Gespräch mit Reiner Kunze
… geben sie mir das beste Clavier von Europa, und aber leiüt zu zuhörer die nichts verstehen, oder die nichts verstehen wollen, und die mit mir nicht Empfinden was ich spielle, so werde ich alle freüde verlieren.
Wolfgang Amadeus Mozart
Jürgen P. Wallmann: Herr Kunze, mehr als vier Jahre nach Ihrer Übersiedlung aus der DDR in den Westen ist kürzlich Ihre erste hier entstandene Buchpublikation herausgekommen, der Gedichtband auf eigene hoffnung. Er erscheint fünf Jahre nach Ihrem Prosabuch Die wunderbaren Jahre und neun Jahre nach dem Lyrikband zimmerlautstärke. Hier im Westen treffen Sie auf ein anderes Publikum mit anderen Leseerwartungen als in der DDR. Hat das Ihr Schreiben beeinflußt – oder denken Sie beim Schreiben nicht an die Leser?
Reiner Kunze: Jeder Leser hat seine eigenen Erwartungen. An welchen Leser sollte ich mich halten? Abgesehen davon, daß ich nur die wenigsten kenne. Ein Autor denkt an die Leser, indem er an sein Buch denkt. Das Buch sucht sich dann seine Leser – hier wie dort, hier und dort.
Wallmann: Mir scheint eine Kontinuität erkennbar zu sein, die Ihre neuen Gedichte mit dem früheren Werk verbindet, formal und thematisch. Hätten Sie diese neuen Gedichte auch in der DDR schreiben können?
Kunze: Nein. Einer, der durchatmet, erlebt die Welt anders als einer, den man würgt. Außerdem habe ich hier Erlebnisse, die ich in der DDR nicht hätte haben können. Wenn Sie Kontinuität feststellen, ist das kein Widerspruch. Der Autor ist derselbe.
Wallmann: Ein Kapitel Ihres neuen Gedichtbuches hat als Motto ein Wort des Erasmus von Rotterdam: „Von niemandem vereinnahmbar.“ Welche Gefahren der Vereinnahmung sehen Sie, drüben und hier? Denken Sie an die Politik, an dem Literaturbetrieb?
Kunze: Versuche, jemanden zu vereinnahmen, gibt es in allen Lebensbereichen. Die Gefahren liegen zum einen in den Verlockungen, also in den Möglichkeiten, die einem geboten werden, wenn man bereit ist, sich vereinnahmen zu lassen, und sie liegen zum anderen in der Angst vor den Folgen, wenn man sich widersetzt. Die Art der Folgen ist in der DDR gewiß anders als hier. Dort sind die Vereinnahmer an der Macht, hier haben sie nur Macht. Aber es genügt publizistische Macht, um das Leben eines Menschen zu zerstören.
Wallmann: Dem neuen Buch ist das Wort von Gottfried Benn über die Resignation vorangestellt. Können Sie das erläutern? Steht Resignation nicht im Widerspruch zu dem Wort „Hoffnung“ im Titel des Buches?
Kunze: Die Hoffnung bezieht sich auf einzelne Menschen, die Resignation auf die Menschheit.
Wallmann: Was sagen Sie denen, die aus Ihren neueren Arbeiten einen Rückzug aus der Welt, einen Eskapismus meinen herauslesen zu können?
Kunze: Nichts. Sie müssen selbst darauf kommen, daß sie einer Täuschung unterliegen, und dazu bedürfen sie bestimmter Erfahrungen. Entweder sie machen sie eines Tages, oder sie machen sie nicht.
Wallmann: Aus einigen Gedichten klingt, so scheint es mir, die Sorge darüber heraus, daß die westlichen Demokratien gefährdet sind. Vor welchen Gefahren wollen Sie warnen?
Kunze: Am 15. Februar 1981 sagte der Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, an dem Tag, an dem die Werktätigen der Bundesrepublik an die sozialistische Umgestaltung der Bundesrepublik Deutschland gehen würden, werde sich die Frage der Wiedervereinigung völlig neu stellen. Daran, wie man sich dann entscheiden würde, bestehe kein Zweifel… Anders gesagt: Man würde bei der sozialistischen Umgestaltung der Bundesrepublik deren Werktätige nicht allein lassen. Davor möchte ich warnen; denn daran, was dann kommt, besteht ebenfalls kein Zweifel. Avraham Shifrin, ehemaliger sowjetischer Staatsanwalt, zum Tode verurteilt, zu fünfundzwanzig Jahren begnadigt und jetzt in Israel lebend, veröffentlichte vor kurzem eine Dokumentation über zweitausend sowjetische Lager, Gefängnisse und psychiatrische Kliniken mit politischen Gefangenen. Shifrin sieht diese Lager für die Westeuropäer immer näher kommen. In den sowjetischen Botschaften, schreibt er, lägen Listen von Intellektuellen, die im Falle der Machtergreifung in dem betreffenden Land zu liquidieren seien.
Wallmann: Sind Sie ein politischer Dichter?
Kunze: Ich stelle mich dem Politischen dort, wo es mich als Autor stellt, wo es ins Existentielle hineinreicht. Aber ich bin kein politischer Autor, kein Autor, der schreibt, um Politik zu machen.
Wallmann: Sie haben gelegentlich für Kinder geschrieben, Ihr Kinderbuch Der Löwe Leopold (1970) etwa fand großen Zuspruch und wurde mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet: Und in einigen Monaten erscheint unter dem Titel Eine stadtbekannte Geschichte ein neues Buch für Kinder. Was ist Ihr Motiv, warum schreiben Sie für Kinder?
Kunze: Weil mir Kindergeschichten einfallen, und weil Kinder nach Geschichten hungern. Hinzu kommt, daß für Kinder zu schreiben heißt, sie fröhlich zu machen und dabei auf die Tragik vorbereiten zu helfen, die das Leben für jeden bereithält.
Wallmann: Wie empfinden Sie die bisweilen gereizt klingende Kritik, die an Ihrem neuen Buch geübt wurde? Sehen Sie darin eine sachliche Auseinandersetzung, oder sind da, nach Ihrer Meinung, auch gelegentlich außerliterarische Dinge mit im Spiel?
Kunze: Sich über die Motive bestimmter Kritiker zu unterhalten ist müßig. Außerdem: Ebensowenig, wie die Kritiker das letzte Wort haben werden, steht es dem Autor zu. Das letzte Wort hat noch immer die Zeit.
Westdeutscher Rundfunk, Mosaik 2, 27.10.1981
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Armin, Ayren: Autor K. angetreten: Kopf bei Fuß
Stuttgarter Zeitung, 10.10.1981
Bruno Bollinger: auf eigene hoffnung
Neue Zürcher Zeitung, 29.10.1981
Wolfgang Broer: Die großen Entfernungen von einem Wort zum andern
Kurier (Wien), 19.9.1981
Peter Demetz: Graue Ideen, buntes Leben.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.8.1981.
Später in: Ein Büchertagebuch. Buchbesprechungen aus der FAZ, 1982
Rolf Eigenwald: Verstummen oder sich äußern. Reiner Kunze, der SchuI- und Literaturbetrieb
(zu dem Gedicht „Apfel für M.R.-R.“)
Rudolf Wolff (Hrsg.): Reiner Kunze. Werk und Wirkung, Bouvier, 1983
Heiner Feldkamp: Freiheitsgrade innen und außen
Praxis Deutsch, Heft 49, 1981
Heiner Feldkamp: Existieren an der Baumgrenze
(zu dem Gedicht „Zu sterben beginnen“)
Stuttgarter Zeitung, 16.8.1983
Françoise Ferlan: Auf eigene Hoffnung – Reiner Kunze entre le doute et l’espoir
Allemagnes d’Aujourd’hui, Heft 79, 1982
Gertrud Fussenegger: Mit genauem Stift
(Zu dem Gedicht „Hallstatt mit schwarzem Stift“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.7.1982
Später in: Marcel Reich-Ranicki (Hrsg.): Frankfurter Anthologie 7, Insel Verlag, 1983
Voker Hage: Gegen Verlockungen
(zu dem Gedicht „Tagebuchblatt 74“).
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.12.1978
Später in: Marcel Reich-Ranicki (Hrsg.): Frankfurter Anthologie 4, Insel Verlag, 1979
Manfred Jäger: Schreiben unter veränderten Bedingungen
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 18.10.1981
Joachim Kaiser: Ahnungen und Treffer
Süddeutsche Zeitung, 5./6.9.1981
Christian Klotz: Wieviel deutsche Lyriken? Gedichte von Reiner Kunze, F.C. Delius und G.K. Zschorsch
Frankfurter Rundschau, 14.10.1981
Wolfgang Kopplin: Reiner Kunzes Auf eigene Hoffnung
Bayernkurier, 17.10.1981
Karl Krolow: Gedichte der Sorge und des Auftrags
General-Anzeiger (Bonn), 2.10.1981
Paul Konrad Kurz: Verse ohne Wunde
Die Presse (Wien), 17./18.10.1981.
Später in: Ders.: Zwischen Widerstand und Wohlstand. Zur Literatur der frühen 80er Jahre, 1986
Rainer Mammen: Die Erde ist uns sicher
Bremer Nachrichten, 15.9.1981
Wolfgang Minaty: Bis ins Blut kreist der Habicht
Die Welt, 29.8.1981
Jay Rosellini: „des fahnenhissens bin ich müde, freund“. Der Lyriker Reiner Kunze meldet sich wieder
Studies in GDR, Heft 3, 1982
Jürgen P. Wallmann: Auf knappestem Raum ein Höchstmaß an Ausdruck
Deutschland Archiv, Heft 10, 1981
Später in: Literatur und Kritik, Heft 175/176, 1983
Begegnungsblitze
Diese ganz ruhige, beharrliche Kühnheit in den Worten – und die Worte auf Blättern, die andere abgeschrieben hatten, weil es die Gedichte nicht als Buch zu kaufen gab. Niemals wieder las ich so viele per Hand oder per simpler Schreibmaschine vervielfältigte Texte wie in den siebziger Jahren jene von Reiner Kunze oder Wolf Biermann. Erst wer ein Gedicht abschrieb und auswendig lernte, inhalierte es wirklich, eignete es sich an.
Ja, er saß allein am Tisch im Schriftstellerverband. Zum allerersten Mal fuhr ich mit dem fast schon exmatrikulierten und bald als verhafteten DDR-Schriftsteller in die West-Öffentlichkeit tretenden Jürgen Fuchs nach Weimar zu einer Einladung des Schriftstellerverbandes. Wir waren Gäste. Bis auf den Dichter Wulf Kirsten wollte offenbar keiner mit Kunze reden. „Wir setzen uns zu ihm“, sagte Jürgen Fuchs fröhlich entschlossen, und ich durfte einem Menschen von großer Freundlichkeit, vorsichtiger Herzlichkeit begegnen. Einer, der nicht viel sagte in dieser Situation, uns aber sofort ernst nahm und Interesse am anderen ausstrahlte. (Kurz darauf lud man Jürgen Fuchs nicht mehr nach Weimar ein, dann bekam ich auch keine Einladungen mehr und musste/durfte den jämmerlichen Rausschmiss des Greizer Dichters aus dem Verband nicht mehr erleben.)
Dieser wunderbare Ernst eines Menschen und in seinen Versen geläutert durch eine große Gelassenheit, Dichter und Gedichte hatten so gar nichts Verdruckstes, Gebeugtes – aber ihnen fehlte auch jede Lärmbereitschaft, die Worte sollten einfach für sich sprechen.
Erhellende Metaphern, die den Verstand anregen. Das Gefühl zu fliegen, ohne von der Erde abgehoben zu sein.
Und dann sein Gedichtband in der DDR, den alle, aber auch alle zu lesen schienen. Der Dichter selbst trat durch die Texte fast zurück, sie lebten unabhängig von ihm und strahlten mehr als in den Texten anderer Lyriker eine Ahnung von dem aus, wie Verdichtung und Dichtung einander brauchen. Das Gedicht als unmittelbarster Ausdruck sprachlicher Intensität, eine Zeile kann ganze Zeitungsberge aufwiegen, sie schützte vor den Anmaßungen der Welt. Nein, ich werde keine seiner Zeilen zitieren in diesem Text – sie sollten für sich gelesen werden: nicht zwischen Deutungsprosa dazwischen geklemmt. Reiner Kunze ist bis heute ein großer Dichter geblieben, der in seinen Kindergedichten (Verse über das Menschenkind in einem jeden) oder auch in spannungsvollen Zeilen über die USA immer bewiesen hat, dass er keine DDR als Resonanz- und Erlebnisraum brauchte, um immer wieder ein Dichter zu sein. Manche wollten und wollen das so nicht wahrnehmen, weil sie sonst eigene Vermutungen revidieren und damit die eigene Vermutungsfähigkeit in Frage stellen müssten.
Und dann das Jahr der „Wunderbaren Jahre“, plötzlich war er ein Bestseller-Autor (im Westen) und ein richtig verbotener Autor im Osten, bis man ihn schließlich aus der DDR hinausekelte. Andere kamen für das Weiterreichen des Buches ins Gefängnis – ein Buch, das gerade in der „Offenen Jugendarbeit“ und anderen Kreisen der Evangelischen Kirche eine große Wirkung entfachte: Die kurzen Texte (in der Tradition vieler deutscher Miniaturen von Lessing und Hebbel bis Günter Eich) handeln alle auch von Angst und Angstüberwindung. Sehr schön, sehr erhellend, wie er Erlebnisse seiner Tochter eingebaut hat – eine interessante junge Frau, die ich immer wieder einmal auf der Post in Jena (da arbeitete sie) oder in der kommuneähnlichen Gemeinschaftswohnung traf, in der sie lebte. Wer Kinder hat, erlebt die ihn umgebende Gesellschaft eben noch einmal anders. Er macht Erfahrungen, die er allein oder kinderlos zu zweien nicht machen würde.
Die wunderbaren Jahre sagen einiges aus über eine DDR, in der vieles im Machtgefüge porös geworden und dennoch weiter bedrohlich gefährlich war. Der Dichter zeigte seine Unberechenbarkeit, indem er sich gestattete, die Lyrik einfach einmal zu verlassen, ohne sie zu vergessen. Und wie schon angedeutet: Unter Autorenkollegen hielt sich die Begeisterung über den Band – sicher aus verschiedenen Gründen – in Grenzen. Ich kenne aber Jugendliche aus nicht so literaturinteressierten Kreisen, für die mit diesem Kunze-Buch Literatur in der DDR interessant zu werden begann.
Ich setzte mich mehrfach auf Lyrikschreibentzug – und bin immer rückfällig geworden.
Der Reiz seiner Prosa – auch der späteren: ähnlich und doch anders als in den Gedichten: Intensität, das Erhoffte im Unerwarteten.
Ein Gedicht habe ich ihm gewidmet – vor gar nicht so langer Zeit:
DER WIRKLICHE DICHTER
für Reiner Kunze
Der wirkliche Dichter
schreibt nicht.
Nein, er schreibt nicht.
Er fühlt ein Bild
und weint vor Glück.
Er würde vertreiben sein Gedicht,
wenn er mit dem Text begänne.
Aber Reiner Kunze soll doch noch das letzte Wort in diesem kleinen Text bekommen: keine Prosa und schon gar kein Gedicht, auch keines seiner vorzüglich nach- und eigentlich neugedichteten aus dem Tschechischen, auch nichts aus seinen wenigen wunderschönen Büchern für Kinder – sondern ein Essay aus dem Jahr 1965. Entdeckt in der Zeitschrift ndl, die kurz vor dem 11. Plenum mit seinen Verboten den Autor doch einmal in die Zeitschrift des DDR-Schriftstellerverbandes hereinließ: „Maßstab und Meinung“ hieß der Text, der als Genre voller Understatement „Fünf Anmerkungen“ notierte. Zwei Seiten, die ich in der Bibliothek abschrieb und dann abtippte. Zwei Seiten, die einen hellwachen Autor vorführen, der den Leser in jedem Satz zur Neugier verführt. Ein Satz aus der Anmerkung vier:
Manchem, der glaubt, über Poesie den Stab brechen zu dürfen, sollte zumindest die Hand ein wenig zittern.
Lutz Rathenow, aus Matthias Buth und Günter Kunert (Hrsg.): Dichter dulden keine Diktatoren neben sich, Verlag Ralf Liebe, 2013
„Im Einbaum versteckt…“
Reiner Kunze sagte einmal, das Jahr 1959 sei in seinem Leben „die Stunde Null“. Es war das Jahr, in dem er nach Angriffen und Schikanen seine Stelle an der Universität Leipzig aufgab und erkrankte. Und es war das Jahr, in dem er seine tschechische Frau kennen lernte und damit die Tschechoslowakei. Für den 1933 in Oelsnitz im Erzgebirge geborenen Sohn eines Bergmannes war es der Abschied von der ideologischen Verengung und Verblendung der DDR, in die er hineingezogen worden war.
Mein vater, sagt ihr,
mein vater im schacht
habe risse im rücken,
narben,
grindige spuren niedergegangenen gesteins,
ich aber, ich
sänge die liebe
ich sage: eben deshalb.
Die, die ihn 1959 aus der Universität Leipzig drängten, wollten nicht Gesänge der Liebe, sondern Gesänge der Agitation: Friedenskampf und Arbeiterlob. In der tschechischen Poesie lernte Reiner Kunze einen anderen Ton kennen.
Der Beginn seiner Bekanntschaft mit Böhmen ist schon poetisch. Eine Dame aus Usti nad Labem schrieb ihm eine Postkarte, nachdem sie Gedichte von ihm im Leipziger Rundfunk gehört hatte. Daraus entstand eine umfangreiche Korrespondenz, bis die beiden sich endlich sehen konnten. Ein Bewohner der DDR konnte nicht ohne weiteres einen Bewohner des benachbarten Brudervolkes besuchen. Erst eine Gruppenreise nach Prag brachte die erste Begegnung. Reiner Kunze lebte dann einige Zeit in Usti, kam aber auch in das liebliche Südmähren, woher seine Frau stammt, in das Land der Rebenhügel und Weindörfer. In Brünn lernte er den Lyriker und Übersetzer Ludvik Kundera kennen und dessen Vetter, den Romancier Milan Kundera und – nicht zuletzt – den Poeten Jan Skácel, mit dem ihn eine enge Freundschaft verband.
„Was ich der Tschechoslowakei alles verdanke“, sagte er später, „kann ich vielleicht gar nicht ermessen. Sie bedeutete damals für mich eine Art menschlicher Auferstehung… Die Tschechoslowakei war für mich für fast ein Jahrzehnt geistiges Asyl und literarische Heimat. Die meisten Gedichte, die 1969 in meinem Rowohlt-Band sensible wege erschienen sind, waren vorher in tschechischer Übertragung publiziert worden.“
Es waren diese sechziger Jahre in der Tschechoslowakei, die man später in der Zeit der sogenannten Normalisierung unter Husak ironisch „die gute alte Zeit unter Novotny“ nannte. Es gab eine Lockerung des Systems und dann eine Öffnung, vor allem im kulturellen Bereich, die schließlich zum sog. Prager Frühling führte, der vergeblichen Hoffnung auf einen Sozialismus „mit menschlichem Antlitz“. So konnte 1964 Milan Kundera in der Wochenzeitung des tschechischen Schriftstellerverbandes offen über die Schikanen schreiben, die Reiner Kunze in der DDR zu erdulden hatte, und dessen tschechische Entwicklung nachzeichnen:
Die tschechische Inspiration bringt Kunze jedoch auch etwas völlig Neues: vor allem das große schicksalhafte Erlebnis, das bewirkte, dass Kunze, bisher Autor kleiner lyrischer Impressionen oder gedanklicher Fabeln, plötzlich Gedichte von kompliziertem dramatischem Aufbau schreibt. Am meisten zeugt davon vielleicht das Gedicht „In der Thaya“, wo er das befreiende Erlebnis seines Aufenthaltes in Znojmo mit traumatischen Erinnerungen konfrontiert.
Sicher, das kurze epigrammatische Gedicht, die knappe Impression oder der Gedankensplitter, oft ironisch gewendet oder paradox verschränkt, ist geblieben bis heute, auch wenn der politische Anlass nicht mehr der vorherrschende ist. Doch das „lange Gedicht“ – mit Walter Höllerer zu sprechen, der es einmal hervorhob – ist, inspiriert von der tschechischen Poesie, die wesentliche Bereicherung bis heute: die Welthaltigkeit, auch wenn es Dinge des Alltags sind, Verknappung auch hier, aber auch Ansätze des Epischen, genaue Bilder und Fülle im Ausgesparten sozusagen. Ein spätes schönes Beispiel aus den neunziger Jahren ist der Zyklus ein tag auf dieser erde, der den Kreis des Tages abschreitet, in Haus und Garten, Stadt und Feld und der auch den Kreis des Lebens umfaßt.
Reiner Kunzes Dank an die tschechische Poesie sind seine zahlreichen Übersetzungen. Kein deutscher Lyriker hat, sehe ich recht, so viele tschechische Poeten übersetzt und so hervorragend. Vor allem übertrug Reiner Kunze natürlich Gedichte seines Freundes Jan Skácel, so dass aus dieser Freundschaft eine Art deutsch- tschechischer Symbiose entstanden ist. Volker Strebel hat die Übersetzungen Reiner Kunzes aus dem Tschechischen eingehend untersucht, Original und Übertragung verglichen. Das ist die späte Ernte der hoffnungsvollen sechziger Jahre in Böhmen und Mähren.
Der Einmarsch der sowjetischen Panzer brachte dem Prager Frühling im August 1968 ein brutales Ende; die Folgen sind bekannt. Milan Kundera und viele andere emigrierten. Auch für Reiner Kunze war 1968 ein Einschnitt. Es folgte der endgültige Abschied von der SED – er gab sein Parteibuch zurück – und es begann die intensivere „operative Behandlung“ durch die Staatsicherheit, die ihn „zersetzen“ wollte und seine Familie auch. 1973 zu Beginn der Honecker-Ära konnte noch einmal ein Gedichtbändchen bei Reclam Leipzig erscheinen, dann nichts mehr. Der Gedichtband sensible wege, der 1969 bei Rowohlt herauskam, brachte heftige Reaktionen der Kulturbürokratie. 1976 nach dem Erscheinen des Prosa-Bandes Die wunderbaren Jahre im Fischer- Verlag brach dann der Sturm los. Reiner Kunze wurde aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen.
Die wunderbaren Jahre sind ein wichtiger Prosa-Band geblieben, der über seinen Anlass hinaus Bestand hat: Schwierigkeiten mit den gesellschaftlichen Institutionen haben junge Leute immer, solche Schwierigkeiten wie hier gibt es nur in repressiven Systemen. Es sind die genauen Beobachtungen, die lakonischen Mitteilungen, die leise Ironie, der Verzicht auf jegliches Pathos, wodurch diese Geschichten heute so eindrucksvoll sind wie am ersten Tag. Der Band wäre eine nützliche Schullektüre in Berliner Schulen. „Eine sauber gearbeitete Prosa“, sagte einer meiner Lehrer, der auch einmal ein Lehrer Reiner Kunzes war: der Literaturwissenchaftler Hans Mayer, der bis 1963 in Leipzig lehrte und danach in Hannover und Tübingen.
Als ich 1976 mit meiner Frau auf einer Reise nach Italien am Tegernsee Station machte, wo Hans Mayer zur Kur weilte, erzählte er uns während des Essens begeistert von diesem Prosa-Band, dessen Korrekturfahnen ihm der Fischer-Verlag geschickt hatte. Wir mussten unsere Weiterfahrt verschieben, um ihn auf sein Zimmer zu begleiten, wo er uns eine Stunde lang aus dem Band vorlas. „Welch ein Mut“, sagte Hans Mayer. Und:
Sie werden sich rächen.
Das geschah denn auch. Reiner Kunze musste Greiz verlassen; im April 1977 übersiedelte die Familie in die Bundesrepublik.
Das ist der dritte wichtige Einschnitt. Die Übersiedlung in die Bundesrepublik brachte ihm die ersehnte Freiheit und Freizügigkeit. Es folgten Reisen durch Europa und nach Nordamerika, die sich auch in seinen Gedichten wiederfinden. Und es folgte die Erfahrung, dass in der Bundesrepublik Menschen, die vom Elend der SED-Diktatur berichten, nicht überall willkommen sind. Reiner Kunze ist viel Häme widerfahren, Mißachtung und Geringschätzung. Die meisten germanistischen Arbeiten zu seinem Werk erschienen und erscheinen im Ausland. Den Band zu seinem 65. Geburtstag gab der polnische Germanist Marek Zybura heraus.
Die veränderten Lebensumstände geben neue Stoffe, die politischen Anlässe weichen zurück, das Gedicht öffnet sich für andere und anderes. Auf die bekannte Frage „Kann ein Gedicht die Welt verändern?“ antwortete Reiner Kunze:
Wenn ein Gedicht überhaupt etwas verändern kann, dann nur etwas in uns, im einzelnen Menschen.
Und:
Die Botschaft des Dichters – wenn er schon eine haben muß – ist das Gedicht.
Und auf die Frage nach dem „politischen Gedicht“ sagte er:
Ein dichterischer Einfall geht immer auf eine Erschütterung zurück, auf Betroffensein (auch ein Glücksmoment ist ein Moment der Betroffenheit). Dabei kann Wirklichkeit in das Gedicht eingehen, die politische Zusammenhänge wiedergibt, und es entsteht ein politisches Gedicht.
Im Gedichtband ein tag auf dieser erde steht das kleine Gedicht „WAS GILT für J. S.“, vermutlich für Jan Skácel:
Wer steinigen will,
dem wird alles zu stein
Sie richten sich an deinem grabe ein
und richten dich
Totenrichter
Und wissen nicht: den dichter richtet das gedicht
Heinrich Böll, der die Laudatio auf den Büchner-Preisträger Reiner Kunze 1977 hielt, fasste damals zusammen, was nicht nur für Kunzes Lyrik gilt, sondern für Lyrik überhaupt:
Lesen muß gelernt sein, deutsch lesen, im Einbaum versteckt zwischen den brüllenden Propagandaflotten. Reiner Kunze zu lesen… Zimmerlautstärke noch zu vernehmen: Ich hoffe, dass deutsche Augen und Ohren noch dazu fähig sind.
Die Poesie als Einbaum zwischen den brüllenden Propagandaflotten, zwischen den lärmenden Medienverbänden? Wer Ohren hat zu hören, höre.
Hans Dieter Zimmermann, aus Matthias Buth und Günter Kunert (Hrsg.): Dichter dulden keine Diktatoren neben sich, Verlag Ralf Liebe, 2013
SOMMERNACHT ÜBERM VORWALD
(fürn reiner kunze)
in de kniakehln
vo da nacht
stehts wasser
gras wachst staad
über des
was ma gestern
mitnander gredt habn
blaadln daampfln
tau liegt auf da schreibmaschin
i lieg im bett
mi frierts
Harald Grill
DIPTYCHON
für Reiner Kunze zum fünfundsechzigsten
I
Als wir auf die welt kamen
schrieb man das jahr 33
in brauner farbe
Die väter arbeitslos
wieder unter tage
brachten ersten lohn
Wir reihten uns ein
bis der endsieg mißlang
Man schrieb das jahr 45
in roter farbe
Die väter waffenlos
wieder unter tage
brachten zweiten lohn
Wir reihten uns ein
lernten tschechisch und polnisch
sprachen lasen und schrieben
bis die ausreise gelang
Nun schrieb man die jahre
in bunter farbe
Wir reihten uns ein
widerständig und mißtrauisch
denn wir haben ausschließlich gelebt
in zwei diktaturen
II
Würgemale an der gurgel
des gedichts
Im geknebelten schweigen noch
zuspruch des verses
auf eigene hoffnung
Mit aufrechtem gang
sich nach hause tastend
an gleichnissen in terroristenschrift
unterm eishimmel
am grünen holz
der poesie
Staatsfeind
angeklagt des regenbogens
den kopf hinhaltend
für einen vers
vogel mit einem flügel
Kleiner mond
im dunklen herzen
des dichters
traurig nach dir
warten wir
ungeduldig
Ernst Josef Krzywon
Michael Wolffsohn: REINER KUNZE – der stille Deutsche
In Lesung und Gespräch: Reiner Kunze (Autor, Obernzell-Erlau), Moderation: Christian Eger (Kulturredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, Halle). Aufnahme vom 17.01.2012, Literaturwerkstatt Berlin. Klassiker der Gegenwartslyrik: Reiner Kunze. Wenn die post hinters fenster fährt blühn die eisblumen gelb.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Harald Hartung: Auf eigene Hoffnung
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.1993
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Katrin Hillgruber: Im Herzen barfuß
Der Tagesspiegel, Berlin, 16.8.2003
Lothar Schmidt-Mühlisch: Eine Stille, die den Kopf oben trägt
Die Welt, 16.8.2003
Beatrix Langner: Verbrüderung mit den Fischen
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.8.2003
Sabine Rohlf: Am Rande des Schweigens
Berliner Zeitung, 16./17.8.2003
Hans-Dieter Schütt: So leis so stark
Neues Deutschland, 16./17.8.2003
Cornelius Hell: Risse des Glaubens
Die Furche, 14.8.2003
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Michael Braun: Poesie mit großen Kinderaugen
Badische Zeitung, 16.8.2008
Christian Eger: Der Dichter errichtet ein Haus der Politik und Poesie
Mitteldeutsche Zeitung, 16.8.2008
Jörg Magenau: Deckname Lyrik
Der Tagesspiegel, 16.8.2008
Hans-Dieter Schütt: Blühen, abseits jedes Blicks
Neues Deutschland, 16./17.8.2008
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Jörg Bernhard Bilke: Der Mann mit dem klaren Blick: Begegnungen mit Reiner Kunze: Zum 80. Geburtstag am 16. August
Tabularasa, 18.7.2013
artour: Reiner Kunze wird 80
MDR Fernsehen, 8.8.2013
André Jahnke: Reiner Kunze wird 80 – Bespitzelter Lyriker sieht sich als Weltbürger
Osterländer Volkszeitung, 10.8.2013
Josef Bichler: Nachmittag am Sonnenhang
der standart, 9.8.2013
Thomas Bickelhaupt: Auf sensiblen Wegen
Sonntagsblatt, 11.8.2013
Günter Kunert: Dichter lesen hören ein Erlebnis
Nordwest Zeitung, 13.8.2013
Marko Martin: In Zimmerlautstärke
Die Welt, 15.8.2013
Peter Mohr: Die Aura der Wörter
lokalkompass.de, 15.8.2013
Arnold Vaatz: Der Einzelne und das Kartell
Der Tagesspiegel, 15.8.2013
Cornelia Geissler: Das Gedicht ist der Blindenstock des Dichters
Berliner Zeitung, 15.8.2013
Johannes Loy und André Jahnke: Eine Lebensader führt nach Münster
Westfälische Nachrichten, 15.8.2013
Michael Braun: Süchtig nach Schönem
Badische Zeitung, 16.8.2013
Jochen Kürten: Ein mutiger Dichter: Reiner Kunze
Deutsche Welle, 15.8.2013
Marcel Hilbert: Greiz: Ehrenbürger Reiner Kunze feiert heute 80. Geburtstag
Ostthüringer Zeitung, 16.8.13
Hans-Dieter Schütt: Rot in Weiß, Weiß in Rot
neues deutschland, 16.8.2013
Jörg Magenau: Der Blindenstock als Wünschelrute
Süddeutsche Zeitung, 16.8.2013
Friedrich Schorlemmer: Zimmerlautstärke
europäische ideen, Heft 155, 2013
Zum 85. Geburtstag des Autors:
LN: Sensible Zeitzeugenschaft
Lübecker Nachrichten, 15.8.2018
Barbara Stühlmeyer: Die Aura der Worte wahrnehmen
Die Tagespost, 14.8.2018
Peter Mohr: Die Erlösung des Planeten
titel-kulturmagazin.de, 16.8.2018
Udo Scheer: Reiner Kunze wird 85
Thüringer Allgemeine, 16.8.2018
Jochen Kürten: Sich mit Worten wehren: Der Dichter Reiner Kunze wird 85
dw.com, 16.8.2018
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Lothar Müller: Widerstand in Jeans
Süddeutsche Zeitung, 15.8.2023
Cornelia Geißler: Dichterfreund und Sprachverteidiger
Berliner Zeitung, 15.8.2023
Antje-Gesine Marsch: Greizer Ehrenbürger Reiner Kunze feiert 90. Geburtstag
Ostthüringische Zeitung, 16.8.2023
Ines Geipel: Nachwort. Zum 90. Geburtstag von Reiner Kunze
S. Fischer Verlag
Ines Geipel: Mit dem Wort am Leben hängen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.2023
Gregor Dotzauer: Mit den Lippen Wörter schälen
Der Tagesspiegel, 15.8.2023
Hans-Dieter Schütt: Das feingesponnene Silber
nd, 15.8.2023
Stefan Stirnemann: Ausgerechnet eine Sendung über Liebesgedichte brachte Reiner Kunze in der DDR in Nöte – und mit seiner späteren Frau zusammen
Neue Zürcher Zeitung, 15.8.2023
Christian Eger: Herz und Gedächtnis
Mitteldeutsche Zeitung, 15.8.2023
Matthias Zwarg: Im Herzen barfuß
Freie Presse, 15.8.2023
Marko Martin: Nie mehr der Lüge den Ring küssen
Die Welt, 16.8.2023
Josef Kraus: Mutiger Lyriker, Essayist, Sprachschützer, DDR-Dissident, Patriot – Reiner Kunze zum 90. Geburtstag
tichyseinblick.de, 16.8.2023
Erich Garhammer: Das Gedicht hat einen Wohnort: entlang dem Staunen
feinschwarz.net, 16.8.2023
Volker Strebel: Ein deutsch-deutscher Dichter
faustkultur.de, 29.8.2023
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG + IMDb + Archiv +
Kalliope + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Rede + Interview 1, 2 & 3
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Reiner Kunze – Befragt von Peter Voss am 15.7.2013.


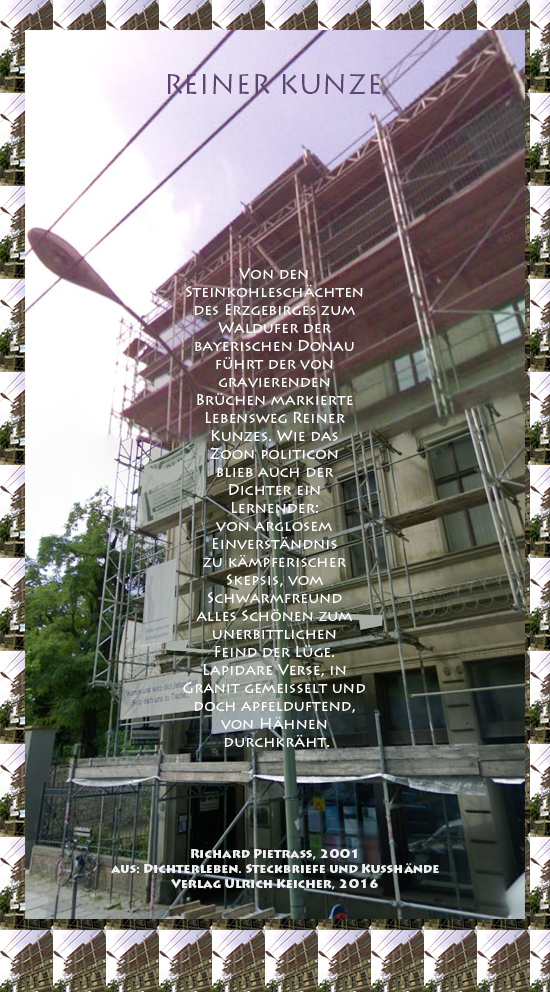












Schreibe einen Kommentar