Hans-Eckardt Wenzel: Poesiealbum 193
DAS ABSCHMINK-LIED
Still vom Klatschen und vom Schreien
Über meine derben Witze
Steh ich plötzlich vor den Reihen
Einsam, all der leeren Sitze.
Ausgetrocknet sind die Lippen,
Hals und Kopf sind leer gesungen,
Stechend ist in meiner Rippen
Käfig mir mein Herz gesprungen.
Stunden später, müd, beim Feste,
Einen scharfen Schnaps im Glase,
Stierte eine auf die Reste
Schminke über meiner Nase.
Aussatz ziert mich! Einen Narren
Hast du neben dir zu sitzen.
Hoffst, ich zög dir jeden Karren
Aus dem Dreck mit meinen Witzen.
Freilich kann ichs! Nur Sekunden,
Da die Augen sich noch drehen
In artistisch großen Runden
Um die Augen, die mich sehen.
Alles, was ich hab, verteil ich,
So erfinde ich mein Glück.
Meine Narrenfreiheit freilich
Ist ein lächerliches Stück.
Texte,
voll unverschämter nackter Prosa, aufklärerischer Prothesen, antiquarischer Gerüche, erotischer Spannung. Immer betont Wenzel die Unstimmigkeit, Unordnung, hält seinen Widerspruch hoch, wie eine Katze übers Wasser, manchmal wie ein Fetisch. Ich vertraue diesen Texten, weil sie mich fordern: an einem Punkt im Labyrinth, wo ich glaube, ahne und hoffe, es sei durchquerbar, sagt mein Begleiter lakonisch: nun lauf allein, du hast doch einen eigenen Kopf, erobre Dir das selbst, dann ist es Deins.
Steffen Mensching, Verlag Neues Leben, Klappentext, 1983
Hans-Eckardt Wenzel
Widersprüche bringen die Lieder und Gedichte Hans-Eckardt Wenzels in Bewegung. Als Autor, Sänger, Schauspieler im Liedertheater Karls Enkel sucht er die öffentliche Verständigung, braucht er die Erfahrungen seines Publikums. Indem Wenzel literarische Vorgänger befragt, die zeitliche Entfernung zur Geschichte und die räumliche zu anderen Ländern in seinen Texten aufhebt, begreift er die Gegenwart als Resultat und Wendepunkt.
Ankündigung in Wilhelm Müller: Poesiealbum 192, Verlag Neues Leben, 1983
„Das Utopische am Lachen“ oder Vom Schreiben
in der präkoitalen und der postkoitalen Gesellschaft
– Ein Gespräch mit Hans-Eckardt Wenzel. –
Kollektiv: In Ihrem Album Reisebilder, in dem Sie wie im gleichnamigen Buch das Genre der Reisebeschreibung in der Art Heinrich Heines Harzreise aufgreifen, vertonten Sie Goethes „Mignons Lied“. Aus den berühmten, fernwehen Zeilen „Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, […] Dahin! Dahin möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn“ wurde im Sauflied der CD Vollmond (1995) ein lakonisches „Dort, wo die Zitronen blühn, da will doch längst kein Schwein mehr hin!“ – Das Thema des Nichtreisen-Könnens, der Sehnsucht nach südlichen und westlichen Gefilden scheint sich in den Jahren nach der Wende eher zum Thema der Ortlosigkeit gewandelt zu haben. „Jetzt gibt es nicht einmal die Flucht“, heißt es nun. Die räumliche Sehnsucht ist nun erfüllbar, die utopische hingegen scheint verspielt, „verramscht“, sagt Volker Braun. – Jenes„ Verramschen“ begann freilich schon vor dem Mauerfall – „Sie haben uns beschissen“, singen die Clowns. Wann und wie wurde Ihnen das klar?
Hans-Eckhardt Wenzel: Die Verramschung der utopischen Illusion?
Kollektiv: Ja.
Wenzel: Schwer zu sagen, was man unter Utopie versteht. Meint man eine kulturelle, allgemein utopische Grundhaltung, so ist dies für mich nicht bedeutungslos, sonst würde ich nicht mehr produzieren, denn das ist für mich der letzte Grund für Produktion. Wenn man das Gesellschaftliche meint, jene Utopie von einer anderen Organisationsform, wurde um ’81 klar, daß ein irreparabler Zustand vorherrschte, auf der ganzen Welt, auch im Westen. Das Land, in dem wir lebten, war auf Ausgleich ausgerichtet; und jede Seite, Ost und West, übernahm das, was die andere Seite nicht besetzt hatte, so daß die Gesamtheit der Welt aus beiden Systemen bestand. In dem einen Teil lebte ich, in dem anderen Teil durfte ich nicht leben, aber in beiden existierten wir. Das war der Ort unserer Existenz.
Jetzt fällt dieses Spannungsverhältnis in sich zusammen, und es ist noch nicht klar, welche Folgen das haben wird. Eine der Folgen ist zum Beispiel, daß Krieg wieder eine normale Form des politischen Umgangs geworden ist. Es ist wohl eher ein Illusionsverlust als ein Utopieverlust. Für mich besteht ein großer Unterschied zwischen Illusion und Utopie: Wenn ich zum Beispiel komponiere, weiß ich, wann die Arbeit fertig ist, wann sie richtig ist, wann ich aufhören muß, an ihr herumzufeilen. Das heißt, wenn ich beginne, gibt es ein utopisches Moment: die Vorstellung von einem glücklichen Endzustand des Materials. Dieses Denken kann ich nicht formulieren; ich kann nicht sagen: im Takt Neun muß eine Quarte sein, das ist nicht zu formulieren, aber ich weiß, wann es richtig ist.
Ich kann nicht sagen, woher ich das weiß. Und das ist die allgemeine Beschreibung utopischen Bewußtseins. Das ist nicht abhängig von politischen Verhältnissen.
Gesellschaftliche Utopie endet an dem Ort, an dem man seine Loyalität aufzukündigen beginnt, also wo man das Staatswesen oder den Song nicht mehr verbessern will, sondern wo man sagt: jetzt müssen die Zustände auf die Spitze getrieben werden. In Marx’ „Der achtzehnte Brumaire“, fast ein Kriminalroman über Napoleon den Dritten, einen Scharlatan, der durch einen Staatsstreich die Franzosen beherrscht, gibt es diesen Gedanken, daß es idiotisch sei, eine Gesellschaft, die bereits verstockt ist und nicht mehr funktioniert, bessern zu wollen – „Bis die Verhältnisse selbst rufen: Hier ist die Rose! Hier tanze!“ Man muß verschärfen, man muß sich lustig machen, man muß mit der Hand in die Wunde, ohne daß man sagen kann: ich habe die Alternative. Das war bei mir um 1980.
Kollektiv: Aber die Don Quichotte-Figur aus dem Roman, an dem Sie jetzt schreiben, ist doch auch jemand, der einer Utopie nachrennt und die Welt verbessern will.
Wenzel: Ja, aber zu spät. Und es ist keine Utopie mehr, es ist eigentlich ein Wahnsinn, Weltgeschichtlich ist das ein interessanter Vorgang. Ich habe durch viele Akten und Materialien im biographischen Kontext von Dimitri Schostakowitsch gelesen, und am meisten hat mich die Profanität erschreckt. Das Niedrige prallt auf das Erhabene. Man stelle sich die dramatische Konstellation vor: Meyerhold im Verhör. Der Fragende, ein Pimpf, versteckt seine Niedrigkeit hinter hohen Idealen… Das hat mich angeekelt interessiert. Die gesamte Welt schwankt zwischen dem Lächerlichen und dem Erhabenen, wie in dem schönen Satz von Napoleon nach Waterloo:
Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt, Madame.
Das sind die zwei Extreme, in denen wir leben, die ich zu benennen versuche, weil das ganz banal und bitter ist. Das ist das Beispiel aus meinem Roman: Zwei Trinker faseln im Wahn von der Weltrevolution.
Kollektiv: Eines Ihrer zentralen Themen klingt schon in dem Debütband Lied vom wilden Mohn (1984) an: das gespaltene Verhältnis des Menschen zur Welt, die Zweigestaltigkeit, die in der Chiron-Gestalt ein Bild findet. In dem Essay „Chiron oder Die Zweigestaltigkeit“ fragen sich zwei fiktive Dichter, wie man mit dem Widerspruch zwischen Objekt und Subjekt umgehen muß, ob man ihn lösen oder aushalten soll. Ist dies für Sie der Grundwiderspruch des modernen Menschen schlechthin, war der also in beiden deutschen Gesellschaftssystemen gleich, oder hat er sich für Sie geändert, nachdem die Gesellschaftsordnung eine andere ist?
Wenzel: Es ist nicht in beiden Gesellschaftsformen das gleiche gewesen, das weiß ich aber erst jetzt. Vielleicht habe ich früher gedacht, daß es gleich wäre, ein europäisches Problem quasi. Dieser verkürzte Widerspruch, der eine lange Philosophiegeschichte hat, von denkender und ausgedehnter Substanz bei Descartes, bei Kant, Subjekt-Objekt bei Hegel – die ganze Philosophiegeschichte hängt in diesem Begriffspaar – funktioniert nur, wenn man die Welt als eine zentrierte Welt denken kann. Dazu braucht es – feudale, realsozialistische, stalinistische oder wie auch immer geartete – Strukturen, die sich auf einen zentralen Punkt hin bewegen.
In der Welt, in der ich jetzt lebe, gibt es diesen Punkt nicht. Das heißt, daß diese Konstellation ausfranst, daß sie auseinanderfällt, daß überall Fliehkräfte wirken, in denen es diese scheinbare Subjekt-Objekt-Dialektik nicht mehr gibt. Sie wird wettgemacht durch eine unglaubliche Hybris der Subjekte, die nun glauben, permanent aktiv zu sein. Es sind Verdrehungen.
Ich mach’s mal an einem Beispiel klar: Wenn ich nach einer Vorstellung in die Kantine gehe, kommen die Leute und sagen: „Na, wie waren wir als Publikum?“ Zuerst denkt man: Eine freundliche Frage – Warst du mit uns zufrieden? Aber im Grunde heißt dies, daß sie sich als eigentliche Subjekte empfinden und ich ihr Objekt sein soll. Es ist eine Verdrehung der Verhältnisse, und damit leben wir. Dem Begriff des Modischen entspricht, daß bizarre Subjekte extreme Subjektivität ausstellen. Diese gesellschaftlich sanktionierte Form der Eitelkeit – das ist Kunst. Und das, was nur funktionale Mechanismen einhält, entspricht nicht mehr dieser Kunstdefinition.
Auf die Bühne zu kacken ist besser (im Sinne eines Effekts), als eine Komposition auf den Kontrapunkt aufzubauen oder eine Fabel zu erzählen; es ist medienkompatibler und entspricht dem heutigen Begriff von Kunst. Dialektik löst sich auf in permanentem Subjektivismus. Alle wollen Dirigenten sein und keiner im Orchester spielen.
Kollektiv: Aber hat solcher Subjektivismus nicht auch irgendwann die Aufhebung des Subjekts zur Folge?
Wenzel: Ja, aber das ist dialektisch gedacht, das ist falsch. Wenn man die Vorstellung von Objektivität abschafft, dann fällt auch das Subjekt weg, als Gegenbegriff. Die Welt ist auf Ausgleich genormt. Die verdrängten Phänomene drängeln sich immer wieder zurück in die Welt. Auch die antiautoritären Achtundsechziger, die ihre Kinder so erzogen haben, daß sie keiner Autorität folgen sollen, haben sich dabei ihre eigenen Kinder und deren Freiheit zur Autorität erkoren. Sie kriechen sozusagen davor, daß sie nicht beschränkt werden. Der Teufelskreis fängt uns und das, was man verhindern will, tritt immer ein.
Kollektiv: Beschreibt nicht Gretchens Stoßseufzer „Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles“ doch so einen zentralen Punkt, um den alles kreist?
Wenzel: Ja, auch. Aber ich glaube, das ist eine Ausflucht. Es herrscht ein größeres Problem: in den hochzivilisierten Ländern gibt es eine Menge sozialer Auffangsysteme; Armut, wie in der Dritten Welt, gibt es nicht. Es ist eher eine kulturelle Armut: Daß man sich im ewigen Lauf von Geschichte und Äonen unglaublich sinnlos empfindet, daß man völlig einsam ist und seine siebzig Jahre Lebenszeit damit verbringt, die Kreditraten abzustottern und warten muß, wann das Leasing ausläuft. Diese eigenartige Verkürzung auf Triviales ist eher das, was hier Armut ausmacht, ein kulturelles Niemandsland. Das Geld hat schon eine sehr zentrierende Wirkung und richtet alles auf Effizienz ab, aber eigentlich sind das nur Phrasen. Das Geld ist die Betäubung, um die Einsamkeit in der Geschichte nicht so schmerzhaft spüren zu müssen. Das richtet sich aber auch danach, wie jeder gestrickt ist.
Kollektiv: Gibt es für Sie so etwas wie Heimat?… Ist das ein Ort oder ein Gefühl? Oder unterscheiden Sie wie Ruth Klüger zwischen Zuhausesein und Heimat und Herkunft?
Wenzel: Heimat ist für mich Musik. Vor allen Dingen, wenn ich unterwegs bin oder wenn man mit guten Freunden zusammen ist. Da ist eher noch etwas von jener Geborgenheit, nach der man sucht, seit man dem Mutterleib entschlüpft ist – von nun an muß man alleine in seiner Haut leben, ob man es will oder nicht. „Heimat“ ist ja eigentlich der Versuch, das wettzumachen.
Kollektiv: Einst waren Sie sich Ihres Ortes sehr sicher, obwohl Bilder aus Kindheit und Jugend, anders als bei vielen Gegenwartsautoren, nur selten literarisch gestaltet werden; es sei denn, man will die aus der Schule und anderen realsozialistischen Orten erinnerten Versatzstücke hier mit einbeziehen – ein Text wie „Buchenwald“ aus den „Reisebildern“ ist eher die Ausnahme. Liegt das eventuell daran, daß die Kindheit literarisch erst dann produktiv zu werden scheint, wenn sie voller Reibungen, Verunsicherungen, ja: Haßmomenten war?
Es gibt natürlich auch das Gegenstück dazu: ein verklärtes Versinken in ein goldenes Zeitalter, von dem nur noch der Glanz, aber nicht die Details wahrgenommen werden können. Doch kann ja selbst eine behütete Kindheit ein Gefühl von Betrogensein evozieren, gerade durch solche Erfahrungen, die in geschichtlichen Umbruchzeiten immer wieder gemacht werden, zum Beispiel wenn man mit den zwar oft geahnten, in ihren Ausmaßen aber ebensooft erschreckenden Realitäten konfrontiert wird.
Von einer merkwürdigen Utopie ist die Rede, auch von einer merkwürdigen Revoluzzerromantik:
Wir sahen in jedem Zweifel etwas zersetzendes, Verrat an der Zukunft.
So politisch das ganze anmutet, für mich lag, als ich den Text zu DDR-Zeiten das erste Mal wahrnahm, die Schwierigkeit eher im Unpolitischen. Zum einen zielte ja das Grauen vor dem Entmenschtsein, das einem in den Berichten aus den Lagern entgegenschlägt, ohnehin weniger auf eine historisch reflektierende, sondern eher auf eine existentielle, humane Ebene. Davon spricht dann auch das dem Erinnerungstext „Buchenwald“ folgende Gedicht „Buchenwald II“. Zugleich wird aber auch deutlich, wie diffus das eigene Weltbild war:
Ein Thälmann-Spartakus-Liebknecht-Müntzer-Lenin-Salat.
Aber das kann bei einem Dreizehnjährigen wohl kaum anders sein. Dazu kommt so eine Mischung von Lagerfeuerromantik, eine sehr klare, schlichte Scheidung von Gut und Böse und das Bewußtsein – gegenüber den „Spießern“ – unter den Guten auch noch unter den Besseren zu sein.
Nun ist das so ein Vorgang, der für mich nur vordergründig historisch eindeutig festgelegt ist beziehungsweise einen historisch eindeutigen Hintergrund hat. Könnten Sie sich vorstellen, daß Sie unter einem völlig anderen System für solche Dinge genauso empfänglich gewesen wären? Dieser Mischung aus einer fast x-beliebigen Ideologie und Abenteuerromantik?
Wenzel: Ich glaube nicht. Als ich den Text geschrieben hab’, wollte ich eigentlich auch diese Gefahr darstellen. Es sind vor allem Personen, an denen ich das festmache, zum Beispiel dieser Pionierleiter, der einen sehr großen Einfluß auf mich ausübte. Möglicherweise hätte er auch etwas anderes mit mir machen können, aber ich glaube nicht. Das liegt an Erziehungsmustern: Ich hab’ einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, der mich sehr zornig, sehr unsachlich und sehr böse werden läßt. Das ist ein moralischer Schutz, der es irgendwann nicht mehr zuläßt, daß man diese Abenteuerromantik x-beliebig austauschen könnte, da gibt es eine Grenze. Das ist vielleicht das, was mir – zumindest zu DDR-Zeiten – immer vorgeworfen wurde: das „Abstrakt-Humanistische“, was auch immer das sein mag. Auch so ein Schutz. Ich habe das in dem Text „Geriebene Äpfel“ in der Anthologie Begrenzt glücklich – Kindheit in der DDR beschrieben: Es war keine egoistische Sucht, die mich teilweise zu diesem Fanatismus getrieben hat, etwas für andere zu unternehmen.
Kollektiv: Na gut, aber wenn man in solche Strukturen hineinwächst… Peter Härtling hat zum Beispiel sehr genau beschrieben, wie er von der Hitlerjugend eingefangen wurde, es war das gleiche Schema: eine klare ideologische Ausrichtung und Lagerromatik – etwas, das man mit der unkritischen Sichtweise eines Kindes noch für besser hält. Das ginge sicher auch in einem streng katholischen Elternhaus, eben immer dann, wenn man einen moralisch-komplexen Hintergrund hat und diese Erfahrungen macht. Die Strukturen von solchen Jugend- und Kinderfängergeschichten sind ja durchaus ähnlich.
Wenzel:Ich hatte noch einen anderen Schutzmechanismus – Texte zu schreiben und darüber hinaus Musik, Theater als Lebenszentrum zu begreifen. Ich brauche viele soziale Bezugssysteme, in denen ich operieren kann. In dieser Zeit der Erzählung habe ich zum Beispiel Rockmusik gemacht, in einer Band mit E-Klampfe Stones-Titel gesungen, und war damit an einer Grenze des Nicht-mehr-Zugelassenen. Ich bin mal wegen meiner langen Haare nicht in die Schule gekommen, ich war Zehnkämpfer und bin wegen des Rauchens bei Spartakiaden disqualifiziert worden, ich war im Ballett… ich hab’ alles gemacht. Man schützt sich damit vor Fanatismus. Ich denke, wenn du nur in einem kulturellen System verankert bist, dann besteht die Gefahr, daß du irgendwann die Logik dieses Systems einsiehst und für alle möglichen Dinge brauchbar bist.
Kollektiv: Der Beitrag in dem Band Begrenzt glücklich scheint mir auch aus einer Haltung, sich gegen etwas zu wehren, Erwartungshaltungen zu brechen, heraus geschrieben…
Wenzel: Ja: Begrenzt glücklich… Jede Kindheit ist glücklich, das ist der Ursprung, in dem wir beginnen zu singen und zu sprechen, sie wird immer das eigentliche Geheimnis des Lebens bleiben. Und dann glaube ich, daß alle Literatur aus der Erinnerung an Kindheit lebt, auch alle Musik, aus diesen Wünschen, die man da bis zur Pubertät hat, bis man die Unschuld verliert. Auch halte ich in meinem Fall das biographisches Material nicht für literarisch hinreichend. Dazu ist meine Biographie zu uninteressant, es gibt interessantere Biographien, denen ich mich stelle, gestaltungswürdigere. Da bin ich Ästhet. Also versuchte ich, meine diffuse metaphysische Verbindung zum Totenreich zu beschreiben, daß ich mich immer empfinde als von irgendwoher kommend und daß mich diese Verbindung wahrscheinlich mehr geprägt hat als das, was äußerlich ideologisch auf mich einstürzte. Und in dem Sinne habe ich versucht, in der Erzählung „Geriebene Äpfel“ das Thema zu unterlaufen.
Kollektiv: War das Schreiben von vornherein ein Schutzmechanismus? Wann begann das Schreiben, welche Einflüsse waren wichtig?
Wenzel: Ich hab’ sehr zeitig, ab der zweiten, dritten Klasse, angefangen, Gedichte in sogenannte Dichterhefte zu schreiben. Dadurch bin ich von der damaligen Kinderorganisation, den „Jungen Pionieren“, als schreibender junger Bursche subsumiert worden und bekam auch schon in der dritten oder vierten Klasse Aufträge: der Brigade zum Frauentag ein Gedicht zu schreiben oder dem angrenzenden Polizeibatallion irgendwelche Grüße zu überbringen. Das habe ich alles gemacht – unkritisch.
Einmal bin ich zu dem einzigen Schriftsteller geschickt worden, den es in meiner kleinen und verkommenen Stadt Wittenberg gab, dem proletarisch-revolutionären Schriftsteller Hans Lorbeer. Der galt in Wittenberg als Enfant terrible, war jemand, der sich permanent gegen die Beschlüsse der Kreisleitung der Partei zur Wehr setzte und immer das machte, was man nicht machen sollte. Dort wurde ich hingeschickt und dachte: Der ist proletarisch-revolutionärer Schriftsteller, da liest du deine ganzen Sachen vor, die du für die Volkspolizei geschrieben hast. Daraufhin hat der mich, aufzeigend, was alles schlecht war, zur Schnecke gemacht.
Ich hatte noch einen kleinen Vers für einen Teddybären, den ich nie bei meinen Lesungen unterbringen konnte und den fand er toll. Da war ich sehr durcheinander und wußte in meiner Naivität nicht mehr, was eigentlich richtig und was falsch ist. Das Gefühl hat eine lange Zeit angehalten, und in dieser Unsicherheit habe ich zugleich am meisten produzieren können. Ich war zwar sehr traurig, denn ich hatte mein ganzes Leben in diese Polizeiverse reingehämmert, trotzdem wußte ich, daß er Recht hatte. Also das, was er mir als Widerspruch aufgemacht hat, habe ich begriffen: Ich hatte sozusagen eine falsche Rolle gespielt.
Ein anderer Einfluß war für mich, daß mein Vater, wenn er seiner Leidenschaft nachkam und vor der Staffelei stand, beim Malen immer Brecht-Songs gehört hat, die ich also schon als kleiner Junge mitbekam: „Und ein Schiff mit acht Segeln…“. Ich bin mit diesen Liedern groß geworden. Später fing ich an, mich für Brecht zu interessieren und habe Konzerte mit Brecht-Texten veranstaltet. Auf der anderen Seite hatte ich viele Freunde – ich bin nicht christlich erzogen – aus Kirchenkreisen; ich begann, die Bibel zu lesen. Ich würde also sagen, daß meine literarischen Einflüsse bis zur Abiturzeit vor allem von Brecht und der Bibel geprägt waren.
Kollektiv: Die Begegnung mit Hans Lorbeer war also eher niederschmetternd. In welchem Maße beeinflußte Kritik beziehungsweise Zustimmung Ihre Arbeit?
Wenzel: Bestätigung braucht man. Nach dem Besuch bei Hans Lorbeer hatte ich keinerlei Ambitionen mehr, literarisch zu arbeiten. Es hat mich nicht mehr interessiert. Später habe ich meine Texte an drei für mich interessante Autoren geschickt: Volker Braun, Franz Fühmann und Heinz Czechowski. Alle drei sandten mir interessante Briefe. Mehr Bestätigung brauchte ich nicht. Die Briefe benannten immer auch die Fehler und plötzlich gingen mir die Augen auf. Es hat mir gereicht, daß diese Schriftsteller mich ernst genommen haben, ich habe einfach weitergemacht und durch Zufälle brachte ich dann einen Gedichtband heraus.
Kollektiv: Wie ist es dazu gekommen?
Wenzel: Ich bekam damals vom Kulturbund das Johannes-R.-Becher-Diplom: Ermunterung und Unterstützung und eintausend Mark. Die wurden zwar spurlos versoffen, aber durch das Stipendium wurden Leute vom Mitteldeutschen Verlag auf meine Arbeiten aufmerksam, sie fragten:
Na, hast du nicht Interesse, einen Band herauszugeben?
Später interessierte sich auch der Verlag Neues Leben für die Reihe Poesiealbum. Als ich dann das Poesiealbum eingereicht hatte, gab es Trouble, was zur Folge hatte, daß die erste Auflage während der Korrektur eingestampft wurde. Die Lust, eine zweite Variante zu erarbeiten, ist mir während der Gespräche vergangen. Ich bin aufs Land gefahren und habe ungefähr ein Vierteljahr lang konzentriert Texte für meinen ersten Band geschrieben. Sowohl die Erfahrung der verschiedenen Öffentlichkeiten Bühne und Buch als auch die während dieser Zeit mich beeinflussende Lektüre waren für mein Schreiben wichtig. Ich habe das erste Mal aufgeräumt in meinem Bewußtsein. Die Fragmente, Splitter und Spinnereien fanden einen kommunikativen Kontext.
Kollektiv: Weshalb wurde das Poesiealbum eingestampft?
Wenzel: Der Zentralrat der FDJ wollte unbedingt zwei Texte raushaben: eine verdrehte Adaption des „Abendliedes“ von Claudius zum Beispiel:
Die Sonn’ wird aufgehangen
An langen Zauberstangen
Am Himmel, ist doch klar.
Der Wald steht schwarz und schweiget
Und auf der Haut da zeiget
Sich gelber Ausschlag, wunderbar.
Es war die Zeit der Friedensbewegung und man sagte mir eindeutig: Der Text muß raus. Ich hatte schon die Korrekturfahnen und antwortete: Nein, der Text geht nicht raus. Damit gingen wir auseinander und es war vorbei.
Kollektiv: Und wie kam es dann dennoch zu einer zweiten Auflage?
Wenzel: Nachdem meine Lektorin beim Mitteldeutschen Verlag die Druckgenehmigung für den Wilden Mohn erkämpft hatte – das Manuskript brauchte gut ein Jahr, immer wieder gab es Nachrichten, daß der Band doch nicht erscheinen soll –, fühlte sich auch der Verlag Neues Leben irgendwie genötigt, nachzuziehen, Vielleicht ist er ja auch von „höherer Stelle“ angewiesen worden. Schließlich hatte der Autor W. eine Art Seligsprechung erfahren durch die Veröffentlichungsgenehmigung von Seiten des Kulturministeriums.
Man darf nicht vergessen, daß damals die FDJ eine härtere Kulturpolitik vertrat als die Partei und gelegentlich, wenn einer päpstlicher sein wollte als der Papst, auch an Hand von solchen Veröffentlichungen Kompetenzen ausgehandelt wurden. Ich hatte das Gefühl, daß ich in einen solchen Zusammenhang geraten war. Das Erscheinen des Poesiealbums wurde allerdings nur noch sehr lieblos von mir beobachtet. Einzig, daß ich eine Grafik von Manfred Butzmann unterbringen konnte, die das (räumliche) „Ende der DDR“ zeigt, den Bahnhof Friedrichstraße, erscheint mir als kleiner Triumph.
* * *
Kollektiv: Auch nach der Wende gab es ähnliche Erfahrungen – da wurde ein Sketch um eine Samenspende für den Papst gestrichen. Worum ging es in diesem Sketch eigentlich und womit wurde die Streichung begründet? Mit „Zensur“ wohl kaum…
Wenzel: Nein, das läuft alles viel diffiziler. Wir haben in einem sogenannten alternativen Kulturmagazin mitgearbeitet, KANAL 4, das sich mit einer Verfassungsklage Sendezeit bei RTL und bei Sat 1 erstritten hatte. Als das Privatfernsehen dazumal von der CDU eingeführt wurde, fügte man, um die kommerzielle Komponente mit Freiheitsphrasen schmackhaft zu machen, eine Klausel von der Kulturpflicht ein. Daraufhin konnte KANAL 4 in Köln frei verfügbare Sendezeit, von der Werbung bezahlt, als kostbare Trophäe sein eigen nennen. Kurz nach der Wende kam KANAL 4 und sagte:
Wir machen ein politisches Magazin, in dem Beiträge, die von den Öffentlich-Rechtlichen oft aus politischen Gründen abgelehnt werden, veröffentlicht werden sollen, und es wäre schön, wenn ihr über vermittelnde Zwischenszenen – Sketche – nachdenken könntet.
Da uns das Medium Film zusagt und wir gern experimentieren und außerdem freie Hand hatten, wollten wir Clownsszenen entwickeln oder jene nehmen, die damit zu tun hatten. Wir haben die Szene mit der Samenspende also gedreht und man war sich einig, daß es gut und frech war, paßte etc. …
Die Geschichte ist einfach: Einer klopft, steht an der Tür und sagt: Tach, ich komm vom Papst, möchte ’ne Spende. – Ja, jeder Zeit. – Samenspende. – Aha, Sie kommen vom Papst – Ich würde die Spende gleich mitnehmen… Also diese Verwirrung, wir haben es als ganz natürliche Szene gespielt, ohne Überdrehungen. Die Szene wollte man unbedingt senden, doch dann kamen erste Einsprüche, vor allem vom Tittensender Sat 1, wo also – kurz vor und nach unserem politischen Magazin – dauernd irgendwelche Möpse rumsprangen, das hatte schon eine komische Komponente. Die Sendung wurde untersagt, aber den Leuten sagte man: Ja, selbstverständlich, klagen Sie, das ist Freiheit der Satire, unternehmen Sie was. Nach einer kurzen Krisensitzung war man sich einig, das durchzuklagen – zwei Ostkünstler, das müssen wir ihnen beweisen! Dann hatten die Rechtsabteilungen errechnet, daß die Klage durch die Instanzen eventuell bis ins Jahr 2000 gehen könnte, und man einigte sich unter der Hand, ohne uns zu informieren, diese Szene doch rauszunehmen und da wäre es doch gut, wenn man die beiden Clowns überhaupt rausstreichen könnte. Dann wurde kurzzeitig das Redaktionskollegium so geändert, daß wir keine Stimme mehr hatten und auf einmal waren wir raus aus dem Rennen.
Das Schöne war, daß dieses Spiel mit den anderen auch noch weitergetrieben wurde, so daß am Schluß, ungefähr nach zwei Monaten, Magazin und Redaktion verschwunden waren. Ein klassisch gut gestrickter Abbau. Eine gute Erfahrung. Belehrt von der Wirklichkeit, und zwar von der medialen.
Kollektiv: Worin bestand für Sie der Unterschied zu den Zensur-Erfahrungen in der DDR?
Wenzel: Der gravierende Unterschied ist, daß man heute prinzipiell das Recht hat, das zu sagen, was man will – vorausgesetzt man findet noch etwas des „Sagens wert“. Aber ich hätte vor Gericht beweisen müssen, daß ich das Recht habe. Es war mir sozusagen formal freigestellt, es schien durchsichtiger. In der DDR war es so, daß sowohl über Grenzen (also Pflichten), als auch über Rechte keine Eindeutigkeit herrschte. Da kam irgendein Telegramm:
Wegen Wasserschaden fällt die Vorstellung aus.
Oder sonst irgend etwas:
Wir haben kein Papier, das Buch kann nächstes Jahr nicht kommen.
Heute gibt es eindeutige Stellungnahmen: Sender und katholische Kirche hatten sich zur Szene geäußert, es gab zwei Gutachten. In der DDR kursierten meist nur Gerüchte, denn eine richtige Zensur gab es ja nicht. Nur eine inoffizielle, mit aller Macht allerdings. Früher mündeten solche Prozesse in Orakeln und Vermutungen, heute endet so etwas in endlosem Geschwätz.
Kollektiv: Wie wird ein Text ein „Text“? Sind es eher Inhalte, die nach Formen suchen oder sind es stärker Bilder, die ein Thema einkreisen?
Wenzel: Das ist schwer zu sagen. Manchmal habe ich das Gefühl, zu wissen, wie ein Text aussehen muß. Ich weiß nicht, worum es geht, ich beginne einfach und suche. Wie ein Bildhauer, der einen Stein hat und weiß, da ist etwas drin. Eine Gefühlssache. Ich wache früh auf und habe eine Ahnung, ein Empfinden – ich will das klären, beschreiben. Manchmal passiert es auch, daß ich etwas sehe oder mir eine Zeile unterwegs notiere. Bis zur Ausarbeitung dauert das oft sehr lange, ganz nach dem Spruch „Die erste Zeile ist Gottesgabe, das andere ist Fleiß“. Ich habe viele Texte in freier Form geschrieben, dann als Lied, dann wieder verworfen – solange, bis die endgültigen Form gefunden war, die sich für einen bestimmten Ton eignet. Der Ton interessiert mich, und den kann man nur finden, indem man formuliert. Formulieren ist in der Literatur dummerweise die Voraussetzung. In der Musik ist es einfacher, weil der Ton selbst eine Form ist, aber in der Literatur brauche ich die Sprache.
Kollektiv: Welche Arbeitstechniken gibt es, Materialisierungsstufen, Korrekturphasen, Schreibweisen?
Wenzel: Ich schreibe alles mit der Hand, mit mehrfarbigen Füllern, grün, blau, rot, schwarz. Seit einiger Zeit habe ich wieder den Bleistift für mich entdeckt, weil sich, wie beim Notenschreiben, alles so schön wegradieren läßt. Ich mag diese physische Arbeit auf dem Papier. Danach arbeite ich sehr viel am Computer. Das sind die nächsten Stufen: Eintippen, Überarbeiten, noch einmal mit dem Füller in die Manuskripte gehen. Es dauert oft sehr lange bei mir, ehe ich mit einer Sache fertig bin. Ich brauche sehr viel Zeit, mit zunehmenden Alter immer mehr, weil man immer unzufriedener wird.
Kollektiv: Geben Sie diese Manuskripte auch aus der Hand?
Wenzel: Ich lese sie gern Freunden vor. Die müssen nichts sagen, ich merke an ihren Reaktionen, wo schwache Stellen sind: dort, wo sie nach der Tasse greifen, ist die schwache Stelle, die Aufmerksamkeit läßt nach. Am Theater habe ich gelernt, daß die Leute in ihren Gesten am genauesten sind, nicht in dem, was sie sagen. Da kann man erkennen, wo ihre Aufmerksamkeit am zentriertesten ist, wo es sie langweilt, wo sie sich anstrengen. Das Laut-Vorlesen oder Vorsingen ist für mich etwas überaus wichtiges.
Kollektiv: Gibt es Texte, die Sie im Nachhinein ärgern?
Wenzel: Nein. Ich halte es da mit Dostojewski: Ich schreibe alles außer Denunziationen.
Kollektiv: In den Clownsprogrammen und auch auf den CDs zeichnen Hans-Eckardt Wenzel und Steffen Mensching als Autorenduo für die Texte verantwortlich. Wie muß man sich das praktisch vorstellen?
Wenzel: Wir arbeiten tatsächlich zusammen an den Texten und diskutieren sie: Was ist gut, was nicht, was bedeutet das. Gemeinsam Szenen zu entwickeln, ist wie musizieren, Man spielt miteinander. Der eine wirft dem anderen einen Gedanken hin, der andere sagt etwas dazu – wie auch Witze entstehen können. Manchmal geben wir ein metrisches Schema vor, sagen, es ist ein Fünfheber, der erste Reim ist männlich, zweiter weiblich, vierstrophiger Block, Thema soundso. Jeder hat 10 Minuten Zeit, wir sitzen uns gegenüber und fangen an, olympiadenmäßig zu produzieren.
Kollektiv: Und das wird dann gemixt?
Wenzel: Dann ist es absurderweise auch kompatibel. Meist braucht man nur noch die Reimworte auszutauschen.
Kollektiv: Sie spielen in ihren Texten sehr viel mit der literarischen Tradition, zum Teil werden Zitate – von Shakespeare bis Joyce – auch direkt in Ihre eigenen Texte montiert. Was können die zitierten besser als die eigenen Worte leisten?
Wenzel: Die Zitate haben für mich eine eigene Rezeptionsgeschichte, sie dokumentieren die Erkenntnis beim ersten Zusammentreffen mit dem Text. Sie helfen mir zum einen, etwas auszudrücken, das ich von Anfang an nur ungenau und unglaublich langwierig beschreiben könnte. Zum anderen gibt es eine stillschweigende Übereinkunft mit den Toten, daß ich mich für ihre literarischen Entwürfe verantwortlich fühle. Für mich sind die vergessenen oder in die Belanglosigkeit abgeschobenen Dichter wichtig. Auch wenn ich an einem Straßenmusiker vorbei gehe, gebe ich grundsätzlich Geld aus dem Gefühl heraus, daß es mir genauso ergehen könnte. Ich weiß, daß diesem Dilemma nur abzuhelfen ist durch Aufmerksamkeit. Vergleichbar empfinde ich auch eine Solidarität zu dem, was in der Literatur geschrieben wurde. Mein eigenes Vergessen-Sein oder mein eigenes Vergessen-Werden hängt damit zusammen, daß ich sie vergesse. Das ist eine Solidarität, die zwischen den Generationen vorhanden sein muß. Das Verhältnis zu den toten Geschlechtern ist für mich Voraussetzung für Literatur.
Kollektiv: War das auch bei der Entdeckung von Theodor Kramer so ein Schub dieses Vergessen-Seins?
Wenzel: Am Ende ja. Ich habe meine erste Diplomarbeit aus dem kühnen Interesse, ein Tabuthema der DDR zu berühren, über faschistische Lyrik geschrieben, über Joseph Weinheber. Über dieser schlechten Lyrik wurde mir zunehmend körperlich elend. Ich bin krank geworden. Ich habe das nicht mehr ausgehalten und zu meinem Professor gesagt, daß ich aufhören muß. Ich wollte sowieso das Studium nicht abschließen. Daraufhin sagte der:
Naja, es ist wie in der Medizin. Du brauchst ’nen Antikörper, läßt dich impfen – Wenn du die faschistische Lyrik nicht mehr aushältst, nimmste ’nen Antifaschisten.
Ich kannte zwei Texte von Kramer – „Selbstbildnis“ und „Ich bin traurig, daß der Raps verblüht“ – und war unsicher. Dann habe ich nach ihm gesucht. Hinzu kam das Gefühl einer unglaublichen Ungerechtigkeit einem solchen Werk gegenüber: Es gab nur die Originalausgaben in der Deutschen Bücherei. Die Ausgaben in der Weißen Reihe und im Poesiealbum waren 1980 das einzige was man bekommen konnte. Ich habe einige hundert Texte mit der Hand abgeschrieben und war sehr wütend, daß diese Schätze im beginnenden Computerzeitalter nur durch altertümlich klösterliches Handwerk verfügbar gemacht werden konnten.
Kollektiv: Schon bei Ihren ersten Publikationen, so in Lied vom wilden Mohn (1984) fällt auf, daß einige Texte mit Vertonung abgedruckt wurden. In Ihrer Sammlung Ich mag das lange Haar (1998) ist das, gemäß dem Untertitel „Liederbuch“, durchgängig der Fall. Bei bestimmten Texten ist Ihnen das Zusammenspiel von Text und Musik also sehr wichtig. Was kann denn ein Lied ausdrücken, was ein Gedicht nicht kann?
Wenzel: Sie können beide das gleiche, es liegt sozusagen an der Fähigkeit der Autoren. Es gibt Autoren, die haben eine sehr hohe Musikalität in der Sprache; ich brauche die Musik, weil sie meine Texte von außen her mitträgt. Wenn die Musik bereits komponiert ist, überlege ich mir, was ich mit dem Ton zu beschreiben versucht habe. Lyrik ist vor allem ein musikalisches Phänomen. Durch Protestantismus und Hegel sind wir im deutschsprachigen Raum sehr stark auf das Geschriebene fixiert, gilt uns das Textliche oder das Verbale immer als die höchste Form der Erkenntnis, obwohl die abstrakteren Formen wie Tanz oder Musik offener sind.
Sehr gute Lyrik ist für mich Musik, und die höchste Form der Erkenntnis ist Musikalität. Sie setzt in unserem Unterbewußtsein etwas in Gang, das wir nicht zu beschreiben vermögen, etwas ganz Eigenartiges, den Ursprung aller Dinge. Das kann mit Tanz oder Rhythmik zusammenhängen, aber es ist immer Musik. In dem Sinne steht für mich nur die Frage, wird es Musik oder wird es keine. Das gilt sowohl für die Klassik, als auch für moderne Musik oder den Popbereich. Wenn es keine Musik wird, ist es uninteressant.
Kollektiv: Sie sind nicht nur Musiker, Komponist, Sänger und Autor Ihrer Lieder, sondern Sie bewegen sich auch auf dem Gebiet der Prosa wie dem der Dramatik, haben mit Steffen Mensching über 30 Theaterproduktionen auf die Beine gestellt, sind Clown – verschiedene Künste vereinen Sie also in einer Person. Gestische Kunst und direkter Kontakt zum Publikum auf der einen Seite, Existenz zwischen zwei Pappdeckeln auf der anderen. Für welches Gebiet entscheiden Sie sich wann und aus welchen Gründen?
Wenzel: Das weiß ich nicht. Ich versuche, den Ausdruck zu finden, der dem, was ich beschreiben oder formulieren möchte, am nächsten kommt. Viele Jahre schien mir, als wäre das Theatralische das Vitalste. Deshalb habe ich sehr viel Theater gemacht. Das hängt vielleicht damit zusammen, daß die Leute in der DDR immer auf der Suche nach sich selbst waren, um sich gegen ein wie auch immer verallgemeinerndes Staatswesen abzugrenzen. Die Kostümierung war eine Provokation, weil man ganz bewußt ein Anderer, ein Idiot sein wollte. Heute scheint es mir, daß die Leute immerzu Rollen spielen. Und wenn jeder in einer eklatanten Weise Theater spielt, beginnt mich diese Form zu langweilen, sie ist nicht mehr provokant genug. Wir sind zu DDR-Zeiten einmal auf einem Bauarbeiterfasching in Cottbus als Clowns aufgetreten. Alle waren kostümiert und wir liefen durch die Menge und jemand sagte: „Na du hast ja ein Scheiß-Kostüm.“ Da geht es eben nicht mehr auf, da stimmte das System nicht mehr. So ist das im Moment auch: Ich fühle mich mit meiner Hose und meiner Badekappe gar nicht mehr so anders als manche Leute, die auf der Straße herumlaufen. Also muß ich fragen: Welche Form ist jetzt eigentlich am wenigsten verhurt, verbraucht, vernichtet? So ändert sich das immer.
Kollektiv: Und welche Form ist das im Moment oder könnte das sein?
Wenzel: Ich interessiere mich im Moment für Musik und Literatur.
Kollektiv: Steffen Mensching antwortete im Dezember 1990 in einem Interview auf die Frage, was die Clowns aus Letztes aus der DaDaeR von denen aus der Hundekomödie unterscheide:
Früher hatte man dieses Narrenkostüm aus Zwang, daß man nur innerhalb dieser Rollen, dieser Typen bestimmte Sachen sagen konnte […] jetzt, wo der äußere Druck weg ist, könnte die neue Rolle vielleicht mit wesentlich mehr Souveränität gehandhabt werden.
Sie selbst sprachen von der Möglichkeit konzentrierten Denkens, wobei wichtig war, den Spaß dabei nicht zu verlieren. Was war den Clowns wichtiger: ästhetische Ausdrucksweise oder spielerische Narrenfreiheit? Oder hielt sich das die Waage?
Wenzel: Beides. Die Narrenfreiheit, das Spielerische war eine Voraussetzung, um zu bestimmten ästhetischen Ausdrucksformen zu finden. Es gibt Theater, das literarisch nicht formulierbar oder als literarischer Text uninteressant ist. Die Stücke von Dario Fo etwa, die stark aus dem Spiel oder der Improvisation entwickelt werden, bleiben literarisch oft unzulänglich. Trotzdem haben sie ein unglaubliches theatralisches Potential, das heißt, dieses Spielerische entwickelt etwas an ästhetischer Ausdrucksform zu einem Zentrum hin. Und das war in dieser Zeit unser Konzept: eine Logik nicht mehr akzeptieren zu müssen, die einfach nur logisch ist.
Kollektiv: David Robb nähert sich Ihrer Arbeit in seiner Monographie Zwei Clowns im Lande des verlorenen Lachens anhand des Leitfadens „karnevalistische Tradition“. Eckpfeiler dieses Gedankengebäudes sind die besondere Situation des Festes, einer „anderen“ Zeit, und das Lachen. Lachen als Ventil beziehungsweise Lächerlichmachen des Bestehenden, das Auf-den-Kopfstellen der gültigen Werte sind im Mittelalter, in einer sonst mit Ver- und Geboten abgesteckten Gesellschaft, zu bestimmten Zeiten erlaubt gewesen. Der Narr, der Harlekin, aus dem sich später der Clown entwickelte, ist eine Figur, die aus der mittelalterlichen Tradition herrührt. – Inwieweit haben solche traditions- und theorieträchtigen Überlegungen, etwa die Beschäftigung mit Bachtins Klassiker Rabelais und seine Welt, Einfluß auf Ihre Arbeit genommen?
Wenzel: Oft sind es die kleinen Dinge, die einen beeinflussen: Bei den Berliner Festtagen habe ich einmal eine Commedia dell’arte-Truppe gesehen, zwei Clowns, die mich unglaublich fasziniert haben. Später studierte ich Theaterwissenschaften. Die Commedia dell’arte und die Revue der zwanziger Jahre, die auch eine Form des literarischen Kabaretts ist, wurden in diesem Studium Schwerpunkte. Ich bin kein Wissenschaftsfeind. Ich habe mit großem Vergnügen studiert. Das Theoretische ist für mich immer eine Bezugsebene gewesen. Bachtin lieferte einen neuen Blick auf die mir im alltäglichen Gebrauch bekannten Phänomene. Ich hatte nach solcher Lektüre das Gefühl, besser sehen zu können.
Man muß die einfachen Fragen finden. Was geschieht eigentlich, wenn Leute lachen? Es ist ein ganz archaisches Verhalten, was da vonstatten geht. Man setzt einen Witz und ein Mutiger beginnt zu lachen. Im Lachen steckt die Frage: wollen wir lachen? Wenn die anderen in das Lachen einsteigen, ist das die Bestätigung einer Gemeinschaft, man gründet kurzzeitig eine Lachgesellschaft. Die Leute sind auf einmal gleich, weil man im Augenblick des Lachens nicht denken kann.
Das ist der Vorteil des Clowns: Wenn der Zuschauer lacht, kann er nicht denken und dieser Augenblick ist meine Chance, weiterzudenken und die nächste Sache vorzubereiten. Bei Walter Benjamin gibt es diesen Gedanken, daß man kurzzeitig die intellektuelle Anstrengung ausschalten müßte. Pablo Neruda besang diese Niemandszeit in seinem Gedicht: Eine Sekunde lang sollten wir alle auf Erden nichts tun, das wäre die Chance. Das Utopische am Lachen ist, daß im kleinen Augenblick des Lachens nichts passiert und danach alles möglich ist. Sie können dich umbringen, dich zerreißen, sie können dich feiern oder mit dir reden. Und diese Gesellschaftlichkeit, die sich da herstellt, kommt als Erfahrung dazu, man denkt darüber nach, was da eigentlich passiert, wenn das Publikum lacht.
Ich lache über komische Angelegenheiten recht selten. Erst ab einer wirklich übersteigerten Ebene entsteht bei mir Komik. Aber ich weiß, komische Vorgänge auszuarbeiten, ist ein hochernster, präziser Prozeß, bei dem man aussieht, als ob man Magenkrämpfe hätte. Schiller beschreibt das sehr schön in „Von naiver und sentimentalischer Dichtung“. Das tragische Objekt oder Thema trägt seinen Autor selbst. Der beschriebene tragische Widerspruch trägt den, der ihn beschreibt, weil er ihm nur dann gerecht wird, wenn er in seiner tragischen Höhe behandelt wird. Im Komischen kann das nur die Subjektivität oder die Präzision dessen ausmachen, der ihn wiedergibt. Das Komische bedarf höherer Konstruktionsleistung.
Kollektiv: Wobei das Tragische in der Tradition immer als das Höherwertige gesetzt wird.
Wenzel: Ja, jemanden beispielsweise im Film zum weinen zu bringen, ist unaufwendig. Es wird ein bißchen Zeug ins Auge geschmiert, die Kamera fährt heran, du schluchzt und guckst ein bißchen nach unten. Aber es ist schwer, eine Szene zu drehen, die wirklich komisch ist. Wenn man die Szenenschnipsel von Charlie Chaplin sieht: dreißig, vierzig Einstellungen, bevor der Witz wirklich da, wirklich präzise war. Nur, wenn es auf die Hundertstel Sekunde stimmt, ist es komisch, wenn er zu spät kommt, nicht. Es ist ein ganz eigenartiger Vorgang, der da mit uns stattfindet.
Kollektiv: Wie reagieren Sie auf diese typischen Lacher im Publikum, die eigentlich gar nicht aus dem Bauch kommen, sondern die fürs Publikum gedacht sind? Die Lacher, die lachen, um zu zeigen: Ich gehe mit dem Text mit.
Wenzel: Ich bin dann immer froh, daß ich dann keine Handgranaten dabei habe. Ich werde zornig, wenn Dummheit um mich herum existiert. In manchen Filmen lachen Leute, wenn einer die Tür aufmacht und hereinkommt, und ich weiß nicht, warum sie lachen. Man trifft sich, zieht häßliche Klamotten an, hört japanische Kaufhausmusik und ißt fast food. Also alles, was schlecht ist, wird gemacht, ist im Moment sehr schick oder geil. Man müßte drüber nachdenken, was das für eine Protestform ist, vielleicht ist es eine Ironisierung der Form. Man lacht auch, obwohl es nicht komisch ist. Wenn etwas tragisch ist, und man lacht, das verstehe ich noch; es sind meistens Männer, die wollen zeigen: Haha, ich bin nicht traurig, daß die Mutti stirbt. Doch dort zu lachen, wo es eigentlich nichts zu lachen gibt, ist mir ein rätselhafter Vorgang.
Kollektiv: Haben Sie da auch schon mal in einer Lesung darauf reagiert?
Wenzel: In Konzerten reagiere ich.
Kollektiv: Und wie?
Wenzel: Es ist meistens irgendeine spielerische Form, man ist ja dann immer im Rausch des Augenblicks und denkt nicht darüber nach. Also ich verbiete das nicht, aber meist endet es so, daß andere über denjenigen lachen.
Kollektiv: Bei der Beschäftigung mit Ihrer Biographie und Ihrer künstlerischen Arbeit fällt Ihr ambivalentes Verhältnis zum Staat DDR auf. Einerseits paßten Sie sich, auf den ersten Blick, der DDR-Kulturpolitik an: Bekenntnis zu marxistischen und antifaschistischen Grundpositionen, literarische Themen und Schreibweisen, die tolerierbar waren, Auftritte bei FDJ-Veranstaltungen, Mitgliedschaft im Schriftstellerverband und sogar in der SED. Auf der anderen Seite gab es aber auch immer wieder Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen und Maßregelungen. Wie sehen Sie heute Ihre Rolle in der DDR, wie sahen Sie sie damals?
Wenzel: Ich bin in diesem Land geboren. Da es sich intellektuell definiert hatte, hielt ich es für einen interessanten Ort und habe am Anfang einen Großteil seiner Utopien geteilt. Ich habe sehr viele Leute aus dem antifaschistischen Bereich kennengelernt, Leute, die im KZ gesessen haben. Verrückte Außenseiter, die ich für sehr faszinierend hielt und deren Lebensentwurf mich geprägt hat. Die waren oft sehr ehrlich, oft sehr hart, ich konnte damit etwas anfangen. Ich lebte die Doppelexistenz, einerseits das Land zu mögen und gleichzeitig zu hassen, und indem ich beides tat, überraschte mich die Diskrepanz zwischen dem ideologischen Entwurf der Gesellschaft und der Realität nicht besonders. Ich habe dennoch versucht, die DDR noch zu stützen, selbst dann noch, als ich es eigentlich schon nicht mehr wollte – auch, weil ich den Westen, die Bundesrepublik, aufgrund ihrer Geschichte nicht leiden konnte, das sage ich ganz ehrlich. Diese Staatswesen, das sich in den fünfziger Jahren, wir vergessen das heute, zu bestimmten Dingen nicht korrekt verhalten hatte, war mir einfach zuwider. Absurderweise wollte sich die DDR aber von mir gar nicht stützen lassen, sondern hat mich von Anfang an kriminalisiert, was ich natürlich erst im Nachhinein in der ganzen Breite herausbekommen habe. 1988 bot sich mir eine Ausreisemöglichkeit in der Form, in einem Krankenhaus in Nicaragua als Kraftfahrer zu arbeiten und ich sagte mir: Gut, eh’ du nach München gehst, fährst du lieber dorthin. Die DDR zu verlassen, war für mich viel interessanter, als in den Westen zu gehen.
Letztendlich war die DDR ein tragikomisches Land. In diesem Sinne entsprach es sogar meiner ästhetischen Konzeption, unfreiwillig. Eigentlich war alle nicht Ernst, aus heutiger Sicht war es ein Indianerspiel. Es war wie auf einem Spielplatz, auf dem man sagt, du bist der und du bist der. Dennoch hatte es einen sehr großen Ernst im Umgang, wie man auch im Spiel sehr ernst ist. Ich glaube, es ist eine spielerische Situation gewesen, mir wird das jetzt erst klar, auch für mich, mit allem, was man so getan hat und wie andere auf einen reagiert haben.
Ich hatte damals ein Studium mit dem Vorsatz begonnen, nach Berlin zu kommen und dort Künstler zu werden. Dann merkte ich, wie wenig ich weiß, wie blöd und arrogant ich eigentlich bin und wie gut das Studium ist: die Philosophie und die Ästhetik. Es hat mir Spaß gemacht und ich habe es erfolgreich beendet. Bestimmte philosophische Ansätze von Hegel, Marx oder Benjamin sind für mich noch immer hochinteressante Gedankenexperimente.
Kollektiv: Das Spielerische konnte aber schnell ziemlich ernst werden. Die Mauer ist eine ziemlich ernste Angelegenheit, da hört das Spiel auf.
Wenzel: Ja, das gehört ja dazu, daß es mal ernst wird, daß das Spiel immer umschlagen kann.
Kollektiv: Hat sich der Blick auf die DDR-Zeit oder auf einen selbst jetzt sehr verändert? Oder sehen Sie die Sachen heute ähnlich wie in den Achtzigern?
Wenzel: Das ist eine schwierige Frage: Man kann sich nicht in den Zustand der früheren Naivität zurückversetzen. Ich glaube, daß ich es im Unterbewußtsein ähnlich gesehen habe. Bestimmte Dinge haben mich am Ende der DDR einfach nicht mehr interessiert. Sie sind auch heute noch uninteressant, wahrscheinlich, weil sie in sich etwas von nicht mehr existierender, abgestorbener Vitalität haben. Die Dinge, die ich machte, waren auch immer eigenartige Partisanenaktionen. Als ich zum Beispiel mit neunzehn zu studieren begann, stellte ich einen Antrag, in die SED aufgenommen zu werden. Das Motiv war, daß sich quasi alle interessanten ästhetischen Diskussionen dieser Sektion nur in dieser Partei abspielten, alle Professoren waren drin, alles fand dort statt. Man nahm mich nicht, denn ich galt als unzuverlässig, als Anarchist, als Bombenleger. Das zog sich noch ewig hin, ich kriegte dann Rügen, aber es war eigentlich ein Spiel, in die inhaltlichen Auseinandersetzungen zu geraten. Es wurde erst wieder interessant, als ich austreten konnte, irgendwann vor dem Sommer ’89, als es mit der DDR nicht mehr ging. Ich hab’ mich gemeldet und gesagt: Hier! – Ach so. du bist ja noch drin.
Kollektiv: Aus den eben genannten Gründen werden Wenzel und Mensching in den Literaturgeschichten oft der Prenzlauer-Berg-Szene gegenübergestellt, Autoren wie Adolf Endler und Bert Papenfuß-Gorek schrieben gar böse Schmähzeilen. Woran lagen diese Diskrepanzen, warum gelang es Ihrer Meinung nach nicht, auch nicht über eine Figur wie Ekkehard Maaß, der ja u.a. auch an Szene-Zeitschriften beteiligt war, einen – wie ich meine: durchaus möglichen – Konsens herzustellen?
Wenzel: Das hatte wohl mehrere Gründe. Ich habe neulich in einer Illustrierten ein Foto von einem der ersten Treffen der Prenzlauer- Berg-Szene in der Wohnung von Eckehard Maaß gesehen und war ganz erstaunt, daß ich mit drauf war. Erstens hatte mir die Atmosphäre nicht gefallen. Ich weiß heute, woher das kam: Da war irgendwas nicht in Ordnung und immer, wenn eine große Anzahl von Stasileuten da war, habe ich mich unwohl gefühlt. Die erahnte man daran, daß sie immer Zeit und irgendwie auch immer Geld hatten – aber woher? Ich kann das nur metaphysisch beschreiben: Unaufrichtigkeit spüre ich einfach, da glaube ich meinem Gefühl – da war irgendetwas, was nicht organisch war.
Das zweite war, daß da eine sehr hohe Form von Eitelkeit herrschte, die zum ästhetischen Konzept gehörte. Die habe ich zwar toleriert, aber die interessierte mich nicht. Nicht umsonst ist Eitelkeit eine christliche Todsünde. Es war ein sehr starkes Herausstellen von extremer Subjektivität und ein Spiel mit dem Nicht-gemocht-Werden vom Staat. In ihren teilweise theoretischen Schriften klang oft an, daß man das Gestische, die Ansprache, auf das Publikum zuzugehen und auch die Veröffentlichungsmechanismen ablehnte. Als jemand, der im Theater arbeitet, bin ich aber auf das Gestische angewiesen. Und so war das eigentlich kein Berührungspunkt, ich habe lediglich bestimmte Sachen gelesen, die mich interessiert haben.
Bestimmte Leute aus dieser Szene halte ich heute noch für ganz interessant. Die Mode drehte auf etwas anderes, das ist ganz normal und legitim. Hinzu kam, daß ich eine eigene Gruppe hatte, und so viel Zeit, um zu zwei verschiedenen Vereinen zu rennen, hatte ich auch wieder nicht.
Kollektiv: Am Ende Ihres Filmes Letztes aus der DaDaeR flüchten die Clowns voller Angst um ihr Leben vor einem sich formierenden Mob, der das zu fordern scheint, was die Gehetzten singen: „Die Clowns gehör’n erschossen!“ Das klingt wie eine wendezeitgemäße Herakles-Paraphrasierung aus dem Chiren-Aufsatz: „Krepier; du Dreck!“ Da zog die Bedrohung einer neuen Zeit herauf, doch hatte das Attentat offensichtlich nicht stattgefunden: Weh und Meh schlüpfen in Ihrem letzten Programm in eine ungeschminkte Angepaßtheit mit Jogginghose und kurzen Haaren.
Die durch den Fall der Mauer neugewonnene Redefreiheit hat Sie, wie viele andere DDR-Künstler, zur Umorientierung gezwungen. Da nun alles überall gesagt werden kann, u.a. vielleicht ja auch deshalb, weil das Gesagte im Sprachgetöse unserer multimedialen „schönen neuen Welt“ ohnehin kaum vernehmbar ist, muß sicher auch die in der DDR selbstgewählte Clowns-Rolle neu überdacht werden. Welche Bedeutung hat für Sie der Clown heute?
Wenzel: Die Clowns haben immer eine große Bedeutung, kann ich nur weise sagen. Sie leben in einem besonderen Verhältnis zwischen Realität, Verkleidung und eigenem Verstellen. Die Clowns haben bis 1999 eine eigene Geschichte durchlebt. Die Rollen wurden einst in der Commedia dell’arte sogar über Generationen vererbt, der Typus wandelte sich über die Zeit nur ganz langsam, veränderte sukzessive die Masken, hatte aber immer eine bestimmte Grundangewohnheit. So war das auch mit diesen beiden Figuren und ich muß sagen, die Wende war gar nicht so sehr ein Einschub.
Wir haben die Produktion in der DDR nie aus politischen Gründen oder Tabu-Geilheit gemacht, das hat mich nie interessiert, mich hat das Ästhetische interessiert und das war meist nur über politische Inhalte auszudrücken. Wenn das Ästhetische nicht stimmte, fand ich es grauenhaft. Und deswegen ist die heutige historische Sicht, beispielsweise bei Dave Robb, unvollständig, aber Geschichte ist sowieso eine Lüge. Es gibt keine genaue Beschreibung von Geschichte.
Bei Dave Robb gibt es diesen Kurzschluß: er stellt Kausalzusammenhänge direkter Art zwischen theoretischer Arbeit, gesellschaftlichen Tabus und Wirkungsstrategien auf. Aber kein Mensch arbeitet so! Theorie kann nur indirekt die künstlerische Produktion bestimmen. Es ist Quatsch zu denken, jetzt lese ich Bachtin und dann analysiere ich meine Realität und weiß, die Theorie anwendend, genau, wo es lang geht. Es gab Leute, die standen mit schlecht gestimmten Gitarren auf der Bühne und sagten: „Honecker ist doof!“ Das wäre unter dem gegenwärtigen Blickwinkel hohe kulturelle Leistung. Weil es moralisch ins gegenwärtige Klischee paßt. Das ist Irrsinn, das ist Quatsch, das liegt nur an dem eigenartigen Druck, der jetzt herrscht, das wird vorbeigehen.
Die Clowns haben mit den Umbrüchen der Zeit zu tun. Sie sind jetzt an einem End-Punkt angelangt. Sie müssen etwas anderes werden oder müssen sterben. Wir haben uns dazu entschieden, diese beiden Figuren in die Rente zu schicken. Ich habe im vergangenen Jahr einen Abend mit Musik und Texten von Hanns Eislers entwickelt, in diesem Clownskostüm, um andere Extreme auszuprobieren. „Doktor Faustus“ war in den fünfziger Jahren in die Formalismus-Debatte der DDR geraten, es gibt viele Fassungen im Archiv…
Ich habe als Clown alle Rollen gespielt, teilweise mit Originalmusik. Da habe ich nach Formen gesucht, die diese Figur erweitern könnten, und das ist für eine eventuelle Wiedergeburt unbedingt notwendig. Momentan ist der Zwang, den die Rezeption auf die beiden Clowns ausübt, zu groß, als daß sie noch frei sein könnten. Die Leute wollen etwas ganz bestimmtes von diesen beiden haben, einen bestimmten Ton, und den muß man verweigern, wenn es nicht zum Selbstlauf werden soll.
***
Kollektiv: Mit dem Verschwinden der DDR gibt es nun Konsum statt „Konsum“, es gibt keine Piko-Eisenbahn und kein vermauertes Berlin mehr, auch das Publikum ist ein anderes geworden. Die Muster einer gemeinsamen Lebenswelt lassen sich in der entschieden vielfältigeren Welt nicht mehr so einfach herstellen. Standen oder stehen Sie damit nicht vor einem Kommunikationsproblem, vor dem Problem des Mangels an einem Zeichenkonsens, und geht mit dem Fehlen eindeutiger Zeichen nicht auch der Verlust an jener Zweideutigkeit einher, von der ein Clown zehren muß? Können Sie die Assoziationen heute noch so sicher vorhersagen wie einst in der DDR?
Wenzel: Das konnte ich auch in der DDR nicht sicher vorhersagen, das wirkt nur heute so. Es stimmt, daß die Gesellschaft in bestimmte Interessengruppen zerfasert ist, die ihre eigenen Geheimkommunikationen haben. Jede Gruppe hat ihre Kommunikationsstruktur, in der zentrale Zeichenebenen dann nicht mehr wirken. Das meinte ich auch vorhin, als ich sagte, daß man in zentralisierten Staaten damit spielen kann. In Staaten, die dezentral arbeiten, in denen die Fliehkräfte das Entscheidende sind und nicht die Kräfte nach innen, haben es Sinn stiftende oder Gemeinsinn herstellende Kunstformen schwer.
Im Moment ist das nur über bestimmte musikalische Dinge zu leisten, denn in dem musikalischen Bereich gibt es diesen archetypischen, ähnlichen Konsens. Das merkt man selbst bei musikalisch ungebildeten Leuten, die, sagen wir mal, nicht sehr viel klassische Musik hören. Es gibt eine natürliche Reaktion: wenn etwas schlecht gespielt ist, langweilt auch ein guter Titel.
Mit dieser allgemeinen Zeichenstruktur versuche ich schon seit längerem zu arbeiten. Es sind nicht mehr so sehr die verbalen Zeichenebenen, die uns bestimmen, außer vielleicht die der Werbung oder die der schwachsinnigen Politiker- oder Fußballtrainerzitate. Das ist dann eben dieser Nonsens, auf dem die Comedy basiert: „Ich habe fertig.“ Aber das ist nicht mehr mit Inhalt belastet, sondern es ist nur eine Phrase, die da existiert, tausendmal darüber gelacht und es klappt immer wieder. Dieses Clowneske und Karnevalistische ging eben nur im Feudalismus und in der DDR als einem quasi feudalistischen Staatswesen.
Kollektiv: Funktionieren Ihre Programme in Westdeutschland anders als in Ostdeutschland?
Wenzel: Sie funktionieren im Norden anders als im Süden und sie funktionieren natürlich auch da unterschiedlich. Ich spiele nicht sehr viel in den alten Bundesländern. Ich habe nur eine gewisse Zeit zur Verfügung, mache nur eine bestimmte Anzahl von Konzerten, dann ist es gut, dann will ich auch mal wieder lesen und etwas schreiben. Die alten Bundesländer haben die ganze Zeit ohne mich existieren können, sie brauchen mich im Grunde nicht, sie haben ihre eigenen Institutionen und kulturellen Verwertungsmechanismen. In ein paar Orten spielt man auch, dort haben wir über Jahre hin ein Publikum „erzogen“, aber eigentlich muß es nicht sein. Zum anderen kann ich mit der kulturellen Arroganz des Westens nur schwer umgehen. Die Leute interessieren sich meist nur für sich selbst.
Kollektiv: Sie haben ja auch als Clownsduo Auftritte westwärts gemacht. Wodurch unterschieden sich diese im Ost-West-Gefüge oder Ost-Süd…
Wenzel: Die unterschieden sich vor allem darin, daß lange Zeit eine große Verwirrung herrschte, was es eigentlich sei, was wir machen. Ich merkte immer, wie die Leute nach Schubladen griffen, um für sich Ordnung zu schaffen. Es war kein Kabarett, es war kein Theater, es war keine Comedy, es war kein Konzert, es war gar nichts. Aber schon für die Werbung wird’s schwierig: Was ist denn das eigentlich, was macht ihr denn? – Ja, wir sind Wenzel und Mensching. – Na ja: Und was…? – Schwer.
Und in dieser Unsicherheit wußten sie nicht, was passiert. Sie trauten sich manchmal nicht zu lachen oder lachten an falschen Stellen, waren verunsichert. Das war interessant. Wir haben über einen längeren Zeitraum dort gespielt – es gibt ein paar Hochburgen im Süden, bei denen wir alle unsere Produktionen gespielt haben, und da haben wir mittlerweile einen Publikumsstamm.
Kollektiv: Wie funktionieren Texte, die Sie zu DDR-Zeiten geschrieben haben, heute?
Wenzel: Erstaunlich.
Kollektiv: Durchweg?
Wenzel: In einer ganzen Reihe von Konzerten habe ich Sachen von früher gesungen und war überrascht: ich singe sie anders, sie haben einen anderen Ton, aber sie funktionieren. Wir spielen aber auch Stücke. Im Oktober ’99 führte ich mit Mensching noch einmal die Fassung Letztes aus der DaDaeR auf, also ein Stück, das wir im Februar 1989 zur Premiere gebracht haben – in der Originalfassung nur mit einem Prolog, als ob die Mauer noch stehen würde. Das haben wir zweimal ausprobiert und es ist erstaunlich, wie das funktioniert – nicht mehr politisch, das ist klar, aber es funktioniert, anders. So, wie ich mir Antigone ansehe und nicht unbedingt im attischen Staat gelebt haben muß. Es kann mich ja auch als Vorgang interessieren. So ist es oft auch mit den Texten. Entweder sie haben einen poetischen Reiz, dann halten sie, oder sie haben ihn nicht, dann sind sie auch nicht wert, daß sie aufgehoben werden. Nur weil da oben ein Typ ausgewechselt wird, muß ich doch mein Schreiben nicht ändern. Die Literatur muß solche Umbrüche überleben können. Das sind doch nur Wechsel von irgendwelchen Larven an der Macht.
Kollektiv: Haben diese Erfolge auch etwas mit Ostalgie zu tun?
Wenzel: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie jemand denkt. Es sind auch sehr viele junge Leute in den Konzerten, und die können schlecht ostalgisch sein, höchstens aus Kultgründen. Außerdem gibt es so eine Sehnsucht doch immer: Als die in den zwanziger Jahren mit ihren Klampfen durch die Wälder gelaufen sind, gab es auch dieses Sehnen nach einer verlorenen Vergangenheit. Vermutlich gehört es zum Singen oder zum Konzerthören immer dazu, daß man so einen Grundton von Melancholie hat, daß etwas verloren ist. Mag das nun DDR oder klassische Kunstperiode heißen, der Widerspruch bleibt erhalten.
Für mich ist der entscheidende Unterschied, daß die DDR eine präkoitale Gesellschaft war, und wir jetzt in einer postkoitalen leben. Das heißt, wir lebten immerzu unter dem Druck permanenten Unbefriedigtseins, irgendwie mußte immer alles gelöst werden. Das klingt jetzt so, als ob wir da ganz böse gewesen wären, so war’s nicht. Jetzt leben wir in einem Zustand, in dem unbefriedigt sein ein sozialer Mangel ist. Der Zustand des Befriedigtseins gehört zum sozialen Standard, sonst ist man gleich ein Außenseiter: Ich muß es mir leisten können, in die Sonne zu fahren, wenn mir danach ist, und wenn ich nicht befriedigt bin als erfolgreicher Businessman, dann bin ich dazu nicht in der Lage. Das bedeutet für mich vor einem Koitus oder nach einem Koitus stehen. Und sicher hängt dieses aufbrausende Alles-oder-Nichts, das in diesem präkoitalen Verhalten gespeichert ist, damit zusammen.
Kollektiv: Haben sich solche Unterschiede in Habitus oder Mentalität nach einem Jahrzehnt nicht nivelliert?
Wenzel: Nein, das hat sich noch mehr verschärft. Im Grunde haben sich eigentlich viele der ostdeutschen Künstler eher dem westlichen Standard angepaßt, als daß sie ihre, wenn auch sparsam ausgeprägte, eigene Handschrift durchsetzen würden. Auch die Organisation des Kunstbetriebs im Westen und im Osten ist unterschiedlich. Wir haben viele Produktionen, auch um dem Vorwurf der Ignoranz zuvorzukommen, im Westen getestet, den Abschied der Matrosen vom Kommunismus in fränkischen Dörfern zum Beispiel. Wir haben zehn Vorstellungen vor der Premiere gespielt, in Kneipensälen und unter ganz normalen Bedingungen. Das funktionierte schon, aber es gibt dort ein anderes rituelles Verhalten im Kunstbetrieb.
Ich will’s mal böse sagen: Manchmal hat man auf so einer Kleinkunstbühne das Gefühl, die Leute haben sich meinen Körper für zwei Stunden gekauft. Diese Empfindung würde es im Osten nicht geben, obwohl man da auch Eintritt bezahlt. Das ist so eine komische Verschiebung, das hängt wohl mit kulturellen Traditionen und Ritualen zusammen. Das, was wir da machen, ist eben Kleinkunst: Nicht ganz groß gewordene Kunst. Das kann man nicht genau orten. Hinzu kommt, daß der Westen unter einer ungeheuerlichen Ignoranz gelitten hat und noch leidet. Ich habe zum Beispiel bei einem westdeutschen Liedermachertreffen auf der Burg Waldeck, einem legendären Ort, ein Konzert gegeben – da waren ganz viele Leute, die Liedermafia, und die waren völlig von den Socken, daß es so etwas gibt. Ich spiele seit zwanzig Jahren, und die waren ja jene, die in den anderen deutschen Teil hätten kommen können, aber sie haben sich einfach nicht dafür interessiert.
Und diese Ignoranz besteht weiter. Wenn da irgendeine Kulturdame sagt: Ja, wer is’n das, der soll mir mal Demos schicken. Das ist ganz komisch, das ist manchmal so, als ob man wieder anfängt, als ob ich meine Gitarre gerade das erste Mal gestimmt hätte. Da bin ich zu stolz und das mache ich nicht. Und deswegen vernachlässigt man diesen Bereich auch.
Kollektiv: Den Versuch, das Clownsduo Weh und Meh in einen anderen Kulturkreisen zu stellen, gab es auch schon vor der Wende, ein meines Erachtens bemerkenswertes Experiment: Anfang 1989 wurde das DaDaeR-Programm in Nicaragua aufgeführt. Wie ist das dort angekommen?
Wenzel: Wir haben es teilweise in spanisch gespielt, und wir haben es sozusagen nicht „pur“ gespielt, sondern gestischer. Diese Grundsituation, daß sich Leute mit Orden erstechen, das kannten sie unter sandinistischen Verhältnissen ebenso, also es waren schon ähnliche Erfahrungsmomente… Schwieriger war, daß sie eine Tradition wie Theater gar nicht hatten. Theater ist eine europäische Institution, die es dort nicht gibt. Da gibt es wohl mal irgendwo ’ne Theatergruppe aber das ist ziemlich exotisch. Wir haben damals einen Schlußtext von Neruda gehabt, den wir im Original gesprochen haben – nachdem wir ihn mit Kreide auf die Erde geschrieben hatten… Es war, als käme die Form unseres Spielens, den Neruda-Text benutzten wir auch in der DDR, zu seinen ganz frühen Quellen zurück, noch ganz ohne Katechismus.
Es ist ein sehr schönes Gefühl, in einem anderen Denksystem seine Sachen auszutesten.
Kollektiv: Das letzte Programm hieß bereits Die letzte Ölung, das Abschiedsprogramm, eine Best-of-Reprise, titelt Ab klappt er der Adapter – Warum werden die Clowns aufgegeben?
Wenzel: Das sind sehr viele Gründe. Ein Grund ist, daß so eine Institution aufhören muß, so lange sie noch vital ist und nicht erst, wenn sie anfängt, nicht mehr lebendig sein zu können. Zum anderen lassen sich die beiden Clownstypen nur schwer erweitern, die beiden Figuren sind an einer Art Endpunkt, und da muß man aufpassen. Der dritte, sehr banale Grund ist, daß im August vorigen Jahres, unsere ausgleichende dritte Person, unser Dramaturg und Regisseur, verstorben ist. Das heißt, daß wir jetzt das demokratische Verhältnis 1:1 haben, was bei zwei sehr energischen Persönlichkeiten kompliziert ist. Und dann ist es natürlich so, daß man sich von Dingen, die einfach nur noch funktionieren, weil sie immer funktioniert haben, verabschieden muß. Ich mag das nicht.
die horen, Heft 201, 1. Quartal 2001
HANS-ECKARDT WENZEL
blumenbrechen argusstechen
braunbierzechen weg wegspülen
unschuld spielen mannsbildsuchen
schamverfluchen reisebuchen mutters
laster gutbetuchen knebeln säbeln
greifen steifen zutschen lutschen
buckelrutschen singen ringen schlingen
oma ihre kekse bringen
mädchen wollt ich niemals sein
wie kam ich in dies märchen rein
Peter Wawerzinek
Fakten und Vermutungen zum Poesiealbum + wiederentdeckt +
Interview
50 Jahre 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Torsten Wahl: Distanz zu den Siegern
Mitteldeutsche Zeitung, 30.7.2015
Torsten Wahl: Hans-Eckardt Wenzel hält sich tapfer am Rand
Berliner Zeitung, 31.7.2015
Hans-Eckardt Wenzel – Sänger, Dichter, Weltentdecker
Mitteldeutscher Rundfunk, 30.7.2015
Hans-Dieter Schütt: Hoch die Meerwertsteuer!
neues deutschland, 31.7.2015
Matthias Zwar: Der Clown mit den traurigen Augen
Freie Presse, 31.7.2015
Fakten und Vermutungen zum Autor + Facebook + Interview + IMDb
Porträtgalerie: deutsche FOTOTHEK
Hans-Eckardt Wenzel Soloprogramm 2006 bei den Osterburger Literaturtagen im Hotel Zum Reichskanzler.

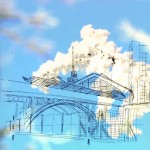
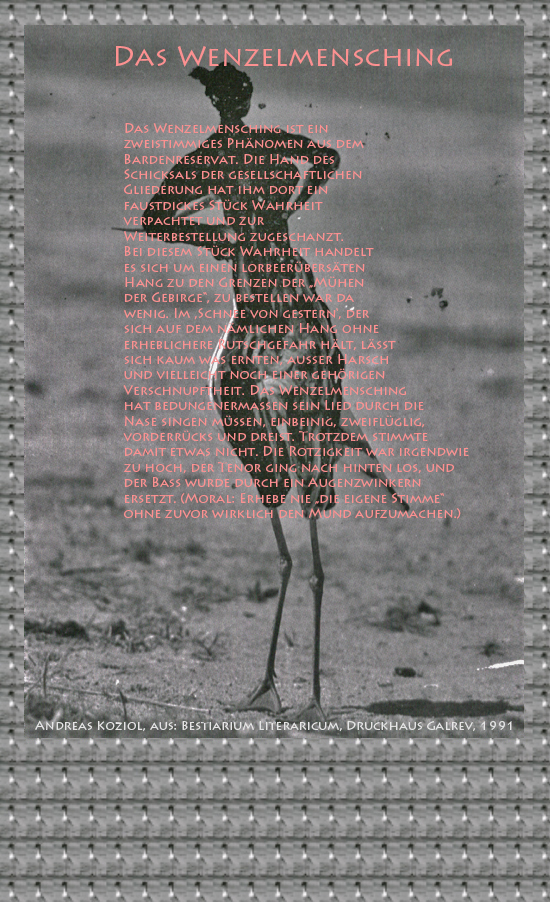













Schreibe einen Kommentar