Heinz F. Schafroth: Günter Eich
VITA
Nur keine Spuren hinterlassen
Eich hat zeitlebens nichts getan, seine Biographie zu überliefern, und schon gar nicht dafür gesorgt, daß sie von der Attraktivität der Legende lebt. Sie ist deshalb, soweit der Autor selbst sie vermittelt, eine Reihe nackter Zahlen, Ortsnamen, Daten, Fakten. Der Versuch, sie mit Hilfe von Menschen, die Eichs Leben streckenweise begleiteten, einigermaßen zu verbinden und mittels vorsichtiger Interpretation lebendig werden zu lassen, ist behelfsmäßig und fragwürdig.
Günter Eich wurde am 1. Februar 1907 in Lebus an der Oder geboren. Im selben Jahr wie Wolfgang Weyrauch. Ein Jahr nach Stefan Andres. Ein Jahr vor Albrecht Goes, Gerd Gaiser, Edzard Schaper. Mit dieser zufälligen Liste soll angedeutet werden, daß Eichs Wirkung innerhalb der deutschen Literatur seit 1945 bis heute kaum eine Parallele hat bei Autoren seines Jahrgangs. (Am ehesten ist noch diejenige Peter Huchels, der 1903 geboren wurde, mit der seinen zu vergleichen.)
Lebus an der Oder – die Herkunft hat zuletzt anläßlich von Eichs Tod zu reden gegeben. Lebus liegt in der Mark Brandenburg, die heute zur DDR gehört. Eich wird deshalb von seiner Herkunft aus zum „Vertreter“ eines „Typus“:1
Deutschland: das waren ja nicht bloß Rheinländer, Hessen, Franken und Bayern, dazu gehören auch Mecklenburger, Pommern, Schwerblütige aus der Mark. Wir bemerken nicht, daß… ein stiller, sympathischer, herrlich verbiesterter und leiser Menschenschlag… ausstirbt. Günter Eich hat eines seiner Gedichte Peter Huchel gewidmet, einen andern Text für Uwe Johnson geschrieben. Weiß man überhaupt noch, daß sie alle aus einer deutschen Ecke kommens die in der DDR umfunktioniert wird und hierzulande vergessen?
Eich als Vertreter eines Menschenschlags? Gleichsam Symbolfigur für die ,Tragödie der deutschen Teilung‘? Er hätte dazu vermutlich einiges zu bemerken gehabt.
Eich war der zweite Sohn. (Sein älterer Bruder hat Zeitungswissenschaft studiert, ist Dr. phil. geworden und lebt heute in der Nähe von München.) Während Eichs Kindheit war der Vater zunächst als Rechnungsführer und Verwalter auf landwirtschaftlichen Gütern tätig, ließ sich dann zum Bücherrevisor ausbilden und zog mit seiner Familie 1918 nach Berlin, wo er eine Kanzlei als Steuerberater führte.
Fast zweitausend Jahre vorher ist ein anderer Vater vom Land in die Hauptstadt gezogen, mit einem Sohn, der einer der größten Schriftsteller seiner Zeit werden sollte. Dieser Vater – es handelt sich um denjenigen des Horaz – zog nach Rom, „… weil er, obwohl arm mit seinem mageren Äckerlein, den Knaben nicht in die Dorfschule des Flavius schicken wollte sondern es gewagt hat, ihn nach Rom zu bringen und ihn in den Wissenschaften und Künsten unterrichten zu lassen…“ (Horaz, Satiren I, 6, Vers 71–77). Die Vorstellung, Eichs Vater habe vergleichbare Beweggründe gehabt, ist anziehend – in irgendeiner Weise durch Eich legitimiert ist sie freilich keineswegs.
1925 macht Eich sein Abitur in Leipzig und beginnt dann mit dem Studium der Sinologie in Berlin. In den ersten Jahren des Studiums entstehen die ersten Gedichte („schon mit neunzehn Jahren pries ihn Oskar Loerke…“),2 1927 werden einige davon in einer Anthologie veröffentlicht, deren Herausgeber Willi Fehse und Klaus Mann sind. Eich publiziert zunächst unter dem Pseudonym Erich Günter. „Wer weiß denn, wie es mir geht, wenn das Buch einem meiner Professoren in die Hände fällt?“3 – so soll er später die Wahl eines Pseudonyms begründet haben und dabei weniger an die Sinologie-Professoren gedacht haben als an diejenigen für Handelsökonomie und Volkswirtschaft: Diese Fächer hat Eich zusätzlich zu studieren begonnen, 1927 in Leipzig.
1928/29 studiert er in Paris wieder ausschließlich Sinologie. Nach seiner Rückkehr schreibt er (zusammen mit seinem Freund Martin Raschke) ein erstes Hörspiel, und 1930 erscheint sein erster Gedichtband: Gedichte. Sein Studium hat Eich nur für kurze Zeit wieder aufgenommen. Er gehört ab 1931 dem Autorenkreis um die Dresdener Literaturzeitschrift Die Kolonne an (zusammen mit Autoren wie Peter Huchel, Elisabeth Langgässer, Oda Schaefer, Horst Lange – laut einem Interview Eichs aus dem Jahre 1949, s. Gesammelte Werke Bd. IV S. 397).4 In der Kolonne und in Die neue Rundschau veröffentlicht Eich die meisten Arbeiten jener Jahre. Er gibt sein Studium auf, weil „die andern in den Kollegs und Diskussionen immer alles besser wußten, obgleich ich doch wirklich geochst und gebüffelt habe. Ich taugte wohl doch bloß zum Schriftsteller.“5 Als solcher lebt Eich in den dreißiger Jahren vor allem von Auftragsarbeiten für den Funk. Zwischen 1932 und 1940 sind über zwanzig Sendedaten für Werke Eichs nachgewiesen (s. Gesammelte Werke Bd. III S. 1409ff.), dazu eine von 1933–37 sich erstreckende Serie, die gemeinsam mit Martin Raschke verfaßte Monatssendung Deutscher Monatskalender – ein Monatsbild vom Königswusterhäuser Landboten.
Mitte der dreißiger Jahre hat Eich geheiratet. Seine erste Frau, Sängerin von Beruf, ist bald nach dem Krieg gestorben.
Bei Kriegsausbruch lebt Eich in der Nähe Berlins. Er wird – „weil er ein Auto besaß“ – sogleich zum Bodenpersonal der Luftwaffe eingezogen. Erhart Kästner berichtet, er habe Eich bei Kriegsbeginn „in soldatischer Verkleidung“ angetroffen, zusammen mit Martin Raschke, der erzählt habe:
Der Eich, der lernt jetzt in einem fort Gedichte auswendig, denn er sagt, die werde man im Unterstand brauchen.6
Eich hat auch die Kriegsjahre nicht biographisch verarbeitet. Daß unter den Gedichten, die er auswendig lernte, solche von Hölderlin waren, läßt sich in dem berühmt gewordenen Gedicht „Latrine“ feststellen. Und vielleicht gehörten auch schon einige jener entlegenen Verse dazu, die Eich bis in die letzten Jahre seines Lebens zitierte, etwa die Schlußverse von Kleists Gedicht „Katharina von Frankreich“:
Und jetzt begehrt er nichts mehr,
als die eine –
ihr Menschen, eine Brust her,
daß ich weine.
1940 wird Eich auf Veranlassung seines Freundes Jürgen Eggebrecht7 in die Stabsstelle Papier kommandiert, die von Eggebrecht geleitet wurde. Eggebrecht, wie Eich nie Mitglied der nationalsozialistischen Partei befördert Eich zum Unteroffizier und kann ihn bis 1944 vor einem Fronteinsatz bewahren.
1945 gerät Eich bei Remagen in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Erst jetzt beginnt er wieder zu schreiben, einen Teil jener Gedichte, die 1948 in der Sammlung Abgelegene Gehöfte erscheinen. 1946 nimmt Eich in Geisenhausen bei Landshut Wohnsitz, dort, wo er während des Krieges zeitweise einquartiert war. Die ersten Nachkriegstexte Eichs werden in der Münchner Gefangenenzeitschrift Der Ruf gedruckt. Die Redakteure des Ruf, Hans Werner Richter und Alfred Andersch werden von der amerikanischen Militärregierung wegen kritischer Äußerungen zur Politik der Besatzungsmächte entlassen. Sie beschließen die Gründung einer Ersatzzeitschrift und fordern Mitarbeiter des Ruf auf, auch beim geplanten Skorpion mitzumachen. Aus der Gründungszusammenkunft der künftigen Skorpion-Mitarbeiter und -Herausgeber entwickelt sich die Gruppe 47, die das literarische Leben in der Bundesrepublik während der nächsten zwanzig Jahre maßgeblich beeinflussen wird. Eich ist eines der ersten Mitglieder. Schon 1948 liest er auf einer ihrer Tagungen vor, und 1950 spricht ihm die Gruppe ihren ersten Literaturpreis zu, für Gedichte, die fünf Jahre später in den Botschaften des Regens erscheinen.
Auf einer der Gruppentagungen lernt Eich seine zweite Frau kennen, die österreichische Schriftstellerin Ilse Aichinger. Seit ihrer Heirat, 1953, ist Ilse Aichinger Eichs erste Leserin und Kritikerin. 1965 erklärt er in einem Interview (Gesammelte Werke Bd. IV S. 406):
Ich empfinde eine starke Verwandtschaft zwischen ihrer Art zu schreiben und meiner, finde ihre literarische Bedeutung größer.
Die beiden wohnen zuerst in Geisenhausen, dann in Breitbrunn am Chiemsee, ab 1956 in Lenggries in Oberbayern, danach in Bayrisch Gmain und ab 1963 im österreichischen Groß-Gmain (b. Salzburg). Solange er Eich kenne, habe der immer in gottverlassenen Nestern gewohnt, schreibt Peter Hamm später einmal. 1954 wird der Sohn Clemens geboren, 1957 die Tochter Mirjam.
In den fünfziger Jahren schreibt Eich seine berühmtesten Hörspiele, veröffentlicht er seine populärste Gedichtsammlung (Botschaften des Regens). Er erhält eine Reihe angesehener Literaturpreise, so 1953 den Hörspielpreis der Kriegsblinden und 1959 den Georg-Büchner-Preis. Er unternimmt, bis lange in die sechziger Jahre hinein, größere Reisen, meist Lesereisen. 1955 nach Portugal, 1962 nach Japan, Indien, Kanada und in die USA, 1965 in den Senegal und 1967 nach Persien.
1967, auf der letzten Tagung der Gruppe 47, liest Eich erstmals ,Maulwürfe‘ vor.
Die beiden letzten Lebensjahre sind gekennzeichnet durch lange Krankheiten und Spitalaufenthalte, ab 1972 scheint Heilung ausgeschlossen. Eich erlebt noch das Erscheinen seines letzten Gedichtbandes (Nach Seumes Papieren) und die Erstsendung seines letzten Hörspiels (Zeit und Kartoffeln), des einzigen, das er nach 1964 noch geschrieben hat. Am 20. Dezember 1972 stirbt Eich in einem Salzburger Krankenhaus. Am 22. Dezember wird er, ebenfalls in Salzburg, kremiert. Er hat sich ein Begräbnis gewünscht, an dem nur die engsten Familienangehörigen teilnahmen.
„Nach dem Ende der Biographie“ (so ist eines der zehn Gedichte im letzten Gedichtband überschrieben) bleibt nur die nochmalige Feststellung ihrer Fragwürdigkeit, vielleicht Unzulässigkeit. Eich selbst – soviel ist gewiß – wollte seine Biographie banal, nicht reich, nicht zugänglich, nicht auswertbar und anwendbar. Möglicherweise aus Gründen der Diskretion. Und aus der Überzeugung heraus, daß Dichterbiographien, die es darauf abgesehen haben, es zu sein, unzumutbar seien, und daß demjenigen, der schreibt, die Festianus-Solidarität mit denen, die keine Biographie hinterlassen, zustehe.
Oder sein Verschweigen des Biographischen hängt zusammen mit dem 1962 notierten Satz:
Sprache beginnt, wo verschwiegen wird. (Gesammelte Werke Bd. IV S. 307)
Eich könnte die Daten, die Landschaften und Orte, die Personen und Begegnungen verschwiegen haben, weil dies die einzige Möglichkeit war, sie zur Sprache zu bringen, Sprache werden zu lassen. Wenn es sich so verhält, dann wäre Eichs eigentliche Biographie in seinem Werk aufzuspüren. Und für die Biographie außerhalb des Werks gälte dann das: „Nur keine Spuren hinterlassen“, der Vers also, mit dem Eich das erste Gedicht seiner letzten Gedichtsammlung abschließt.
Die frühen Gedichte
„Deine Tage gehen falsch“ („Verse an vielen Abenden“, Gesammelte Werke Bd. I S. 9). Dieser Vers bedeutet Eichs lyrisches Debut. Er leitet das erste von acht Gedichten Eichs ein, die 1927 in der Anthologie jüngster Lyrik erschienen sind. Er soll nun nicht die lyrische Originalität des Zwanzigjährigen beweisen. Aber er besticht: durch Lakonik und eine Art Kälte; durch eine unüberhörbare, abweisende Radikalität – er schließt Einwände und weltanschauliches Palaver aus. In diesem Sinn nimmt der erste Vers, den die Öffentlichkeit von Eich zu lesen bekommt, den Autor des Gedichtbandes Zu den Akten (1964) vorweg. Das ist keineswegs eine Feststellung, die allgemein für die Lyrik des jungen Eich zu machen wäre. Eich selbst erklärte 1965, er habe als „verspäteter Expressionist und Naturlyriker“ (Gesammelte Werke Bd. IV S. 407) begonnen. Expressionismus und Naturlyrik sind die Begriffe, die auch in der Sekundärliteratur über Eichs Lyrik bis hin zu den Botschaften des Regens (1955) am beharrlichsten auftauchen. Und die Autoren, denen er immer wieder zugeordnet wird, sind die Naturlyriker Loerke (1884–1941) und Lehmann (1892–1968). Aber auch Trakls und Rilkes, sogar Georges Wirkung wird nachgewiesen, und von ihnen aus wird Eichs frühe Lyrik zurückgeführt auf die französischen Symbolisten auf der einen und Novalis, Brentano und Hölderlin auf der andern Seite.
Das Vokabular von Eichs früher Lyrik mutet jedenfalls bekannt an. Gestirne, Sterne, Mond, Trauer, Schmerz, erinnern, Erinnerung, vergehen, verwehen – Vokabeln wie diese und ähnliche sind auffallend häufig und damals kaum weniger abgebraucht, als sie heute anmuten. Und wenn das Bewußtsein ihrer Abgebrauchtheit zu besonders exquisiten Zusammenstellungen veranlaßt („blauer Herbst“, „bittere Sterne“), wirken diese, zumindest in ihrer Tendenz, eher gängig als kühn. Der Herbst, auch das erstaunt nicht, ist stärker vertreten als alle anderen Jahreszeiten, und die dominierenden meteorologischen Verhältnisse in Eichs damaliger Lyrik (und nicht nur seiner) sind Regen, Wind und Nebel.
Eich hat in einer interessanten Lyrikdiskussion das Recht des Lyrikers auf die alten Wörter verteidigt. Bernhard Diebold, Dramaturg und Kritiker, hatte 1932 den jungen Lyrikern vorgeworfen, daß sie, wie vor hundert Jahren, unter Goethes Mond und in Hölderlins oder Mörikes Hain lebten. Er stellt die These auf, die neue Lyrik könne „nur an der neuen Umgangssprache mit modernen Vokabeln und modernen Gegenständen herauskristallisiert werden“. (Gesammelte Werke Bd. IV S. 470) Eich entgegnet, daß die äußeren Erscheinungsformen wie Flugzeug und Dynamo nicht das Wesentliche einer Zeit seien, sondern die Veränderungen, die ein Mensch und seine Empfindungsmöglichkeiten durch sie erführen. Weil keines der neuen Denk- oder Lebenssysteme die Zeit universal repräsentiere, würde die Entscheidung des Lyrikers für heutige Vokabeln die Entscheidung nur für eine Teilerscheinung der Zeit bedeuten, und solche interessierten den Lyriker nicht.
Die Wandlungen des Ichs sind das Problem des Lyrikers. Das wird im Formalen die Folge haben, daß er… Vokabeln vermeidet, die ein zeitgebundenes, also ihn nicht direkt interessierendes Problem in sich schließen. Ja, ich meine, der Lyriker muß ,alte‘ Vokabeln gebrauchen, die, selbst problemlos geworden, ihre neue Bedeutung erst durch das Ich gewinnen. An Vokabeln wie ,Dynamo‘ oder ,Telephonkabel‘ hängen soviele zeitlich bedingte Assoziationen, daß sie die reine Ichproblematik des Gedichts durch ihre eigene Problematik zumeist verfälschen.(Gesammelte Werke Bd. IV S. 389)
Die Stellungnahme beweist, daß Eich das epigonale Vokabular mit Bewußtsein und aus einer Gegnerschaft zu Modetendenzen heraus verwendet.
Es wäre dennoch falsch, ihn zu berichtigen, wenn er seine frühe Lyrik 1965 als „verspätet“ bezeichnet. Sie ist es vielfach auch in ihren Motiven. Die Sehnsucht, mit der Natur zu verschmelzen („du mußt wieder stumm werden, unbeschwert, eine Mücke, ein Windstoß, eine Lilie sein“; „Verse an vielen Abenden“, Gesammelte Werke Bd. I S. 9), kontrapunktiert die Vergänglichkeitserfahrung, die die Natur besonders schmerzlich vermittelt. Aus der Schönheit der Erinnerungen schleicht die Erkenntnis des Vorbei, Zuspät, und sie erweckt Aggression gegen die Erinnerung („Laß dein Herz verhärten / und ohne Gedächtnis sein“; „Gesicht“, Gesammelte Werke Bd. I S. 57). Das Ich ist heillos gespalten, und die eine Hälfte von der andern so völlig geschieden, daß es zur „Erinnerung an mich selbst“ (Gesammelte Werke Bd. I S. 17) kommen kann und zur Erfahrung des andern Körpers („mein anderer Leib“; „Aegyptische Plastik“, Gesammelte Werke Bd. I S. 11, und „Erinnerung an mich selbst“, Gesammelte Werke Bd. I S. 17). Schließlich verschwimmt jegliche Wirklichkeit und wird ungewiß:
Wir sind uns so entschwunden,
daß alles fraglich wird…
was war denn Wirklichkeit
(„Der Anfang kühlerer Tage“, Gesammelte Werke Bd. I S. 12)
In diesem Verschwimmen und Verschwinden, in der Vagheit seiner Existenz verliert der Mensch Sicherheit und Halt, es gibt keine Erfahrung mehr, die ihm Heimatgefühle vermitteln könnte; er bleibt unbehaust, in Tod und Leben gleichermaßen:
… Dieses heißt Leben und ein anderes Tod. Aber wir gehören
nie einem ganz an
(„Verse an einen Toten“, Gesammelte Werke Bd. I S. 15)
Kein Zweifel: in dieser Lyrik ist vieles vertrauter Weltschmerz, vieles teils zeit-, teils altersbedingt. „O ich bin von der Zeit angefressen“ – ein Vers wie dieser (aus einem Gedicht von 1927, „Verse an vielen Abenden“, Gesammelte Werke Bd. I S. 9) kann als Motto für einen großen Teil von Eichs Frühwerk verstanden werden.
Aber gerade dieser Vers, sieht man einmal ab von der Traklschen Interjektion am Anfang, ist erstaunlich hart im Ton, es geht ihn die Traklsche Sangbarkeit gänzlich ab, er läßt den Grundklang pubertärer Wehleidigkeit, der in den Gedichten verbreitet ist, in dieser Härte weit hinter sich. Ähnlich merkwürdige Töne finden sich auch sonst in Eichs frühen Gedichten. In „Fragment“ (Gesammelte Werke Bd. I S. 10/11) von 1930 zum Beispiel.
Wolken klettern wie Tiere auf den Berg des Himmels,
die Abende dunkeln zu früh und aus allen
Lampen tropft der Herbst.
Dies kennst du, es ist November,
weit sind Wiesen und die Gerüche des Waldes.
Als du sehr klein warst, fingst du Schmetterlinge.
Alles verging, wie ein Atemzug voll Wind.
Zwischen die Tage schieben sich Ewigkeiten.
Du hörst, wie unterm Regen ein Kind eine Mundharmonika bläst.
Die Bäume rosten und
wie ein Flug Wildenten erscheinen im Schilf die Geschwader der Sterne.
Gewiß wuchern da noch Metaphorik und Melancholik, gibt es zuviel Vergleiche und große Worte (Ewigkeiten), die rostenden Bäume und der aus allen Lampen tropfende Herbst sind schwer zu ertragen. Aber es kommt auch ein Satz vor wie „die Abende dunkeln zu früh“, ein Satz ohne Zutaten und Attraktionen, ein Satz der fast nur Information ist. Und da ist auch der Vers von den Schmetterlingen, an dem vielleicht das rilkesche „sehr“ noch stört, der aber auch so eindringlich unvermittelt an eine Leerstelle anschließt und der eine starke Traurigkeit mit einer einfachen, ganz und gar zugänglichen Feststellung belegt. Noch stiller und nachhaltiger die akustisch-optische Genauigkeit im Vers:
Du hörst, wie unterm Regen ein Kind die Mundharmonika bläst.
Ebenso genau und plastisch die Verbindung einer seelischen und einer räumlichen Erfahrung in einem Vers des Gedichts „Aegyptische Plastik“(Gesammelte Werke Bd. I S. 11):
und im Horizont verschwand das Fahrzeug traurig und verrückt.
Es gibt unter Eichs frühsten Gedichten solche, die moderner anmuten als manche aus Abgelegene Gehöfte.
Nach dreißig Wochen grundloser
Unruhe, nach dreißig Wochen
zitternder Luft, möchte ich
ein Feld hier haben, um darüberhin
zu stolpern vielleicht, mit Füßen,
die nicht mehr lernen wollen zu gehn.
Nach dreißig Wochen und es sind
Gefühl und Sprache abgelegt wie alte Kleider,
unnütz wie ein Zeitungsblatt vom vergangenen Jahr. (Gesammelte Werke Bd. I S. 181)
Was hier auffällt, ist das Bemühen, prosaisch zu sein, ist der Versuch, Natur als Erfahrung, nicht als Metapher einzusetzen („Feld…, um darüberhin zu stolpern“). Wo Vergleiche verwendet werden, sind sie unpoetisch, sachlich, ohne Farbigkeit. Zusammen mit der Vorstellung des Clownesken (Vers 5/6) ergibt das eine Grundsituation, die entfernt an Beckett erinnert.
Erstaunlich auch die Schlußstrophe von „Erwachen“ (Gesammelte Werke Bd. I S. 183):
Langsam fallen dir wieder
Silben und Worte ein:
Gehen, Herbst, Straße,
Traum, du und dein.
Der Augenblick des Erwachens ist nachvollzogen an der Rückkehr der Sprache, der Worte, die in dem Moment, wo sie sich, zufällig, unprogrammatisch, wieder einstellen, erst die Umgebung, die Wirklichkeit erschaffen. Das ist ein früher Beleg für „die Entscheidung“ des Schriftstellers Eich, „die Welt als Sprache zu sehen“ (Gesammelte Werke Bd. IV S. 441). Ebenso Vorwegnahme, diesmal der „verschweigenden Sprache“ (Gesammelte Werke Bd. IV S. 307), ist eine Formel aus einem Gedicht zum Geburtstag Loerkes:
Wort, das selber schweigt (Gesammelte Werke Bd. I S. 185).
Und im Gedicht „Manchmal“ (Gesammelte Werke Bd. I S. 56), das 1932 entstanden ist, dann (wie übrigens viele der Gedichte aus den dreißiger Jahren) in die Sammlung Abgelegene Gehöfte von 1948 aufgenommen wurde, ist das für Eich später zentrale Mißtrauen gegen die Antworten und seine „Option für die Frage“8 andeutungsweise artikuliert:
Hörst du endlich die Frage,
und die Antwort ist plötzlich schwer.
Auch der meist konventionell anmutende Weltschmerz gewinnt manchmal eigenartige Dimensionen. An den Vers „O ich bin von der Zeit angefressen“ schließen die Verse an:
und bin in gleicher
Langeweile vom zehnten bis zum achtzigsten Jahre (Gesammelte Werke Bd. I S. 9).
In „Gegen vier Uhr nachmittags“ (Gesammelte Werke Bd. I S. 56) heißt es:
… jeden neuen Tag mit allen
alten Tagen vermengt.
Die Melancholie, welcher der Weltschmerz oder -ekel sich so formuliert nähert, weist wie das Wort Langeweile auf Büchners Leonce und Lena oder Danton, und der junge Eich ist da nicht mehr jung wie die Expressionisten oder Stürmer und Dränger, sondern eher wie der ihm später so wichtige, als Vierundzwanzigjähriger verstorbene Georg Büchner und wie dessen Leonce, von dem Lena sagt:
Er ist so alt unter seinen blonden Locken. Den Frühling auf den Wangen und den Winter im Herzen.
Man kann (und hat) anhand der Perfektion von Eichs Strophen, Rhythmen und Reimen nachweisen wollen, daß sich in den frühen Gedichten der große Lyriker entdecken ließe. Aber die Souveränität in der Beherrschung übernommener Formen ist allgemein Merkmal des Epigonalen. Interessanter und wegweisender sind die „Ungereimtheiten“ in Eichs frühen Gedichten; die Verse, wo er sich nicht ohne weiteres auf die Zeit und naheliegende Vorbilder zurückführen läßt. Ein Vers wie der erste aus dem Zyklus „An vielen Abenden“. Mit diesem leitete Eich 1930 den eigenen Gedichtband ein, und er steht erneut am Anfang des 1972 erschienenen Eich-Lesebuchs,9 das der Autor selber zusammenstellen half. Der erste Vers einer von Eich selbst legitimierten Sammlung eigener Texte ist angesichts von Eichs bekannt bösartigem Umgang mit seinem früheren Werk also gewiß von einigem Gewicht. Er lautet:
Herumtrabend mit hungrigen Wolfsschritten um deine verlassene Hütte (Gesammelte Werke Bd. I S. 9).
Wenn einem solchen Vers gegenüber von Beherrschung der Form gesprochen werden kann, dann kaum im üblichen Sinn. Der Vers scheint in seiner ungeheuren Länge jegliche Form sprengen zu wollen. Er ist von Rhythmus und Wortstellung her seltsam sperrig, jedenfalls überhaupt nicht glatt und einnehmend. Aber in dieser Sperrigkeit ist es ein Vers, der stärker an den späten Eich erinnert als viele Verse, die ihn in den Fünfziger Jahren als Lyriker erfolgreich gemacht haben.
Inhalt
I. Vita: Nur keine Spuren hinterlassen
II. 1927–1945: O ich bin von der Zeit angefressen
1. Einleitung
2. Die frühen Gedichte
3. Die Vorkriegshörspiele
4. Die Prosa der dreißiger Jahre
5. Der Präsident
6. Günter Eich und das Theater
7. Europa contra China – Eichs Auseinandersetzung mit dem Osten
III. 1946–1958: Alles was geschieht, geht dich an
1. Einleitung
2. Die Prosa
3. Eichs Verhältnis zu seiner Prosa
4. Die Gedichtbände Abgelegene Gehöfte, Untergrundbahn und Botschaften des Regens
5. Die klassischen Hörspiele
6. Eich und das Hörspiel – ein provisorischer Abschluß des Themas
7. Eichs Poetologie 1930-1971
IV. 1959–1972: Mir liegt nichts daran, mich anmutig zu bewegen
1. Einleitung
2. Die Büchner-Preis-Rede: Der ,politische‘ Eich
3. Die Marionettenspiele
4. Die letzten Hörspiele
5. Die Gedichtbände Zu den Akten, Anlässe und Steingärten und Nach Seumes Papieren
6. Die Entwicklung von Eichs Lyrik und Theorien zur Lyrik
7. Die Maulwürfe
V. Eichs Position in der deutschen Literatur nach 1945: Eben hielt ich mich noch für Avantgarde, schon gibt es Spezialisten
Anmerkungen
Zeittafel zu Leben und Werk Günter Eichs
Günter Eich – Inventur
Die Buchpublikationen der ersten Nachkriegsjahre geben auf die Frage nach authentischer Lyrik meist nur enttäuschende Auskunft. Sie scheinen allenfalls das Schlagwort von der „schweigenden Generation“ bestätigen zu wollen, das seinerzeit neben den Begriffen „Nullpunktsituation“ und „Kahlschlagliteratur“ (Wolfgang Weyrauch) die Runde machte. Auch wenn man heute noch einmal die Zeitschriften jener Vorzeit durchblättert, die behelfsmäßigen Sammelbroschüren und zusammengestoppelten Anthologien, findet man allenfalls so etwas wie Unvollkommenheit repräsentiert. Woran es mangelt, ist vor allem Richtung und Kontur. Ganz offensichtlich hatte man zunächst einmal versucht, versprengte einzelne unter Dach und Buchdeckel zu bringen, ohne das alteingesessen Formtreue vom Flugversuch des Anfängers zu trennen und auf stilistische Geschlossenheit hinzuwirken. Man muß schon sehr genau hinsehen, um wenigstens einen Anflug von Richtung auszumachen, wird dann, rückblickend, freilich zu meinen neigen, daß die sachlichen Ironiker und Grau-in-Grau-Maler dem glanzlosen Alltag angemessener begegneten als die Pathetiker mit dem pastosen Farbauftrag.
Wo Poesie sich an einer Ortsbestimmung des Menschen versuchte – zu denken an Günter Eich – da lief es allemal auf die Nennung flüchtiger Aufenthaltsorte hinaus: Gefangenenzelt, Strohsack, Schlafbunker, Bahnhof, Nissenhütte, Baracke, Wartesaal.
In diesem Umkreis trat der Mensch als ziemlich transitorische Existenz in Erscheinung, ohne gültigen Grund unter seinen Füßen und bar aller philosophischen und weltanschaulichen Immobilien. Was war schon mehr über ihn auszusagen, als daß er gerade noch lebte? Welcher Halt konnte ihm angewiesen werden, wenn nicht das Naheliegende? Ein Gedicht Günter Eichs, „Inventur“ genannt, zieht denn auch die Bilanz von Überbleibseln. In programmatischem Understatement und in demonstrativ herausgekehrter Wortkargheit bekennt sich das zu nichts Festem berufene, zu nichts Höherem bestimmte Subjekt zu seiner geringsten als seiner einzig wirklichen Habe:
Dies ist meine Mütze,
dies ist mein Mantel,
hier mein Rasierzeug
im Beutel aus Leinen.
Konservenbüchse:
Mein Teller, mein Becher,
ich hab in das Weißblech
den Namen geritzt.
Also: keine heilig beschworenen guten Vorsätze, keine Blankowechsel auf die Zukunft, sondern: die gezielte Nüchternheit der Bestandsaufnahme. Und wo der Name des Menschen neu geschrieben wird, dort nicht auf Ruhmestafeln und Ehrenmale, sondern auf die durch nichts als Brauchbarkeit bestimmte Konservenbüchse. Das Ich definiert sich als vorläufig. Seine geringen Hoffnungen klammern sich all Restbestände. Der Radius des von der Welt Besitz Ergreifenden ist auf die Reichweite seines Armes zurückgenommen. Obwohl Günter Eich nicht der einzige Bedichter der situationären Misere war, und obwohl sich auch andere junge Talente an einer Poesie des Unpoetischen versuchten, war er dennoch der einzige, der einen sozialen Status konsequent in Schreibweise überführte. Die meisten Innungsgenossen gelangten über das Umschreiben von Armutsverhältnissen nicht hinaus. Das waren die in Krisenzeiten immer zahlreich aufbrechenden Begabungen, deren Umgang mit der Poesie auch dieses Provisorium nicht überlebte. Sie traten hier oder dort mit ein oder zwei beachtlichen Gedichten hervor, waren einige Zeilen lang auf der Höhe der schlimmen und verschwanden dann für immer aus dem Gebiet der schönen Literatur.
Peter Rühmkorf, aus Werner Richter Hrsg.: Bestandsaufnahme. Eine deutsche Bilanz 1962. Sechsunddreißig Beiträge deutscher Wissenschaftler, Schriftsteller und Publizisten, 1962
„In jeder Freude muß die Traurigkeit der ganzen Welt sein“
– Eichs ästhetische Zäsur Mitte der 60er-Jahre vor dem Hintergrund der NS-Vergangenheit. –
Seit meiner Jugend begleiten mich die Gedichte von Günter Eich. Anfangs war mein Unverständnis groß. Ich wusste noch nicht, dass man Gedichte am besten meditiert. Größer als mein Unverständnis war meine Faszination. Sie ist geblieben. Allem voran die Faszination seines dichterischen Spätwerks. Es ist dann eine bittere Irritation gewesen, von Eichs sehr umfangreichen Arbeiten für die Unterhaltungsformate des NS-Rundfunks zu erfahren. Das wirkliche Ausmaß seiner „Fehlbarkeit“ unter dem Hakenkreuz hatte Axel Vieregg aufgespürt. Und über all dem stand das Eichsche Schweigen. Ein Zeichen der Verdrängung, der eigenen Ent-Schuldigung? Oder Ausdruck einer Scham, womöglich eines belastenden, nicht abtragbaren Schuldgefühls, für das Eich in öffentlicher Sprache keine Worte finden konnte oder wollte? Das lässt sich nicht entscheiden. Doch diese Frage hat mich immer wieder beschäftigt.
Nach Roland Berbig ging Eich der NS-Vergangenheit keinesfalls aus dem Weg.10 Und Jörg Drews resümiert im Nachwort seiner Ausgabe Günter Eich: Sämtliche Gedichte:
Untergründig scheint aber noch etwas anderes in den Gedichten der Nachkriegszeit und dann wieder der sechziger Jahre zu wühlen und Eich unablässig zu beunruhigen, etwas, das zur depressiv anmutenden Wortkargheit der späten Gedichte zumindest beigetragen hat. Es ist der Gedanke an die Opfer der Nazi-Diktatur in den dreißiger und vierziger Jahren, an die, welche umkamen, verschwanden, ermordet wurden, während man selbst noch vergleichsweise glimpflich davonkam.11S. 623f.
Möglicherweise steckt in Eichs Schweigen mehr Scham- und Schuldgefühl gegenüber den Opfern des Nazi-Regimes als vermutet.
Der von Drews angesprochene Blick auf die 60er-Jahre scheint mir aufgrund der zu dieser Zeit von Eich vollzogenen poetisch-poetologischen Zäsur von besonderer Bedeutung zu sein. Mit meinem Beitrag begebe ich mich auf Spurensuche und trage Material zusammen, das einerseits das Eichsche Schweigen aus seiner Zeit heraus beleuchtet und „Stationen“ markiert, die erkennbar machen, wann und wo Eich vor allem in der 50er-Jahren die Begegnung mit der NS-Vergangenheit suchte. Andererseits möchte ich Plausibilitäten für die Annahme aufzeigen, dass die von Eich Mitte der 60er-Jahre vollzogene ästhetische Zäsur durchaus im Kontext der NS-Vergangenheit und ihrer (Nicht-) Aufarbeitung betrachtet werden kann.
*
Anfang der 1930er-Jahre ist Günter Eich ein ästhetisch konservativ orientierter Dichter und unpolitischer Zeitgenosse. Zivilisationskritik verbindet er mit der Suche nach einer zeitentbundenen Natur-Poesie, die Natur als göttliches Palimpsest betrachtet, das es poetisch zu entziffern gilt. Eich besteht auf eine dichterische Eigenweltlich- und Eigenverantwortlichkeit jenseits der historischen Realität, wie er 1930 deutlich macht:
Verantwortung vor der Zeit? Nicht im geringsten. Nur vor mir selbst. (Gesammelte Werke, Band IV, S. 457)
Ende 1932 zeichnet sich für ihn der Beginn einer Karriere als Hörfunkautor ab:
So günstig ist die Auftragslage schon Ende 1932, dass Eich sich am 27. Januar 1933, also drei Tage vor der Machtergreifung, ein Haus in Poberow an der Ostseeküste auf Kredit kauft.12Eggingen 1993, S. 18
Finanzielle Absicherung und Planungssicherheit sind für ihn von nun an dringend geboten. Seine Tätigkeit als Hörfunkautor will er unbedingt fortsetzen, auch im gleichgeschalteten NS-Rundfunk. Über die politischen Implikationen seiner Entscheidung macht er sich keine Gedanken.
Eich ist kein NS-Ideologe, er propagiert keine völkischen Gedanken, wird nicht in die NSDAP aufgenommen13Tag übrigens wie Herbert von Karajan und Martin Heidegger“, jedoch wurde „(d)ie Aufnahme in die Partei… nie vollzogen.“ Vieregg 1993, S. 15. Einen späteren Antrag auf Parteimitgliedschaft stellte Eich nicht. und ist auch nicht auf der von Joseph Goebbels zusammengestellten Liste der „Gottbegnadeten“ Künstler zu finden. Dennoch überantwortet er sich der völkisch aufgestellten NS-Unterhaltungsindustrie. Um eine Festanstellung beim gleichgeschalteten Deutschlandsender zu erhalten, wird er Mitglied im Reichsverband Deutscher Schriftsteller (RDS) und verpflichtet sich gemäß Aufnahmebedingungen des RDS stets „einwandfrei im Sinne des neuen deutschen Staates“ zu handeln. Vor allem seine langjährige Mitarbeit an den beliebten Funk-Reihen Deutscher Kalender. Monatsbilder vom Königswusterhäuser Landboten und Der märkische Kalendermann sagt den neuen Monat an, die das deutsche Landleben idealisieren und die ländliche, deutsche Idylle durchaus im Sinne des „neuen deutschen Staates“ preisen, wird er zu einem Zuarbeiter im Getriebe des nationalsozialistischen Machtmechanismus.14für den NS-Rundfunk durchlebte, hat Vieregg herausgearbeitet. Vgl. dazu Axel Vieregg: Der eigenen Fehlbarkeit begegnet. Günter Eichs Realitäten 1933–1945, Eggingen 1993, S. 49ff.
*
Als Eich im Juni 1945 aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft entlassen wird, kehrt er ins bayrische Geisenhausen zurück und findet dort erneut Unterkunft bei Familie Schmid, die ihn bereits 1944 als Wehrmachtssoldat vorübergehend beherbergt hat. Zu dieser Zeit lernt er in Geisenhausen den Musiker und Konzertmeister Willy Schalter kennen, der für mehrere Wochen ebenfalls bei den Schmids unterkommt.15Göttingen 2013, S. 33ff. Willy Schaller wird Ende Oktober 1944 wegen des Abhörens von Feindsendern von den Nazis zu Gefängnis verurteilt. Er sitzt in verschiedenen Zuchthäusern ein, ehe man ihn auf einen Häftlings-Marsch zum KZ Dachau schickt, wo er später von amerikanischen Soldaten befreit wird. Eich führt mit Schaller Gespräche, unternimmt mit ihm Spaziergänge und kleinere Ausflüge. Leider ist über den Inhalt dieser Gespräche nichts bekannt. Doch dürfte Eichs eigene „Fehlbarkeit“ in den Begegnungen mit Schaller sehr konkret mit den Gräueltaten der Nazis konfrontiert worden sein, ohne dass Eich die schreckliche Dimension der NS-Verbrechen zu diesem Zeitpunkt vollständig einschätzen konnte.
*
Eich verwahrt sich dagegen, als Autor der Inneren Emigration eingeordnet zu werden, schließlich habe er nie aktiven Widerstand gegen die Nazis geleistet. Im Gegensatz zu vielen anderen seiner Schriftstellerkollegen, die ihre Verwobenheit mit dem NS-Regime erst Jahrzehnte später eingestehen oder bis über den Tod hinaus verschweigen, wird er direkt nach Kriegsende mit seiner Tätigkeit für den NS-Rundfunk öffentlich konfrontiert. Seine Aufnahme in den deutschen PEN wird ihm deswegen zunächst verweigert, erst im zweiten Anlauf kommt es zur Mitgliedschaft. Vermutlich aus Sorge um das eigene literarische Überleben redet Eich den Umfang seiner Beiträge im NS-Rundfunk klein. Erst Axel Viereggs 1993 veröffentlichte Recherchen zu Günter Eichs Realitäten 1933–1945 zeigen auf, wie zahlreich, beliebt und wirkungsmächtig seine Hörfunkarbeiten gewesen sind. Eich stellt sich den mit seiner Tätigkeit im NS-Rundfunk verbundenen Fragen nach moralischer Verantwortung und Schuld nicht in der Öffentlichkeit, grundsätzlich bleibt er zeitlebens sehr diskret mit Auskünften zu Biografie und Privatleben.
*
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Umgang der westdeutschen Bevölkerung mit der NS-Erblast belegen, dass die große Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung nicht nur in der unmittelbaren Nachkriegszeit, sondern bis zu Beginn der 60er-Jahre eine Mitverantwortung an den Gräueltaten des Nazis-Regimes leugnet. Von persönlicher Mitschuld ist kaum die Rede, wenn, dann dominiert ein Schamgefühl. Die meisten Deutschen betrachten die deutschen Konzentrationslager in den ersten Nachkriegsjahren eher als „gefängnisähnliche Arbeitslager“ und hatten „keine klare Vorstellung von den dort begangenen Grausamkeiten“.161989“, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 12 (1992), S. 327–3513. S. 327 Mehrheitlich sieht man sich als Opfer des Nationalsozialismus, vertreten durch eine verbrecherische NS-Führungselite. Eine Auseinandersetzung mit dem Schicksal von KZ-Häftlingen, mit aus rassistischen oder politischen Gründen inhaftierten NS-Opfern findet in der Öffentlichkeit nicht statt. Hilfeleistungen für Vertriebene, Kriegsopfer und Flüchtlinge erfahren größere Zustimmung als Entschädigungsleistungen für KZ-Häftlinge. Es entwickelt sich eine „Aufrechnungsmentalität“,171989“, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 12 (1992), S. 332 die eigenen Kriegsopfer mit den Opfern der Shoah auf eine Stufe zu stellen und zu verrechnen:
Das Schweigen – Beschweigen und Verschweigen – wird zu einem Grundkonsens der frühen Bundesrepublik.18S. 581
*
Auch wenn Eich in diesen Grundkonsens des Schweigens einstimmt, besagt das nicht, dass ihn die NS-Zeit unberührt lässt oder er sie ignoriert. Neben den Begegnungen und Gesprächen mit Willy Schaller geben uns seine privaten Notizen einen bemerkenswerten Aufschluss darüber, dass das Schweigen des begeisterten Automobilisten Günter Eich mit dem Er-Fahren von Orten korrespondiert, die als Stätten für Nazi-Verbrechen stehen. Akribisch führt Eich zunächst in seinen „Abrißkalendern“ und dann in seinen „Taschenkalendern“ Buch über Dutzende seiner automobilen Ausflüge und Erkundungstouren in die nähere Umgebung und darüber hinaus, die er teils alleine, teils mit Freunden unternimmt. Es entstehen kleine Ortsnetze über seine Reiseziele und Zwischenstationen.
*
Folgt man Berbigs Darstellungen, unternimmt Eich am 7. August 1947 eine Reise, die ihn unter anderem nach Ellwangen in Baden-Württemberg führt, ein Ort, an dem „drei Außenlager der Konzentrationslager Natzweiler/Elsass und Dachau existierten“. Ein Vermerk, was Eich in Ellwangen unternimmt, sich dort anschaut oder erkundet, fehlt allerdings. Aber, so Berbig, „(e)s waren die Ausnahmen, wenn er in seinem Kalender hinter Augsburg in Klammern die ,Ulrichskirche‘ vermerkt, deren Turmkuppel und Fenster durch Luftangriffe zerstört worden waren“.19Göttingen 2013, S. 104f. Spürt man Eichs Reiseeinträgen in seinen Taschenkalendern weiter nach, so fällt auf, dass er für den 8. April 195120 die Tour Wasserburg-Kraiburg-Ampfing-Mühldorf-Altötting notiert. Was sich zunächst wie Etappen eines frühlingshaften Ausflugs darstellt, liest sich bei näherem Hinsehen als topographische Erkundung nationalsozialistischer Schreckensstätten: Wasserburg (in der Heil- und Pflegeanstalt Gabersee bei Wasserburg wurden von Juni 1940 bis Anfang 1941 Selektionen zur Vorbereitung von Krankenmorden durchgeführt) – Kraiburg (Gedenkstätte: Friedhof mit Überresten von KZ-Häftlingen, die aus einem Massengrab am Kronprinzenstein geborgen wurden) – Ampfing (zweitgrößtes Außenlager des KZ-Außenlagerkomplexes Mühldorf) – Mühldorf (gehörte zu den größten Außenlagern des Stammlagers Dachau) – Altötting (Gedenkstätte: Friedhof, auf dem 1945 ca. 250 Häftlinge beigesetzt wurden, die in der Mettenheimer Außenstelle des KZ Dachau umgekommen sind).
*
Bei der Tagung der Gruppe 47 vom 18. bis 20. Oktober 1951 in Laufenmühle bei Ulm begegnen sich Günter Eich und Ilse Aichinger zum zweiten Mal. Sie vereinbaren, sich per Post ihre jüngsten Werke zu schicken. Aichingers Roman Die größere Hoffnung, von dem Eich weiß, dass er aus eigenwilliger Kinderperspektive die Verfolgung der Juden und die Grausamkeiten der Nazi-Zeit thematisiert, dürfte bis Mitte November bei Eich in Geisenhausen eingetroffen sein. Es ist auffällig, dass Eich am 7. November 1951, also vor Erhalt des Aichinger Romans und zwei Tage nach der Beisetzung seiner von ihm geschiedenen Frau Else in Weißenau, seine Rückreise nach Geisenhausen über Dachau antritt: Es ist die erste Eintragung des Ortsnamen Dachau in seinem Taschenkalender. Knapp anderthalb Jahre später, am 27. März 1953, begibt sich Eich auf eine Reisetour, die ihn erneut nach Dachau bringt. Diesmal setzt er in seinem Kalendereintrag hinter den Ortsnamen Dachau in Klammern das Kürzel „KZ“. Rund drei Wochen später, am 16. April 1953, finden wir einen weiteren Dachau-Eintrag und am 24. August 1953 führt ihn – in Begleitung von Aichinger – eine Tour nach Flossenbürg, diesmal mit dem Vermerk hinter dem Ortsnamen: „KZ mit Ruine“.21Vgl. dazu auch Berbig 2013, S. 334f.
*
Mit der verfassungsmäßigen Gründung der Bundesrepublik 1949 kommt es zur Einstellung der von den Alliierten betriebenen Entnazifizierung. Amnestiegesetze werden erlassen, ein Großteil der von deutschen Gerichten bestraften NS-Täter wird begnadigt. Fast alle Beamten, die von den Alliierten aus politischen Gründen ihres Dienstes enthoben wurden, erhalten ab 1951 das Recht auf Wiedereinstellung und dürfen zu ihren ehemaligen Dienststellen zurückkehren: Lehrer, Polizisten, Juristen. NS-Funktionseliten vollziehen ihre berufliche und gesellschaftliche Integration, werden rehabilitiert.22der Nachkriegszeit, S. 19–54 und Ulrich Herbert: NS-Eliten in der Bundesrepublik, S. 79–82. In: Wilfried Loth / Bernd-A. Rusinek (Hg.): Verwandlungspolitik. NS-Eliten in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft, Frankfurt a.M., New York 1998 Allein in der Karlsruher Behörde der Bundesanwaltschaft haben zwischen 1953–1959 rund 75% der Mitarbeiter im höheren Dienst vormals das NSDAP-Parteibuch besessen.23 Normalität ist das Zauberwort. In Fragen NS-Erblast, Shoah und Völkermord dominiert ein geradezu amtliches Schweigen, das bis in die Geschichtsbücher an deutschen Schulen reicht. Das wahre Ausmaß und die Singularität des nationalsozialistischen Völkermords sind noch nicht ins öffentliche Bewusstsein gedrungen.24unveröffentlichten Versuch eines Requiems lässt er die Einzelstimme fragen: „wer gedenkt noch derer, / die unter den Trümmern starben in Dresden? / Wer gedenkt der Vergasten in Auschwitz? / Und die unter der Erde Rußlands – / vergessen, vergessen.“ Dresden, Auschwitz und Stalingrad bilden hier eine Assoziationslinie.
*
Es entspricht einem zeittypischen Verhaltensmuster, wenn Eich seine NS-Mitläuferschaft in der Öffentlichkeit nicht thematisiert und das Angesprochenwerden diesbezüglich vermeidet. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass ihn die NS-Erblast und sein Agieren unter dem NS-Regime nicht beschämt oder erschüttert, dass er sich frei von Schuld fühlt. Vor allem in seinen Hörspielen der 50er-Jahre (von denen er sich 1971 distanziert), die teils biografische Analogien aufweisen, werden vor diesem Hintergrund Fragen nach Schuld und mögliche Antworten darauf thematisiert.25 Ob Eich dabei eigene Entschuldigungsversuche literarisch modelliert hat, um sich biografisch (zumindest temporär) zu entlasten, gilt es an dieser Stelle nicht zu beurteilen.26Mitverantwortung oder Mitschuld an den NS-Verbrechen eingesteht, geht Jürgen Joachimsthaler mit Eich hart ins Gericht. Für ihn „korrespondiert“ vor allem in Eichs Hörspielen nach 1945 „die zunehmend betonte ,Falschheit‘ der Welt mit einer unaufhebbaren Determination aller Handlungen…, die dem Einzelnen die Chance gar nicht mehr lässt, anders zu handeln als seine soziale Rolle für ihn vorsieht“ (S. 109). So sei „Schuld“ nach Eichschen Vorgaben „das gemeinsame Schicksal aller Menschen, die sich nur als Opfer ihrer eigenen, ihnen von ihrer jeweiligen Umwelt aufgezwungenen entfremdeten Handlungen in gemeinsamem Schmerz eins fühlen können. Verantwortlichkeit gibt es nicht.“ Unter diesen deterministischen Annahmen werde der Mensch grundsätzlich „schuldlos schuldig“ (ebenda) Folglich sei „,Schuld‘… bei Eich, sofern es sie überhaupt gibt, immer eine ,innere‘ des Individuums sich selbst (und seinen Möglichkeiten) gegenüber, kaum je Verantwortung gegenüber den Opfern des Systems, zu denen Eichs Subjekte sich im Gegenteil selbst hinzuzählen“. (S. 113). Damit entlaste Eich sich selbst von der Schuldfrage. Jürgen Joachimsthaler: „Die Pest der Bezeichnung“. In: Carsten Dutt / Dirk von Petersdorff (Hg): Günter Eichs Metamorphosen, Heidelberg 2007, S. 97–119 Auch wenn er sich in der Bewertung seiner NS-Mitläuferschaft nicht vor der Zeit, sondern nur vor sich selbst verantwortlich gesehen haben sollte (analog zu seiner Äußerung von 1930, er fühle sich als Lyriker nicht vor der Zeit, sondern nur vor sich selbst verantwortlich), muss diese Selbst-Verantwortlichkeit keineswegs zur Selbst-Entlastung oder zur Abkehr eines schmerzlichen Gedenkens an die NS-Opfer geführt haben.
*
Das öffentliche Schweigen über die NS-Zeit hat polyphonen Charakter, denn in das Schweigen von Tätern und Mitläufern mischt sich das Schweigen der Opfer, die sich häufig aus Scham vor der durch das NS-Regime erlittenen Gewalt und Erniedrigung ein Schweigegebot auferlegen.272022) in einem FAZ-Interview, dass sein Vater kurz nach seiner Entlassung aus dem KZ Sachsenhausen 1940 an den Folgen der dort erlittenen Folter verstarb. Ab 1943 musste sich Degen mit seiner Mutter bei Freunden und Bekannten verstecken, um dem Zugriff der Gestapo zu entgehen. Nach dem Krieg erklärte ihm seine Mutter: „Jetzt sind wir neu geboren, was bisher war, wollen wir vergessen.“ Degen hielt sich an ihren Appell der Verdrängung und ihr Schweigegebot. Erst 1969, als er in George Taboris Theaterstück Die Kannibalen, das in einer Auschwitz-Baracke spielt, auf der Bühne stand, brachen die Schrecknisse der Nazi-Zeit in ihm auf. Bis dahin hatte er die „Erlebnisse als jüdischer Junge in der Nazizeit sehr gut verdrängen können.‘ (FAZ, 29.1.2022) Dieses Schweigen setzt sich auch im Privaten fort und wird selbst unter Freunden kaum aufgehoben. In der umfänglichen Korrespondenz zwischen Günter Eich und seinem Dichterfreund Rainer Brambach, der 1939 als „arbeitsscheuer“ deutscher Staatsbürger aus der Schweiz ausgewiesen und wenig später zum Reichsarbeitsdienst eingezogen wird, dort desertiert, bis man ihn festnimmt und in ein Internierungslager steckt, wird die NS-Zeit ausgespart. In der nicht minder umfangreichen Korrespondenz zwischen Ingeborg Bachmann, Ilse Aichinger und Günter Eich findet ebenfalls kein Austausch über die NS-Zeit statt. Dabei tritt Bachmanns Vater bereits 1932 in die NSDAP ein, verschleppen die Nazis Ilse Aichingers geliebte, jüdische Großmutter und die jüngeren Geschwister ihrer Mutter und ermorden sie 1942 im Vernichtungslager Maly Trostinez bei Minsk.28– eine für Aichinger traumatische Erfahrung. Eich bleibt, was seine Biografie angeht, auch gegenüber seiner Familie verschwiegen:
Aber er erzählte wenig. Auch was er seinen Kindern berichtete – von seiner frühen Zeit, von seinen Reisen, sollte sie nicht unsicher machen.29a.M. 2021. S. 206
Zu Beginn der 60er-Jahre erfährt die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen in der Bundesrepublik eine neue Dimension. Dazu trägt der Eichmann-Prozess 1961 in Israel bei, vor allem aber der Frankfurter Auschwitzprozess von 1963–1965, der die weitgehend etablierte Entlastung zahlreicher deutscher Kriegsverbrecher aufhebt. Dieser Prozess erschüttert die deutsche Öffentlichkeit und verändert das Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland. Es zeigt sich, was vorher nur die Wenigsten für möglich gehalten haben oder wahrhaben wollten, was unvorstellbar schien und von dessen Ungeheuerlichkeit sich selbst das Gericht des Frankfurter Auschwitzprozesses 1964 durch persönliche „Inaugenscheinnahme“ des Vernichtungslagers Auschwitz ein Bild machen muss: Nazi-Deutschland hat mit aller Rationalität und Brutalität einen perfekt organisierten, industriellen Völkermord betrieben, einen Genozid und Zivilisationsbruch.
*
Im Jahr 1965 formuliert Eich erstmals eine Position der Negation, der eine ästhetische Zäsur zugrunde liegt:
(H)eute enthält meine Lyrik viel groteske Züge, das liegt wohl an meinem Hang zum Realen. … Alles addiert, ergibt, so meine ich, die Welt eine negative Zahl. (Gesammelte Werke, Band IV, S. 503)
Zwei Jahre später konturiert er diese Position und seine „Absicht des Anarchischen“ noch schärfer:
… mit allem, was ich schreibe, wende ich mich im Grunde gegen das Einverständnis mit der Welt, nicht nur mit dem Gesellschaftlichen, sondern auch mit den Dingen der Schöpfung, die ich also ablehne. (Gesammelte Werke, Band IV, S. 510)
Die Schöpfung abzulehnen bedeutet für Eich eine poetisch-poetologische Radikalisierung und Neuausrichtung sowie eine Distanz zu seinem bisherigen poetischen Schaffen. Es ist eine ästhetische Zäsur, die ein poetisches Weiterschreiben unter den bisherigen Maximen nicht mehr erlaubt. Die Aufkündigung seines Einverständnisses mit der Schöpfung bringt auf den Begriff, was er ästhetisch in seinen Gedichtbänden 1964 und 1966 bereits umgesetzt hat.
*
Mit dem Erscheinen seines Gedichtbandes Botschaften des Regens 1955 begreift Eich sich noch als „ein Naturdichter, der die Schöpfung akzeptiert hat“ (Gesammelte Werke, Band IV, S. 534). In seiner Rede vor den Kriegsblinden (1953) weist er daraufhin, „(d)aß es darauf ankommt, daß alles Geschriebene sich der Theologie nähert“ (Gesammelte Werke, Band IV, S. 611) und „(j)edes Wort einen Abglanz des magischen Zustandes (bewahrt), wo es mit dem gemeinten Gegenstand eins ist, wo es mit der Schöpfung identisch ist“. Aus dieser „niegehörten und unhörbaren“ Sprache zu übersetzen, sei „das eigentlich Entscheidende des Schreibens“ (Gesammelte Werke, Band IV, S. 612). Von diesem Anspruch ist seinen Gedichtbänden Zu den Akten (1964) und Anlässe und Steingärten (1966) nichts mehr zu finden. Wer sein Einverständnis mit der Schöpfung aufkündigt, kündigt sein Einverständnis mit der Natur auf, und dazu gehört auch die Menschennatur. Eichs Gedichte werden lakonischer, rätselhafter, disparater, grotesker und verspielter, kündigen Musikalität, Sinnzusammenhänge und Verbindungslinien auf, suspendieren Kohärenzen. Teils wirken sie wie disparate Abstraktionen, teils wie Kurzformeln seiner späteren Maulwürfe. Es sind Gedichte, die von einer leeren Gegenwart zeugen, so heißt es damals in der Literaturkritik, ohne Zukunftsvision oder erkennbarer Hoffnung. Es findet eine „metaphysische Desillusionierung“30H.J. Heise: Das Profil unter der Maske. Essays, Düsseldorf 1974, S. 167 statt. Eich kann sein Schreiben nicht mehr „als einen fortwährenden Annäherungsversuch an den Seinsgrund“31 betrachten, Natur ist für ihn nicht mehr als göttliches Palimpsest zu lesen.32und der Aufkündigung seines Einverständnisses mit der Schöpfung, die Aspekte der Theodizee anklingen lässt, auch eine Anmerkung von Drews: „Nachdem Eich die Opfer von Unterdrückung und Weltkrieg, aus der konventionellen Denkfigur heraus, daß niemand aus Gottes Hand falle, der Fiktion eines göttlichen Willens unterstellt hatte, erschien ihm dieser Beschwichtigungsversuch nach und nach als ungenügend und wohl auch als beschämend.“ Jörg Drews in Günter Eich: Sämtliche Gedichte. Nachwort, Frankfurt a.M. 2006, S. 624 Vieles deutet auf eine existentielle Krise hin, die Eichs literarisches Schaffen radikal auf den Prüfstand stellt.
*
Halten wir fest, dass Eich sich Mitte der 60er-Jahre in einer Krisensituation befindet, die sein poetisch-poetologisches Selbstverständnis verändert und ihn zu einer ästhetischen Zäsur veranlasst. Seine Krisensituation geht einher mit der öffentlichen Erschütterung durch den Frankfurter Auschwitzprozess und eine damit einsetzende Veränderung des Selbstverständnisses der Bundesrepublik Deutschland. Eine Parallelität, die auffällt und für Eichs dichterisches Schreiben vielleicht von größerer Bedeutung ist als bisher angenommen. Auch Eich wird erst zu Beginn der 60er-Jahre das ganze Ausmaß des nationalsozialistischen Völkermords und Zivilisationsbruchs bewusst geworden sein. Er wird mit den Verbrechen des Nazi-Regimes und seiner Rolle beim NS-Rundfunk erneut konfrontiert, und das über einen langen Zeitraum, denn der Frankfurter Auschwitzprozess streckt sich über zwanzig Monate. Sein Schmerz über die Shoah dürfte einhergehen mit Fragen nach Mitverantwortung und Schuld durch die eigene „Fehlbarkeit“ – gleichgültig, ob er Antworten auf diese Fragen für sich gefunden haben mag. Das alles lässt sich nicht durch Briefe, Interviews oder Selbstaussagen dokumentieren. Aber einen Menschen, der in den frühen 50er-Jahren mehrfach deutsche Konzentrationslager bzw. ihre Außenlager aufsucht, um sich von den (noch nicht musealisierten) Stätten des Grauens und der Vernichtung ein Bild zu machen, wird diese neue Dimension der durch den Frankfurter Auschwitzprozess ermittelten NS-Verbrechen nicht unberührt lassen. Auch jetzt bleibt die NS-Zeit für Eich weiterhin „Tabu- und Schweigezone“ (Vieregg). Aber, so denke ich, sein Schweigen ist schmerzbesetzter als zuvor. Er durchbricht es nach außen in Form eines poetologischen Kurswechsels und einer literarischen Neuausrichtung: Sein schweigender Schmerz reflektiert sich in einem ästhetischen Echo.
*
Eich vollzieht im Kontext des Auschwitzprozesses nicht nur eine ästhetische Zäsur – „der Gedanke an die Opfer der Nazi-Diktatur“ (Drews) begleitet ihn auch beim Verfassen seiner Gedichte. Werfen wir einen Blick auf Eichs Gedichtband Zu den Akten (1964) , stellen wir zunächst fest: Ein Viertel der Gedichte ist 1962 entstanden, rund die Hälfte zwischen 1963 und 1964. Einen direkten Bezug zur Nazi-Zeit und zur Shoah finden wir in diesem Gedichtband nur in „Wildwechsel“, einem bereits 1961 geschriebenen, Nelly Sachs gewidmeten Gedicht, in dem Eich seine NS-Mitläuferschaft zum Thema macht. Allerdings sind für den Zeitraum von 1964 bis 1972 rund 40 unveröffentlichte Gedichte von ihm erhalten. Zwei dieser unveröffentlichten Gedichte rekurrieren ebenfalls auf die Shoah und datieren aus dem Jahr 1964. In seinem lakonischen Gedicht „Theaterkritik“ finden wir eine sarkastische Anspielung auf das historische Versagen Papst Pius XII. bei der Deportation römischer Juden aus Rom und eine Anspielung auf Rolf Hochhuths Drama Der Stellvertreter.33internationaler Ebene für heftige Kontroversen, eben indem es die Mitschuld des Vatikan an den Deportationen römischer Juden aufzeigt. In seinem ebenfalls 1964 verfassten Gedicht „Alle Augenblicke“ synchronisiert Eich die Banalität und Naivität seines (Über)Lebens in der Nazi-Zeit „mit den zeitgleichen Augenblicken H.G. Adlers in den Konzentrationslagern Theresienstadt, Auschwitz und Buchenwald“.34 Darüber hinaus datiert aus dem Jahr 1964 seine Weiterschreibung des Zyklus’ „Alte Postkarten“, der aber erst 1966 in seinem Gedichtband Anlässe und Steingärten veröffentlicht wird. In „Alte Postkarten“ (11) greift er die Deportation und Ermordung der Großmutter Ilse Aichingers durch die Nazis auf und den damit verbundenen, nie überwundenen Schmerz:
Es geht,
es geht.
Aber wenn der Krieg vorbei ist,
fahren wir nach Minsk
und holen die Großmutter ab.
*
Am 31. Oktober 1971 schreibt Eich mit „Und“ eines seiner letzten Gedichte. Ein programmatisches Gedicht, das noch einmal die Aufkündigung seines Einverständnisses mit der Welt und einer sinnstiftenden Justierung von Erfahrung aufzeigt. Völlig unvermittelt kommt dieses zu seinen Lebzeiten unveröffentlichte Gedicht auf Rajissas süßes Gelächter zu sprechen, nachdem es vorher durch die zweimalige, jeweils einversige Wiederholung der Kopula und einen Redestau anzeigt und wie in einer Warteschleife zu einer Welt-Verbindung sein Weitersprechen zu gefährden scheint. Es ist „Rajissas süßes Gelächter“, das das sich anbahnende Schweigen beendet und zum poetischen Weitersprechen verleitet.
Eich spricht hier mit einem rätselhaften Namen zu seiner Leserschaft, der einen doppelten familiären und damit biografischen Bezug aufweist. Rajissa: So nennt Ayten, das türkische Kindermädchen im Hause von Aichinger und Eich, ihre 1970 geborene Tochter. Bis zu Eichs Tod gehören Ayten und Rajissa zum Haushalt von Aichinger und Eich und ihrer gemeinsamen Tochter Mirjam. Bemerkenswert ist, dass Aichinger ihrem Kindermädchen Ayten den Wunsch anträgt, sie möge ihrer Tochter den ungewöhnlichen, russischen Namen Rajissa geben. Das bestätigt eine Korrespondenz mit Mirjam Eich, in der sie auf die besondere Beziehung ihrer Mutter zu Vornamen und Namen hinweist und anmerkt, dass ihre Mutter sich gerne auf Friedhöfen aufhielt und sich Geschichten zu den Namen der Verstorbenen ausdachte.35auf meine Frage, ob im Aichinger/Eich-Haushalt ein Haushaltsmädchen namens Rajissa gearbeitet habe: „Im Gedicht ,Dreizehn Jahre‘ meiner Mutter aus den 50er-Jahren taucht der Name meiner Meinung nach zum ersten Mal auf. Aus den Zeilen im Gedicht schließe ich, dass sie den Namen auf einem Grabstein las und er ihr auffiel. Sie hatte eine besondere Beziehung zu Namen/Vornamen. Als Ayten, unser türkisches Kindermädchen 1970 eine Tochter bekam, die ihre ersten zwei Jahre bei uns verbrachte, schlug meine Mutter den Namen Rajissa vor. Ich glaube nicht, dass sie jemanden mit diesem Namen kannte. (Rajissa bekam aber auch noch einen türkischen Vornamen).“ Über Ilse Aichingers Vorliebe für Friedhöfe schrieb Mirjam Eich am 1. Februar 2022: „Ja, meine Mutter ging gerne auf Friedhöfe, nicht nur jüdische. Sie studierte die Namen der Gestorbenen und überlegte sich die Familiengeschichten dazu.“
Der Name Rajissa taucht nur einmal in Ilse Aichingers Gedichten auf, in ihrem Gedicht „Dreizehn Jahre“, geschrieben im Jahr 1955. Auf dem Zentralfriedhof Wien (Neuer jüdischer Friedhof) existiert ein Grabstein des Ehepaares Josef und Rajissa Meriminsky. Rajissa Meriminsky verstarb 1951, ihr Ehemann 1939. In ihrem Gedicht „Dreizehn Jahre“ nimmt Ilse Aichinger unter anderem auf das jüdische Laubhüttenfest sowie auf die Heimatlosigkeit und Verfolgung des jüdischen Volkes Bezug. Aichinger verfasst dieses Gedicht genau dreizehn Jahre nachdem ihre Großmutter 1942 von den Nazis verschleppt und in der Nähe des belarussischen Minsk ermordet wurde.
„Rajissas süßes Gelächter“ zeugt in seiner Doppelbildlichkeit von Anrührung und Schmerz, Leben und Gedenken vor dem Hintergrund der Shoah. Diese Sequenz liest sich wie die ästhetische Umsetzung einer Äußerung von Günter Eich, die Ilse Aichinger 1954 in einem Brief an ihren Vater zitiert:
Günter sagte mir einmal etwas sehr Schönes…: „In jeder Freude muß die Traurigkeit der ganzen Welt sein, sonst ist sie nicht echt.“36
Jürgen Nendza, aus Michael Braun (Hrsg.): „Was ich weiß, geht mich nichts an“. Zu Günter Eich, poetenladen, 2022
Fakten und Vermutungen zum Autor + Kalliope
Dichterlesung am 1.1.1959 im Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. Moderation: Siegfried Unseld. Günter Eich liest die Gedichte „Herrenchiemsee“, „Himbeerranken“, „D-Zug München-Frankfurt“ und „Wo ich wohne“ sowie zwei Szenen aus seinem Hörspiel Unter Wasser.
Samuel Moser: Welt der Literatur – Mir klingt das Ohr – doch wer kann mich meinen? Ein Porträt des Dichters Günter Eich.
Ein geheimer Sender, der weiterschabt in unserem Ohr – Ein Gespräch von Michael Braun mit dem Lyriker Jürgen Nendza. Über Günter Eich, die Vokabel „und“ und über Gedichte zwischen „Haut und Serpentine“
Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstler Günter Eich
Kurt Drawert: Er hatte seine Hoffnung auf Deserteure gesetzt
Am Rande der Welt – Roland Berbig im Gespräch mit Michael Braun über den Briefwechsel von Günter Eich mit Rainer Brambach
Zum 60. Geburtstag von Günther Eich:
Jürgen P. Wallmann: Zum 60. Geburtstag von Günter Eich
Die Tat, 26.1.1967
Max Frisch, Wolfgang Hildesheimer und Erich Fried: Drei Begegnungen mit Günter Eich
Merkur, Heft 231, Juni 1967
Peter Hamm: Bescheidenes und dauerhaftes Entsetzen
Süddeutsche Zeitung, 1.2.1967
Zum 65. Geburtstag von Günter Eich:
Jürgen P. Wallmann: Auf der Suche nach dem Urtext
Die Tat, 28.1.1972
Zum 70. Geburtstag von Günter Eich:
Johannes Poethen: Wirklichkeiten hinter der Wirklichkeit
Die Tat, 28.1.1977
Zum 80. Geburtstag von Günter Eich:
Eva-Maria Lenz: Erhellende Träume
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.1.1987
Rudolf Käser: … das Zeitliche habe er nicht gesegnet
Neue Zürcher Zeitung, 29.1.1987
Zum 20. Todestag von Günter Eich:
Peter M Graf.: Singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet
Der kleine Bund, Bern, 19.12.1992
Götz-Dietrich Schmedes / Hans-Jürgen Krug: Das Wort in ständigem Wechsel mit dem Schweigen
Frankfurter Rundschau, 19.12.1992
Zum 100. Geburtstag von Günter Eich:
Christoph Janacs: Sand sein, nicht Öl im Getriebe
Die Presse, 27.1.2007
Roland Berbig: Maulwurf im Steingarten
Der Tagesspiegel, 1.2.2007
Helmut Böttiger: Stil ist ein Explosivstoff
Süddeutsche Zeitung, 1.2.2007
Michael Braun: Narr auf verlorenem Posten
Basler Zeitung, 1.2.2007
Ole Frahm: Der Konsequente
Frankfurter Rundschau, 1.2.2007
Martin Halter: Seid Sand im Getriebe!
Tages-Anzeiger, 1.2.2007
Samuel Moser: Spuren eines Maulwurfs
Neue Zürcher Zeitung, 1.2.2007
Iris Radisch: Man sollte gleich später leben
Die Zeit, 1.2.2007
Sabine Rohlf: Dichtkunst mit Maulwürfen.
Berliner Zeitung, 1 2.2007
Hans-Dieter Schütt: Der linke Augenblick
Neues Deutschland, 1.2.2007
Wulf Segebrecht: Schweigt still von den Jägern
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.2.2007
Jürgen P. Wallmann: Gedichte und Maulwürfe
Am Erker, 2007, Heft 53
Jörg Drews: Wenn die Welt zerbricht
Die Furche, 1.2.2007
Zum 50. Todestag von Günter Eich:
Fakten und Vermutungen zu Günter Eich + Debatte + KLG + IMDb +
UeLEX + Archiv 1 & 2 + Internet Archive + Kalliope + YouTube
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Günter Eich – Ein Film von Michael Wolgensinger aus dem Jahr 1972.
„Deshalb ist er immer auf den Berg gegangen“. Mirjam Eich spricht hier mit Michael Braun und Jürgen Nendza u.a. über diesen Film.



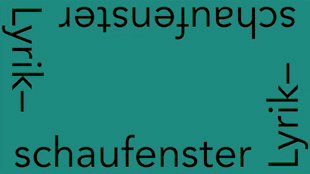
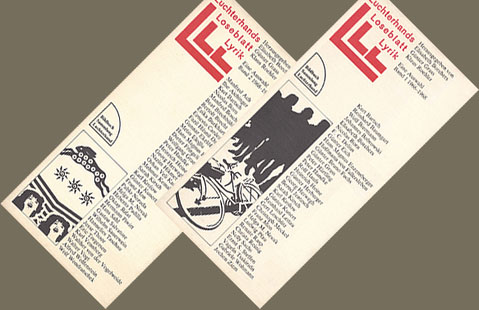


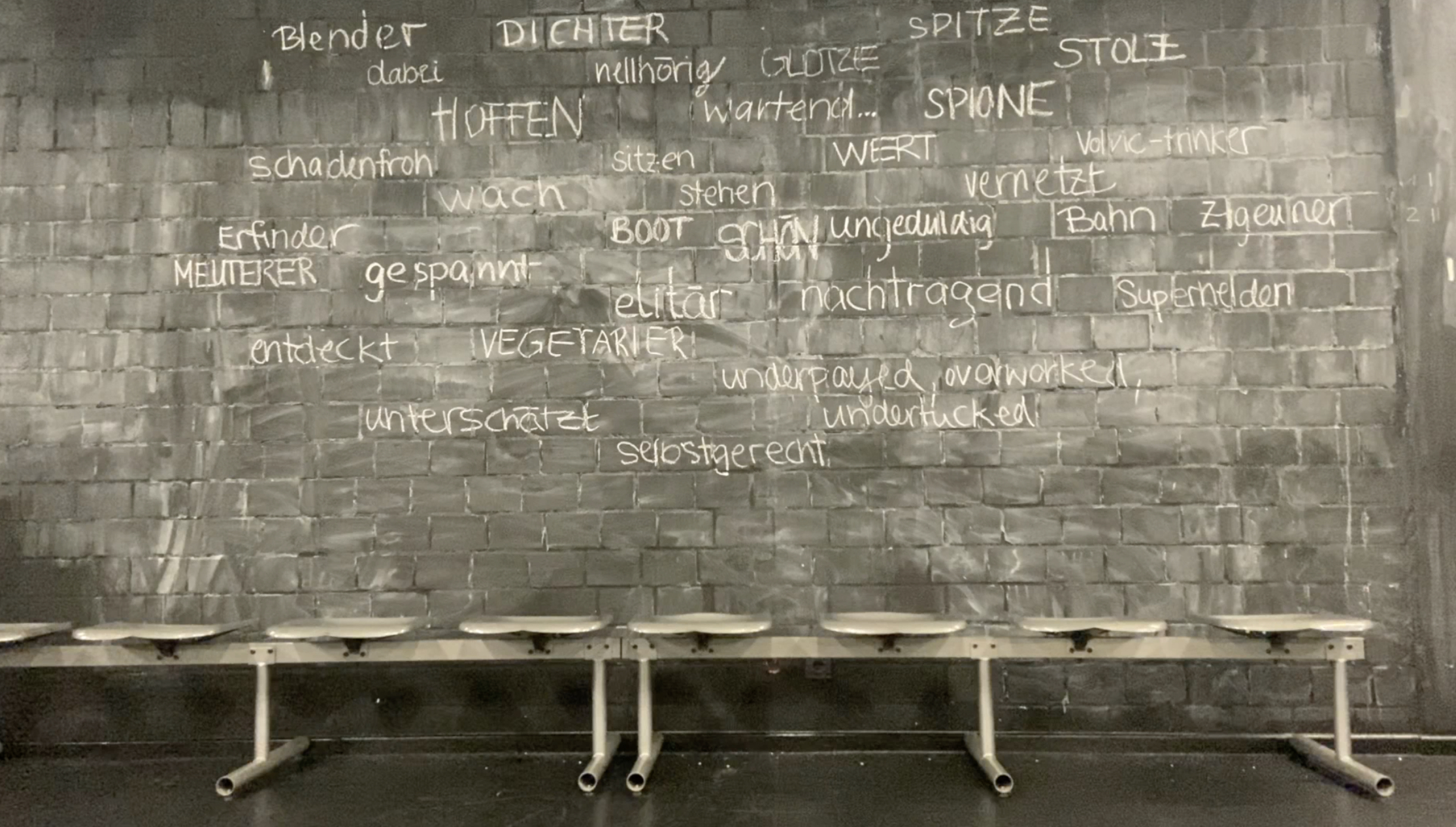
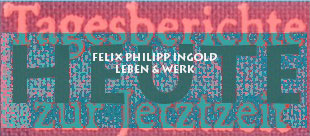
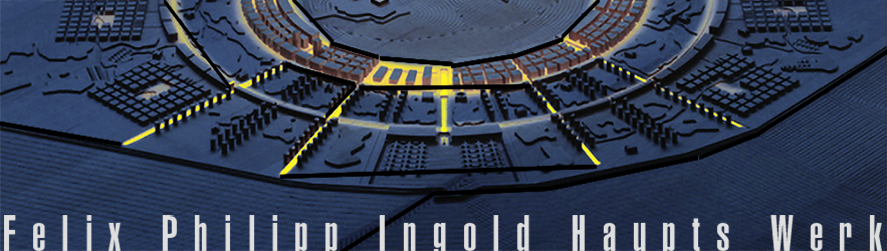
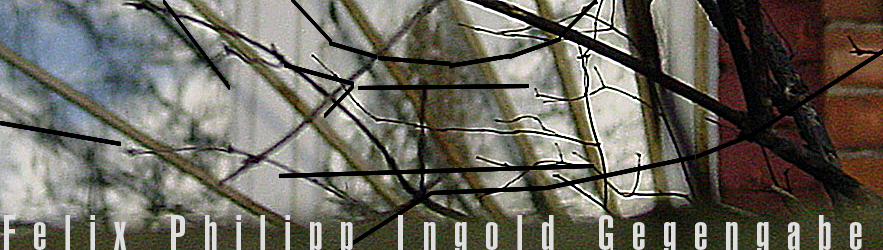
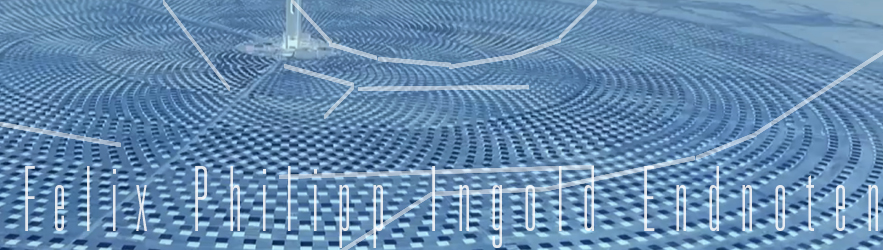

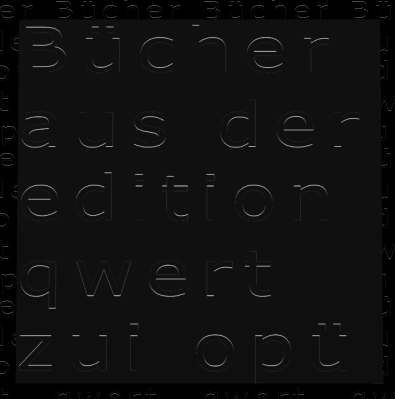
Schreibe einen Kommentar