Jan Skácel: Fährgeld für Charon
EMPFINDSAM UND NOCH EMPFINDSAMER
Für den alten aberglauben und für so kluge ohren,
fürs radar der sommernächte unter den linden,
für die häßlichkeit des eigenen antlitzes
schlugen einst die menschen die fledermaus ans tor.
Mit dem stift durchdrangen sie die dünne haut der
aaaaaflügel,
die kleine leiche hing zerknittert in der stille,
und das schamvolle entsetzen, seidenglatt,
rauschte lange auf den kleinen fallschirmen der glocken.
Warum trag ich dieses marterbild in mir,
und warum prüfe ich, bevor in einem neuen haus ich
um nachtlager bitte, aufmerksam und lange
die pfosten an der haustür,
im holz nach nagellöchern suchend?
Ich bin nur ein dichter, ein radar unter den linden.
Nicht an mir ist’s zu antworten. Ich frage.
Nachbemerkung
Als „Fährgeld für Charon“, die erste auswahl von gedichten Jan Skácels in deutscher sprache, 1967 im Merlin Verlag erschienen war, schrieb Helmuth de Haas in der „Welt der Literatur“: „Diese Lyrik … läßt sich, preisgegeben an die Epoche, anschlagen wie die Fledermaus ans Tor: ‚Ich bin nur ein dichter, ein radar unter den linden‘ … Skácel ist ein hellsichtiger, bildkräftiger Poet … Er hat die äußerste Verkürzung von abstrakter und konkreter Wirklichkeit erreicht und blickt zufrieden wie ein Kormoran; mehr nicht, mehr gibt es nicht. Mehr muß denn auch nicht sein.“
Von Jan Skácel, geboren 1922 in Znorovy (Südmähren), waren bis dahin die bücher erschienen: „Kolik prilezitostí má ruze“ (Gelegenheiten hat die rose viele), Prag 1957, „Co zbylo z andela“ (Was vom engel übrigblieb), Prag 1960, „Hodina mezi psem a vlkem“ (Die stunde zwischen hund und wolf), Prag 1962, „Jedenáctý bílý kun“ (Das elfte weiße pferd), Brünn 1964, und „Smuténka“ (Die kleine trauer), Prag 1965, und der dichter, mehrfach preisgekrönt, war chefredakteur der literaturzeitschrift „Host do domu“ (Der gast ins haus). Vor dem einmarsch von truppen des Warschauer paktes in die Tschechoslowakei 1968 gelangte noch der gedichtband „Metlicky“ (Kleine ruten) in druck, und danach konnte Jan Skácel über ein jahrzehnt in seiner heimat nicht mehr publizieren. In Italien erschien 1981 der gedichtband „Il diletto delle pesche“, in Frankfurt am Main 1982 eine weitere auswahl in deutscher sprache: „Wundklee“ und 1989 in Hauzenberg die kleine prosasammlung „Das blaueste feuilleton“. Die Bayerische Akademie der schönen Künste ernannte Skácel zum korrespondierenden mitglied.
Inzwischen sind in tschechischer sprache die gedichtbände gefolgt: „Dávné proso“ (Hirse hirse langeher), Brünn 1981, „Uspávanky“ (Schlaflieder), Prag 1983, „Nadeje s bukovými krídly“ (Hoffnung mit buchenflügeln), Prag 1983, „Odlévání do straceného vosku“ (Ausgießen verlorenen wachses), Brünn 1984, „Kam odesly lane“ (Wohin die hirschkühe gingen), Prag 1985, und „Kdo pije potme víno“ (Wer den wein im dunkeln trinkt), Brünn 1988.
1989 erhielt Jan Skácel den Petrarca-Preis, den jugoslawischen Verenica-Preis und den Preis des tschechischen Kinderbuchverlages Albatros.
In seiner laudatio auf den Petrarca-preisträger sagte Peter Handke: „Wie nur die Liebe, welche die Gedichte Jan Skácels auf mich Leser übertragen – vollkommen schweigsame und im Schweigen ganz ihre Genüge findende Augenblicke der Zuneigung über die Gedichte hinaus zu den Dingen der Welt – hinüberbringen ins Reden … ? Sachlich – nicht bleiben (denn sachlich bin ich nicht von vornherein), sondern werden; sich an die Sachen, die Wörtlichkeiten der einzelnen Gedichte, halten; und dann sachlich sagen – es zumindest versuchen, auch wenn dabei zugleich schon wieder eine Empfindung dazwischen spielt: die Empfindung beim Lesen von Jan Skácels Gedichten wie die von wärmendem Sommergras unter den bloßen Sohlen. So beruhigend, begütigend, erdend wirken die Gedichte – mag in diesem Sommergras auch so manche Stechbiene sein; denn, nach Skácel:
der dichter setzt
zur wehr sich wie die biene
und schenkt das eigene sterben
dem den er verletzt…
Am 7. November 1989 legte sich Jan Skácel nach einem spaziergang erschöpft nieder und erwachte nicht mehr.
Reiner Kunze, Nachwort, 1990
Reiner Kunze liest ein Gedicht über Jan Skácel.
Milan Kundera über Jan Skácel gelesen von Reiner Kunze.
Reiner Kunze spricht über die Gedichte Jan Skácels.
Reiner Kunze erzählt über Jan Skácel und den Spitzel.
Hanfwege des Herbstes
Der Eingang zur Weltliteratur wird von einem Türhüter bewacht, der Order hat, nur einzulassen, was sich durch hohen literarischen Rang ausweist. Man sagt ihm Unbestechlichkeit nach, und daran ist zumindest so viel richtig, daß er alle Empfehlungsschreiben der Literaturkritik zunächst für einige Jahre beiseite legt. Er hat ein anderes Zeitmaß als das Feuilleton, und das ist gut so. Schlechter ist, daß er nur die sogenannten Weltsprachen spricht. Er versteht noch kaum Russisch, geschweige Tschechisch. Kafka, erfahren im Umgang mit Türhütern, wußte das und schrieb deutsch. Seine tschechisch schreibenden Kollegen können sich dagegen der Welt nur durch Dolmetscher empfehlen.
Dramatiker leiden darunter nicht allzu sehr, Romanciers erdrücken die Unzulänglichkeiten ihres Übersetzers durch epische Masse; nur der Lyriker ist völlig dem ausgeliefert, der ihn überträgt. Das macht die Lage der tschechischen Literatur so prekär: verdankt sie doch ihr Bestes gerade den Dichtern. Einer, dem ansonsten übel mitgespielt wurde, hatte wenigstens darin Glück: der unlängst verstorbene Jan Skácel. Jene Auswahl aus seinen vier ersten Gedichtbänden, die von 1957 bis 1965 erschienen, bahnte Skácel in der Übersetzung von Reiner Kunze den Weg in die Welt; sie ist jetzt, nach mehr als zwanzig Jahren, wieder aufgelegt. „Fährgeld für Charon“, mit sicherem Griff nach dem wohl besten Gedicht benannt, verrät ausdrücklich, wo dieser Weg seinen Anfang nahm: in dem südmährischen Dorf Znorovy.
Skácel gelingt es, von der Heimat zu dichten, ohne ein Heimatdichter zu sein. Das Atmen der Ställe „mit warmer, verschwitzter brust“, das „getreide, das die liebe schändlich niederwälzte“, der „mit dem nackten und nassen nach oben“ aufgehängte Hasenbalg sind so universal wie das leise Fluchen des Flusses, „wenn er so über die steine / nachts, im dunkeln, stolpert“. Und ebendieses fluchen, das man überall, wo es Wasser gibt, hören kann, dient Skácel als Metapher für Poesie überhaupt. Skácels Dichtung wächst aus ländlicher Verwurzelung ins Allgemeine; nicht nur in ihrer Thematik, auch in der Diktion. Vor allem in den frühen Gedichten klingt, wenngleich wohldosiert, allerlei Märchenhaftes, Liedartiges, Spruchweises an. Diese Neigung weicht dann dem Drang zu immer bündigerem Ausdruck bei zunehmender Verschleierung des Sinns. Was aber bleibt und stets auf jene ursprüngliche Wurzel zurückweist, ist die rauhe Greifbarkeit der Bilder, in die das Rätsel gefaßt wird. Selbst das kürzeste Gedicht, der Dreizeiler „Poesie“, umkreist ein überaus bestimmtes, dem Jäger vertrautes Phänomen:
Für so viel schande hab ich keine tränen.
Das hassen auf den uhu ist das wort.
So schlechte wahrheit und so schöne rede.
Die Geste, mit der hier dem Leser der Schlüssel gereicht wird, ist charakteristisch für Skácel. Das Wort Rätsel fiel mit Bedacht. Ist ein rechtes Rätsel doch alles andere als verschwommen: Es liefert die genaue Anweisung zu seiner Lösung; womit es freilich den Rätselnden nicht vom Kopfzerbrechen befreit. So wird man Skácel oft dunkel finden – aber kaum je trübe.
Skácel malt keine Idyllen. Auf den Fluren, wo Pärchen, „jung, voller anmut, über die feuchten zäune der wimpern / … einander in den augen äpfel“ pflücken, riecht es nach dem Blut getöteter Tauben. Alleen werden gerodet, Ferkel verschnitten, Fledermäuse ans Tor genagelt. Doch die Präzision, mit der Skácel dies geschehen läßt, fällt allem rhetorisch ausholenden Pathos sanft in den Arm. Durch sein Werk geht die „kleine trauer“ (smuténka), ein elegisches Wesen, das zweimal auch personifiziert auftritt und der vierten Gedichtsammlung den Namen lieh. Es ist die Trauer dessen, der an der Jagt teilnimmt – das Thema läßt Skácel nicht los – und den es unter die Treiber verschlagen hat, obwohl er selbst, tierhaft ängstlich, die Welt mit den Augen des Wilds sieht. Skácel bekennt sich freimütig zu der „goldenen uralten angst“, schämt sich „nicht im geringsten / (s)einer beklommenheit“, empfindet „große freude“, daß er sich noch „fürchten kann“. Dabei gibt er sich nie der billigen Illusion hin, bloßes Mitgefühl versetze einen bereits vom Lager des Jägers in das der Gejagten. Denn jeder ist beides zugleich, dort, „wo lämmer tappen. Lämmer, so grausam.“
Angesichts solcher Erkenntnis wird die „kleine trauer“ nicht zur Ruhe kommen, wird sie weiter gehen über „die hanfwege hin des herbstes“ und gelegentlich mahnend beim Menschen einkehren. Dort klopft sie dann „an die fässer / ob der wein zu haus ist“ – mit dem Mittelfinger, wie Skácel hinzufügt, denn so und nicht anders hat er es gesehen.
Seine Entwicklung ist die einer konsequenten Zusammenziehung auf das Wesentliche. Zum Maß der Kunst wird es ihm, Maß zu halten. Zuletzt scheint ihm fast jeder Vers einer zuviel: Weil alle nur im kreise reden, / schweigst du dir im geist ein steinchen aus.“ Gern möchte man den Weg mitverfolgen, auf dem er zu seinen ausgeschwiegenen Steinchen gelangt. Die deutsche Ausgabe leistet dabei keine Hilfe: ihre vier Abschnitte decken sich nicht, wie man erwarten könnte, mit den vier Gedichtsammlungen Skácels. Das ginge an, wenn wenigstens im Inhaltsverzeichnis eine Zuordnung vorgenommen würde. Tatsächlich ist es aber unmöglich zu erfahren, welches Gedicht welchem Band entstammt.
Reiner Kunze nimmt für seine Arbeit anstelle des bei Lyrik üblichen Begriffs „Übertragung“ das Wort „Übersetzung“ in Anspruch. Zu Recht: Er verdeutscht Skácel mit seltener Genauigkeit. Doch nicht das ist die eigentliche Leistung: sondern daß er bei solcher Nähe zum Original noch den Eindruck vollkommener Unangestrengtheit zu wahren weiß. Natürlich gibt es auch hier Fälle, in denen der Übersetzer nur die Wahl zwischen zwei Weisen des Scheiterns hat. So, wenn Skácel sprechende Namen von Pflanzen einsetzt, für die das Deutsche kein Äquivalent kennt. Schließlich wird, wer emsig sucht, auch Beispiele finden, wo der Übersetzer danebengreift. Etwa, wenn er die Haut eines ausgeweideten Hasen im Luftzug „rasseln“ läßt, obwohl sie doch – wie im Original – allenfalls rascheln kann. Daß man aber bei einer solch geringen Unstimmigkeit überhaupt hellhörig wird, beweist zuletzt nur eines: alle übrigen Details sind vollendet getroffen. So spricht aus Reiner Kunzes Übersetzung ungetrübt jener ländlich klare Sinn für die Dinge, den Jan Skácel aus Znorovy in die Welt mitbrachte.
Urs Heftrich, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.4.1990
„Ich bin nur ein Dichter…“
– Ein hellsichtiger, bildkräftiger Poet aus der Tschechoslowakei. –
Eine Kulturnation wird reicher um jeden Dichter fremder Zunge, den sie sich anzueignen vermag. Von einem solchen Zugewinn ist hier zu sprechen, von der Lyrik des südmährischen Poeten Jan Skácel, der aus Znorovy stammt und heute in Brünn lebt. Skácel, Jahrgang 1922, gibt eine namhafte Literaturzeitschrift heraus: „Host do domu“ (Herr des Hauses). In der CSSR sind von ihm bisher vier Lyrikbücher und ein Band Prosa erschienen. Erste Proben seiner Verskunst waren bei uns in der Hohwacht-Anthologie „Die Tür – Nachdichtungen aus dem Tschechischen“ zu finden. In seiner Heimat wurde Skácel mit einem Schlag berühmt – durch das antistalinistische Widerstandsgedicht „Der blaue Vogel“.
Es macht ziemlich genau den Mittelpunkt der ersten deutschen Skácel-Sammlung aus, die jetzt im Hamburger Merlin Verlag des Andreas J. Meyer erschienen ist: „Fährgeld für Charon“, achtzig Gedichte, übersetzt von Reiner Kunze aus Mitteldeutschland. Die Rixdorfer Grafiker Ali Schindehütte und Arno Waldschmidt haben das handliche Lyrikbuch sehr adäquat ausgestattet.
Das Naturgedicht überwiegt. Aber es handelt sich dabei nicht um jene Art von Naturlyrik, die Gottfried Benn als „Nußbewisperung“ abtat. Skácels Gebilde haben keine Tendenz zu Kalligraphie und Eskapismus; sie binden die jahreszeitliche Natur in den Ort des Dichters, in die Zeitgeschichte, durchkreuzen sie mit gesichteter Welt:
In der Melde blüht die Distel,
das Königszepter voller Blattläuse,
Reichsäpfel reifen hier
gleich neben dem Straßengraben,
und Hamlet, der Königssohn,
fuhr nach Pavlov in den Ferien,
als er noch
der Glücklichste war im ganzen Lande Dänemark.
Skácel ist ein hellsichtiger, bildkräftiger Poet: in anderen Zeitläufen wäre er ein Mann der reinen Sangbarkeit, die Zunge gelöst; in heutiger Zeit ist seine Strophe gnomisch instrumentiert – er muß Politik verkraften, Wissenschaft, den „hüftschmalen“ Atomflieger, den Tod des kleinen blauen Vogels (Poesie) über MG-bestrichenen Feldern, über Wachturm und Drahtverhau. Und was vom Engel übrigblieb, ist das grüne, singende Nichts zwischen zwei Pappeln.
Diese Lyrik ist mit Flugtier bevölkert, Wildänse, Spatzen und Finken. Sie ist in dem „Sehr groben Gedicht über die Jagd“ selber „die entsetzte Flöte des Pirols“. Sie läßt sich, preisgegeben an die Epoche, anschlagen wie die Fledermaus ans Tor: „Ich bin nur ein Dichter, ein Radar unter den Linden…“
Der erste Schritt in das Werk Jan Skácels wird leichtgemacht durch seine Incantationen, deren einige von ganz gewiß seltener und überraschender Schönheit sind: „Mit vollen Händen aß der Wind den Schnee“ oder: „Über den Wassern, ach, über den Wasern / erhob sich ein Vogel ins Blau“ oder: „Mit hauchdünner Peitsche hieb der Frühlingsregen…“
Manche Schönheit ging beim Transport verloren, man ahnt und kann sie ergänzen, wenn man den Schlüssel zu dieser Lyrik gefunden hat: die Amalgamierung, die Verkochung von Abstraktem und Konkretem von Spruchwissen und Sinnenhaftigkeit, von Begrifflichkeit und Bild:
Ich hörte eine kleine Trauer in der Nacht.
Sie kam, und mit dem Mittelfinger
klopfte sie an die Fässer,
ob der Wein zu Haus ist.
Das Abstraktum wird personifiziert, wie denn umgekehrt die bilderspendende, nicht mehr namenlose Natur für historische Stunden aufgerufen, in die Gegenwart erkenntnis-kritisch gezogen werden kann. Am Webstuhl Skácels schießt das ineinander, am härtesten und genauesten in dem „Gebet für den Atomflieger“, das zum Motto das Wort hat: „Verbirg dich, Absalom, dein goldenes Haar glänzt“. Man deute dies Bild aus: der Atomflieger ist ein Junge mit seidenen Wimpern und trägt „im Ohr eine kleine Hummel“, und was er bewirkt, ist dies:
Nur schwarzer Teer wird sein,
und aus den Pissoiren des Todes
wird die Schwärze, scharf nach Ammoniak riechend,
ganz öffentlich zusammenfließen.
Der Flieger sät Pfauenfedern aus – kühnes, fatales, eigensinniges Bild des tschechoslovakischen Dichters für den Rauchpilz im Herbst. Mit diesem Bild aber gibt er die vorletzte Warnung – Schönheit soll das Paradox sein vor dem völlig absurden Tod durch Strahlung. Die letzte Warnung ist ein apostrophischer Dreizeiler, Frage an den Piloten:
Was wird mit dir,
wenn in deinem Ohr
die kleine Hummel stirbt?
Doch noch einmal: die Abstrakta, Angst zum Beispiel. In dem so betitelten Gedicht, das buchstäblich vier Schlüsse hat (nach jeder Strophe könnte man die nächste streichen), sieht der Dichter „die verbrannte Stelle in den Wiesen an der March“, sieht „den schwarzen Storch, die erblühte Angst“. Eine Setzung, die hinreißt; wie selten gelingt ein Bild von dieser höllischen Anmut.
Teile des Bandes sind „Heimatlyrik“, aber von jener Intensität, die Thomas Wolfe oder Faulkner oder, wenn man will, gewisse märkische Strophen Benns haben. Da werden Brünn und Znorovy („schöpft des Dichters reine Hand“) zu köstlichen, mit Finsternis und Glück beladenen Zentren der Welt; da werden Häuser in Pavlov – dem Weindorf am Fuß der Pillauer Berge – neu vom Vers unterkellert, auf daß Wein fließe in Strömen durch diese Keller; da werden Sommergewitter in Dürrenholz, dem tschechischen Drnholec, die Versammlung aller Blitze dieser Welt:
Wasser und Tod
trank die Erde.
Der spruchweise Lyriker Skácel, der die Melancholien des Zeitalters wie seine Heimat kennt, kann diese aussparen und Lakonie sich abfordern, zu der er den Schlüssel verweigert. Er hat die äußerste Verkürzung von abstrakter und konkreter Wirklichkeit erreicht und blickt zufrieden wie ein Kormoran; mehr nicht, mehr gibt es nicht. Mehr muß denn auch nicht sein. Die Bilder haben sich in Totenfinger verwandelt, den Blumen gleich.
Trakl und Huchel, bekennt er, sind seine Vorbilder. Das ist Wink genug – dem einen, Lebenden, dankt er Verse wie diesen: „Wolken, naßkalt wie gesprenkelte Forellen, schnellen über die Köpfe“, jenem, dem Salzburger, das schwere Gesicht, das marternde Zeichen der Psychodelie. Manie oder Clairvoyance – was zuletzt überwiegt? Nun, ich glaube, dieser uns neue Poet hat eine Bilderschrift gefunden, die den von ihm beschworenen „Töchtern des Gesangs“ gefällt – reich an vollkommen sinnlicher Rede (Lessings Forderung für die Prosa!), reich im Wechselspiel von Natur- und Zeitmetapher.
Skácel ist ein Studium wert. Einige seiner Gedichte werden neu und anders übersetzt werden. Der Merlin-Band ist ein Auftakt. Bei ansonsten geringer lyrischer Ernte fährt uns der Nachbar einen vollen Wagen in die Scheuer. Eßbare, schmeckbare, fühlbare, denkbare Welt.
Helmuth de Haas, Die Welt der Literatur, 12.10.1967
Kenner östlicher Lyrik
fiel der südmährische Poet Jan Skácel zum erstenmal in der vom Hohwacht-Verlag (Bad Godesberg) veröffentlichten Anthologie Die Tür – Nachdichtungen aus dem Tschechischen auf. Seine bildkräftigen Naturgedichte überraschten in ihrer eigenwilligen Sprache, die, wie Skácel selbst bekennt, in Peter Peter Huchel und Georg Trakl ihre Vorbilder hat, ohne jedoch epigonal zu sein. Skácel, der 1922 in Znorovy geboren wurde und heute in Brünn lebt, gibt in seiner Heimat eine vielbeachtete Literaturzeitschrift heraus. Vier Lyrikbände und ein Prosabuch machten ihn in der CSSR bekannt.
Daß der Hamburger Merlin Verlag jetzt die erste geschlossene Sammlung des hochbegabten Skácel in der Übersetzung Reiner Kunzes (DDR) herausgebracht hat, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Fährgeld für Charon vereinigt achtzig Texte, die in den vier Abteilungen „Der Grund“, „Mut dazu“, „Gras wie wir“ und „Der Weg zu uns“ gegliedert sind. Dekor und Ausstattung der vorwiegend reimfreien Verse sind sehr sparsam. Oft nahe dem lyrischen Stenogramm, beschränkt sich Skácel auf eine ausgesparte Beschreibung der Gegenstände: Häuser, Weindörfer, Sommergewitter, Blumen, Schwäne, Tod, Jagd, aber auch Zeitzeichen wie Drahtverhau und Wachturm, Tod durch Strahlung sind die Bildsignale, die zwischen abstrakter und konkreter Wirklichkeit angesiedelt sind. Zu den Höhepunkten der Sammlung gehört zweifellos das „Gebet für den Atomflieger“.
Die künstlerisch wertvolle Ausstattung der beiden Grafiker Schindehütte und Waldschmidt kommt dem natur- und zeitverbundenen Inhalt des Bandes nahe. Es ist zu hoffen, daß diese empfehlenswerte Veröffentlichung einem größeren Leserkreis bekannt wird.
Hugo Ernst Käufer, Literaturspiegel, Heft 4, 1969
Dichter aus Brünn
– Lyrik von Jan Skácel. –
Zu einer nachahmenswerten Buchpremiere hatte der rührige Merlin-Verlag, Hamburg, in den Künstlerclub „die insel“ gebeten. In Anwesenheit des in Brünn lebenden Autors Jan Skácel, dem im Gegensatz zu seinem in der Ostzone ansässigen Übersetzer Reiner Kunze, die Ausreisegenehmigung bewilligt wurde, stellte Verleger Andreas J. Meyer den ersten Band seiner Herbstproduktion vor Skácels bemerkenswerte Gedichte Fährgeld für Charon. Valter Taub las nuanciert und einfühlsam aus dem Band.
Skácel zählt Trakl und Huchel zu seinen Vorbildern, ohne an Eigenständigkeit einzubüßen. Seine sehr bildhaften Verse, die mit melancholischer Eindringlichkeit die Wiedergabe der Wechselwirkung von Natur und Mensch beschwören, die nicht selten ungebrochen liedhaft (ohne falsche lyrische Ambitionen) die eigene existentielle Wirklichkeit mit einer Vergangenheit konfrontieren, die sich als die verlorene Kindheit bezeugt, sollten Beachtung finden. Skácel beweist sich auch im symbolträchtigen Zeitgedicht („Der blaue Vogel“) sehr gültig als ein Lyriker von Rang.
Anzumerken bleibt die Ausstattung des Bandes, für die die Rixdorfer Ali Schindehütte und Arno Waldschmidt verantwortlich zeichnen. Ob das ornamentale Gepränge, das dem Band einen bibliophilen Charakter geben soll, in Übereinstimmung mit Skácels Gedichten steht, wagen allerdings wir zu bezweifeln.
A., Hamburger Abendblatt, 8.9.1967
Mutter Natur lyrisch
– Gedichte von Jan Skácel. –
Ein bißchen trotzig und ziemlich treuherzig klingt es, wenn ein Lyriker heute mit sich und seinen Lesern übereinkommt, der Schmerz solle „wirklich schmerzen und die Träne eine Träne sein“. Gewiß – da will sich jemand nicht damit abfinden, daß ehemals gute, schöne und inzwischen vieltausendmal korrumpierte Wörter und Bilder in der Rumpelkammer verstauben. Jan Skácel, 1922 geboren, hat sich dem Versuch verschrieben, Mutter Natur lyrisch zu rehabilitieren, und er will natürlich mehr, als nur die ewig rauschenden Wälder seines südmährischen Heimatlandes aufwerten; von einigen Balladen abgesehen, bewegt er sich auf die kurze Parabel zu, auf zeitbezogene, zugleich aber überzeitlich-zeitlose (zuweilen auch klassisch-mythologisch eingekleidete) Gedankenlyrik, auf Tiefe und hintergründige Pointen, wie man sie aus den Gedichten Zbigniew Herberts oder Vasko Popas oder Miodrag Pavlovics, zum Teil auch Josif Brodskijs kennt. Skácel jedoch verzichtet im Gegensatz zu diesen Lyrikern nicht auf die Schönheit der Sprache, auf Duft, Aroma, Klang und deren Suggestivkraft, mehr noch: Er läßt die müden, abgewetzten Wörter auf der Zunge zergehen, als spräche er sie zum ersten Male aus.
Dadurch mischt sich in die stille, manchmal moralisierende Eindringlichkeit seiner Gedichte etwas Beschwörendes, das wohl deswegen so frösteln macht, weil zwischen effektiver Mitteilung und sprachlicher Intention ein doch krasses Mißverhältnis besteht. Nämlich immer dann, wenn es im Grunde dabei bleibt, daß die Wälder rauschen und „betäubend der Holunder“ duftet, wenn nicht mehr geschieht, als daß die Große Überschwemmung zum Schluß ein Bild einbringt wie:
Nur schwarze Bäume, kahl noch,
ragten aus dem Wasser
wie nackte Wahrheiten.
Doch gerade dieser Ton herrscht vor bei Skácel. Ironie, die hier einiges Nötige leisten könnte, ist Skácels Sache nicht. Nach Halas, und vor allem nach Vitezslav Nezval, gehört vielmehr einiges an Mut dazu (ein Kapitel des Bandes), in einem Text Wie Kälbchen zur Welt kommen zu schreiben:
Wehmütig muht zuweilen die Kuh
und blickt sich um
mit Augen, blauer als Achat.
Milchquellen rasselnd an Melkkübeln,
im Luftzug wehn goldene Saiten des Mistes.
Und dieser Mut ist zu bewundern, nur – lohnt das Resultat solch hohe Einsätze?
Peter Urban, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.10.1967
Mit einfachen, zuweilen fast alltäglichen Worten
erreicht der mährische Dichter zauberhafte poetische Stimmungen, in denen sich Georg Trakls düsterfarbige Bildlichkeit, Huchels intellektuelle Naturempfindung und kindliche, vom Märchen inspirierte Fantasie bruchlos vereinigen. Kunze hat mit Einfühlungsgabe und ausgeprägtem Sinn für Sprach- und Klangwirkungen eine autorisierte deutsche Übersetzung hergestellt, die den Gedichten nichts von ihrem Reiz, ihrem spielerischen Ernst und ihrer Schlichtheit des Ausdrucks nehmen.
Helmut Rösner, Buchanzeiger für öffentliche Büchereien, Januar 1968
… Weit weniger schwer
sind die Verse des Mähren Jan Skácel in dem Band Fährgeld für Charon. Zwar ist auch ihm das Kreisen um Existenzielles nicht fremd, doch neben der Gedankentiefe ist seine Dichtung getragen von einer hedonistischen Stimmung, klingt ein ebenso tief verankerter Humor an, versöhnlich und schmunzelnd:
Am himbeerhimmel
zergeht der Tag.
Hinter der Ziegelmauer
duftet betäubend der holunder.
Jedes blatt ist zu hören.
Reglos wächst
die kastanie in die nacht.
In den steinen plätschert die finsternis.
Es ist, als klinge darin die in Bann ziehende musikalische Tradition Mährens an, als schöpfe Skácel aus der unwiderstehlichen Landschaft:
Auf dem Grund jedes liedes,
des traurigsten auch,
auf dem grund jedes gläschens
klingt etwas leis.
Manchmal nur kurz,
ein andermal lang.
Ich will es hören.
Gottweiß, was mich zwingt,
doch ich muß warten, bis es klingt,
sonst würde meinem herzen bang.
Und musikalisch ist auch die Wirkung, die die Lektüre seiner Verse im Leser erzeugt: Als klänge Skácels in Worte gefaßte Stimme mit einem leisen, kaum zu hörenden Liebeslied im vom Styx schmerzlich getrennten Universum des Orpheus wider.
Minne Bley, Prager Zeitung, 13.3.1997
Jan Skácel,
Jahrgang 1922, lebt in Brünn als Chefredakteur der Literaturzeitschrift Host do dumu, zu deutsch soviel wie „Gast ins Haus“. Die fünf oder sechs Gedichtbände, die von ihm seit 1957 erschienen sind, seine Feuilletons in der von ihm redigierten Zeitschrift und die Zeitschrift selbst machen ihn zu einer der bemerkenswertesten und profiliertesten Gestalten der mittleren Generation tschechischer Lyriker.
Sehr allgemein und summarisch könnte man die Produktion seiner Generationskollegen engagiert nennen, weil sie deutlich die Wandlungen und Spannungen der jüngsten tschechischen Geschichte spiegelt. Auch Skácel entzieht sich nicht jenem Engagement, das man an der tschechischen zeitgenössischen Literatur zu bewundern gelernt hat, seine Feuilletons und die Gestaltung seiner Zeitschrift reflektieren auf die Ereignisse der tschechischen Politik und Kulturpolitik distanziert zwar und ironisch, doch mit unzweideutigen Stellungnahmen. In seiner Lyrik jedoch, von der das Buch Fährgeld für Charon im Hamburger Merlin Verlag eine umfangreiche Probe gibt, ist der Transformationsweg vom Erlebnis, von der Empfindung, vom Einfall zu endgültiger poetischer Gestalt so lang, daß unmittelbare Bezüge verschwinden. Was bleibt, ist in den kurzen und kürzeren Gedichten, die zumindest in der vorliegenden Sammlung vorwiegen, eine komplexe, kaum definitiv ausdeutbare Metapher: jedes Gedicht, um eine mathematische Unterscheidung anzuwenden, repräsentiert eine begrenzte, jedoch unendliche Welt. Das Material der Vergleiche und Metaphern entstammt zumeist der Natur, nicht irgendeiner Natur, sondern der südmährischen Landschaft, von der das Marchfeld eine Fortsetzung ist und daher einen guten Begriff von ihrer Eigenart gibt. In der Ausprägung der Gedichte klingt die Form der gereimten Bauernweisheiten an. Skácels Gedichte präsentieren in der Pointe – sie ist meistens im Schlußbild enthalten – eine Weisheit, die allerdings nicht wie jene des Bauern auf der überlieferten Erfahrung von Generationen beruht und auf der Verallgemeinerung von Beobachtungen, sondern eine singuläre Entdeckung ist, die komprimierte Formulierung eines Sachverhalts, der wegen seiner Vielschichtigkeit nicht anders zu fassen ist als eben durch Poesie.
Um ein Beispiel aufzugreifen: in dem Gedicht „Mit dem Nackten und Nassen nach oben“ wird eine visuelles Erlebnis umgeformt: ein abgezogener Hasenbalg, auf einem Balken aufgehängt, in einer Winterlandschaft. Der Gegensatz von Frost und Schnee einerseits, der dampfenden, noch blutigen Haut andrerseits wird ins Spiel gebracht, irgendwie, ohne konkrete Hinweise, baut sich das Bild des Winters in einer bereits halb versteppten, flachen Gegend auf, die gleichsam metaphysische Qualität des Winters im flachen Land wird greifbar. Und daraus erhält dann die Schlußmetapher ihre Wirkung. Auf dem Hintergrund der angedeuteten Stimmungskomplexe hebt sie sich plastisch ab, macht in einigen Worten, einigen grammatischen Beziehungen etwas Einmaliges klar, was jedoch nur so und nicht anders sinnfällig werden kann. Alles, was man mit Worten erreichen kann, wenn man mit ihnen auf Erfahrungen verweisen will, nicht wieder auf Worte selbst. Das also ist die große Kunst Jan Skácels: den Verweisungszusammenhang der Worte mit der Wirklichkeit so herzustellen, daß er unzweideutig und konkret ist, daß man weiß, diese Worte bezeichnen diesen Sachverhalt und keinen anderen. Wie die Worte gesetzt sind, das erlaubt den Nachvollzug, nicht durch die Zerlegung in einzelne Bedeutungszusammenhänge, also analytisch, sondern integral, als ganzheitliche Gestalt. Reiner Kunzes Übersetzungen geben diese und andere Qualitäten von Jan Skácels Poesie sehr gelungen wieder, im angemessenen Zwischenbereich von Genauigkeit und Nachdichtung.
Paul Kruntorad, Österreichischer Rundfunk, 8.3.1968
Mähren
ist schon deswegen ein sonderbares Land, weil es Mähren gibt und zugleich auch nicht gibt. Einst, in der längst vergangenen Geschichte, war Mähren eine Markgrafschaft, locker mit dem Böhmischen Königreich verbunden. Heute ist Mähren mit der Tschechischen Föderativen Republik verschmolzen; der Name Mähren kommt nur in den Wettervorhersagen für die Tschechoslowakei und in Volksliedern vor.
Und die sind in Mähren wunderschön. Ohne die mährischen Volkslieder, ohne ihre ein wenig rauhe Schönheit gäbe es heute keinen Leoš Janáček, den weltberühmten Komponisten, der in Mähren geboren wurde und in Mähren sein ganzes Leben verbracht hat. In den mährischen Volksliedern wird über die treue und auch über die untreue Liebe gesungen, über die Kriege gegen die Türken, über klares, schnell fließendes Wasser, über Schwalben, über Räuber, über gesattelte und auch über ungesattelte Pferde und über einen jungen Burschen, den jemand im Wald erschlug. Die Wörter dieser Lieder sind aus Gold und die Melodie ist aus Silber geschmiedet.
Es ist das Silber des durch den Ostwind gekämmten Pfriemengrases. Unser Land ist nämlich gegen den Osten geöffnet und flach. Aus dem Osten kamen die tatarischen Horden bis nach Mähren geritten, und nach ihnen kamen auch die Türken. Der Mais wird in Mähren nach den ungarischen Kuruzzen, die mehrmals nach Mähren eingefallen waren, Kukuruz genannt.
In Mähren sprechen wir zwar alle tschechisch, aber unsere mährische Mundart. Für einen Fremden kann diese Feststellung geheimnisvoll klingen, aber es ist nun einmal so.
Es gibt ein Mähren, aber es gibt keine Mährer mehr, es gibt zwar immer noch Mährer, aber kein Mähren. Wie soll ich mich aus diesem Widerspruch heil und ehrlich herauswinden? František Palacký, unser großer Historiker des 19. Jahrhunderts, der Autor der umfangreichen, in einem hochgestochenen Tschechisch geschriebenen Geschichte des tschechischen Volkes, sagte einmal:
Ich bin ein Tscheche, aus dem Geschlecht der Mährer.
Palackýs Worte entsprechen der Tatsache und erklären alles.
Also: Es gibt ein Mähren – und es gibt es nicht. Und vor allem: Mähren ist ein anmutvolles Land. In dieser Hinsicht sind wir uns alle einig, wir, die Mährer, die zugleich auch Tschechen sind, also Tschechen, was die Sprache betrifft, und Mährer im Grunde unserer Herzen.
Und noch etwas haben wir – und zugleich haben wir es nicht, nämlich eine Nationalhymne. Die Nationalhymne der Tschechoslowakei besteht aus zwei Liedern, aus einem tschechischen und aus einem slowakischen Lied, die hintereinander gespielt und gesungen werden. Zwischen den zwei Liedern gibt es immer eine Pause, zwei, wahrscheinlich drei Sekunden lang, nicht mehr. Und diese scheinbar winzige Pause, die kurze Stille, das ist die mährische Nationalhymne.
Wir Mährer sind auf unsere Nationalhymne sehr stolz und nehmen mit Humor an, daß wir die überhaupt schönste Nationalhymne auf der ganzen Welt haben: die Stille. Eine Stille, die heutzutage so kostbar ist, eine Stille, die immer erhaben und zugleich auch bescheiden ist, eine Stille ohne aufgeblasene Worte, die uns über alle anderen Völker erheben möchten, eine Stille, die nie lügt. Und in dieser Stille denken wir an unser Mähren.
An dieses besonders gute Land, das es zwar nicht gibt, das es aber dennoch gibt.
Jan Skácel, im Herbst 1989 geschrieben als Dank für den Mitteleuropäischen Literaturpreis. Aus dem Tschechischen von Ota Filip. Erschienen in Petrarca-Preis, / Petrarca-Übersetzer-Preis / Nicolas-Born-Preis, Band 4. 1989–1991, Edition Petrarca
Daniel Bayerstorfer: Der Dichter Jan Skácel und sein Echo in Deutschland
AUF DEM FRIEDHOF IN BRÜNN
… Ich habe meinen alten treuen füllhalter verloren…
Könntest Du mir einen neuen schicken? Wenn möglich
mit einer feder, die schattig schreibt, d.h. mit einer
spitze, die schräg geschnitten ist, keine weiche, so daß
die schrift, wenn man aufdrückt, einen leichten
schatten wirft.
Jan Skácel, brief ohne datum
… könntest Du mir einige gläser schwarzer tinte
schicken?
An schwarzer tinte reicht’s nun
für die ewigkeit
Woher aber nimmst du
den schatten dort?
Wie das grab für dich schweigt!
Immer hattest du gewollt, daß das geheimnis
geheimnis bleibt
Auch für dich selbst
und im eigenen vers
Wir stehn, den kopf geneigt, sten
auf der lichtseite deiner feder
Reiner Kunze
J. S., 18.9.1989
KEIN VERGLEICH
für Jan Skácel
Wie eine Zigarette ist ein Gedicht
zwischen den Fingern leichter Urwaldgeruch
Es atmet in den Lungen durch
Schmerzt bis unerträglich Der Rauch
stört frisst an der Gesundheit klebt
an den Gardinen gelb wie verdorrter Efeu
Manchmal weiß man nicht warum
man die Glut nicht ausgehen lässt
Kein Vergleich
Die zeitliche Länge einer Cigarette
Der brandige Schleier der Worte
Das bewegte Glimmen im Dunkel
Dieter Krause
Felix Philipp Ingold: Nach Mähren und anderswohin
Fakten und Vermutungen zum Autor + Erinnerung+ IMDb +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie
Nachrufe auf Jan Skácel: NZZ ✝︎ Gedicht
Zum 100. Geburtstag des Autors:
Matthias Buth: Alles kann Poesie sein
faustkultur.de, 2.5.2022
Jan Skácel und Petr Oslzlý bei Theater in Bewegung III am 22.9.1987 in Brünn.
Zum 60. Geburtstag des Übersetzers:
Harald Hartung: Auf eigene Hoffnung
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.1993
Zum 70. Geburtstag des Übersetzers:
Katrin Hillgruber: Im Herzen barfuß
Der Tagesspiegel, Berlin, 16.8.2003
Lothar Schmidt-Mühlisch: Eine Stille, die den Kopf oben trägt
Die Welt, 16.8.2003
Beatrix Langner: Verbrüderung mit den Fischen
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.8.2003
Sabine Rohlf: Am Rande des Schweigens
Berliner Zeitung, 16./17.8.2003
Hans-Dieter Schütt: So leis so stark
Neues Deutschland, 16./17.8.2003
Cornelius Hell: Risse des Glaubens
Die Furche, 14.8.2003
Zum 75. Geburtstag des Übersetzers:
Michael Braun: Poesie mit großen Kinderaugen
Badische Zeitung, 16.8.2008
Christian Eger: Der Dichter errichtet ein Haus der Politik und Poesie
Mitteldeutsche Zeitung, 16.8.2008
Jörg Magenau: Deckname Lyrik
Der Tagesspiegel, 16.8.2008
Hans-Dieter Schütt: Blühen, abseits jedes Blicks
Neues Deutschland, 16./17.8.2008
Zum 80. Geburtstag des Übersetzers:
Jörg Bernhard Bilke: Der Mann mit dem klaren Blick: Begegnungen mit Reiner Kunze: Zum 80. Geburtstag am 16. August
Tabularasa, 18.7.2013
artour: Reiner Kunze wird 80
MDR Fernsehen, 8.8.2013
André Jahnke: Reiner Kunze wird 80 – Bespitzelter Lyriker sieht sich als Weltbürger
Osterländer Volkszeitung, 10.8.2013
Josef Bichler: Nachmittag am Sonnenhang
der standart, 9.8.2013
Thomas Bickelhaupt: Auf sensiblen Wegen
Sonntagsblatt, 11.8.2013
Günter Kunert: Dichter lesen hören ein Erlebnis
Nordwest Zeitung, 13.8.2013
Marko Martin: In Zimmerlautstärke
Die Welt, 15.8.2013
Peter Mohr: Die Aura der Wörter
lokalkompass.de, 15.8.2013
Arnold Vaatz: Der Einzelne und das Kartell
Der Tagesspiegel, 15.8.2013
Cornelia Geissler: Das Gedicht ist der Blindenstock des Dichters
Berliner Zeitung, 15.8.2013
Johannes Loy und André Jahnke: Eine Lebensader führt nach Münster
Westfälische Nachrichten, 15.8.2013
Michael Braun: Süchtig nach Schönem
Badische Zeitung, 16.8.2013
Jochen Kürten: Ein mutiger Dichter: Reiner Kunze
Deutsche Welle, 15.8.2013
Marcel Hilbert: Greiz: Ehrenbürger Reiner Kunze feiert heute 80. Geburtstag
Ostthüringer Zeitung, 16.8.13
Hans-Dieter Schütt: Rot in Weiß, Weiß in Rot
neues deutschland, 16.8.2013
Jörg Magenau: Der Blindenstock als Wünschelrute
Süddeutsche Zeitung, 16.8.2013
Friedrich Schorlemmer: Zimmerlautstärke
europäische ideen, Heft 155, 2013
Zum 85. Geburtstag des Übersetzers:
LN: Sensible Zeitzeugenschaft
Lübecker Nachrichten, 15.8.2018
Barbara Stühlmeyer: Die Aura der Worte wahrnehmen
Die Tagespost, 14.8.2018
Peter Mohr: Die Erlösung des Planeten
titel-kulturmagazin.de, 16.8.2018
Udo Scheer: Reiner Kunze wird 85
Thüringer Allgemeine, 16.8.2018
Jochen Kürten: Sich mit Worten wehren: Der Dichter Reiner Kunze wird 85
dw.com, 16.8.2018
Zum 90. Geburtstag des Übersetzers:
Lothar Müller: Widerstand in Jeans
Süddeutsche Zeitung, 15.8.2023
Cornelia Geißler: Dichterfreund und Sprachverteidiger
Berliner Zeitung, 15.8.2023
Antje-Gesine Marsch: Greizer Ehrenbürger Reiner Kunze feiert 90. Geburtstag
Ostthüringische Zeitung, 16.8.2023
Ines Geipel: Nachwort. Zum 90. Geburtstag von Reiner Kunze
S. Fischer Verlag
Ines Geipel: Mit dem Wort am Leben hängen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.2023
Gregor Dotzauer: Mit den Lippen Wörter schälen
Der Tagesspiegel, 15.8.2023
Hans-Dieter Schütt: Das feingesponnene Silber
nd, 15.8.2023
Stefan Stirnemann: Ausgerechnet eine Sendung über Liebesgedichte brachte Reiner Kunze in der DDR in Nöte – und mit seiner späteren Frau zusammen
Neue Zürcher Zeitung, 15.8.2023
Christian Eger: Herz und Gedächtnis
Mitteldeutsche Zeitung, 15.8.2023
Matthias Zwarg: Im Herzen barfuß
Freie Presse, 15.8.2023
Marko Martin: Nie mehr der Lüge den Ring küssen
Die Welt, 16.8.2023
Josef Kraus: Mutiger Lyriker, Essayist, Sprachschützer, DDR-Dissident, Patriot – Reiner Kunze zum 90. Geburtstag
tichyseinblick.de, 16.8.2023
Erich Garhammer: Das Gedicht hat einen Wohnort: entlang dem Staunen
feinschwarz.net, 16.8.2023
Volker Strebel: Ein deutsch-deutscher Dichter
faustkultur.de, 29.8.2023
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + KLG + IMDb +
Archiv + Kalliope + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Rede + Interview 1, 2 & 3
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Reiner Kunze – Befragt von Peter Voss am 15.7.2013.


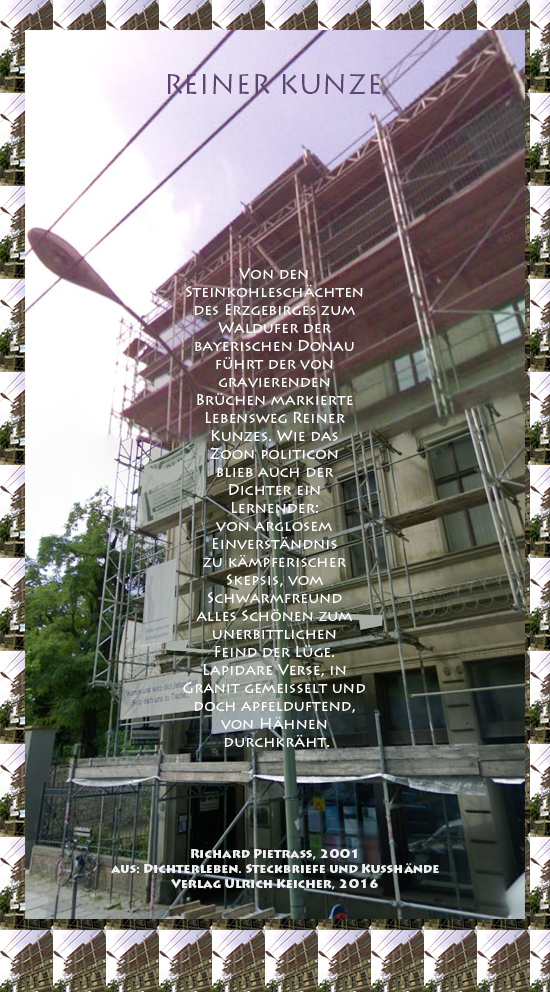












Schreibe einen Kommentar