Sarah Kirsch: Zaubersprüche
SELBSTMORD
Aber bei der lag es in der Familie
Sie wohnten früher am Moor
Der Großmutter fiel regelmäßig
Ein Bild von der Wand wenn wieder
Ein Sohn gefallen war
Acht Fragen an Sarah Kirsch
1. Sie nennen die neue Sammlung Ihrer Gedichte Zaubersprüche…
Ja. Ich hoffe, daß Hexen, gäbe es sie, diese Gedichte als Fachliteratur nützen könnten.
2. Die Wirkung Ihrer Gedichte steht oft in direktem Bezug zu Assoziationsreihen. Sie schaffen Überraschung, Verwirrung, Klarheit. Haben Sie ein Gedicht bei der Niederschrift im Kopf?
Das Gedicht wird am Schreibtisch fertig. Natürlich weiß ich vorher, warum ich gerade dieses Gedicht mache. Ich weiß auch die meisten Bausteine des Gedichtes lange vorher. Die schließliche Ordnung fordert Sitzfleisch.
3. Sie sind episch auf knappem Raum. Sie erzählen den Leuten nicht selten Geschichten – im Gedicht.
Ich denke an „Angeln mit Sascha“, aber auch an „Anziehung“, den dreizeiligen Spruch.
Ich glaube, daß Gedichte nicht nur Empfindungen, sondern auch die Ursachen der Empfindungen wiedergeben sollten.
4. Theoretisieren sie gern?
Man muß schon gelegentlich Lehren aus der eigenen Arbeit ziehen; ich analysiere die Dichter, die ich mag, sehr gern im Gespräch. Hätte ich keine politischen Interessen, könnte ich keinen Vers schreiben.
5. Was halten sie von Gelegenheitsgedichten?
Es gibt zwei Sorten: Gedichte, die für eine Gelegenheit geschrieben sind; Gedichte, die sich aus einer Gelegenheit entfalten. Die Gedichte dieses Bandes zähle ich fast sämtlich zur zweiten Gruppe. Ich halte es auch für notwendig, Gelegenheitsgedichte der ersten Gruppe zielstrebig zu fördern; das ist eine Sache der Auftraggeber. Die Presse zum Bespiel behilft sich bei festlichen Staatsangelegenheiten oder sonstigen politischen Anlässen zu häufig mit journalistischen Mitteln und nutzt die poetischen zu wenig
6. Müssen gesellschaftliche Beziehungen im Liebesgedicht widergespiegelt werden?
Wenn in grauer Vorzeit ein junger Mann aus bürgerlichem Stande eine adlige Jungfrau nicht ehelichen durfte, wenn der junge Adlige die junge Bäuerin von Amts wegen zu schwängern bestimmt schien: so möge man versuchen, das Seelenleben der Beteiligten zu schildern, ohne die sozialen Umstände zu berühren. Ich bin sicher, der Versuch würde fehlschlagen; auch ist er wohl nie unternommen worden. Manchmal freilich muß man, mehr als dies bei anderen Gedichtgegenständen nötig ist, aus dem Resultat auf die Ursache rückschließen. Das ist die Arbeit des Lesers, der gerade für das Liebesgedicht, gewisser Einsichten bedarf.
7. Welche Beziehung sehen Sie zwischen Gedicht und Spiel?
Das ist eine Grundfrage der Ästhetik; sie würde eine theoretische Konferenz lohnen, um nur die Fragestellung zu präzisieren. Ich kann daher nur meine Überzeugung aussprechen. Ich meine nämlich, daß, wie die Kinder spielend lernen, die Erwachsenen das Spiel gleichfalls produktiv nützen können. Die Erfahrung zeigt, daß unsere Gesellschaft nicht aufs Spiel verzichten kann. Wie sonst könnten Millionen Menschen ein Fußballspiel oder sonstige Sportwettkämpfe am Bildschirm verfolgen? Welche Begeisterung wird in den Stadien manifest! Ich glaube, daß die Literatur hier eher einen Nachholbedarf hat.
8. Welche Vorbilder hat Ihr Gedicht „Aynn Wintrstück“?
Ich habe in letzter Zeit wieder und wieder Volkslieder gelesen. Ich versuche mich über ihren Lakonismus durch praktische Nachbildung zu verständigen.
Vademecum für Leser von Zaubersprüchen
− Zu einem Gedichtband der Sarah Kirsch. −
Gedichtbände sind Städte, und sie entstehen auch so: Barock oder Klassizismus die einen, am Reißbrett konstruiert und, bis in scheinbare Zufälligkeiten dem Bauwillen einer Idee unterworfen, mit Herrschergewalt dem Land aufgeprägt. Andere sind gotische Kerne mit Mauern und Toren und Katzkopfpflaster; in Widersprüchen krummgassig um ihre Zentren gewachsen, der Landschaft entsprossen, Geschichte verkörpernd, und noch die kleinste Kummerkaue spiegelt auf ihrer stumpfen Lehmwand den Glanz aus den Fenstern der Kathedrale, und es streift sie ein Schatten des Rolands vom Markt. Und dann gibt es großgemeindete Vororte, Sammelsurien vereinzelter Bauten, Stückwerk im Kleinen, Flickwerk im Großen, und selbst ein zufällig schönes Landhaus wird von der umstreuten Konfektion ebenso unters Maß genommen, wie es deren Schäbigkeit manifestiert. Die Masse des Mittelmäßigen schlägt in neue Qualität nur nach unten um; da lobe ich mir noch die Einzelvillen, die freilich setzen Baugrund voraus. Dann gibt es Saniertes und Modernisiertes; Aufgeputztes und Übertünchtes; Scheinfassaden; Potemkinsche Dörfer; Disney-Land und Neon in der Wüste; schlechtes Neues aus geplünderten Foren, und der eine und andre Stein bezeugt auf Mitleid und Wut erregende Weise die einstige Wucht. Öde Goldgräberstädte und Laubenkolonien, einander zum Verwechseln ähnlich; Kasernengelände, da riecht es nach Pissoir und Männergehorsam; echte Quartier latins und fades Sankt Pauli; erbärmlich jede Reservation. Häfen; die Menschheitsdämmerung ist das Berlin des zweiten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts; Rilkes Gedichte sind eine habsburgerländische Kleinstadt, von der ein Satan die Dächer abdeckt, und jeder Band Vítězslav Nezvals ist Prag mit seinen schwarzen Kirchen und dem lila Gewitterfirmament. Da gibt’s Kleinstädte, die wurden Verkehrsknotenpunkte: man fühlt sich nicht wohl in ihnen, doch man muß sie passieren; da gibt es die gräßlichen Mietshäuser mancher Anthologien und daneben, gleichem Geist entsprungen, den schwülstigen Kitsch schlecht beratner Verfügungsmacht, die Überflüssiges nicht nur erzwingt, sondern richtungweisend machen möchte. Da erfreun, immer seltner, anspruchslos liebenswerte Dörfer; da gibt es – gewöhnlich im dicksten Wald – Experimentierviertel und Laborgelände, auch Häusermuseen, zu Lehrzwecken zusammengetragen wie die Dorfmuseen in Rumänien und Lettland, die sind instruktiv, auch wenn man drin nicht wohnt, und ganz selten ist hinreißender Kitsch geworden.
Welchen Ort will man durchwandern? Dem Besucher steht’s frei, der Erbauer ist in seine Kräfte gebunden wie der Städtebauer in seine Zeit. Zum Barock gehören Größe und Planungsgewalt, zur Gotik Zentren, Spannung und schwieriges notwendiges Wachsen. Imitation zeugt nur Imitiertes, und das Kainsmal des Falschen trägt dann jede Fassade: Neobarock und Barock sind nicht identisch, und ein hervorragendes Merkmal der Neogotik ist Dürre und Widerspruchslosigkeit.
Wo können Hexen wohnen, wenn sie es sind? Im Winkel einer gotischen Stadt, wo anders, und dies Buch hier ist eine, und eine echte – man wird ihm nicht ganz gerecht, wenn man es unterm Aspekt des Zopfstils sieht. „… asymmetrisch; die Ornamente gleichen sich nicht. Wo ein Pferd springen müßte, weidet ein Stier; hier Weinlaub, da Rosen. Ein Bogen ist breiter und niedriger als der vorige…“ Diese Sätze über die „Kirche in Mzcheta“ kennzeichnen das Ganze in Form wie Inhalt: Man verfehlt den Charakter solcher Kosmen, wenn man sie, durch ihre souveräne Komposition verführt, als einheitlichen Planvollzug auffaßt. Ihr Wesen ist aus dem Grundriß nicht abzulesen, auch wenn dieser drei Bezirke zeigt. Dächer gehn über Mauern hinweg; unterirdische Gänge und Stollen; zeitlich danach ist nicht örtlich dahinter, und die Zentren stehn selten zentral und durchdringen einander wie die Kräfte eines Tonnengewölbes. Solche Städte soll man kreuz und quer durchwandern, sie laden ein, in Winkel zu spähen und Details in Fresko und Fries zu entdecken, darum wird man ein Vademecum nicht verschmähen, das weniger als einer der üblichen Stadtführer sein möchte und dem dadurch vielleicht ein Mehr gelingt: weniger, insofern es Auswahl, mehr, insofern es Ausschweifung ist. Eine Warnung: Wir betreten Zaubergelände. Der Wanderer wappne sich gegen Magie.
ANZIEHUNG
Nebel zieht auf, das Wetter schlägt um. Der Mond
versammelt Wolken im Kreis. Das Eis auf dem See
hat Risse und reibt sich. Komm über den See.
Vor den Mauern der Stadt, am See, das einsame Haus. In solcher Gegend ist’s nicht geheuer. Der Scharfrichter wohnt da, verrufenes Volk. Das da ist das Hexenhaus.
Mit dieser Annonce wird nicht zu einer Mut-, sondern zu einer Hexenprobe eingeladen: Nicht Charakter, sondern Zunft soll erkundet werden. Im Bestehn auf den Schollen werden sich die Leiber scheiden; im Bestehn vor diesen drei Zeilen scheiden sich die Geister.
Bei solchem Wetter kommt nur über den See, wer zur Gilde gehört. Heil übers Festeis zu gehn gelingt jedem Tölpel, und nach dem Tauwetter sind auch Boote mietbar. Doch nun, da das Wetter umschlägt: Komm über den See. Erreichst du mein Haus, bist du unsresgleichen.
Nicht das Schwierige wird verlangt, sondern das Unmögliche, das zugleich das Selbstverständliche ist.
Eine exklusive Zunft, ein Geheimorden? Nun – die Einladung geht an jeden, und der See ist nicht abgezäunt. Du mußt nur hexen können, das ist alles.
Wo aber lernt man’s? – Komm über den See!
Die Hexen wollen Rache nehmen. Jahrhundertelang hat man mit ihnen die Probe gemacht: nackt zusammengeschnürt und aufs Wasser geworfen: Schwimmst du oben, wirst du verbrannt, gehst du unter, wirst du ertrinken.
Doch die Hexenverbrenner sind aufgeklärt. Wer glaubt denn heute noch an Gespenster!
Der Himmel ist klar, das Boot stößt ans Ufer. „Da bin ich! Nun sage, wie klug ich bin! Ich habe die Gefährdung durchschaut und anderes Wetter abgewartet! Wo bist du? Nun öffne mir deine Arme!“
Und irgendeine wird sie ihm schon öffnen. Irgendeine ist immer da.
„Aha“, sagt danach der Unerschrockne, „fauler Zauber, ich hab’s ja geahnt! Eine Umarmung wie jede andre! Dafür hätte ich meinen Kopf wagen sollen, meine heile Haut, meine trockenen Socken?
Und er fährt zurück, mit sich sehr zufrieden.
„Es gibt keine Hexen“, sagt er laut. Und dann dehnt er sich, und dann gähnt er ein bißchen.
Ich bin doch ein Mordskerl! denkt er stolz.
Die Ruferin tanzt auf den Wellen und grinst.
SIEBEN HÄUTE
Die Zwiebel liegt weißgeschält auf dem kalten Herd
Sie leuchtet aus ihrer innersten Haut daneben das Messer
Die Zwiebel allein das Messer allein die Hausfrau
Lief weinend die Treppe hinab so hatte die Zwiebel
lhr zugesetzt oder die Stellung der Sonne überm Nachbarhaus
Wenn sie nicht wiederkommt wenn sie nicht bald
Wiederkommt findet der Mann die Zwiebel sanft und das Messer beschlagen
Torbögen, durch die man das offene Treppenhaus sieht und hinter dem Treppenhaus die offene Küche mit dem schwarzen Herd vor dem milchigen Fenster, und Torhof, Treppe und Küche sind leer, wiewohl der Herd glüht.
Was die Hexen früh lernen müssen: Prozesse, die man nicht abbrechen darf, auch eben dann nicht abzubrechen, wenn sie unerträglich werden. Zwiebeln schneidet man weinend, oder gar nicht. Der Sinn jeder schöpferischen Krise besteht in eben solcher Erprobung, und jede Liebe weiß davon, wenn sie Liebe ist.
Freilich: Nicht alles Quälende ist des Durchstehens wert. Eine sichere Probe wäre Gewöhnung. Ans Zwiebelschneiden gewöhnt man sich nicht, dafür endet es einmal, und am Ende dampft die Zwiebelsuppe. Schlechte Qual endet nie, jedoch man gewöhnt sich, und das Ende ist schlechte Gewöhnung, sonst nichts.
Aber Durchstehn von Qual allein ist zu wenig: Man muß danach auch noch kochen können.
König Lindwurm; das Märchen von den sieben Häuten; Sie sind aus Leder, aus Kupfer, aus Eisen, der Verwunschene steckt als Kern in ihnen, und alle sind sie seine Haut. Die Häute müssen abgepeitscht werden, anders gibt es keine Erlösung, und verflucht sei, wer’s anfängt und wieder abbricht, weil er das Jammern des Wunden nicht mehr erträgt.
Nimm die Peitsche und peitsch dich selbst heraus!
Ein Dieb, so erzählt eine morgenländische Sage, stahl einen Topf Salz. Vor die Wahl gestellt, zur Sühne das Salz aufzuessen, fünfzig Sohlenhiebe zu dulden oder hundert Piaster Strafe zu zahlen, wählte er lachend das Salz. Nach drei Löffeln würgend und blau im Schlund, bat er um die Hiebe; fünf Hiebe lang schrie er, dann zahlte er. Hier liegt die Klugheit nicht im Durchstehen, sondern im richtigen Wählen, und die nächste im Abbruch der schlechten Wahl. Hätt er das Salz gefressen, wär er krepiert. Zwiebelschneiden ist davon das Gegenteil.
Fällt jemand auf, daß im Ausgang des Gedichts nicht mehr nach dieser Hausfrau gefragt wird? Auch bleibt durchaus offen, warum sie weglief – gleichgültig; es gibt dafür keinen Grund, versteht ihr, auch die Sonne ist kein Argument. An dieser hat der Mann nichts verloren, oder er ist ihr ebenbürtig.
Schmeckt man – um im kulinarischen Bild zu bleiben −, schmeckt man die sichere Klugheit im Rhythmischen ab, die eine große Pause zwischen die Wörter „bald“ und „wiederkommt“ gesetzt hat und so eine Prädikatwiederholung nicht schal macht, sondern pointiert? Ich kann mir vorstellen, daß hier Geduld vonnöten war, vielleicht Geduld, bis man heulte, wiewohl es so selbstverständlich ausschaut.
Jeder kann Zwiebeln schneiden; nicht einmal Zwiebelschneiden kann jeder.
Und man muß danach auch noch kochen können.
SCHWARZE BOHNEN
Nachmittags mahle ich Kaffee
Nachmittags setze ich den zermahlenen Kaffee
Rückwärts zusammen schöne
Schwarze Bohnen
Nachmittags ziehe ich mich aus mich an
Erst schminke dann wasche ich mich
Singe bin stumm
Manches romanische Haus hat niedrige Türen. Man schilt es, denn solche Portale sind unbequem. Oft gelangt man dann in Gewölbe. Dem hier folgt ein sehr düsterer Gang.
Daß man nicht zweimal in denselben Fluß steigen kann, ist überall dort, wo Dialektik gelehrt wird, eine Binsenweisheit geworden, und die taugt dann in der Praxis dazu, bestimmte Konturen zu verwischen und mühsam abgegrenzte Begriffe in vag Allgemeinem aufzulösen, in unserem Fall das, was die Alltagsmeinung, und nicht nur sie, irreversible, also unumkehrbare Prozesse nennt. Schmelzen von Eis und Einfrieren von Wasser ist beliebig, und beliebig oft, umkehrbar, Überführen von Strahlung in Wärme nicht, und die Wassermetamorphose bleibt von der Energieumwandlung als reversibel auch dann unterschieden, wenn man auftrumpft, daß jenes und dieses Eis im Sinn Heraklits nicht dasselbe Eis sei. Die Binsenweisheit verschleift das Besondere, darum wird sie so gern Allgemeingut.
Nun treten in jenem Irreversiblen nochmals Sonderungen auf: Abläufe, danach äußerlich derselbe Zustand wie vordem hergestellt scheint. Solcherart ereignet sich Irreversibles nur im Sozialen. Von ebendem handelt das Gedicht.
Physikalisch-mechanisch irreversibel: Kaffee mahlen; man kriegt die Bohnen nicht mehr als Bohnen zusammen, auch mit Leim nicht (wunderschön kommt das im Akzent heraus: in der ersten Zeile ist es Kaffée, in der zweiten Zeile ist es Káffee; das gleiche Wort ist trotz gleicher Schreibweise nicht mehr dasselbe, im Phonetischen nicht, und im Geistigen schon gar nicht: Kaffe). Hier wird nun behauptet, daß man es doch hingekriegt hätte, doch würde, nähme man diese Behauptung als Bericht tatsächlicher Leistung, im Folgenden so viel mehr Unwahrscheinliches behauptet, daß, an diesem gemessen die erste Aussage nicht anders zu werten wäre als die, Eis in Wasser und Wasser in Eis verwandelt zu haben. Denn in den folgenden Zeilen würde dies erzählt: Man war stumm in der Vorfreude der Erwartung, noch bekleidet, und noch ohne Lippenrot. Er wird kommen, nichts gewisser als dies, eher stürzte das Tal in den Berg hinauf, als daß er mich heute allein lassen würde! Man sang, man zog sich aus, Rouge, und ein Spiegel; und dann einen Nachmittag allein. Nun ist man wieder stumm, und das „stumm“ solchen Endes wäre dasselbe „stumm“ des Beginns? Man zog sich, bekleidet, aus, zu empfangen; man zieht sich nach sinnloser Nacktheit an: Anfang und Ende in äußerer Gleichheit; doch dazwischen – und hier im Gedicht liegt der knappste Zwischenraum dazwischen, interpunktionsloses schmalstes Spatium −, dazwischen liegt das, was einst Wendepunkt eines Lebens geworden sein wird. Nichts mehr kann dann bleiben, wie es gewesen, und auch mit demselben Kleid am Leibe ist es nicht mehr dasselbe Bekleidetsein.
Was will es dagegen schon heißen, gemahlenen Kaffee zu Bohnen zurückzusammensetzen zu können? Jede Zauberanfängerin im zweiten Semester wird darin geprüft, doch dann muß sie das Schwere lernen: die Einsicht, wo ihre Grenzen sind. Auch Hexen sind nicht allmächtig, gerade sie nicht. Auch für sie gibt es irreversible Prozesse im Physikalischen kaum, doch im Sozialen. Hier ist das Ende ihrer Kunst.
Und nun kommt unser Binsenweisheitler: „Jeder erlebt mal eine Enttäuschung, und von jedem wird man halt mal enttäuscht. Das Leben geht weiter, nun hab dich nicht so!“ Gewiß, gewiß; wie richtig, wie richtig. Nur gibt es Enttäuschung und Enttäuschung, denn dieser ist eben nicht jeder, sonst wär’s ja nicht dieser, verstehst du das nicht? Das Leben geht weiter – wer zweifelt daran? Nur ist es, geht es weiter, dann anders, als es gewesen. – „Na und? Es ändert sich doch alles, das ist ein Gesetz! Man steigt nicht zweimal in dens…“
Wie wahr.
Man hat dieses Gedicht nur als Beschreibung tödlicher Langeweile bestimmter Sommersonntagsnachmittage interpretiert. Man hätte, oder die Schreiberin hatte da also nichts Beßres zu tun gehabt. Singen, ihr Guten, wäre schon Beßres, allein man kann es dann nicht mehr.
Gewiß, aus solchen, und wiederholten Enttäuschungen kann auch die tödliche Langeweile wachsen, und sie beschreibt dies Gedicht ja auch. Doch das ist meist nicht das Ende von Hexen. Deren Ende ist Bösesein. Sie sind’s nicht von Haus aus, doch sie können es werden. Sie wehren sich lange; sie unterliegen.
Es sind auch noch andere Schlüsse möglich, Schlüsse, nach denen das Herz auch physikalisch nicht mehr das Herz ist, das es vordem war: zerlöchert oder von anderem Pulver versehrt. Das, allerdings, ist die tödliche Langeweile, und was ihr vorausging, war die Krankheit zum Tode. Und nun wage keiner zu sagen: „Jeder stirbt einmal!“ Es gibt Selbstmorde auch in dieser Gesellschaftsordnung. Sie sind nicht dieselben als anderswann.
ICH WOLLTE MEINEN KÖNIG TÖTEN
Ich wollte meinen König töten
Und wieder frei sein. Das Armband
Das er mir gab, den einen schönen Namen
Legte ich ab und warf die Worte
Weg die ich gemacht hatte: Vergleiche
Für seine Augen die Stimme die Zunge
Ich baute leergetrunkene Flaschen auf
Füllte Explosives ein – das sollte ihn
Für immer verjagen. Damit
Die Rebellion vollständig würde
Verschloß ich die Tür, ging
Unter Menschen, verbrüderte mich
In verschiedenen Häusern – doch
Die Freiheit wollte nicht groß werden
Das Ding Seele dies bourgeoise Stück
Verharrte nicht nur, wurde milder
Tanzte wenn ich den Kopf
An gegen Mauem rannte. Ich ging
Den Gerüchten nach im Land die
Gegen ihn sprachen, sammelte
Drei Bände Verfehlungen eine Mappe
Ungerechtigkeiten, selbst Lügen
Führte ich auf. Ganz zuletzt
Wollte ich ihn einfach verraten
Ich suchte ihn, den Plan zu vollenden
Küßte den andern, daß meinem
König nichts widerführe
Der Dom; das Legendenmosaik, und sein Rot und sein Violett wallen jeden Abend über die Stadt.
Dieses Gedicht – eines der bedeutendsten und schönsten, die unsere Zeit hervorgebracht hat – besitzt den Vorzug gültiger Lyrik: Es widersetzt sich dem völligen Auflösen ins Rationale, wiewohl es eben dazu stachelt, und dies um so drängender, je deutlicher jener Rest hervortritt, dessen Bedrängnis zuletzt doch in Genugtuung umschlägt. Dazu muß man Wort um Wort vorangehn.
Ich
Erster Satz im Roman, erstes Wort im Gedicht – ließen sich Werktypen nach ihnen bestimmen? „Die erste Zeile schenkt Gott, das übrige ist Sache des Dichters“ – ich weiß nicht mehr, wer diesen Ausspruch getan hat, ich weiß auch nicht, ob ich richtig zitiere, ich weiß nur aus meiner Leseerfahrung, daß im ersten Gedichtwort ein Keim gelegt ist, dessen Stringenz der Entfaltung wenn auch nicht immer das Ganze, so doch Wesenhaftes des Ganzen bestimmt. Ach; all; als; am; auch; da; daß; du; es; Gott; hier; ich; in; ist; kein; mein; nicht; noch; nun; so; sag; schon; schön; seht; sei; so; und; was; wenn; wie; wir; wo; zu – jedes Register der Gedichtanfänge weist diese Einsilber, und dazu die bestimmten und den unbestimmten Artikel, als die meistgewählten Eröffnungen auf. Könnte man nun wie im Schach klassifizieren? Hat man es längst getan? Will es einer versuchen? „Auf C2 – C4 spielt man am besten E7 – E5“ – „Wer ein Gedicht mit ich anfängt, sollte…“ Ergötzlich-entsetzlicher Gedanke; doch vielleicht führt der Abweg auch zum Ziel.
Ich: rigoroseste Subjektsetzung; wenn ein Gedichtanfang fragwürdig, einer Frage würdig ist, dann dieser: Wer ist’s, der hier redet, wer sagt hier: „ich“? Impulsive Antwort: Der Dichter, wer sonst – doch dagegen verwahrt sich erfahrungsgemäß sofort und gereizt gerade der Dichter (Eröffnungen der Art: „Ich, Bertolt Brecht…“ sind äußerst selten), und der Poetologe stimmt ihm hier bei: Man unterscheide, geläufigerweise, das gedichtete Ich vom dichtenden Ich – doch wer, um Himmels willen, ist nun wieder „man“, wer unterscheidet da jenes von diesem und dieses von jenem? Wenn der Autor – durch eine Überschrift etwa – es selbst tut, kann das wenig beweisen: Ein Ich sagt ich, sagend oder stillschweigend als unterstellt unterstellend, daß dies „Ich“, das sein Ich sagt, nicht sein Ich sei – er kann da doch wohl nicht mehr als drauf hinweisen, daß er’s gern so hätte oder auch nicht so hätte, aber ein Subjekt sagt nun einmal von sich nur Subjektives aus, und das ist zunächst nichts als eine Behauptung, und von denen gab’s oft genug logischen Unfug. „Alle Kreter sind Lügner, sagte der Kreter“ – dieser Zirkelspaß ist allbekannt. Wenn irgendwo, dann wird hier an eine objektive Instanz appelliert, und die könnte ja nur – wenn man zustimmt, daß die Musen tot sind – der Leser werden, aber wie könnte das geschehen? Wie will der Außenstehende den Streit über Schöpfer und Geschöpf entscheiden, die beide ihm nur vermittelt sind, und zwar wechselweise voneinander: das Geschöpf von seinem Schöpfer, und der Schöpfer von seinem Geschöpf? Wie will er da trennen oder nicht trennen, wie will er da ein „je nachdem“ anwenden – nach welchem „dem“ denn, nach welchem Prinzip, nach welchem Kriterium? Er könnte das noch am ehesten als Theologe tun, wenn er einer wäre, die plagen sich nämlich mit solchen Problemen, oder vielleicht als geschulter, diagnostizierender Psychologe, am besten aber als intimer Kenner des Schreibers, der weiß, wie das mit dessen zwei Ichs ist, doch dagegen verwahrt sich erfahrungsgemäß sofort und gereizt wiederum der Dichter mit dem Bemerken, er habe nicht für Wissenschaftler und auch nicht nur für seine Bekannten, er habe für jedermann, und das will heißen für den naiven, den kunstaufnehmenden, den poesieempfänglichen Leser geschrieben – aber woraus, zum Teufel, geht denn nun wieder dieser differenzierende Verallgemeinerungsanspruch hervor? Aus dem Wort des Beginns am wenigsten: Wer ich sagt, tritt doch mit dem Anspruch und zugleich der Bescheidung auf, seine Erfahrung zu sagen und sonst nichts als sie; er spreche, betont er, von keinem als von sich, doch damit spricht er ja auch für keinen als für sich – mit welchem Recht spricht er eigentlich da überhaupt? Mit seinem Menschenrecht freier Meinungsäußerung, sicher, aber mit welchem poetischen Recht? Das, was er da sein Gedicht nennt, ist doch erst mal nichts anderes als eine beliebige andre subjektive Aussage und etwa von der eines Wahnsinnigen oder eines Zwecklügners durch nichts und im Wesen auch nicht durch die Form unterschieden. Ein solches Gebilde kann erst durch einen Dritten, den Leser, in den Rang eines Gedichts erhoben werden, denn nur dadurch, daß ein Andrer die Erfahrungen des (schreibenden oder geschriebenen) Ichs als eigne bestätigt und für sich, als einen des Artikulierens oder so Artikulierens Unfähigen, ausgedrückt sieht, gewinnt jene Hervorbringung gesellschaftlichen Charakter, und ohne den ist Literatur nicht Literatur. Gerade der subjektivste Anfang verlangt so drängend wie kein andrer das objektive Korrelat. Ob gedichtetes oder dichtendes Ich: eines muß mit dem lesenden Ich zumindest ein Wegstück Erfahrung teilen, und dieses Gemeinsame heißt doch wohl: Wir … Nichts schien selbstverständlicher, als mit ich zu beginnen, doch nichts versteht sich – weniger von selbst. „Ein anständiger Mensch fängt mit ich keinen Brief an“ – solche Weisheit hat schon ihren tiefen Sinn. Das scheint auch der Naivste zu ahnen; der Debütant schrickt vor so einem Anfang zurück, und der souverän Gestaltende wird zögern, ihn einzusetzen, und ihn jenen Gedichten vorbehalten, von denen er fühlt (glaubt; hofft; ahnt; erwartet; weiß?), daß er mehr als ich sagt, wenn er rigoros sich zum Ich bekennt.
Wie verhalten sich Hexen in so einem Fall?
Ich – im ersten Teil dieses Buches beginnen fünf von fünfzehn Gedichten mit diesem Pronomen; im zweiten Teil keines; im dritten Teil mit seinen sechsundzwanzig Stücken nur eines, und das ist das andere, das verborgene Zentralgedicht. Das Schlußgedicht trägt dieses Wort dann als Titel; sehr selten ist es (als Personal- wie Possessivpronomen) gänzlich vermieden, und eines der beiden Stücke, in denen konsequent und ausschließlich wir und unser gesagt wird, ist auch thematisch ein mißlungener Neubau, der nicht in dieses Gefüge gehört.
Ich wollte
Imperfekt: Zeitwort und Zeitort des Erzählers; es weist in die Vergangenheit, doch mit einer der deutschen Sprache eigenen schwierigen Ungenauigkeit. Manche Sprachen, das Tschechische etwa, unterscheiden vollendete von unvollendeten Verben: Wird (mit und in einem einmaligen Tätigkeitsakt) die Handlung abgeschlossen, oder dauert sie als eine Art charakteristischer Zustand des Täters – oder im zweiten Fall besser: des Tuenden – an? „Ich sang“ – sagt das ein Ungeübter, der, von Bitten bestürmt, in einer weinfrohen Gesellschaft einmal eine Strophe zum besten gegeben, oder sagt das die Diva, die Kehlkopfkrebs von der Bühne riß? Das Tschechische kann hier im Verb unterscheiden, doch im Deutschen: Burleske wie Tragik hinter dem Samtvorhang desselben Wortes. „Ich wollte“ – einmalige Willensanstrengung, Affekt der Entschlußkraft, oder langandauernde Spannung? Nun, die Frage mag sich bald müßig ausnehmen, denn schon die nächsten Zeilen werden ein Attentat, also doch wohl eine einmalige Handlung, erzählen, aber vorläufig bleibt die Frage offen, und ob sie sich gänzlich schließt, lehrt erst der Schluß.
Doch abgeschlossen oder nicht – jenes Verb bringt sofort äußerste Spannung, da es den Anfang direkt mit dem Ende verknüpft. „Ich wollte“ – da reizt das Wie des Ausgangs schon mehr als das Was des Anstrengungsziels. „Ich wollte“ – gelingt es, oder gelingt es nicht? Ein unerhörtes Tempo wird angeschlagen – und ein langer Weg, so sieht man, die Seite hinabblickend, erschrocken, steht einem bevor. Hält man ihn durch? Im Roman schlägt man schnell nach, wie’s ausgeht: Kriegen sie sich, oder kriegen sie sich nicht? Beim Gedicht bleibt nichts, als weiterzulesen, und schön wär’s, ging’s konjunktivisch unerfüllbar weiter: „Ich wollte, ich wäre“ – ein Vöglein zum Beispiel, da wüßte man, er würd’ es nie werden; das Wie wäre also klargestellt, und man widmete sich beruhigt dem Was. Aber hier:
meinen König
Meinen König, nicht: einen König, und auch nicht: den König, also weder die Inkarnation eines Machtprinzips noch den Herrscher des Landes, in dem ich lebe, sondern jenen, der mein König ist – was der Territorialfürst zwar auch sein könnte, aber von vornherein nicht sein muß. In. diesem „mein“ herrscht unbedingte Freiheit und in diesem „König“ unbedingte Notwendigkeit. Zu „meinem König“ kann sich keiner ernennen, als „mein König“ kann keiner eingesetzt werden, „meinen König“ kann mir niemand aufzwingen, und versuchte es roheste Gewalt, würde ihn vielleicht meine Stimme so nennen, doch nie mein Gedicht. Dieser König kann eine Person oder eine Idee sein oder auch ein Drittes; der Gläubige nennt Christus so und die Hexe den Satan; es könnte eine Gang und es könnte ein Land sein, das Eis des Nordpols, der Ozean, das Denken, das Sirren des Sands in der blauen Wüste, die Kunst, eine andre Besessenheit; es mag für den Nachbarn das Törichteste, Lächerlichste, ja Widrigste sein – ist es mein König, bin ich sein Lehnsmann, und die Freiheit der Wahl ist die Pflicht zum Dienst. Denn auf das Dienenkönnen kommt es an; nur wer einen Dienst ermöglicht, kann König, nur wer ihn leisten will, Lehnsmann sein. Ob der Geliebte immer „mein König“ wäre? Es müßte der So-Geliebte sein; doch auf jeden Fall ist „mein König“ immer der So-Geliebte, der jeden Nebenbuhler besiegt. Kein andrer wäre seinesgleichen. „Mein König“ ist immer Singular.
töten
„Töten“ ist hier nicht identisch mit „morden“; es ist nicht auf physische Vernichtung als Grundabsicht aus. Die See, wenn sie mein König ist, kann als See wohl nicht getötet werden; sie läßt sich nicht einfrieren noch verdampfen. „Meinen König töten“ kann nur heißen, den, der mein König ist, als eben meinen König entthronen, ungeachtet seiner in Körper oder Idee leibhaftigen Existenz, und nur wenn mein König etwas Lebendiges wäre, könnte dies auch durch Mord geschehen.
Ich wollte meinen König töten
Nichts klingt ungeheuerlicher; nichts scheint leichter als dies.
Ungeheuerlich: Wenn „mein König“ mein König ist, habe ich ihn wählen müssen, weil mein Leben ohne ihn sinnlos wäre. Eine solche Bindung löst nur ein Tod. „Mein König“, das ist kein Karnevalsprinz, kein Bohnenkönig, kein Herrscher auf Abruf, auch nicht ein zeitweiliger Notstandsdiktator, und am wenigsten der Erkorene einer Laune. Als all dies könnte er beginnen; ich mag schon als Kind auf ihn gestoßen sein; er mag sich mir jählings offenbart haben; ich mag ihn durch einen Zufall entdeckt oder erst nach langem Um-und Irrweg endgültig zu ihm gefunden haben: Wenn er mein König geworden ist, habe ich ihm einen Treueid geschworen, und fortan gehört mein Leben ihm.
„Bis daß der Tod euch scheide…“: weil ich es will. Ist mein König ein Lebendiges, kann ich ihn und er mich überleben, wie aber der König einer Idee oder Dämonie? Er mag mich verschmähen, und ich diene ihm weiter; dann hat er mich wohl seit je verschmäht, das ist hoffnungslos und so alltäglich. Was aber, wenn ich entrinnen will, sei es, daß ich den Dienst, nicht ertrage, sei es aus einem andern Grund? Nur mein Eid könnte mich daran hindern, und mein König entbindet mich nicht.
Was also bleibt?
Seinen Treueid brechen, und eben dies heißt seinen König töten, denn dies heißt ja: sein Königtum über mich zerstören, damit ich meines Diensts ledig sei. Das aber ist einzig mir anheimgegeben; „mein König“ hat außer mir keinen Vasallen; nur durch mich ist er ja „mein König“ geworden, und mag er Tausender Andrer König auch sein: mein Vasallentum ist allein mein Entscheid.
Ich brauche nur zu wollen, und ich bin seiner ledig.
Was könnte leichter sein als dies?
Ich wollte meinen König töten
Und wieder frei sein
Wenn einer mein König ist und ich sein Vasall bin, dann ist mein Dienst sowohl Zwang als Freiheit; es entfaltet sich in ihm der Widerspruch, dessen Keim ja schon in meiner Wahl lag. Meine Bindung an meinen König ist der freie Wille meines Zwanges; die Bindung meines Königs an mich der Zwang meiner Freiwilligkeit. Dies Verhältnis nun scheint und erscheint mir stets dann, wenn die Härten des Diensts überwiegen, und das tun sie gewöhnlich, nach der Richtung zum Zwang hin verschoben: Ich sehe als Widerpart meines freien Willens meinen Dienst an, der doch beides, Zwang wie Freiwilligkeit, ist, und in diesem Augenblick schon trennt sich von meinem Willen und verselbständigt sich etwas, was fortan „meine Freiheit“ heißt. Meine Freiheit mein Dienst – so wird mir der Widerspruch von Zwang und Freiwilligkeit nun bewußt, der als Harmonie seiner Einheit „mein tiefstes Glück“ hieß, und das waren jene Augenblicke, die mein Leben nicht mehr vergißt. Doch das Wesen des Widerspruchs ist widerspruchsvoll. Die Harmonie ist nicht sein Alltag; er drängt danach, ausgetragen zu werden, und dieses Drängen ist die Spannung, die ihn und mich mit ihm zusammenhält, damit ich das Werk meines Lebens vollbringe, das anders nicht vollbracht werden kann. Ebendarum bin ich Vasall geworden, ebendarum habe ich Dienst und König gewählt. „Die Freiheit des Künstlers ist, daß er keine hat“, rief Barlach aus, dieser Ritter der Königin Kunst ohnegleichen, und er fügte hinzu: „das verstehe, wer will!“ Seinen König wählen heißt seinen Widerspruch als Antrieb zu seinem Lebenswerk wählen und mit ihm die Spannung zwischen den Polen: tiefste Verzweiflung und höchstes Glück. Beides sind Grenzstationen: Dort begehrt man ins Nichtsein des Todes, hier ins Nichtsein ewiger Lust zu gehen, was auch nichts andres als sterben hieße.
Denn man lebt nur mit seinem Widerspruch.
Freilich: Beginnt er sich zu verschärfen, tritt das Element des Zwangs immer mehr hervor, und bei einem bestimmten Grad beginnt dann die Krise, genauer: die als quälend ins Bewußtsein tretende Krise, denn es gibt auch jenen als Krise nur schwer erkennbaren Zustand der Entschärfung, da dir alles, und mühelos, zu glücken scheint. Diese Krise ist die bedrohlichere: Wenn sie erstarrt, ist’s um dich geschehen: Faulbett der Selbstzufriedenheit, Faulbett der Manier, Faulbett des Errungenen, Faulbett des glatten Funktionierens, es ist die sterilisierende Krise, und ihr Ende heißt Senilität. Die andere, die quälende, ist in der Regel produktiv. In ihr tritt das Element des Zwangs weit über das Element des freien Willens; das bringt über schwierige Strecken voran, doch die Einheit der beiden Gegensätze, der Dienst, der schon vordem als identisch nur mit dem Zwang erschien, wird nun als unzumutbar empfunden; der Zwang schlägt um in Sklaverei; das Vergangene verklärt sich zur Freiheit, und als Freiheit erscheint all das, was nicht Dienst ist; die Einheit des Widerspruchs bricht auseinander, und diese Veränderung verdüstert den Thron.
Höre mein Lehnsmann, sagt da eine Stimme: Ein Fremder ist zwischen uns getreten. Er will mich töten: Beschütze mich! Sieh: Ich bin ganz in deiner Hand! – Töte ihn! tönt eine verworrene Stimme, denn siehe, er ist in deiner Hand! In meinem Namen: Töte ihn! Ich bin der Kaiser Freiheit, und mein Zepter ist mächtiger als das seine! In meinem Reich wirst du glücklich sein!
Ich wollte meinen König töten
Und wieder frei sein. Das Armband
Das er mir gab, den einen schönen Namen
Legte ich ab und warf die Worte
Weg die ich gemacht hatte: Vergleiche
Für seine Augen die Stimme die Zunge
Ich baute leer getrunkene Flaschen auf
Füllte Explosives ein – das sollte ihn
Für immer verjagen. Damit
Die Rebellion vollständig würde
Verschloß ich die Tür, ging
Unter Menschen, verbrüderte mich
In verschiedenen Häusern – doch
Die Freiheit wollte nicht groß werden
Denn die Freiheit kann nie mein König werden, sie ist ein Medium, mehr nicht. Mein König wird mich fordern, solang ich ihm diene: Daß er mir mein Lebenswerk abverlange, das eben ist sein Königtum, und daß ich mein Lebenswerk vollbringe, deshalb wurde ich sein Vasall. Die Freiheit aber ist meine Forderung, und das ja nur, solange ich sie nicht habe, und ich will sie haben als Freiheit zu meinem Werke; Freiheit zu nichts ist leeres Sein. Sie ähnelt darin der Gesundheit: Fehlt sie mir, strebe ich, sie zu erringen, und dieses Streben (der Diktator für eine bestimmte Notzeit) kann mich beherrschen; habe ich sie, ist mein Streben erfüllt, und wenn ich weiter keines hätte, wäre ich bedauernswert. Auf den Dienst, der ein Werk ermöglicht, kommt es an: auf Königs-, nicht auf Götzendienst. Daß ich gesund bin, kann, unter Umständen, meinem Lebenswerk unentbehrlich sein, und ich habe auch ein Recht auf Gesundheit, jedoch ich müßte und würde sie opfern, wenn mein Werk dies Opfer von mir verlangte. „Meine Gesundheit“ könnte nie jemandes König, sie könnte höchstens sein Fetisch sein, ebenso wie „mein Wohlbefinden“, „meine Ruhe“, „mein Seelenfrieden“, ja selbst: „mein Leben“, und ähnlich ist es um die Freiheit bestellt. Sie ist Menschenrecht, und als solches ein Banner, doch ein Banner ist stets nur das Banner des Königs, sonst flattert im Augenblick des Sieges nur ein Fetzen Stoff in meiner Hand.
„Strebe ich denn nach meinem Glück? Nein, ich strebe nach meinem Werke!“
Ich wollte meinen König töten
Und wieder frei sein. Das Armband
Das er mir gab, den einen schönen Namen
Legte ich ab und warf die Worte
Weg die ich gemacht hatte: Vergleiche
Für seine Augen die Stimme die Zunge
Ich baute leer getrunkene Flaschen auf
Füllte Explosives ein – das sollte ihn
Für immer verjagen. Damit
Die Rebellion vollständig würde
Verschloß ich die Tür, ging
Unter Menschen, verbrüderte mich
In verschiedenen Häusern – doch
Die Freiheit wollte nicht groß werden
Das Ding Seele dies bourgeoise Stück
Verharrte nicht nur, wurde milder
Tanzte wenn ich den Kopf
An gegen Mauern rannte.
Der König hat sich ganz in die Hand des Vasallen gegeben, er hat sich in seine sicherste Burg zurückgezogen: in die Seele seines Lehnsmanns, und in dem Maß, da der Lehnsmann gegen seinen König wütet, wütet er gegen sein eigenes Ich.
Der König aber scheint unvernichtbar – es sei denn, man zerstöre sich selbst. Und eben das tut man.
Ich wollte meinen König töten
Und wieder frei sein. Das Armband
Das er mir gab, den einen schönen Namen
Legte ich ab und warf die Worte
Weg die ich gemacht hatte: Vergleiche
Für seine Augen die Stimme die Zunge
Ich baute leer getrunkene Flaschen auf
Füllte Explosives ein – das sollte ihn
Für immer verjagen. Damit
Die Rebellion vollständig würde
Verschloß ich die Tür, ging
Unter Menschen, verbrüderte mich
In verschiedenen Häusern – doch
Die Freiheit wollte nicht groß werden
Das Ding Seele dies bourgeoise Stück
Verharrte nicht nur, wurde milder
Tanzte wenn ich den Kopf
An gegen Mauern rannte.
Den Gerüchten nach im Land die
Gegen ihn sprachen, sammelte
Drei Bände Verfehlungen eine Mappe
Ungerechtigkeiten, selbst Lügen
Führte ich auf.
Die Selbstzerstörung hat begonnen: In dem Maß, als der Widerspruch in der Krise die Einheit seines Gegensatzpaares zerbricht, beginnt jeder Maßstab zu zerbrechen, und alles kommt unter sein Niveau: Königtum wie Vasallentum. Der Vasall legt Dossiers an, und sogar Lügen verschmäht er nicht – und der König? Die Seele tanzte, da er sie berührte… Nein, der König kommt nicht herunter: Die See, die Kunst, der So-Geliebte, das Sirren des Sands in der blauen Wüste, Christus, der Satan, mein Land, das Denken, wie könnten sie denn herunterkommen – was da seine Maße verliert, ist nur das Königtum, dem ich Vasall bin und das als „mein König“ nur ein Abglanz der Majestät des Königs in seiner Leibhaftigkeit ist. Der König bleibt groß, wie er je gewesen; mein König wird Lügen nicht verschmähen: Die Kunst lügt nicht; meine Kunst lügt; wir gleichen uns an. So geht es nicht weiter; so geht es weiter: eine Möglichkeit des Widerspruchs ist ja eben sein Herunterkommen: Unausgetragen und ungelöst, durch äußere Mittel zusammengehalten, siecht er dahin und schleppt sich weiter, sein Zerbrechen wird Faulen und Zerbröckeln, doch man täuscht sich, wenn man das Ende nah hofft: auch verkümmert bleibt er ein Widerspruch. Die Krise wird zum Dauerzustand, und man täuscht sich auch über ihr Kleinerwerden: Der Widerspruch schrumpft, an der Umwelt gemessen, es schrumpft seine Größe nach außen, und es schrumpft seine schöpferische Leistung, aber wir schrumpfen ja mit ihm. Er wird kleiner, da wir kleiner werden, und wir verkümmern, da er verkümmert, doch da wir das im selben Maße tun, verringert sich sein Quälendes nicht. Man stumpft nur ab, und man gewöhnt sich. Es ist halt so, beginnt man zu sagen, und man täuscht sich dabei ein drittes Mal. Was so ist, bleibt nicht, man täuscht sich über seinen Tiefpunkt, den eigenen wie den seines Widerspruchs. Bis dort hinab ist der Weg noch weit, viel weiter, als man wähnt und hofft.
Und zudem: Ist der Tiefpunkt denn mein Ziel? Ich bin doch nicht zu ihm aufgebrochen. Ich wollte meinen König töten… Und eigentlich: War dies denn mein Ziel? Ich wollte meinen Widerspruch lösen. Nun bin ich drin tiefer verstrickt denn je. – Man blickt zurück, doch dahin ist kein Pfad mehr. Man wollte vorwärts und kam herunter. So kann man nicht mehr weiterleben.
Ein Ende muß gemacht werden; von selbst wird es nicht. Man kann seinen König nicht verjagen. Er geht nicht fort, wenn man sagt: Geh fort! Er nimmt den Ring nicht zurück, den man ihm zurückgibt; er duldet, daß man anderen Dienst nimmt. Daß man ihn töten wollte, genügt nicht: Man muß ihn töten. Das aber heißt: Sein Werk verraten.
Ich wollte meinen König töten
Und wieder frei sein. Das Armband
Das er mir gab, den einen schönen Namen
Legte ich ab und warf die Worte
Weg die ich gemacht hatte: Vergleiche
Für seine Augen die Stimme die Zunge
Ich baute leer getrunkene Flaschen auf
Füllte Explosives ein – das sollte ihn
Für immer verjagen. Damit
Die Rebellion vollständig würde
Verschloß ich die Tür, ging
Unter Menschen, verbrüderte mich
In verschiedenen Häusern – doch
Die Freiheit wollte nicht groß werden
Das Ding Seele dies bourgeoise Stück
Verharrte nicht nur, wurde milder
Tanzte wenn ich den Kopf
An gegen Mauern rannte.
Den Gerüchten nach im Land die
Gegen ihn sprachen, sammelte
Drei Bände Verfehlungen eine Mappe
Ungerechtigkeiten, selbst Lügen
Führte ich auf.
Wollte ich ihn einfach verraten
Ich suchte ihn, den Plan zu vollenden
Küßte
Die Stringenz des Gedichts ist schonungslos. Ihr Bezug ist evident: Markus 14, 43-46: „Und alsbald, während er noch sprach, kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern und Knütteln, ausgeschickt von den Hohepriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Der ihn überlieferte, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt: ,Der, den ich küssen werde, der ist’s; den nehmt fest und führt ihn sicher ab.‘ Und wie er kam, ging er sofort auf ihn zu und sagte: ,Rabbi‘, und küßte ihn. Da aber legten sie Hand an ihn und nahmen ihn fest.“
Ich wollte meinen König töten
Und wieder frei sein. Das Armband
Das er mir gab, den einen schönen Namen
Legte ich ab und warf die Worte
Weg die ich gemacht hatte: Vergleiche
Für seine Augen die Stimme die Zunge
Ich baute leer getrunkene Flaschen auf
Füllte Explosives ein – das sollte ihn
Für immer verjagen. Damit
Die Rebellion vollständig würde
Verschloß ich die Tür, ging
Unter Menschen, verbrüderte mich
In verschiedenen Häusern – doch
Die Freiheit wollte nicht groß werden
Das Ding Seele dies bourgeoise Stück
Verharrte nicht nur, wurde milder
Tanzte wenn ich den Kopf
An gegen Mauern rannte.
Den Gerüchten nach im Land die
Gegen ihn sprachen, sammelte
Drei Bände Verfehlungen eine Mappe
Ungerechtigkeiten, selbst Lügen
Führte ich auf.
Wollte ich ihn einfach verraten
Ich suchte ihn, den Plan zu vollenden
Küßte den Andern, daß meinem
König nichts widerführe
Welche Möglichkeit, die Krise zu lösen: die schöpferische Möglichkeit! Du hast alles getan, deinen König zu töten; er hat sich in deine Hand gegeben, und nun, da es den letzten Stoß gilt, gibst du dich in deines Königs Hand! Denn dies ist der tiefe Sinn einer Krise: den Widerspruch auf die Spitze zu treiben, gleichgültig, was danach geschehe, denn geschehn muß danach das Notwendige, und das ist: der neue Widerspruch! Ich mußte meinen Widerspruch lösen; ich mußte meinen König töten; ich konnte meinen König nicht töten, denn mein Dasein ist nichts ohne ihn! Nun heißt es: Er oder Ich, und ich sage: Er, und ich küsse den Andern, mag danach geschehen, was immer geschieht! Damit endet dieses Gedicht, und es muß hier enden: Es ist Gleichnis, und nicht Allegorie. Aber daß es geschrieben wurde, sagt eines: Daß der Andere der Eine gewesen: der König in ganzer Majestät, und ich war sein treuester Vasall… Mein Tod oder mein König, und jedes: meine Freiheit; es ist die Krise zum Tode gewesen, und nur wer sie durchsteht, ist des Königs Vasall. Le roi est mort, vive le roi… Der auszog, seinen König zu töten, hat seinen König wiedergewonnen: erneut, erneuert, und: mein König! und ich, erneuert, erneut: meines Königs Vasall! Ihm zu dienen wie je: mein Werk und mein Leben; und mein Dienst aufs neue: meine Freiheit mein Zwang… Der Widerspruch hat sich reproduziert, aber nicht als Wiederkehr des Alten. Keiner ist geblieben, wie er gewesen: mein König nicht, sein Vasall nicht, sein Dienst nicht, sein Werk nicht: Die Krise zum Tode war schöpferisch.
Sie hätte auch tödlich enden können.
„Ich wollte“ – vollendet? unvollendet? Vollendet als Niezuvollendendes. Was sprachbedingt ungenau schien, hat sich als höchst präzis erwiesen. Ich wollte meinen König töten – es ist getan, und ich werde es stets wieder wollen müssen. Den Widerspruch meines Lebens lösen heißt das Leben seines Widerspruchs immer wieder erneuern. Die Krise ist nichts als ein Ausdruck des Schöpferischen. Freilich:
Ich bin
Der schöne Vogel Phönix
Aber durch das
Flieg ich nicht wieder
Wenn es Vogel Phönix ist: Lebenslang.
Wie aber, durchfährt es plötzlich den Leser: wie aber, wenn dieser unvergleichliche Kuß des Andern am Anfang jenes Prozesses gestanden hätte und diese Zeilen nur geschrieben wären, um Untreue zu rechtfertigen? Eine höchst geistreiche Apologie – könnte man dieses Gedicht nicht auch so lesen? Was spräche dagegen?
Dieses Gedicht spricht dagegen, und zwar vehement. Ausrede läßt sich so nicht erfinden, so hinreißend und so erschütternd nicht. Und man kann hier auch gleich Unterstellungen abtun, die dieses Gedicht als eine Art politischer Schlüssellyrik nehmen. Sie verstehn den gesellschaftlichen Bezug von Dichtung auf ärgerlich schadenstiftende Weise. „Mein König“ wird so weder inthronisiert noch getarnt; hier wird, nebenbei, überhaupt nichts getarnt, hier wird mit erschütternder Aufrichtigkeit und höchster Kunstpräzision ein innerer Prozeß abgebildet, der – und das eben ist ja das Wesen der Lyrik und überhaupt der Literatur – in seinem Symbolgehalt auch zur Anwendung auf Soziales freisteht, wenn dort analoge Prozesse erscheinen, und in den gewiß auch soziale Erfahrung eingeflossen ist. Doch solche Züge werden eben dann verdunkelt und mystifiziert, wenn Unangemessenheit sie auf ihre Dimension zurechtgestutzt. Dann wird ein Bekenntnis radikaler Liebe zu seinem König aufs oberflächlichste mißverstanden und dadurch Gesellschaft wie Literatur herabgesetzt. Ein König, der sich auf solche Beflissenheit stützen müßte, hätte diese Verse nicht verdient, und sie wären seinetwillen auch nie entstanden.
Dichtendes Ich, gedichtetes Ich – das Ich des Lesers fragt nicht mehr danach. Hier ist Erfahrung Wort geworden; hier vermochte Lyrik einen Prozeß schwierigster, weil ebenso lapidarer wie differenzierter menschlicher Wirklichkeit so einfach und unausschöpfbar zu fassen, wie das Zeichen √2 oder log 2 eine Zahl faßt, die, wiewohl von schärfster Exaktheit, in Ziffern allein unausdrückbar ist. Und nun geschicht etwas Seltsames: Gerade durch diese Exaktheit verführt, wird die Versuchung übermächtig, das Gedicht als Allegorie zu lesen, also zu fragen: Wer wären die Häscher, wer schwänge die Geißel, wer schlüge schließlich den Verratnen ans Kreuz? Damit zerstörte man das Gleichnis. Lyrisch präzis heißt nicht: platt identifizierbar; es heißt: das Gleichnis mit höchster innerer Genauigkeit.
Eben das leistet dieses Gedicht. Das Gleichnis hält stand, und dies um so geschmeidiger und zäher, je mehr man ihm zusetzt. Es ist ja nicht wahr, daß man Gedichten nicht zusetzen dürfe. Ich gestehe: Dem da habe ich zugesetzt, und es mir.
Jedes Gedicht lädt ein, es zu töten. Gelänge es, wäre wenig verloren. Gelingt es nicht, ist viel gewonnen: Man erführe, als Besiegter siegend, die magische Macht der Poesie.
Eu
Eu Regen Schnee Gewitter Hagelschlangen
…
Mit ihr in eure Kammer gehst Eu Gott!
Nur in dieser Stadt: An zwei Kapitälen ein Blatt jener Blume, um die Oberon Puck in die Winde warf.
„Eu“ – eine neue Interjektion. Wie hatten wir ohne sie leben können; wie kommt’s, daß sie vordem keiner gefunden hat? Aus einem Idiom, das endgültig ins Witzblatt verbannt schien, wurde lyrische Wirklichkeit gezaubert, und gleich eine voll ebenso entzückendem Charme wie düster-entschloßner Verhaltenheit. Franziska verschmilzt hier mit Hekate, und drohende Wut kann draus ebenso klingen wie naiv-staunendes Überraschtsein.
Eu – welche Schöpfung, welch Sprachgewinn! Merket: Im Hervorbringen einer Partikel kann mehr poetische Erfindungskraft stecken als im Gesamtwerk so manches Poeten.
Diese Silbe wiegt Dutzende Bände auf.
DON JUAN KOMMT AM VORMITTAG
Don Juan kommt am Vormittag
So schrieb er im Telegramm was
Mich nachdenken ließ ich hatte den Mond
Eingeplant und Fontänen nun blieb
Nicht viel Zeit nicht mal die Augen
Größer malen die Füße nicht waschen
Ich stand wo sie anfängt die Stadt sah ihn
Im wehenden Mantel auf einem Rennrad
Den weißen Schal von der Schulter flattern
Herannahn die Lippen zersprungen und tief
Lagen die Augen ich fragte ihn
Weshalb er so früh sei sicher später
Ein Rendezvous mit einer Schönheit
Achwasdummheit er stellte das Rad
Schräg in die Luft er nahm den Hut ab
Legte uns beide ins Gras das rings
Üppig zu werden begann zog Vögel
Aus Metall auf die fingen zu singen
An daß es schallte Variationen
Über ein Thema von Mozart ich kenn das
Sagte er und alle Platten-
Spielersysteme Schönberg und
Ich werd dich jetzt das wird aber gut sein
Der Pranger am Markt; gehörnte Maske, und am Pfahl: Hals- und Fußeisen solidester Schmiedekunst. Wen diese gezackten Bänder halten, der kommt nicht mehr frei.
Variation über ein Thema von Mozart: eine Mythengestalt im tiefsten Heruntergekommensein. Es ist lehrreich, die Merkmale dieser Endgestalt herzuzählen: Mechanisiertheit, Rationalisiertheit, Konfektioniertheit; und vor allem: Reduzierung auf die Sphäre der Konsumtion.
Don Juan: Vor der Lust des Verbrauchs stand die Lust des Eroberns: „Ein Weib verführen und entehrt entlassen“. Dieser will nur noch Verbraucherfreuden; daß die größere Lust im Erobern liegt, weiß er nicht mehr, denn Eroberungsmühn hat er längst nicht mehr nötig. Er und seine Opfer, sie haben sich gegenseitig heruntergebracht: Donna Elvira (oder, wenn man der würdigsten Don-Juan-Deutung, der E.T.A. Hoffmanns, folgen will: Donna Anna) bietet sich an auch noch nach der Entlassung, und Don Juan verschmäht sie auch dann nicht: mein König in äußerster Schäbigkeit. Vormittags, und als Risiko Portospesen, das ist Don Juan; mit eingeplantem Mond und gewaschenen Füßen, das ist Donna Elvira. Das eine ist des andern würdig: Elvira verliest selbst Leporellolisten, nein, schlimmer noch: sie fragt sie ab, und kein Gouverneur mußte vorher durchstochen, kein Sbirrenhaufen zersprengt, kein Rächer überlistet sein. Nicht die Erde, nur das Gras tut sich auf, zu verschlingen, und der Opernschluß des „Sieg des Guten“ erlebt hier die höllischste Parodie. Dazu, selbstverständlich, Musik aus der Dose.
Und dennoch ist es Don Juan, auch ohne den Steinernen Gast und ohne Zerline. Man kann ihn an zwei Attributen erkennen: mytho-ikonologisch: am wehenden Mantel; charakterologisch: am Rennrad, dem letzten Stück Wagefreudigkeit.
Dieser Don Juan ist eine Folie, von der sich viele Stücke dieses Buchs abheben, so auch der große Mythos von „Playboy und Cowboy“. Hier sind Don Juans optimale Möglichkeiten von heute gezeichnet, und dies mit einer traumklar offenherzigen Großmut, die beste Frauenmöglichkeit ist. Man hat dieses Buch in das Modegerede von Emanzipation gestellt. – Nun: Die nobelste Selbstbefreiung wäre die Befreiung zur Wahrheit gegen sich selber und sein Geschlecht. Dies Gedicht ist wahrhaftig auf eindringlichste Weise: Es zeigt Don Juan nicht als Argument, sondern als Spiegel. Die ihn amalgamierte, schreckt nicht zurück, ihn zu gebrauchen. Die ihn brauchen müßten, schaun nicht hinein, doch sie emanzipieren sich, und vor allem uns, und schimpfen auf die Spiegelmacher.
Umgang mit Schäbigem kann zurückwirken; dann entsteht schäbige Poesie. Dies hier ist ein großes Gedicht, souverän seine Wahrheit, unheimlich seine Nuancierungskraft; es bietet sich an, daß man’s mißverstehe. Die Schlußzeile ist der Tiefpunkt möglichen Liebesgesprächs: Die im Deutschen nun einmal vulgär klingenden Verben für den Geschlechtsakt wären in diesem Kontext ein Grad Humanisierung des Sprechers, doch da es um Mechanisiertheit geht, verlöre, würden sie ausgesprochen (lautlich klingen beide Verben an), das Gedicht um viele Grade an Humanität wie Sprachgestalt.
Hier könnte der Ort sein, ein paar Worte zu jener Form zu sagen, die man euphemistisch „freie Rhythmen“ nennt. Diese hier lassen den spanischen Dramentrochäus durchrattern (wie durch andere dieses Buches, je nach Funktion, der Blankvers Shakespeares oder Dantes Terzinenjambus oder auch Vossens Hexameter tönt), doch selbst wenn sie ohne diese geistreiche Beziehung zum Urstoff blieben – hier wäre ihre Verwendung erlaubt. Denn eben um das Gestattetsein geht es. Man greift fehl, wenn man diese Versart nur formal als Versart zu fassen versucht und Hebungen und Senkungen abzählt. Ob man sich ihrer bedienen darf, ist eine Inhaltsfrage; man muß etwas zu sagen (oder zu stammeln oder zu heulen, zu keuchen, zu prophezeien, meinetwegen auch: zu schweigen) haben, was anders sich nicht ins Wort bringen ließe. Daß man jedes Gebilde freier Rhythmik auch zusammenhängend als Prosa hinschreiben kann, beweist noch wenig – solcherart hinschreiben könnte man auch ein Sonett oder eine sapphische Strophe, und beim Hexameter fiele es kaum auf. Der entscheidende Einwand bestünde von Fall zu Fall in dem Nachweis, daß schon die Prosaform überflüssig gewesen wäre, geschweige also die des Gedichts. Überflüssige Lyrik ist schlechter als schlechte: Diese kann noch als Lehrbeispiel dienen; nur mittelmäßige zu gar nichts mehr. Wenn ich eine Hexe in Diensten hätte – die hexte mir aber Berge Gedichtetes weg! Doch so wird munter weitergeschrieben: Sie haben nur Längstgewußtes zu sagen, deswegen fühlen sie sich berechtigt, auch keine Formen zu beherrschen. Es ist ein bißchen gar zu wenig. Wenn solche Stimmen verstummen, ist weniger als nichts gewesen: Ärgerliches.
Wer freie Rhythmen gebrauchen will, muß sich legitimieren. Ein Hinweis auf Bobrowski genügt nicht.
Aber nicht nur Don Juan und Donna Anna sind im Verlauf einer polarisierenden Entwicklung heruntergekommen: Viele Leser verschmähn die Mühe des Eroberns von Gedichten ebenso wie viele Dichter die Mühe des Eroberns der Leser. Jene: Ich werd dich jetzt lesen, nun tu dich schon auf, und beim ersten Mal, und sofort, und keine Sperenzchen, und die Gedichte, die sich ihnen da auftun, sind auch danach. Der Gegenpol: Jene Art der Verschlossenheit, die aus der Not des Unvermögens eine Tugend des Grundsätzlichen macht. Dort: die Leere, und nichts davor; da: die Barriere, und nichts dahinter.
Jene Leser: heruntergekommene Don Juans; jene Dichter: heruntergekommene Donna Annas. Freilich sind sie nicht gleichzusetzen. Aber sie sind Endprodukte.
Bliebe ein Blick auf die Donna-Elvira-Gebilde, jene Gedichte, die sich jedem öffnen, ohne mehr zu bieten als bereitwillige Leere. Ihre Merkmale sind die Standardkennzeichen allen Heruntergekommenseins. Mit dem eigenen Inhalt ist auch die eigene Form verlorengegangen; die Konfektioniertheit ist offensichtlich; das Element der Rationalisierung steckt im Kalkül aufs Opportune, und die Mechanisiertheit ist im Prinzip auch da, nur: im Handbetrieb kommt’s billiger. Der Computer müßte programmiert werden, aber das wäre eine Art Stilbruch: Solche Gebilde bewegen sich – den Schöpferakt eingeschlossen – nur in der Sphäre der Konsumtion.
NACHRICHT AUS LESBOS
Ich weiche ab und kann mich den Gesetzen
Die hierorts walten länger nicht ergeben:
Durch einen Zufall oder starren Regen
Trat Wandlung ein in meinen grauen Zellen
Ich kann nicht wie die Schwestern wollen leben.
Nicht liebe ich das Nichts das bei uns herrscht
Ich sah den Ast gehalten mich zu halten
An anderes Geschlecht ich lieb hinfort
Die runden Wangen nicht wie ehegestern
Nachts ruht ein Bärtiger auf meinem Bett.
Und wenn die Schwestern erst entdecken werden
Daß ich leibhaft bin der Taten meines Nachbilds
Täterin und ich nicht meine Schranke
Muß Feuer mich verzehren und verberg ichs
Verrät mich bald die Plumpheit meines Leibes.
Der andere Zentralbau: Der Turm. Quadern; nach dem Markt hin Scharten, und Gewölbe und sich verengende Gänge tief hinab in die Unterwelt.
Ein Gleichnis im historischen Gewand: Sappho; Lesbos; eine lüsterne Überlieferung. Sie ist falsch: Die Mädchenzirkel auf Lesbos, deren berühmtesten Sappho leitete, waren Vorbereitungskurse zur Hochzeit; sie lehrten, einschließlich der erotischen, frauliche Kultur und entließen die Absolventinnen in die Arme des Bräutigams.
Hoch das Dach
aaaaaHymenaios!
Erhoben, ihr Zimmerleute!
aaaaaHymenaiosl
Es kommt der Bräutigam, gleich dem Ares!
aaaaaHymenaios!
Viel größer als ein großer Mann!
aaaaaHymenaios!
Dies – eine Strophe der Sappho – eine historisch-authentische Nachricht von Lesbos; „Lesbos“ ist eine Männererfindung, und sie wurde von Männern begierig tradiert. Doch wenn die Logik in ihrer großherzigen Strenge den Schluß vom Unwahren auf Wahres als insgesamt wahre Aussage wertet, darf auch der Dichter das Recht geltend machen, von der Kolportage zur poetischen Wahrheit zu gehen. Sein Lesbos wird Lesbos und wahr selbst als „Lesbos“ sein, wenn das Gleichnis nur in sich wahr ist und eine Erfahrung artikuliert. Der Einwand mancher Geschichtslehrer soll ihn dann am allerwenigsten kümmern; die leben in dem Wahn, daß Dichtung nur geschaffen werde, ihnen Fachunterrichtshilfe zu geben. Unterrichtshilfe gäbe sie schon: sie lehrt Erfahrung. In diesem Fall: nicht mit Homoerotik, sondern mit dem Linearen, und nicht nur die Mathematik profitierte davon.
Erfahrung mit dem Linearen, abgebildet im Gleichnis: Lesbos, ein Frauenstaat mit Gesetzen, die Liebe zum andern Geschlecht verbieten und mit dem Feuertod bedrohn. Gegen dieses Gebot die notwendige Revolte, und, dem Wesen solcher Despotie nach, notwendig individuell. Im individuellen Charakter stimmt sie mit der mißlungenen Rebellion gegen den, der „mein König“ ist, überein, sonst ist sie deren genaues Gegenteil: nicht Entfaltung, sondern Verkümmerung menschlicher Kräfte; nicht frei gewählte Bindung als Antrieb zum Vorwärtsschreiten, sondern Feßlung ans Überkommne und damit Stagnieren; nicht innerer Widerspruch, sondern äußeres Hemmnis: die Indoktrinierung der Widerspruchslosigkeit als oberstes Gesellschaftsprinzip. Lesbos: Nicht die gleichgeschlechtliche Liebe wird attackiert, sondern die Formung des Menschen nach einem Bilde, das weniger als ein Menschheitsbild ist, weil der ganze Mensch in ihm nicht aufgehen kann. Lesbos: die zwangsweise Festlegung aller auf den Sonderfall des Verlangens wie Begnügens im Gleichgearteten und die Erhebung dieses engen Verhältnisses zur ausschließlichen Norm. Was mir schon als Kind einen Stich ins Herz gab: „He, Sie sind hier in Deutschland, hier wird deutsch gesprochen!“ Im Geistigen das, was Dogmatismus, im Ästhetischen das, was Klischierung und Provinzialismus, in jedem Menschenbereich das, was für ebendiesen Bereich das Unschöpferische heißt. Lesbos ist die Verurteilung zur Sterilheit.
Noch einmal: Man darf nicht vergessen, daß es hier um das Gleichnis und nicht um Sexualmoral geht. Gerade Hexen teilen nicht die Meinung, daß Liebe nur der Fortpflanzung dienen und Homoerotik darum verpönt werden müsse; nur: bei zwangsweiser Zuordnung zum gleichen Geschlecht stirbt die Menschheit aus, und schon vorher ihr Menschsein. Die gleichgeschlechtliche Frau ist um nichts schlechter oder besser als die heterosexuelle, nur eben andersgeartet, und würde es ihr verwehrt sein, die Lust nach ihrer Art zu finden, verarmte ihr Menschsein. Es mag nun Naturen geben und gibt sie, und sie sind um nichts schlechter oder besser als andre, nur andersgeartet, die geistige und ästhetische Lust ausschließlich aus der Wiederbegegnung mit ihrem eigenen Naturell ziehen, das aufs unbeschwert Spaßige und harmlos Ergötzliche aus ist, aufs humorig Problemlose und gemütsfroh Verklärende, nicht auf Wachstum, sondern auf Selbstbestätigung durch stetes Reproduzieren der Illusion, daß ihr Horizont darum der Horizont aller sein müsse, weil er die eigene Welt vollkommen begrenzt. Sie sollen Befriedigung finden und finden sie ja, nur müssen sie sich aus dem Irrglauben lösen, daß ihr Verlangen und Begnügen dem aller Mitmenschen kongruent ist. Freilich gehört grade dieser Irrtum zu ihrer Selbstbestätigung, darum zwingen sie Andere gern zu dem, was ihr eigenes Glück tatsächlich ist, und sei es mit dem Scheiterhaufen. Ihr Glück fänden sie allerorten; aber: Es soll das aller sein. Sie sind besorgt ums Allgemeinwohl, vor allem, was Bildung anbelangt. Um einen alten Witz abzuwandeln: „Wissen Sie, Deutsch ist die einzige Sprache, die etwas taugt, da versteht man ein jedes Wort!“ Dies wäre ein Irrtum selbst dann noch, wenn statt „man“ da „ich“, stände, aber es zeigt die Prätention.
„Eindeutig muß das Gedicht sein… Und Neues will ich sehen! Von den nicht direkt politischen oder weltanschaulichen Gedichten wünsche ich mir, daß sie lebensbejahend sind, daß sie positive Wirklichkeitsbeziehungen erkennen lassen, daß in ihnen Sinnesfreude sind und vergnüglicher Spaß am Phantastischen“. Das ist so ein kleines Scheiterhäuflein, denn dieser Wunsch, der als individuelles Verlangen auch mit grammatikalischen Fehlern ein gutes Recht wäre, soll ja nicht dadurch befriedigt werden, daß entsprechende Lektüre für den Wünscheäußernden bereitgestellt würde, sondern daß nichts andres entstehe als eben das, was seinen Wunsch deckt… Das Zitat ist eine Kritik an den „Zaubersprüchen“ und läuft auf Inhibierung, hinaus, und damit auf ein Klima des Unschöpferischen. Alles eine Richtung: eben das Lineare; letzten Endes: die Widerspruchslosigkeit. Doch auch im Gleichen entsteht ein Widerspruch: der gegen das Gleiche.
„Nicht liebe ich das Nichts das bei uns herrscht…“ Natürlich hat dieses Bild in einem Gleichnis, das in der erotischen Sphäre daheim ist, auch einen sexuellen Bezug, doch nicht nur diesen. Das Nichts ist der widerspruchslose Widerspruch. Das Nichts ist das Fehlen des Anderen. Ob linear oder platt – es ist das Zuwenigdimensionale. Daß es „den Schwestern“ genügt, ist kein Beweis. Es muß, um gesellschaftsbestimmend zu sein, allen Elementen der Gesellschaft genügen können.
Nichts gegen die „Schwestern“, nur: sie sind nicht das Maß aller.
Auch in dieser Gesellschaft sind Hexen daheim.
DER BÖSE BLICK
Auf die Postille gestützt nah am Herde
Seh ich ihn sitzen, das Aug auf den Knochen
Dessen, das einstmals ein Vogel gewesen ist
Zahm und nicht die bewegliche Sorte
Die uns im Freien den Himmel verschönt.
Allerorten: Stein- und Schnitzwerk von der Art der Hasenrosette im Dom zu Paderborn: Drei Hasen, laufend im Kreis, und insgesamt nur drei Ohren, und jeder Hase trägt doch deren zwei.
Das ist beste Hexenkunst.
Ein Stilelement dieses Buchs ähnelt jenem Steinscherz, der nun genau beschrieben sei: Ein Fensterrund, drei Hasen im Kreis am Innenrand laufend, die Köpfe gegen die Mitte gerichtet, und die Mitte des Kreises ist geometrisch genau der Mittelpunkt eines Dreiecks, das von den Innenkanten der insgesamt drei Hasenohren gebildet wird. Das geht so zu: Das linke Ohr des unten laufenden Hasen ist gleichzeitig das rechte seines im Uhrzeigersinn, also links von ihm die Kreisinnenwand hinauflaufenden Vorderhasen, dessen linkes Ohr wiederum gleichzeitig das rechte Ohr jenes Hasen ist, der von rechts herab den unteren Hasen verfolgt und dessen – des unteren Hasen – rechtes Ohr als sein linkes trägt. Jeder Hase hat dergestalt zwei Ohren, linkes und rechtes, wie es sein muß, und da jedes zugleich ein Ohr seines Vorder- und Hintermannes ist, kann man ebensogut auch sagen: Jeder hat keines, und die Summe der keinen wäre dann ebenso drei, wie die Summe von dreimal zweien drei ist. Man versteht: das Hexeneinmaleins.
Im Lyrischen sieht das nun so aus:
… wir schwammen
Nun schneller, es wallten die Bäume, die Möwen
Auf den Balkonen, da standen sie, lachten und flochten
Dir nicht mir Federn ins Haar…
Wie ist diese Episode eines Hexenflugs zu verstehen? Wem flochten die Möwen da Federn ins Haar? Durch zwei Kommata wird Klarheit geschaffen:
„… da standen sie, lachten und flochten dir, nicht mir, Federn ins Haar…“
Wie anders: Die Möwen sind Weiber und schmücken den Mann!
Aber nein, da steht ja das Konträre:
„… da standen sie, lachten und flochten dir nicht, mir Federn ins Haar…“
Wie anders: Die Möwen sind Weiber und schmücken die Schwester, die Geschlechtsgenossin, und deren Stolz kommt ganz durch die Pause zum Ausdruck, die man zwischen dem „nicht“ und dem „mir“ mitzulesen hätte! Aber da dieses „nicht“ nun einmal so zauberträchtig ist, könnte es sich doch auch als elliptisches Element auffassen und zu seiner Verdoppelung durch den Leser einladen lassen: „… da standen sie, lachten und flochten dir nicht, nicht mir Federn ins Haar…“, was eigentlich ja das logischste wäre, denn wer Möwen nur ein wenig kennt, weiß, daß sie mit ihren Federn geizen.
Wie also ist das zu verstehen? Am besten wörtlich, ganz so wie es dasteht:
„… da standen sie, lachten und flochten dir nicht mir Federn ins Haar…“
Es ist unentschieden, denn es ist unentscheidbar: Es geschieht ja im Vorbeiflug des Liebespaares an den verharrenden Möwen; Bewegungen her- und hinauf, wem gilt da der Gruß und die Feder: den beiden, und beiden nicht, denn sie verliert sich −: Durch die grammatische Unbestimmtheit wird der Charakter des Flugs präzis bestimmt, und der Leser erlebt den Vorgang des Fliegens, den Flug als Prozeß und in seinem Prozeß.
Überinterpretiert?
Man könnte diesen Vorwurf erheben, wenn dies die einzige Stelle solcher Stilgestalt wäre, allein es ist ein Stilelement. Dies Traumhafte, Fließende, dies im scheinbar Ungenauen gerade Genaue und höchst Genaue ist ein Wesenszug dieser Zaubersprüche, und sein Sprachausdruck ist nicht modische Spielerei, wie in diesem Buch überhaupt sehr viel weniger Verspieltheit ist, als mancher Kritiker so denkt:
Die Leute verkennen es geht um ernsthafte Dinge
Wie komisch sagen sie erzähl ich ein Unglück
Wenn sie lachen müßten, erschrecken sie…
Verspieltheit auch nicht in der sparsamen Interpunktion, die ist aufs exakteste eingesetzt, etwa die (außer einem Doppelpunkt) einzigen drei Zeichen in der „Nachricht aus Lesbos“, die Schlußpunkte hinter jeder Strophe, die hier wirklich Schluß-Punkte sind, Abschlüsse je eines – und welchen! – Aktes, Verwandlung eines Berichts in den Ablauf eines Geschehens, aufs äußerste konzentrierte Zeit. Oder der einzige, durch ein Enjambement von Strophe zu Strophe verstärkte Punkt im „Mai“, der das Tödliche von der Idylle schon da absetzt, wo diese noch weitergeht, und nicht erst in der Reflexion. Man stelle sich, um dies nachzufühlen, jenes Gedicht für einen Augenblick mit veränderter, und zwar nur um die Stellung des einzigen Punkts veränderter Zeichensetzung vor, und man wild durch diese winzig anmutende Operation den einen, äußerlich unveränderten, Vorgang (ein Rettungswagen fährt durchs Charitétor) in zwei durchaus miteinander nicht deckungsgleiche Erlebnisinhalte divergieren sehn können.
Das Original:
MAI
Auf dem Dach der großen Klinik
Sitzen feiertags die Kranken
In gestreiften Bademänteln
Legen Finger auf die Wunden
Rauchen eine Zigarette
Auf der Erde ist das Gras grün
Gelbe Blumen sind darin
Und die weißen Küchenfrauen
Ziehen Karren mit Kartoffeln
Fleisch Kompott Gemüse. Wieder
Kommt ein Krankenwagen
Mit der Fahne und der schrillen
Stimme die um Eile schreit
Ach ich seh dich blütenblaß
Neben deinem Auto liegen
Und dagegen nun die um eine einzige PunktsteIlung veränderte Fassung:
Auf dem Dach der großen Klinik
Sitzen feiertags die Kranken
In gestreiften Bademänteln
Legen Finger auf die Wunden
Rauchen eine Zigarette
Auf der Erde ist das Gras grün
Gelbe Blumen sind darin
Und die weißen Küchenfrauen
Ziehen Karren mit Kartoffeln
Fleisch Kompott Gemüse wieder
Kommt ein Krankenwagen
Mit der Fahne und der schrillen
Stimme die um Eile schreit.
Ach ich seh dich blütenblaß
Neben deinem Auto liegen
Dahin. – In der Originalfassung ist die „Stimme die um Eile schreit“ in ebenjenem Punkt schon da, ehe noch das Bild des Wagens da ist. Der Schall lief voraus. Oder: Wie unabdingbar die völlige Interpunktionslosigkeit in „Grünes Land“ und „Keiner hat mich verlassen“, oder die Notwendigkeit des Kommas in „Probe“ gleich nach dem ersten Wort, oder – doch man sehe selbst. Und hat man, um zu dem Mai-Gedicht zurückzukehren, hat man entdeckt, daß dort ein Wort wieder eine Doppelfunktion, und diesmal eine metrische, hat, nämlich eben das Enjambement-Wort hinter dem Schlußpunkt? Es ist genau das Hasenohr, es schließt die Vorderzeile rhythmisch ebenso ab, wie es rhythmisch die Anschlußzeile eröffnen würde, in der nun, da dieses Wort nicht dort steht, ein prosodisches Loch klafft: die Schrecksekunde nach dem Ertönen des Martinshornes:
Ziehen Karren mit Kartoffeln
Fleisch Kompott Gemüse. Wieder
Das sind vierfüßige Trochäen.
Wenn dieses letzte „wieder“ nun die nächste Zeile eröffnen würde, also: „Wieder kommt ein Krankenwagen“, wäre sie ebenfalls ein vierfüßiger Trochäus, und wenn das gesamte Gedicht in solchem Rhythmus ungestört liefe (natürlich könnte dann nicht zweimal hintereinander „wieder“ stehen, man müßte eine der Zeilen ein wenig umbaun), bliebe alles in dieser Sonntagnachmittagmaiidylle.
Im Zusammenhang sähe dies dann etwa so aus:
…
Ziehen Karren mit Kartoffeln
Fleisch Kompott Gemüse wieder
Kommt durchs Tor ein Krankenwagen
Mit der Fahne und der schrillen
…
oder gar:
…
Ziehen Karren mit Kartoffeln
Fleisch Kompott Gemüse Kuchen
Wieder kommt ein Krankenwagen
Mit der Fahne und der schrillen
…
Dahin, dahin!
Jedes Formelement mit höchster Präzision verwendet! Welche Genugtuung, daß man Gedichte so schonungslos erproben kann!
Wird man mir’s nachsehen, daß ich, von solcher Fedrigkeit hingerissen, auf noch zwei solcher Stellen (von vielen) aufmerksam mache: In der „Ode“ (nicht dem stärksten Gedicht) eine schöne Doppelfunktion der Sonne, dazu noch als Zeugma, zuerst Akkusativ, dann Nominativ, also eigentlich ganz was Verbotenes, aber hier, als ein bißchen ironisierend, durchaus treffsicher eingesetzt:
Und säen und ernten die Sonne
Brennet und bräunt
Den Kühler den pfeifenden Gott…
Und aus dem „Angeln mit Sascha“ nur diese Stelle (und wieder könnte man mehr anführen):
Beiß mal die Bleikügelchen fest
Ich kann doch was siehst du
Nämlich:
„Ich kann doch was! siehst du?!“
Aber auch:
„Ich kann doch – was siehst du?“
Was siehst du??
Das ertrunkene Mädchen.
Das ist, ich sag’s ruhig zweimal, keine Spielerei, das ist ein Inhaltsmoment:
Er hält meine Angel sagt was von Täubchen
Wen meint er von uns rings gibts nur zwei Mädchen die eine ist tot
Doch nun zum „Bösen Blick“. Nochmals das Gedicht:
Auf die Postille gestützt nah am Herde
Seh ich ihn sitzen, das Aug auf den Knochen
Dessen, das einstmals ein Vogel gewesen ist
Zahm und nicht die bewegliche Sorte
Die uns im Freien den Himmel verschönt
Wer hat da eigentlich den bösen Blick?
„Auf die Postille gestützt nah am Herde / Seh ich ihn sitzen“ – wer ist da, nah am Herd, auf die Postille gestützt, der Sitzende oder die Sprecherin?
„Das Aug auf den Knochen dessen…“
Wessen Auge – das der Sprecherin oder des Sitzenden?
„Dessen, das einstmals ein Vogel gewesen ist…“
Wer: das Huhn oder der Sitzende?
„Zahm und nicht die bewegliche Sorte / Die uns im Freien den Himmel verschönt“ – der Vogel oder der Sitzende oder die Sprecherin, die ja, das wissen wir, beide fliegen können? All dies, und Kombinationen all dessen, kann möglich sein. Was wir hier erleben, ist der böse Blick in Aktion, der Prozeß der Verhexung. Zauberei: nicht als Resultat noch als Stoff: im Prozeß.
Bisher galt als Axiom, daß ein Stück Literatur sein Thema oder Objekt nicht real reproduzierend darstellen könne, also nicht ein Gedicht über die Langeweile als Langeweile im Gedicht. Hier ist, ohne viel Aufhebens zu machen, ein Gestaltungsprinzip entwickelt worden, das erfolgreich diesem Axiom widerspricht.
Dieses Gedicht ist ein Hexenblick.
GRÜNES LAND
Wenn der Kuckuck ruft den hörst du nicht bin ich weit
Grünes grünes Land zwischen mir und der Stadt
Ich zieh ins Haus zwischen die Arme des Flusses
aaaaaAber was tu ich ich fang keinen Fisch
aaaaaVerstehe die Stimmen der Krähen nicht
Wiesen Koppel zu Türmen gehaunes Gras Schonungen der Hochwald
Ich sehe gebogene weidende Pferde sie sind gar nicht da
Nur einmal ein Kopflaus dem Stallfenster
aaaaaAch und ich lief auf beuligen Wegen
aaaaaFort aus der Stadt
Ich rauche im Regen traf tagelang keinen Menschen
Nur ein Alter sah übern Zaun hatte Zeitung gelesen
Wenns losgeht sagte er ich hab einen eigenen Brunnen
aaaaaIch nichts aber auf diesem Land
aaaaaBau ich dir vierblättrigen Klee
In der alten Prager Altstadt, erzählt der Gewährsmann, gab es ein Haus mit einem Fenster im Hof, zu dem keine Tür führte, aber manchmal, an gewissen Septemberabenden, zeigte sich dort eine traurige Frau.
Drei Strophen, jede bestehend aus einem dreizeiligen Stollen und einem zweizeiligen, stets anders lautenden Abgesang, ein stilles, vollkommen klares Gedicht der einfachsten und schönsten Bilder. Grünes Land, schöner Fluß, ein Gespräch am Brunnen und das unaufhaltsame Ziehen der ruhigen Illusionslosigkeit.
Ach und ich lief auf beuligen Wegen
Fort aus der Stadt
Erneut das Motiv des Heruntergekommenseins, hier in seiner schmerzlichsten, weil das Erträumteste konterkarierenden Gestalt: Die Wiederbegegnung mit dem verlorenen Paradies, das ist die grausamste aller Entzauberungen und sie zu überstehen das schwerste Lehrstück; nicht nur für Hexen, doch auch für sie.
Der ruhige, stille, stetige Fluß dieser Desillusionierung, dies Fließen im Sinne eines Sich-Füllens und Sich-Erfüllens, das ist die Bewegung dieses Gedichtes.
Im Stollen der ersten Strophe: Grünes Land; zu einer nicht näher bezeichneten Stadt und einem nicht weiter beschriebenen Vergangnen das Andere, und da das Andre als Paradies geträumt ist, wird wohl das Verlaßne die Hölle sein. Paradies: Das Land ist noch Land und nicht Schutt- oder Privatvillen- oder Campinggelände; der Fluß ist noch Fluß und nicht Kloake, auch der Kuckucksruf noch, und ein Haus in den Wiesen, und die Stadt wie das Vergangene ist fern. Und dennoch schon die Dissonanz: in der Verdoppelung des Adjektivs. Das grüne Land, das die Überschrift: uns verheißen und das sich so fern von der Stadt hinbreitet, ist nicht grünes, es ist grünes grünes Land – Paradies im Spiegel einer Seele, die es nicht feststellt, sondern beschwört, da sie es schon gefährdet weiß, und zwar vom unabweisbarsten Feind: von sich selber. Der, der ins grüne Land kommt, um der Stadt und seinem Vergangenen zu entfliehen, trägt Stadt und Vergangenheit in sein Asyl.
„Ich zieh ins Haus zwischen die Arme des Flusses“ – was für ein Bild, und welch ein Vorgang! Doch was soll man zwischen den Armen des Flusses, wenn man nicht einmal einen Fisch fangen kann?
Und was soll man in der Umarmung des Grases, wenn man, eines Kuckucksrufs grade noch kundig, nicht einmal die Stimmen der Krähen versteht?
Im Paradies hat man noch Fische gefangen. Forellen; wir fingen sie mit den Händen, im Hüttenbach, vor den Höhlen im tangigen Stein. Und wir haben nicht nur Vögel verstanden, auch den Wind und die Hügel.
Aber eines, eines ist ja geblieben: das Grün, und Grünes tausendgestaltig: Wiesen, Heuschober, Schonungen, Hochwald, die Koppel, und da müssen ja, Inbegriff des Paradieses, auch noch die freien Pferde sein…
Aber dies Grün ist leer, und schlimmer als leer:
… ein Kopf aus dem Stallfenster
Aber noch: Rauchen im Regen, und Einsamkeit, und der Rauch ist noch Rauch der Zigarette, und der Regen noch der Regen wie einst… Doch der Nachbar hat die Zeitung gelesen:
Wenns losgeht sagte er ich hab einen eigenen Brunnen
Mein Eigentum! Ich! Ist man deshalb geflohn, auf beuligen Wegen, mit blutendem Fuß? Das Gedicht sagt uns nichts über die verlassene Hölle, doch der Schluß ist erlaubt: Sie war beherrscht von solch einem Ich. Dort hat es die Liebe besessen. Hier besitzt es das Wasser:
Wenns losgeht sagte er ich hab einen eigenen Brunnen
Was bleibt noch? Nur nüchtern das Fazit: Ich nichts.
Ich nichts – das Nichts ist das Bessere. Freilich: Es ist damit noch kein Brunnen.
Aber es ist der Anfang zum Andern:
… aber auf diesem Land
Bau ich dir vierblättrigen Klee
Vierblättriger Klee, das ist der Glücksklee, und Glücksklee, verstehst du, ist eben das, was sich nicht anbauen läßt. Vierblättriger Klee, der wäre schon ziehbar, aus Samentüten, vom Versandwarenhaus, doch Glücksklee ist er dann nicht mehr. Glücksklee ist das nicht Anbaubare. Man muß ihn finden, das ist es, und die Sprecherin weiß das.
Vierblättriger Klee ist als letztes Wort das Gegenstück zu einem ersten Wort, das grünes Land heißt. Das grüne Land war das grüne Land nicht, und angebauter vierblättriger Klee wird vierblättriger Klee nicht sein. Zwischen beiden: ein Kopf aus dem Stallfenster.
Das verlorene Paradies.
Die letzte Ernüchterung ist vollzogen. Das Maß des Bitteren ist erfüllt.
Was tun?
Vierblättrigen Klee anbaun. In diesem Land, im verlorenen Paradies, das ja nie eines war. Vierblättrigen Klee anbaun, das ist das Andre, und es ist das Einzige anstatt verzweifeln oder den eigenen Brunnen bewachen. Man lebt nicht in Utopien und nicht im Erinnern. Das Paradies ist unwiederbringbar. Der Hölle bist du entflohn. Also: zwischen beiden, und das hieße wohl eben: im Menschenland. Ausgeraucht; der Regen rinnt: Bau vierblättrigen Klee an. Vielleicht wächst doch noch: Grünes Land!
Grünes Land: das ist das Land der Hoffnung, und Hoffnung ist immer da, wo ein Mensch ohne Illusionen ist. Wer nüchtern, mit tapferster Wahnlosigkeit, seiner Umwelt ins Aug sieht, der hat das Recht und die Pflicht zu hoffen, und die Hoffnung birgt das Unmögliche! Ja: Bau vierblättrigen Klee an! Kümmre dich um Glück, da du ein Mensch bist! Und vielleicht findet dein Kind oder mein Enkel beglückt beim Spielen ein noch niemals zuvor geschautes Pflänzchen: Dreiblättrigen Klee.
Ich kann diesen Gang durch die gotische Stadt nicht besser beschließen, als zu einem Ausflug vor seine Mauern einzuladen, in guter Gesellschaft, mit jungen Frauen. Dies Gedicht, in lockeren Hexametern geschrieben, ist ein Stückchen Ilias. Ich will es kommentarlos hinsetzen, Schlußwort, einem Zauberbuch gegeben, das mit Nebel begann und mit Feuer schloß:
DAS GRUNDSTÜCK
Sonntags kommen die Mädchen mit ihren Kindern zum Grundstück
Das sie vor Jahren billig erwarben. Noch immer kein Geld für
Zäune und festere Türen; so gehn sie und sehen und zählen
Was da verschwand: die Pumpe, die Tassen, die flauschige Decke −
Ach, es ist schon zu spüren, wenn man allein steht und selber
Nicht mit Hobel und Säge umgehen kann und die Freunde
Können sie selten bewegen hierher, denn es gibt nichts
Was sie verlockte, der Sand: der lädt wohl die Mädchen
Ein, sich ohne Bikini zu sonnen, die winzigen Kinder
Pausenlos fordern sie Dies und Das von den Müttern und tollen
Immer dazwischen. Das wissen die Männer und sagen:
Besser, man kommt in der Woche. – Man klingelt um sechs an der Wohnung
Noch eine Stunde, dann gehts. – So sehn sich die
Mädchen Sonntag für Sonntag den Grund abgehn, das Gras und die Kiefern
Liebevoll streifend; sie zählen und messen und rechnen:
Eintausend Mark für den Zaun, wer setzt ihn? Etwa die Spechte
Meisen und Häher? Und naht zwischen Kiefern die Alte
Die man, die Rente ist klein, mit Wurst oder Pudding bewirtet?
Die man, gut wie man ist, herbergt: und hat man drei Wünsche
Frei? wie im Märchen würden sie leben mit Kindern
Und Geliebten in Datschen im Sommer und sorglos.
So aber müssen die Mädchen am Abend, nachdem sie die Sonne
Etwas gebräunt hat, entfliehen mit Kindern und Taschen
Denn es wäre ein Wagnis, die Nacht hier alleine zu schlafen
Fremde könnten die zaunlose Festung erstürmen, die Freunde
Glaubten den Schönen die Unschuld nicht und verzeihn nicht.
Die Kinder sind müde und zwitschern wie Vögel. Die Frauen lachen.
Franz Fühmann, aus Franz Fühmann: Erfahrungen und Widersprüche. Versuche über Literatur, Hinstorff Verlag, 1975
Poesievolle Erkundungen
Von Sarah Kirschs Gedichten geht ein poetischer Zauber aus, dem man sich schwer entziehen kann. Schon ihr 1967 erschienener Gedichtband Landaufenthalt machte auf eine Dichterin aufmerksam, die im Alltäglichen eine oft verborgene Poesie entzifferte und darüber phantastische Dinge mitzuteilen wußte. Entzog sich schon der erste Lyrikband landläufigen Bewertungskriterien, so stellen auch die Zaubersprüche einige Ansprüche an die Bereitschaft, diesen poetischen Erkundungen zu folgen, sich von der Dichterin entführen zu lassen in die Bereiche des Phantastischen.
Auf den ersten Blick muten viele Gedichte wie ganz private Mitteilungen an, erst beim genaueren Lesen entdeckt man auf und zwischen den Zeilen die gesellschaftlichen Bezüge, das historisch Bedeutsame, das auf den Leser zukommt. Sarah Kirschs Zauberformeln wollen entschlüsselt sein, darin liegt der besondere ästhetische Reiz dieser Dichtungen: Der rationale Kern muß freigelegt werden, wie man eine Zwiebel schält, erst hinter sieben Häuten wird die Frucht sichtbar.
Dabei sind ihre Gedichte alles andere als geheimnisvoll, wie man vielleicht dem Titel entnehmen könnte; hier wird nicht der Mystik das Wort geredet als vielmehr dem Tätigsein, der Produktivität, wenn man darunter mehr versteht als die täglich zu verrichtende Arbeit. Auch die Liebe, immer wiederkehrendes Thema, ist produktiv im besten Sinne dieses Wortes: Sie wandelt den Menschen. Überhaupt fixiert Sarah Kirsch nicht so sehr Tatbestände als unabänderlich, sie deckt Veränderungen auf. Wenn sie durch fremde Städte geht und von Landschaften Besitz ergreift, immer wird der Mensch sichtbar, der da am Werk ist, drauf aus, sich eine freundliche Welt einzurichten. Auf dem Schutzumschlag des Gedichtbandes ist ein Interview mit Sarah Kirsch abgedruckt: Hier sagt sie etwas darüber, wie und warum sie Gedichte schreibt.
Unter anderem ist da auch die Rede von den Beziehungen zwischen Spiel und Gedichten. Ihre Antwort, daß auch Erwachsene das Spiel wie Kinder produktiv nutzen können, erleichtert den Zugang zu den Gedichten und verrät zugleich etwas vom Wesen ihrer Dichtung: Sie ist gleichsam spielerisch, ohne verspielt zu sein, sie ist phantastisch, ohne unreal zu sein. Sarah Kirsch lehrt uns, die Wirklichkeit genauer zu sehen, als märchenhafte Realität oder als realistisches Märchen. Dieser Gedichtband, mit dem den Gedichten adäquaten Federzeichnungen von Dieter Goltzsche, bereitet ästhetischen Genuß, verstanden als die Fähigkeit zur Vergegenständlichung und Selbstveränderung des Menschen.
Fred Reinke, Neue Zeit, 13.12.1973
Sarah Kirsch und ihre Kritiker
Vorbemerkung
Nicht nur, weil Zaubersprüche (Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, Ende 1973) der dritte Gedichtband Ingrid Kirschs ist, die sich aus antirassistischen Gründen den Vornamen Sarah gab, nicht weil der Rezensent der Magie der dialektischen Dreizahl erliegt, hatte er sich zu Beginn dieser Arbeit vorgenommen, die Züge im Bild der Lyrikerin, aus Böswilligkeit wie aus Gutartigkeit oft verzeichnete, ein wenig gründlicher als üblich nachzuziehen. Der Plan war gut, der Plan war liebenswert: Diese Notizen sollten jenen Hundertschaften junger Versemacher gewidmet werden, denen Andreas Reimann in Sinn und Form (2/74) ein so grobes Scherbengericht bereitet hat, sollten ihnen eine greifbare Vorstellung davon geben, welcher Mühen und Studien es bedarf, welche vielfältigen Wege (und Irrwege) zu gehen sind, um eine Poesie solcher Eigenart und Intensität wie die Sarah Kirschs auszubilden. Sarah Kirschs Entwicklung sollte (stichwortartig, thesenartig) zu ihren Anfängen zurückverfolgt werden, ja, bis zu den ersten – um 1960 – gedruckten Versen, die eher dürftiger waren als manche Schüler-Lyrik unserer Tage. („Am Dienstag abend gingen wir hin zur Dorfakademie. Auch weil es eben unser Bürgermeister war, der die Karte uns brachte, und weil er uns half, die Straße zu baun im Regen, und er hat doch nur einen Arm“; auf die Markierung der Zeilenbrechung darf man verzichten.) Der Plan war liebenswert, der Plan war gut: Dann aber hat der Rezensent einen Fehler gemacht; er hat nämlich, ehe er begann, die Rezensionen seiner Kollegen gelesen, die sich bis Mitte 74 den Zaubersprüchen zugesellt! Dahin war die Hoffnung, sich ausschließlich der lehrhaften Demonstration widmen zu können, daß die ernsthaft zu erwägende Entwicklung eines Lyrikers erst jenseits der „Kleinen Karriere“ beginnt, die man zwischen Schule und Vorfeld des Schriftstellerverbandes heute als Schüler-Lyriker und Poesie-Seminarist absolvieren kann. Statt dessen sieht sich der Rezensent gezwungen, sich neuerlich, dieser Rolle längst müde, als Polemiker, als Kritiker der Kritik zu betätigen – muß er es nicht auch, um der zunächst ins Auge gefaßten Aufgabe einigermaßen gerecht zu werden? Daß das Bild, wie es Andreas Reimann versuchsweise beschrieben hat, auch im Ergebnis maßstabloser Kritik entstanden ist, das ließe sich, wollte man böse sein, mit zahlreichen Details belegen. Nicht nur die Poesie-Seminaristen allein waren es, die allzu häufig den Status des halb-kindlichen Verseschnitzlers, der es in seinen Grenzen sicher bis zu einer gewissen Fertigkeit bringen kann, mit der ganz anderen Position des ernsthaften Lyrikers verwechselten, dessen Existenz auf die Poesie hin orientiert ist. (Die Verwechslung hat natürlich zum Hintergrund das nicht unberechtigte Unbehagen angesichts der fortdauernden ästhetisch-ideologischen Problematik des literarischen Spezialistentums, die sich beim Lyriker besonders spektakulär ausprägt, freilich, die Fragwürdigkeit jener fatalen „Kleinen Karriere“ besteht eben nicht zuletzt darin, daß sie sich auf ihrer anderen Stufe an einigen, nicht den schönsten Spielregeln des schöngeistigen Spezialistentums orientiert, wie an ihrem Ende oft nicht einmal tieferes Verständnis und größere Begeisterung für die Poesie winken, sondern bornierte Gekränktheit und Ignoranz.) Die nachfolgende Darstellung, an knappen Raum gebunden, versucht in zahlreichen Punkten Korrektur, Zurückweisung und Fingerzeig zu sein, ohne sich in jedem Fall entsprechend zu kennzeichnen.
1
Der Titel fiel 1922 schon einmal Paul Valéry ein: „Zaubersprüche“. Daß auch Sarah Kirschs dritter Band so heißt, wird Kenner der bisherigen Bemühungen der Lyrikerin nicht sonderlich überraschen. Denn bereits mit ihrem ersten Band (Gespräch mit dem Saurier, 1965) wurde nicht nur in Grundrissen das ganze Themen- und Motivfeld sichtbar, das auch die „innere Geschichte“ des Bandes Zaubersprüche (weniger des Landaufenthalt von 1967) bestimmt – die Geschichte listen- und schmerzensreichen Kampfes um den sich entziehenden Mann –, darüber hinaus findet man bereits unter den frühesten Gedichten einige jener beschwörenden und bannenden Zaubersprüche, die im neuen Band in der Abteilung „Katzenkopfpflaster“ stehen, freilich nun von erheblich größerer Kraft als damals. Schon in der frühen „Dreistufigen Drohung“ und nicht erst seit letzten Donnerstag werden Natur und Elemente in „hexischer“ Weise in Dienst genommen und zu dem gleichen Zweck wie jetzt in der „Rufformel“, der „Fluchformel“, der „Ruf- und Fluchformel“. „Du willst jetzt gehn?“ hieß es:
Das sag ich dem Mond!
Da hat sich der Mond
im Großen Wagen verladen,
der fühlt mit mir, weißzahnig
rollt er hinter dir her!
(Die zweite Drohung verbündet sich mit dem Wind, die dritte besteht in der listigen Ankündigung des Verzichts.) Die damals erprobte poetische Geste – auch in Landaufenthalt wird sie hier und da geübt –, unschwer erkennt man sie wieder z.B. in der „Rufformel“, Zeugnis für den Erfolg konsequenter Arbeit, den erarbeiteten Zuwachs an sprachlicher Kraft:
Phöbus rotkrachende Wolkenwand
Schwimm
Ihm unters Lid vermenge dich
Mit meinen Haaren
Binden ihn daß er nicht weiß
Ob Montag ob Freitag ist und
Welches Jahrhundert ob er Ovid
Gelesen oder gesehen hat ob ich
Sein Löffel seine Frau bin oder
Nur so ein Wolkentier
Quer übern Himmel
(Allein schon dieser knappe Vergleich entzieht einigen Rezensionen den Boden, die die Zaubersprüche als Ergebnis veränderter Konstellationen im Werk Sarah Kirschs werten oder sie sich im wesentlichen als Frucht eines aktuellen „Erlebnisses“ erklären, womit man indessen die lyrische Methode überhaupt verkennt. Manchen mag die Gestaltung offenen Besitzanspruches auf den Mann, gelte es sogar die Vernichtung seiner Individualität, erstaunen und erschrecken, der „sanften Dusche“ früherer Gedichte eingedenk. Der Vergleich lehrt, daß die größere Reife Sarah Kirschs tatsächlich auch in größerer Offenheit und Direktheit besteht, in einer kühnen Verschärfung der Gestik, die den Rezensenten freilich auch menschlicher anmutet. „Unheimlicher“ (um in der Begriffswelt der Hexengeschichten zu bleiben) war ihm der fragwürdige Baby-Talk einer studierten Dreißigjährigen, „unheimlich“ erschienen ihm die frühen Gedichte Sarah Kirschs gerade dann, wenn sie sich – Ausdruck eines Kollegen – so „charmant verspielt“ gaben wie das vielgedruckte „Bekanntschaft“:
Guten Tag, Kamm!
Willst du
nicht bei mir bleiben,
daß ich immer schön bin?
Guten Tag, Katze!
Willst du
nicht bei mir bleiben?
Du bist lustig,
tanzt auf zwei Beinen.
Guten Tag, Lieber!
Willst du
nicht bei mir bleiben? Ich bin schön
und kann lachen.
Hat denn damals keinen bedenklich gestimmt, daß in diesem Gedicht der Rang des Menschen kaum höher veranschlagt war als der des kunstgewerblichen Fetischs und der fetischisierten Katze? (Das Gedicht hat einen gesellschaftlichen Kontext, ein „plötzliches“ modisches Schmückedeinheim Anfang der sechziger Jahre, Kunstgewerbewelt, Welt der Modejournale, nicht nur gefährlich abfärbend auf Sarah Kirschs Gedichte: enthumanisierender Rückzug ins Unverbindliche. Wenn man die Gedichte Sarah und Rainer Kirschs in Gespräch mit dem Saurier als Dialog begreift dann hat Rainer mit „Beobachtung von deinem Hals aus“ vor dem Zauberspruch „Bekanntschaft“ kapituliert:
Heute war ich eine Linse.
Eine Linse an deinem schönen Hals
… In sanftem Wasser
War ich aufgeweicht, gefädelt
Auf einen Faden,
In durchsichtigen Lack getaucht, daß ich glänze
Und die Kette dich schmückt.
Die Verwandlung des lyrischen Helden in einen modischen Kunstgewerbeartikel macht heute lachen. Aber war es nicht doch ein recht böser Spuk, der sich damals in die Lyrik der Rainer und Sarah Kirsch wie mancher anderer eingeschlichen hatte? Der Teufel stampfte vergnügt mit dem Pferdefuß auf…) Sarah Kirsch trennte sich um 1966 von dieser Scheinwelt, mit den ersten Gedichten des Landaufenthalt – gemäß einer innerliterarischen Diskussion, gemäß z.B. der eisigen Verzichterklärung Bernd Jentzschs, die auch, so verstand man es damals, jene „private“ modische Sphäre meinte:
Deine Hand ist mit Metall beschlagen.
Finger und Lippen, dein Atem:
alles verkommt
Charakteristischerweise tönt aus den Zaubersprüchen ein Nachklang des Gedichts von Bernd Jentzsch, aus der „Fluchtformel“:
Deine Poren
Sind völlig verstopft und verkommen: vernehmen
Die einfachsten Dinge nicht mehr.
Auch dieses Gedicht ist zunächst nur Anrede an einen anderwärts Gebundenen:
Frost Regen und Schlamm über die Füße dir
Zarthäutiger, Eis dir zwischen die Zehen mit denen ich
Einstmals die Finger verflocht, du schiebst sie
Nicht mir untern Tisch…
Irritabel: die Geste scheint Bestrafung zu wollen, in Wirklichkeit zielt sie auf Erfrischung, Befreiung der Poren –, und ist das in übertragenem Sinn nicht der Effekt des Bandes in bezug auf die Gesellschaft? Andererseits zeigt die Vertracktheit, mit er das Gedicht zu seiner Wirkung kommt, deutlicher noch als „The bird“ (von unten nach oben zu lesen), daß man Sarah Kirschs ironischen Selbstkommentar („Ich hoffe, daß Hexen, gäbe es sie, diese Gedichte als Fachliteratur nützen könnten“) um einen Hauch ernster nehmen muß, als es in der Regel geschieht.
Der Hinweis auf das vertracktere Spiel mit dem Hexeneinmaleins der Poesie steht nicht im Widerspruch zu unserem Lob der „Offenheit“ dieses Bandes, die in zunehmendem Maße erkannt werden wird, wenn man bereit ist, sich an das jetzt Ungewohnte zu gewöhnen. Es scheint mir aufschlußreich zu sein, wenn es bislang kein einziger Rezensent der Anmerkung für wert befand, daß es sich bei den Zaubersprüchen um den in sexueller oder erotischer Hinsicht „freiesten“ Gedichtband aus der ganzen uns bekannten (und relevanten) deutschsprachigen Frauenlyrik handelt. Wo noch läßt eine Poetessa ihren „Don Juan“ sagen „Ich werd dich jetzt“; um sachlich zu erwidern: „Das wird aber gut sein.“ Einmal heißt es – und, bitte: man verweise den Rezensenten nicht auf die schwüle Libertinage einiger wild gewordener Bourgeoisweiber-Dichterinnen um die Jahrhundertwende! –:
Wenn er den Stab hebt, dürft ihr draußen toben.
Ein ironisches Gedicht „Muskelkater“ ist nichts anderem als den Techniken des schönen Sports Beischlaf gewidmet:
Wir sind in Form und wirklich trainiert…
Freilich drängen sich solche Züge des Bandes, die wir nicht überbetont wissen wollen, sowenig auf, wie sie augenzwinkernd versteckt werden, sondern kommen kraft der „Schamlosigkeit“ (verstanden als: Abwesenheit von Scheu) des Bandes insgesamt zu unbetonter und berechtigter Geltung. Trotzdem sind sie doch remarkabel in einem Land, in dem noch Mitte 62, die vom Nachklang des proletarisch-revolutionären Asketismus bestimmte Situation der jungen Lyrik durchaus kennzeichnend, das Gedicht eines jungen Autors erscheinen konnte, in dem es hieß:
Du
denk doch mal –
Was bin ich doch verdreht!
Da muß mir erst die Feder stehen bleiben,
daß ein Gedicht für dich entsteht.
(Die sozialistischen Klassiker von Brecht bis Becher hatten diesen Asketismus bekanntlich längst hinter sich gelassen.) Erstaunlich sind diese Züge auch im Hinblick auf die in den sechziger Jahren losbrechende Liebeslyrikwoge, die in Gestalt von Dutzenden von Liebeslyrikbändchen und Anthologien über uns niederbrach, eine Woge von Zartsinnig-Verschleiertem, Neckisch-Verspieltem und Emanzipatorisch-Belehrendem. Auch ihr entziehen sich die Zaubersprüche, ja, man kann sie interpretieren als einen Schlag gegen diese Welle: In geradezu archaischer Weise wird in ihnen um den Mann gekämpft, mit List und Verstand, mit Zärtlichkeit und Güte, mit fairen und unfairen Mitteln – Kampf jenseits des Begriffes der Emanzipation wie jenseits des „kühnen“ Bekenntnisses zur süßen Intim-Welt:
Das gehört auch zum Leben…
Der Widerspruch in den Zaubersprüchen: Mit einem Mut und einer Selbstbewußtheit, die zweifellos Züge der Emanzipiertheit transportieren, wird Mitteilung gemacht von Vorgängen, die aller Emanzipation Hohn sprechen – und in diesem Widerspruch offenbart sich vermutlich deutlicher der Zustand bestimmter Sektoren unserer Gesellschaft als etwa in Sarah Kirschs O-Ton-Naturalismen Die Pantherfrau, mit denen die Autorin sich als Chronistin erweisen wollte. Der fast brutale Besitzanspruch auf den Mann, die intendierte Macht über ihn – man sollte das freilich nicht als „Privat“-Geschichte Sarah Kirschs lesen! –, wird am deutlichsten in „Klagruf“ charakterisiert, nach der Weise von Zigeunerliedern verfaßt; die Verse könnten auch die Überschrift „Verschmäht“ tragen:
Weh mein schneeweißer Traber
Mit den Steinkohlenaugen
Der perlendurchflochtenen Mähne
Den sehr weichen Nüstern
Dem schöngewaltigen Schatten
Ging durch! Lief
Drei Abende weit war nicht zu bewegen
Heimzukehren. Nahm das Heu nicht
Wahllos fraß er die Spreu
Ich dachte ich sterbe so fror ich.
Es ist klar, daß sich ein so radikaler Besitzanspruch gegen andere Frauen durchsetzen muß, daß hier ein Krieg zwischen (womöglich emanzipierten) Frauen mitgestaltet wird, der, wie jeder weiß, tatsächlich stattfindet, der aber bislang samt seiner Schönheit und Härte erstaunlicherweise aus unserer Poesie ausgeklammert war, der in der realistischen Poesie Sarah Kirschs zum erstenmal faßbar wird; und er wird nicht nur spürbar, er wird in dem Gedicht „Probe“ und mit manchem anderen Vers bewußt ins Licht gehoben. „Probe“ beschreibt einen bösen Wettkampf:
So, sagte der Alte mit den geflochtenen Augenbrauen
Wer von euch beiden als erste trockene Hände hat
Soll ihn bekommen!…
Der Kampf wird gewonnen mit List und Lüge:
Ich schrie: Ich will ihn nicht! Ich schrie und schleuderte
Die Hände von unten nach oben, daß die Gelenke knackten
Die Tropfen flohen und heiß warn die Finger.
Ist Sarah Kirsch eine Denunziantin ihrer Geschlechtsgenossinnen? Aber solche Unverhülltheit, jetzt fällt es uns wieder ein, solche „Härte“ ist seit Jahrtausenden schon das Kennzeichen bedeutender Frauenlyrik. Die Vorstellung von der Frauenlyrik als einer zarten, verhüllten, sanften basiert im wesentlichen auf dem Angebot der zweit- und drittrangigen Vertreterinnen des Fachs. „Ich bin sehr sanft nenn / mich Kamille…“, begann das Schlußgedicht Sarah Kirschs in Landaufenthalt – wie gut, daß es nicht als Programm ihrer weiteren Bemühungen wirksam geblieben ist. Welches Lehrgeld es gekostet hat, die bequemen Lösungen auszuschlagen, kann nur geahnt werden! Zweifellos mußte Sarah Kirsch u.a. dem verführerischen Klang der Else Lasker-Schüler oder Ingeborg Bachmann Widerstand entgegensetzen. Sicher ist Sarah Kirsch auf den Ernst der wesentlichen Poesie u.a. verwiesen worden von Anna Achmatowa, der sie als Nachdichterin gedient hat und von deren Werk sie schroff vor die Frage der poetischen Wahrhaftigkeit gestellt wurde. „Nun, sagt man, lehrte ich die Frauen sprechen“, schrieb die Achmatowa einem Epigramm:
Wie bringt man sie zum Schweigen großer Gott?
Der Frage war nicht auszuweichen. Sie zwang zur Überprüfung der Legitimation für die poetische Arbeit. Die Legitimation fand Sarah Kirsch (bereits mehr als satzweise mit dem Landaufenthalt) in der möglichst genauen Fixierung (nicht nur) ihrer (privaten) Erfahrung, in poetischen Statements, denen keinerlei moralisierende Vorurteile die Kraft nehmen.
Daß die Fortschritte, die den Band Zaubersprüche kennzeichnen, auch negative Momente zur Voraussetzung haben, z.B. eine im Vergleich zum Landaufenthalt erhebliche thematische Verengung, das sollte schon deshalb nicht verschwiegen werden, weil der Vorgang wieder einmal einer allzu pragmatischen „Anleitung“ ein höhnisches Schnippchen schlägt. Aufs Schnippchenschlagen verstand sich die Lyrik Sarah Kirschs indessen immer schon gut. Wenn man Mitte der sechziger Jahre auf Grund des Gedichts „Schornsteinbauer“ die Hoffnung äußerte, Sarah Kirsch möge in verstärktem Maße den Alltag der werktätigen Bevölkerung in ihre Lyrik nehmen, dann wurde der Wunsch erfüllt, aber so, daß es kein einziger Kritiker bemerkte: Sie gestaltete in „Protokoll“ und anderen Gedichten des Bandes Landaufenthalt gleichsam sich selber als Prototyp der arbeitenden Frau, deren Gedanken sogar bei Spaziergängen noch um die Arbeit kreisen:
… noch immer sind Schreibmaschinen zu schwer
zum Umhertragen daß man unterwegs
aufschreibt was einem begegnet…
Den Reichtum der gesellschaftlichen Beziehungen – der sich z.B. auch in einer Adresse an die Partei ausdrückte („Tausend- / äugiger Antreiber millionen- / fingrige Faust Hoffnung auf Hoffnung“) –, wie ihn die in Landaufenthalt geprägte Gestalt gewann, solche Vielfalt weisen die Zaubersprüche nicht mehr auf. Das liegt nicht daran, daß Sarah Kirsch das Material ausgegangen wäre; es hat seinen Grund u.a. in gestörter bzw. eingeschränkter Beziehung zum Publikum. Die Datierung der Gedichte hätte Aufschluß darüber geben können, daß sie in Jahren entstanden, die für die Lyrik der DDR einige Schwierigkeiten brachten. (Es ist bekannt, daß nach dem VIII. Parteitag Abhilfe geschaffen wurde.) Wenn man Lyrik schreibt – wie 1967/71 Sarah Kirsch und ihre Generationsgefährten –, ohne damit rechnen zu können, in absehbarer Zeit wieder einen Gedichtband zu publizieren: Dann wird es eine Lyrik anderer Geste, anderen Inhalts, anderer Gestalt sein als in günstigeren Zeiten. Die Zaubersprüche tragen in vieler Hinsicht die Spure jener Jahre, ohne daß die befürchteten qualitativen Verluste eintraten; wir wissen es bereits. Die Mehrzahl der Rezensenten steht vor solchen Spuren rätselnd, befremdet, ja, abgestoßen, z.B. vor den Zeilen des Gedichts „Die Nacht streckt ihre Finger aus“:
Zähl ich alle meine lieben
Freunde an des Fingern ab
Es sind zu viele Finger, die ich hab
zu wenig Freunde sind geblieben.
(Das Gedicht trug ursprünglich eine Widmung, die unmißverständlich auf die angedeuteten Mißlichkeiten wies.) Es zeigt sich: das Motiv der Einsamkeit, das den Band durchzieht, steht nicht nur unter dem Bogen der Liebes-Thematik. „Einsamkeit“ – das ist der Hintergrund, vor dem sich die Liebesgeschichte im Band verschärft, zu etwas Verzweifeltem wird, vor dem sie Farbe und Kontur gewinnt. Die Bildwelt vor allem der Gedichte „Schneehütte“ (1968) und „Schneeröschen“ (1969) ist überreich an Signalen, die auf diesen Sachverhalt pfeifen. Der z.T. schnoddrige Ton ist ein desperater und kein spaßiger wie gesagt worden ist. Es bedarf keiner allzu feinen Schlüssel, um etwa die Zeilen von „Schneeröschen“ aufzuschließen:
Schneehecke türmt sich wächst stündlich
Keiner kommt durch ich befinde mich abgeschnitten
Weg sind die Wege kein Mensch
Schlägt sich durch nur du kannst mich retten…
Und in „Schneehütte“, ein Jahr vorher entstanden, hieß es:
Verdammt! Wir haben Glück gehabt gerade in einem Bett
Als der Überfluß abkam wir hörten Musik, sonst
Hätten wir uns bis Frühjahr niemals gefunden
An Trennung ist nicht mehr zu denken
Dies Leben schafft keiner allein zu viel Niederschlag…
(In „Schneehütte“ wird übrigens auch eine neue Art von Büchern vorgeschlagen:
… wir drucken sie selbst auf
Holzfreies Eis der Druckstock beheizt schon sind
Einige Klassiker fertig…)
Tatsächlich hat Sarah Kirsch – wie andere auf anderem Weg – auf diese Weise eine Möglichkeit gefunden, als Dichterin weiter zu wirken, weiter zu sprechen. Wollte ich mich auf den Ton mancher Betrachter einlassen, dann würde ich entgegnen: die „unglückliche, traurige, verzweifelte“ Liebe, die sich in den Zaubersprüchen ausdrückt, war genau das, was die Dichterin für ihr lyrisches Werk brauchte. (Eine Grobheit, für die ich mich bei der Dichterin entschuldigen muß!) Denn die Gefahr des Verstummens deutet sich nicht nur in „Georgien, Fotografien“ an – wie wenig Atem nur noch für das Gedicht! –, sondern wird in „Die Nacht streckt ihre Finger aus“ auch ausdrücklich benannt, wenn es vom Rauch-Baum im Zimmer heißt:
Der war vollbelaubt mit Worten
Worten, die alsbald verdorrten
Schiffchen schwimmen durch die Zweige
Die ich heut nicht mehr besteige…
Statt dessen wird neue Aktivität gewonnen, aus dieser Situation heraus eine poetische Gestalt gebildet, die endlich sogar ohne Schwierigkeit nicht nur in Liebesgedichten „Wir“ sagen kann: nämlich in dem fabelhaften Erzählgedicht „Das Grundstück“ im Namen der zahlreichen alleinstehenden jungen Frauen unseres Landes. Die Töne der Neuen Sachlichkeit, die man bei der Lektüre des vorigen Bandes Landaufenthalt noch zuweilen als Gefahr für Sarah Kirsch empfand, sind ebenso gebannt wie die Phantastik jenes Buches sublimiert ist. Diese Leistung, die der Rezensent bewundernswert nennen muß, wäre Sarah Kirsch nicht möglich geworden, wenn sie nicht immer, auf jeder Stufe ihrer Entwicklung, heftig gearbeitet und nach neuen Wegen gesucht hätte. Es lohnt sich das Vorfeld der Zaubersprüche unter diesem Gesichtspunkt zu sondieren.
2
Zum Beispiel könnte man die Frage stellen: Wie sind die Engel ins poetische Instrumentarium Sarah Kirschs geraten? Und man könnte nach den Veränderungen fragen, die sie bei ihrem Flug durch die drei Gedichtbände Sarah Kirschs erleben. Sind sie nicht auch „verdächtig“, wenn sie über den Landschaften der DDR-Bürgerin Kirsch flügeln? Der Schweizer Urs Oberlin meinte freilich die spätbürgerliche Dichtung, als er schrieb:
Nur ein gut erhaltenes Exemplar Odysseus
Heb dir auf. Ohne den geht’s auch heut nicht
und vielleicht einen Engel, bläulich gefiedert,
wie ihn Chagall empfiehlt, doch schon der ist verdächtig.
Rilke hatte es vorzeiten schon schärfer empfunden:
Alle Engel sind schrecklich
Die zahlreichen Engel in den westlichen Poesien des 20. Jahrhunderts sind zweifellos in der Regel Indizien der grauenhaftesten Entfremdung – sind sie es nicht auch bei Sarah Kirsch? Der Rezensent zweifelt nicht daran, daß sich die Lyrikerin selbst solche Fragen vorgelegt hat, ohne sie wahrscheinlich ins theoretische Vokabular der Philosophen zu kleiden. „Man muß schon gelegentlich Lehren aus der eigenen Arbeit ziehen;…“, sagt Sarah Kirsch auf dem Umschlag der Zaubersprüche. Auch die Metamorphose der Engel im Laufe von zehn oder zwölf Jahren ist gewiß nicht nur einem Automatismus zu verdanken, dieser weite und kurvenreiche Weg vom frühen „Gleisarbeiterschutzengel“ über die Vielzahl der Engel und Halb-Engel in Landaufenthalt bis zu dem Gedicht „Die Engel“ in den Zaubersprüchen, das sie ins Altarbild zurückgekehrt zeigt:
bis dann
Die letzte Stunde gekommen ist
Und die Engel mit eiskalten Augen
Die großen Blätter auf denen Geschichte verzeichnet ist
Einrollen ein neues
Licht anzünden…
Diese stilisierten Boten göttlicher Unerbittlichkeit scheinen, nach dem puren Text geurteilt, die bösesten Engel zu sein, die Sarah Kirsch jemals beschwor „schrecklicher“ wären der Sensibilität Rilkes gewiß jene zahlreichen lachenden Munds und freundlichen Gehabes erschienen, die den Band Landaufenthalt beleben: Auf- und Niederfliegende, „Der kleine Prinz“, Seil- und Traumtänzerinnen; ein ganzes Kaleidoskop, in dessen bunten Splittern immer wieder eine Feder vom Engelsflügel steckt. Der Rezensent zweifelt nicht daran, daß die um 1960, wie sie zugibt, noch recht unbewußt arbeitende Lyrikerin zu einem bestimmten Zeitpunkt der Faszination durch „spätbürgerliche“ Poesie „erlag“, und zwar vor allem den „spätbürgerlichen“ Poesien eines groß sozialistischen Dichters, der dem „Engel“-Motiv ungewöhnlich große Aufmerksamkeit gewidmet hat und der auch auf andere Poeten der DDR, z.B. Uwe Greßmann, seine Wirkung nicht verfehlt hat. Das Buch, das ich im Auge habe, erschien in der DDR 1959 (in der Nachdichtung Erich Arendts), ist aber bis heute kaum ins Bewußtsein größerer Kreise gedrungen: „Stimme aus Nesslerde und Guitarre, eine umfangreiche und repräsentative Sammlung der Gedichte Rafael Albertis. Nicht nur Rafael Alberti wurde damals rezipiert, auch Ezra Pound, William Carlos Williams – die Sarah Kirsch noch jüngst in einem Interview zu ihren Lieblingsdichtern rechnete –, Pablo Neruda, das weite Feld der sowjetischen Lyrik: Jene Jahre waren es, in denen sich die damals junge DDR-Poesie die Weltlyrik des 20. Jahrhunderts aufschloß. Rafael Albertis Poesie, in hervorragender Nachdichtung in der DDR leicht erreichbar geworden, scheint damals – wir folgen einem Hinweis Karl Mickels – doch eine größere Rolle gespielt zu haben, als es Untersuchungen der Kritiker, aber eh Bekenntnisse der Dichter verraten. Ihre Rolle für Sarah Kirschs Weg ist offenkundig: Albertis maritime Capriccios, z.B. sein „Leuchtturmwächter und seine Braut“ („Will kein Boot Schifferherz / will über Meer zu Fuß zum Hafen“), werden von Sarah Kirsch in „Das grüne Meer mit den Muschelkämmen“ ganz offen variiert („Einfach so, vor dem Neuen Jahr / ging seine Frau übers Wasser“ – die Frau eines Leuchtturmwächters!) und spielen bis in die Zaubersprüche hinein, die Umkehrung des Motivs beispielsweise in das Motto-Gedicht „Anziehung“:
Nebel zieht auf, das Wetter schlägt um. Der Mond versammelt Wolken im Kreis. Das Eis auf dem See hat Risse und reibt sich. Komm über den See.
Die Galerie der Engel bis hin zu den extremen „Der somnambule Engel“ und „Der Engel Engel“, die sich in Rafael Albertis Buch findet, sie schüttelte die Flügel, erhob sich und erreichte die DDR, wo sie sich – vor allem unter den Händen Sarah Kirschs – seltsame Veränderungen und Verwandlungen gefallen lassen mußte: aufschlußreiche. Im ersten Band Sarah Kirschs schon findet man den „Gleisarbeiterschutzengel“, in dem mit Hilfe des Engel-Motivs das vollzogen wurde, was damals oft gefordert wurde: eine „Poetisierung“ des Alltags – freilich erscheint sie nicht ganz reell; ist die Poetisierung nicht doch nur Versüßlichung, wenn die Frau mit „Messinghorn unterm Arm, die Hände in der Dienstwattejacke“ folgendermaßen apostrophiert wird:
Der vollständige Engel heißt Angela, wen wundert das?
Sie kommt direkt aus dem Himmel (sie nimmt lila Lippenstift,
und sonntags trägt sie eine Schwanenfedermütze).?
In Landaufenthalt – die Jahre der „Poetisierung“ sind vorbei! – greift der Engel selber, die träumend fliegende Dichterin, in die Arbeitswelt ein:
Nachts besteig ich den Nylonmantel… flieg einfach los… Die Sterne, Poren in meinen Flügeln… ich häng überm Land… fort reißts mich über den Fluß, die aufrechten Bäume, den Tagebau / Hier werf ich scheppernd Ersatzteile ab – bloß so, die / brauchen sie immer…
Über mehrere Stufen hinweg wird der Engel schließlich seiner phantastischen Vitalität entkleidet und kommt, „die Kleider waren verblaßt Goldreste / überzogen die Brust er war ohne Flügel“, aus dem Antiquitätengeschäft. Im spannungsreichen Prüffeld des Bandes Landaufenthalt, Prüffeld zwischen Phantastik und Sachlichkeit, ist das Albertische Engel-Motiv zerrieben. Die Engel in den Zaubersprüchen, wie gesagt, stammen bereits wieder aus einer anderen Serie, um es ironisch zu akzentuieren.
Eine dritte Frage lag mir zu Beginn dieses Abschnitts auf der Zunge, die Frage nach den Voraussetzungen, die bei Sarah Kirsch zu so bemerkenswerter Disponiertheit für die Rezeption eines Dichters wie Rafael Alberti u.a. geführt haben. Natürlich läßt sich eine endgültige Antwort angesichts zum Teil sicher unbewußter Prozesse nicht geben. Wichtig aber – im Hinblick auf unsere jüngsten Poeten sagt es der Rezensent: Die Begegnung mit anderen Poesien wäre nie so folgenreich gewesen, wenn es sich lediglich um passive Aufnahme und um Stigmatisierung einer Wehrlosen, Widerstandslosen gehandelt hätte. Es lohnt sich nachzusehen, wie Sarah Kirsch auch schon in ihre gleichsam „vorliterarischen“ Zeit aktiv ihre Möglichkeiten weiterentwickelt, wozu auch der probende, experimentierende Griff nach fremden Mustern gehört. Bereits Gespräch mit dem Saurier, 1965 gemeinsam mit Rainer Kirsch publiziert, ein Band, in dem noch viele Gedichte auf dem Niveau etwa heutiger Schüler-Lyrik (siehe: Offene Fenster) bleiben, bereits dieses in seinen Grundzügen noch „vorliterarische“ Werk ist gekennzeichnet von der permanenten Auseinandersetzung Sarah Kirschs mit sich selbst – und mit anderen Poeten: ihrer eigenen Generation wie vorausgegangener Generationen des Jahrhunderts. Der Band bildet so etwas wie die Geschichte der Auseinandersetzung mit naiv-kindlicher Verspieltheit, die auch noch in „Schornsteinbauer“ und „Gleisarbeiterschutzengel“ zum Zuge kommt und endgültig erst mit der „Kleinen Adresse“ überwunden ist. Es bedurfte sichtbarlich großer Mühe, sich einer Manier zu entziehen, die erfahrungsgemäß Popularität gewährleistete und die auch schon nicht aus dem Nichts kam, sondern vorbereitet war und legitimiert erschien durch die Arbeiten älterer Dichter der DDR, z.B. durch die Kinderlieder Brechts oder durch Fühmanns Märchenpersiflagen „Lob des Ungehorsams“ und „Die Prinzessin und der Frosch“. Doch blieb bei Brecht wie bei Fühmann – auch Teile des Maurerschen „Dreistrophen-Kalenders“ wären zu nennen – die Reduktion auf eine kindlich-primitivistische Ausdrucksweise im Gegensatz zu Sarah Kirsch immer als bewußter, distanzierter Kunstgriff deutlich, der es dem Leser, dem Zuhörer, dem Literaturkritiker verwehrte, sich dem Dichter opa-artig überlegen zu fühlen, was angesichts der frühen Produktionen Sarah Kirschs durchaus möglich war. Fühmann („Lob des Ungehorsams“) schreibt z.B.:
Es, war ein unartiges Geißlein,
das sprang in den Uhrenkasten,
es wußte, daß er hohl war,
dort hat’s der Wolf nicht gefunden,
so ist es am Leben geblieben.
Da war Mutter Geiß aber froh
Bei Sarah Kirsch dominieren solche Töne lange und weithin, ohne daß ironische Distanz spürbar würde. Es gelingt ihr, sich sogar über die „Schornsteinbauer“ im Baby-Talk zu äußern:
Sie mauern dem Wind keine Flöte,
sie mauern dem Rauch ein Loch,
durch das muß er durch,
dann fängt ihn der Wind,
dann ist der Wind gefangen.
Dann fällt er uns nicht in die Augen
Mit solchen Versen wurde er berechtigte und notwendige Machtanspruch der Poesie im Sinne Johannes R. Bechers aus den Händen gegeben, indem sie sich selber als intellektuell „beschränkt“ diskreditierte. Derlei mußte selbstkritisch eingesehen werden, sobald Sarah Kirsch großen Gestalten der Poesie des Jahrhunderts, den weiblichen zumal, begegnete, den Else Lasker-Schüler, Gabriela Mistral oder Anna Achmatowa. Es wäre bequem gewesen, dieser Prüfung auszuweichen, etwa in den so beliebten schnoddrigen Ton der „Neuen Sachlichkeit“ im Gefolge Kästners bzw. Mascha Kalekos, an einen literarischen Platz, an dem man heute beispielsweise Gisela Steineckert sieht. Es gibt im Gespräch mit dem Saurier erste Schritte in dieser Richtung. Was nur hat Sarah Kirsch davor bewahrt, diesen Weg weiterzugehen? Lag es daran, daß sie sich in einem Kollektiv gleichaltriger Poeten bewegte, die sich gegenseitig nicht schonten? Auf jeden Fall hat Sarah Kirsch viele Experimente gemacht, um sich von den Märchen- besser: Kinderschuhen zu erlösen, die sie immer weiter zu tanzen zwangen. Daß ihr die allgemeinere Bemühung ihrer Generation dabei half, daran kann nicht gezweifelt werden. Seit den späten fünfziger Jahren blickten sich die begabteren Lyriker jener Zeit gegenseitig nicht nur kritisch, sondern auch neugierig auf die Hände. So verfiel mancher für kürzere Zeit – es hätte von hier aus ein Weg zur „konkreten Poesie“ führen können; damals wurde sie in der DDR verworfen – auf einen kabarettistischen Spät-Dadaismus, der gerade Sarah Kirschs (damals) spielerischen Sinn verführen mußte:
Der Beifuß am Schuttplatz
steht wieder bei Fuß
steht gerade bei Fuß
am Schuttplatz der Beifuß
weil doch eines Tages
ein Befehl kommen muß
zum Beifuß am schuttplatz
das Gewehr bei Fuß
Die distanziert-parodistische Variante gab der zehn Jahre ältere Jens Gerlach in den „gedichten auf bundes-deutsch“, auf die fragwürdige Herkunft derartiger Techniken verweisend:
Wenn die soldaten
in die stadt marschieren
öffnen sich die gulaschkanonen
am tage der offenen türen.
jedem ein schlag deutscher erbsensuppe
an diesem wunderschönen tage.
ein schlag ein schlag
einschlag einschlag
jedenfalls ein schlag vom alten schlage
Sarah Kirschs „Beifuß“ ist 1963 geschrieben. Die Lyrikerin kommt später nie wieder zu solcher Akrobatik zurück. Statt dessen finden wir in der Zeit von 1963 bis 1964 eine Gruppe von Gedichten; mit denen sie ernsthafter an die Enträtselung der Schwierigkeit geht, eine reifere Bildersprache zu finden und „erwachsen“ zu werden. Nach den alten Regeln der Barockpoesie werden den ausgewählten Objekten des Gedichts die poetischen Bilder wie schöne Attribute, wie kostbarer Schmuck gleichsam angehängt; da baumeln sie lose. „Bootsfahrt“ beginnt folgendermaßen: „Fluß, müdes geschändetes Lasttier des Fortschritts…“; „Die Stadt“ nach dem gleichen Schema: „Die Stadt, dieser Generationsbaukasten“; „Holunder“ ebenso: „Staubiger Holunderbusch, rundes Sommerhaus…“; der Aster werden sogar zwei solcher Attribute umgehängt: „Aster, Rücklicht des Sommers, blaugefiederter Trennungsvogel…“ In immer erneutem Anlauf wie ein Sportler, der eine bislang unbewältigte Marke überspringen will, sucht Sarah Kirsch neue Ausgangspunkte für ihr Gedicht zu erreichen. Mit der „Kleinen Adresse“, wie bereits gesagt, die Sarah Kirschs Kollektion im Gespräch mit dem Saurier beschließt, findet sie das neue Glacis – mit Versen, wie selbstverständlich und zwanglos hingesprochen. Bevor sie aber diese Sicherheit im nächsten Band, in Landaufenthalt erproben kann, kommt es auf den ersten Seiten dieses Buches noch einmal zu einer Zuspitzung und Anspannung der Sprache, die wohl notwendig war, um die sachlichere Sprechweise abzusichern gegen den Abfall in Banalität, um sie als Poesie abzusichern. Gerade diese Gedichte haben dann wilde Kritik provoziert, Verse wie „Der Himmel schuppt sich“, „Hirtenlied“ oder „Brueghel-Bild“, in dem es heißt:
Der Himmel schneit sich nackt und grün
schon häufts sich (nicht das glattere: häuft sichs; A. E.)
besetzt die Erde auf Landsknechtart
fallen Krähen ein belauben den Baum
schrein spähn sammeln sich fliegen weiter…
Zu befragen wäre aber nicht allein dies, oder jenes Motiv nach seiner abenteuerlichen Wanderung durch Sarah Kirschs Poesie, nicht nur das Maß der Intensität, mit dem sie sich ihrer Arbeit widmet, zu befragen wäre nicht zuletzt der Gedichttypus, den sie neben dem „Zauberspruch“ als Novum innerhalb der Lyrik der DDR ausgebildet hat: den Typ eines tagebuchartigen Briefgedichts (zum Bericht-Gedicht tendierend). Dieser Typ, wie ihn sich Sarah Kirsch in Landaufenthalt erarbeitet, erlistet, erspielt hat, ist auch für die Zaubersprüche noch von gravierender Bedeutung und wird, wie wir aus neuen, noch ungedruckten Arbeiten ersehen, wahrscheinlich in der nächsten Zeit zum Haupttransportmittel der poetischen Erfahrungen Sarah Kirschs werden. (Der Typ hat Folgen auch für die Gestik mancher begabten jüngsten Lyrikerinnen. scheint mir, wobei es darauf ankommen wird, ihn zwischen Zwanglosigkeit und Konzentration in der Waage zu halten: ein zukunftsreicher Gedichttyp, doch keineswegs so leicht zu beherrschen, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint.) Der Rezensent gesteht, daß er nicht ohne Spannung des zukünftigen Schicksals des „Briefgedichts“, wie er es provisorisch nennt, harrt. Auffällig in den Zaubersprüchen ist ein Detail (etwa in „Der Flug“ oder „Vorortzug“, vor allem aber in „Das Grundstück“), das vielleicht manch einem unwesentlich erscheint: Sarah Kirsch verwendet wieder reichlicher den Schatz der Satzzeichen, den Punkt, das Komma, den Doppelpunkt, das Ausrufezeichen. Der sekundäre Fakt signalisiert nichts anderes, als daß Sarah Kirsch diesen zur poetischen Anarchie verführenden Gedichttyp fester im Griff hat. Die teilweise satzzeichenlose Schreibweise in Landaufenthalt war u.a. bedingt durch die Art des sprunghaften Erzählens (wie diese Art durch solche Schreibweise auch gefördert wird), die meistens vier bis sechs kleine Erzählpartikel aneinanderreihte. (Bei einigen Gedichten scheint es sogar, daß sie, mit allen Satzzeichen versehen, nicht mehr so recht funktionieren würden.) Mit fast tagebuchartiger Fixierung des Ausgangspunkts des Gedichts lenkt man das poetische Ich in eine bestimmte Richtung, trägt ihm gleichsam auf, ein bestimmtes Beobachtungs- bzw. Beschreibungspensum zu erledigen. Gedichte wie „Die Vögel singen im Regen am schönsten“ wirken tatsächlich wie die fleißigen Protokolle fleißiger schulmädchenhafter Beobachtungsübungen: Die Dichterin distanziert sich und notiert, notiert und distanziert sich. (Man könnte auch an Briefe an sich selbst denken, zu denen man sich beflissen beauftragt, um auch im Urlaub, da die Schulaufgaben einen nicht zwingen, in Übung zu bleiben.) Oft wirken die Anfangszeilen dieser Gedichte wie erste Zeilen eines Frauentagebuches oder eben eines Briefes (und auf diese Weise ist das Mädchenhafte, Naive der frühen Gedichte wirklich aufgehoben, wie es Eduard Zak andeutete.):
Morgens füttere ich den Schwan abends die Katzen dazwischen
gehe ich über das Gras passiere die verkommene Obstplantage
hier wachsen Birnbäume in rostigen Öfen…
Oder man schreibt jemandem, vielleicht einer Freundin, von seinen täglichen Arbeiten:
Es hatte gleich morgens geregnet, wir trafen zusammen
wegen des Buchs das wir herausgeben, wir
täten es lieber nicht…
Die Beiläufigkeit solchen Sprechens, das durchaus poetisch bleibt, machte allerdings in Grenzfällen deutlich, daß man sich (vorläufig) noch nicht ganz mit dem Stoff einlassen wollte; eine Art Scheu war im Spiel, die in den Zaubersprüchen vollkommen überwunden ist. Sind die einen dieser Gedichte von schulmädchenhafter Gründlichkeit geprägt, so wirken andere wie schnell zur Seite gesagt. Künstlerisch hieß die Gefahr: Feuilletonisierung des Gedichts. Diese Gedichtform begünstigt einleuchtenderweise Dezentralisation und Redseligkeit, führt in ungünstigen Fällen zu „feuilletonistischer“ Plauderei. (Der Rezensent ist ein begeisterter Freund des Feuilletons, wie er der Vermischung der Genres wenigstens in diesem Fall heftig widerstreitet.) Alles, was einem im Alltag begegnet, kann Stoff für solche Gedichte werden – aber sind es dann noch Gedichte, wenn sie der Ergriffenheit des Gestalters entraten und sich dem Geschmack des Arrangeurs überlassen können? (Das war wohl der Kern der entsprechenden Kritik Michael Franz’ in den Weimarer Beiträgen.) Daß kein einziges Gedicht in den Zaubersprüchen – ich betone: nicht eines! – solche Bedenken provoziert, spricht für sich. Denn bei der Lektüre des Landaufenthalts drängten sie sich hier und da geradezu auf. Das heißt indes nicht, daß Sarah Kirsch diese Gedichtsform aufgegeben hätte, wie ihr vor einigen Jahren von einem Kritiker empfohlen worden ist: Sie hat sie beherrschen gelernt. Die Gedichte dieser Art in den Zaubersprüchen: Sie rasseln nicht mehr wie auf einen Knopfdruck hin gleichsam als poetische Rouleaus herunter, die Stückchen der Erzählung reihen sich nicht länger zu einer Art lyrischer Zimmerflucht aneinander – jetzt ist das Stichwort (die poetische Idee) oft im Zentrum oder am Schluß des Gedichts zu suchen („Vorortzug“), jetzt gruppieren sich die Erzählpartikel um einen nicht immer leicht zu bezeichnenden emotionellen Kern („Der Flug“). Solche Veränderungen, hier nur angedeutet, verdienen von jungen Menschen, die Gedichte schreiben wollen, gründlich studiert zu werden. Daß auch die Verfeinerung der Sensibilität für die Qualität sprachlich-poetischer Signale, für die Weiterentwicklung dieses Gedichttyps bei Sarah Kirsch eine erhebliche Rolle spielt, kann man z.B. mit dem Anfang des Gedichts „Der Schnee“ demonstrieren (um wenigstens mit einem einzigen Zitat unsere Hinweise zu untermalen):
Er ließ mich nach seinen frohen Befehlen
Über Pfützen und Rinnsale springen. Die langen Büros
Rahmten den Platz ein, schwarz schwarz
Die Straße, der Fluß, es war warm. K. hatte
Die Handschuh verloren, wir gingen und gingen
Dreimal über den Fluß…
Deskription wurde Poesie, gemäß einer Zeile in dem Band Landaufenthalt:
jetzt gehn wir ins Bild besteigen das Schiff.
3
Viele Rezensenten der Zaubersprüche haben einen anderen Gedichtband gelesen als der Verfasser der vorliegenden Notizen. Abgesehen von wenigen Ausnahmen (z.B. Ursula Heukenkamp in den Weimarer Beiträgen oder Eberhard Haufe im Thüringer Tageblatt) hat die Kritik vor diesem Gedichtband in einer Weise versagt, die nun doch zu diesen Seitenhieben zwingt. Dabei haben wir durchaus gesehen, daß sich fast alle diese Rezensenten in den letzten Jahren ernstlich um eine differenziertere und tiefer schürfende Betrachtungsweise bemüht haben. Vor dem Band Sarah Kirschs bleibt kaum etwas anderes übrig als verständnislose Freundlichkeit. (Das ist um so beunruhigender, als Zaubersprüche der erste einer Reihe von Gedichtbänden ist, die zwar nach wie vor aktuelle Bedeutung haben, aber von inzwischen – nach dem VIII. Parteitag – überwundenen Schwierigkeiten gezeichnet sind: Einige dieser Gedichtbände werden die Rezensenten vor erheblich größere Probleme stellen als die Zaubersprüche). Diese Freundlichkeit führt in einigen Fällen zu Absurditäten, vor denen man einigermaßen verzweifelt steht, wie z.B. vor der folgenden Anmerkung, die offenkundig mit dem Inhalt des Bandes kaum noch etwas zu tun hat:
Ob nun beim Spaziergang durch die Stadt oder beim Erlebnis von Regen und Schnee fernab der Häuser – zur immer neuen bildhaften Erfahrung wird, daß dies Land, unsere Zeit der Liebe günstig sind… : „Auf diesem Land / Bau ich dir vierblättrigen Klee“.
(„Grünes Land“, aus dem diese Zeilen stammen, auf die sich nicht nur dieser eine Rezensent wie auf einen rettenden Strohhalm des Optimismus stürzt, ist eins der frühesten, wenn nicht das früheste Gedicht des Bandes und gehört noch ganz zum Komplex des vorigen. Landaufenthalt folgt noch ganz dem Motto „Erde die ich überflieg auf die Regen und Schnee fällt / nicht mehr so unschuldig wie eh“, mit dem eine neue Naturbeziehung unterstrichen wurde, für die ein Gespräch über Bäume schon deshalb kein Verbrechen ist, weil sich die Verbrechen an den Bäumen ablesen lassen; der muntere Schluß des Gedichts „Grünes Land“ ist die hilflose, kaum überzeugende Schlußgeste dieses Komplexes in Landaufenthalt, die im neuen Band ein wenig anachronistisch steht, proklamative Schlußgeste nach den Versen:
Wiesen Koppel zu Türmen gehaunes Gras Schonungen der Hochwald
Ich sehe gebogene weidende Pferde sie sind gar nicht da
Nur einmal ein Kopf aus dem Stallfenster
… Ich rauche im Regen traf tagelang keinen Menschen
Nur ein Alter sah übern Zaun hatte Zeitung gelesen
Wenns losgeht sagte er ich hab einen eigenen Brunnen
Ich nichts aber auf diesem Land
Bau ich dir vierblättrigen Klee…
Daß diese Geste weitgehend folgenlos geblieben ist, dokumentierten die Zaubersprüche) Ist man mit den freundlichen, aber verfälschenden Gutachten über Sarah Kirschs neuen Band wirklich schon sehr weit von den Invektiven entfernt, mit denen um 1966 ihr Eintritt in die erwägenswerte Literatur quittiert wurde? Handelt es sich bei dem Versuch, unbequeme Widersprüche zu planieren, um sich das Bild einer ansonsten harmonischen Welt zu retten, nicht doch letztendlich nur um eine Variante des Erschreckens vor den Disharmonien der frühen Gedichte des Landaufenthalts!? Der Rezensent rechnet zu diesen Versuchen krampfhafter Harmonisierung (die keinem nützt) nicht nur schönfärberische Interpretationen, sondern auch jene, die zwar die dunklen Töne dieses Buches vermelden, sie aber auf eine Ausnahme-Situation zurückführen, letztendlich auf ein spezielles privates Erlebnis, eine „unglückliche Liebe“:
Ihre neuen Gedichte kommen aus einer wie in einem großen Schmerz gereiften Weitsicht. Sie artikuliert sich durch den ganzen Band hindurch immer wieder bald in einem Kummer, bald in Wehmut, bald in Bangigkeit über eine unvermutet und bitter enttäuschte Liebe.
(Und wie dann die Melancholien und Zornesausbrüche im Werk der Generationsgefährten Sarah Kirschs erklären, die nicht durch eine unvermutet enttäuschte Liebe rehabilitiert sind?) Ein anderer Rezensent wieder macht die Entdeckung, es handle sich, nicht wahr?, eigentlich um einen Gedichtband über Emanzipationsprobleme:
Schwierige Liebe wird… im originellen Vers mitteilbar, eine der Möglichkeiten, Probleme der Emanzipation transparent zu machen, zur Sprache zu bringen…
Man spricht von „hohen Forderungen“ an den Geliebten, wo von der Dringlichkeit gesungen wird, einen Mann zu vergnüglichem Spiel ins Bett zu gewinnen und für sich allein (!). „Der Partner teilt diese Unbedingtheit nicht“, schreibt eine andere Rezensentin und interpretiert:
… sein Rückzug auf ,Haus und Herd‘ wird im Kontext vieler Gedichte mit einem deutlich kritischen Akzent als ein Verzicht auf ein volles Mensch-Sein gestaltet.
In Wirklichkeit gestaltet der Band – kühn auch, weil er all die Schemata, die sich in den Rezensionen dem Band anzukrümmen versuchen, vollkommen mißachtet –, er realisiert offen und antik-„schamlos“ die Klage darüber, daß jener zu anderem „Haus und Herd“ strebt: „… du schiebst sie / nicht mir untern Tisch“, die Füße. „Wenn er den Stab hebt“, werden die Stürme beschworen: „… schließet mir das Haus“! Das poetische „Du“ dieses Bandes scheint ganz im Gegenteil „Haus und Herd“ und Stall zu mißachten:
… war nicht zu bewegen
Heimzukehren. Nahm das Heu nicht
Wahllos fraß er die Spreu…
(Wir wiederholen zum Teil Zitate, die schon oben eingesetzt waren; aber konfrontiert mit den Wunschbildern der Rezensenten, wird der hohe Rang des Buches von Sarah Kirsch um so deutlicher.) Im Grunde rechtfertigen solche Rezensionen nachträglich das Dekret von 1966:
Der ,Gedichtmacherschutzengel‘ hat sie verlassen, und sie ihn…
Glaubt man wirklich, sehr viel weiter zu sein, wenn man 1974 dem Leser nahelegt (in einer Rezension, die überschrieben ist: „… bau ich dir vierblättrigen Klee“), sie habe diesen Engel auf irgend einem „Umschlagplatz“ wiedergefunden: „Am Schluß des Bandes kehrt der Sommer, die Jahreszeit der Sarah Kirsch wieder, im ,Grünen Land‘ (!), im ,Grundstück‘, am schönsten im Sonnenbild der ,Ode‘“, der grimassierenden Fratze zu einer Ode in ihrer Zerknautschtheit und mit ihren besoffenen Bildsprüngen! (Allerdings kommen in dem auf flirrende Weise intensiven Gedicht die Worte „Traktoren“ und „Silage“ vor…) Der Rezensent findet sich von siebzig Prozent der Rezensionen zu den Zaubersprüchen an ein 1972 erschienenes Zeitungsporträt der Dichterin erinnert, in dem man die Bildner des erwünschten Sarah-Kirsch-Images unverhüllt am Werk sah:
Porträtfotos spiegeln nicht immer das Wesen eines Menschen wider. Aus Zeitungen und Zeitschriften sah sie uns oft sachlich, kühl und streng ab… „Das liegt gewiß daran, daß ich starr werde, unnatürlich, wenn eine Kamera auftaucht“, meint Sarah Kirsch, als wir sie in ihrer kleinen Neubauwohnung auf der Fischerinsel besuchen. Und sie erklärt es freundlich, mit einem versonnenen Blick.
Der Band Zaubersprüche steht in absolutem Gegensatz zu solchen Niedlichkeiten. (Aber, natürlich, so wollt ihr den Dichter haben:
… kleine Neubauwohnung auf der Fischerinsel… mit einem versonnenen Blick… anregende Atmosphäre… streichelst Rosenblätterzehen…
Nitschewo! zum Glück!)
Ist die Unaufmerksamkeit, die sich in solchen Urteilen kundtut, nicht doch am Ende wieder nur die Frucht der Gleichgültigkeit, der es weniger um den Dichter und mehr um Programme geht, denen er sich fügen möge? Wenn die Kluft zu groß wird, redet man eben aneinander vorbei. Sarah Kirsch hat den Zaubersprüchen die Antwort an diese Kritiker gleich mitgegeben, ein epigrammaisches Verschen über eloquente Gleichgültigkeit (wie sie trotz unserer hohen Ideale in unserer Gesellschaft häufiger anzutreffen ist, als es manche Journalisten-Schmonzette weiß):
Keiner hat mich verlassen
Keiner ein Haus mir gezeigt
Keiner einen Stein aufgehoben
Erschlagen wollte mich keiner
Alle reden mir zu.
(Die Verse stammen aus den späten sechziger Jahren und finden Parallelen im damaligen Werk vieler anderer Poeten, z.B. Elke Erbs titellosen Dreizeiler, der in denselben Wochen geschrieben sein muß wie Sarah Kirschs Fünfzeiler:
Nicht schlägt, wo ich bin, Geschirr an die Wand,
Oder kommt man gelaufen, weil etwas brennt,
Nicht sieht man das Tischtuch zerrissen.)
Es ist selbstverständlich, daß derlei Gedichtchen von den Betroffenen entweder mißmutig abgewehrt werden oder auf eine Weise mißverstanden, durch die deren Berechtigung unterstrichen wird. Das zitierte Epigramm Sarah Kirschs wird z.B. als „Abwehr“ der „Fürsorge der anderen“ (!!??) Kirsch erscheint als ein Trotzköpfchen, das sich nicht helfen lassen will und statt dessen „bittere“ Liedchen singt:
Alle reden mir zu… keiner ein Haus mir gezeigt…
Die Deutung bewegt sich in der Nähe des Hinweises auf die „subjektiven Ursachen“ so mancher unbequemer Gedichte der Lyrikerin, die zumindest jenem Leser als „un-normal“ erscheinen müssen, der vor einigen Jahren einmal an eine Magdeburger Zeitung schrieb:
In der DDR gibt es keine unglücklichen Menschen mehr!
Die Zaubersprüche enthalten die Antwort auch an die Rezensenten dieser Fraktion, nämlich das sarkastische „Selbstmord“:
Aber bei der lag es in der Familie
Sie wohnten früher am Moor
Der Großmutter fiel regelmäßig
Ein Bild von der Wand wenn wieder
Ein Sohn gefallen war
Es handelt sich bei solchen Gedichten ohne allen Zweifel um prononcierte Hinweise auf die Realität. Wenn sie (als Nachklänge der sogenannten „kritischen Lyrik“) auch nicht zu den stärksten Arbeiten des Bandes gehören, so doch, wie sich zeigt, zu den notwendigen, – auch dies ein Widerspruch, freilich hoffentlich ein einleuchtender. Das große Verdienst Sarah Kirschs und der wichtigen Poeten aus ihrer Generation besteht nicht zuletzt darin, auf den Realitäten bestanden zu haben gegenüber Wunschvorstellungen und Illusionen: Dieser Fakt bedingt ihre Stärke und die erstaunliche Höherentwicklung ihres Werks in relativ kurzer Zeit.) Meinen die Rezensenten, die angesichts solcher Verse den Hut ins Gesicht ziehen, die bekannte Massenproduktion jugendlich-heiterer Gedichte sei ein Beweis für die hohe „Lebensqualität“ in der DDR, ein verzweiflungsvoller oder wütender Band womöglich ein Votum gegen unser Land? Warum sonst die mühsame Suche nach „vierblättrigen Kleeblättern“ an Orten, wo gar kein Klee wächst? „Was bin ich für ein vollkommen Weißgesichtiger Clown / Am Anfang war meine Natur sorglos und fröhlich / Aber was ich gesehen habe zog mir den Mund / In Richtung der Füße“, schreibt Sarah Kirsch in „Besinnung“. Die Interpretation:
Der Künstler als Clown, der mit seinen Späßen die eigenen Fehler und Schwächen vorspielt… (!!??)
Und auch derlei Kunststückehen werden in den Zaubersprüchen charakterisiert, mit den Zeilen des gleichen Gedichts „Besinnung“:
Wie komisch sagen sie erzähl ich ein Unglück
Wenn sie lachen müßten, erschrecken sie…
Wir haben im Rahmen dieser Rezension mehrfach angedeutet, welche Eigenschaften des Buches es waren, die eine sonst bemühte Kritik so hoffnungslos scheitern ließen, als wäre sie in ein undurchdringliches Dornendickicht geraten. Der Band war eine erste strenge Prüfung der Lyrik-Kritik in diesen Jahren. Am Ende wußte sich mancher nur noch zu helfen, indem er (wie in einer unserer großen Literaturzeitschriften geschehen) fragte, „ob einige… schwache, bedeutungsarme… Gedichte des Bandes“ vielleicht „nur von der literarischen Qualität her erklärt werden können.“ (Hervorhebung durch A. E.)
Man muß nicht der Meinung des Rezensenten von Christ und Welt sein, der die Zaubersprüche als „das lyrische Ereignis des Jahres 1973 in beiden Deutschlands“ feierte – solche Emphase stimmt uns eher mißmutig: Soll da nicht wieder auf Kosten der anderen und gleichrangigen Lyriker der DDR etwas manipuliert werden? –, eines aber ist sicher: Sarah Kirsch ist heute die im In- wie im Ausland bekannteste Lyrikerin der DDR, und sie ist es gewiß nur zum geringsten Teil auf Grund der wohlfeilen Effekte geworden, die ihr am Anfang ihres Weges die Gunst eines noch anspruchslosen Publikums gewannen. (Was die Intensität ihrer Poesien betrifft, können sich unter den Poetessen unseres Landes nur die früh verstorbene Inge Müller und Elke Erb mit ihr messen, die Ältere und die Jüngere.) Etwas anderes ist der „Sarah-Kirsch-Boom“ der letzten zwölf Monate, von dem die Lektoren sprechen; Zaubersprüche war in wenigen Tagen vergriffen, wie auch die beiden Prosabände Die Pantherfrau und Die ungeheuren bergehohen Wellen auf See. Der Rezensent gesteht, daß es ihm lieber gewesen wäre, wenn Sarah Kirsch auf ein wenig stillere Weise zu ihrem verdienten Erfolg gekommen. Er befürchtet, daß die wesentliche Leistung der Autorin in den letzten Jahren, nämlich mit den Zaubersprüchen ihre Eigenart als Lyrikerin wohl unwiderruflich bekräftigt zu haben, im Rahn solchen „Booms“ aus den Augen verloren werden könnte. Auch deshalb die Substanzlosigkeit vieler Rezensionen zu bedauern, die kaum geeignet sind, bei der Sicherung literarischer Maßstäbe mitzuhelfen. So wäre zum Beispiel klarzustellen gewesen, daß Sarah Kirschs Prosa-Arbeiten (obschon zum Frischesten und Lebendigsten neuerer Prosa zählend) innerhalb der verschiedenen Bemühungen der Dichterin noch lange nicht das gleiche künstlerische Gewicht gewinnen, wie es ihre Gedichte besitzen. Der Rezensent vertraut der Standfestigkeit der Autorin, aber er weiß auch: Die Art und Weise, in der Sarah Kirschs verschiedenartige und verschieden gewichtige Arbeiten von der öffentlichen Meinung quittiert wurden, nämlich mit undifferenzierter Freundlichkeit, kann einen Autor zerstören, leichter als Beschimpfung und Invektive!!
Wenn es keinen Grund sonst gäbe, dies wäre einer, sich neuerlich den Zaubersprüchen zuzuwenden, noch einmal zu versuchen, den Band zu begreifen – eine Aufforderung auch an jene Rezensenten, die wir kritisch zitiert haben! Dabei wäre der Band nicht, wie es jetzt durchweg geschehen ist, als etwas Isoliertes zu behandeln, sondern als das Ergebnis eines Reifeprozesses. Wie anders will man den Fortschritt der Dichterin markieren? Daß es versäumt wurde, den Band in eine Entwicklung zu stellen – auch dies ist nachweislich einer der Gründe für viele Ungereimtheiten in den vorliegenden Rezensionen. Der Band wird von fast allen Gutachtern als etwas vom Himmel Gefallenes betrachtet und nach mindestens zwei Seiten hin so gut wie vollkommen isoliert: 1. gegenüber den früheren lyrischen Arbeiten Sarah Kirschs, vor allem dem Band Landaufenthalt, der, wenn überhaupt, in der Regel mit einer eher abweisenden Handbewegung gestreift wird, obschon mindestens zwei Drittel der Zaubersprüche noch zu der Serie gehören, die von Landaufenthalt dokumentiert wird: Sie begann 1965 und endete etwa 1969 mit „Georgien, Fotografien“; 2. gegenüber den lyrischen Arbeiten der Generationsgefährten der Dichterin, mit deren fortschreitender Arbeit die Poesie Sarah Kirschs auf vielfältige Weise, in thematischer wie in formaler Hinsicht verknüpft ist. Es wird von manchem Ausländer geradezu als verblüffendes Charakteristikum der neueren DDR-Poesie empfunden, daß sie nicht ein Werk von Einzelgängern darstellt, sondern das eines Kollektivs, dem es gelang, eine Poesie mit Zügen auszubilden, die man „DDR-spezifisch“ nennen könnte. Vor allem jüngeren Menschen, die sich anschicken, in die Literatur einzutreten, muß es bei der Lektüre der Rezensionen über Sarah Kirsch rätselhaft bleiben, wie sie zu dem Rang gekommen ist, den sie nun innehat. Gewiß, es würde alle diesbezüglichen Konventionen zerstören, wenn der eine oder andere Rezensent ein zweites Mal zur Feder griffe, um neuerlich seine (vielleicht korrigierte) Meinung zu einem Buch vorzulegen. Aber es ist eigentlich verwunderlich, daß ein solches Verfahren, daß dem realen Prozeß der Meinungsbildung entsprechen würde, noch nie (?) praktiziert worden ist.
4
Auch anderen schon ist es aufgefallen: Das Gedicht, mit dem Sarah Kirsch die relevante Phase ihrer Entwicklung einleitet, fand sich bereits in dem Band Gespräch mit dem Saurier (1965). Es war das Programm einer Welt-Rundreise, als „Kleine Adresse“ (an die Gesellschaft, an den Staat) formuliert, mit dem Sarah Kirsch eine lyrische Versuchsreihe begründete, die bis in die Zaubersprüche hinein weitergeführt wird, die aber vor allem das Gesicht des Bandes Landaufenthalt mitbestimmte. „Rundreise“ heißen die Verse in den Zaubersprüchen – und auch die „Kleine Adresse“ könnte bereits diesen Titel tragen –, mit denen diese Versuchsserie ihren Abschluß findet bzw. in eine neue Serie übergeht. Was einst Wunsch nach weiter Welt war („… ach, wär ich Vogel, Fluß oder Eisenbahn, / besichtigen möcht ich den Umbruch der Welt“.), ist in großer Kurve, in „langer Reise“ gleichsam über mehrere Gedichte hin, wieder nach innen genommen und findet Genüge im frei verfügenden Spiel mit den imaginierten Bildern einer Phantasiewelt, in der es Grenzen nicht mehr gibt:
Mir war ich war
– Kurzer Rasen Schnurobst –
Auf einem englischen Parkplatz
auf einer preußischen Postmeilensäule
Sitzend in blue jeans…
Ich trug eine Frisur diesen Tag
wie ehmals Johann Sebastian…
auch ich bin ein Schwede wie du…
Angesetzt wurde zu dieser Kurve mit der rührenden und frischen Zeile:
Aufstehn möcht ich, fortgehn und sehn
Ans Ziel kommt die Kurve mit der nachdenklichen Zeile:
Mir war ich war…
(Man könnte diese Gedichtreihe als eine Diskussion des Freiheits-Problems interpretieren, an deren Ende der Verzicht steht. Sie ist aber zumindest mit dem gleichen Gewicht auch eine Diskussion über die Problematik der poetischen Imagination, der Einbildungskraft. Schließlich stellt diese Reihe eine Diskussion über das Verhältnis von Bewußtsein und vermittelter Erfahrung dar, über ein Weltbild, das wesentlich von den Massenmedien bestimmt wird, Zeitungen und Television.) Handelt es sich um Resignation? Denn zweifellos war Sarah Kirsch gemeinsam mit ihren Generationsgefährten mit dem Wunsch nach Begreifen (im Sinne auch direkter Erfahrung gleichsam mit den Händen) und dem Wunsch nach Eingreifen aufgebrochen. Die zahlreichen Reisegedichte, Reiseprogramme in Versform, lyrischen Erwägungen über das Reisen haben einen ideologisch-philosophischen Hintergrund, der die Unterstellung verbietet, es handle sich bei diesen Gedichten lediglich und hauptsächlich um kritische Reflexe auf die Reisebeschränkungen, die damals erheblich schneidender waren als heute. Daß diese direkt-politischen Fragen in einige solcher Gedichte hinein spielen, vor allem in Sarah Kirschs „Kleine Adresse“ („Wär ich Ardenne, Gewichtheber, Fluß oder Eisenbahn / Fortgehn möcht ich, sehn und wiederkommen…“), darf nicht überschätzt werden. Im Grunde handelt es sich um Wesentlicheres: um die Proklamation des Aufbruchs in die Realität. So kann man auch keine scharfe Grenze ziehen zwischen den Gedichten, die den Wunsch nach direkter Erfahrung auf das Inland beziehen, und den anderen, mit denen man den Erdball umgreifen möchte: Volker Braun, Heinz Czechowski, Karl Mickel, Bernd Jentzsch, Rainer Kirsch u.a. Es wäre eine Doktorarbeit wert, unsere These bis in diffizile Einzelheiten zu verfolgen; denn gewiß ließe sich an dieser Thematik die jüngere Lyrik der DDR am einleuchtendsten darstellen als das aufregende Kollektiv-Werk, das sie ist. Ausgehen könnte man vielleicht von einem Gedicht Karl Mickels, das bereits 1957 entstand, einfach „Reisen“ heißt, 1966 in Mickels Band vita nova mea geriet:
In Zügen fahren fahren fahren schnell
Die Hände streck ich aus dem Zug
Ich will mit der Hand sehn!
Hand Hand Windpflug
Begreifen ist schön.
Möglicherweise haben wir in diesem Gedicht so etwas wie die Geburtsurkunde jener Poesie vor uns, die in den frühen sechziger Jahren auf sich aufmerksam zu machen begann. Im weiteren Verlauf ihrer Entfaltung wurden freilich nicht nur viele genaue Bilder „begriffen“ und im Gedicht ausgestellt; in den Gedichten jener Zeit wurde auch eine permanente Diskussion über das Verhältnis von Erfahrung und Poesie geführt, indirekt bei Sarah Kirsch, wie wir oben gezeigt haben, am direktesten bei Heinz Czechowski. Während Sarah Kirsch das Erlebnis der vermittelten Erlebnisse artikulierte (und prüfte), zeigte sich bei Heinz Czechowski im sogenannten Weltanschauungsgedicht der „Wasserfahrt“ die Tendenz zur Auflösung des Poetischen in philosophisch-weltanschaulicher Grübelei, wenn er sich z.B. vom auslösenden Erlebnis („Wasserfahrt, den Fluß stromauf…“) alsbald trennte, um sich in schnellen Assoziationssprüngen zu höchst abstrakten Gedankengängen zu entfernen:
Was aber ist das: dieses Wasser,
Diese Wiesen, der Berg?
Ich begreif’s nicht.
Aber was greifen wir denn
Mit dem Gedanken?
Kommunismus? Eine Vision, Durchgangsstufe
Der Menschheit, zu welchen
Erreichbaren Fernen?
Damit war, obschon sich die poetische Bildhaftigkeit verflüchtigt hatte, doch der ideologische Hintergrund markiert, vor dem die zahlreichen Reisegedichte der Generation der sechziger Jahre zu sehen sind. Die Fragezeichen bei Czechowski signalisieren freilich auch die Gefahr der Ermüdung, die nun mit Sarah Kirschs „Mir war ich war“ greifbar geworden zu sein scheint. In diesem Gedicht verbirgt sich indessen als Chance für Sarah Kirsch und unsere Lyrik ein neues Arbeitsprogramm, gerichtet auf die poetische Bewältigung (und Entdeckung) ideologischer Vorgänge im Zeichen der friedlichen Koexistenz, die kritische Wertung eines „weltweiten Bewußtseins“, befördert u.a. durch die Massenmedien, das sich simultanistisch an allen Orten „gleichzeitig“ weiß und an keinem wirklich ist, ein „Bewußtsein“, das sich z.B. – um es zugespitzt zu formulieren – mehr oder weniger passiv aus den uns erreichbaren Fernsehprogrammen speisen würde. Das Gedicht Sarah Kirschs scheint mir die Möglichkeit zu haben, auch auf Grund der deutlichen Neu-Entdeckung simultanistischer Techniken, dieses problematische Feld poetisch-kritisch zu erfassen und zu signalisieren. Sarah Kirsch ist sich dessen wahrscheinlich noch nicht bewußt. Wenn sie es sich bewußt gemacht hat, wird sie ihrer Poesie ein atemberaubend hohes Ziel gesteckt haben, das sie lukrativere, aber nebensächliche Projekte – „Was geschieht im Wassertropfen?“ – vergessen lassen wird.
Der Band Landaufenthalt wäre unter diesem Aspekt als umfangreiche Vor-Arbeit solcher weiter reichenden potentiellen Arbeiten zu lesen, als Experimentierfeld zu betrachten. (Das ist selbstverständlich nicht die Betrachtungsweise des Konsumenten.) Bei neuerlicher Lektüre des Bandes sticht deutlicher ins Auge, was Sarah Kirsch von ihren Generationsgenossen unterschied, nämlich eine gewisse Verliebtheit in die Nostalgien des „möcht ich…“ und „könnt ich doch“. Das Begreifen selbst wird sekundär, gefeiert werden Wunsch und Sehnsucht; wieder einmal drängt sich das Wort „Scheu“ auf: Scheu vor der direkten Konfrontation. Auch in dieser Beziehung ist die „Kleine Adresse“ bereits charakteristisch für spätere Arbeiten – mit ihrer von der poetischen Aufgabenstellung her legitimierten flüchtigen Berührung zahlreicher Objekte:
Warum nicht New York?
Durch alle Straßen muß ich in Stöckelschuhn,
dreieckige Birnen suchen im U-Bahn-Schacht,
gehn, alles sehn, was ich
früh aus spreutrocknen Zeitungen klaube…
Pack meinen Koffer, werf ein blutendes
Plasteherz ein, und weiter gehts, gradaus
nach Sibirien, wo Bäume geerntet werden.
Hab, wie schrein die elektrischen Sägen, wie steigt
Sägemehl pyramidenhoch, wie wuchert der Wald, wie
brechen die Städte herein! Und die Flüsse!
Wunsch nach Welt, rasches Hintereinander von Eindrücken (vermittelten), Spiel der Phantasie… Das reihende Gestaltungsprinzip solcher Arbeiten, das in „Rundreise“ mit einem einzigen Sprung zum Simultanistischen werden wird, findet sich zum Beispiel auch in einem Gedicht über eine Rumänienreise, wie der Wunsch-Faktor modifiziert als Erwartungs-Faktor. (Es handelt sich um eine intendierte Flugreise; auch in diesem Punkt bietet sich ein Vergleich mit entsprechenden Gedichten ihrer gleichaltrigen Kollegen, aber auch älterer Dichter wie Erich Arendt, Georg Maurer, Günther Deicke an: Das Flugerlebnis wird von Sarah Kirsch als Traumflug, als Engelflug etc. häufig genug gestaltet, der reale Flug meines Wissens nirgendwo, auch nicht in dem Gedicht „Der Flug“ in den Zaubersprüchen, in dem ein Liebespaar – das Motiv ist uns auch aus neuerer bildender Kunst z.B. durch Mattheuer bekannt – als Schwimmendschwebendfliegende im Bannkreis einer Stadt kreuzen.) In dem Rumänien-Gedicht „Ich soll in einem Flugzeug“ heißt es:
… sein Grab (Ovids; A. E.)
könnte ich sehn und erstmals im Leben Palmen
ich möchte
mit diesem Fahrzeug ,Karpatenschreck‘
in den Schnee reinkommen, mein Fuß
spürt schon ich will Steine
abgehn sehn und genügsame Pflanzen, den Strand
voller vergnüglicher Häuser groß
da will ich auch tanzen und abends ins Meer
ich kaufe eine grüne Melone
gebe dem Taxifahrer davon
wenn alles eintrifft und ich da
eines Tags aussteig…
Immer wieder auch berichtet Sarah Kirsch in ihren Gedichten von Berichtetem, erzählt sie von Erzähltem – vermittelte Erfahrung auch dies – und vergißt nicht, es entsprechend zu charakterisieren wie in dem Landaufenthalt-Gedicht „Meine vielgereisten Freunde berichten mir“, um fortzufahren:
wies in der Welt zugeht, sprechen an meinem Tisch
von verschiednen Ländern, zum Beispiel Italien…
etc. Dieses „zum Beispiel“ sagt genug über die locker verfügende Beziehung der Dichterin zu ihrem Stoff in dieser Gruppe von Gedichten, obwohl dann verblüffenderweise eine ungemein präzise Beschreibung folgt:
… zum Beispiel Italien
vor dem Dogenpalast spazieren die unzählbaren Tauben
anordnen sich
zu Mustern, fliegen kaum auf, haben
das Pflaster im Aug die Ritzen mit
Eßbarem…
Genauer könnte die Deskription auch nicht sein, wenn Sarah Kirsch wirklich vor dem Dogenpalast spaziert wäre – muß man noch hinfahren, wenn man Filme hat? „Zum Beispiel“ könnte auch das Gedicht „Mittelmeer“ überschrieben sein, das von der Erzählung vom Thunfischfang erzählt und folgendermaßen beginnt:
Der alte Dichter war da
Er erzählte vom Thunfischfang wenn
Die übermanngroßen Tiere
Ins Netz getrieben werden wie sie toben
Der Leitfisch bringt alle und die Schuppen
Glänzen wie rostfreier Stahl
Er aß Kirschkuchen…
usw. Die Grenzen dieser Methode, wenn sie sich nicht zur Darstellung von Bewußtseinsinhalten erhebt, wird in diesem Fall allerdings schmerzlich klar. Der alte Dichter (Erich Arendt) hat nämlich selber ein Gedicht dem Thema des Thunfischfangs gewidmet, das ausgehend von konkreter Erfahrung, weit über sie hinausgehen kann. Man darf die Beiläufigkeit des Gedichts „Mittelmeer“ nicht messen an Arendts mit letztem Ernst und entschiedenem Engagement verfaßten „Die Matanza“, aufzusuchen in seinem jüngsten Bändchen Feuerhalm:
… Wer
wie Er
die schwarze Woge
umarmt hat,
lebt mit den Schatten
der Thune, am Grund,
er kenn das Schweigen
des weißen Vogels der Tiefe,
der,
was hinabschwieg
mit der Nässe des Bluts,
nicht mehr losläßt:
gedeckt ist der Tisch
mit Leere.
(Die unbedingte Bindung jedes der Gedichte Erich Arendts an eine präzis zu ortende und datierende Begegnung mit unvermittelter Welt macht den Nestor unserer Poesie freilich nicht nur zum Gegenbild der jüngeren Lyrikerin; doch dürfte es innerhalb der DDR-Lyrik keinen schrofferen Gegensatz geben als der zwischen Arendt und Sarah Kirsch.)
Film – nicht zufällig geriet es uns in den Text. Hat es eine besondere Bedeutung, wenn in den Zaubersprüchen eine Gedichtgruppe „Fotografien“ genannt wird und die Abteilung, in der man sie findet: „Lichtbilder“? In dieser Abteilung findet man die Reisebilder des Bandes, auch „Rundreise“; und einige, eben die „Fotografien“ aus Georgien, heben sich mit ihrer schnappschußartigen Kälte und Unbewegtheit deutlich ab von dem heftigen Bildersturz in früheren und (ruhigeren) späteren Gedichten. „Fotografien“? Der Film und seine Montage- und Schnittechniken hat sicherlich für die Poetologie Sarah Kirschs seine nicht geringe Bedeutung gehabt, wenn er auch von der Dichterin zunächst nicht so bewußt rezipiert worden sein mag wie von Günter Kunert, der eins seiner Gedichte ausdrücklich „Film verkehrt eingespannt“ genannt hat, Ein Gedicht wie „Lange Reise“; das auf zunächst verblüffende Weise von Ort zu Ort springen kann, wird zugänglicher, wenn man sich das poetische Ich dieser Arbeit gleichsam am Drücker eines Fernsehapparates denkt, durch den es sich rasch wechselnde Filme herbeiholt:
Jetzt wolln wir mal nach Birmingham gehn… Dann wolln wir lieber Onkel Olaf besuchen, der liegt unten am Sund… So nehmen wir den Weg auf die Shetland-Inseln… Jetzt wird es aber Zeit, daß wir Palmbäume sehen… Nun müssen wir bis Köln hinlaufen, sehr weit unten hat der Koch von Birmingham gesagt…
Gedichte dieser Art hat es früher nicht gegeben – kein Wunder, daß Sarah Kirsch mit ihnen auf Mißverständnisse und Widerstände stieß, daß man ihr Modernismus vorwarf und Neigung zum Exzentrischen, obwohl leicht einzusehen ist, daß ihr Gedicht der alltäglichen Erfahrung von Millionen DDR-Bürgern entspricht, die Abend für Abend am Televisions-Gerät sitzen. Die Methode läßt sich auch auf andersartige Gedichte übertragen, wie z.B. „Schöner See Wasseraug“ erkennen läßt. Beschreibung eines märischen Sees, der seine Ufer wählte „inmitten heimischer Bäume / Kiefern und Laubwald Weiden und Birken…“ In der zweiten Strophe aber „ist die Sonne in Tücher gewickelt und fern / das andre Ufer verschwimmt, seine Hänge sanft abfallende Palmenhaine / erreichen dich, du / einem langsamen Flußarm ähnlich / birgst Krokodile und lederne Schlangen…“ In der dritten Strophe liegt der See in wieder „anderer Landschaft / er weiß alle jetzt hat er das Ufer der Marne / ein Stahlbrückchen eckige Häuser Büsche…“ Mit einem bekannten amerikanischen Buchtitel könnte der Engel Sarah Kirschs sich leicht mit den Worten „Ich bin eine Kamera“ vorstellen oder als Cutter und Spezialist für Trickaufnahmen: der Engel auch zahlreicher Gedichte, die zunächst recht harmlos wirken. Aber auch ein Gedicht wie „Im Baum“ gehört zur Reihe „Lange Reise… Schöner See Wasseraug“, um nur eine einzige Strähne aus diesem Knäuel herauszuziehen, ein Gedicht über das Erlebnis des Schaukelns. Rasch wechselt die optische Perspektive, da sich das poetische Ich als subjektive Kamera bewegt, auf eine Schaukel montiert zwischen Stricken am Baum. Aufschwingend:
… zu meinen Augen der See
und die Sonne, weils schwingt, springt
blattwärts erreicht meinen Finger
der See mit blauschwarzem Buckel
rollt sacht ans Ufer zerplatzt
es sieht ein schweinsäugig Tier hervor, sagt
Ich bin der See von Anbeginn…
Niederschwingend:
… klatscht die Welle vom Ufer zurück, der See
ist glatt sein Tier
hats nie gegeben, ich schaukle
erreiche die Blätter das Gras…
Extreme Optik, die aus einer Landschaft drei, aus der vertrauten eine exotische macht; man wird hinter diesem Vorgang auch ein Dilemma vermuten dürfen, das in den Zaubersprüchen seine Lösung findet: die temporäre Unfähigkeit, Alltägliches poetisch zu fassen. Sarah Kirsch deutet das Fragwürdige solchen Verhältnisses zu den Objekten selber an, indem sie Baum, Strick und Schaukel am Ende des Gedichts als Fessel charakterisiert, die Optik „Im Baum“ als etwas Zwanghaftes:
… sehe
zwei Ufer meins und das andere
rieche Apfelblüten weiß Häuser in meinem Rücken kann los
von Baum und Strick.
(Hervorhebung A. E.)
Die Methode wird aufgegeben am entschiedensten in den „Fotografien“ (wie sie später sicherer wieder aufgenommen wird), die einem anderen Extrem im Werk Sarah Kirschs, der Tendenz zur Versachlichung, bis an die Grenze des Möglichen folgen. Man muß sich wundern, daß anhand dieser „Fotografien“ die Diskussion über die Metaphernfeindlichkeit mancher neueren Poesie – Ausgangspunkt war Rainer Kirschs provokant deskriptives „Signachi“ – nicht fortgeführt wurde, die vor zwei Jahren auf einem Kolloquium des Zentralinstituts für Literaturgeschichte nicht ohne Schärfe vor internationalem Publikum begann. (Siehe auch Robert Weimann: „Welt und Ich in der Metapher“ in Sinn und Form 1/74.) Denn einige der „Fotografien“ übertreffen alles, was sich DDR-Autoren bisher in dieser Richtung geleistet haben. Aber kein einziger Rezensent – war jene Diskussion vielleicht nur ein Scheingefecht? – fühlt sich, wie es scheint, davon provoziert, wenn ein Prosagedicht „Haustiere im Gebirge“ aus nichts anderem besteht als aus folgendem:
Die Bäche springen wild von den Bergen, sammeln sich im Flußbett, das ist breiter als die Chaussee und voller Geröll, Grünes wächst, das Wasser füllt es nicht aus. Auf der Chaussee gehn die Tiere, kleine knochige Kühe, ein schwarzes Schwein, ein weißes mit einer Mähne bespringt es rennt auf zwei Beinen, die Schafe wie Steine, ein brauner Esel. Oder sie weiden im Flußbett umgehen die Flüßchen darin. Vor einer neuen Brücke steht ein Pferd, ich sehe die Adern am Hals.
Kein einziger Rezensent fühlt sich provoziert von dem kältesten Text, den wir von Sarah Kirsch kennen, der „Das Fußballspiel“ heißt und der zeigt, wie man durch kahlste Deskription den Leser vor eine Entscheidung und zu einem Kommentar zwingen kann:
Die Akazien blühen die Stadt ist voller Duft die Straßen sind leer, Fußball im Radio und Fernsehen ich hörs aus den Fenstern. Die Taxifahrer rufen sich zu: Nr. 4 ein Mann aus Tbilissi schoß das Tor. Sie überfuhrn einen Hund. Zwei Stunden schrie er im Park.
Nicht das Gedicht „Grünes Land“ mit seinem optimistischen vierblättrigen Schlußplakat markiert den „Umschlagpunkt“ im Werk Sarah Kirschs und in den Zaubersprüchen, diese „Fotografien“ aus Georgien mit ihrem Minimum Metaphern und Gesten markieren ihn: 1969 oder Ende 1968 geschrieben, mühsam und mit dem Gefühl, die Quellen ihrer Poesie wären verarmt und dem versiegen nahe. Mit diesen Gedichten ist in poetologischer Hinsicht ein Nullpunkt erreicht und die beinahe rauschhafte Produktion von etwa vier Jahren beendet. Es ist bedauerlich, daß die Gedichte des Bandes undatiert geblieben sind und somit für breitere Kreise die Möglichkeit entfällt zu kontrollieren, welche Gedichte vor, welche nach diesem Datum entstanden sind und auf welche Weise Sarah Kirsch die Neu-Konstituierung ihres poetischen Ich gelang, „Proleten unter den Gliedern“, wie es im Schlußgedicht der Zaubersprüche heißt, und das ist keine Phrase: Das Abenteuer der Dichtung Sarah Kirschs ist wie der jüngeren DDR-Lyrik insgesamt nicht anders denkbar als unter den besonderen und sozialistischen Bedingungen unseres Landes.
Schlußfrage:
In der Anthologie Saison für Lyrik veröffentlichte Sarah Kirsch 1968 die Verse „Schwarze Bohnen“:
Nachmittags nehme ich ein Buch in die Hand
nachmittags lege ich ein Buch aus der Hand
nachmittags fällt mir ein es gibt Krieg
nachmittags vergesse ich jedweden Krieg
nachmittags mahle ich Kaffee
nachmittags setze ich den zermahlnen Kaffee
rückwärts zusammen schöne
schwarze Bohnen
nachmittags zieh ich mich aus mich an
erst schminke dann wasche ich mich
singe bin stumm
Auf dem VI. Deutschen Schiftstellerkongreß 1969 wurde Sarah Kirsch wegen solcher Gedichte nicht einfach kritisiert; man sprach ihr (und indirekt manchem anderen) geradezu das Recht ab, sie zu schreiben:
Jeder von uns kennt solche Stimmungen und wurde schon von solchen Gefühlen heimgesucht, deshalb ist uns das nicht fremd. Aber gestaltenswert, scheint mir, ist erst ihre Überwindung, das erst macht uns zu sozialistischen Poeten.
Viereinhalb Jahre später fand wieder ein Schriftstellerkongreß statt, der VII., und wieder wurde aus Saison für Lyrik Sarah Kirschs Gedicht „Schwarze Bohnen“ vorgelesen, diesmal jedoch zustimmend und als Beispiel für die notwendige Vielfalt unserer Poesie, unserer Literatur. Das mag jüngeren Autoren, die unters Messer der Kritik geraten, zum Trost gereichen. (Zur Lehre aber kann dienen, daß sich Sarah Kirsch von jener Kritik nicht beirren ließ in ihrem wachen Verhältnis zu ihren Gedichten und daß sie – die Gefahr der Unterstellung mißachtend, sie habe jener unsinnigen Kritik nachgegeben – zwischen den Kongressen von elf Zeilen vier gestrichen hat. Die zweite Fassung steht in den Zaubersprüchen und lautet:
Nachmittags mahle ich Kaffee
Nachmittags setze ich den zermahlenen Kaffee
Rückwärts zusammen schöne
Schwarze Bohnen
Nachmittags ziehe ich mich aus mich an
Erst schminke dann wasche ich mich
Singe bin stumm
Weshalb ist die zweite Fassung besser als die erste?)
Adolf Endler, Sinn und Form, Heft 1, Januar/Februar 1975
Zwischen Großstadt und Märchenwelt
Vor sechs Jahren erschien Sarah Kirschs zweiter Gedichtband mit dem Titel Landaufenthalt. Zumindest seitdem wußte man, daß sie zu den selbständigsten und eigenwilligsten lyrischen Begabungen unserer jüngeren Schriftstellergeneration zählt. Ihr neuer Gedichtband Zaubersprüche beweist dies in verstärktem Maß. Mag der Titel auch einige falsche Erwartungen wecken – nur wenige Gedichte sind reine Spruchgedichte, nur manche geben sich als Zauberverse –, ein eigentümlicher Sprachzauber geht von vielen von ihnen aus, deutlichste Bekundung eines äußerst originellen, differenzierten und sehr nachdenklichen Erlebens und Verarbeitens von Wirklichkeit.
Dieser geheime, keineswegs romantische Sprachzauber gründet in den verschwiegenen thematischen Spannungen dieser Lyrik, die zugleich die ihrer Dichterin sind. Spannungen zwischen Großstadtexistenz und elementarer Zuwendung zu Natur und Landschaft, Spannung zwischen Alltag und Märchenwelt, zwischen alltäglicher Umwelt und weiträumigen Reisefernen, zwischen Realitätsstrenge und produktivem Spiel der Phantasie, zwischen verhaltener Schwermut und beinahe kindlichem Übermut – und mitten darin immer wieder die vielfältigen, bald bitteren, bald heiteren, immer heftig vibrierenden Spannungen, in denen jede lebendige Liebe sich beweist (die Liebesgedichte zählen zu den schönsten des Bandes).
Daß Poesie eine eigene Art von Wirklichkeitserfahrung ist, die den ganzen Menschen, nicht nur seine Ratio beansprucht und anspricht, lehren Sarah Kirschs Verse auf jene Weise, die dem Leser oft eine mehrfache Lektüre abverlangt, weil zu ihr das scheinbar freie Spiel der Assoziationen, das unerwartete Neusehen scheinbar bekannter Wirklichkeiten gehört.
Dennoch sind diese Gedichte alles andere als hermetisch. Das Wirkliche steht ebenso kraftvoll wie in genauesten Konturen vor uns, es leuchtet in einem strengen Licht, es redet mit der Sprache von Alltag und harter Umwelt wie mit der Sprache der Beschwörung und des Volksliedes.
Der Formenreichtum dieser Lyrik ist nur ein anderer Beweis für die Vielfalt und Diffizilität der zugrundeliegenden Welterfahrung. Neben dem sprunghaften Kurzgedicht steht das seitenlang erzählende Gedicht, neben dem freirhythmischen das streng gereimte Gedicht, neben volksliednahen Versen eine lyrische Prosa oder prosanahe Lyrik (Jean Paul nannte dergleichen „polymetrische“ Gedichte). Vielleiche kann man heute ein Gedichtbuch nicht mehr loben als mit der Feststellung, daß es uns auf neue Weise davon überzeugt, daß die Wirklichkeit unseres Hier und Jetzt das Poetische noch immer oder gar aufs neue einschließe. Sarah Kirschs Verse öffnen uns dafür den Sinn und die Sinne. Das ist viel.
Eberhard Haufe, Thüringer Tageblatt, 22.9.1973
Zaubersprüche (1973)
Mit der Sammlung Zaubersprüche gelang Sarah Kirsch der Durchbruch als Lyrikerin. In den folgenden Jahren erschienen wichtige Aufsätze über sie und ihr Werk von Adolf Endler, Franz Fühmann und Peter Hacks, wodurch ihre für die DDR unkonventionelle, neue Art, Lyrik zu schreiben, offizielle Anerkennung gewann.
Die Sammlung gliedert sich in drei Teile: „Sieben Häute“, „Lichtbilder“ und „Katzenkopfpflaster“. Die meisten Gedichte des ersten und dritten Teils handeln von Liebe, an deren Ende die Trennung steht, Gedichte über den Verlust des Geliebten, den Willen und die Möglichkeit, ihn zu halten, die größere Liebesfähigkeit und Absolutheit des Gefühls der Sprecherin, das von dem Mann nicht in gleicher Stärke und Intensität erwidert wird. Der Mittelteil enthält zumeist Reisegedichte im weitesten Sinne; sie berichten von Reisen nach Georgien, Moskau und Prag.
Die Liebesgedichte behandeln nicht nur die individuellen Gefühle des lyrischen Ich, sondern sie sind vor allem Ausdruck der inneren Befindlichkeit eines Menschen, der die Erfahrung einer wenig erwiderten Liebe macht und sich in diesem Gefühl einzurichten gezwungen ist, damit leben lernt. Um diese allgemeine Erfahrung auszudrücken, benutzt die Dichterin immer wieder alte Formen des Mythos, des Märchens, des Volkslieds und des magischen Zaubers. So steht schon hinter dem „Anziehung“ (S. 5) überschriebenen Motto des ersten Gedichts, einer den Ton der Sammlung angebenden Beschwörungsformel, die griechische Sage von Hero und Leander:
Nebel zieht auf, das Wetter schlägt um. Der Mond versammelt Wolken im Kreis. Das Eis auf dem See hat Risse und reibt sich. Komm über den See.
Da das Eis bereits Risse hat, die Schollen sich aneinander reiben, impliziert die Aufforderung, über den See zu kommen, das Risiko des Ertrinkens, Es besagt: nimm das Risiko auf dich; wenn du mich liebst, komm trotzdem zu mir! Wie in den anderen Liebesgedichten der Sammlung will die Sprecherin diese Risikobereitschaft, diese emotionale Versicherung seitens des Geliebten immer wieder evozieren.
Die emotionale Bindung der Sprecherin an den Geliebten ist so stark, daß sie ihn nicht verlassen, nicht verraten kann. In „Ich wollte meinen König toten“ (S. 8), das sich auf den Verrat Christi durch Judas (Markus 14, 43–46) bezieht, versucht sie sich mit aller Gewalt von dem Geliebten loszureißen, will wieder frei sein, doch sie schafft es nicht:
(…) – doch
Die Freiheit wollte nicht groß werden
Das Ding Seele dies bourgeoise Stück
Verharrte nicht nur, wurde milder
Tanzte wenn ich den Kopf
An gegen Mauern rannte (…)
Das lyrische Ich sammelt Verfehlungen des Geliebten:
Ungerechtigkeiten, selbst Lügen
Führte ich auf. Ganz zuletzt
Wollte ich ihn einfach verraten
Ich suchte ihn, den Plan zu vollenden
Küßte den andern, daß meinem
König nichts widerführe
In „Elegie 1“ (S. 18) bezieht sich die Dichterin auf den Orpheus-Mythos, in „Elegie 2“ auf den Phönix-Mythos, um Vergeblichkeit, Mutlosigkeit, die eigene Unfähigkeit zur Aktivität, Ohnmacht und Unerfülltheit auszudrücken. Die Vergeblichkeit, die Sinnlosigkeit alles Tuns wird jedoch nirgends deutlicher als in dem bereits erwähnten Gedicht „Schwarze Bohnen“ (S. 9), das wegen seines scheinbaren Mangels einer positiven Perspektive den Theoretikern des sozialistischen Realismus ein Dorn im Auge sein mußte:
Nachmittags nehme ich ein Buch in die Hand
Nachmittags lege ich ein Buch aus der Hand
Nachmittags fällt mir ein es gibt Krieg
Nachmittags vergesse ich jedweden Krieg
Nachmittags mahle ich Kaffee
Nachmittags setze ich den zermahlenen Kaffee
Rückwärts zusammen schöne
Schwarze Bohnen
Nachmittags ziehe ich mich aus mich an
Erst schminke dann wasche ich mich
Singe bin stumm
Am Ende des ersten Teils steht das Gedicht „Trennung“ (S. 21), in dem man oberflächlich-biographisch zwar die Trennung von Rainer Kirsch reflektiert sehen kann, das aber in der Unbestimmtheit, Artikellosigkeit des Titels und in seiner epigrammatischen Konzentration jede Trennung von einem Geliebten ausdrückt:
Jeder trinkt seinen Whisky für sich
„Three Swallows“ er / „Four Roses“ ich
Im zweiten Teil, „Lichtbilder“, scheint sich die Dichterin in die durch Reisen erfahrene Welt zu flüchten. Sie verläßt den eigenen Innenraum und begibt sich nach außen, in die Landschaft, in fremde Länder. Der Teil beginnt mit „Georgien, Fotografien“, einer Reihe von irritierenden Prosagedichten: Gleich im ersten Gedicht, „Kirche in Mzcheta“ (S. 23), wird berichtet, wie der Bischof dem Meister, der die Schönheit geschaffen hat, die Hand hat abhauen lassen, um das Werk dadurch einzigartig zu machen. In „Das Fußballspiel“ (S. 24) ist Fußball im Radio und Fernsehen:
Die Taxifahrer rufen sich zu: Nr. 4 ein Mann aus Tbilissi schoß das Tor. Sie überfuhrn einen Hund. Zwei Stunden schrie er im Park.
Immer wieder wird die scheinbare Idylle durch die Kontraste des Grausamen, Inhumanen in Geschichte und Gegenwart aufgehoben, wodurch der eigene Kummer ein Gegenbild im fremden Leid erhält: In „Das Landhaus“ (S. 25), in dem ein verschlafenes Landhaus inmitten eines Parks beschrieben wird, heißt es am Schluß:
Das Ruhebett die Uhr der schwarze Mantel die Jagdtasche das Landhaus
gehören dem Dichter Tschawchadwadse
von Weißen
1907 erschossen sagte man gestern.
Wie in diesen „Fotografien“ klingt auch in „Klosterruine Dshwari“ (S. 26), wo die Stimmen der Mönche durch Touristen von einem Tonband abgerufen werden können und die Ruine zur reinen Touristenattraktion degradiert ist, etwas marxistische Religionskritik an, während „Im Kreml noch Licht“ (S. 27), über Lenins Katze, eine versteckte Parodie auf Erich Weinerts Lobgedicht auf Stalin, „Im Kreml ist noch Licht“ (1939), ist. Die Erfahrung der Dichterin ist nie rein additiv beschreibend, sondern immer subjektiv. In „Moskauer Tag“ (S. 28) wird der Sprecherin genauso ihre Einsamkeit und Isolierung bewußt („Ich kannte nur mich und das war zu wenig“) wie in dem folgenden „Moskauer Morgen“ (S. 29), wo sich als Grund der Einsamkeit die Trennung von dem Geliebten erweist („[…], ach der mich anzieht / Ist nicht wo ich bin.“). Und nach Prag führt uns die Autorin, zu einer Mauer, die während der Weltwirtschaftskrise zur Arbeitsbeschaffung gebaut wurde („Mauer in Prag“; S. 34), und auf den Prager Judenfriedhof („Lithographie“; S. 35). In dem Gedicht über „Playboy und Cowboy“ (S. 38f.), zwei gegensätzliche Typen, scheinbare Brüder, Prototypen des Arbeitslebens und des Nichtstuns, erscheint der Gegensatz zu forciert, nicht überzeugend das mitspielende Pathos; die implizierte Amerikakritik wirkt zu künstlich, klischeehaft, auch wenn sie am Schluß mit einem die Möglichkeit des Irrtums zugebenden Fragezeichen versehen ist. Überzeugender ist Kirsch immer dann, wenn sie von sich selbst spricht, wie hier in den letzten beiden Gedichten dieses zweiten Teils: „Der Droste würde ich gern Wasser reichen“ (S. 42), wo sie ihre innere Verwandtschaft mit der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848) thematisiert, und „Besinnung“ (S. 43), wo sie, über sich selbst und ihre künstlerische Wirkung reflektierend, das traditionelle Motiv des Clowns als des mißverstandenen Künstlers zum Anlaß der verfremdenden Sicht auf das eigene Künstlertum, zur Selbstreflexion verwendet:
Was bin ich für ein vollkommener weißgesichtiger Clown
Am Anfang war meine Natur sorglos und fröhlich
Aber was ich gesehen habe zog mir den Mund
In Richtung der Füße
Richtig verstanden fühlt sich die Lyrikerin aber von Matrosen und „Schoffören“, und damit dreht sie das traditionelle Clownsmotiv vom mißverstandenen Künstler um.
Bei den Liebesgedichten des dritten Teils „Katzenkopfpflaster“ wird die Dichterin voll und ganz dem Titel ihres Bändchens gerecht.
Das Du des ersten Teils tritt jetzt stärker hervor, wird kritisch gesehen. Trauer schlägt um in Aufbegehren, die Elegie wird durchbrochen. (Sigrid Damm)
Es handelt sich zumeist um beschwörende Zaubersprüche, Anrufe, die den Geliebten binden oder ihn zurückbringen sollen. In „Rufformel“ (S. 47) will ihn die Sprecherin
Mit meinen Haaren
Binden ihn daß er nicht weiß
Ob Montag ob Freitag ist und
Welches Jahrhundert ob er Ovid
Gelesen oder gesehen hat ob ich
Sein Löffel seine Frau bin […]
In „Klagruf“ (S. 48) vergleicht sie ihn mit einem Schimmel, der durchgegangen ist und nicht wiederkommt. Mit dem Adjektiv „schneeweiß“ spielt sie offensichtlich auf Grimmsche Märchen an:
Weh mein schneeweißer Traber
Mit den Steinkohlenaugen
Der perlendurchflochtenen Mähne
Den sehr weichen Nüstern
Dem schöngewaltigen Schatten
Ging durch! Lief
Drei Abende weit war nicht zu bewegen
Heimzukehren. Nahm das Heu nicht
Wahllos fraß er die Spreu
Ich dachte ich sterbe so fror ich
Im folgenden Gedicht „The Bird“ (S. 49) erhält das Thema von der verlassenden Liebenden – der Geliebte wird als wieder mit der Ehefrau vereint dargestellt – dadurch etwas magisch Zwingendes, daß es von unten nach oben, also vom Ende her rückwärts gelesen werden muß, um einen Sinn zu ergeben. In „Fluchformel“ (S. 50) verflucht die Sprecherin den Geliebten, weil er seine Füße nicht mehr unter ihren Tisch schiebt, während sie in „Ruf- und Fluchformel“ (S. 51) offen die sinnliche Liebe besingt, die ihr in Muskelkater (S. 71) „Zierlichen Schmerz Leib Gliedern“ verursacht. Leicht ließe sich das zentrale Gedicht des dritten Teils, „Nachricht aus Lesbos“ (S. 52), von einer Frau, die lieber einen Mann als Frauen liebt, oberflächlich politisch interpretieren, zumal die Wortwahl der ersten Zeile eine solche Interpretation nahezulegen scheint:
Ich weiche ab und kann mich den Gesetzen
die hierorts walten länger nicht ergeben
Es geht jedoch weder um Politisches noch einfach um ein positives, fruchtbares Abweichlertum in eroticis, sondern um die Freiheit, sich so zu verhalten, wie man will, um ein Hinaus aus der allgemeinen, unfruchtbaren Sterilität zu einem Verhalten, das die volle Selbstverwirklichung des Menschen einschließt:
Nicht liebe ich das Nichts das bei uns herrscht.
Nur in diesem Sinne, als Verteidigung ihrer eigenen Wahl, ihrer eigenen, andersartigen, individuell gewählten Lebensweise läßt sich das Gedicht als politisch bezeichnen. Franz Fühmann schreibt dazu:
Nicht die gleichgeschlechtliche Liebe wird attackiert, sondern die Formung des Menschen nach einem Bilde, das weniger als ein Menschheitsbild ist, weil der ganze Mensch in ihm nicht aufgehen kann. Lesbos: die zwangsweise Festlegung aller auf den Sonderfall des Verlangens wie Begnügens im Gleichgearteten und die Erhebung dieses engen Verhältnisses zur ausschließlichen Norm.
In solchen Gedichten spricht die Autorin ungewöhnlich offen, wie man es vorher in der DDR-Lyrik selten lesen konnte. Ohne falsches Schamgefühl spricht sie ihre Gefühle, Empfindungen und innersten Erlebnisse aus, ihr Verlangen, sexuelles Begehren und absolutes Wollen, ihren Schmerz der Einsamkeit und ihre sinnliche Freude, wenn sie mit dem Geliebten zusammen ist. Die Liebesgedichte der Sarah Kirsch haben nun jegliche Naivität verloren und sind durch das ihnen innewohnende reflektierende, die Erfahrung verallgemeinernde Element Ausdruck der nun erreichten inneren Reifestufe der Autorin. Die Offenheit und Ernsthaftigkeit in dieser Sammlung muß beim Leser eine tiefe Betroffenheit auslösen, ein Beweis mehr für den Wert dieser Gedichte. Nicht zufällig endet die Sammlung mit einem Gedicht, das selbstbewußt „Ich“ überschrieben ist (S. 73), indem sich die Überwindung der inneren Krise in einem unbändigen Schaffensdrang, der Bereitschaft zu neuen Schöpfungen anzeigt:
[…] Ich stand
Auf eigenen Füßen, Proleten unter den Gliedern, ich hätte
Mir gern einen Bärn aufgeladen ein Zopf aufgebunden
Ein Pulverfaß aufm Feuer gehabt.
Hans Wagener, aus Hans Wagener: Sarah Kirsch. Colloquium Verlag Berlin, 1989
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Karl Corino: Lenin für die Katz. Gedichte der DDR-Autorin Sarah Kirsch
Deutsche Zeitung, 28.9.1973
Sigrid Damm: … bau ich dir vierblättrigen Klee
Neue Deutsche Literatur, Heft 11, 1973
Leonore Krenzlin: Zaubersprüche
Sonntag, 16.12.1973
Heinz Klunker: Risse im Eis
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 25.1.1973
Ursula Heukenkamp: Sarah Kirsch: Zaubersprüche
Weimarer Beiträge, Heft 3, 1974
Roland H. Wiegenstein: Approbierte Hexe, Sprechstunden nach Vereinbarung
Merkur, Heft 345, Februar 1977
Eberhard Lämmert: Stimmenzauber
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.10. 1975
Auch in: Frankfurter Anthologie Bd. 2. Frankfurt/M. (Insel) 1977: (Zu dem Gedicht „Klosterruine Dshwari“).
Christel und Walfried Hartinger: Unterwegs in die Erfahrung. Zeitgenossenschaft und lyrische Subjektivität
Klaus Walther (Hg.): Ansichten. Aufsätze zur Literatur der DDR. Halle (Mitteldeutscher Verlag) 1976
Jutta Goheen: Die Optik der Zaubersprüche: Zur Bildpoesie der Sarah Kirsch
Carleton Germanic Papers (Ottawa). 9. 1981
Georg Guntermann / Hajo Kurzenberger: Sarah Kirsch: „Die Nacht streckt ihre Finger aus“
Peter Bekes u.a. (Hg.): Deutsche Gegenwartslyrik von Biermann bis Zahl. Interpretationen. München (Fink) 1982
Timo Brandt: Sarah Kirschs frühe Lyrik 1967–1976
babelsprech.org
Randnotiz über die Engel Sarah Kirschs
Zum Beispiel könnte man (statt nach dem Hexenbesen der Verfasserin der Zaubersprüche Ausschau zu halten) auch einmal die Frage stellen: Auf welche Weise sind eigentlich die Engel ins poetische Personal, ins lyrische Instrumentarium der noch ganz jungen Dichterin geraten? Und man könnte nach den Veränderungen oder gar Verstümmelungen fragen, die diese bis in die Mitte der Sechziger hinein vor allem dem problematischen Luftraum im Territorium Halle/Bitterfeld/Leipzig zugeteilten Schwebewesen bei ihren Flugübungen und Landemanövern im Lauf der Zeit erlebt bzw. erlitten haben. (Zu dokumentieren wäre diese merkwürdige auf- und niederflügelnde DDR-Fauna von Engeln, Sylphen, Seil- und Traumtänzerinnen, „kleinen Prinzen“, heimischem und exotischem Vogelgetier usw. vornehmlich mit Texten aus den ersten drei Gedichtbänden der Autorin, dem gemeinsam mit Rainer Kirsch bestrittenen Gespräch mit dem Saurier von 1965, dem Landaufenthalt von 1967, den jahrelang der Veröffentlichung harrenden Zaubersprüchen von – endlich! – 1973; was nicht heißen soll, daß die Motive des Frühwerks später wegschmelzen – etwa nach der Übersiedlung Sarah Kirschs in die Bundesrepublik −, sondern im Gegenteil aufmerksam machen möchten auf die fast naturhaft anmutende Kontinuität der Entwicklung dieses Werkes, aus welcher auch Späteres, auch Allerneuestes nie ganz ausschert.) Zugegeben, der Verfasser findet sich bei der ersten Begegnung mit diesen frühen Botinnen einer bis dahin ungewohnten neuen Phantastik in der DDR-Literatur am Ende der sechziger, zu Beginn der siebziger Jahre, er findet sich damals eher zurückhaltend und mißtrauisch gestimmt, nicht zuletzt die vielsagende Rilkesche Formel „Alle Engel sind schrecklich“ und die wiederentdeckte Entfremdungsproblematik im Kopf; als glossierendes Zitat boten sich die Verse des schweizerischen Dichters Urs Oberlin an:
Nur ein gut erhaltenes Exemplar Odysseus
Heb dir auf.
Ohne den geht’s auch heute nicht
Und vielleicht einen Engel, bläulich gefiedert
Wie ihn Chagall empfiehlt, doch schon der ist verdächtig…
Möglicherweise schrecklich, jedenfalls verdächtig, nichts anderes als Entfremdungssymptom zu sein, auch wenn sie lachenden oder lächelnden Munds herangeflogen kamen, die Engel der Harz-Tochter Sarah Kirsch (und waren sie’s nicht, nämlich Boten der Entfremdung?) – Zwanzig Jahre später setzt sich der Verfasser dem Risiko einer Wiederbegegnung aus und wundert sich und wundert sich; und er kommt sich bei dem Versuch, Rolle und Eigenart der Engel Sarah Kirschs zu bestimmen, selber ein wenig irreal vor, ungefähr so, als hätte man ihm den Auftrag gegeben, Jaroslav Beraks frühdadaistische Verse „Alle Sozialisten sind Engel“ zu interpretieren: Kein Zweifel – weshalb hat man das damals nicht so recht wahrgenommen? −, die frühen Engel Sarah Kirschs sind überzeugte Sozialisten, nach dem heutigen Sprachgebrauch: Sozialisten vom Feinsten… Man stelle sich die Feen aus Tausendundeiner Nacht oder dem deutschen Volksmärchen mit weiten Flügeln versehen und als Aktivistinnnen (u. U. mehrmals ausgezeichnet) beim sozialistischen Aufbau vor, sowohl die Arbeitslust und -moral unserer Werktätigen befördernde als auch dem ungestörten Produktionsablauf dienliche „gute Geister“! Wer ungläubig den Kopf schütteln will – dieser etwas ironische Passus richtet sich nicht gegen die Dichterin, dies nebenher −, der lese doch ganz einfach nach!, der lese die Verse „Gleisarbeiterschutzengel“ von 1963 über einen weiblichen Sicherheitsposten, „direkt aus dem Himmel“ – und nicht nur einfach „von oben“ – zum Eisenbahnbau versetzt:
Der vollständige Engel heißt Angela, wen wundert das?
Sie kommt direkt aus dem Himmel (sie nimmt lila Lippenstift,
und sonntags trägt sie eine Schwanenfedermütze).
Das Messinghorn unterm Arm, die Hände in der Dienstwattejacke,
so steht sie hinter uns, vor uns, zwischen uns, um uns,
DAMIT UNS NICHTS ÜBERROLLT…
(Auch im Original in Versalien diese Zeile, was bedeutsamer ist oder war, als man denken mag; die plakative Betonung etwelcher Bedrohung verleiht der menschenfreundlichen „Wachsamkeit“ solcher Angela einen allgemeineren, einen klassenkämpferischen Sinn…) Das Gedicht „Ausflug“, höchstens zwei bis drei Jahre später entstanden, präsentiert sich dagegen nicht als Porträt-, sondern als Rollengedicht, in dem die Dichterin von sich selber als solch einem um die Produktion besorgten Engel zu sprechen scheint (um es zu wiederholen: scheint!), welcher nachts den Nylonmantel „besteigt“ und die Sterne als „Poren in meinen Flügeln“ empfindet, um fortzufahren, besser, fortzufliegen:
Wind in den Ärmeln hebt mich in maßlosen Schornsteinruß
ich häng überm Land, seh nichts vor Nebel und Rauch
fort reißts mich über den Fluß, die aufrechten Bäume, den Tagebau
Hier werf ich scheppernd Ersatzteile ab – bloß so, die
brauchen sie immer…
(Eine „Aufbruchsstimmmung“ damals und Atmosphärilien, wie sie der gleichzeitigen westdeutschen Lyrik vollkommen fremd waren, mit manchem seltsamerweise jedoch dem „Guten Morgen, Amerika!“-Sound Carl Sandburgs nahe – „Under the smoke, dust tall over his mouth laughing with white teeth…“ −, von Louis Untermeyer vorzeiten „Der Dichter von Rauch und Stahl“ genannt. Die Zeit der ökologischen Bedenken war noch fern; unbelastet von „Jetztzeit-Letztzeit“-Visionen – wie sie heute Sarah Kirschs Weltsicht bestimmen konnte man damals der von der Partei empfohlenen Hinwendung zur Arbeiterklasse und ihrem Kampfplatz Industrie Folge leisten; und so gut wie alle Lyriker der mittleren Generation, der um ’35 geborenen, haben ihr Scherflein beigetragen zu diesem Komplex. Heiner Müller über die Großbaustelle Schwarze Pumpe 1958:
Gegen Mittag der Bauplatz, die neue schönere Landschaft
Schornsteine. Montagehallen. Stahl und Beton.
(…)
Lärm und Staub…
Und die Frühfeder Peter Gosses in diesem Sinn: „Es atmet sich gut, wenn die hagere Reihe Schornsteine den sentimentalen Himmel zerqualmt.“) Weiter Sarah Kirsch und ihr „Ausflug“:
… ich singe, da trägts mich
schwarz von der Arbeit des Fliegens bis in die Vorstadt
(…)
und mein Freund, der Schmied aus dem Rauchkombinat
gibt mir ein duftendes Seifenstück…
Ach, auch das wird, wie wir wissen, eines Tages nicht mehr helfen können solcher innigst der Arbeiterklasse verknüpften Fortuna mit dem Ersatzteile-Füllhorn, vorerst noch mit Leidenschaft der schweren und schwärzenden „Arbeit“ des Fliegens ergeben, die einen selbstverständlich sofort die gleichfalls so zweifelhafte „Arbeit des Dichtens“ assoziieren läßt, diese wie jene, Genossen, zu würdigen jedenfalls als „Arbeit“, bitte! (Das alte Problem: Majakowskis poetische Argumentation gegenüber dem mißlichen Steuerinspektor; Sie erinnern sich!) – Daß solcherlei Engel es nicht allzu lange treiben werden, kann man sich denken. Als Abschluß einer ersten Engel-Serie läßt sich das einfach „Engel“ genannte Gedicht im Landaufenthalt lesen; es gilt einem Engel aus dem oder fürs Antiquitätengeschäft, „die Kleider waren verblaßt Goldreste / überzogen die Brust er war ohne Flügel…“; der Schluß findet dann doch noch zu einer menschenfreundlichen Wendung: „… der Ausweg für ihn / wäre ein Kindergarten wenn der ihn beherbergte / wer wüchse nicht gern mit einem Engel auf.“ (Rafael Albertis vergleichbare Gedichtreihe „Sobre los ángeles“ / „Von den Engeln“ endet mit dem Gedicht „Der überlebende Engel“ und dieses in der Nachdichtung Erich Arendts mit den zwei Zeilen: „Alle Engel verloren das Leben. / Nur einer nicht, verwundet, gebrochenen Flügels.“) In kurzer Zeit welche Metamorphose, welch weiter Weg vom „Gleisarbeiterschutzengel“ bis zu den Engeln einer, wenn man so will, zweiten Serie in den Zaubersprüchen, wo man sie gleichsam ins Altarbild zurückgebannt findet:
… bis dann
Die letzte Stunde gekommen ist
Und die Engel mit eiskalten Augen
Die großen Blätter auf denen Geschichte verzeichnet ist
Einrollen ein neues Licht anzünden
− Endzeit-Visionen also auch schon in der DDR wie später immer wieder, gipfelnd vorerst in den Überlegungen am Schluß der merkwürdigerweise als „Chronik“ bezeichneten die Räume und Zeiten durchflügelnden Prosa Allerlei-Rauh von 1988.
Flug des Engels und Kamerablick; „Der kleine Prinz“ in Landaufenthalt:
Meine Augen verkehrten sich, daß ich die Erde
über mir sehe auf Wolken nun geh, wo
Richtungen sind,
keine Wege, die Berge
hängen nach unten wie ihre Bäume…
− In den Jahren davor war anläßlich einiger sowjetischer Filme der Chruschtschow-Ära, z.B. dem spektakulären „Wenn die Kraniche ziehen…“ (der Sarah Kirsch fasziniert haben muß) auch wieder über das filmische Experiment diskutiert worden und vor allem über das Phänomen der sogenannten subjektiven Kamera; daß Filmisches in diesen Jahren auch in die Lyrik eindrang, wurde besonders deutlich, als Günter Kunert in dem Band Der ungebetene Gast von 1965 ein Gedicht publizierte, das „Film – verkehrt eingespannt“ hieß und den filmischen Kunstgriff ohne besondere Kennzeichnung auch in anderen Gedichten verwendete, in modifizierter Weise bis heute verwendet, z.B. in dem im April 88 in der FAZ erschienenen Prosastück „Ausgrabungsbericht“. (Rolf Dieter Brinkmanns „Film, von rückwärts gesehen“ bzw. „Die Fortsetzung“ findet man erst in der Nummer 9/67 des Merkur.) – Kamera-Auge und Engels-Geturn; in der Tat könnte man nach der Bedeutung filmischer Techniken auch für Sarah Kirsch fragen, und nicht allein nach der „Kunst der umherschweifenden Seele, des Kinos im Kopf“, wie es in Allerlei-Rauh heißt, sondern mit gleich berechtigter Neugier nach der spezifischen filmischen Optik, nach Techniken und Tricks im engeren Sinn, wie sie sich Sarah Kirsch gewiß zunächst so naiv wie wir alle, dann bewußter zu Gemüte geführt, schließlich ihrem poetischen Handwerk dienstbar gemacht hat. Aufschlußreich eine kleine Notiz, die sie 1977 für die Zeitschrift Neue deutsche Literatur geschrieben hat, um der Öffentlichkeit die junge Lyrikerin Christiane Grosz zu empfehlen; die aber auch für manche ihrer eigenen Texte gelten könnten: „Es gibt Gedichte, in denen die Dinge sich bewegen, ein zeitlicher Ablauf eingefangen ist, Zeit verstreicht optisch, der Vorgang wird nicht behauptet, er läuft vor unserer Augen ab… Stereo-Kino im Kopf durch ein paar aufgeschriebene Buchstaben…“ (Ein so direktes und riskantes Ineinssetzen von Filmsequenz und lyrischer Strophe wird man von keinem zweiten Lyriker der DDR behauptet finden.) Als filmisch, wenn nicht sogar als Wiedergabe eines Films, würde einem freilich auch ohne Kenntnis entsprechender theoretischer Äußerungen von Sarah Kirsch so manches erscheinen, z.B. auch das folgende Bild aus dem Landaufenthalts-Gedicht „Meine vielgereisten Freunde berichten mir…“, einer der vielen frühen Arbeiten der Autorin, die von Berichtetem berichten, von Erzähltem erzählen:
… zum Beispiel Italien
vor dem Dogenpalast spazieren die unzählbaren Tauben
anordnen sich
zu Mustern, fliegen kaum auf, haben
das Pflaster im Aug die Ritzen mit Eßbarem…
(Von Berichtetem berichten, die Engel, Film oder Foto – eine Abteilung in den Zaubersprüchen, „Lichtbilder“ genannt, enthält die Serie „Georgien, Fotografien“ −; man könnte ein System von Filtern oder Schutzvorrichtungen vermuten, das der Empfindlichkeit der Dichterin einen indirekten, vermittelten Umgang mit ihren Stoffen bzw. der Realität gestattet, aus welchen Gründen auch immer nötig geworden in jenen Jahren; ist das spätere Werk nicht u.U. auch zu beschreiben als Ab- und Umbau des zu Beginn ihres Weges entwickelten Systems, ohne daß es jemals durch ein ganz und gar neues ersetzt worden wäre? Der Verfasser hatte sich vorgenommen, mit sicheren Antworten sparsam zu sein!) Jedenfalls verwandelt sich der Engel Sarah Kirschs zuweilen in etwas, das sich mit einem Isherwoodschen Romantitel als „Ich bin eine Kamera“ vorstellen könnte, z.B. aus dem Gedicht „Im Baum“ heraus, das dem auf den ersten Blick recht harmlos bedünkenden schönen Erlebnis des Schaukelns gewidmet ist; rasch wechselnde Blickwinkel, Film und Phantastik, da das „poetische Ich“ auf eine Schaukel montiert erscheint, die sich zwischen ihren Stricken hin und her, aufwärts und abwärts bewegt. Aufschwingend:
… zu meinen Augen der See
und die Sonne, weils schwingt, springt
blattwärts erreicht meinen Finger
der See mit blauschwarzem Buckel
rollt sacht ans Ufer zerplatzt
es sieht ein schweinsäugig Tier hervor, sagt
ich bin der See von Anbeginn…
(Ein Kettenkarussell – und das kennt man auch aus dem Kino – hätte ebenso oder noch besser zum Herantransport phantastischer, skurril deformierender Views taugen können; nein, es bedarf nicht unbedingt des von Sarah Kirsch in ihren Texten gelegentlich „eingesetzten“ exzessuösen Alkohol-Rauschs…) Niederschwingend:
… klatscht die Welle vom Ufer zurück, der See
ist glatt sein Tier
hats nie gegeben, ich schaukle
erreiche die Blätter das Gras…
− Extreme und agile Optik, die aus einer Landschaft drei, aus der vertrauten eine exotische macht, „Bewegung“ im spannungsreichen und produktiven Verhältnis zu der anderen, entgegenwirkenden Grundtendenz im Frühwerk, der zur Versachlichung, zu beinahe schon emotionsloser Deskription Sarah Kirsch war als Biologiestudentin natürlich zu Beschreibungsversuchen angehalten worden −, zum zuweilen etwas neckischen Understatement auch (William Carlos Williams kontert Rafael Alberti), charakteristischerweise am radikalsten herausgearbeitet in eben jenen Texten, die als „Fotografien“ bezeichnet werden – auch das von Lyrikern seit längerem verwendete „snap-shots“ wäre möglich gewesen −, die sich mit ihrer in der Tat schnappschußartigen Kälte und Unbewegtheit deutlich abheben von dem heftigen Bildersturz der vorangegangenen Poesien Sarah Kirschs; das Erstarrte der Bilder scheint auf das Erstarren der Produzentin weisen zu wollen… Das Gedicht „Im Baum“ bezeichnet übrigens am Rande (am Ende) auch den Punkt kurz vor solcher mehrmals vollzogenen Wende (zum weniger Exaltierten hin); ein gewisses Mißtrauen gegen die in Gedichten wie „Im Baum“ angewendete Methode wird laut, da sie schließlich als etwas durch die Verhältnisse oder eigene Manien Aufgezwungenes erscheinen mag und Baum, Strick und Schaukel als Fesseln charakterisiert werden: „… sehe / zwei Ufer meins und das andere / rieche Apfelblüten weiß Häuser in meinem Rücken“ – das „Normale“ also – „kann los / von Baum und Strick…“ – Sarah Kirsch hat sich dennoch auch in Zukunft nicht davon abhalten lassen (können), sich immer wieder vom tristen Boden der Tatsachen abzustoßen und schräg nach oben zu schwimmen… (Es ist vielleicht kennzeichnend für die Situation in der Mitte der Sechziger, der ein viel bewunderter Qualitätssprung der DDR-Lyrik folgte, kennzeichnend auch für das Irritierende dieser Phase, daß in der gleichen Zeit neben Sarah Kirsch ein zweiter, noch entschiedener zum Phantastischen, ja, Phantasmagorischen tendierender Autor, nämlich der früh verstorbene „Naive“ Uwe Greßmann sich seine kuriose Theorie von der „geometrischen Idylle“ ausdenkt, die ähnliche poetische Tricks im Umgang mit einer deutlich als mißlich gekennzeichneten Realität empfiehlt, wie sie Sarah Kirsch in mehr oder weniger geglückter Weise vorführt. Nach Greßmann kommt es freilich weniger auf die „Bewegung“ an – der er in vielen seiner Gedichte dennoch Tribut zollt – als auf die räumliche Entfernung von den Dingen, die es zu besingen gilt, die möglichst nicht zu knapp bemessene Distanz zwischen dem Dichter und seinem Objekt, dank derer es erst „schön“ oder „häßlich“ – und Greßmann geht es um die Rettung des Schönen −: „Stehe ich dicht vor einem Haus, daß ich bloß Mörtel, Risse… der Wände anstiere, so ist der Eindruck, den ich von der Welt gewinne, langweilig. Es ist der berühmte graue Alltag… / Liegen die Bauklötzer vor mir in der Ferne wie eine Stadt zum Spielen über den Gärten ausgebreitet, so ist der Eindruck, den ich nun von den Häusern gewinne, ein poetischer: die Feier…“ Und die Straßenbahnen „spielen“ auch nur dann „in der Kurve Geige“, wenn man nicht direkt an der Kurve wohnt, sondern einige Straßen entfernt! – Man kann diese von Uwe Greßmann, dem einzigen wichtigen Vertreter einer literarischen l’art brut in der DDR, in vollem Ernst mitgeteilte poetologische Erwägung rechtens als unfreiwilligen Beitrag zur Welt des schwarzen Humors betrachten; ernst zu nehmen bleibt sie als Ausdruck eines Dilemmas bei der Auseinandersetzung mit den Realitäten rings, eines Dilemmas, von welchem sich in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre zeitweilig auch andere Poeten der DDR betroffen finden – unterschiedliche Lösungswege im Blick, z.B. den noch protzigerer Antike-Rezeption…) Zurück zum Filmischen, wichtig für Sarah Kirsch bis heute, auf das auch in Allerlei-Rauh noch gut ein dutzendmal so oder so angespielt wird! Als direkt mit dem „Baum“-Gedicht verknüpftes Muster für weiterführende Varianten bietet sich „Schöner See Wasseraug“ dar, gleichfalls im Landaufenthalt von 1967 zu finden, Beschreibung eines märkischen Sees, der seine Ufer wählte „inmitten heimischer Bäume / Kiefern und Laubwald Weiden und Birken…“; in der zweiten Strophe aber
ist die Sonne in Tücher gewickelt und fern
das andere Ufer verschwimmt, seine Hänge
sanft abfallende Palmenhaine
erreichen dich, du
einem langsamen Flußarm ähnlich
birgst Krokodile und lederne Schlangen
seltsame Vögel mit roten Federn
fliegen dir quellwärts…;
die dritte Strophe präsentiert den See in wieder „anderer Landschaft / er weiß alle“ – alle Landschaften! – „jetzt hat er das Ufer der Marne / ein Stahlbrückchen eckige Häuser Büsche…“ (Als Schlußpointe ein Motiv, wir kommen darauf zurück, das vermutlich in die meisten dieser Gedichte ausgesprochen oder unausgesprochen hineinwirkt: „Mein schöner Bruder… // … er singt das Lied / vom See der zum Fluß wurde / aus Sehnsucht nach fremden Flüssen und Städten“) – Von solchen Versen ist es nicht weit zu einem Gedicht wie „Lange Reise“, ein pur phantasmagorisches, „gesponnenes“ Gebilde, in dem ein „Wir“ (sic!) gleichsam in Siebenmeilenstiefelsätzen von Ort zu Ort, Landschaft zu Landschaft, Kontinent zu Kontinent springt (oder jettet) – „Kunst der umherschweifenden Seele, des Kinos im Kopf“ oder Kunst dessen, der vor dem Fernsehapparat sitzt und alle paar Sekunden mittels Knöpfchendruck die Programme wechselt, als säße er an einem verrückten Mischpult: „Jetzt wolln wir mal nach Birmingham gehn… Dann wolln wir lieber Onkel Olaf besuchen, der liegt unten am Sund… So nehmen wir den Weg auf die Shetland-Inseln… Jetzt wird es aber Zeit, daß wir Palmbäume sehen… Nun müssen wir bis Köln hinlaufen, sehr weit unten hat der Koch von Birmingham gesagt…“ Undsoweiter. Verse, die sowohl an die weiten landschaften- und namenreichen Prospekte Walt Whitmans oder Majakowskis denken lassen als auch – und das, obwohl es sich hier um ein locker gefügtes Hintereinander handelt – an jene Erscheinung in der Frühzeit des Expressionismus, die als „Simultanismus“ bezeichnet worden ist; dem üblichen Film-Hintereinander hat in seinen Versen „Kinematograph“ auch Jakob van Hoddis, einer der Erfinder des Simultanismus, entsprochen:
Der Saal wird dunkel. Und wir sehn die Schnellen
Der Ganga, Palmen, Tempel auch des Brahma,
Ein lautlos tobendes Familiendrama
Mit Lebemännern dann und Maskenbällen.
Man zückt Revolver, Eifersucht wird rege.
Herr Piefke duelliert sich ohne Kopf.
Dann zeigt man uns mit Kiepe und mit Kropf
Die Älplerin auf mächtig steilem Wege…;
etcetera. – Daß die Aufnahme von Lyrik in der Regel nichts mit der „Einfachheit“ oder der „Wirklichkeitsnähe“ von Texten zu tun hat – andernfalls müßte ja Brecht mit manchem ebenso in der Gunst des Arbeiter-Publikums stehen wie Wilhelm Busch oder Hans Georg Stengel; keine Red’ davon! −, das wurde wieder einmal durch den Umstand deutlich, daß gerade diese im Unterschied zu manchen anderen Gedichten Sarah Kirschs ungewöhnlich schlicht aufgesagte „Lange Reise“ und ähnliches der Dichterin den Vorwurf der Neigung zum „Modernismus“ und zum Weltfremd-Exzentrischen eingebracht hat.
Unsereins griff sich schon damals verzweifelt an den Kopf: Es war doch mehr als offenkundig, daß der rasche Orts- bzw. Bildwechsel, wie die „Lange Reise“ ihn zeigte, eine allabendliche Erfahrung von Millionen DDR-Bürgern war, Tag für Tag dem „Engelsflug“ rund um die Welt verfallen, vorzüglich dank der zwei oder drei erreichbaren exotischen westlichen Fernsehprogramme; nicht zu vergessen das letztendlich doch immer unbefriedigte Hin- und Hergehüpfe zwischen den verschiedenen sogenannten Kanälen… Um noch einmal (und nicht zu lange, bitte) darauf zurückzukommen: Es wäre lächerlich zu leugnen, daß die besondere poetische Methode Sarah Kirschs dem miserablen Fakt der dem DDR-Bürger staatlicherseits verordneten Beschränkung der Reise-Möglichkeiten einiges zu „danken“ hat, Umständen also, die die Existenz aller bewußten Menschen im Lande bis in den Traum hinein stigmatisieren, selbstverständlich auch die der eher privilegierten Poeten (die sonst keine wären); immerhin heißt es in dem später beiseite gelegten und auch nicht in den leipziger von Elke Erb herausgegebenen Reclam-Band Musik auf dem Wasser (1977) aufgenommenen Gedicht „Kleine Adresse“ schon aus dem Jahr 1964, in einem Gedicht, das als Vorstufe der „Langen Reise“ gelten kann: „Aufstehn möcht ich, fortgehn und sehn… / … / fortgehen möcht ich, sehn und / wiederkommen.“ (Und das gleiche Lied hörst du als Leipziger, Magdeburger oder Ostberliner immer noch zwölfmal am Tag.) – Trotzdem, vor einer allzu einsträhnigen Zurückführung dieses poetischen Werks auf die spezifische Problematik der DDR und ihrer Bewohner sollte besser gewarnt sein. Ohne alles Brimborium: Wie alle andere Poesie, die heute zählt, spricht auch diese vor allem von der Not der Welt am Ende des zwanzigsten Jahrhundert – und, deutlicher vielleicht als manches andere, von zerscherbten Hoffnungen:
Grabsteine Flursteine der hohe Mut
Flog mit den Schwalben davon. (So in den Versen „Geröll“ von 1983.)
Sarah Kirsch in einer vor etwa zwei Dezennien verfaßten autobiographischen Notiz: „Geboren an Chaplins 46. Geburtstag in Winzigerode, einem wirklich kleinen Harzdörfchen…“ – Ja, vielleicht kommen sie wirklich in gewisser Beziehung auch aus Winzigerode, die zahlreichen Fliege-Wesen Sarah Kirschs, vom Blocksberg, vom Hexentanzplatz bei Wernigerode (aus der reichen Welt der Harzmärchen also); um sich dann viel später unter anderem dank der Begegnung mit der Poesie z.B. Rafael Albertis – wir folgen einem Nebenher-Wink Karl Mickels – um Grade zu veredeln und ihre Provinz zu verlassen: Es ist natürlich nur ein Moment, doch das allerunwichtigste sicher nicht im Zusammenhang mit der Herausbildung ihres poetischen Apparates, daß für die Dichterin gerade im richtigen Moment, nämlich im Jahr ’59, in der DDR eine repräsentative Auswahl aus den Poesien des damals im Westen noch kaum wahrgenommenen Rafael Alberti erscheint, der umfangreiche Band Nesselerde und Guitarre (Nachdichtung: Erich Arendt und Katja Hajek-Arendt), der auch für einige andere Dichter der Sarah-Kirsch-Generation wichtig geworden ist und in besonderem Maße wieder für Uwe Greßmann… Die Entwicklung der DDR-Poesie ist nicht gerade arm an solcherlei Besonderheiten; aber daß dank der Vermittlung durch Erich Arendt die Albertischen Engel-Schwärme in jenen Jahren das Territorium der DDR erreichen konnten – eine „Luftraumverletzung“ der dritten Art sozusagen! −, das ist „schon’n Ding“. (Seit 1980 gibt es die Sammlung Sobre los Ángeles auch separat als Bändchen 1034 der in Leipzig erscheinenden Insel-Bücherei, und zwar spanisch und deutsch: „Von den Engeln“.) Es bleibe bei einem Beispiel, dem offenkundigen der Rezeption auch der verführerischen maritimen Capriccios durch die Binnenländerin Sarah Kirsch; so sieht man Albertis „will kein Boot Schifferherz / will über Meer zu Fuß zum Hafen“ („Der Leuchtturmwärter und seine Braut“) von Sarah Kirsch in „Das grüne Meer mit den Muschelkämmen“ u.a. mit den Zeilen „Einfach so, vor dem Neuen Jahr / ging seine Frau übers Wasser“ (die Frau eines Leuchtturmwärters natürlich) ohne Versteckspiel variiert, was nicht ohne Folgen für Späteres bleiben wird; modifiziert (und gleichsam umgedreht) heißt es z.B. im Motto-Gedicht der Zaubersprüche, dem viel zitierten „Anziehung“:
Nebel zieht auf, das Wetter schlägt um.
Der Mond versammelt Wolken im Kreis.
Das Eis auf dem See hat Risse und reibt sich.
Komm über den See.
(Und in Allerlei-Rauh von ’88 erinnert sie sich neuerlich solcher Motive, da sie sich – wie nicht gerade selten – wieder einmal in ihre Vergangenheit zurückschwingt; doch jetzt ist es wieder sie, die übers Wasser geht: „… oho wenn ich dort bin, werde ich eine Elbschiffermütze auf dickem Haar, das die Flügel schlägt, tragen und übern Schnee, unter dem Katzenkopfpflaster liegt, kommen, auf zugefrorenem See mit Rissen zu gehen, nach dem, dem die Mütze gehörte, zu rufen…“ – Wie auch der Titel Allerlei-Rauh eine Wiederaufnahme ist, zum ersten Mal für jene Abteilung in dem Band Drachensteigen von 1979 verwendet, der die letzten der in der DDR verfaßten Gedichte enthält.) Ja, es bleibe bei diesem einen Beispiel, das allerdings auch auf ein Faktum aufmerksam machen möchte, wie es dem öffentlichen bzw. literaturwissenschaftlichen Bewußtsein bis heute weitgehend entgangen zu sein scheint: Daß nämlich die sogenannte mittlere Generation der DDR-Lyriker um die Wende von den fünfziger zu den sechziger Jahren sich nicht allein zum „Klassischen Erbe“ der Klopstock, Hölderlin, Goethe ins Verhältnis gesetzt hat, sondern mit kaum geringerem Eifer zur internationalen poetischen Moderne, beides in der Regel hoch bewußt. (Die Geburt der wesentlicheren Lyrik der DDR läßt sich ohne Berücksichtigung solchen Umstands eigentlich nicht so recht erklären.) Und es wurde keineswegs nur die sowjetrussische Moderne der zwanziger Jahre – Achmatowa, Mandelstam, Blok, Jessenin – von diesen Autoren (auch nachdichterisch) entdeckt, sondern nicht minder die des Westens bis hin zu der damals in den USA wütenden Beat-Literatur (die z.B. auf Volker Brauns frühen „Jugend-Zyklus“ durchgeschlagen hat). Sarah Kirsch hat damals nicht nur für sich allein gesprochen, als sie in einem Interview ein wenig provokant die in der DDR noch längst nicht gedruckten William Carlos Williams und Ezra Pound zu ihren „Lieblingsdichtern“ gezählt hat. Rafael Alberti, den durch Erich Arendt in der DDR vielfach bekannt gemachten, hat sie nicht genannt; es war nicht nötig… – In Allerlei-Rauh, um dies noch nachzutragen, braucht es der richtigen Engelsflügel nicht mehr; sie sind inzwischen für die Dichterin zu den schlichteren „Flügeln der Phantasie“ geworden, heftig benutzte jedoch: „Wie in jenem bezaubernden Sommer kann ich jederzeit mit Hülfe phantastischer Flügel in Caros Küche mich schwingen…“ (ins Mecklenburg des Jahres ’78). In dieser Wunderküche finden wir uns freilich wieder einem Engel gegenüber, in dessen Zügen auch etwas von dem allerfrühesten „Gleisarbeiterschutzengel“ aufglimmt: Carola statt Angela, Hüterin einer mecklenburgischen Sommeridylle ohnegleichen am Ende der Siebziger (kurz vor dem Crash), eine Dame „von solch unbeschreiblicher südländischer Schönheit, daß sie recht daran tut, in der Einöde zu wohnen“, wie die Hexen es indessen nicht anders tun; ein Schutzengel wieder letztendlich, „damit uns nichts überrollt“, welcher sein Arbeitsverhältnis zum VEB inzwischen gekündigt zu haben scheint, in dessen nun ländlichem Umkreis man den Widerlichkeiten der Welt wenigstens eine Gnadenfrist lang entrückt ist. „Wesen wie Carola trifft man selten oder nie im Leben…“; was könnte das anderes sein als neuerlich ein Objekt für die Angelologie? (Aber Kassandra wohnt gleich nebenan.)
Adolf Endler, Bizarre Städte Bd. 3, 1988
Sarah Kirsch ist eine Hexe
Ich möchte gern ein paar Worte zu den Gedichten von Sarah Kirsch sagen. Das fällt mir nicht ganz leicht. Sarah Kirschs Gedichte sind, trotz oder wegen ihrer öffentlichen Rolle, zerbrechlich und geheim. Sätze über sie können sie verletzen. Es ist aber nicht etwa schwierig, über Sarah Kirschs Gedichte zu sprechen, weil sie immer etwas mit ihren – und dann auch mit unsern – Gefühlen zu tun haben. Über Gefühle kann ich sprechen, auch öffentlich. Eher meine ich, daß Sarah Kirsch in ihren Gedichten eine nicht leicht beschreibbare Gratwanderung geht: einesteils sucht sie in sich ständig nach Worten für etwas, was auch für sie selber grad eben noch wortlos gewesen ist (und sie stößt dabei natürlich auf die Begriffe, die reibungslos im allgemeinen Verständnis aufgehen). Andrerseits hält sie sich, fast wie ein Medium, offen für die Sehnsüchte und Ängste der Menschen, mit denen sie lebt. Eine Art Sprachrohr der verschütteten oder vielleicht nicht erlaubten Gefühle ihrer Gesellschaft. Jedes Gedicht kommt mir wie ein von mir nicht aufzuschlüsselndes Gemisch aus sehr öffentlichem und sehr Geheimem vor. Ein Geständnis großer Einsamkeit und eine Hoffnung, mit allen Menschen gemeinsam sein zu können.
Gedichte, auch wenn sie aus ganz normalen Wörtern zusammengesetzt sind, sagen etwas, was sich mit den normalen Wörtern eben nicht sagen läßt. Vielleicht würde auch Sarah Kirsch lieber mit andern Menschen sprechen statt ihnen Gedichte zu schreiben. Aber sie kann es nicht, oder nur zum Teil. Irgend etwas steht ihr im Weg: die andern, sie sich selbst. Vielleicht sind ihre Gedichte Mitteilungen an ihre Freunde aus dem Bereich, den sie ihnen nicht sagen kann. Früher wurden Gedichte nur gesprochen, das heißt, sie wurden gesungen. Heute schreibt Sarah Kirsch sie an einem Ort auf, und wir lesen sie an einem andern Ort. Das ist natürlich ein Verlust. Die Welt ist groß geworden. Petrarca, zu dessen Zeit man für eine Reise von Avignon nach Rom drei Monate brauchte, konnte sich trotzdem in einer überschaubaren Welt fühlen. Er konnte sich auch, offenbar, des Wortes mächtig fühlen. Bei Sarah Kirsch würde ich zögern, sie des Wortes mächtig zu empfinden. Allein schon der Begriff „mächtig“ kommt aus einer andern Welt als ihre Gedichte. Heute gehen vielleicht nicht die Dichter besonders souverän mit den Wörtern um, sondern das tun die Politiker oder die Journalisten oder der sprichwörtliche Mann auf der Straße. Der gebraucht seine Wörter ohne das leiseste Bauchgrimmen. „Alles klar“, sagt er zur sprichwörtlichen Frau auf der Straße, obwohl fast alles sehr unklar ist. Sarah Kirschs Gedichte sprechen also eher davon, daß das Leben eine schwierige Sache ist, wenn man es einigermaßen identisch mit sich selber tun will. Dabei sind sie nie wehleidig. Sie sind, weil sie die Trauer der Verluste nicht verleugnen, auf eine unauffällige Art mutig. Sie sind voll wilder Sehnsucht nach einem intensiven, sinnvollen Leben.
Man könnte sich heute nicht mehr vorstellen, daß ein Dichter wie damals Petrarca auf einem Karren, von Jungfrauen gezogen, bekränzt, mit einer Toga bekleidet, und einer Lyra unter dem Arm, durch die Straßen gezogen würde, umtost vom Applaus der Masse. Trotzdem hätten wir ja eine geheime Lust, so etwas mit Sarah Kirsch und Ernst Meister zu tun, und ein ganz kleines bißchen tun wir es ja auch. Schon zu Petrarcas Zeiten waren so Feiern vermutlich ambivalent: eine Frau vergriff sich bekanntlich in ihren Flaschen und schüttete über den bekränzten Dichter, statt eines wohlriechenden Parfüms, etwas Ätzendes. Dem armen Petrarca fielen in der Folge die Haare aus.
Ich will noch ein bißchen weiter abschweifen: seitdem wir gelesen haben, daß Präsident Kennedy in einer Minute zehn Seiten Prosa lesen konnte, sind seine Leseleistungen das Ideal der Leser in Industrienationen überhaupt geworden. Woran wir ein Jahr schreiben, das schafft der an Spiegel-Lektüre geschulte Leser in einer Stunde. Das gesteigerte Lesetempo hängt aber auch damit zusammen, daß Gedrucktes mehr und mehr keine neuen Erfahrungen mehr vermitteln soll, sondern nur noch dazu dient, alte Erfahrungen in neuen Wortarrangements zu bestätigen. Schreiben für die Massenmedien ist für viele Journalisten heute zu einem Verpackungsproblem degeneriert. Gedichte aber geraten in einen immer heftigeren Widerspruch zum sog. normalen Lesen. Sie ertragen nur ein sehr langsames Lesetempo.
Man muß in ihnen wirklich neugierig auf die Erfahrungen von jemand anderem sein und kann nicht nur auf das tägliche bestätigende Aha-Erlebnis lauern. „Ich kannte nur mich“, sagt Sarah Kirsch in einer Zeile eines ihrer Gedichte, „und das war zuwenig.“ Das ist zu wenig. Aber manche Leute leben tatsächlich so, als hätten sie schon einmal gelebt. Sie wissen alles erschreckend genau. Manche Leute leben so, als könnten sie später einmal das Versäumte nachholen. Es scheint ihnen gar nicht darauf anzukommen, daß sie im einzigen Leben, das sie haben, gefühllose Säue, eingebildete Besserwisser, korrupte Spekulanten oder sture Langeweiler sind. Sie scheinen gar nie zu denken, daß es ihr einziges Leben ist, das ihnen da unter der Hand zerrinnt, nutzlos, trostlos, hoffnungslos. Sarah Kirsch aber lebt gern, oder sie möchte gern leben. Sie liebt das Leben, und sie liebt die Menschen. Sie weiß, daß wir alle nur mit Wasser kochen. Aber dahinter ist bei ihr immer eine heftige Sehnsucht nach etwas Besserem, Schönerem, Heftigerem. Es ist kein Wunder, daß einer ihrer Gedichtbände Zaubersprüche heißt. Sarah Kirsch weiß, daß es einmal Wörter gab, die Berge zum Zerspringen bringen konnten – oder Menschen, die es glaubten. Sie ist eine oft melancholische Zauberin. Sie hat begreifen gelernt, daß die Berge nicht wirklich zerspringen, wenn man sie bespricht. Nichts zerspringt wirklich vor den Wörtern der Dichter: Gefängnismauern nicht, keine Grenzen, keine Türen, keine zugemauerten Herzen, nicht einmal das eigene. Sarah Kirschs Gedichte haben zuweilen eine Art Dennoch-Magie. Sie setzen auf das magische Wort, obwohl sie wissen, daß die Magie nicht wirkt. Sarah Kirsch ist, wie alle Dichter, nicht mächtig, sondern ohnmächtig. Sie jammert nicht darüber. Sie hält sich nicht für etwas Besseres.
Die DDR-Behörden, denen ich keinen poetischen Sinn nachsagen will, scheinen zu vermuten, daß der Petrarca-Preis eine Art gesamtdeutscher Preis sei. Mindestens scheinen sie es sich nicht anders erklären zu können, weshalb dieser Preis zwischen einem Lyriker aus der Bundesrepublik und einer Lyrikerin aus der DDR geteilt worden ist. Sie scheinen sich nicht vorstellen zu können, daß wir den Preis zwischen zwei Lyrikern geteilt haben. Aber natürlich sehe ich nicht davon ab, wenn ich Sarah Kirschs Gedichte lese, daß sie sie in der DDR geschrieben hat. Natürlich lese ich sie auch als politische Gedichte. Sie sind ja nicht im luftleeren Raum entstanden und meinen mit ihrer liebevollen Trauer auch den Ort, an dem sie lebt. Gewiß spiegeln sie, wie jede künstlerische Leistung, auch unfreiwillig den verformenden Druck wider, den ihre Gesellschaft auf sie ausübt. Leider ist die DDR ein Staat, der auch nicht davon absieht, ihre Bewohner mit den bekannten Machtmitteln eines Obrigkeitsstaats einzuschüchtern. Aber was tut die Bundesrepublik denn anderes? Auch wir werden immer massiver diszipliniert. Wenn der Paragraph 88a keine massive Drohung an die Schreibenden ist, was dann?
Sarah Kirschs Gedichte sprechen alle von Freiheit. Sie hat einen heftigen, unideologischen Freiheitsbegriff, der sich gewiß auch an den Grenzen der eigenen Psyche und Physis reibt. Aber es ist wichtig, daß irgendwer heftige Freiheitssehnsüchte ausspricht und aufbewahrt. Die Erinnerung an schon einmal Errungenes oder in Zukunft Mögliches geht so schnell verloren. Die Hühner in den Leganstalten denken, daß die gesamte Welt aus einer Stange, einem Neonlicht, Hormonfutter und andern Hühnern besteht. Weil die Hühner es nicht geschafft haben, eine kulturelle Tradition aufzubauen, ist ihnen jede Erinnerung an stolze Hähne, weite Hühnerhöfe, grüne Wiesen und blauen Himmel verlorengegangen.
„Ich hoffe“, sagt Sarah Kirsch zu ihren Zaubersprüchen, „daß Hexen, gäbe es sie, diese Gedichte als Fachliteratur nutzen könnten.“ Sarah Kirsch ist auch eine Hexe: Hexen reiten auf ihren Besen lachend über soziale und innere Schranken hinweg, mit hohem Risiko. Sie sind verbrannt worden, weil sie die Freiheit liebten. Vielleicht ist auch Sarah Kirsch, vielleicht sind auch wir nicht sicher, daß es nicht wieder eine Zeit gibt, in der ihr und uns so etwas zustoßen könnte.
Urs Widmer, aus: Petrarca-Preis 1975-1979, Privatdruck des Petrarca-Preises
Im Spiegel eigenen Empfindens
− Begegnung mit der Schriftstellerin Sarah Kirsch. −
(…)
Sie wohnt sehr hoch. Der Blick geht weit über Dächer und Straßen. Zu viel Beton, sagt sie. Aber dann ist da plötzlich dieses Licht. Ein seltsames, unwirkliches Violett übergießt die regengraue Stadt und verwandelt sie in eine Kulissenlandschaft. Ein Maler müßte das sehen, um diesen Augenblick festzuhalten. Oder ein Dichter. Löst dieser Anblick, der sie für Sekunden fesselt, einen Gedanken aus, der sich irgendwann in der Zeile eines Gedichts wiederfinden wird? Versöhnt er sie einen Atemzug lang mit ihrem Leben hinterm Schreibtisch in der X-ten Etage mit Lift und Klimaanlage, während es sie doch hinausdrängt zu Flüssen und Wiesen und Wäldern?
Einmal gab es eine Zelt in ihrem Leben, da sie das genießen konnte: Landschaft, den Geruch nach Stall und nach Tier, als sie ein Jahr lang in eine LPG geschickt wurde, um dort Kulturarbeit in Gang zu bringen. Damals hat sie zum erstenmal erlebt, wie das ist, so richtig müde zu sein von schwerer körperlicher Arbeit. Seitdem ist eine Sehnsucht geblieben und dieser Zweifel, ob das genügt für einen Menschen, sich anderen mitzuteilen, die Frage:
Ach warum bin ich Dichter, ackre den Wagen
der Schreibmaschine übers kleine Papierfeld, fahr Taxi
und koche mit Wasser?
Aber dann gibt sie selbst die Antwort darauf, wenn sie sagt: Schreiben, das ist für sie eine Befreiung. Es läßt ihr keine Zeit, darüber nachzudenken, ob das, was sie gerade macht, für andere von Bedeutung ist. Sie schreibt, weil es sie zum Schreiben zwingt. Erst später kann sie versuchen herauszubekommen, ob sie anderen damit etwas zu sagen hat, ob ihre Dichtung den Menschen hilft, ein wenig besser mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Sie möchte dem Leser das Gefühl vermitteln, daß er nicht allein steht, möchte seinen Blick erweitern und bereichern, ihm zurufen: Sieh, da ist einer, der so denkt und fühlt und lebt wie du, der dir ein Stück voranhelfen will.
Sarah Kirsch hat nach dem Studium der Biologie über eine Arbeitsgemeinschaft Junger Autoren in Halle zur Dichtung gefunden, hat sich auslachen lassen mit ihren ersten unbeholfenen Versen, hat geheult und tapfer weiter gedichtet. Der Leiter des Zirkels, der Schriftsteller Gerhard Wolf, hat sie gelehrt auszudrücken, was sie bewegt. Ein Jahr lang hat Sarah Kirsch als Diplombiologin gearbeitet, bevor sie das Literaturinstitut Johannes R. Becher besuchte. Die Lyrik-Seminare unter Georg Maurer haben ihr späteres Schaffen wesentlich beeinflußt. Sein Vorbild hat ihr Mut gegeben bei aller Unerbittlichkeit, mit der er Beispiele aus der Weltliteratur als Maßstab ansetzte. Später ist ihr über die Begegnung mit der Dichtung Bertolt Brechts klargeworden, daß es kein Wort gibt, das nicht literaturfähig ist. Brechts Verse haben ihr dabei geholfen, von falschen Vorstellungen freizukommen und den Weg zu finden, um das Alltägliche poetisch auszudrücken. Sie meint, daß Allgemeinverständlichkeit der Schönheit eines Gedichtes keinen Abbruch tut, hält es für eine Unsitte, hinter jedem Wort einer Zeile nach einem tieferen Sinn zu suchen, der sich dem von selbst enthüllt, der ihn braucht.
Viele Gedichte hat Sarah Kirsch aus fremden Sprachen ins Deutsche übertragen, polnische, sowjetische, russische Lyrik. Es wirkt erregend und anregend auf sie, sich in eine fremde Gedankenwelt hineinzuversetzen. Niemals sonst beschäftigt man sich so intensiv mit einem Gedicht, sagt sie. Jedes Wort, jeder Gedanke, jeder Tonfall muß stimmen. Sie hat soeben vietnamesische Kindergedichte übersetzt, einfache Verse über Spinne und Fledermaus, die nach schönen Reimen verlangen, wenn ihre Anschaulichkeit erhalten bleiben soll. Sie arbeitete zusammen mit dem Fotografen Roger Melis an einem Fotokinderbuch. Ihre Kenntnisse als Biologin kommen ihr zugute in einer Geschichte über die kleine Welt, die ein Wassertropfen umschließt. Im nächsten Jahr wird ein neuer Gedichtband von ihr im Aufbau-Verlag erscheinen. Irgendwann will sie sich auch wieder der Prosa widmen, nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten suchen.
Sie braucht zum Schreiben den Kontakt mit Menschen, den Gedankenaustausch mit Freunden, ihr kritisches Wort, die Tätigkeit im Vorstand des Schriftstellerverbandes, sie liebt es, bei der Arbeit hinterm Schreibtisch Schallplatten zu hören, die Musik von Bach, Haydn, Mozart, Gustav Mahler. Ihre innige Anteilnahme am Aufwachsen des eigenen Kindes prägt die bildkräftige Sprache ihrer Kindergedichte. Immer ist sie Problemen auf der Spur, immer aufnahmebereit für fremdes Erleben, das sie im Spiegel eigenen Empfindens zur Gestaltung drängt, täglich von neuem.
Gudrun Skulski, Neue Zeit, 21.12.1974
Lyrik-Eule
(…) Was nun Sarah Kirsch betrifft, von der im Aufbau-Verlag eine neue Gedichtsammlung unter dem Titel Zaubersprüche erschienen ist, so möchte ich über diese Poetin gern etwas freundliches und ein paar kleine Bosheiten äußern. Auf dem Schutzumschlag des Buches stehen „Acht Fragen an Sarah Kirsch“ und werden von ihr beantwortet. Gefragt nach dem Warum und Wieso des Buchtitels, antwortet sie:
Ich hoffe, das Hexen, gebe es sie, diese Gedichte als Fachliteratur nutzen könnten.
Und eben weil es ja viel mehr Hexen gibt, als manche Männer glauben, ist Letzteren diese Fachliteratur durchaus zu empfehlen. An die äußerste Sparsamkeit mit Interpunktionszeichen und an die Preisgabe aller Grammatik an die freie Assoziation, dieser offenbar unerlässlichen Stilmittel moderner Lyrik, muss der aufnahmebereite Leser sich freilich bei Sarah Kirsch ebenso wie bei anderen gewöhnen.
Lothar Creutz, Eulenspiegel, 2. Oktoberheft, 1973
Richard A. Zipster: DDR-Literatur im Tauwetter. Band III. Stellungnahmen
Andrea Marggraf: Ein Besuch bei Sarah Kirsch
Versprengte Engel – Wolfgang Hilbig und Sarah Kirsch ein Briefwechsel
Lesung in der Quichotte-Buchhandlung in Tübingen am 8.12.2023 mit Wilhelm Bartsch und Nancy Hünger sowie Marit Heuß im Studio Gezett in Berlin.
Begrüßung: Wolfgang Zwierzynski, Buchhandlung Quichotte
Einleitung: Katrin Hanisch, Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft e.V.
Zum 60. Geburtstag der Autorin:
Jens Jessen: Versteckte Aggressivität
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.4.1995
Zum 65. Geburtstag der Autorin:
Jürgen P. Wallmann: Verspielte Vision
Rheinische Post, 14.4.2000
Heinz Ludwig Arnold: Ein paar Abgründe überwinden
Frankfurter Rundschau, 15.4.2000
Peter Mohr: Meine schönsten Akwareller sint weck
General-Anzeiger, Bonn, 15./16.4.2000
Jürgen Israel: Das Herz hat einen Riss
Unsere Kirche, 16.4.2000
Horst H. Lehmann: Bibliophile Werkausgabe auf Büttenpapier
Neues Deutschland, 17.4.2000
Hans Joachim Schädlich: Sarah. Ein Geburtstagsgruß
Neue Rundschau, Heft 3, 2000
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Marion Poschmann/ Iris Radisch: Man muss demütig und einfach sein. Gespräch
Die Zeit, 14.4.2005
Michael Braun: Landschaften mit Endzeit-Boten
Basler Zeitung, 15.4.2005
Unter dem Titel Idyllische Apokalypse
Stuttgarter Zeitung, 15.4.2005
Helmut Böttiger: Hier ist das Versmaß elegisch
Badische Zeitung, 16.4.2005
Michael Braun: Die Schmerzzeitlose
Der Tagesspiegel, 16.4.2005
Johann Holzner: Das Leben verlängern
Die Furche, 14.4.2005
Christian Eger: Unter dem Flug des Bussards
Mitteldeutsche Zeitung, 16.4.2005
Alexander Kluy: Den Himmel vergleichen
Frankfurter Rundschau, 16.4.2005
Dorothea von Törne: Schütteln und weiterleben
Literarische Welt, 16.4.2005
Gunnar Decker: Fisch, der am Grund lebt
Neues Deutschland, 16./17.4.2005
Samuel Moser: Verse vom Rand der Welt
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.4.2005
Hans-Herbert Räkel: Ein Elefant muss über die Alpen
Süddeutsche Zeitung, 16./17.4.2005
Sabine Rohlf: Läuse bei Mäusen in der Umgebung von Halle
Berliner Zeitung, 16./17.4.2005
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Andrea Marggraf: „Bevor ich stürze, bin ich weiter“
Deutschlandradio Kultur, 13.4.2010
Erich Malezke: Natürliche Distanz zur Außenwelt
SHZ, 15.4.2010
Jürgen Verdofsky: Remmidemmi in Tielenhemmi
Frankfurter Rundschau, 15.4.2010
Wilfried F. Schoeller: Hier bin ich gern und immerdar
Der Tagesspiegel, 15.4.2010
Sarah Kirsch zum 75. Geburtstag
Thüringer Allgemeine, 16.4.2010
Rebekka Haubold: Sarah Kirsch feiert 75. Geburtstag
Radio für Kopfhörer, 16.4.2010
Gunnar Decker: Pirol unter Krähen
Neues Deutschland, 16.4.2010
Brita Janssen: Sarah Kirsch zum 75. Geburtstag
BZ, 16.4.2010
Peter Mohr: Meine Naivität war mein Glück
literaturkritik.de, Mai 2010
Michael Braun: „Alles ist auffindbar in meinen Spuren“
Konrad Adenauer Stiftung, April 2010
Zum 5. Todestag der Autorin:
Heidelore Kneffel: 1997 bei Sarah Kirsch in Tielenhemme
nnz, 5.5.2018
Zum 10. Todestag der Autorin:
Karin Kisker: Zum zehnten Todestag der Dichterin Sarah Kirsch
Neue Nordhäuser Zeitung, 5.5.2023
Wulf Kirsten: Rede auf Sarah Kirsch zur Verleihung der Ehrengabe der Heine-Gesellschaft 1992.
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Archiv + Internet Archive +
Kalliope + KLG + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 und weiteres
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
Nachrufe auf Sarah Kirsch: Spiegel ✝ FAZ ✝ FR ✝ Tagesspiegel ✝
Die Zeit ✝ Focus ✝ Die Welt ✝ SZ ✝ NZZ ✝ WAZ ✝ MZ ✝
KAS ✝ junge Welt ✝ Tagesschau ✝ titelblog


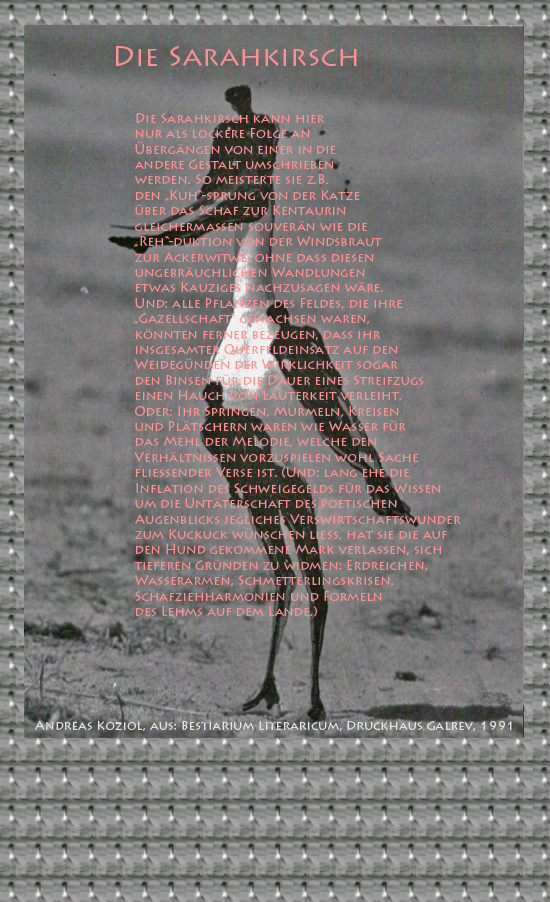













Schreibe einen Kommentar