Bert Papenfuß • Ronald Lippok: Psychonautikon Prenzlauer Berg
LITERATUR DICH SELBST INS KNIE
Ein erfülltes Arbeitsleben liegt hinter uns,
ein noch anstrengenderes Liebesleben vor uns;
untenrum erogen und enterogen, oben entheogen.
aaaEwig giert der Schlund,
aaaohne Zutaten keine Gedichte;
aaaliteratur du dich erstmal ins Knie rein!
aaaaaaAuge um Produkt, Produkt um Zahn…
Es ist richtig, wenn man mit den falschen Leuten
die falschen Sachen macht, und nicht umgekehrt, leider.
Werfen wir doch mal ein Auge auf den Produktionsprozeß1:
aaaEifrig giert der Schlund,
aaaohne Zutaten keine Gedichte;
aaaliteratur dich ins Knie noch mal!
aaaaaaAuge um Produkt, Produkt um Zahn
aaaaaa– die Not am Kunden treibt voran.
Ab uff’n Schwof mit Schickedanz, Schüddekopp, Lobe-
danz, Schlichtegroll, Rördanz, Störtebeker und Discomaus;
die Elite ist der Abschaum des Durchschnitts durch und durch:
aaaEitrig giert der Schlund,
aaaohne Zutaten keine Gedichte;
aaaliteratur dich andermal ins Knie rein!
aaaaaaAuge um Produkt, Produkt um Zahn
aaaaaa– die Not am Kunden treibt voran.
aaaaaaPardon, schon wieder einer tot?
Die Toten, mit denen ich gesprochen habe, sind jedenfalls einverstanden
mit dem Ausbau des Betäubungs-, Aufputschmittel- und Austauscharsenals,
das nicht greift, solange Liebe, Arbeit, Wissen nicht mit der Mutter der Ordnung
aaatief im Einklang sind –––
aaaohne Wirkmittel keine Gedichte;
aaaliteratur dich ins Knie ein für allemal!
aaaaaaAuge um Produkt, Produkt um Zahn
aaaaaa– die Not am Kunden treibt voran.
aaaaaaPardon, schon wieder einer tot?
aaaaaaAbgebissen und ausgekaut.
Abwärts an den Start!
Annett Gröschner im Gespräch
mit Bert Papenfuß und Ronald Lippok, Teil 1
„Eine Stirnmoräne ist eine endartige Wallakkumulation vor dem Gletscher des Materials.“ [Frei nach: www.geodz.com.]
Annett Gröschner: Euer Buch sollte eigentlich Pißpott Prenzlauer Berg heißen. Was verbirgt sich hinter dem Titel?
Bert Papenfuß: Für mich war die Initialzündung eine Äußerung von Ronni, als wir vor ein paar Jahren im Golden Pudel Club in Hamburg aufgetreten sind. Tarwater, die Band von Ronni und Bernd Jestram hat gespielt, ich habe gelesen, und Pehlemann von Zonic [Alexander Pehlemann ist Herausgeber des Magazins Zonic – Kulturelle Randstandsblicke und Involvierungsmomente, Redaktionsmitglieder seit einigen Jahren sind Robert Mießner und Bert Papenfuß: siehe: http://www.zonic-online.de/] hat aufgelegt. Das war die Konstellation. Wir kamen rein in den Pudel Club, ein ziemlich ranziger Laden eigentlich…
Annett: … wo es immer nach einer Mischung aus Elbwasser und Sperrholz riecht…
Bert: … und Ronni meinte: Willkommen im Pißpott!
Ronald Lippok: In Anlehnung an das Grimmsche Märchen, denn wir hatten da vor Jahren gespielt, bevor wir dann eine internationale Karriere gemacht haben. Das war eines unserer ersten Konzerte. Da wurden damals noch Mikrophone an Besenstiele getapt. Und dann kamen wir viele Jahre später zurück.
Bert: Und zwischendurch Südamerika, Japan, USA, Royal Albert Hall und dann, zack, wieder in den Pudel Club. So kam das. Das hat uns an das Märchen erinnert.
Annett: Ich hab auch sofort an den Fischer un sin Fru gedacht, aber in einem anderen Sinne, ich dachte Pißpott Prenzlauer Berg geographisch. Jeder von uns hatte anfangs hier so eine kleine abgeratzte Bude mit schlecht funktionierendem Kachelofen, Außentoilette und einfachen Fenstern. Und jetzt wird dieser Ort auf eine Weise aufgebauscht, als sei das ein alter Adelssitz. Und jeder, der etwas auf sich hält, baut sich ein Schloß an die Ecken oder aufs Dach oder kauft eine Wohnung, die so teuer ist wie der Erlös aus einem Nobelpreis. Aber die Frage ist, ob wir am Ende nicht am selben Ort wieder im Pißpott sitzen, und die anderen sind über alle Prenzlauer Berge, in der nächsten imaginierten Blase. Also meine Interpretation ist verbunden mit einer sehr gegenwärtigen Form von Hybris, immer mehr haben zu wollen, und am Ende ist dann nichts mehr da.
Bert: Diese Auslegung ist impliziert.
Ronald: Sehnsucht nach dem Pißpott ist akzeptiert…
Genau, der Pudel Club war der Anlaß. Es gab dann die Anfrage von starfruit publications. Erst hatte Bert vorgeschlagen, das Buch Pißpott Prenzlauer Berg zu nennen. Wie nennst du das jetzt: Psycho…?
Bert: Jetzt heißt es Psychonautikon Prenzlauer Berg.
Annett: Willst du das auflösen?
Bert: Psychonautikon? Psychonaut ist eine Bezeichnung für einen Drogenfreak.
Ronald: In Anlehnung an Kosmonaut. Jemand, der nicht den Kosmos, sondern die Seelengründe erforscht.
Bert: Ich weiß nicht, wer das Wort zum ersten Mal verwendet hat. Psychonaut ist ein Begriff, der nicht von mir ist, sondern wahrscheinlich aus dem Hippie-, Spacerock-Umfeld der 60er und 70er Jahre kommt.
Annett: Ich habe den Begriff völlig anders interpretiert. Ich dachte, in Psychonaut steckt die Nautik, man bewegt sich übers Meer, macht das aber nicht mit irgendwelchen nautischen Gerätschaften, wie einem Kompaß oder so, sondern verläßt sich auf seine Psyche. So interpretiere ich auch eure Karten. Die stimmen ja nur ansatzweise mit der Topographie eines Berliner Stadtplans überein. Ihr habt euren ganz persönlichen Stadtplan im Kopf, den ihr lebt oder gelebt habt, der anders ist als der, den man kaufen kann. Eine sogenannte kognitive Karte.
Ronald: Genau so sind die Sachen auch entstanden. Wir haben nicht reale Stadtpläne bebildert oder beschriftet, sondern einen imaginären Prenzlauer Berg entworfen.
Bert: Es ist natürlich so, daß manchmal Straßen, zu denen man eine Beziehung hat, viel näher beieinander liegen als auf dem tatsächlichen Stadtplan.
Annett: Ich finde, die Karten sind in einem doppelten Sinne kognitiv. Zum einen ist die Geographie nicht real. Und gleichzeitig verhandelt ihr mit den Bezeichnungen, die von euch über die Pläne gestreut sind, verschiedene Zeitebenen. Es gibt Orte und Straßennamen, die schon lange nicht mehr existieren, die nächste Straße auf dem Plan hat dann aber den heutigen Namen und bezeichnet heutige Etablissements.
Ronald: Das stimmt absolut. Das sind verschiedene Schichten. Wir haben absichtlich Zeit und Geografie vernachlässigt.
Bert: Was heißt vernachlässigt? Entzerrt. Denn das ist ja das, was passiert, wenn man psychedelische Drogen nimmt, daß die Zusammenhänge einfach anders werden.
Annett: Und ihr habt das imaginiert?
Bert: Ja.
Annett: Oder habt ihr die Pläne auf irgendeine Weise benutzt?
Ronald: Für eine Alltagseffizienz ist das natürlich schlecht. Also ich würde kaum einem Touristen raten, mit den Plänen auf Wanderschaft zu gehen, wobei, andererseits, vielleicht gerade.
Annett: Wieso nicht? Er kommt dann da an, wo er nicht hin wollte. Völlig neue Räume tun sich ihm auf.
Ronald: Das wäre nicht die schlechteste Folge.
Annett: Werbetechnisch könntet ihr das natürlich so machen, daß alle Wege in der Rumbalotte enden.
Ronald: Das tun sie ja oft von alleine. Die Karten stehen auch in der Tradition der Scherzkarten, die es schon seit dem Barock gibt, also Karten, die nicht real sind.
Annett: Die Weltkarte, die in jedem Schulatlas ist, ist auch nicht real, die ist zentriert auf Europa. Die Welt kann man auch ganz anders sehen.
Ronald: Es gibt ja diese berühmte Karte der Surrealisten, wo die Osterinseln größer sind als die USA. Ich glaube, die USA sind so kleine Flecken, kann sein, daß sie sogar nur aus Hawaii bestehen.
Bert: Das mit den Scherzkarten war eine Idee von Ronni. Da haben wir angeknüpft.
Annett: Hast du vorher schon mit Topographien gearbeitet?
Ronald: Karten haben mich schon immer interessiert, aber ich habe damit noch nie so experimentiert, wie wir das jetzt gemacht haben. Hier sind ja ganz reale Orte und reale Erlebnisse in diese ausgedachten Strukturen eingeflochten.
Bert: Ich bin ein großer Kartenfan. Ich hab auch viele zu Hause. Ich lese immer Karten, wenn wir Auto fahren, und bin dann völlig fasziniert von den Orts-, Flur- und Gewässernamen, das ist schon seit der Kindheit so.
Ronald: Das sind Schatzkarten. ja. Ich glaube, eine der ältesten zeichnerischen Betätigungen der Menschen sind Karten; wo das nächste Wasserloch liegt, und wo die Herden sich so rumtreiben.
Annett: Ich bin auch ein richtiger Kartenfreak. Aber ich muß sie in der Hand haben und zurechtfalten können. Mit Karten im Internet kann ich nichts anfangen, weil sie so unhaptisch sind. Am liebsten mag ich alte Stadtpläne von Berlin.
Bert: Hab ich auch viele.
Ronald: Das war in der Zusammenarbeit mit Bert schon zu spüren, daß er von Karten was versteht, weil, er hat ja alle eingenordet. „Nee, Ronni, Norden ist hier, sorry, wenn das Metzer Eck da ist“, da war mit ihm nicht zu spaßen. Mein Norden dagegen wechselt eigentlich täglich.
Annett: Der Norden ist auch nicht immer da, wo der Norden eigentlich sein sollte. Viel deutlicher ist das in Berlin aber natürlich mit Ost und West. Der Westen kann ja auch im Osten liegen oder umgekehrt.
Ich mag diese Schwarzpläne, wo man die Verdichtung von Stadt sieht, die steinerne Stadt ist schwarz, die Grünanlagen und Plätze weiß, je größer die Verdichtung, desto dunkler die Karte. In den 1930er Jahren ist der Prenzlauer Berg komplett schwarz mit ein bißchen Volkspark Friedrichshain als weißer Punkt drin. Nach dem Krieg war es viel weißer, und jetzt verdichtet es sich wieder.
Ronald: Ich hätte auch eine Handvoll Erbsen nehmen und auf die Erde werfen können, und wir hätten die dann beschriftet. Ähnlich zufällig sind auch diese Karten zustande gekommen. Wir haben überlegt: Was ist für uns in der Gegend von Bedeutung gewesen, oder was ist es noch?
Aber vielleicht klappern wir einfach mal ein paar Orte auf den Karten ab.
Annett: Ja, genau. Also was mir aufgefallen ist bei der originalgrafischen Ausgabe [Bert Papenfuß, Ronald Lippok. Pïßpott Prenzlauer Berg. Vorabausköppelungen aus Psychonautikön Prenzlauer Berg. Mit Altlastern konterkariert. – Zeichnungen: Ronald Lippok. Texte und Textgrafiken: Bert Papenfuß. Totalgestaltung (inkl. Satz der Textabdrucke): rag, Wien. Handgedruckt und handgebunden im November 2013 in der Edition Rothahndruck, Berlin. Einmalige nummerierte und signierte Auflage: 30 Exemplare.] eures Buches, daß vorne zwar Pïßpott Prenzlauer Berg draufstand, aber der einzige Ort, der geographisch dem Prenzlauer Berg zuzuordnen ist, eigentlich nur die Darmschleimerei ist, weil das Schlachthofgelände, auf dem sie steht, zum Prenzlauer Berg gehört. Alle anderen Kartenausschnitte liegen außerhalb der Grenzen des Stadtteils.
Bert: Wir nennen diese Gebiete im Buch „angeschlossene Siedlungsabgründe“. Damit sind Friedrichshain, Pankow, Mitte und alles drum herum gemeint.
Annett: Ich dachte, ihr geht davon aus, daß Prenzlauer Berg…
Bert: nicht mehr existiert.
Annett: eine Imagination ist, also im Sinne von: „Mein Prenzlauer Berg ist nicht dein Prenzlauer Berg“. Oder: „Das, was du darunter verstehst, ist für mich unerheblich. Wenn ich Prenzlauer Berg meine, sehe ich den Leninplatz.“ So dachte ich.
Ronald: Das ist insofern schon ganz richtig gesehen, daß wir uns rausgenommen haben, den Prenzlauer Berg zu definieren. Das führt uns dann auch an Orte, die streng genommen nicht dazu gehören. Oder auch durchaus kosmische Eckpunkte, es gibt ja auch diese Spacerock-Ausflüge im Text…
Annett: Der Begriff Prenzlauer Berg ist ja umdefiniert. Es gab Paradigmenwechsel von Arbeiterbezirk über Bohème bis hin zu Latte-Macchiato-Bio-Biedermeiertum usw.
Bert: Und das alles innerhalb von 30 Jahren!
Annett: Ja. Unsere Zeit ist ja wie so ein Fliegenschiß. Die Frage ist, ob man den Fliegenschiß größer macht oder umdefiniert oder ob man jetzt kampflos aufgibt und sagt, okay, die haben eben den Begriff Prenzlauer Berg zu etwas ganz anderem umdefiniert, das sie dann auch offensiv leben.
Bert: Na, ich glaube, für die neu Hinzuziehenden spielt der Prenzlauer Berg vielleicht gar nicht die Rolle. Das heißt jetzt Pankow. Okay, sie haben mal irgendwas gehört vom Prenzlauer Berg und seiner Bohème-Szene, aber das spielt sich ja nicht mehr ab, die ist ja nicht mehr präsent.
Annett: Aber den Begriff Prenzlauer Berg gibt’s ja noch mit einer bestimmten Zuschreibung. Du kannst den in jedem Feuilleton und auf jeder Immobilienseite lesen.
Ronald: Das sind Leute aus dem Westen, die sich darum streiten. Das ist nicht der Ostler gegen den Westler, der zugezogen ist, sondern es sind verschiedene Generationen von Westlern im Sinne von verschiedenen Migrationsströmen, die hierhergekommen sind. Und zwischen denen spielen sich diese Diskussionen in viel stärkerem Maße ab. Also es geht jetzt nicht darum, daß wir als Leute, die hier lange oder schon immer gewohnt haben, versuchen, irgendwas zurückzuerobern im Sinne einer Neudefinition, oder?
Bert: Ich glaube, der Impuls ist schon da, den Ort auch kulturell zu behaupten. Darzustellen, was hier passiert. Das wird auch in den Texten so beschrieben. Ronni hat, glaube ich, noch mal daran erinnert, daß die erste Generation Westler ja wegzieht, weil sie die zweite nicht mehr leiden kann.
Annett: Das stimmt, die Kämpfe untereinander sind viel stärker als zwischen Ost und West. Bei diesem Spätzle-Krieg haben ja Leute gegeneinander gekämpft, die sich aus der Kindheit kennen. Bloß die einen sind schon eher abgehauen, weil sie in dieser geistigen Kehrwochenenge nicht atmen konnten. Jetzt sind die anderen nachgekommen und haben das große Geld mitgebracht. Und die, die zuerst da waren, müssen jetzt woandershin ausweichen. Früher nannte man so was Klassenkampf.
Ronald: Ja, so gesehen ist das richtig. Es ist kein Kampf zwischen Seelen und Schrippen.
Annett: Der Kampf um Brötchennamen ist ein Stellvertreterkrieg.
Ronald: Etwas anderes ist, daß sich eine Nachbarschaft so sehr verändert, daß man sich wundert, wenn man in der Kaufhalle mal eine alte Frau sieht und die anstaunt wie ein Wundertier aus Afrika: Ja, wie kommt denn die hierher?
Annett: In meinem Haus wohnen noch vier alte Frauen, das liegt sozusagen in Afrika.
Ronald: Das ist die große Veränderung auch in dem Haus, in dem ich ja mit Unterbrechungen seit 1963 lebe… daß es einfach keine alten Leute mehr gibt.
Annett: Also, wir pflegen unsere alten Omis im Haus, indem wir ihnen die Taschen hochtragen.
Ronald: Das ist Nachbarschaft. Aber man darf nicht sentimental werden. Es gibt auch neue Nachbarschaften, die entstehen, die auch gut sind und auch funktionieren und auch solidarisch sind. Es ist ja nicht so, daß jetzt alles völlig auseinandergeflogen ist. Aber definitiv ist es so, daß viele von den alten Leuten gehen mußten, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen konnten.
Bert: In 10 bis 20 Jahren bist du der Älteste.
Ronald: Ja, ich bin ja jetzt schon der älteste Mieter hier im Haus.
Annett: Hast du wenigstens noch einen alten Mietvertrag?
Ronald: Ja, so einen 1980er-Jahre-Mietvertrag.
Bert: Oder der Konflikt um die Nachkriegshäuser, wo Mieraus drin gewohnt haben, Metzer, Straßburger, Belforter. Das sind ja zwei Generationen von Hausbesitzern, die sich da streiten. Die Hausbesitzer, die Häuser haben auf der Seite, wo das Metzer Eck ist, prozessieren gegen den Besitzer des…
Annett: Belle-Kolle [Palais Kolle Belle, Eigentumswohnungen, Kollwitzstraße Ecke Belforter Straße.]…
Bert: Kotze-Belle, der Eigentümer, will ausbauen und die alten Häuser abreißen, Bäume fällen usw., dadurch sinkt sozusagen der Wert der Häuser auf der anderen Straßenseite. Das ist ein Streit zwischen Hausbesitzern der ersten und der zweiten Generation.
Ronald: Genau, insofern ist Annetts Bemerkung mit dem Klassendings gar nicht falsch, weil ich das wirklich weniger als Streit zwischen Ost und West sehe.
Annett: Ja, mittlerweile denke ich, ist es eine klare Form von Klassismus.
Ronald: Und wir reagieren darauf mit unserem Manierismus, Surrealismus, den Karten, indem wir sagen, okay, unser Universum ist ein bißchen anders gestrickt als eures.
Annett: Also, fangen wir mal unsere Kartenbetrachtung an mit der Mierau-Ecke. Das Wort lese ich auf der Karte, ich nenne sie jetzt mal einfach Wasserturmkarree.
Bert: Da haben wir ja eben drüber gesprochen.
Annett: Genau, das ist die Ecke, die wir eben schon abgehandelt haben, wo der Slawist und Franz-Jung-Forscher Fritz Mierau mit seiner Frau über 50 Jahre gelebt hat, ehe sie nach Auflösung der Genossenschaft das Weite, oder besser gesagt, das Offene gesucht haben. Soll das ein Gehirn sein, da am Rand der Metzer Straße?
Bert: Das sind Därme.
Ronald: Der Verdauungsapparat in der Nähe der Metzer Straße.
Annett: Was ist der Klaus-Brasch-Rückweg?
Bert: Warte mal, ich muß mich mal kurz orientieren. Da ist das Metzer Eck. Metzer Ecke Straßburger. Klaus Brasch hat zwei Häuser neben dem Metzer Eck, in der Metzer Straße gewohnt, mit seiner Freundin. Die war Tänzerin am Friedrichstadtpalast.
Annett: Marion Brasch hat das in ihrem Roman Ab jetzt ist Ruhe beschrieben.
Bert: Ich hab damals im BAT [Ehemaliges Hinterhofkino, in den 1960er Jahren als Berliner Arbeiter- und Studententheater gegründet und wieder geschlossen. Seit 1974 Spielstätte des Regieinstitutes, das 1981 in die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch integriert wurde.] als Beleuchter gearbeitet, in der Belforter Straße. Klaus Brasch hat am Theater gespielt. Da waren wir oft im Metzer Eck saufen und sind danach noch zur Party zu ihm nach Hause gegangen.
Annett: Sein Bruder Peter hat mal erzählt, daß da, wo die Rumbalotte ist, auch eine Kneipe war, und daß sein Bruder da immer versackt ist. Das muß irgendwie eine Absturzkneipe gewesen sein, oder?
Bert: Ja, Klaus war ein bißchen ausufernd, wenn er betrunken war, hat dann wahrscheinlich im Metzer Eck Hausverbot gehabt, also ist er eben auf die andere Straßenseite zu Friedel, wo heute die Rumbalotte drin ist, gegangen oder vielleicht in die Bierquelle an der Ecke Prenzlauer Allee.
Ronald: In der Metzer Straße hat Bo Kondren gewohnt, der hatte da eine Wohnung, die ein bißchen so aussah wie der Merz-Bau, mit Ornament & Verbrechen haben wir da geprobt und auch Sachen aufgenommen und große Instrumente gebaut.
Ich kann mich erinnern, einmal kam die Feuerwehr, so eine routinemäßige Kontrolle der Wohnung. Und der Bo hatte alle Wände aus ästhetischen Gründen mit so einem Gerät, womit man die Türen vom Lack befreit, abgeflammt. Das war alles verrußt, die Feuerwehrleute standen relativ bestürzt in der abgefackelten Wohnung. Wir hatten zu der Zeit gerade so eine große Konstruktion, von der wir uns akustisch viel erhofft haben. Das war eine Mülltonne, die am Boden lag, und da führten Plasterohre rein. Und wir haben uns in die Mülltonne reingelegt und da drin gesungen, um so eine Art klaustrophobischen akustischen Raum zu erzeugen. Und mitten in diese Versuchsanordnung ist uns die Feuerwehr reingeplatzt. Die war aber so nachhaltig geschockt, daß sie ohne Murren wieder abgezogen ist.
Bert: Das war Wohnung, Studio und Treffpunkt zugleich. Flake von Feeling B und später Rammstein wohnten da auch. Das waren zwei Wohnungen nebeneinander. Da trafen sich eben Feeling B und Ornament & Verbrechen und diese ganzen Musiker, die aktiv waren. Das war ein wichtiger Treffpunkt Ende der 1980er Jahre und ist hier auf der Karte vermerkt.
Ronald: Obwohl der Klaus-Brasch-Rückweg ja früher war, oder? Klaus Brasch war ja Mitte der 80er schon tot.
Annett: Genau, das sind die Zeitsprünge. Auf der Karte sind noch Kenner und Metzer Eck vermerkt. Was heißt Kenner?
Bert: Kenner ist Egon Kenner, der Gitarrist von Freygang. Der hat hier gewohnt auf der Ecke Straßburger/Belforter.
Annett: Von wo man auf den Wasserturm gucken kann.
Bert: Egon wurde vor ungefähr zwei Jahren hinausgentrifiziert, wohnt jetzt in Pankow.
Annett: Was bedeutet Zabka hier neben der Bierquelle, die in echt an der Ecke zur Prenzlauer war?
Bert: Als ich 1976 nach Berlin kam, habe ich Reinhard Zabka kennengelernt. Und Zabka wohnte in der Metzer 25, hatte dort Wohnung, Atelier und Siebdruckwerkstatt, wo übrigens immer Reiner Slotta rumhing, der mitgeholfen hat beim Siebdrucken und sich dann so langsam die Kenntnisse des Siebdrucks angeeignet hat, was er ja heute noch macht. Dieses originalgrafische Buch ist eine Edition von ihm. Und zur Bierquelle, wie gesagt: eigentlich war das Metzer Eck die angesagte Kneipe. Aber die hatte ja schon so ein bißchen einen Promiruf zu DDR-Zeiten.
Annett: Die waren auch schon so ein bißchen…
Bert: Schickimicki…
Ronald: So mit Bildern von Manfred Krug an der Wand.
Bert: Die haben sich mit Prominenz gebrüstet.
Annett: Das hatte immer so was leicht abgestanden Bürgerliches, fand ich zumindest damals.
Bert: Wozu das Theater BAT aber viel beigetragen hat. Die haben immer ihre Premierenfeiern da gemacht. Das sprach sich auch in Westberlin rum, daß da noch so eine urige Berliner Kneipe ist. Da kamen dann alle möglichen Prominenten und die Betreiber waren stolz darauf. Und dann war es eben oft voll, die waren so ein bißchen arrogant und man mußte ausweichen auf die anderen Kneipen, Bierquelle oder Friedel.
Annett: Ich kann mich nicht erinnern, jemals im Friedel gewesen zu sein, obwohl man ja alle Kneipen mal ausprobiert hat, schon aus sportlichen Gründen.
Bert: Ins Friedel ist man möglichst nicht reingegangen, total intolerant.
Ronald: Da hat man immer Ärger bekommen. Wir haben das einmal versucht mit Ornament & Verbrechen, weil das Metzer Eck voll war, und das ist nicht gut ausgegangen, wenn ich mich richtig erinnere.
Bert: Das war schon in den 1970er Jahren so. Friedel war ein typisches Beispiel für eine Kneipe, die in den 70ern keine Langhaarigen mochte und in den 80er Jahren keine mit kurzen Haaren, aber dann nach der Wende jahrelang eine Skinhead-Kneipe war.
Ronald: Dann war das Frisurenproblem gelöst.
Annett: Die Rumbalotte fehlt aber auf der Karte. Statt der Verlängerung der Straßburger Straße gibt’s ja hier nur Streichhölzer.
Bert: Genau, für die Raucherkneipe.
Annett: Und was bedeutet Rompe-Block?
Bert: Rompe hat da auch gewohnt.
Annett: Das ist ja dann schon Prenzlauer? Oder ist der ganze Block der Rompe-Block?
Bert: Da ist der ganze Block gemeint. Aljoscha Rompe von Feeling B hat da gewohnt und dann eben Flake neben Bo.
Ronald: Vielleicht darf man hier mal als kleinen Einschub sagen, daß die Wohnungen damals natürlich super durchlässig waren im Vergleich zu jetzt. Heutzutage mailst du oder rufst an und sagst, wir treffen uns um 14 Uhr. Damals sind die Leute einfach aufgetaucht, es gab kein Telefon.
Bert: Das müssen wir Annett nicht erzählen.
Annett: Aber das wissen vielleicht die Leute nicht, die das lesen.
Ronald: Ich sag es mal für euch, ihr Leute da draußen. Es gab kein Telefon, insofern hatte man Glück, wenn man jemanden angetroffen hat. Wenn man niemanden angetroffen hat, mußte man einen Zettel an die Tür hängen und sich so verabreden. Aber so wurden alle Projekte und Konzerte geplant damals. Das bedeutete aber, wenn jemand kam, daß der möglicherweise den ganzen Tag geblieben ist. Also wurde auch gekocht für ihn.
Annett: Martin Otting und andere gehörten schon zum Inventar meiner Wohnung, die habe ich schon gar nicht mehr bemerkt, die kamen und gingen.
Ronald: Das war hier auch so. Es saßen immer Leute am Küchentisch. Ellen hat für alle gekocht und ich hab Sachen rangeschleppt. Das fand man normal. Im Nachhinein fällt einem auf, was das bedeutet, wenn eine Wohnung so durchlässig ist und so transparent für Leute.
Bert: Das hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun. Wir sahen das damals, glaub ich, anders als mit, sagen wir mal, 50, wenn man Schriftsteller ist und in seiner Wohnung sitzen und in Ruhe schreiben will.
Ronald: Ich habe letzthin jemanden gesprochen, der zu den Techno-Zeiten in den frühen 90ern nach Berlin gekommen ist. Er hat sich in der Szene rumgetrieben, hat am Rosenthaler Platz in einer Wohngemeinschaft gewohnt. Und er meinte, für ihn, also für jemand, der ursprünglich aus Westdeutschland kam und eigentlich mit dem Telefon aufgewachsen ist, war es wie eine Befreiung, daß man nicht einfach anrufen konnte, sondern daß man zu den Leuten gehen mußte. Der hat das als absolut abenteuerlich empfunden. Was für uns Alltag war, war für den wie eine Robinsonade und eine soziale Initiation.
Annett: So ist das heute, wenn das Internet ausfällt. Dann bin ich zwei Stunden lang wie Rumpelstilzchen. In der dritten Stunde gewöhne ich mich an den Gedanken, daß es auch offline geht.
Mitte der 80er Jahre wohnte ich in einer Einraumwohnung, die einer Frau gehörte, die mit ihrer Familie bei Potsdam lebte. Und die kam immer nach Berlin in die Wohnung, um mit Männern zu schlafen. Es hing dann ein Zettel an der Wohnungstür: „Liebe Annett, bis morgen ist die Wohnung nicht zu benutzen.“ Dann mußte ich mir irgendwie für ein, zwei Tage…
Ronald: … ein Ausweichquartier suchen.
Annett: Ich kam auch nicht an meine Sachen in der Wohnung, ich konnte nicht reingehen, weil es nur ein Zimmer gab.
Ronald: So kann man Eros auch das Opfer bringen.
Annett: Jochen Berg? [Jochen Berg (1948–2009), Schriftsteller (Dramatik, Prosa, Lyrik)] steht hier noch. Mir fällt auf, wie viele Tote es hier gibt. Eine Toten-Topographie.
Ronald: Daß das eine Gemeinschaft der Lebenden und der Toten wird, ist ja klar. Die Toten gehören dazu. Oder? Die sind auch schon immer noch wirksam.
Bert: Wenn du mit irgendjemandem, der die Gegend nicht so kennt, durch den Prenzlauer Berg gehst, sagst du auch, okay, hier hat der gewohnt, hier war das und das, und da war die und die Kneipe, in der wir immer…
Annett: Ich bin jetzt auch schon so wie die alten Omis. Als ich vor 20 Jahren dieses Prenzlauer-Berg-Projekt über den Krieg gemacht habe und die alten Frauen zu ihrem Prenzlauer Berg befragte [Annett Gröschners Zeitzeugenrecherchen erschienen in der Zeitschrift Sklaven, später gesammelt als Buch unter dem Titel Jeder hat sein Stück Berlin gekriegt – Geschichten vom Prenzlauer Berg (Rowohlt, Reinbek 1998)], da haben die ja auch Topographien beschrieben, die komplett überschrieben waren. Die erzählten, da war das Nordstern-Lebensmittelgeschäft, und hier war der Schuster, da war unser Blumenladen mit dieser verkrüppelten Blumenhändlerin, da lagen die Leichen nach dem Bombenangriff. Und das gab es alles nicht mehr. Und ich bin jetzt schon genauso. Ich ertappe mich dabei, daß ich sage: Da in der Dimitroffstraße habe ich auch mal gewohnt. Oder: Das ist da, wo der HO-Laden war, wo dieser Nazityp dich immer nicht bedienen wollte.
Ronald: Wie meine Tante Margot, die in den Prenzlauer Berg zurückkam, nachdem sie schon viele Jahrzehnte in Amerika war. Die hat gesagt: Hier haben sie Oma gekascht, und hier ist Vater immer besoffen die Stufen runtergefallen. Aber das sind Geschichten, die sich ablagern.
Annett: Aber diese Schichten interessieren mich.
Ronald: Insofern ist es eine privatarchäologische Arbeit.
Bert: Das ist das, was man wohl Psychogeographie nennt.
Annett: Kognitive Karten sind das. Die Geschichtswissenschaft nutzt die auch. Die arbeiten z.B. mit Leuten, die ihre Häuser bzw. Dörfer verlassen mußten, und lassen sich von denen aus der Erinnerung ihre Karten aufmalen. Und jeder hat eine andere.
Ronald: Das ist eine gute Idee. Wir waren natürlich auch konfrontiert mit unserer Erinnerung. Wie erinnert man sich überhaupt, was spielt eine Rolle und was keine?
Annett: Den Greiner-Pol-Weg [Andre Greiner-Pol (1952–2008), Rockmusiker, Häuptling der Band Freygang.] finde ich auch lustig, der führt ja von der Metzer Straße direkt auf den Friedhof. Als wäre das blaue Haus an der Stirnseite der Metzer weg, und die Metzer Straße würde als Greiner-Pol-Weg auf der anderen Seite der Prenzlauer Allee weitergehen.
Bert: Du hast da gewohnt in dem blauen Haus, oder?
Annett: Nein, eins daneben.
Ronald: Dann ist das dein Zeichen an der Stelle der Karte, ein Ritter.
Bert: Das Symbol heißt: unorthodox,
Ronald: Das ist ein sehr unorthodoxes Kreuz.
Annett: Man könnte es auch als Symbol für unsere Patchwork-Familie lesen. – Der Greiner-Pol-Weg ist eigentlich ein schönes Fleckchen. Da bin ich gern. Wenn man ein bißchen Ruhe haben oder über irgendwas nachdenken möchte, gehe ich da hin.
Berg: Jochen Berg gleich daneben.
Annett: Mmh. Eine Zeitlang stand ja da auch noch Schnaps am Grab. Aber irgendjemand hat ihn immer ausgetrunken.
Ronald: Na, irgendjemand muß das ja tun. Also ich würde mir wünschen, wenn ich six feet under bin, daß jemand das auch für mich tut, wenn da eine Flasche steht. Ich kann das ja dann nicht mehr in dem Umfang, wahrscheinlich.
Annett: Was heißt IKS?
Bert: Immanuelkirchstraße – die von der Kommunalen Wohnungsverwaltung haben den Straßennamen so abgekürzt, IKS, es war also eine administrative Abkürzung der Immanuelkirchstraße, wo ich lange gewohnt habe. Ich fand das witzig, es gab ja damals diesen Roman Der IKS-Haken von Joseph Heller.
Annett: Kommen wir zum Mittelpunkt, dem Wasserturm, und dem Zeichen, das dafür steht. Ich habe das als die rote Fahne interpretiert, die in den 1930er Jahren da oben gehißt worden ist auf dem Turm.
Bert: Na, das ist eins von den Signets, die ich gemacht habe, als ich 1982/83 zusammen mit Ronni bei der Armee war.
Annett: Ihr wart zusammen bei der Armee?
Ronald: Ja, aber wir haben uns schon vor der Armee kennengelernt. Ich habe bei der Band Rosa Extra gespielt, für die Bert Texte geschrieben hat. Außerdem gehörte er zu dem Kreis dazu, der sich im Wiener Café getroffen hat.
Bert: Wir waren beide bei den Bausoldaten und haben das letzte halbe Jahr unserer Dienstzeit zusammen in Neuseddin verbracht. Ich habe abends gesessen und Briefe oder meine Texte geschrieben und immer so kleine Zeichnungen gemacht. Und diese kleinen runden Dinger waren typisch für diese Zeit. Die meisten sind in Manuskripten und Briefen verstreut, ein paar habe ich noch gefunden, und die habe ich dann hierfür verwendet.
Ronald: Und der Wasserturm… Mit 13 Jahren, also 1977, gehörte ich zu einer Clique, die Die Krippe hieß, weil sie sich immer an den Mülltonnen der Kinderkrippe an der Schwedter Straße getroffen hat. Am Wasserturm gab es auch eine Kinderclique, das waren unsere erklärten Feinde. Und die galten als besonders gefährlich, die waren Union-Fans, glaube ich. Ich bin am Arkonaplatz zur Schule gegangen. Da waren wegen der Nähe zur Mauer viele Eltern aus dem Polizeimilieu. Deshalb gab es unter den Schülern viele BFC Dynamo-Fans, die waren natürlich mit den Union-Fans verfeindet. Da hieß es dann immer: Jetzt kommen die Jungs vom Wasserturm. Die haben Fahrradketten mit. Eine Schlägerei habe ich nie miterlebt. Aber der Wasserturm hatte seitdem wegen der Clique dort eine ganz dämonische Bedeutung für mich.
Annett: Und hast du den Wasserturm irgendwann für dich erobert?
Ronald: Ehrlich gesagt, als Kind wußte ich nicht, was das Wort Wasserturm bedeuten soll, es gab nur das Wort wie eine Drohung, das Gebäude habe ich erst als Erwachsener registriert. Ah, da also müssen sich die bösen Jungs getroffen haben, die mit den Fahrradketten. Eine Weltgegend, die ich erst später kennengelernt habe.
Annett: Diese Zeichen, haben die irgendeine Bedeutung?
Ronald: Da mußt du Bert fragen. Aber damals, als ich ihn beim Zeichnen beobachtet hatte, waren das durchaus magische Zeichen. Sie hatten schon was von Zauberdiagrammen. So könnte man das nennen.
Bert: Es ist so eine Mischung aus Badge und Vignette. Was sehe ich darin? Ich sehe eine Fahne…
Robert: Hammer und Sichel in dynamischer Abwandlung.
Bert: … aber statt dem Hammer ist hier ein Pfeil, darüber ein Anarcho-A.
Annett: Das erinnert ein bißchen an das Hausbesetzersignet.
Bert: So in der Richtung.
Annett: Ich hatte an die rote Fahne gedacht. Es gab ja diese Geschichte von dem Kommunisten, der zu DDR-Zeiten als großer Widerstandskämpfer gefeiert wurde, weil er 1933 eine rote Fahne auf dem Steigrohrturm auf dem Wasserturmgelände gehißt hat, zu der Zeit, als dort ein sogenanntes „wildes KZ“ war, wo die SA die ganzen Gewerkschafter, Kommunisten und Sozialdemokraten von rundherum eingesperrt hatte. Nun gab es aber im Landesarchiv noch Akten zum Wasserturm und da hat sich herausgestellt, das war schon 1932, daß der Mann da hochgestiegen ist – eine völlig andere Situation.
Ronald: Das kann man so sagen.
Bert: Bald nachdem ich 1976/77 Zabka kennengelernt hatte, haben wir am Wasserturmplatz Veranstaltungen gemacht. Das war noch vor der Punk-Zeit. Wir haben uns immer mittwochs um acht oder neun auf der Plattform des Wasserspeichers getroffen. Oben auf der Wiese haben wir Lesungen und kleine Konzerte gemacht. Organisiert haben das im wesentlichen Zabka und ich. Das fand ungefähr fünf, sechs Mal statt.
Ronald: Wurde da auch musiziert?
Bert: Ja. Ich kann mich erinnern, daß Trötsch [Frank „Trötsch“ Tröger (1958–2015), Berliner Musiker, Texter und Komponist.], der damals noch Liedermacher war, zur Gitarre gesungen hat. Wie Biermann, gräßlich. Und an den Jazz-Kontrabassisten Rüdiger Philipp. Es gab noch einen anderen Liedermacher, Kalle Winkler, der dann in den Westen gegangen ist.
Annett: Der ist doch Mitte der 90er im Mittelmeer ertrunken.
Bert: Ja, genau. Die Treffen auf dem Plateau wurden strengstens observiert von der Stasi. Als sie im Sommer des nächsten Jahres wieder stattfinden sollten, wurden wir davor alle zu den Bullen in die Immanuelkirchstraße zitiert und mußten ein Papier unterschreiben, daß wir diese illegalen Veranstaltungen nicht fortführen. Steht hier zwar alles nicht drin in der Karte, aber es gehört für mich mit zu dieser Erinnerung.
Annett: Es ist sozusagen in den Zeichen versteckt. Na, später gab es ja auch wunderbare Konzerte auf den Dächern, sonntags. Die Dächer vermisse ich zum Beispiel sehr.
Ronald: Die Dächer als Orte, wo was passiert.
Bert: Da kommt man heute wahrscheinlich gar nicht mehr rauf.
Annett: Du siehst ganz oft Stacheldrahtrollen. die die Häuser voneinander abgrenzen.
Ronald: Damals konnte man richtige Wanderungen über die Dächer machen.
Annett: Wenn keine Bombenlücke war, konntest du rundherum laufen. Manchmal waren da Löcher, wenn die Dächer kaputt waren, da mußtest du aufpassen, daß du nicht durchgebrochen bist.
Bert: Ich kann mich erinnern, daß ich von der Immanuelkirchstraße aus, in der Nummer 30 haben wir gewohnt, fast um den ganzen Block gehen konnte. Nur in der Prenzlauer war ein Haus, da war irgendwas drin, eine Druckerei glaube ich, da konnte man nicht drüber. – Wir haben manchmal im Sommer auf dem Dach geschlafen.
Annett: Ich hab da oben im Sommer gewohnt.
Ronald: Unterm Sternenzelt.
Annett: Einer hatte sogar so ein kleines Kinderplanschbecken oben. Und ein anderer lebte da mit Fernsehapparat. Man konnte dort oben herumwandern, hat immer was zu essen gekriegt.
Ronald: Man darf auch nicht vergessen, es gab ja diese ganzen abgefuckten leeren Häuser. Als junge Männer haben wir oft in diesen verlassenen Häusern Streifzüge unternommen und dann Sachen gefunden. Ich habe jahrelang einen Mantel getragen, den ich in so einem Haus gefunden hatte. Das war mein absoluter Lieblingsmantel.
Bert: Haste mal so’n kleenet Schnäpperken da?
Ronald: Schnäpperken? Einen Cherry kann ich dir anbieten.
Bert: Na gut, gib mir mal einen Cherry.
Ronald: Es gibt auch noch tolle italienische Süßigkeiten, die zum Tee wirklich super passen.
Annett: Die kannst du mitbringen. – Noch eins. Was ist mit dem Darm, den ich erst für ein Gehirn gehalten habe?
Bert: Das sind DDR-Schulstempel. Die wurden auf Papier gestempelt im Biologieunterricht und dann mußten die Schüler sie beschriften.
Annett: Die Stempelkultur fand ich großartig. Es ist lustig, daß der Friedhof das Herz ist. Prenzlauer Allee, hatte die eine Bedeutung? Oder war das nur eine Durchgangsstraße?
Bert: Auf der Prenzlauer war eigentlich nüscht. Außer der Bierquelle und dem Café Prenzlau, die hatten ja einen Spätverkauf. Der war wichtig. Da bin ich von der Immanuelkirchstraße oft hingegangen.
Annett: Es gab in der Gegend auch so ein paar Kneipen, wo man mit einem Eimer hingehen konnte, um Bier zu holen. Im Prenzlauer Eck habe ich das öfter gemacht.
Bert: Als ich noch in der Ebertystraße gewohnt habe, sind wir immer in die Eberty-Klause gegangen, mit einem 10- Liter-Eimer und haben Bier geholt.
Annett: Meine Schwester hat neulich die Geschichte erzählt, daß ich betrunken mit einem Kohleneimer rüber bin.
Annett: Die Kneipiers haben ihn dann noch saubergemacht. Die im Prenzlauer Eck waren ein bißchen seriöser. Die hatten ja auch eine Weinabteilung.
Ronald: Für die Herren gibt’s Cherry, und hier sind noch Baisers mit Mandeln drin; Brutti e Buoni, die hat ein Freund aus Italien geschickt. Da gibt es eine Konditorei bei ihm im Dorf, die machen diese Teile. Probier die, die sind richtig toll. Die werden nur da gemacht.
Annett: Bei Cherry fällt mir immer Micha Voges [Michael Voges (1953–2002), Maler und Zeichner, lebte in Berlin.] ein.
Ronald: War der ein Cherry-Fan?
Annett: Irgendwann hat er alles getrunken. Eine Zeitlang stand er auf Cherry und ist immer zum Intershop gegangen, dem einzigen Ort in Ostberlin, wo es so was gab.
Bert: Mit Micha habe ich nie gesprochen, der hat doch gar nicht gesprochen, oder? Hat der gesprochen?
Annett: Mit mir schon, ja, jedenfalls in der Zeit, als ich ihn gut kannte.
Bert: Ich glaube, ich habe nie ein Wort mit ihm gewechselt.
Annett: Ein kluger Mensch.
Annett Gröschner, Ronald Lippok und Bert Papenfuß unterhalten sich über ihre kognitiven Karten.
Dort, wo einst Luschen und Ässer die Sau rausließen,
wird jetzt Berliner Luft eingewickelt. Hauptsache,
die Touristen amüsieren sich und machen keinen Krach,
und koksen uns nicht das ganze Strychnin weg.
Bert Papenfuß
Im Psychonautikon Prenzlauer Berg prallen Weltraumpiraten und Paramilitärs, Kosmonauten und Glücksritter, Rotwelsch und Schwabenblagen, T. Rex und Franz Jung hart aufeinander.
Der Dichter und legendäre Berliner Kneipier (Kaffee Burger, Kulturspelunke Rumbalotte continua) Bert Papenfuß, eine der zentralen Figuren des künstlerischen Untergrunds der DDR, und der Künstler und Musiker Ronald Lippok (Ornament & Verbrechen, Tarwater) zeigen der Gentrifizierung des Prenzlauer Bergs den ausgestreckten Mittelfinger.
Durch ihr Psychonautikon wälzt sich ein kaum zu bändigender Informations- und Assoziationsstrom. Drei Gedichtzyklen („Pißpott revisited“, „Pißpott revisited for worse“, „Pro tussi à gogo“), zwei Essays („Abflugschneise Nordost“, „Das Haus der Anarchie“), zahlreiche Zeichnungen und zwei Interview-Passagen mit Annett Gröschner („Psychonautikon des eigentlichen Prenzlauer Bergs“, „Psychonautikon der angeschlossenen Siedlungsabgründe“) werfen eine große Diskursmaschine an, zeichnen einen psychogeographischen Stadtplan aus Erinnerungen und Befürchtungen, in dem sich Stimmen aus verschiedenen Zeiten und Welten kreuzen und durchdringen.
Rebellische Widerständigkeit in Wort und Bild, „Verse zum In-Steine-Hauen, Wortmusik, die rockt“ (Ralf Stiftel).
Damit ist zwar kein Buchpreis zu gewinnen, aber mit Sicherheit das ein oder andere wilde Herz.
*Starfruit, Ankündigung
Trinken und Denken
Wie Sternenhaufen entstehen: Angewandte alltagswissenschaftliche Dichtungen und Diskussionen im Psychonautikon Prenzlauer Berg. –
Als voriges Jahr der Herbst begann, zog die Rumbalotte aus dem Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg fort. Aus der Kneipe wurde ein Verein, der wiederum eine Kneipe ist, am Rand von Pankow, aber nicht mehr täglich geöffnet hat. Ja, man konnte im fast durchgentrifizierten Prenzlauer Berg unarschlochmäßig ausgehen, und man kann es immer noch hier und da. Aber es ist nicht einfach.
„Mareile und mir ging das Stammpublikum in erster Linie auf die blankliegenden Nerven, weil der Umsatz nie reichte, anfallende Kosten und Unkosten zu bestreiten. Stark anzuzweifeln ist auch, ob wir mit den Tausenden demnächst in die Straßburger Straße ziehenden Miethochpreislern und Eigentumswohnern auskommen würden“, schreibt der Dichter und Kneipier Bert Papenfuß in dem Buch Psychonautikon Prenzlauer Berg, einer poetischen Rückschau auf fünf Jahre Alkoholopposition gegen die Zudringlichkeiten der braven schlimmen Ordnung des westdeutschen Kolonialismus, der die DDR aufgegessen hat, obwohl sie ihm nicht schmeckte.
Alles, was wir ,Brüder und Schwestern‘
in Staatsbürgerkunde über Westdeutschland
gelernt haben, war richtig! Konsequenterweise
war alles, was die Westdeutschen über die DDR
gelernt haben, zumindest so unrichtig, dass ,falsch‘
nicht das richtige Wort dafür ist, stimmt doch, oder?
heißt es in „Keine Ursache, mitnichten“, einem dieser weitentwickelten Fußnotengedichte von Papenfuß aus dem Jahr 2014. „Candy says“, „Caroline says“, „Lisa says“ hieß es bei Lou Reed, bei Papenfuß heißt in der Fußnote zu den obigen Zeilen „… sagt Mareile“. Das ist seine Frau, Frau Mareile Fellien. Sie verschickt immer noch die Rumbalotte-Programm-Mails für ihren neuen Ort in der Willner Brauerei, Berliner Straße 80.
Am heutigen Donnerstag lesen dort um 20 Uhr übrigens der Verleger Hermann Jan Ooster aus El Dorado, One way, einer Abrechnung über den Einzelnen, „der leergut stapelt / in der ihm zugewiesenen traumfabrik“, und Kai Pohl aus seinem Cut-up-Gedichtband Staatenlose Insekten. Ooster ist Westdeutschland/Westberlin, Pohl ist Ostdeutschland/Ostberlin.
Das Grundproblem der Gesamtstadt ist neben der Verteuerung der Vereinzelung im kapitalistischen Realismus die Verödung und Verblödung der Nacht. Die Ausmaße der fortschreitenden Katastrophe lassen sich ermessen, wenn man einem Gespräch folgt, das die drei Ostberliner Kneipenveteranen Bert Papenfuß, Ronald Lippok und Annett Gröschner über das Nachtleben vor und nach 1989 führen und das in dem Psychonautikon abgedruckt ist. Die Grundlage dieser Unterhaltung bilden Stadtpläne der Ausgeh-Erinnerung, die Lippok angefertigt hat. Der Musiker und Künstler hat Nachbarn, Nachhausewege, Netzwerke und Nischen imaginär kartographiert und diskutiert diesen „stereoskopischen Blick“ mit dem Dichter Papenfuß und der Schriftstellerin Gröschner. Was war wichtig, was löst welche Assoziationen aus? Das ist angewandte Psychogeographie, von der die Situationisten in ihren Erklärungen meistens nur geredet haben.
Ein Auszug:
Roland: Was wir jetzt beobachten, ist ja, dass so ein nächtlicher Ausflug in dem Gebiet, von dem wir sprechen, mittlerweile kaum noch möglich ist.
Annett: Ich bin ja sehr oft nachts unterwegs, und seit fünf, sechs Jahren ist der Prenzlauer Berg nachts total ausgestorben. Die Leute, die dir auf einem Kilometer begegnen, kannst du an einer Hand abzählen. Was auch an den Rändern des Wedding so ist, also es ist nicht nur Prenzlauer Berg tot. Die meisten Kneipen machen in der Woche vor Mitternacht zu. Da werde ich gerade wach.
R.: Das liegt natürlich auch an den Alkoholpreisen. Das war doch normal, dass nach der Wende alle Kneipen so lange offen hatten, wie Gäste da waren. Die Leute haben aber auch eine andere Disziplin oder führen überhaupt ein anderes Leben mit anderen Herausforderungen. Die meisten Menschen sind heute nicht mehr so die Creatures of the night.
A.: In Zeiten der Selbstoptimierung fällt zuerst die Party weg. Die gepflegte Afterworkparty natürlich nicht, aber das Abstürzen.
R.: Eher diese Art Exzess. Es ist ja physisch auch nicht ganz ohne, die ganze Nacht durchzubringen. Wir sprechen jetzt gar nicht von 9-to-5-Jobs, wir sprechen davon, dass die Leute auch zu Hause früh um acht an ihren Computern sitzen müssen.
Ein alltagswissenschaftlich hochinteressantes Gespräch, zur Schullektüre ab 14 Jahren empfohlen. Es geht hier stets um die Kneipe, Stampe, Schankwirtschaft, nie um das Café oder die Bar der milchgeschäumten, aperolgespritzten Gegenwart. Um Menschen, die trinken und denken. Ungefähr derart wie Papenfuß 2010 dichtete:
Kurz nach der letzten Runde bilden sich in der verdichteten
Materiewolke der Ex-Supernova zierliche Klumpen;
es entstehen Sternenhaufen der leichteren Bauart, die sich in der Metzer Straße verteilen.
Wir selbst sind ein einzelner Stern;
in der uns umschwirrenden Scheibe
entstehen nach und nach Planeten.
Durch, durch den Kosmos,
ran an das Pflaumenmus.
Raus aus der Materie,
rein in die Kartoffeln.
Rum um die Kalotte
rein in die Spelunke.
Christof Meueler, junge Welt, 26.5.2016
Das hat schon etwas Lässiges
– Querköpfe, -denker, -leser. –
Auf der letzten Seite des Psychonautikon Prenzlauer Berg angekommen, lässt es sich nicht mehr leugnen: Eine Ahnung hat den Leser beschlichen, eine Ahnung von der Künstlerszene Prenzlauer Berg, von den 1980er Jahren bis heute. Keine rechte Ahnung hat man allerdings, wie das Buch das eigentlich geschafft hat.
Vielleicht sollte man zum Einstieg mittendrin, mit den „gelben Seiten“ beginnen; in zwei Teile gegliedert findet sich, auf gelbes Papier gedruckt, ein Gespräch zwischen Annett Gröschner, Bert Papenfuß und Ronald Lippok. Und das hat schon etwas Lässiges. Der Verlag dringt nicht auf stringente, konzise Textsorten, stellt auch nicht einfach eine Audiospur online, sondern lässt entspannt plaudern und schreibt das mal eben so mit, rund 50 Seiten lang. Kommentiert werden hauptsächlich die von Papenfuß und Lippok erstellten „Stadtpläne“. Graphische Kartenausschnitte, die nicht auf Orientierung im Bezirk, sondern auf Einblick in die Köpfe der beiden Künstler, ihre Erinnerungen, ihre Perspektive abheben. Damit illustrieren sie hinlänglich, wie im Grunde auch die Gedichte von Papenfuß gearbeitet sind: „Gedanken wie Geäst zwischen den Zeiten“, individueller Zugriff auf einst oder gegenwärtig Erfahrbares, mit allerlei Skurrilitäten, Rätselhaftigkeiten durchwirkt, „Gedanken wie Geschling zwischen den Zehen“. Querlesen reicht für die Gedichte natürlich nicht, wenngleich man sie quer lesen muss, denn das ganze Buch ist quer gesetzt; gewissermaßen ein Literatur-Kalender ohne Kalender.
Auch Bert Papenfuß versieht seine Texte mit Fußnoten, verzichtet aber – anders als Kuhlbrodt – zumeist auf Kommentare und beschränkt sich auf genaue Quellenangaben und (zum Teil sehr ausführliche) Kontext-Zitate. Grundsätzlich neu ist die Idee, Gedichte mit Fußnoten zu versehen, freilich nicht. August Wilhelm Schlegel spöttelte bereits vor über zweihundert Jahren, dass derlei so gewitzt sei wie „anatomische Vorlesungen über einen Braten“. Sympathischerweise wird dieser Schlegel’sche Einwand im Psychonautikon unerschrocken zitiert.
Den eigenen Worten fügt Papenfuß mit Lust und List seine Fundstücke bei, ganze Strophen mitunter, gerne Englisch, mitunter Russisch. Poetisch verwertbare Entdeckungen macht er allerorten, zum einen bei Kolleginnen und Kollegen wie Brecht, Novalis, Heine, Elke Erb, Ann Cotten, zum anderen auf Internetseiten, Grabsteinen oder in „einem Grafitti (sic!) auf dem Herrenklo“.
(Szene-)Anspielungen werden gemacht, Lokalkolorit und Ostsozialisation scheinen auf (ohne in den Fußnoten kommentiert zu werden), so dass eine spannende Frage wäre, wie und wo genau die Leseeindrücke von Ost und West, In- und Outsider divergieren.
So sind die Texte letztlich postmoderne Collagen, immer für eine Überraschung gut, dabei selten völlig eingängig und gerade deswegen zur Mehrfachlektüre ermunternd; oder besser ausgedrückt:
das Versteck der Sinne ist unangespannt,
vielsagend Mark um Deut das Wortgeflecht, kirrem Gedanken folgt klirrendes Geschirr,
dem Schlangenverderben das Wurmwerden.
Auch die Graphiken von Lippok sind in der Gesamtschau heterogen, mal klein im Fußnotenbereich, mal die Doppelseite ausfüllend, mal eher abstrakt, nebulös, surreal, mal gegenständlicher, stets passend und unpassend zugleich.
Essayistisch klingt der Band aus und konstatiert durchaus treffend für den Prenzlauer Berg:
Er ist überall, wo nicht nirgends ist
Fest steht aber auch:
Wo Bert Papenfuß steht, ist Prenzlauer Berg.
Lutz Graner, Am Erker, Heft 71, 2016
Musik, Kneipenkultur, Wut, Politik: alles drin
„Es gibt keine Freiheit in der Diktatur der Bourgeoisie, Demokratie genannt“. Das ist die Stimme von Bert Papenfuß (60), Verursacher dieses unverblümten Bilderbuchs aus der Mitte der Berliner Subkultur. Kleinstmögliche Zielgruppe, aber klasse gemacht! Angesprochen fühlen werden sich Menschen, die alt genug sind, um die unabhängige Künstlerszene in Berlin, Prenzlauer Berg der Jahre 1970–1989 mit einem Satz klar umreißen zu können.
Jüngeren Lesern wird sich die eine oder andere der ätzend direkten Kiez- Anspielungen nicht erschließen. Denn der in Mecklenburg-Vorpommern geborene Papenfuß, einst Bausoldat der NVA, später Dichter und Kneipier, hat mit dem Berliner Musiker und Maler Ronald Lippok sowie der gebürtigen Magdeburger Journalistin Annett Gröschner hier ganz tief in die Mottenkiste gegriffen, um das Kiez-Flair zumindest verbal gegen die Verspießerung und den Pankow-Schick zu verteidigen. Drei Gedichtzyklen, Interviews, Lippoks Zeichnungen, alles schwarz-gelb und frech im Querformat. Musik, Kneipenkultur, Wut und Politik: alles drin.
Große Bestände dürfen dafür gerne ein wenig Platz im Regal machen!
Connie Haag, ekz bibliotheksservice, 7.3.2016
Sprengungen mit Orten
Das Zentrum von Überall
„Dort, wo einst Luschen und Ässer die Sau rausließen, wird jetzt Berliner Luft eingewickelt.“ Klare Ansage für ein Bilder-Textbuch, das sich der Auflösung eines mentalen Biotops, der Gentrifizierung des Prenzlauer Bergs, widersetzt, ganz im Sinne von Bert Brecht in seinem Poem „Vom Sprengen des Gartens“:
Und übersieh nicht zwischen den Blumen das Unkraut, das auch Durst hat.
Aber Bert Papenfuß (60) vollzieht seine Sprengungen nicht mit Wasser, sondern mit Worten. Es kracht mitunter ganz schön. Papenfuß war im einstigen DDR-Untergrund eine wichtige Persönlichkeit, gerühmt als Kneipier der im Herbst 2015 geschlossenen Kulturspelunke Rumbalotte continua, empathisch als Dichter. Seine Poem-Zyklen sind wortreich, unverblümt, schroff: ein Strom voller Stimmen und Assoziationen. Bert Papenfuß erklärt den enigmatischen Buchtitel schlicht so:
Sagen wir mal: Das Buch ist ein Seelenführer durch den Prenzlauer Berg
Also ein mentaler Stadtführer durch einen längst geplätteten Bezirk, der einst geprägt war von dieser schlichten Weltanschauung vieler Berg-Insassen:
Rumzicken, Durchticken, Rumficken und Durchblicken.
Papenfuß selber gehört wohl zu dem Typus des poetischen Anarchisten: Zahllose Veranstaltungen, Lesungen, Koops mit Künstlern und Musikern und natürlich diverse Druckwerke pflastern seinen Weg, der kein Ziel kennt. Sein Prenzlauer Berg kann auch verstanden werden als Synonym für einen Lebens-Raum:
Er ist überall, wo nicht nirgends ist
Minimalistisch, kongenial, kafkaesk und sehr prägnant sind im Buch die Schwarzweiß-Zeichnungen von Ronald Lippok, seinerseits einst Drummer der Ostrock-Punkband Rosa Extra, Weggefährte von Papenfuß und Mitbegründer des Musikprojekts Ornament & Verbrechen. Herausgeber Manfred Rothenberger hat mit diesem Buch ein weiteres Kunst-Literaturprojekt realisiert, das in Sachen Originalität und eben auch Sorgfalt in der Gestaltung seinesgleichen sucht.
Jochen Schmoldt, Plärrer, März 2016
Im Viertel stets aufs Ganze
– Bei starfruit ist jetzt das Kunstbuch Psychonautikon Prenzlauer Berg erschienen. Der Untergrund-Dichter Bert Papenfuß und der Zeichner Ronald Lippok wagen darin wilde Würfe in Wort und Bild. –
Wer als Kneipenbetreiber tolle Schänken aus den Ruinen des Ostens stampfte und sie zum Beispiel Kulturspelunke Rumbalotte continua taufte, der macht auch als Dichter nicht halblang, wenn es im Viertel aufs Ganze geht. Bert Papenfuß jedenfalls, dieser schillernde Berliner Wirtshaus-Rimbaud, dieser hartgesottene Nachtlokalerfinder (Kaffee Burger) und diese zentrale Figur des künstlerischen Untergrunds der DDR, hat gemeinsam mit dem Zeichner und Musiker Ronald Lippok (Ornament & Verbrechen) ein Buch erarbeitet, in dem Erinnerung wie Befürchtung pulsieren. Der aktuellen Gentrifizierung des verblühenden Szeneviertels ihres Herzens treten die beiden als Prenzlonauten damit heftig in den Hintern.
Monster des Morgengrauens
„Dort wo einst Luschen und Ässer die Sau raus ließen, wird jetzt Berliner Luft eingewickelt. Hauptsache, die Touristen amüsieren sich und machen keinen Krach, und koksen uns nicht das ganze Strychnin weg“, schallt es aus den Zeilen des Herrn Papenfuß. Und Lippok flankiert ihn passend mit ein paar Motiven, die sich als Monster des Morgengrauens ebenso einordnen ließen wie als Archaik im letzten Licht. Das sitzt.
Manfred Rothenberger wiederum, der sich neben seinem Brotjob als Direktor des Nürnberger Instituts für moderne Kunst seit 2009 einen kleinen Liebhaber-Verlag namens starfruit leistet, um darin furchtlos Literatur mit bildender Kunst zu kreuzen, packt auch diesen Stier bei den Hörnern, wenn er sagt: Mit so einem Werk sei zwar „kein Buchpreis zu gewinnen, aber mit Sicherheit das ein oder andere wilde Herz“.
Das ist tief gestapelt. Die Stiftung Buchkunst etwa hat vor wenigen Monaten die starfruit-Veröffentlichung Magische Rosinen von Joshua Groß und Philippe Gerlach als „eines der schönsten Bücher des Jahres 2015“ gepriesen. 2013 heimste Rothenberger für sein Engagement einen Staatspreis für Kleinverlage ein. Die Auflage bei starfruit liegt so bei 1.000 bis 1.500 Stück.
Zurück zu den schlagenden Herzen der Kiezkartographen Papenfuß (Jg. 1956) und Lippok (Jg. 1963) und ihrem Kosmos der Künste, zurück zu diesen Stadtführern der anderen Art in ihrem Rausch der Zeilen, Zeichen und Zeiten. Drei Gedichtzyklen mit den deftigen Titeln „Pißpott revisited“, „Pißpott revisited für worse“ und „Pro tussi à gogo“ erhält ihr gelbschwarzes Buch mit einer Rüsselzeichnung vorne drauf. Zwei Essays kommen noch dazu.
Was es mit dem Begriff „Psychonautikon“ auf sich hat, ist dann im Interview zu erfahren, das Annett Gröscher den beiden Raumgestaltern für Idealisten und Fantasten abgerungen hat. „Psychonaut“ sei eine „Bezeichnung für einen Drogenfreak“, eröffnet Papenfuß neue Horizonte und Lippok fügt beflissen hinzu:
In Anlehnung an Kosmonaut. Jemand, der nicht den Kosmos, sondern die Seelengründe erforscht.
In Papenfuß’ Versen und Zeilen samt ihren so unterhaltsam wie wahnwitzig anmutenden Quellenverweisen aus Kunst, Punk und Politik fließen Weltraumpiraten und Paramilitärs, Nachttiger und Glücksritter, Rotwelsch, Aufruhr, Begehr und Verzehr als gewaltige Gedankenströme zusammen, ja, geraten hart aneinander.
Das Bier war im Eimer
Wohn-Dächer und Kneipen, Friedhöfe und Autobahnen, real existierende Straßennamen und fantastische Gedenkstätten wie „750 Jahre im Eimer“ weisen dann die Orientierungspläne und schwarz gezeichneten Straßenkarten auf, die das Szenegebiet Prenzlau mit internen Bezugspunkten zeigen. Als so genannte Scherzkarten gab es solche Graphiken von fantastischen oder verfremdeten Landkarten in der Kunstgeschichte bereits seit dem Barock.
„Im Eimer“ wiederum hieß nicht nur ein Club, von dem Papenfuß und Lippok im Interview berichten, im Eimer war zuweilen auch das Bier, das zuweilen in Literkübeln aus Kneipen in die umliegenden Wohnungen geholt worden ist, wie die Psychonauten sich erinnern. Bier als ein Balsam im Prenzlauer Berg.
Christian Mückl, Nürnberger Zeitung, 29.12.2015
Hochheiliger Nibelungenquatsch
Psychonautikon Prenzlauer Berg – eine Kulturgeschichte der poetischen Renitenz
Es war einmal ein blendend aussehender Dichter in schwarzer Lederkluft, der den Mythos der poetischen Renitenz im Prenzlauer Berg mit sehr wortnärrischen, politisch respektlosen, aufsässigen Gedichten begründete. dreizehntanz hieß der Gedichtband, mit dem der experimentelle Wortartist Bert Papenfuß-Gorek 1988 „gegen ferfestigungen / ferfestigter zungen“ anschrieb und die herrschende Grammatik des SED-Staats aus den Angeln hob. Um die vorlauten Rivalen aus der subliterarischen Szene der „Prenzlauer-Berg-Connection“ in ihrem Übermut ein wenig zu dämpfen, hatte damals der Dichter Volker Braun in Sinn und Form einen sehr boshaften Aufsatz veröffentlicht, der die rebellischen Gesten der von ihm belächelten „Neutöner“ doch deutlich relativierte. „Unsere jungen Dichter“, so Braun damals, „verbrauchen ihre Fantasie an Tunnels und Fesselballons, ihre ,monologe gehen rechtens fremd‘, Fluchten wieder, aber auf Hasenpfoten… unsere vermeintlichen Neutöner, Hausbesetzer in den romantischen Quartieren (wo sie sich ordentlich führen), sind wohl gute Anschaffer, die fleißig auf den Putz hauen, Hucker, nicht Maurer.“ Als Hauptverantwortliche und Unterstützerin dieser ästhetisch renitenten Poeten hatte Volker Braun die von ihm so apostrophierte „Flip-out-Elke“ ausgemacht, die an poetischer Aufsässigkeit seit je interessierte Elke Erb, die mit der Anthologie Berührung ist keine Randerscheinung (Kiepenheuer & Witsch 1985) den Aufbruch der jungen Poeten in der DDR motiviert und dokumentiert hatte.
Dreißig Jahre nach Volker Brauns Ironisierungen der Prenzelberg-Dichter hat sich die Szenerie von Grund auf verändert. Nach Sascha Andersons literarischem Offenbarungseid als Mitarbeiter der Stasi war das Ansehen der experimentell ambitionierten Dichterszene im Berliner Osten dramatisch gesunken.
Bert Papenfuß indes blieb der Gralshüter der anarchistischen Bewusstseinshaltung und die Zentralfigur der poetischen Renitenz. Während viele experimentell ambitionierte Dichter aus jenen Aufbruchsjahren in die Komfortzonen des Literaturbetriebs abwanderten oder in der Bedeutungslosigkeit versanken, erfand Papenfuß immer neue Kraftorte des literarischen Anarchismus. Zunächst waren es Zeitschriften im Geiste des Dadaisten und Anarchisten Franz Jung (1888–1963), mit denen Papenfuß den Mythos der anarchistischen Rebellion am Leben hielt.
Es waren Zeitschriften mit kampfeslustigen Namen, die zwar nur eine kurze Lebensdauer hatten, aber dann sofort ein Nachfolge-Perodikum generierten: Zeitschriften wie das 1997 im Basis Druck Verlag gegründete Blatt SKLAVEN, auf die der SKLAVEN Aufstand folgte, danach der GEGNER. Nach weiteren publizistischen Probeläufen mit Blättern wie floppy myriapoda, telegraph und Zonic wurde dann ab 2013 das anarchistische Zentralorgan ABWÄRTS! ins Leben gerufen, worin bis heute die schwarze Fahne der Anarchie geschwenkt wird.
All diese Metamorphosen und Mutationen des anarchistischen Biotops im Prenzlauer Berg kann man nun in einem herrlich ausgestatteten und mit Zeichnungen von Ronald Lippok und heiteren Fußnoten von Papenfuß versehenen Buch nachlesen, das bei starfruit publications erschienen ist. Allein schon die sorgfältig erstellte Typographie und die liebevolle Gestaltung, die dem starfruit-Verleger Manfred Rothenberger zu verdanken ist, machen dieses Psychonautikon Prenzlauer Berg zu einem großen Lesevergnügen. Die Gedichte und Traktate werden auf weißem Papier im Querformat präsentiert, auf gelbem Papier dann die ethnografischen Gespräche zur Genese des anarchistischen Biotops. Auch wenn man nicht bereit ist, in die kokette anarchistische Selbstbeweihräucherung der Autoren mit einzustimmen, liest man mit Begeisterung diese kleine Kulturgeschichte der poetischen Renitenz. Aus dem Mann mit der Lederkluft ist dreißig Jahre später ein Mann mit üppigem Seemannsbart geworden, der seine experimentellen Poeme in Moritaten, Traktate und lästerliche Lieder verwandelt hat. Bert Papenfuß, der Wortartist, hat mittlerweile eine Poetik der heiter-beiläufigen Schnoddrigkeit entwickelt, die ihre Quellen und Stichwortgeber aus altnordischen Mythologien, Störtebeker-Romantik, der Gaunersprache Rotwelsch und anarchistischem Schrifttum bezieht. Das klingt manchmal verdammt kalauerhaft oder bierselig, zelebriert aber in den stärkeren Passagen einen immer noch verblüffenden Wörter-Tanz. In heiterer Selbststilisierung entwerfen Papenfuß, Ronald Lippok und Annett Gröschner eine „psychogeographische“ Weltkarte des Prenzlauer Bergs, wo alle kleinen Kampfplätze der Szene eingezeichnet werden und wo am Ende deutlich wird, dass alle Wege der Anarchie in die Metzer Straße und die dort von Bert Papenfuß bis September 2015 betriebene Kulturspelunke Rumbalotte Continua führen. Wer jemals als Nicht-Eingeweihter die Schwelle dieser wirkungsmächtigen Raucherkneipe überschritt, geriet nach kurzer Zeit in Atemnot. Denn so viel dicke Luft und auch heiße Luft hat sich wohl kaum jemals in einem Lokal der Gegenwart zu so vielen Ideen der Renitenz inkarniert. In einem Papenfuß-Gedicht aus neuerer Zeit heißt es vielsagend:
Hochheiliger Nibelungenquatsch,
Remmidemmi und Kladderadatsch:
Ich geh schon mal ausbüxen.
So weit, so ungefähr. Ratze-
kahl. Das Glas ist leer.
Diese Gestalter des poetischen „Remmidemmis“, die hier ihren privatanarchistischen Mythen-Mix vorlegen – sie verstehen es wirklich sehr gut, auf den Putz zu hauen. Auch wenn dabei die eigenen Legendenbildungen immer mehr abbröckeln.
Michael Braun, signaturen, 27.12.2015
Herrlicher Krach!
Zunächst einmal ist es ein sehr schönes Buch, schwarz-gelb mit einer Zeichnung auf dem Cover, unverkennbar Lippok, ein Elefantenkopf mit einem seesternförmigen Auswuchs auf der Stirn und leeren Augenhöhlen, die auch eine Art Eingang sein könnten.
Psychonautikon deutet ja auch darauf hin, dass es im Inneren handelt. Irgendwie ein Ritt über Hirnwindungen oder ein Surfen auf einer Gedankenbrandung.
Im Buch selbst jede Menge Lippokscher Kunst, fortführend und erweiternd die Kubinsche Reise ins Skurril-Paradoxe zuweilen, und an anderer Stelle bis zum Anschein von Höhlenmalerei zurückgenommen. Ein Strich, eine Figur. Lippok, Leiberg und Penck waren und sind Gegenentwürfe. Rau gegenüber der Leipziger Schule mit ihren photographisch exakten Oberflächen. Lippok puzzelt nicht, Lippok erfindet. Das Abseitige wächst ihm aus dem Strich heraus, es muss also irgendwie im Strich selbst schon liegen. Mitunter gibt es sich als Archaisches preis, aber nicht im Sinne von zeitlich ursprünglich, sondern als etwas, das von der Außenwand der Kultur her kommt. Erhabenheit, die man sonst vielleicht nur im Horrorfilm findet.
Vielleicht ist es jetzt so weit, oder aber es war schon immer so. Der Berg wird historisch. Untrügliches Zeichen dafür sind die Anmerkungen in den Fußnoten zu Papenfuß’ Gedichten. Referenzen auf Texte von altisländischer Dichtung über Expressionismus bis hin zu Artikeln von Volker Braun in Sinn und Form.
Zentral (zumindest für mich) vielleicht ein Gedicht, das der nimmermüden Elke Erb gewidmet ist, das „Schonen“ heißt und das im Refrain Verse der Autorin durchdekliniert. Der erste Refrain, bestehend aus Zitaten lautet:
„Gedanken wie Reisig zu Füßen“
„Es fängt an dunkel zu werden
Es hört auf hell zu sein“
„Meine eigenen störrischen Zweige,
zum Winter geworfen“
„Es hört auf dunkel zu sein
Es fängt an hell zu werden
Und zwei ist eins.“
Der mehr oder weniger romantische Anklang dieser Strophe verliert sich dann natürlich in der Permutation und im handfest Balladesken des ganzen Gedichts.
Der letzte Refrain:
„die Monologe gehen fremd“
Vorbeigefahren, eingeschliffen:
Eins ist zwei und null zugleich.
„Werden zu hell an fängt es
Sein zu dunkel auf hört es
Werden zu dunkel an fängt es“
Mainstream ist woanders.
Sichtbar auch hier der Zugriff von Papenfuß aufs Material. Er hält die Form, führt Treibstoff ins Innere, bis sie es selbst nicht mehr aushält und explodiert. Dieses Phänomen ist fast in jedem seiner Gedichte zu beobachten. Eine Art Atomlyrik. Es wird angereichert bis zum Knall. Herrlicher Krach!
Mir, als gebürtigem Karl-Marx-Städter und später dann Leipziger, war der Prenzlauer Berg immer Fiktion und somit ein Sehnsuchtsort, den ich mein Lebtag umschiffte, als hätte ich Angst, den Berg/die Insel zu betreten, weil er/sie verschwände im reinen Kontakt. Und nun hat er sich auch in die Fiktion zurückgezogen und als Gedanke konserviert.
Der Berg ist historisch geworden, seine Protagonisten siedeln in der Diaspora und senden mythologische Betrachtungen. Variationen einer Vergangenheit. Einer Vergangenheit aber, die ihren Anspruch bewahrt und immer wieder Explosionen zeitigt und damit verhindert, dass ein Leser wie ich in melancholische Rückschau versinkt.
Durch, durch den Kosmos,
ran an das Pflaumenmus.
Raus aus der Materie,
rein in die Kartoffeln.
Rum um die Kalotte,
rein in die Spelunke.
Gedichte und Zeichnungen im Buch sind auf weißem Papier gedruckt. Durchschossen sind sie von zwei auf gelbem Papier gedruckten Gesprächsblöcken. Hier konstruiert und rekonstruiert die Berliner Autorin Annett Gröschner im Gespräch mit Papenfuß und Lippok den Berg jenseits des Szeneviertels neu. Irgendetwas muss man mit der Asche ja machen. So lautet der letzte Satz.
Jan Kuhlbrodt, signaturen, 30.11.2015
Punk auf der Tastatur
– Warum es sich nicht mehr lohnt, über den Prenzlauer Berg zu schimpfen, außer es wird ein Psychonautikon. –
Es gab mal eine Zeit, in der der Prenzlauer Berg wild war. Eine Zeit, die wie aus einer anderen Epoche scheint, von der man hier und da mal munkelt und die dann gerne in einem Ton mit der Geschichte vom Trümmerfeld Mitte genannt wird. All das ist im Jahrzehnt des Prenzlberg-Bashings in den Wogen grüner Smoothies ertrunken und unter Schwabenwitzen todverniedlicht worden. Was jetzt nicht passieren sollte: Dass dieser Text in den Ordner mit den Prenzlauer-Berg-Lästerartikeln verschoben wird. Dies ist keine Tirade. Vielmehr so etwas wie die Bühne für eine Ehrenrettung im Wolfspelz. Bert Papenfuß (Gedichte und Text) und Ronald Lippok (Zeichnungen) beleuchten in Psychonautikon Prenzlauer Berg diese Welt, in der „einst Luschen und Ässer die Sau rausließen“, aber mit den Mitteln eines Spions im System.
Der Dichter Papenfuß war eine der zentralen Figuren des DDR-Untergrunds. Gemeinsam mit dem Musiker und Künstler Lippok (Ornament & Verbrechen, Tarwater, to roccoco rot) lässt der Kneipier (u.a. Kaffee Burger) eine Assoziationswelle auf den geneigten Leser los, die ihresgleichen sucht. Wenn hier Weltraumpiraten und Paramilitärs auf Kosmonauten und Glücksritter, Rotwelsch und Schwabenblagen, T. Rex und Franz Jung treffen, ist der harte Aufprall nicht weit. Psychonautikon Prenzlauer Berg zeigt der Gentrifizierung den Mittelfinger, aber nicht aus der Sicht des arroganten Zuzug-Hipsters. Papenfuß und Lippok machen Tabula Rasa und erwecken damit die längst verloren geglaubte Welt des wilden Prenzlauer Bergs wieder zum Leben.
Wenn Architektur gefrorene Musik ist, dann hatte der Architekt hinter diesen Versen Punk auf der Tastatur.
Am kommenden Donnerstag stellen Papenfuß und Lippok Psychonautikon Prenzlauer Berg im Rumbalotte continua mit einer Lesung vor. Drei Tage später, am Sonntag, findet dann im Roten Salon der Volksbühne die große Gala zu „20 Jahren Tarwater“ statt. Für beide Abende gilt – wie die Volksbühne so treffend schrieb: Der Abend soll ausdrücklich unterhalten. Für alle gilt: Hin da und noch ein bisschen von dem Prenzlauerberg-Spirit schniefen, in dem die wilden Kerle wohnten.
Johannes Hertwig, apfelknecht.de, 15.11.2015
Zeilen, neben denen sich Gangsta-Rapper wie Pussies
ausnehmen.
– 67. Frankfurter Buchmesse: Zehn Bücher, die uns auffielen. –
(…)
Interessiert sich tief im Westen jemand für die Gentrifizierung des Prenzlauer Bergs? All die verlorenen Ost-Ruinen, die jetzt von Beate Uhse oder Rossmann übernommen sind. Man tut dem Lyriker und Kneipier Bert Papenfuß und dem Musiker und Zeichner Ronald Lippok nicht Unrecht, wenn man ihnen Ostalgie unterstellt im Psychonautikon Prenzlauer Berg. Im kongenial gestalteten, quer zu lesenden Band lassen sie in Wort und Zeichnung ihrer Aggression freien Lauf, und ihrer Wehmut, und es werden vielleicht auch alte Schlachten noch einmal ausgefochten. Immerhin lösen eingeschobene Interview-Passagen mit Annett Gröschner und Fußnoten manche kryptische Anspielung auf, und Papenfuß montiert sich quer durch die Kulturgeschichte von alten Runensteinen über den Barocklyriker Hans Aßmann von Abschatz und Brecht bis zu T. Rex und Can. Er fügt Zeilen, neben denen sich Gangsta-Rapper wie Pussies ausnehmen. Auf mindestens jeder zweiten Seite stehen Verse zum In-Steine-Hauen, Wortmusik, die rockt:
Ab uff’n Schwof mit Schickedanz, Schüddekopp, Lobe-
danz, Schlichtegroll, Rördanz, Störtebeker und Discomaus;
die Elite ist der Abschaum des Durchschnitts durch und durch:
Eitrig giert der Schlund,
ohne Zutaten keine Gedichte;
literatur dich andermal ins Knie rein!
(…)
Ralf Stiftel, Westfälischer Anzeiger, 16.10.2015
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Jonis Hartmann: Kompanie Fußnoten, Underground-Sprech
fixpoetry.com, 29.6.2016
Der Punk aus der Kleinstadt
Bert Papenfuß ist ein Lyriker, dessen Texte in der DDR verboten waren. Der Punk Papenfuß prägte die Ostberliner Szene wesentlich mit. Nach der Wende erhielt er zahlreiche Lyrik-Preise. Was wenige wissen: Seine Wurzeln liegen in Stavenhagen. Silke Voß unterhielt sich mit dem Enfant terrible des Ostens über Mecklenburg.
Silke Voß: Herr Papenfuß, Sie kennen den Prenzlauer Berg aus einer Zeit der leeren Häuser mit abgeratzten Buden samt Außentoilette, des nächtlichen Bierholens aus Kohleeimern, endloser Spaziergänge auf Mietshaus-Dächern. Ganz anders als das Leben in der DDR-Provinz. Hat die dörfliche Enge ihre später gelebte Anarchie geprägt?
Bert Papenfuß: Naja, nicht unbedingt. Ich glaube, junge Leute mit 17 kommen überall auf den Trichter, sich gegen Autoritäten zu wehren. Das hängt ja auch davon ab, ob jemand vom Dorf oder einer Kleinstadt kommt, wie die persönliche Konstitution beschaffen ist und so weiter. Dass es in Mecklenburg nun besonders engstirnig war, kann ich auch nicht behaupten. Die Leute sind hier genauso nett und genauso bekloppt wie anderswo auch.
Voß: Wie lange waren Sie in Stavenhagen?
Papenfuß: Geboren bin ich 1956 in der Reuterstadt, aufgewachsen bin ich aber bei meiner Oma mütterlicherseits und den Urgroßeltern in Jürgenstorf. Allerdings war ich oft bei Verwandten und Bekannten in Stavenhagen. Ab 1961 lebte ich dann bei meinen Eltern in Greifswald, war aber bis Anfang der 70er Jahre oft in den Ferien in Jürgenstorf.
Voß: Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit?
Papenfuß: In Pribbenow im Krug habe ich mein erstes Bier getrunken und Skat gespielt, in Kittendorf war ich zum Jugendtanz, war in Waren baden und so weiter. Es ist alles schon so lange her.
Voß: Sind Sie jetzt manchmal noch in den Orten Ihrer Kindheit?
Papenfuß: Bis Anfang der 80er Jahre war ich noch des öfteren mit meiner Frau und Tochter in Jürgenstorf und Stavenhagen, danach seltener, seit der Wende wohl gar nicht mehr.
Voß: Inwieweit hat Mecklenburg Ihr literarisches Schaffen geprägt?
Papenfuß: Wenn man aus der Reuterstadt und umliegenden Dörfern kommt, hat man – abgesehen von beziehungsweise aufgrund der eingeborenen Mentalität – natürlich auch einen Zugang zu Reuters Sprache. Plattdeutsche Wörter, Worte, Einsprengsel und längere Passagen finden sich überall mehr oder weniger versprengt in meinen Büchern.
Voß: Wo ist Heimat für Sie?
Papenfuß: Seit der Kindheit lese ich gern Karten, bin ich fasziniert von Orts-, Flur,- und Gewässernamen. Man kann Rügen ebenso gut Hawaii nennen. Es ist überall wie in Cornwall. Es kommt auf das Herz an, schreib ich einmal. Ich persönlich mag Bunkerstationen, Felsüberhänge und Hünengräber…
Nordkurier, 10.2.2016
„Berlin ist nicht aller Tage Abend“
– Bert Papenfuß ist gerade 60 geworden. Wir sprachen mit dem Lyriker und Anarchisten über letzte Horte der Resistenz im Bezirk, Saufen mit Peter Brasch bei Trümmerkutte und sein mit Ronald Lippok zusammengestelltes neues Buch Psychonautikon Prenzlauer Berg. –
Erik Heier: Glückwunsch zum 60. Geburtstag, Bert Papenfuß. Werden Sie jetzt melancholisch?
Bert Papenfuß: Nee, eigentlich nicht. Mit 19 konnte ich mir nicht vorstellen, 20 zu werden, geschweige denn 91. Und heute bin ich eben 60. So.
Heier: Im September haben Sie nach 15 Jahren Ihren Quasi-Zweitberuf als Kneipier aufgegeben: mit dem Ende der Kulturspelunke Rumbalotte continua in der Metzer Straße.
Papenfuß: Ja, es begann 1999 mit dem Kaffee Burger. Das habe ich neun Jahre lang gemacht, zusammen mit Karl-Heinz Heymann und Uwe Schilling. Und nach einem Jahr Pause noch mal fünf Jahre die Rumbalotte.
Heier: Fehlt Ihnen jetzt schon die Tresenarbeit?
Papenfuß: Überhaupt nicht, nee. Die Rumbalotte war für meine Frau Mareile und mich ein sehr anstrengender Job. Der Laden lief nicht gut genug. Wir konnten nicht wirklich davon leben.
Heier: Weil das Stammpublikum nicht ausreichte?
Papenfuß: Da haben sich ja auch Touristen hin verlaufen, in der Nähe sind viele Hostels. Die dachten, das wäre eine ganz normale Anarchokneipe, oder ein linkes Informationszentrum. Andere haben das für eine harte Musik-Bar gehalten. Ein paar haben aber auch begriffen, dass es ein Hort der Prenzlauer-Berg-Resistenz war.
Heier: Einer der letzten im Bezirk.
Papenfuß: Alle kennen ja die Situation. Der Prenzlauer Berg ist konsolidiert für eine bestimmte Populationsschicht, die ich jetzt nicht näher beschreiben muss. Aber auch diese Leute haben Kinder, die irgendwann groß sind. Dann werden sie merken, dass hier nichts los ist. Wenn sie sich amüsieren wollen, müssen sie nach Neukölln oder Kreuzberg. Gesellschaftliche Umbrüche haben Konsequenzen: Gentrifizierung, Degentrifizierung, Reconquista, Anarchie usw. usf.
Heier: Wie genau meinen Sie das jetzt?
Papenfuß: Wie ich’s gesagt habe: Berlin ist nicht aller Tage Abend.
Heier: Was bedeutet eigentlich das Wort Psychonautikon im Titel des neuen Buches?
Papenfuß: Sagen wir mal: Das Buch ist ein Seelenführer durch den Prenzlauer Berg, schon seit der Konzeption ein Standardwerk.
Heier: Eigentlich sollte es ja „Pißpott Prenzlauer Berg“ heißen, wie eine originalgraphische Edition, die Sie – wie dieses Buch – mit dem Musiker Ronald Lippok (Tarwater, To Rococo Rot) gemacht haben.
Papenfuß: „Pißpott“ bezieht sich auf das Märchen vom Fischer und seiner Frau. Dass man diverse Stufen der Entwicklung durchlebt und am Ende wieder auf seinen Ursprung zurückgeworfen wird. So ähnlich erschien Ronald Lippok und mir die Situation im Prenzlauer Berg. Als wir dort Anfang der 80er-Jahre anfingen, gab es keine Veranstaltungsorte für die Art von Kultur, für die wir standen. Kurz nach der Wende hatten wir ein reges kulturelles Leben in Prenzlauer Berg. Dann wurde es nach und nach wieder abgebaut. Und zum Schluss ist es so wie zu Beginn: Man will ein Konzert veranstalten. Aber wo eigentlich? Wo?
Heier: Vielleicht zurück dorthin, wo alles anfing – zu den Performances in Wohnungen?
Papenfuß: ScHappy hat mir neulich erzählt, er mache jetzt wieder Wohnungslesungen.
Heier: Peter Wawerzinek alias ScHappy gehörte wie Sie zur legendären Prenzlauer-Berg-Connection – der Subkultur in Ostberlin.
Papenfuß: Er wohnt ja direkt im Herzen der Bestie: am Kollwitzplatz (lacht). Der Prenzlauer Berg hat sich damals auch in Mitte abgespielt, oder in Friedrichshain. Und wir haben vorzugsweise in Friedrichshain gewohnt. Adolf Endler hat zwar später diesen Begriff der „Prenzlauer-Berg-Connection“ geprägt, aber das hing viel eher damit zusammen, dass relativ viele Veranstaltungen in Prenzlauer Berg stattfanden – und auch unsere Kneipen dort waren.
Heier: Auf einer von Lippoks wunderbar stilisierten Karten im Buch sind einige zu sehen.
Papenfuß: Klar, wir sind ins Café Mosaik in der Prenzlauer Allee gegangen, ins Wiener Café in der Schönhauser Alle, ins Fengler in der Lychener Straße. Oder ins Burger in den 70er Jahren.
Heier: Eine andere war Trümmerkutte an der Ecke Oderberger Straße/Kastanienallee.
Papenfuß: Das war eine Kneipe für Peter Brasch, der hat um die Ecke in der Choriner gewohnt. Wenn ich mal bei Trümmerkutte war, dann mit Peter Brasch nach einer durchsoffenen Nacht. Der machte sehr früh auf. Um vier oder fünf Uhr. Gut für die Nachtschwärmer.
Heier: Hat Ihnen die langjährige Kneipenerfahrung später hinterm Tresen was gebracht?
Papenfuß: Das hat im Kaffee Burger dazu geführt, daß ich sofort Tresenverbot hatte – da ich am Tresen immer so großzügig bin und alle meine Freunde einlade.
Heier: Die alte Prenzlauer-Berg-Szene wirkt ja als Schlagwort fort. Aber auch literarisch?
Papenfuß: Viele haben sich zurückgezogen. Stefan Döring macht kaum noch was. So ähnlich wie Henryk Gericke, der auch nur alle fünf Jahre mal ein Büchlein rausbringt. Von vielen hört man gar nichts mehr. Detlef Opitz arbeitet immer zehn oder 15 Jahre an einem Buch. Ein paar sind gestorben, wie Peter Brasch. Wer ist eigentlich noch literarisch aktiv (grübelt)? ScHappy, ich. Döring hin und wieder. Aber sonst?
Heier: Jan Faktor – der aber der Szene entsagte und im Jahr 2000 in einem Text darlegte, „warum aus uns nichts geworden ist.“
Papenfuß: Die Vorwürfe hat er schon 1984 erhoben. Immer wieder über die Jahre. Diszipliniert euch! Sauft nicht so viel! Verderbt euch die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht durch die ganze Rumfickerei! (lacht)
Heier: In einem Ihrer Texte im Buch schreiben Sie ja von der angeblichen Prenzlauer Berger Redensart „Rumzicken, Durchticken, Rumficken und Durchblicken“. Laut Fußnote ein Zitat aus: Diktatorenkollektiv (Hg.). „Lohn und Sanktion. Wie wir sprachen – was wir wurden. Lexikon und Idiotikon der Prenzlauer Berg-Untertagesprache“. Erscheinungstermin: 2017. Im Netz findet man dafür unter einem Ihrer Texte aber auch ein früheres Datum: 2013.
Papenfuß: Ja, ja. Wir arbeiten schon lange daran (lacht). Steht da nicht auch noch etwas vom Kapitel „Prenzlauer Berg rhyming slang“?
Heier: Ja. Das Projekt gibt es also wirklich?
Papenfuß: Ich bin ein Mitglied des Autorenkollektivs. Wir wollen einfach mal die ganzen klandestinen Ausdrücke zusammentragen, die man in den 70er- und 80er-Jahren benutzt hat.
Heier: Wie geht es nach dem Ende der Kulturspelunke Rumbalotte continua weiter?
Papenfuß: Wir betreiben die Rumbalotte als Verein. Jetzt haben wir ein Vereinslokal in der Willner-Brauerei in Pankow. Da gibt es einen Biergarten, ein paar kleine Gewerke wie eine Kaffeerösterei und diverse Clubs. Es war ja auch immer so, dass wir unsere Veranstaltungen auch in befreundeten Kneipen gemacht haben: im Baiz oder im Lokal – dem ehemaligen Pieper –, und im Luxus von Stefan Döring.
Heier: Sie selbst sind vor vier Jahren nach Weißensee ins Komponistenviertel zu Ihrer Frau gezogen. Wie sind die Kneipen dort?
Papenfuß: Wir gehen da eigentlich nicht in die Kneipe. Gibt ja keine richtige. Gegenüber ist ein Kubaner. Das war früher mal die Baiz von Weißensee. Aber der Vermieter hat irgendwann viel mehr Miete verlangt, das war’s dann. Das Komponistenviertel ist sozusagen der verlängerte Prenzlauer Berg.
Heier: Der Prenzlauer Berg zieht Ihnen also quasi hinterher, Herr Papenfuß!
Papenfuß: Natürlich! Ein Bio-Ding nach dem anderen, eine Cocktail-Bar nach der anderen! Weiter hinten gibt es immerhin noch einen Antifa-Laden, die Bunte Kuh, die ist schon ewig da. Für die bin ich jetzt allerdings zu alt.
tip, Heft 2, 2016
Warum ich immer eine arbeitsscheue Freundin wollte
Schuld ist der Aufbau-Verlag, 1987 erschien eine von seinem Lektor Hanns Kristian Schlosser zusammengestellte Anthologie zur 750-Jahrfeier der Haupt- und Frontstadt: Berlin. 100 Gedichte aus 100 Jahren. Sie gliedert sich in zwei Teile, und in dem, der die Literatur nach 1945 umfasst, steht ein 1978 erstveröffentlichtes Gedicht von Bert Papenfuß: „erzaehl das mal keinem so naif. sechs einfache sakksaetze“. Er nimmt uns mit auf einen ausgedehnten Abend voller Wein, Weib und Gezank. Die Beteiligten machen sich alsdann mit alkoholischem Proviant „auf den weg / zum rang & namenlosen fang & fest.“ Nicht allen wird es leicht:
denn einige schlafen schon
sie muessen in zwei stunden
aufstehn & luegen gehn.
Ein paar frühmorgendliche Ab- und Irrwege später:
ueberraschend ist es kaum
aber es macht mich
irrsinnig fotz freude
in meinem zimmer
die schlafende emm zu treffen
meine listige schoene
& arbeitsscheue freundin
Das hatte gesessen! – und den Weg ins Bücherregal meiner Eltern gefunden. Wir wohnten fünf Minuten Fußweg von der Friedrichsgracht, Berlin-Mitte, die das Titelblatt jener Anthologie abgab, als Ausschnitt eines Panoramas von Otto Nagel. Ich will hier nicht nachträglich eine Initialzündung konstruieren, aber „arbeitsscheu“ und dann noch „listig schön“; dieser Ton wurde in unseren Schullesebüchern nicht angeschlagen. Und auf unserem Schulhof redete man auch nicht von „Arbeitsscheuen“, sondern von „Asozialen“. Oder gleich von „Assis“. Die nämlich gab’s; auch sie hatten Kinder, und auch die mussten lernen. Von jeher erscheinen die bösen Jungs und Mädchen als die interessanteren; ausnahmsweise habe ich da keine Ausnahme gemacht.
Ein Staatsuntergang später, und ich sollte den Autor der sakksaetze kennen lernen. Wir saßen am Küchentisch von Christine und Norman Gorek. Eine wohlmeinende Deutschlehrerin hatte mir am Gymnasium, ich machte mein Abitur nach, ans Herz gelegt:
Robert, aus Ihnen kann was werden. Sie müssen sich nur diesen Dialekt abgewöhnen.
Und jetzt sagte mir Bert:
Du, du bist doch wohl Rheinländer.
Ich bin bis heute traumatisiert und meine: richtig berlinert habe ich ab da. Ich fürchte fast, meine Freunde und ich haben Bert damals Sorgen bereitet. Wir hatten uns gesagt, was Heiner Müller kann, das können wir auch – wir lasen Ernst Jünger. Was Bert mit dem Satz quittierte:
Wenn’s schon ein alter Knacker sein muss, dann versucht’s mit Halldór Laxness. Der ist wenigstens Kommunist.
Drei Kneipengründungen später gab mir Bert am Tresen der Rumbalotte ein halbes Dutzend CDs von Mick Farren und den Deviants in die Hand. In einem Herbst, da ich wenig Rockmusik hörte. Aber die sehr oft; und ich tue es immer noch. Zum Beispiel Ptoojf!, erschienen 1967, zehn Jahre vor Punk – großartiges Dröhnen, dezidiertes Anti-Hippietum. Gerade läuft „Coming Home“, der zweite Song. Und ich kann nicht anders, der Gang des Sängers durch die Stadt, sie dürfte London sein, aber was sind schon Namen, zu seiner Freundin, erinnert mich plötzlich an den Gang des Dichters zu seiner Arbeitsscheuen. Danach dann ein ganz schlichtes, fast verhaltenes Lied. „Child of the Sky“ heißt es. Ich will es schön nennen, doch lauert da etwas. Das ist die List, ohne die es nichts wird. Mit der Lust. Und überhaupt.
Robert Mießner, aus Kaperfahrt um sieben Fuder Anagramme. Jubeldruck für Bert Papenfuß zum 60., 2016
Endstation Vinetastrasse
fährt man mit der berliner ubahn durch den prenzlauer berg, heisst es an der station und im bezirk pankow:
bitte alle aussteigen, dieser zug endet hier.
das war nicht immer so. bevor der sonderzug im sommer 2000 zum gewöhnlichen minutentakter wurde, endete die fahrt an der vinetastrasse, quasi im unendlichen. aussteigen musste man auch dort, die bezeichnung der näheren umgebung verhiess allerdings hoffnung. die strasse musste, auch, wenn sie zunächst im horizont verschwamm, zu der untergegangenen, sagenhaften stadt vineta führen. wer sich auf den weg in die utopie machte, stellte jedoch fest, dass er im kreis lief: die vinetastrasse umschloss in wirklichkeit bloss eine reihe kleinerer strassen und häuserblocks, bevor sie in etwa wieder an ihren ausgangspunkt anschloss. immerhin: der kreis umfasste mit der thulestrasse und der westerlandstrasse zwei eilande, die jahrzehntelang genauso unerreichbar schienen wie vineta.
sylt mit westerland wurde 1989 erreichbar, thule nicht. und ebenso wenig greifbar blieb schliesslich auch die damals laut ausgerufene szene prenzlauer berg, die es als einzelne kunstschaffende und vor allem gegen etablierte kunstbegriffe opponierende vielleicht gab, keinesfalls aber als geschlossene gruppe mit einem einheitlichen oder überhaupt einem manifest auf der bunten fahne. die szene verstand sich garnicht als szene, sondern wurde erst im zuge des mauerfalls als solche begriffen, bzw. der begriff mit einigen ostberliner autoren wie stefan döring, adolf endler, bert papenfusz, jan faktor, andreas koziol, johannes jansen oder rainer schedlinski verknüpft. oft entzündete sich das interesse des feuilletons der nachwende nichteinmal an den arbeiten der künstler in der gesellschaftlichen nische, „die sich erst durch ein [fortwährendes, unabdingbares] mitdenken des konkreten alltags“ erschloss2 sondern „an der aktiven i.m.-tätigkeit prominenter vertreter“ wie sascha anderson und rainer schedlinski. „,prenzlauer berg‘, ,die szene am prenzlauer berg‘ – chiffren einerseits für verrückte und ungezügelte kreativität, andererseits für ein geflecht düsterer machenschaften und spitzelei“, schreibt adolf endler3 und findet es „höchst verwunderlich und kommt einem ruhmestitel gleich, dass sich nur so wenige spitzel in der ,alternativen‘ kunst- und literaturgesellschaft haben installieren können.“ diese wenigen haben laut jan faktor innerhalb der „szene“ auch weniger schaden und verunsicherung verursacht, als vielmehr durch eine höchst unterschiedliche, verzerrte berichterstattung für verwirrung aufseiten der staatssicherheit gesorgt, die gegenüber den prenzlauer-berg-dichtern dann eher eine politik der schonung übte.4
nach einer „überdosis von standardisierung, die die summe aller möglichen interpretationen“ von text gleichermaszen wie von wahrnehmung der wirklichkeit „auf nur eine gültige bedeutung festschrieb“, so michael thulin [!],5 war der ausgangspunkt der prenzlauer-berg-literatur „eine kritik an der vorherrschenden sprache und ihren verkrusteten sprachgebungen“ in der bis dahin existierenden ddr. diese allgemeinste voraussetzung einer unzufriedenheit mit den gegebenen ausdrucksmöglichkeiten führte autoren zusammen, die unter anderen umständen (und mit einem eher apolitischen selbstverständnis) wohlmöglich nicht zusammengefunden hätten, und verbreitete die nachricht als literarisches gerücht.6 „was unterdessen zu einer ,sprachkritischen poetischen schule‘ prenzlauer berg berlin/ddr avanciert, hat in seiner einheitlichkeit nur im blick seiner kritiker bestanden.“ so lagen (geographisch betrachtet) wichtige veranstaltungsorte und treffpunkte der szene garnicht im prenzlauer berg, sondern im bezirk mitte oder in pankow (zb. bei dem dortigen, schon lange bestehenden lyrikclub pankow). „und was inzwischen wie ein intelligentes linguistisches spiel anmutet und manchem immer noch interpretationsrätsel aufgibt, war vor kurzem noch bitterer ernst“, erklärt thulin. „wer sprach, musste sich entscheiden […] zwischen dem konflikt mit den signifikanten an- & abwesenheiten der sprache oder dem festkrallen an den gängigen sprachgebungen der simulationsmaschinerie“, die immer nur die gleichen, sinnentleerten worthülsen wiederholten und über institutionen wie das „druckgenehmigungsverfahren“ in texte eingriffen bzw. sie ganz verhinderten. dass in der presse zudem meldungen über mordfälle, sexualdelikte und ähnliche verbrechen oder auskünfte über das leben prominenter ganz fehlten bzw. strengen reglementierungen unterlagen, förderte eher die phantasie der bevölkerung und die kreativität der kunstschaffenden. die „wahrnehmung der kulturell-erzieherischen funktionen des staates“7 durch praktizierte zensur führte. bei textern zur vorauseilend entschärfenden selbstzensur, aber auch zu den sogenannten „grünen elefanten“, die in einen text eingebaut wurden, um von den wirklich scharfen stellen abzulenken. wurden die auffälligen elemente zensiert, blieb das eigentliche stehen.
für die gesamte ddr galt damals – und es gilt heute noch ohne westöstlichen unterschied –, dass grosse städte für individualisten durch die höhere anonymität ebenso wie durch vielfältigere treff-, begegnungs- und berührungspunkte spezifischer gruppierungen gleichzeitig gegenüber dem platten land mehr publizistischen freiraum als auch mehr schutz vor repressalien boten. die atmosphäre in ostberlin war „wirklich entspannter als in der übrigen ,republik‘, man konnte es hier relativ einfach schaffen, nur die lächerlichen und harmlosen seiten der stasi-aktivitäten wahrzunehmen und die ernsthafteren dinge auszublenden. als schutzmechanismus hat das gut funktioniert.“8 literarisch gesehen war für „eine gesamte generation zurückgewiesener schriftsteller“9 in diesem sinn berlin das höchste der gefühle, knapp gefolgt von dem kleineren, jedoch sehr eigentümlichen mantel, den etwa dresden und leipzig boten.10 hier konnten sich lange gestaute energien, wut und langeweile entladen und „mit einer bibliothek voller angedruckter texte“11 eine schranke durchbrechen, um neuland zu entdecken.
es wimmelte von lyrikern, die noch nie ein gedicht veröffentlicht hatten, von malern, deren bilder in keiner ausstellung hingen. […] ihrem ruhm in der szene tat dies keinen abbruch – im gegenteil. es war ein ausweis von qualität, nirgends gedruckt zu sein, da die zensur in ihren augen nur schwachsinn und lügen passieren liess.12
ziel von kunst sei die kultivierung des fehlers, proklamierten döring, faktor und papenfusz in ihrem manifest zoro in skorne ende der 198oer jahre. für ihre literatur hiess das, im umgang mit sprachlichen strukturen (alten/neuen, westlichen/östlichen) die semantische veränderlichkeit und fehlerhaftigkeit durch assoziative ablenkung und syntaktische derivationen vom etablierten sprachmuster zu stimulieren und als eigene geste zu postulieren. „die ddr war das land der erfundenen leben. in ihr existierte die ganze welt noch einmal spiegelverkehrt“,13 berichtet stefan wolle.
genau das war vielleicht eine vorstufe, aber eben nicht das ziel der prenzlauer-berg-autoren. man war nie bestrebt, ein positives bild dem zu ignorierenden negativen entgegenzusetzen, sondern den sprachlichen moder des neuen deutschland wahrzunehmen, ihn so lange zu traktieren und abzukratzen, bis seine unstimmigkeit und lügenhaftigkeit sichtbar wurde. ralf b. korte stellt im vorwort zur perspektive 26, einer sondernummer mit texten aus „dem umfeld der ehemaligen prenzlauerberg-szene“, diese vorgehensweise der literarischen produktion einerseits in die nähe des generalkonzepts der österreichischen zeitschrift und andererseits in die tradition der wiener gruppe, die in der umbruchzeit nach dem zweiten weltkrieg „einen raum für schreibweisen jenseits standardisierten erzählens und neokonservativer dichtkunst“ schuf.14 diesen raum galt es, in dem ach so hippen berliner bezirk zu verteidigen. aber: „im literarischen feld sind hierarchien in den satzbau der einzelkämpfer gebrannt, man darf sich da nicht täuschen lassen. sublimationsstrategien dichten den konkurrenzdruck, die freundliche befüllung der siegessäulen umrollenden räderreifen, nicht ab. nach dem staat, der die frage der lebensform stellt, ist nun, unter neuer gewalt, die überlebensfrage dominant“, und wenn es bloss darum ging, die ehemaligen treffpunkte aufrecht und von touristischer nivellierung rein zu halten. Denn:
die welten der dichter und der normalen menschen waren nicht voneinander geschieden; sie verband bisher eine gewisse proletarische grundstimmung. das änderte sich mit der wende. der im osten bislang unbekannte typus der ,szenekneipe‘ entstand […] es liegt auf der hand, dass da die gefahr der intellektuellen selbstbespiegelung nicht weit ist, mit der verwechslung von substanz und gestus, die dafür typisch ist.15
wichtiges verständigungsmittel der dichter vom prenzlauer berg waren neben den zahlreichen im selbstkostenvertrieb vervielfältigten zeitschriften die legendären, zum mythos gewordenen wohnzimmerlesungen und eine art der mündlichen volkskultur und ersatzöffentlichkeit mit lesungen in caféhäusern: dem ecke schönhauser, dem poesie-café clara, das adolf endler zu einem „sammlungsraum der weltpoesie“ machte,16 sowie bars wie dem fengler im lsdviertel zwischen lychener-, schliemann- und dunckerstrasse. das clara wurde 1998 geschlossen, fand mit dem von bert papenfusz geleiteten kaffee burger in der torstrasse (ehem. wilhelm-pieck-str. in mitte) lange zeit einen würdigen nachfolger, bevor auch dort mit dem besitzer die verhältnisse wechselten.
papenfusz und döring „besetzten“ mit ihrer zeitschrift sklaven vorher bereits den torpedokäfer in der dunckerstrasse, das walden in der choriner strasse, später die nachtbar luxus, und hielten im siemeck den „sklavenmarkt“, eine offene lesebühne, ab. allgemein galt in den kneipen und cafés, dass „das schnell hingeworfene wort kaum kontrollierbar oder gar gegen den redner zu verwenden war, der in diesem milieu obligate ironische tonfall machte jede strafrechtliche würdigung schwer, und niemand trug die verantwortung oder unterlag der verpflichtung, sein gegenüber zu kennen“.17 ausser dem „tresenlesen“ gehörten diskussionsrunden auf dem dachboden der zionskirche oder autorenlesungen auch ausländischer dichter wie bulat okudshawa und allen ginsberg in der wohnküche der familien maass, poppe u.a. als fester und wichtiger bestandteil zum kulturellen austausch. häufig genug wurde eine bereits plakatierte und dann doch verbotene autorenlesung in private räumlichkeiten umverlegt. Und oft genug erwartete die stasi die besucher danach zur personenkontrolle auf der strasse:
immer wieder beim besuch in fremden wohnungen der gewohnheitsmäszige forschende blick zum meistens blätternden plafond, zu den buckeln der tapete, auf die dielenritzen hinunter, […] und manchmal findet man die dinger, die ,wanzen‘ auch, hat sie ergriffen […] und zeigt sie im bekanntenkreis mit dem stolz des erfolgreichen jägers grienend herum; vor einer weile ist das ein paar stunden vor dem beginn einer lesung bei den poppes in der rykestrasse geschehen, und es ist beleidigenderweise eine abhörwanze ,der älteren bauart‘ gewesen, wie mir der kenner und wanzen-fan gerd poppe erklärt hat […] alle in poppes kleiner wohnung zusammengepferchten 100 oder 120 zuhörer […] werden bestätigen können: es wurde die sagenhafteste ,lesung‘, die man sich denken kann – vielleicht nicht zuletzt dank der befeuernden anwesenheit der einen oder anderen ,wanze‘, der man ziemlich sicher sein konnte,
berichtet adolf endler.18 im januar 1982 kommt „jandl ins landl“:
es wirkt wie blanker hohn und ist nicht leicht erträglich, wenn ernst jandl vor ausgesuchtem publikum im tip, im theater im palast der republik, seine quirligen texte vortragen darf – ein beweis dafür, wie ,liberal‘ die ddr ist –, die ihm geistesverwandten jüngeren autoren im landl jedoch mit striktem auftrittsverbot geschlagen sind, von der drucklegung ihrer werke ganz zu schweigen […] glücklicherweise gelingt es, ernst jandl mit list und tücke in den prenzlauer berg zu entführen, […] wo jandl in eine der typischen ,wohnzimmerlesungen‘ integriert wird; neben jandl, der sehr viel bodenständiger wirkt als erwartet, lesen unter anderem papenfusz, döring, faktor, die ,jandlianer‘ der ddr, um es vereinfachend zu sagen. kein zweifel, dass es demnächst eine sehr besorgte ,sitzung‘ der offiziell-literarischen führungs- und leithammel geben wird, […] zumal der gast aus wien auch über die misslichkeiten informiert wird, denen wir ,asoziale‘ ausgesetzt sind […] jedenfalls hat die ,szene‘ in ihm, dem schwer beeindruckten, einen neuen propagandisten gefunden, welcher verspricht, in österreich dies und das in die wege zu leiten für papenfusz, döring, faktor.19
über die jüngeren autoren vom prenzlauer berg denkt endler:
dass die einen ,beitrag zur sozialistischen lyrik-entwicklung‘ zu leisten haben [wie es für die aufnahme in die fortlaufend aktualisierte anthologie lyrik der ddr20 gefordert wurde], ist ihnen bislang selbst im traum nicht eingefallen; man kann ja schon froh sein, wenn sie einen ,beitrag‘ zur lyrik schlechthin leisten wollen, was nicht in jedem fall ganz klar ist… – diese poeten kommen eigentlich von vornherein für den schriftstellerverband nicht in frage, in dessen statut die tollkühne zumutung ausgesprochen ist: „die mitglieder des schriftstellerverbandes der ddr… bekennen sich zur schaffensmethode des sozialistischen realismus.“21
sich im schaffen vom realismus zu entfernen, wie es das dreigestirn döring, faktor und papenfusz vormacht, heisst ja noch lange nicht, sich gleichzeitig vom sozialismus zu verabschieden. und auch hier lautet das gegenteil von realismus nicht automatisch abstraktheit, sondern zunächst: wohltuender hyperrealismus.
dass endler wortkaskaden wie die sich schnell abnutzenden georgs sorgen um die zukunft22 nicht automatisch für lyrik hält, scheint nachvollziehbar:
mein name ist georg und ich habe angst vor der zukunft
wir alle sehen’s doch
das untreue wird immer untreuer
das omnipotente immer omnipotenter
das unbefugte immer unbefugter
das chemische immer chemischer
das theoretische immer theoretischer
[…]
das kille immer killer
das edame immer edamer
das orcheste immer orchester
[…]
das redundante immer redundanter
das simulante immer simulanter
das penetrante immer penetranter
undsoweiter und so fort. seitenlang. faktor demonstriert den leerlauf der sprache durch sich aneinander abarbeitende versatzstücke von bedeutung. „beim schreiben des textes hatte ich die möglichkeit, an mir zu beobachten, wie die mengen der wörter mit der zeit stumpf und unaufmerksam machen“, erklärt der autor im nachwort. bert papenfusz dagegen findet einen ganz anderen ansatz „im kritischen umgang mit den metaphorischen einheiten der sprache. im zentrum dieses schreibens steht das bezeichnete“23 und nicht das zeichen selber wie bei faktor. „in cunt we trust“,24 heisst es da mehrdeutig:
glocken dröhnen, titten
klingeln, flügel pfeifen
[…] bei kater besehn, ist sex ein arschloch
in cunt we trust, cook my sock.
beide, papenfusz wie faktor, arbeiten bei der präsentation ihrer texte mit technischer unterstützung: der eine wird begleitet und unterstützt von der sphärischen musik eines dj, der andere von seiner eigenen, auf tonband oder cassette aufgenommenen, schreienden stimme.
die in diesem aufsatz genannten dichter stehen, das ist zu beachten, nur stellvertretend für eine unzahl weiterer literaten der „szene“, die 1982 ihr erstarkendes jahr hatte und spätestens seit 1989 glorifiziert wird. überdies lohnte einmal eine weitere untersuchung der entwicklung der literarischen klein- und splittergrüppchen sowie deren publikationen (saufen aktuell beispielsweise, dem faltblatt der epidemie der künste) in den 2000er jahren. einige sind unterwegs verlorengegangen, viele von ihnen sind aber noch (oder wieder) aktiv oder – wie florian günther – geniessen zumindest eine art kultstatus mit gastauftritten bei events der jüngeren literaten.
aber wo hatten sie in der zwischenzeit, den jahren des ddr-„tauwetters“ publiziert? „plötzlich gedichte von uwe kolbe, die von internationalen politischen aktivitäten ,ausgelöst‘ sind:
falklandinseln
malwinen, anfang april 1982
ich finde die abschriften morgens in meinem briefkasten, vermutlich von kolbe hineingesteckt.25 das werfen von zetteln durch den briefschlitz ist schon die erste veröffentlichung. nach dem morgendlichen fund wird endler einige bogen papier in seine schreibmaschine spannen und das pamphlet vervielfältigen. im besagten jahr 82 ist die einfache form sowohl der literarischen präsentation als auch der graphisch-künstlerischen trumpf: „neu sind die, seit 1982 existierenden, kartonierten din-a4-hefte, deren herausgeber auf buchbinderische noblesse verzichten und kunstanspruch zugunsten eines anspruchs auf ein ende der stummheit zurückgenommen haben“, so christoph tannert zu einer graphik- und lyrik-ausstellung 1986.26 aber gerade weil viele dieser hefte unikatcharakter besitzen, werden sie zu begehrten sammelobjekten. vorreiter des mediums ist das zunächst in dresden, dann in berlin produzierte poe-sie-all-bum, in dem ebenfalls die texte als typoskripte und die eingehefteten leporelli sowie die umschläge als unikate in umlauf gebracht wurden. prinzip war die wechselseitige durchdringung von lyrischem text und malerisch-graphischer gestaltung. das poe-sie-all-bum erschien mit zehn nummern 1978–84 und fand mit der literaturzeitschrift mikado (1983–87 neun hefte), herausgegeben von uwe kolbe, lothar trolle und bernd wagner, einen würdigen nachfolger. „leben ist ausser den staatlichen sprachen“, konstatiert kolbe in seinen gedicht ,frühlinks‘ einmal mehr das credo der prenzlauer-berg-künstler der 1980er jahre und fasst zusammen:
deutlicher als an einzelne texte bleibt vermutlich die erinnerung daran, durchs schneetreiben einen kleinen handwagen mit einem apparat gezogen zu haben, mit dem man unter keinen umständen hätte erwischt werden dürfen, oder mit hundert umschlägen unter dem arm vom atelier eines befreundeten malers zurück nach pankow oder weissensee zu trampen. will man resümierend von einem ergebnis reden, muss zunächst einmal festgestellt werden, dass mit mikado das bis dahin undenkbare gelungen ist: über mehrere jahre hinweg in relativ regelmäszigen abständen in der ddr eine zeitschrift: ohne staatliche genehmigung zu drucken und zu vertreiben.27
weiter zu nennen im zeitschriftenbestand wären kontext, ostkreuz, ariadnefabrik, DER SCHADEN sowie das monatlich erschienene UND (berlin/dresden 1983–85) mit einer auflage von 15 rebellischen und punkigen exemplaren: „der modus war denkbar einfach: wer einen text in 15facher ausführung gab, wurde veröffentlicht – und bekam ein heft“, erläutert peter böthig28 das, was michael thulin ein „unikat-syndrom“ nennt, und berichtet über den (ebenfalls in ausrufenden block-buchstaben betitelten) SCHADEN, er sei mit zuletzt „nahezu 90 autoren, über 30 malern und mehr als 10 fotografen mitte der 80er ein repräsentativer und umfassender katalog der nichtoffiziellen kunst und literatur der ddr [gewesen], und besass bald eine erhebliche autorität.“ die „am längsten und kontinuierlichsten, allerdings mit einem engeren kreis von autoren, arbeitende zeitschrift [war] die in berlin von uwe warnke herausgegebene entweder/oder“,29 1982 zum erstenmal und 2017 zum 100. mal erschienen, in auflagen zwischen 10 und 20 exemplaren, nr. 100 in 100 exemplaren, plus mehrere sonderhefte zb. zur seriellen poesie. in einem selbstversuch uwe warnkes heisst es:
01. fr buchstabensuppe pur
02. sa buchstabensuppe mit wenig wasser, dazu reis
03. so buchstabensuppe pur mit brot
[…]
14. do buchstabensuppe mit zucker als pudding
15. fr buchstabensuppe in aspik
[…]30
warnke ist einer der glühendsten vertreter auch der visuellen poesie:
die sprachlosigkeit des zeichenhaften hatte im herbst 1988 endgültig ein ende gefunden. karla sachse, intime kennerin der szene, hatte den verantwortlichen im berliner kulturbund mit ausdauer und geduld klargemacht, dass das stiefkind zwischen den lagern der bildenden kunst und der schriftstellerei, die visuelle poesie, endlich ein podium benötigt, um aus seinem schattendasein herauszutreten.31
fast jeder in 1058 berlin, das war der prenzlauer berg zu ddr-zeiten, hatte also nicht nur sein eigenes blättchen, sondern, wie adolf endler sagt, auch „seine“ strasse. heute dagegen ist alles, was berühmt geworden ist aus der zeit damals das ostalgische nacherleben eines verlorenen, exotischen landes geworden, auch oder gerade weil die auflagen der „gebliebenen“ in die höhe gegangen sind. zwar müssen gleichermaszen viele der hier nichtgenannten autoren froh sein, überhaupt irgendwo veröffentlicht zu werden, aber beinah jeder dort im kiez hat jetzt seine eigene postleitzahl…
Crauss, Kritische Ausgabe. Zeitschrift für Germanistik & Literatur, Nr. 6, 2002
Kismet Radio :: TJ White Rabbit presents Bertz68BirthdaySession_110124_part 2
Zum 60. Geburtstag von Bert Papenfuß:
Lorenz Jäger: ich such das meuterland
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.1.2016
Zeitansage 10 – Papenfuß Rebell
Jutta Voigt: Stierblut-Jahre, 2016
Zum 65. Geburtstag von Bert Papenfuß:
Thomas Hartmann: Kalenderblatt
MDR, 11.1.2021
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb +
Internet Archive
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Dirk Skibas Autorenporträts +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Bert Papenfuß: FAZ ✝︎ taz 1 & 2 ✝︎ BZ 1, 2 & 3 ✝︎
Tagesspiegel ✝︎ LVZ ✝︎ telegraph ✝︎ lyrikkritik 1 & 2 ✝︎ NDR ✝︎
junge Welt 1 & 2 ✝︎ freitag ✝︎ nd 1 & 2 ✝︎ Zeit ✝︎ MZ ✝︎ Facebook ✝︎
Abwärts! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✝︎ Volksbühne ✝︎ Faustkultur ✝︎ DNB ✝︎
artour ✝︎ Fotos
Nachruf auf Bert Papenfuß bei Kulturzeit auf 3sat am 28.8.2023 ab Minute 27:59
Bert Papenfuß liest bei OST meets WEST – Festival der freien Künste, 6.11.2009.
Bert Papenfuß, einer der damals dabei war und immer noch ein Teil der „Prenzlauer Berg-Connection“ ist, spricht 2009 über die literarische Subkultur der ’80er Jahre in Ostberlin.
Bert Papenfuß, erzählt am 14.8.2022 in der Brotfabrik Berlin aus seinem Leben und liest Halluzinogenes aus TrakTat zum Aber.



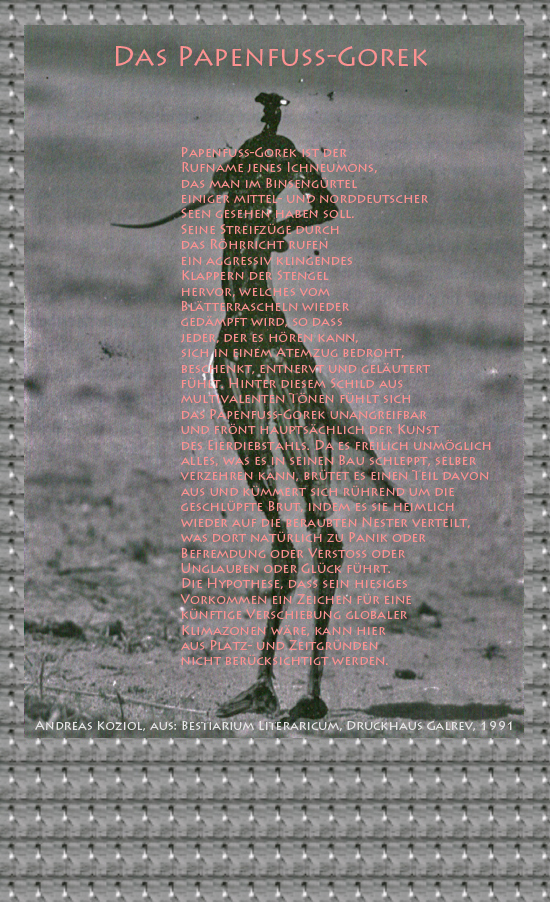
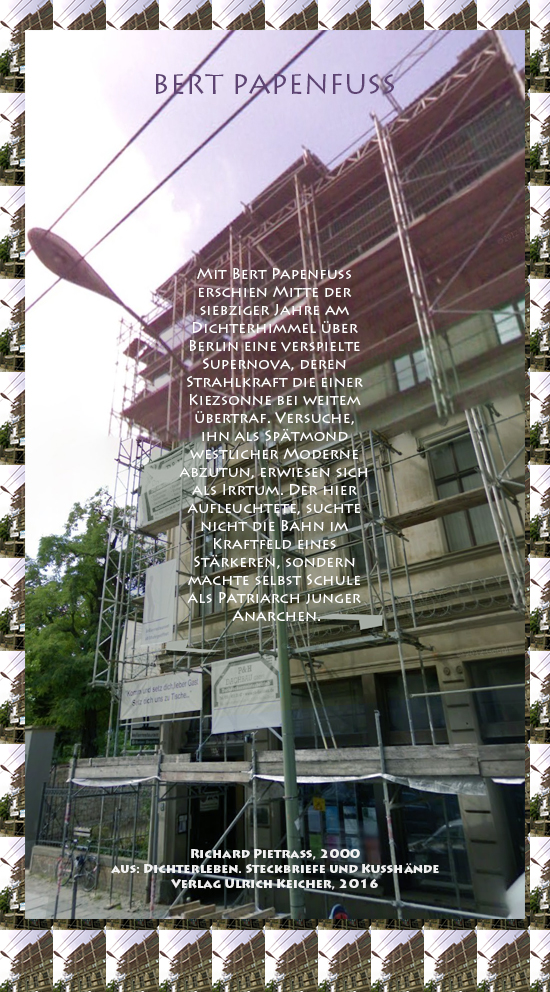












Sprachtypen, die ihre Literatur auch leben, sterben beschleunigt aus, schon vorab in Erscheinungsagonie gebracht durch berühmtes S-Arschloch-Treiben vor und zu Druckhaus Galrev, der steigende Stasispiegel hat anpassenden Menschen den nötigen Vorschub geleistet, die interessanteste Lektüreseite der DDR-Spätgeborenen unter den Kulturspieltisch zu kehren, ein in der Situation besonderer Vermittlungsschwere benötigtes Wurmloch ist hoffentlich in Arbeit für Bert Papenfuß, Andreas Koziol, Ulrich Zieger und einige mehr.