Elke Erb: Poesiealbum 301
IDYLL
Ich lag und sann, da kamen Kram-Gedanken.
Natürlich ist es recht, den Kram im Kopf zu haben.
So hältst die Sterne du in ihren Bahnen.
Statt aus der Welt heraus zu existieren
und fremd zu sein wie dir mehr als den Tieren.
Laß deinen Kram wie Himmelskörper strahlen
und denke dir zum Abschluß Brombeerranken.
Elke Erb
Kurvenreich wie das Eichblatt, spricht aus den Gedichten der 1938 in einem Eifeldorf Geborenen – seit vierzig Jahren in Berlin und in der Lausitz Lebenden – ein forschendes Bewußtsein, welches stets auf dem Gedankensprung ist. Während sie die Worte umgarnt, umarmen sie die Worte, in denen sie Zuflucht findet. Entfesselte Selbstgespräche dringen ans Ohr des Verdutzten, der merkt, daß es sich hier um die Besprechung von Wundern und Wunden handelt, die so nicht nur heilen, sondern zur Wabe eigenen Honigs werden. In Elke Erbs Texten nimmt das Staunen Gestalt an: ihre Verse werden Vehikel, Sinntaxen für alles Menschengewachsene.
Ankündigung aus Gottfried Benn: Poesiealbum 300, MärkischerVerlag Wilhelmshorst, Klappentext, 2012
Stimmen zur Autorin
Ihre innere, meist unaufgeregt leuchtende, sich mehr und mehr gewisse Sprache war von Anfang an Haltung, war Würde.
Uwe Kolbe
Nicht ein Text dabei, der einen fremden Gang nachahmt, nicht einer, der sich auf Kosten anderer amüsiert…
Brigitte Struzyk
Elke Erb schafft es mit ihrer Wortkunst, sich von der Alltagskommunikation zu entfernen, ohne dabei abgehoben oder künstlich zu wirken.
Jan-Gerrit Berendse
Wenn Elke Erb hermetisch ist, dann ist das alles andere als ein selbstzufrieden auf die fensterlose Schulter sich klopfendender Hermetismus, der etwa sanft auf dem Kissen seines guten Gewissens ruhte. Es ist vielmehr ein sich gegen den Prozeß anstrengender Hermetismus, der Öffnung einklagt und dessen Parole nicht Selbstperpetuierung auf ,Nimmerstirb‘, sondern Selbstaufhebung, Selbstentgradigung, Wiederrundwerdung ist.
Urs Allemann
Kurvenreich wie das Eichblatt, spricht aus Elke Erbs Gedichten ein forschendes Bewußtsein, welches stets auf dem Sprung ist. In ihnen nimmt das Staunen Gestalt an: ihre Verse werden Vehikel, Sinntaxen für alles Menschengewachsene.
Richard Pietraß
MärkischerVerlag Wilhelmshorst, Klappentext, 2012
Poesiealbum 301
In den Orgelgärten ihrer Mutter- und Zwittersprachräume von Eifel und Sachsen-Anhalt, Berlin und Lausitz reifte die Grüblerin Elke Erb zur rutengängerischen Dichterin eines schöpferischen Zweifels an allem, was Zunge und Lunge, Herzstechen und Heurekajubel hervorbringen. Schreiben, weiß sie, ist ,geistiges Atmen‘, und die Poesie ,die bündigste und gründlichste Form der Erkenntnis‘.
MärkischerVerlag Wilhelmshorst, Klappentext, 2012
Der Tag ist ein Schutzmann
Vom Rückgrat sagt sie, es „glimme“. Leuchtfaden Charakter. Durchs Rückgrat jagen die Ströme, die das Leben anfachen, es ausmachen – in des Wortes doppelter Bedeutung. Elke Erb ist eine Meisterin in der geheimnisvollen sprachlichen Beschwörung von winzigen Wahrnehmungen; sie gibt den Realitäten des Alltags die Würde eines Rätsels zurück. Heimkehr in die Naivität, wo die Bedeutungen vor den Ahnungen kapitulieren: Das ist die größte Leistung eines Gemüts, das ist die längste, abenteuerlichste Reise eines Bewusstseins – Wissen endlich abperlen lassen von den Herzhäuten; nicht mehr nur immer sagen, was gefordert ist:
Ich stellte die Unstimme still
und wußte von nichts
Endlich Freiheit, bitte, von den ermüdenden Wirklichkeiten, denn „der Tag, ein Schutzmann, holt mich auf die Wache“.
Die Gedichte Erbs im Poesiealbum 301 – komponiert aus Texten von zwölf Bänden – sind eine Expedition in immer kühnere Gefilde sprachlicher Abstraktion. Dieser Dichterin widerfährt aus banalstem Stoff eine spracherfindende Poesie, die nicht verstanden, sondern empfunden werden will wie ein Tonstück.
Engel in zersprungenen Farben. Des Blutbaums Äste. Der Zaun im ergrünten Land. Die Gesellschaft „ein geregeltes Geisterreich“ – Elke Erb, Dichterin des Prenzlauer Bergs, schaut wach in „finstere Wirrnis“ allüberall; sie verweigert sich der Vergemeindung ins Volk der hurtigen Informationsschlucker und Begriffsfresser; sie besteht auf Abgeschlossenheit ihres Terrains, wenn die Knechte der klaren, eindeutigen Formulierungen anrücken wie Besatzer und sie die Poesie auf sogenanntes Normalsprachmaß überprüfen.
Im Gedicht der 1938 Geborenen herrscht ein tiefes Einverständnis (ein Entspanntsein, wie man es nur am Grund der Schmerzen sein kann) mit den Dingen der Welt – wie sie uns den Mut abringen, als Menschengattung nicht beherrschend aufzutreten, sondern flaggenzeigend gering. In diesen Versen reicht keine Wahrheit für alle, und für jeden Einzelnen ist sie zu viel.
Dies Manna der Verletzungen, sie munden.
Lebe wohl!, das weiß man nach der Lektüre, ist ein gütiger, aber auch hart fordernder Spruch.
Hans-Dieter Schütt, neues deutschland, 20.12.2012
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Redaktion: Elke Erb: Poesiealbum 301
poetenladen.de, 15.8.2012
„Der Stein, der ich bin, durch den alles hindurchmuß…“
– Ein Gespräch zwischen Elke Erb und Brigitte Oleschinski. –
Mich reizen poetologische Erörterungen nicht so wie dich.
Die Spannung der Frage liegt ganz auf deiner Seite.
Elke Erb zu Brigitte Oleschinski, 22. Juni 1994
Deine Texte versetzen mich in eine besondere Art von Ratlosigkeit.
Immer gibt es etwas darin, das mich anspringt,
und dann ist mein gesamter Verstehensapparat außer Kraft gesetzt.
Brigitte Oleschinski zu Elke Erb, 1. November 1994
Wie verständigen wir uns über Gedichte? Können wir darüber gemeinsam nachdenken, bedeuten Begriffe wie „Sprache“, „Erkenntnis“ und „Gesellschaft“ im Arbeitsfeld der Poesie für uns etwas ähnliches? Oder reden wir aneinander vorbei, sobald es um allgemeine, vom einzelnen Gedicht abgelöste Thesen zur (eigenen) Poetik geht? Brauchen wir solche Verallgemeinerungen überhaupt? Um diesen Fragen in einem Dialog nachzugehen, habe ich mir seit langem Elke Erb als Gegenüber gewünscht und bin froh, daß sie sich dazu bereitgefunden hat.
Auf der ersten Kassette, aufgenommen im Juni 1994 in Rotterdam, blieb nur die Hälfte des Gesprächs erhalten, das wir dort begannen. Elkes Stimme setzt mitten im Mäander eines ihrer typischen, d.h. in ihrem Mäandern äußerst zielgenauen Erb-Sätze ein, und am Ende des Bandes zerschneidet das Klicken eine meiner eher abstrakten Überlegungen. Aber das, was ich zusätzlich hätte dokumentieren wollen, geht ohnehin über das Gesagte hinaus. Ich meine damit die intensive Spannung, in der wir miteinander zu reden versuchten. Sie ist hörbar in unseren Tonfällen, in Nachdruck oder Zögern, Rückfragen, Vergewisserungen und den kleinen Lauten und Pausen, die auch sonst jede Mündlichkeit begleiten, ohne sich ins Schriftliche übertragen zu lassen. Es war meine idée fixe, von unseren unterschiedlichen poetischen Ansätzen aus über eine allgemeine(re) Bestimmung von Gedichten zu sprechen, und ebenso beharrlich war Elkes begründeter Widerstand dagegen.
Als wir uns in Rotterdam zu unterhalten begannen, hatte ich zwei grundsätzliche Fragen an sie: Die nämlich, wie das poetische Sprechen sich zu einem allgemeinen Erkenntnisbedürfnis verhalte, und im weiteren, wie es sich darin auf die Gesellschaft beziehe. In jenem Teil des Gesprächs, der sich nur noch aus wenigen Notizen rekonstruieren läßt, beschrieb ich zunächst meinen Hintergrund für solche Problemstellungen. In der von technisch-ökonomischen Interessen dominierten, immer stärker beschleunigten Medienkultur, sagte ich etwa, gelte das poetische Sprechen im (gedruckten) Gedicht längst als Randerscheinung einer Literatur, die sich ihrer Zeit nicht anpassen wolle oder könne. Zeitgenössische Lyrik werde öffentlich kaum noch wahrgenommen und trage selbst im Bewußtsein des Kulturbetriebs wenig zu den aktuellen ästhetischen Diskursen bei. Das allgemeine Desinteresse an Gedichten verwische nicht nur die Maßstäbe für eine engagierte und trennscharfe (Selbst)Kritik, sondern löse auch die Horizonte auf, vor denen die Poesie sich als angemessener künstlerischer Ausdruck „auf der Höhe der Zeit“ situieren könne.
Das muß dort, im Flipse-Zaal des De Doelen-Hauses, ein bißchen eigenartig geklungen haben. Der ausgeborgte Recorder zeichnete noch nichts auf; erst eine halbe Stunde später porträtierte er den Ort wenigstens akustisch. Aber wie soll ich ihn hier beschreiben…? Das Stimmengewirr in Afrikaans, Englisch, Japanisch, Französisch, Chinesisch, Russisch, Arabisch, Holländisch, Tschechisch, Hebräisch, Italienisch, Deutsch…, in einer Ecke die Schreibtische der Veranstalter, Telefone, Faxgefiepe, gegenüber eine Bar, die bis in die Nacht hinein Getränke ausgab, Wein, Sandwiches, Obst, dazwischen die weißen Ledersofas, auf denen sich immer neue Gespräche zusammenfanden, improvisierte Übersetzungen, radebrechende Poetologien, ich müßte emphatische Töne anschlagen, Windgongs aus diesen Stimmen, aber ich träfe es nicht, das Aufatmen, wie in einer scharfen Brise über dem sonnigen Hafen. Einmal im Jahr veranstaltet in Rotterdam die niederländische Stichting Poetry International ein DichterInnen-Treffen mit Gästen aus aller Welt, es gibt öffentliche und nichtöffentliche Lesungen unter dem Rubrum „Poets on Poets“, Nobelpreisträger lesen neben den Stimmen aus kleinen Sprachen, entlegenen Gegenden, untergehenden Traditionen, dazwischen tagt ein Komitee, das den International Poetry Award für verfolgte und inhaftierte Schriftsteller vergibt, Breyten Breytenbach hat ihn bekommen, Mircea Dinescu, in letzten Jahr die kubanische Autorin Maria Elena Cruz Varela. Das Festival feierte in diesem Jahr seinen fünfundzwanzigsten Geburtstag, die Liste der rund achtzig Gäste begann mit Yehuda Amichai aus Israel und endete bei Andrea Zanzotto aus Italien und Zheng Min aus China, die niederländische Königin kam zur Eröffnung, kurzum: Das Aufatmen meinte alles dort, die unprätentiöse Herzlichkeit der VeranstalterInnen und das ein wenig angestaubte Pathos der Elephantenrunden, die noch einmal über eine Summa poetica der Moderne zu diskutieren versuchten, die „world language of poetry“ der sechziger Jahre abwägend gegen einen Trend der Neunziger, „that poets stuck to the specific“, es meinte den kurzen, wie ein Déjàvu aufflackernden Disput zwischen Miroslav Holub, der für etwas Unnennbares hinter den Gedichten sprach, mit dem ganzen Gewicht seiner naturwissenschaftlichen Bilderrätsel, und dem ihm empört ins Wort fallenden Ernst Jandl, Nein! fuchtelnd, Nein! Nein!, hinter einem Gedicht sei gar nichts!, das Gedicht sei nichts als das Gedicht!, und es meinte selbst die Eitelkeiten und Intrigen hinter den Kulissen, die nicht zu ignorieren eine besondere Lust an der Wirklichkeit voraussetzt. In dieser Umgebung hatte Poesie, hatten die vielfältigen Gesten, Gewänder und Gesichter des Poetischen etwas ungemein Offenes, Tröstendes, einander Zugewandtes, jedenfalls nichts Marginales, und sie erreichten damit für Augenblicke das, was Kofi Awoonor aus Ghana, geübt in Löwengebärden, mit rollender Stimme als die Aufgabe von Gedichten in seiner Kultur beschrieb, nämlich:
To confuse the demons.
Von Dichtung verwirrt werden allerdings nicht nur die Dämonen. Auch zwei Dichterinnen brauchen offenbar Zeit, um zwischen allgemeinem Theoretisieren und handwerklicher Fachsimpelei ein Feld gemeinsamer Begriffe zu erzeugen, in dem sich eine Verständigung über Poesie ereignen kann. Worüber wir sprachen, war und blieb in vielem strittig. „Ehe du nicht durch diesen Stein, der ich bin, hindurch bist, hast du die Bedingungen für die gesellschaftliche Figur, die ein Gedicht ist, nicht erfüllt“, beschrieb anfangs Elke den Reiz, der für sie von der Sprache in einem „gespannten Medium“ gesellschaftlicher Zustände ausgehe. In jenem Teil des Gesprächs, der für das Band verlorenging, zitierte ich daraufhin einen Satz aus Adornos Schrift Zur gesellschaftlichen Lage der Musik, in der ich vor Jahren einmal für einen Essay das Wort „Musik“ durch „Poesie“ ersetzt habe:
Von [Poesie] […] ist in gewissem Sinne Erkenntnischarakter zu fordern. In ihrem Material muß sie die Probleme rein ausformen, die das Material – selber nie reines Naturmaterial, sondern gesellschaftlich-geschichtlich produziert – ihr stellt; die Lösungen, die sie dabei findet, stehen Theorien gleich.
Was Elke daran mißfiel, war weniger Adornos Argument als das Ordnungsbedürfnis, das sie hinter meinem Griff nach solchen Gedanken vermutete. Ihr schien, daß ich damit auf eine Meta-Ebene hinauswollte, die die in Gedichten auf poetische Weise längst geleistete oder erst noch voranzubringende Arbeit nur auf bedenkliche Weise konterkarieren könne. An dieser Stelle setzt das erste Band ein.
Elke Erb: Poesie scheint etwas an sich zu haben, daß man ihr auf gleicher Höhe begegnet. Man kann Poesie nicht so überblicken, wie man über Musik sprechen kann. Keineswegs kann man das. Man kann über Musik sagen, daß sie einen Raum bildet, über den man in großen Dimensionen hinblicken kann, weit blicken kann, aber so etwas ist fast unmöglich bei Poesie. Weil sie dir immer wieder auf gleicher Höhe begegnet.
Brigitte Oleschinski: Ich weiß nicht, ob das Handicap die individuelle Begegnung ist. Es besteht eher darin, daß man fast mit demselben Material die Theorie wie die Durchführung leisten muß, nämlich mittels Sprache und Sprechen. Darin ist natürlich das Begegnungsmoment mit dem „gespannten Medium“ Gesellschaft, wie du vorhin gesagt hast, bereits enthalten. Aber bei Musik ist das anders. Bei Musik versetzt man sich, wenn man in die Theorie geht, wirklich in ein anderes Medium.
Erb: Es ist noch anders. Nachdem du gesagt hast, du hast bei Adorno das Wort Musik ersetzt durch Poesie, habe ich plötzlich vor Augen, daß man das über Musik – also Musik sei eine Erkenntnisträgerin – viel leichter sagen kann, obwohl es ja ganz abwegig erscheint. Aber mir scheint nun auch, daß der logische Schlüssel sehr viel schneller in der Hand umzudrehen ist als bei Poesie, weil Poesie etwas auf dich Zukommendes, dir Begegnendes ist, und da geht es nicht darum, wo das landen will – du bist ja diejenige, die jenseits davon noch eine Sprache aufmachen will –, sondern wo es herkommt, denn es ist mit der dir üblichen, gewohnten, dich umgebenden Sprache eine Individualisierung passiert, und infolgedessen hast du das Gegenübergefühl und auch das Undurchdringliche. Wenn du in einem Passantenstrom gehst, kannst du nicht den Überblick haben, das geht nicht, die Passanten begegnen dir.
Oleschinski: Ich bin mir doch gar nicht sicher, ob das, was mich antreibt in den poetologischen Fragen, wirklich der Versuch ist, einen Überblick zu gewinnen und damit eine Meta-Ebene aufzumachen. Ich weiß nicht, ob Erkenntnisinteresse unbedingt etwas mit Überblick zu tun haben muß. Auch du hast ein Erkenntnisinteresse in deinen Gedichten, das auf den ersten Blick oft abstrakt oder theoretisch erscheint, selbst wenn es völlig im Material eines Textes bzw. Kommentars gebunden ist.
Erb: Ja sicher. Aber ich nehme an, daß du einen intensiveren oder näheren oder kongruenteren Anlaß hast, einen Grund, ein Movens für dieses poetologische Interesse, während das bei mir nicht unbedingt auf die Poesie selbst zielt. Im Gegenteil, ich müßte eher noch viel mehr an Erkenntnisbedürfnis aufbringen, um dem zuzugucken, was ich überhaupt tue: Wie verhält es sich, wenn du schreibst und spürst plötzlich, eigentlich ist es jetzt ein mathematisches Problem, das du löst, nachdem du seit der zwölften Klasse doch jede Berührung mit der Mathematik abgetan hast? Wie verhält sich dann das, was du versprochen hast, indem du ein Gedicht beginnst, nämlich Poesie, wie verhält sie sich zu dem Erkenntnistrieb? Unterläufst du nicht mit dieser Erkenntnislust oder diesem Schläfensausen, dem Interesse an diesem „Hach – jetzt: da! Da beginnt etwas sich aufzulösen!“ deine Poesie-Pflicht? Das ist doch eine andere Lust, oder? Wie verhält sie sich zur Poesie? In der ich wiederum, sage ich, eine leibliche Schwester sehe, etwas, das mir begegnet, eine Leiblichkeit, die mir begegnen könnte. Also fast eine Dame, fast eine wirkliche leibliche Sache, so dicht. Ich käme doch nie darauf, etwas wie eine solche leibliche Schönheit, oder was es auch immer ist, als Objekt einer Erkenntnis zu fassen. Es würde mir im Traum nicht einfallen.
Oleschinski: Objekt ist auch falsch. Ich würde von Medium sprechen. Das, worum es mir geht, ist eine Form von medialer Erkenntnis. Erkenntnis ist für mich ein Medium und damit ein Durchgangsstadium. Das, was darin aussieht wie Ordnungen oder Definitionen, sind bestimmte Zerfallsprodukte.
Erb: Du hast sogar noch mehr gesagt. Du hast gesagt, daß dich genau das Durchgängige interessiert, so daß darin ein Anhäufen von Poetologie einprogrammiert ist, weil sich die Stellen der Durchgängigkeit zu einem – fast – Milieu verdichten, in dem man leben kann, ja?, zu so einer Weghaftigkeit – das ist aber sehr dürftig, weil es nicht nur um einen Weg geht, und außerdem ist Weg definiert von Herkunft und Ziel, logischerweise. Sei gerecht: es gibt keinen Weg, der keine Herkunft hat und nicht ein Ziel hat.
Oleschinski: Jeder Weg hat eine Herkunft, aber ob er ein Ziel hat oder sein Ziel kennt, ist keineswegs klar.
Erb: Oh – wenn du die Realwege nimmst… Gut, es stimmt, es ist wahr, aber: „Jetzt gehen sie los und suchen eine Wasserstelle“ – unter das würde ich nicht gehen, oder beweise es mir.
Oleschinski: Es gibt das Gehen um des Gehens willen. Einfach diese körperliche Bewegung, die du brauchst.
Erb: Tatsächlich? Kann man das hinräumen neben die Realität eines begründeten Weges? Ist das eine Größe, die überhaupt gilt? – Vielleicht ist das auch ein Punkt: Wie können solche Größen miteinander ein Verhältnis eingehen?
Oleschinski: Ich denke, daß das Gehen um des Gehens willen eine ganz reale Kategorie ist.
Erb: Ja, aber die ist außerhalb des Themas der Ordnung, in das wir vorhin gekommen sind. Diese Kategorie ist auch ähnlich wie das Interesse für Durchgängigkeit. Du bist also nicht die, die alles ausdefinieren will, sondern es geht dir darum – und das wäre die Ordnung davor –, es geht dir darum, immer wieder durch die Mitte durchzuschreiten, also etwas, das sonst übergeben wäre, ausgeliefert wäre einer tödlichen Befriedung, umgedreht zu benutzen als Passierbarkeit, ja?
Oleschinski: Stimmt, es ist eine Form von Passage. Einer meiner Lieblingsbezugspunkte dafür ist serielle Musik. Serielle Musik durchschreitet immer wieder dieselben formalen Elemente. Ich glaube, es gibt eine wirkliche, unaufhebbare Spannung zwischen diesen eigentlich sehr wenigen elementaren Lebensäußerungen und ihrem ganz körperlichen Bezug, da kommt sehr viel Körperlichkeit mit hinein.
Erb: Jetzt verstehe ich nicht, was du meinst. Was sind elementare Lebensäußerungen?
Oleschinski: Gehen, Schlafen, Essen, – Lieben…
Erb: Ach so – aber die sind doch auch geortet, meine ich – weil du sagtest, es gibt ein Gehen um des Gehens willen –. Ich wollte damit feststellen, daß das Gehen um des Gehens willen jenseits dieser Grenze ist, wo die Durchgängigkeit überhaupt sich herstellt, denn die Durchgängigkeit ist doch in ihrem Interesse, da, wo sie Lust macht, wo sie reizt, orientiert an dem anderen, wo definiert wird, an diesem System, und das Gehen um des Gehens willen ist nicht erfaßt in dem Ordnungssystem, wo die Wege eine Herkunft, ein Ziel haben, usw.
Oleschinski: Ja und nein. Wenn man das Ordnungssystem mit Zwecken und Zielen verbindet, dann ist es als Gehen um des Gehens willen wirklich nicht erfaßt.
Erb: Aber du siehst in dem Ordnungssystem Möglichkeiten, die ich ihm abspreche. Guck, die Marxisten hatten doch ein gesellschaftliches Koordinatenkreuz, das fing an mit der Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus usw., dann kam die bürgerliche Klasse und schließlich sie selbst. Da habe ich mir gedacht: Mit diesem Ordnungssystem können sie niemals Dschingis Khan bestimmen, sie haben überhaupt nicht einen leisesten Ansatz, alles das, was innerhalb des Feudalismus doch großartig Geschichte macht, zu bestimmen. Sie haben überhaupt keine Möglichkeit, da eine weitere Gesetzmäßigkeit aufzudecken, nicht die geringste. Und so ähnlich sehe ich das mit diesem Gehen: Es sind eben sehr viele Realitäten – Bei der Veranstaltungsreihe „Reisen im Text“ in der Berliner LiteraturWERKstatt sagte Michael Krüger, es gibt kein Reisen mehr, es gibt nur noch Mobilität, und von daher ist ganz klar, daß auf das Gehen um des Gehens willen ein besonderes Licht und eine besondere Aufmerksamkeit fallen muß, schon aus einer bestimmten Definitionsnot oder Begriffsnot. Jetzt haben wir noch die alten Griffe dazu, aber man müßte eben auf neue kommen.
Oleschinski: „Alte Griffe“ ist sehr schön. – Im übrigen hast du recht: Ich versuche in diesem Gespräch Punkte zu fixieren, zu denen wir noch kein gemeinsames Begriffsfeld haben. Ein solches Stichwort war „Sprache“, bei dem wir die Spannung zu dem umgebenden Medium, nämlich „Gesellschaft“, mit hineingebracht haben, um dazu einen gemeinsamen Bezugspunkt zu finden, und „Ordnung“ ist ein anderes solches Stichwort.
Erb: Dann habe ich gar nicht begriffen, wo sich für dich der Unterschied zwischen uns ergeben hat. Könntest du mir deutlich machen, wo eine Nichtkongruenz in den Begriffen gewesen ist?
Oleschinski: Ja, worin hat bisher die Nichtkongruenz bestanden? Ich bin davon ausgegangen, daß Sprache bereits deine Meta-Ebene ist, so daß du keine weitere Meta-Ebene brauchst.
Erb: Wie kannst du so etwas denken? Ich weiß wirklich nicht, wie man das denken kann. Ich weiß wohl, daß genau dieser Punkt eine Rolle spielt im Gespräch zwischen mir und Durs [Grünbein]. Er fragt mich wirklich: „Wie kommst du noch nach außerhalb der Sprache?“, und du fragst ja fast umgedreht, nämlich du sagst: „Du kommst aus nichts als Sprache“. Wahrscheinlich spreche ich überhaupt so, daß alles weitere sich noch ergeben kann. Also, wenn ich sage „Sprache“, dann habe ich nicht etwas geordnet und sage, das ist jetzt die Sprache, oder weggeräumt, oder festgestellt, sondern es ist wie die erste vorartikulierte Schicht, so reliefartig vor vielem, was dahinter noch ist. Darüber, wie wir die Worte gebrauchen, müßten wir uns erst klarwerden, und das müßten wir eigentlich – richtig wie so ein Fußballer, der sich fit trimmt – mit allen Begriffen tun, die wir benutzen. Du kommst aus einer anderen Gesellschaft – und anderen Generation – als ich –
Oleschinski: Als du vorhin zum Erläutern der Ordnungen, gegen die du dich wendest, auf das marxistische System kamst, wurde mir klar, daß ich natürlich von einem völlig anderen Ordnungsbegriff ausgehe. Ich gehe von einem philosophischen Background aus – ohne daß der jetzt im einzelnen akademisch verfestigt wäre oder einer besonders genauen Lektüre entspränge –, der jede Form „wesensmäßiger“ Ordnungen schon verneint, indem er sagt, sie seien als sprachliche Systeme konstituiert.
Erb: Das ist ein anderer Blick. Er schafft aber keine Nichtkongruenz. Es ist so, als ob du zu mir sagst, ich hätte diesen Marxismus als Beispiel für eine Ordnung, und du hast einen Background, der dir sagt, es ist von Anfang an nicht zulässig, daß du eine Ordnung überhaupt anders auffaßt als eine sprachliche Fixierung. Oder habe ich das jetzt wiederum mit gewissen Defiziten ausgedrückt, die aus meiner Herkunft herkommen?
Oleschinski: Ich weiß nicht, ob das etwas mit „Defiziten“ deiner Herkunft zu tun hat. Ich glaube eher, daß es mit Defiziten meiner Art und Weise, mit Begriffen umzugehen, zu tun hat. Wie gesagt, es handelt sich um einen philosophischen Background und nicht um eine zulässige Form, Begriffe innerhalb eines akademischen Kontextes zu beschreiben. Die Grundauffassung, mit der diese Philosophien arbeiten, ist die, daß es keine in irgendeiner Form prädefinierten Sinnsysteme gibt, und daß deshalb die Frage einer realen Entsprechung dessen, was Gesellschaft ist, was unsere Ansichten über Gesellschaft sind, was Kategorien wie Kausalität usw. angeht, unbeantwortbar ist und auch völlig irrelevant für die Systeme, in denen wir leben. Aber um das auszuführen, müßte ich jetzt weit ausholen, und das kann ich nicht auf der akademischen Ebene. Deshalb unterhalte ich mich so ungern in Begriffen, es sei denn, es handelt sich um Begriffe, die man gemeinsam definiert – was wir hier gerade versuchen. Meine Vorstellung geht jedenfalls nicht von einem „realen“ geschlossenen System aus, sondern von der Unzulänglichkeit des Systembegriffs, weshalb ich zu Systemen oder dem Versuch, Systeme herzustellen, einen anderen Zugang habe. Ich halte diese Systeme grundsätzlich immer für vorübergehende Erscheinungen, für kurzfristig vereinbart. Es ist einfach ein Spannungsverhältnis: Sprache – Ordnung – Begegnung. Ordnung ist also nichts Vorgegebenes, sondern Ordnung ist etwas, das in der Begegnung erst vereinbart wird. Und Sprache – Sprache tut das, sie stellt diese Vereinbarung her.
Erb: Im Grunde entspricht das dem, was mir eben in den Kopf kam: Wenn es einen Quantitätssprung gibt in eine neue Qualität, dann ist es nicht irgendwann, sondern immer.
Oleschinski: Genau. Insofern gilt natürlich auch das, was du eben gesagt hast: daß man das Kleinste irgendwo aufnehmen kann, vorausgesetzt, man hat diese Vorstellung von dem Stein, „der ich bin, durch den das alles hindurchmuß“ – das ist eine sehr schöne Vorstellung, wie von Wasser, das sintert. Aber jetzt möchte ich wieder auf den Dissens kommen, über den ich mich gerade scheinbar beruhigt hatte.
Erb: War es das, wo ich vorhin anfing mit dem gespannten Medium? Du sagtest, daß es also nicht nur Sprache sei, was mich beschäftigt, und ich habe dich erstaunt gefragt, wie du annehmen kannst, daß ich nur Sprache meine. Ich schließe auf eine Verwechslung, die aber sehr mit der Realität zu tun hat, mit der Formation, in der sich die Gesellschaft befindet, mit ihren Ablösungen-von, ihrem Ausbreiten-von… Zum Beispiel die postmodernistischen Bauten. Ich sehe sie von mir aus so an, als ob darin Denkschritte, die man früher gemacht hat, indem man gebaut hat, offengelegt werden, und man kann leibhaftem Denken begegnen. Das gefällt mir sehr.
Oleschinski: Das ist richtig. Man begegnet natürlich gleichzeitig noch etwas anderem: Man begegnet dem Schritt aus dem in der Moderne möglich und denkbar gewordenen Zerlegen in funktionale Einheiten hin zur völligen Verfügbarkeit dieser Einheiten. Es ist heute möglich, Dinge in funktionale Einheiten zu zerlegen, von denen man sich das vor fünfzig Jahren noch nicht hätte träumen lassen, ob es nun die Genome irgendwelcher Pflanzen und Lebewesen sind oder bestimmte Baustoffe oder gesellschaftliche Strukturen. Allein wenn man sich ansieht, wie bestimmte Ecken der Welt durch Geldströme zerlegt werden, wie soziale Strukturen durch Geldströme zerlegt werden, weil funktionale Einheiten aus einem scheinbar natürlichen – oder historisch tradierten – Zusammenhang herausgelöst und verfügbar gemacht werden. Meine Frage bei Gedichten ist deshalb, inwieweit sie in ihrer Form dasselbe Dilemma spiegeln: Auf der einen Seite sehe ich Gedichteschreiben ebenfalls als einen Zerlegungs- und Verfügungsprozeß, auf der anderen Seite beschäftigt mich daran aber auch das, was nicht verfügbar ist. Was kann nicht zerlegt werden, und manchmal auch, was darf nicht zerlegt werden?
Erb: Ich habe ganz früh, als ich anfing – das war ein Schritt in die Selbständigkeit hinein –, unterschieden zwischen Konsumenten und Produzenten und den erwachsenen Menschen als Produzenten betrachtet. Davon unterscheide ich immer wieder Konsumentenbedürfnisse –
Oleschinski: Was sind für dich Konsumentenbedürfnisse?
Erb: Wenn du sagst, was feststehen soll oder nicht zerlegt werden darf, und was überhaupt nicht zerlegbar ist, wittere ich darin sofort ein Konsumentenbedürfnis. Wie wenn du dort eine Sicherheit stellvertretend für dich selbst suchst. Das Ich, das lebende Wesen da, würde auch wollen, daß es unangreifbar ist, und das führt dazu, daß man eine Unangreifbarkeit annimmt. In dieser Konstellation sehe ich eben eine nicht ganz ausgereifte Erwachsenheit im Gang.
Oleschinski: Nein, das glaube ich nicht. Ich gehe von folgendem aus: Irgendwann setzt sich ein Mensch aus der ihn umgebenden Materie zusammen, wird geboren, wächst auf, wird alt, stirbt, zersetzt sich wieder. Das ist ein Prozeß, den ich in seiner Gesamtheit als vollkommen natürlich und angemessen empfinde. Innerhalb dieses Prozesses aber entwickelt sich eine Zeitlang ein Bedürfnis danach, heil zu bleiben – heil bleiben zu dürfen und auch heil bleiben zu müssen, und dieses Bedürfnis setze ich nicht gleich mit einer Konsumentenhaltung.
Erb: Aber es artet sehr leicht dahin aus. Wenn du dieses Heilbleiben als dynamisch ansiehst, als eine Individualität dynamischer Art, dann ist es vielleicht etwas anderes. Ich habe so viele Anfänge von Poeten gesehen, oder manchmal geht das auch durch das ganze Leben durch – ich will das überhaupt nicht abqualifizieren, weil es auch eine Grundkonstellation ist. Zum Beispiel der Stein am Grunde des Flusses ist immer wieder das nicht abgeholte, nicht ausgelebte Ich, das Ich als Existenz darunter. Dann ist die zweite Frage, wenn du anfängst zu schreiben, daß eine Analogie stattfindet, und zwar habe ich das bei der Zwetajewa so deutlich gesehen, aber auch bei der Annette von Droste-Hülshoff, also mit realen Auseinandersetzungen. Wenn du anfängst zu schreiben, möchte diese Werkstatt, die du eröffnest, ein Kind bekommen, sie möchte individualisierungsfähig sein. Das drückt sich zum Beispiel darin aus, daß bei der Annette plötzlich am Fußende ein kleines Kind sitzt, und sie träumt davon. Ich meine, daß so eine Dichterin viele Bewegungen in sich hat, in Jugendgedichten zum Beispiel, „Wenn ich dann gestorben bin, dann kommt ihr an mein Grab“, die das schon vorweggenommen haben, was nicht auslebbar ist. Aber andererseits ist es eine abschneidende Verzweiflung, die auch verhindert, daß du das ausleben kannst.
Oleschinski: Das verstehe ich noch nicht ganz.
Erb: Wenn du bereit bist, dich als Stein auf dem Grunde des Flusses aufzufassen, dann kommst du nicht gut weiter damit.
Oleschinski: Und was wäre das Gegenmodell? Die Abweichung davon?
Erb: Das Zersetzen des Steins, das Moosansetzen, die Flechten, bis hin zur Zieselmaus, die rauskommt und pfeift. Und auf der anderen Seite, was auch durch Steine hinsintern kann, ist dieses In-Netzen-Sein. Die Netze selber können aber eine Figur produzieren, die nicht lebensfähig ist, in der richtige Angstfiguren wie der Golem entstehen. Das ist die Verkörperung des Gedankens: was passiert, wenn das System, in dem ich jetzt lebe, ein Mensch wird? Dann hast du den Golem, eine Angstfigur. Oder du hast den bösen Zauberer, den Mabuse, den, der irgendwo sitzt, dieses häßliche Zwergending, das von ferne alle Vorgänge lenkt – das ist auch so etwas in der Form des eigentlich wünschbaren Umsetzens Verkommenes. Ich bin erst dabei, ein Unheils-Heil in mir selbst zu entdecken. An einem Brief, der kam und in dem ich mit Du angeredet werde, entdeckte ich, daß dieses Du an mir vorbeigeht. Also ist in mir ein asozialer Kern, ein nicht sozialer Kern, und darüber war ich erschrocken und beschämt. Ich möchte diese Auffassungsweise ändern, um das, was sich da unverfügbar hält, herauszuholen. Und darin liegen natürlich auch Codes; wenn du sagst, du faßt alles als etwas schnell Veränderliches, Verfügbares auf, was machst du dann mit diesen alten Codes? In den Winkelzügen habe ich sehr viele Gefechte ausgefochten, die immer friedlich endeten. Ich weiß, es ging einmal gegen Kausalität, ich ging regelrecht gegen das Kausalitätsdenken vor, bis ich an den Punkt kam, wo es erlöst war. Dann ging es um Dualismen, Denken in Dualismen, bis ich wieder an den Punkt kam – die kann ich mir aber nicht auswählen, diese Punkte, dafür nehme ich etwas als Modell. Beim Dualismus war es, glaube ich, etwas aus dem Mittelalter, wo ich meinte, das ist wie mitteralterliches Denken und war beruhigt und habe es ablösen können. Der Kampf gegen den Ausdruck in Dualismen überhaupt.
Oleschinski: Das ist ein dramatisches Prinzip, denke ich.
Erb: Auf der anderen Seite: Wenn du natürlich das dann wieder befriedest, den Kampfbereich, dieses Für und Gegen, die Vereinnahmung durch Ordnung – Führer – Art, dann entsteht eine Zulässigkeit für alles Mögliche, die wirklich mit der Postmoderne zu tun hat, jedenfalls eine Bereitschaft klärt und darbietet.
Oleschinski: Gut, aber jetzt will ich wieder das Unverfügbare einbringen, das nicht Zerlegbare, oder sagen wir besser: das nicht willkürlich Zerlegbare. Ich unterscheide zwischen willkürlicher Zerlegung und einer Zerlegung, die durch Zeit, Bewegung, Lebensablauf unvermeidlich ist – unverfügbar eben. Mir geht es letztlich mit meinen Gedichten genau um diese unverfügbaren Bewegungen. Die Gedichte versuchen immer, in den Text hinein und wieder hinauszugehen im Blick auf dieses Unverfügbare, auf der Suche nach ihm und zugleich in der entsetzlichen Spannung, daß das Unverfügbare tatsächlich unverfügbar ist. Es ist schließlich eine Aporie, mittels poetischer Zerlegungen nach dem Unverfügbaren zu suchen. Aber was mich an den postmodernen Zusammenhängen schreckt, ist, daß es dort überhaupt keine Unterscheidung mehr zu geben scheint zwischen dem Verfügbaren und dem Unverfügbaren.
Erb: Warum erschreckt dich das? Das Unverfügbare existiert doch, auch wenn man es dort nicht sieht.
Oleschinski: Dieses Gehen um seiner selbst willen, das wir eben hatten, ist für mich eine Art Spiegelung einer unverfügbaren Bewegung. Wie eine körperliche Erinnerung daran – oder wie ein Memento mori.
Erb: Ein Memento mori? Interessant. Also haben die postmodernen Ordnungen offenbar doch etwas, das nicht sterben kann. Egal, welche Mobilität sie in die Welt setzen.
Oleschinski: Ich glaube, der Witz dabei ist etwas anderes. Diese Mobilität, Zerlegbarkeit, Verfügbarkeit wird nicht begriffen in ihrem Verhältnis zur Sterblichkeit. Sterblichkeit ist dieses Unverfügbare, und die Zerlegungen zielen auf eine potentiell unendliche Vervielfältigung.
Erb: Es soll wohl eine Dauerhaftigkeit reproduziert werden. Eine Dauerhaftigkeit, in der nicht gestorben werden kann. Wobei dann für mich, da ich ja auch Lyrikerin bin, darin sofort der Tod auftritt. Wo nicht gestorben werden kann, tritt der Tod auf. Er steht neben dir, das ist tödlich. So kommen wir zu einem Paradox kommen, nämlich da, wo nicht gestorben werden kann, trittst du in den Bereich des Todes ein. Das ist klassisch, sogar mit einer Tautologie verbunden, klassisch und sehr abgesättigt.
Oleschinski: Dieser Griff nach dem Paradox ist abgesättigt, da hast du recht, aber er hat durchaus etwas mit dem Problem zu tun.
Erb: Nein, ich meine mit Absättigung, daß ich ihm noch etwas von außen gegeben habe: Zu dem Paradox kam noch die tautologische Geschichte. Das ist allerdings schwierig. Also noch einmal: Da, wo nicht gestorben werden kann, begegnest du dem Tod. Und dann kommt die Tautologie: Im Tod kann natürlich nicht gestorben werden. Vielleicht ist es auch keine Tautologie, ich bin jetzt nicht sicher, wie man das nennt.
Oleschinski: Fachbegriffe kann man finden, das braucht uns hier nicht aufzuhalten.
Erb: Na gut. Was du übrigens ganz aus dem Blick läßt, ist das Geborenwerden, dieses dauernde Neuentstehen. Wieso neige ich mich denn nach dem Aufhören und nicht nach dem anderen? Wenn du – als Windharfe – zum Beispiel diese Bemerkung von Brecht über die Bäume aufnimmst, wo ein Gespräch über Bäume als ein Verbrechen bezeichnet wird, und wenn du dann ein Kind bekommst, verstehst du, daß das nicht geht. So kann man nicht reden, wann auch immer. Wenn man überhaupt eine Grenze setzen kann, dann vielleicht die, daß man so eine Aussage nicht machen kann, wo doch Kinder geboren werden. Natürlich muß man durch alles durch, aber das wissen wir doch, wir haben diesen Faschismus hinter uns, wir haben den Krieg hinter uns, wir müssen immer durch alles hindurch, wir haben also genügend Negationen in uns hineingelassen. Und außerdem ist alles „opgebleekt“, die Welt macht doch alles auf, es liegt alles deutlich vor dir, „aufgeweißt“, es liegt weiß da. Wenn du sagst: „Da kann nicht gestorben werden“, dann ist das eigentlich dem mit seinen eigenen Ansprüchen geantwortet. Es wäre viel intelligenter, alle diese Verfügbarkeitssyndrome damit zu verbinden, daß etwas geboren wird, denn sonst bist du nur in einem Kontra zu ihnen. Du fragst nicht, was sie überhaupt wollen.
Oleschinski: Aber an dieser Stelle setzt die Frage nach der Verfügbarkeit und Nichtverfügbarkeit ein. Wenn du dieses Geborenwerden in einen technischen Prozeß verwandelst, was ja heute technisch möglich ist, sind wir davon nur noch einen winzigen Schritt entfernt.
Erb: Das wäre mir überhaupt recht. Geburtsschäden so oder so. Was mache ich denn, wenn ich schreibe? Was mache ich, wenn ich male? Das ist dasselbe.
Oleschinski: Das eben ist der Punkt! Hier setzt nämlich bei mir das Gefühl ein, daß wir alle – diese Gesellschaft, die Menschheit, der einzelne an seinem Schreibtisch – einen Schritt zu weit gehen, den man nicht zu weit gehen darf. Und man kann keinen einzigen Schritt, den man jemals über eine Grenze hinaus gemacht hat, zurückholen. Es gibt einfach keinen freiwilligen Schritt in die Grenze zurück. Also frage ich mich, was wir da eigentlich anrichten.
Erb: Ist das so – eine Sache des Fortschritts?
Oleschinski: Es ist keine Frage von Fortschritt. „Fortschritt“ ist ein Begriff, der über so lange Zeit hin positiv besetzt war, daß man ihn heute gar nicht mehr verwenden kann. Ich denke, daß das, was er bezeichnet, ein linearer Prozeß ist, der sich nicht umkehren und auch nicht domestizieren läßt.
Erb: Du willst damit sagen, daß es auch nichts hilft, wenn man ihn negativ besetzt. Aber was ich sagte, hatte eben dieselbe Logik: Wenn du sagst, das kann nicht sterben, frage ich, warum fängst du nicht vom Geborenwerden an. Nun sagst du, das Leben kann per System erzeugt werden, und ich sage dir: Ich bin außerstande, die Äußerungen künstlerischer Art als irgendwie verwerflich anzusehen, weil sie einfach das Intensivste und Schönste sind, wie der Mensch sich äußern kann. Warum sollte ich also, wenn wirklich ein Kind technisch gezeugt wird, das so befremdlich finden? Und nicht imstande sein, in ihm wiederum eine neue Individualitätsmöglichkeit zu sehen?
Oleschinski: Auch das ist ein Impuls, den ich völlig teile. Das Kind, das es schon gibt, wie immer es gezeugt worden sein mag, gehört dazu, es ist von unserer Art. Aber ich frage, wo die Grenzen künftiger Entscheidungen liegen. Ob es solche Grenzen nicht doch geben müßte, und was das bedeuten würde im Hinblick auf unsere, also die poetische Arbeit. Ich frage das. Weder weiß ich es, noch weiß ich, ob es darauf überhaupt eine Antwort geben kann, geben soll. –
An dieser Stelle endet das Band aus Rotterdam. Das nächste Gespräch, das wir aufzeichneten, fand am 1. November 1994 in Berlin statt. Diesmal konzentrierten wir uns stärker auf unsere eigenen Texte und auf die Frage, ob und wie sich sinnvoll über diese eigene Arbeit sprechen läßt.
Erb: Als ich mich mit der Zwetajewa beschäftigte, las ich einmal einen Satz von Siegfried Kracauer, der hat mir sehr geholfen: nämlich, die Entität eines produktiven Tuns – ich weiß nicht mehr genau, wie der Satz war – bewegt sich nicht von ihren Gründen, von der Not her schlechthin ins Freie, sondern, wenn überhaupt die Produktivität begonnen hat, Erkennen, Behandeln, holt sie ihre eigenen Grundlagen hervor, und das ist das Freie, das sie erreicht.
Oleschinski: Inwieweit ist deine Vorstellung von einem sich entwickelnden Werk verknüpft mit einer Subjekt-Vorstellung?
Erb: Das Subjekt ist einfach das Wesen, das die Spannung aufbringt, leben zu wollen und sich nicht ersticken zu lassen. Dann kommt dieses Glücken dazu, daß man nicht herumfaselt, nicht herumirrt, sondern etwas sich weiterträgt. Und das ist mehr als das Subjekt, als seine Produktivität oder sein Lebenswille. Da fangen schon diese von der Umwelt hineingetragenen Formen an zu wirken, ergeben Motivketten. Aber das Bündel der Formen ist eine geschlossene Sache. Das ist nicht beliebig erweiterbar. Sie versuchen sich zu kennen, diese Formen. Es sind Dinge, die man nicht immer festmachen kann – das arbeitet auch von allein, darum brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Insofern ist der Text, der in dem Ganzen abläuft, immer kohärent.
Oleschinski: Und was nennst du das Ganze?
Erb: Die Werkstatt. Ich meine – und das ist, glaube ich, auch durch andere gestützt – mit Werkstatt ein begonnenes Werk. Das läuft ab nach einem Ensemble bestimmter Gesetze. Bei jedem ist das anders. Und es könnte sein, daß das Werk, wenn die Reize dieser Gesetze sich ausgetragen haben, beendet ist. Das ist etwas, wovor viele Angst haben. Das meine ich, zum Beispiel auch an den poetologischen Gedichten zu sehen, die Sartorius in der Zeitschrift Lettre zusammengetragen hat. Darin kommt immer wieder vor, daß man sich keine Illusionen machen möchte über die Tauglichkeit der Poesie. Ist nicht die Angst im Spiel, daß die kreativen Stimulanzien wegfallen, weil man vielleicht ahnt, das Sensorium oder der Werkhorizont, ihr Schreibhorizont, ihre Auffassung, ihre Orientierung ist materiell begrenzt? Mit materiell begrenzt meine ich: es hat bestimmte Grundzüge. Und meine eigenen kenne ich nicht.
Oleschinski: Aber ich glaube nicht, daß das Werkbedürfnis wirklich versiegen kann. Selbst wenn einzelne Arbeiten beendet werden, gibt es doch gerade den Drang, die damit verbundenen Grenzen wieder zu sprengen. Gestern abend war Sabine Techel hier, und wir haben lange darüber geredet, daß die Vorstellung von abgeschlossenen Projekten in der Poesie völlig unsinnig ist, also die Vorstellung, man nehme sich ein Projekt vor und beende das und nehme sich das nächste vor, beende auch das, und in regelmäßigen Abständen werfe man dann seine Bücher auf den Markt. Daß das, was man macht, abschließbar sein soll. Daß es einen konkreten Anfang und ein konkretes Ende hat, ein klares Programm, zu dem sich ein Exposé schreiben ließe, undsoweiter. Wir waren uns darüber einig, daß diese Vorstellung im Ansatz falsch ist.
Erb: Ich weiß gar nicht, wozu diese Vorstellung überhaupt auftaucht und woher sie auftaucht oder was man zu ihr zu sagen hat. Mir kommt es so vor, als sei das eine abwesende Vorstellung. Aber du hast darin offenbar noch einen Gegner, der dich im Nebel anfällt, oder als Nebel.
Oleschinski: Natürlich hast du darin einen Gegner, der dich anfällt. Das ist eine gegebene Publikationsöffentlichkeit, oder der Literaturbetrieb, wenn du so willst.
Erb: Bringst du es wirklich fertig, darin noch ein Gesicht zu sehen? Eine Figur? Oder zu vermissen?
Oleschinski: Eigentlich nicht. Aber wenn du dir gerade überlegst, wohin du dein nächstes Manuskript gibst, wer es überhaupt drucken kann und will, mußt du dir schon Gedanken darüber machen, was in der Verlagslandschaft geschieht. Dann wird dir sehr schnell deutlich, daß diese Paßform der fertigen Schriftstellerin, die dein Verlag von dir erwartet oder erwarten muß, so himmelweit entfernt ist von dem, was tatsächlich deine Arbeit ausmacht, daß die Kommunikationsschwierigkeiten fast unüberbrückbar sind.
Erb: Die muß es vielleicht auch geben. Ich habe immer und immer wieder zugelassen, daß man mich nicht will. Immer und immer wieder.
Oleschinski: Dein letzter Gedichtband, Unschuld, du Licht meiner Augen, ist in diesem Jahr bei Steidl in Göttingen erschienen. Mir ist, neben der intensiven Auseinandersetzung mit Friederike Mayröcker, die den ersten Teil prägt, im letzten Teil das Verfahren aufgefallen, zwei kurze Gedichte jeweils oben und unten auf einer Seite zu plazieren. Was hat es damit auf sich?
Erb: Meistens ist es ganz einfach: Beides kommt aus derselben Wirklichkeit heraus, es gehört zusammen. 1993 hatte ich eine Zeit, in der ich nur gelegentlich ein kurzes Gedicht abgeerntet habe, während untergründige Prozesse vorgingen. Diese kurzen Gedichte erscheinen wie Zeichen, oft ganz unruhig, und deshalb habe ich sie als Schwarm in das Buch gegeben, meistens zwei zusammen, und in der chronologischen Reihenfolge belassen. Du mußt es als Tagebuch lesen. Wenn eins davon einzeln erschien, habe ich es auch einzeln gesetzt, wie das Anfangsgedicht über den IM. Erst in der Chronologie konnte ich in diesen Schwarm überhaupt eine Ordnung hineinbringen. Vorher hatte ich die Texte nach den Bearbeitungsdaten in einem Lesemanuskript, und erst, als es um das Buch ging, habe ich sie nach den Entstehungsdaten geordnet. Es erwies sich, daß das eine gute Ordnung war, für alle Texte, obwohl auch einiges dagegen spricht.
Oleschinski: Du notierst also sowohl das Entstehungs- wie das Bearbeitungsdatum?
Erb: Das Entstehungsdatum ergibt sich aus dem Notizbuch, und erst später, wenn ich die Notizen aufarbeite, komme ich auf diese Eintragung zurück. Bis dahin sind das einfache Notate, sie sind nicht als Gedichte dort hineingeschrieben. Insofern ist der Tag, an dem ich das wieder aufnehme und wittere, daß darin die Form von einem Gedicht steckt, der eigentliche Geburtstag für das Gedicht. Obwohl andererseits in dem Notat im Grunde alles schon gegeben ist.
Oleschinski: Es gibt ein Gedicht mit dem Titel „Sonnenblumen sind nicht mehr / Sonnenblumen“ in der letzten Gruppe, das ich sehr mag.
Erb: Das war auch für mich das eigentliche, denn das sagt nun wirklich ganz deutlich, daß etwas im Umbruch ist. Das rührt dann an dieses Werkstattinteresse, oder dieses Werdegangsinteresse, denn es kommt ja, wie es will, du hast keine Wahl dabei. Dann sehe ich auf diesen Text und frage mich: Will ich denn wirklich keine Gefühle mehr? Das kann doch gar nicht sein, so kenne ich mich gar nicht. Aber in diesem Fall ist einfach die Stimmigkeit des Gedichtablaufs über alle negative Interpretation erhaben, die es sonst geben könnte: „Alle Gefühle, / wie Flammen, abschneiden“, ich bitte dich, was ist das für eine Aufforderung. Aber die Fortführung „als sollten sie ewiger / Hölle gleich // wie vom Erdboden / verschluckt“ ist eine so zutreffende Interpretation der Hölle. Und zwar einfach abgelesen, da ist so eine Art Naht, oder nenn es auch Fußboden, davon werden sie einfach verschluckt – daran die Vorstellung Hölle begreifen zu können. Als Wandlungen, als Antworten auf überholte Reize. Denn es ist ja gemeint, daß du dich nicht mehr von dem Angebot eines Reizes fangen lassen willst. Dafür ist Sonnenblume ein gutes Klischee. Aber das Gedicht, wie ich es gemacht habe, ist kein Klischee, es ist wie eine Nymphenreihe, Feenreihe, Schwesternreihe –
Oleschinski: Wenn ich einen Text von dir lese, spiele ich mit seinen Bedeutungen nicht so herum wie du; ich spekuliere weniger und nehme ihn in seiner Wirkung auf mich eher als gegeben.
Erb: Aber der Text ist doch mein Spielfeld. Da zuckt das Bein noch, da rollt der Ball noch, wenn ich dort wieder hinkomme. Du kannst das nicht machen, aber von mir aus ist es ganz natürlich.
Oleschinski: Ja, ich lese es als fertigen Text. Es gibt natürlich zwischen mir und diesem Text ein veränderliches Verhältnis, das sich durch die Lektüre entwickelt, zum Beispiel von den Tageszeiten abhängt, zu denen ich das Gedicht lese oder wieder lese. Aber das ist etwas anderes als dein Spielen mit dem Werkstattzustand.
Erb: Das kann man nicht als Leser. Ich mache es aber doch. Ich nehme etwas, wenn ich es lese, und reagiere darauf, auch in einem fremden Buch. Mir ist überhaupt egal, ob ein Text auf eine andere Formenwelt, auf diese oder jene reagiert. Ich habe darin überhaupt keine Bedenken. Manche Lyriker scheinen Bedenken zu haben, wenn „Literatur von Literatur“ kommt, als wäre das nicht in Ordnung oder Selbstbefriedigung oder was. Ich höre das immer wieder. Es ist doch völlig egal, ob du jetzt auf einen Text oder – sagen wir mal: das Bild einer Kreuzung reagierst. Wo ist denn da der Unterschied? Im einen wie im anderen Fall treffen perfekte Formen auf dich, mit Spannungen, mit Reizen, mit Stillständen und tragen etwas ein und tragen etwas aus.
Oleschinski: Darum geht es doch nicht. Wenn du auf einen Text triffst, als Text, dann ist es, als ob du auf eine andere Person triffst. Du kannst alles mögliche mit ihr machen: sie berühren, mit ihr reden, eine Beziehung mit ihr aufbauen, mit ihr schlafen… Aber du dürftest ihr nicht den Bauch aufschlitzen oder den Arm da annähen, wo jetzt noch ein Bein sitzt.
Erb: Wenn ich mich einem Text nähere, kann ich auch sonst nichts aufschlitzen oder abnähen. Du siehst doch, wie vorsichtig ich bin. Das ist nicht angeboren, sondern es hat sich allmählich entwickelt. – Bei dem Gedicht „Ankunft“ habe ich ewig gebraucht, um die Überschrift zu finden:
ANKUNFT
des Schuhleders
unter den Schneekristallen
Überhaupt habe ich in der letzten Zeit mehrere Texte geschrieben, für die ich lange keine Überschrift fand. Dann habe ich die Überschrift „Ankunft“ gefunden. Ich meine, die Überschrift „Ankunft“ ist eine Bildung, die ganz vorn ist in ihrer Entschiedenheit. Es geht eigentlich um Abmessungen, um eine Abgemessenheit, oder um Reduktionen, Zurückhaltung, Öffnung –
Oleschinski: Mit dem Wort Ankunft, oder mit dem gesamten Text?
Erb: Mit dem gesamten Text. Mit dem Wort Ankunft meine ich das gelöst zu haben. Sonst hätte ich ja nicht „des Schuhs“ schreiben können. Wenn du dir vorstellst, vorher hätte eventuell „Image“ als Titel gestanden. Image ist auch eine Ankunft: du bist ein lebendes Wesen und triffst auf eine Vielheit, so entsteht ein Image von dir.
Oleschinski: Aber das Image wird dir zugeschrieben.
Erb: Ja sicher. Aber das kann doch nur sein, indem du auf sie triffst. Und das macht der Schuh mit den Schneekristallen. Es ist eigentlich komisch. – Dann habe ich das Definierende weggenommen und lasse den nur ankommen. Ich weiß, daß es stimmt, und ich weiß, daß es genauso prekär ist wie der Reim hier im Gedicht „Drauf los“:
DRAUF LOS
Stöbert… 2 km, zwei
hundert Meter, zwei unendliche
Schritt vor ihm, auch von ihm
(Vielzelligem) bereits
gegangene – der
zu erwartende Steg.
Ich will kein Fleisch sehn,
Baba Jaga!
Blieb denn des Brückchens
bläuliches Gebein
im Schein?
Ich brauchte eine bestimmte neue Entscheidungsschärfe, um das zu machen. Etwas, wo die Klinge bebt. Da ist in mir etwas, was neu ist und noch nie so zu spüren war.
Oleschinski: Aber gerade in deinen kürzeren Texten verwendest du häufiger Reime. Das hat mich immer schon überrascht: einmal, weil es überhaupt Reime sind, und dann, daß du sie verwendest.
Erb: Du mußt Schärfe aufbringen dafür, fast eine Affront-Schärfe, und das nur in dem lautlichen Raum, nicht gerichtet gegen Leute, die keine Reime mögen. Das ist ernst, es ist wirklich eine Begegnung. Als wenn du diesen anderen Placken entzündest, sozusagen von einem Placken zum anderen das Spenden der Infektion durch Masern. – Wenn du merkst, daß du eine neue Entscheidungsschärfe hast, ist das äußerst positiv für dein Selbstgefühl. Du spürst, daß du lebst, es ist gar keine Frage, alles fällt weg, was dich sonst herabstimmt. Dafür gibt es übrigens niemanden und keine Außenseite, die das bestätigen müßte, keine Geltungsskala. Das ist nur noch in dir. Du könntest es sonst ja nicht sehen. Aber ich weiß doch, daß dieser Reim – zum Beispiel „Schein“ auf „Gebein“, was sehr, sehr eng ist – nicht nur in mir klingt, sondern in einem ganz allgemeinen Raum, in den das Gehör hinlangt. Außerdem hat er aber auch noch einen totalen Frieden. Abgesehen davon, daß da von mir etwas Neues gemacht wird, ist die Ecke, wo etwas für mich so Brisantes passiert, auch noch in einem völligen Frieden. Das ist interessant. In einem natürlichen Frieden, wie eine ein bißchen von Nebel beströmte Wiese, auf der sich irgendwelche Bäumchen erheben, ganz natürlich.
Oleschinski: Wenn du über deine Texte sprichst, ist das wieder, wie die Texte selbst, eine Art Gesamtkunstwerk. Man kann kaum einzelne Thesen daraus isolieren. Anders als in Rotterdam habe ich deshalb gar nicht das Bedürfnis, darüber zu argumentieren, sondern ich möchte dem einfach nur zuhören.
Erb: Aber wäre es nicht dasselbe, wenn du über einen Text von dir sprichst? Nimm ein Gedicht und fang an. Was ich berede, entsteht vor meinen Augen, und sofort laufe ich wieder dahin. So ist es immer gewesen, mein Leben lang. Es entsteht etwas, während ich etwas bespreche, weil ich kommunizieren will, und zwar, indem ich prüfe, ob ich es richtig sage. Dabei entsteht ein Bild, und ich laufe diesem Bild nach. Du siehst mich davonlaufen, und du kriegst das natürlich zurück mit den Wellen, die auch auf mich den Reiz ausüben. Aber du bist nicht der Sender. Ich bin gleichzeitig der Sender wie der Empfänger.
Oleschinski: Siehst du, dieses Gefühl habe ich für mich nicht. Die Empfindung, der ich im Augenblick an verschiedenen Stellen nachzuspüren versuche, weil sie mich in Gesprächen oft überfällt, und ganz besonders oft in Gesprächen über Gedichte, obwohl ich Gespräche über Gedichte unglaublich liebe, ist eine Form von Traurigkeit, von Sich-Entfernen, von Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, weil ich das nicht sagen kann, was ich sagen möchte.
Erb: In den Gesprächen über Gedichte? Hilflosigkeit? Entsteht die auch in einem Gespräch über Gedichte, die du geschrieben hast?
Oleschinski: Ich kann über Gedichte, die ich geschrieben habe, nicht sprechen.
Erb: Warum nicht? Hast du sie verlassen?
Oleschinski: Sie haben mich verlassen. Das ist auch gut, ich will es so. Ich will, daß ein Text, der seine Stadien in mir durchlaufen hat, von mir fortgeht.
Erb: Was ich nicht verstehe, ist das: Du hast so viel Verständnis für allgemeine Gedankengänge, was ein Text sei, wo er hinführe, ob er auf sich selbst zurückführe – solche Gedankengänge habe ich gar nicht, ich beschäftige mich damit nicht. Nun sagst du aber, daß du deine eigenen Gedichte schreibst und dann fortgehen läßt, weil das der Punkt ist, an dem sie vollkommen sind, oder weil du dich nicht länger mit ihnen beschäftigen willst. Das muß mich doch wundern. Es ist, als ob du das einzelne Gedicht direkt an der Wurzel verabschiedest, aber auf der Rückseite holst du es mit den allgemeinen Gedankengängen wieder ein. Während ich, wie man ja sieht, es in vielen Fällen ganz natürlich finde, auf das Spielfeld des einzelnen Textes zurückzugehen. Das ist keineswegs eine Belästigung des Gedichts. Warum sollte ich denn der Figur nicht trauen, die ich gebaut habe und die von mir weggesprungen ist?
Oleschinski: Ich traue ihr doch. Daß ich meinen Gedichten traue, steht außer Zweifel.
Erb: Aber du kannst nicht über deine Gedichte sprechen? Du könntest nicht sagen: Sieh mal, hier, an dieser Stelle ist ein neuer Zug, oder etwas in der Art? Ich finde, etwas anderes kann man kaum tun, als darauf hinzuweisen und es vielleicht mit Hilfsbegriffen zu umschreiben. Man kann nicht viel daran herumtheoretisieren. Mir will scheinen, bei dir ist etwas dahinter, das eigentlich dürr ist, so, als hätten wir das mit der Kommunion abgetan, als hätten wir das schon längst hinter uns zu haben. Ich wittere dahinter eine kleine bürgerliche Blödigkeit. Ein Das-Tut-Man-Nicht. Denn über den Text zu sprechen würde für dich heißen, daß du ihn noch nicht von dir fortgegeben hast, daß er noch kein Ding ist. Während ich meine: Gerade wenn es ein Ding ist, kannst du zu ihm hingehen, kannst es befingern, kannst es in die Luft werfen und wieder auffangen. Du kannst alles mit ihm machen, wenn es ein Ding ist. Ist es diese kleine bürgerliche Blödigkeit?
Oleschinski: Über Zustände, die mit dem Schreiben zu tun haben, Zustände auf dem Weg zu einem Gedicht, habe ich schon geschrieben. Das geht auch. Aber ich kann über meine Gedichte nicht in der Weise sprechen, daß ich anderen bei ihrer Lektüre sozusagen auf die Sprünge helfe. Ich höre allerdings sehr aufmerksam zu, wenn jemand seine Lesebewegung in meinen Gedichten schildert. Kürzlich war ich wirklich fasziniert von einem Werkstattgespräch, in dem ich erleben konnte, wie andere sich über die Leseerfahrung mit einem meiner Gedichte verständigten und wie sich dabei der Text – den erkennbar gemacht zu haben ich doch immer nur hoffen kann –, vor aller Augen ganz objektiv aus ihren einzelnen Schritten und Bemerkungen zusammensetzte.
Erb: Weißt du, was ich nicht begreife? Da hat jemand den Anstand aufgebracht, einen Text zu machen. Wieso ist er völlig darüber verzweifelt, daß er, wenn er darüber redet, diesen Anstand verlassen könnte? Gerade sind wir einen Schritt in dem neuen Reich der neuen Erde mit unserem Textchen, und schon denken wir, die Tür ist zu, wir sind wieder draußen. Was soll das? Wenn du darüber redest, warum solltest du dich nicht, ohne ihn zu verletzten, deinem Text gesellen können? – Du hast vielleicht deinen letzten Atem verbraucht mit einem Gedicht… Aber du würdest auf dieses Gedicht doch jemanden hinweisen wollen. Du hast wirklich etwas gemacht, das sich von dir abgelöst hat. Jetzt kommt jemand herein, der davon nichts weiß. Ich meine, daß es eine schöne Mitteilung wäre, ihm das zu zeigen. Wenn es ein Ding geworden ist, dann zerfällt es davon nicht, dann kannst du ihm das erklären.
Oleschinski: Vielleicht hängt es mit den Unwägbarkeiten zusammen, die das Schreiben für mich im Ganzen hat, oder die ich derzeit besonders stark empfinde. Ich habe vor einiger Zeit gesagt, daß etwas an dieser Blockierung mich an die Schwierigkeit mit meinen Venen erinnert, die sehr dünn sind; immer, wenn mir beim Arzt Blut abgenommen wird, ist das eine ganz furchtbare Prozedur. Ich denke oft, daß ich beim Schreiben die Vene nicht treffe, daß ich sie vielleicht noch nie richtig getroffen habe.
Erb: Das verstehe ich. Das Gewebe in deinen Texten ist so feingesponnen, daß ich sofort verstehe, was du meinst. – Aber was willst du bei der Vene? Du triffst sie nicht: Das ist doch vielleicht nur die List, die dich veranlaßt, deinen Text fertigzumachen.
Oleschinski: Wenn wir schon bei dieser eigenartigen Bildlichkeit sind, und weil ich heute einen melancholischen Tag habe – mir schwebt auf der Zunge zu sagen: Im Grunde möchte ich verbluten… Aber das nehme ich selbst nicht ganz ernst. Vielleicht ist es nur ein Zwischenstadium, in dem ich das so empfinde.
Erb: Du scheinst etwas zu vermissen.
Oleschinski: Ich vermisse in meinem Schreiben etwas, das sehr viel körperlicher ist. Ich glaube, daß sich die Impulse zu den Gedichten, wenn ich sie bearbeite, in einem extrem intellektualisierten Stadium befinden. Aber das, was mich daran wirklich beschäftigt, ist viel, viel körperlicher. Dafür funktioniert meine Sprache nicht so, wie ich sie gern funktionieren sähe. Sie ist dem nicht adäquat.
Erb: Da geht sie nun an sich selber lang und nörgelt…
Oleschinski: Nein, es ist nicht Nörgeln. Es ist Suchen. – Das, was mich an Gedichten wirklich beschäftigt, ist etwas, das mit Rhythmus zu tun hat. Rhythmus ist etwas ganz Elementares. Wenn man für das Verständnis von Gedichten ein Schema aus mehreren Ebenen aufbaut, dann kann man drei Schichten eigentlich immer identifizieren. Die erste ist eine rhythmische Schicht, eine körperliche, die zweite eine Klangschicht, die vor allem mit Emotionen zu tun hat, Harmonien, Dissonanzen, und als drittes gibt es so eine visuelle Schicht, in der die Semantik und die Bildlichkeit funktionieren, als intellektuelle Evidenz.
Erb: Ich denke, daß ein Vers seine Qualität erst bekommt, wenn er diese drei Schichten in sich vereinigt. Ein Gedicht ohne Rhythmus wäre wie ein Körper ohne Atem.
Oleschinski: Eben. Deshalb ist das Rhythmische meine Ausgangsebene, aber ich gebe ihm nicht genug nach. Das hat nichts mit Nörgelei zu tun. Ich habe den ganzen Sommer gebraucht, um diesen Mangel zu bemerken. Einen Mangel, der daraus entsteht, daß ich mich verändert habe, daß meine Themen sich verändert haben, aber daß meine poetischen Mittel sich nicht entsprechend verändert haben. – Ich glaube, es geht um Kraft, um mehr Weite, mehr Atem, darum, woanders herzukommen und woanders hinzugehen, und im Grunde ist es viel mehr eine Herausforderung als etwas, das sich mit einem Wort wie Traurigkeit oder Hilflosigkeit bezeichnen läßt. Traurig macht mich bloß, daß ich das bisher nur als Anspruch formulieren kann, nicht schon im Gedicht. Es sollte andersherum sein, es sollte aus den Gedichten kommen, nicht aus dem Bedürfnis nach ihnen.
Erb: Wenn ich darauf antworten soll, frage ich dich: Wozu soll das gut sein? So, als ob ich blasiert wäre und solche Bewegungen von Kraft, Entschiedenheit usw. mich von vornherein langweilten, denn ich will dein feines Gewebe erhalten. Es müßte eine ganz eigene Bewegung sein, die aus deinem Vorhandenen sich entwickeln müßte, nicht eine, die mit irgendwelchen anderen Mitteln frappiert. – Mehr Kraft, mehr Frische, mehr was?
Oleschinski: Mehr Körper. Mehr Entschiedenheit. Mehr Lust, mehr Intensität.
Erb: Das kommt vom Risiko. Ich habe viele sinnliche Dinge, die ich nicht weiß, aber das weiß ich. – Dahinter steht natürlich unser deutscher Ernst im Arbeiten. Berge von Ernst im Arbeiten haben wir zur Verfügung, unerschöpflich sind wir in unserem Arbeitsernst. Darin sind wir maßlos reich: Wir können uns jedes Risiko leisten, weil wir solchen Reichtum an ernsthafter Arbeit in uns haben. – Vielleicht läßt du einfach nicht los. Ich habe mal ein Gedicht geschrieben, das vom Einschlafen handelt. Seit fünfzehn Jahren höre ich, daß ich dabei „loslassen“ soll. Hör mal, wie das geht:
IM EINSCHLAFEN
sein lassen können
mußt du… – loslassen, sein!
Loslassen was?
Die Zügel
los
Zügel…
Die Pferde?
Kutschpferde!
Hah!!
Oleschinski: Kutschpferde, hah!?! – Ich danke dir.
Aufgenommen am 22. Juni 1994 in Rotterdam und am 1. November 1994 in Berlin.
Veröffentlicht in:
Elke Erb: Der wilde Forst, der tiefe Wald. Auskünfte in Prosa. Steidl-Verlag, Göttingen, 1995
und: Brigitte Oleschinski: Reizstrom in Aspik. Wie Gedichte denken, DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln 2002
Fakten und Vermutungen zum Poesiealbum + wiederentdeckt +
Interview
50 Jahre 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Gedichtverdachte: Zum Werk Elke Erbs. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung In den Vordergrund sprechen Hendrik Jackson, Steffen Popp, Monika Rinck und Saskia Warzecha über Elke Erbs Werk.
Franz Hofner: Hinter der Scheibe. Notizen zu Elke Erb
Elke Erb: Die irdische Seele (Ein schriftlich geführtes Interview)
Elke Erbs Dankesrede zur Verleihung des Roswitha-Preises 2012.
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Elke Erb und Friederike Mayröcker.
Klassiker der Gegenwartslyrik: Elke Erb liest und diskutiert am 19.11.2013 in der literaturWERKstatt berlin mit Steffen Popp.
Lesung von Elke Erb zur Buchmesse 2014
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Steffen Popp: Elke Erb zum Siebzigsten Geburtstag
literaturkritik.de
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Waltraud Schwab: Mit den Gedanken fliegen
taz, 10.2.2018
Olga Martynova: Kastanienallee 30, nachmittags halb fünf
Süddeutsche Zeitung, 15.2.2018
Michael Braun: Da kamen Kram-Gedanken
Badische Zeitung, 17.2.2018
Michael Braun: Die Königin des poetischen Eigensinns
Die Zeit, 18.2.2018
Karin Großmann: Und ich sitze und halte still
Sächsische Zeitung, 17.2.2018
Christian Eger: Dichterin aus Halle – Wie Literatur und Sprache Lebensimpulse für Elke Erb wurden
Mitteldeutsche Zeitung, 17.2.2018
Ilma Rakusa: Mensch sein, im Wort sein
Neue Zürcher Zeitung, 18.2.2018
Oleg Jurjew: Elke Erb: Bis die Sprache ihr Okay gibt
Die Furche, 8.3.2018
Annett Gröschner: Gebt Elke Erb endlich den Georg-Büchner-Preis!
piqd.de, 27.6.2017
Zum Georg-Büchner-Preis an Elke Erb: FR 1 & 2 + MOZ + StZ + SZ +
Echo + Welt + WAZ + BR24 + TTB + MAZ + FAZ 1 & 2 + TS + DP +
rbb +taz 1 & 2 + NZZ +mdr 1 & 2 + Zeit + JW + SZ 1 & 2 +
Zur Georg-Büchner-Preis-Verleihung an Elke Erb: BaZ + BZ + StZ +
AZ + FAZ + SZ
Verleihung des Georg-Büchner-Preises 2020 an Elke Erb am 31.10.2020 im Staatstheater Darmstadt.
Fakten und Vermutungen zur Autorin + KLG + IMDb + Archiv +
Internet Archive + PIA + weiteres 1, 2 & 3 +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Galerie Foto Gezett 1, 2 & 3 +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Elke Erb: FAZ ✝︎ BZ 1 + 2 ✝︎ Tagesspiegel 1 +2 ✝︎ taz ✝︎ MZ ✝︎
nd ✝︎ SZ ✝︎ Die Zeit ✝︎ signaturen ✝︎ Facebook 1, 2 + 3 ✝︎ literaturkritik ✝︎
mdr ✝︎ LiteraturLand ✝︎ junge Welt ✝︎ faustkultur ✝︎ tagtigall ✝︎
Volksbühne ✝︎ Bundespräsident ✝︎
Im Universum von Elke Erb. Beitrag aus dem JUNIVERS-Kollektiv für die Gedenkmatinée in der Volksbühne am 25.2.2024 mit: Verica Tričković, Carmen Gómez García, Shane Anderson, Riikka Johanna Uhlig, Gonzalo Vélez, Dong Li, Namita Khare, Nicholas Grindell, Shane Anderson, Aurélie Maurin, Bela Chekurishvili, Iryna Herasimovich, Brane Čop, Douglas Pompeu. Film/Schnitt: Christian Filips
Elke Erb liest auf dem XVII. International Poetry Festival von Medellín 2007.
Elke Erb liest bei OST meets WEST – Festival der freien Künste, 6.11.2009.
Zum 70. Geburtstag des Herausgebers:
Jan Wagner: Lob des Spreewals
Der Tagesspiegel, 11.6.2016
Stefan Sprenger: Dass der Mensch der Stil sein möge
Sprache im technischen Zeitalter, Heft 218, Juni 2016
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + DAS&D +
Übersetzungen 1 & 2 + KLG 1 & 2
Porträtgalerie: Galerie Foto Gezett + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Richard Pietraß liest am 4.5.2018 für planetlyrik.de die 3 Gedichte „Hundewiese“, „Klausur“ und „Amok“.



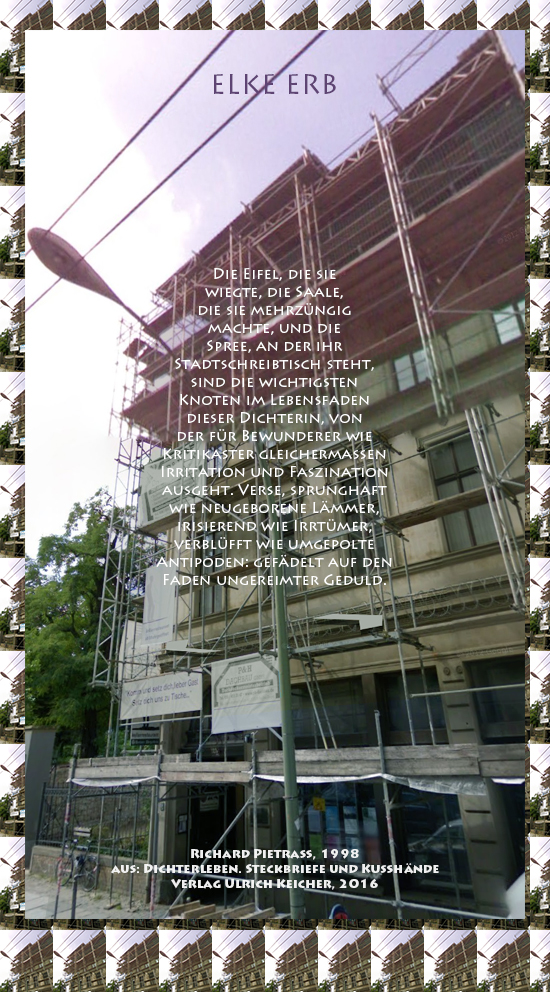













Schreibe einen Kommentar