Ernst Jandl: Das Öffnen und Schließen des Mundes
um ein gedicht zu machen
habe ich nichts
eine ganze sprache
ein ganzes leben
ein ganzes denken
ein ganzes erinnern
um ein gedicht zu machen
habe ich nichts
Und nun erst – eine Vorlesung! Nein – fünf!
Um eine Vorlesung zu halten
habe ich nichts
eine ganze Sprache – mir fehlen die Worte
ein ganzes Leben – zu viele Versäumnisse
ein ganzes Denken – nur noch Perseverationen
ein ganzes Erinnern – ausschließlich Lücken
um eine Vorlesung halten
habe ich alles
Vor allem ein Thema. Zu diesem kam es aus rein organisatorischen Gründen. Es läßt sich indes aus sich selbst begründen. Vor allem als Zeichen des Fleißes, des Mangels an Faulsein. Ich rieche, rieche – Menschenfleiß!
ein falusein
ist nicht lesen kein buch
ist nicht lesen keine zeitung
ist überhaupt nicht kein lesen
ein faulsein
ist nicht lernen kein lesen und schreiben
ist nicht lernen kein rechnen
ist überhaupt nicht kein lernen
ein faulsein
ist nicht rühren keinen finger
ist nicht tun keinen handgriff
ist überhaupt nicht kein arbeiten
ein faulsein
solang mund geht auf und zu
solang luft geht aus und ein
ist überhaupt nicht
Dies – unser Motto. Unser Thema: das Öffnen und Schließen des Mundes.
„Fünf Vorlesungen hindurch
wird uns nun das Öffnen und Schließen des Mundes beschäftigen … Wobei das Öffnen und Schließen des Mundes von meiner Seite immer im Gedanken an Ihre Ohren geschehen wird, die etwas aus meinem Inneren in Ihr Inneres zu transportieren haben werden, an die Stelle in Ihrem Inneren, wo es denkt … aber sehr viel in meinem Inneren wird in Bewegung sein müssen, damit mein Atem etwas von dort, wo es in mir denkt, durch die Luft, die uns verbindet und trennt, bis zu Ihnen befördern kann.“
Diese Vorlesungen hielt Ernst Jandl (geb. 1925) 1984/85 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Wie es der Tradition der Veranstaltung entspricht – vor ihm lasen u.a. Ingeborg Bachmann, Martin Walser, Adolf Muschg −, waren es keine germanistischen Fachvorträge, sondern eher Arbeitsberichte aus der Werkstatt des Dichters. Ernst Jandl offenbart jedoch weit mehr als die vielfältigen Möglichkeiten der Verwandlung eines phonetischen Akts in einen poetischen. Er macht seine Biographie, die prägenden Erlebnisse im Krieg, im Wien der Nachkriegsjahre und in der „Wiener Gruppe“, seine literarischen Entdeckungen bei Hugo Ball, Kurt Schwitters, Bertold Brecht, Gertrude Stein zu Kronzeugen eines Prozesses der dichterischen Selbstausformung von zwingender Folgerichtigkeit. Und er erzählt von der zermürbenden Lebensarbeit, die notwendig ist, um Sehen, Erinnern, Fühlen und Denken miteinander ins Spiel treten zu lassen und zum sprechen zu bringen. Ohne diese Arbeit ist wirkliche Dichtung nicht denkbar, und in diesem Sinne gehören auch Jandls Vorlesungen dazu.
Verlag Volk und Welt, Klappentext, 1987
Sprechgedichte, Lautgedichte, visuelle Gedichte,
Gedichte, die sich der Alltagssprache annähern oder sich eines defekten Sprachmaterials, einer „heruntergekommenen“ Sprache bedienen – in seinen Frankfurter Poetik-Vorlesungen, die er im Wintersemester 1984/85 vor einem begeisterten Publikum gehalten hat, nimmt Ernst Jandl seine Erfahrungen aus mehr als dreißig Jahren eigener Arbeit an Gedichten, an Hörspielen und Theaterstücken zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen. Ernst Jandl denkt also über den Autor Ernst Jandl nach. Dabei kommt es ihm nicht so darauf an, seine Arbeit nachträglich theoretisch zu begründen. Er zeigt, weswegen er Lyrik in unlyrischer Sprache schreibt, welche persönlichen und politischen Begleitumstände ihn dazu gebracht haben, sich der überhöhten Formen und Festen zu enthalten, die traditionell noch immer das Material für Gedichte liefern. Seine Vorlesungen lesen sich wie ein grundlegender Kurs in moderner Poesie und ein poetisches Handbuch, das einzige, wenn überhaupt, das zu Jandls Werk geschrieben werden kann. Eine Tendenz in seiner Dichtung zu immer einfacheren Formen wird deutlich sichtbar, die am Ende nur noch aus dem Öffnen und Schließen des Mundes bestehen: er ist offen / er ist weiter offen / er ist sehr weit offen, / er ist zu.
Luchterhand Verlag, Klappentext, 1985
Ernst Jandl: Das Öffnen und Schließen des Mundes
In der ersten seiner 5 Vorlesungen (Wintersemester 1984-85) geht Jandl – Verfasser von Texten wie Laut und Luise (1966; darin u.a. „wien: heldenplatz“, „schtzngrmm“), flöda und der schwan (1971), der ,Sprechoper‘ Aus der Fremde (1980) und zuletzt dem selbstporträt des schachspielers als trinkende uhr (1983) – auf mehrere Laut- und Sprechgedichte von eigner Hand und Hugo Balls dadaistischen Text „Karawane“ ein. Er vermittelt dem Leser Einblicke in seine Schreibpraxis, in seine poetologischen Auffassungen und Verfahren und in sein Traditionsverständnis. Er sieht die literarische Entwicklung in Österreich wie in Deutschland als brutal unterbrochen von den Jahren 1933–45. Zwar lasse sich eine fortgesetzte Rezeption von Klassikern wie Th. Mann, Kafka und Brecht wahrnehmen, aber, fragt Jandl, wo war die Vorkriegsavantgarde (wie Ball, Hausmann, Schwitters)? Da bedurfte es einer neuen literarischen Revolution, um sie wieder in den Blick zu bringen und an die Anfänge dieser modernen Dichtung anknüpfen zu können: eben die der konkreten Poeten.
Die zweite Vorlesung handelt von Jandls ,heruntergekommener Sprache‘, die er neben seinen Sprechgedichten als zweite Blüte seiner Produktivät empfindet. Wie in der vierten Vorlesung läßt er nicht die Gelegenheit aus, auf konservativ-repressive (kultur)politische Tendenzen und persönliche Erfahrungen damit hinzuweisen. In der dritten Vorlesung setzt er bei der Frage an, wie sich Gedichte „unter Aufbietung der verschiedensten poetischen Mittel zur außerpoetischen Realität verhallen“, und behandelt weitere Proben aus seinen Primärtexten. Er weist auf Gertrude Stein als seine Inspirationsquelle sowie auf Schwitters hin.
Als Titel und Ausgangsbasis der vierten Vorlesung wählte Jandl „Die Humanisten“ (Titel auch eines Einakters von ihm). ,Humanisten‘ sind nach ihm im Grunde gefährliche Gegner der wahren Kunst, die sich mit (Goethe, Grillparzer, Burgtheater und ,küßdiehandke‘ alibisieren, um die gelegentlich garstige Realität beim Namen nennende, kritische Künstler als die Kultur, die Heimat und die ,heilige‘ Muttersprache besudelnde ,schmutzen finken‘ außer Spiel zu setzen.
Die letzte Vorlesung solle von Jandl selbst handeln. Aber da ist er sehr zurückhaltend. Mit seinem Gedicht „kommentar“ bekundet und begründet er treffend seine Weigerung, eine Autobiographie zum besten zu geben, so zugleich die Aufmerksamkeit von sich auf seine Gedichte lenkend. Er setzt hinzu: „Überhaupt dürfte der Begriff des ,Selbstporträts‘ sich für manches Gedicht wohl eignen“. So stellt Jandl sich hier vor: witzig, scharfsinnig, mit einem guten Blick fürs Relevante. Souverän und wortspielerisch gewandt teilt er genau soviel oder so wenig von sich und seinen poetologischen Ideen mit, wie er dann gerade für nötig hält. Ein Meister der Dosierung. Er erweist sich als ein Mann mit vielerlei Inspirationen, weltoffen, als einer, der es versteht, andere sprachlich zu fesseln und zu überraschen, zu begeistern und zu inspirieren. Nach der Lektüre bedauert man, daß es nur fünf Vorlesungen waren.
Cegienas de Groot, Deutsche Bücher, Heft 1, 1985
Weitere Beiträge zu einer anderen Ausgabe:
Josef Quack: Das Öffnen und Schließen des Mundes
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.12.1984
Ulrich Janetzki: Um den Reiz des Vortrags gebracht
Der Tagesspiegel, Berlin, 16.6.1985
Beatrice von Matt: Über Jandl zu Jandl, Stein, Schwitters, Heißenbüttel. Der lange Weg der literarischen Avantgarde
Neue Zürcher Zeitung, 19.9.1986
„… eine Schonungslosigkeit, die nicht verletzt…“
Alfred Estermann: Sie haben eine Reihe von interpretatorischen Äußerungen zu Ihrer literarischen Produktion veröffentlicht, gesammelt in dem Buch Die schöne Kunst des Schreibens. Aneinandergereiht gelesen ergeben diese Publikationen eine erwünscht subjektive, vielfach objektivierbare Einführung in Ihr Werk. Sind in diesem Sinne auch die Frankfurter Vorlesungen zu verstehen?
Könnten Sie eine Vorschau geben?
Ernst Jandl: Ich werde wiederum in erster Linie von eigenen Texten – Gedichten und anderen – ausgehen, und mich dann in die jeweilige Richtung zu bewegen suchen, in die mich der entsprechende Text führt. Das heißt nicht, daß ich von vornherein Texte anderer Autoren ausschließe, aber meine eigenen Texte sind wohl die, die ich am besten von außen und innen kenne und anhand derer ich mich auf theoretisierendem Gebiet nicht allzu deplaziert fühlen werde.
Der Titel „Das Öffnen und Schließen des Mundes“ ist früher dagewesen als jede Zeile dieser zu schreibenden Vorlesungen. Es mußte ein Titel aus organisatorischen Gründen gefunden werden, und das hatte für mich ein Titel zu sein, der mir sozusagen alles gestattet, der mich nicht von vornherein einengt. Hätte ich selber die Reihenfolge entscheiden können, so hätte ich wahrscheinlich abgewartet, bis einiges von dem Text dieser Vorlesungen vorhanden ist, um dann einen Titel für die Vorlesungen zu finden.
Das Öffnen und Schließen des Mundes ist natürlich auf verschiedene Weise auffaßbar. Es spielt, um es auf den engeren Bereich meiner literarischen Tätigkeit zu begrenzen, auf das gesprochene Wort, auf gesprochene Dichtung an. Es kann auch symbolisch aufgefaßt werden als ein Öffnen des Mundes, mit dem das Atmen und alles, was sonst mit dem menschlichen Leben zusammenhängt, beginnt, bis zu einem letzten Schließen des Mundes, mit dem das Atmen und alles, was mit dem menschlichen Leben sonst noch zusammenhängt, endet. Ich habe fünf Vorlesungen zu halten, und werde mich, wenn alles so verläuft, wie ich es mir vorstelle, in der ersten dem Titel insofern nahe verhalten, als ich über das Laut- und Sprechgedicht sprechen möchte. In der zweiten, der ich einen Untertitel geben möchte, „Das Röcheln der Mona Lisa“ (das ist der Titel eines Hörspiels von mir), werde ich über die Schönheit einer sogenannten „heruntergekommenen“ Sprache sprechen. Die dritte wird den Untertitel „Szenen aus dem wirklichen Leben“ haben und sich mit dem Verhältnis zwischen Gedicht und außerpoetischer Realität beschäftigen. Die vierte, die nach einem Einakter von mir „Die Humanisten“ heißen soll, wird sich mit sogenannten engagierten, also im weitesten Sinne gesellschaftskritischen Texten befassen. Und zu guter Letzt ein doppelter Untertitel: „Aus der Fremde oder Selbstporträt des Schachspielers als trinkende Uhr“. Hier wird der Autor seinen eigenen Bereich dem Publikum öffnen, soweit es anhand entsprechender Texte notwendig ist, also Texte, die offen zeigen, daß der Autor von sich selber spricht oder sich durch den Text mit sich selbst beschäftigt.
Carl Paschek: Eben fiel das Stichwort „Sprechgedicht“. Viele Ihrer Arbeiten gewinnen erst durch den persönlichen, klanglichen realisierenden Vortrag des „Sprechspielers“ ihre eigentliche Dimension für das Verständnis des Zuhörers und Zuschauers. In manchen Ihrer „konkreten“ Gedichte kann man einen durchgehenden, fast maschinenartigen Rhythmus ebenso nachweisen, wie in Ihren Lautgedichten ein sehr sensibles Verhältnis zum differenziert modulierten Klang festzustellen ist. Sie haben auch eine Reihe von literarisch-musikalischen Produktionen, in Zusammenarbeit mit Musikern, veröffentlicht. Welche Beziehungen haben Sie zur Musik?
Jandl: Ich habe eine ganz enge Beziehung zum Jazz. Und zwar zu allen Stilen des Jazz vom traditionellen bis zu den radikalen Formen des Free Jazz. Ich habe, als ich mit Sprechgedichten begann, etwa 1957, eine Reihe von Gedichten geschrieben, die lang und dünn auf der Buchseite wirken, die gesprochen aber einen „Beat“ haben, einen durchlaufenden Rhythmus, den Sie auch mit dem Fuß schlagen können, wie etwa der Fuß sich bei einer gewissen Art von Jazz automatisch bewegt. Das sind Gedichte wie „bestiarium“ oder „bericht über malmö“ oder „viel vieh o so viel vieh“.
Ich habe mich immer als einen in mancher Beziehung unmusikalischen Menschen erfahren, seit meiner Kindheit, seit dem Beginn des Klavierunterrichts, der zwar eine ganze Reihe von Jahren angehalten hat, aber mich nie zu einem befriedigenden Ergebnis gebracht hat. Ich habe sicherlich nur eine sehr partielle Musikalität, die mich daran hindert, über das hinaus, was ich an Musikalischem in meine Gedichte dann und wann hineinstellen will, auch tatsächlich Musik zu machen. Ich könnte es mir vorstellen, daß ich vielleicht lieber Tenorsaxophon spielen würde, wenn ich die Qualitäten eines Lester Young oder eines John Coltrane hätte, um nur einige Meister zu nennen. Ich habe kein Musikinstrument außer einer Blockflöte und einer kleinen Mundharmonika, mit denen ich wenig anzufangen im Stande bin. Andererseits habe ich seit geraumer Zeit immer wieder mit Musikern zusammengearbeitet, natürlich mit Jazzmusikern.
Das geht zurück in die sechziger Jahre, zu meinem ersten Zusammentreffen mit Schriftstellern, Künstlern und Musikern im Forum Stadtpark Graz. Dort kam ich in engeren Kontakt mit drei Jazzmusikern, Dieter Glawischnig, John Preininger und Ewald Oberleitner, die seit langer Zeit ein erfolgreiches Trio bilden, Klavier, Baß, Schlagzeug. Seit den sechziger Jahren gab es vereinzelt Auftritte dieses Trios mit mir zusammen: Es wurden die Texte abgesprochen, es gab auch ein verhältnismäßig geringes Maß an Probenarbeit und dann kam es zu Auftritten dieses Jazztrios mit mir als Sprecher.
Dieter Glawischnig, als er später die Leitung der NDR-Big-Band übernommen hatte, trat bald an mich mit der Frage heran, ob ich nicht etwas für die Big-Band zu machen versuchen wolle.
Ich verhielt mich sehr zögernd, denn eine Big-Band ist ein großer Klangapparat – wie konnte eine Sprechstimme wie meine in eine solche Formation tatsächlich integriert werden? Schließlich war ich doch dazu bereit, und so kam es dann, nach Vorgesprächen und nachdem Glawischnig eine Komposition auf der Basis einer Reihe von Gedichten von mir ausgearbeitet hatte, zu einem gemeinsamen Auftreten mit der NDR-Studio-Band, wie sie sich nannte.
Es wurden noch einige Solisten dazu engagiert, darunter die berühmten deutschen Musiker Manfred Schoof und Gerd Dudek. Wir arbeiteten einige Tage probend und traten dann beim 7. New Jazz Festival in Hamburg mit großem Erfolg auf. Das war für mich eine außerordentliche Erfahrung. Das war 1982. Wir führten die Komposition, die etwa 55 Minuten dauert, ein Jahr später beim Steirischen Herbst in Graz ebenfalls mit Erfolg auf.
Inzwischen hatte ich eine außerordentlich gute Band in Wien kennen gelernt, das Vienna Art Orchestra, das gegründet wurde und geleitet wird von Mathias Rüegg, einem in Wien lebenden Schweizer. Mit drei Musikern dieses Orchesters studierte ich ein Programm ein, das zum großen Teil von Mathias Rüegg komponiert worden war, wobei das Faszinierende an dieser Zusammenarbeit mit den drei Musikern darin bestand und besteht, daß neben Wolfgang Puschnig, Saxophone und Flöten, und Woody Schabata, Vibraphon, Marimbaphon und Percussion, eine ganz hervorragende Vokalistin, Lauren Newton, an dieser Sache beteiligt war, so daß nicht nur ein Sprecher, sondern auch eine Sängerin mitwirkte.
Dieses Zusammenspiel mit einer weiteren Stimme war für mich etwas ganz Neues und überaus Befriedigendes. Es kommt in Kürze eine Schallplatte dieses Quartettes heraus unter dem Titel Bist Eulen?, es hat bereits mehrere gemeinsame Auftritte gegeben und es wird nächstes Jahr im März in Verbindung mit dem Literarischen März Darmstadt ebenfalls einen Auftritt dieses Quartetts geben, wo wir diese Sache, die etwa 45 Minuten dauert, aufführen werden.
Ich habe durch die Jahrzehnte relativ viel Geld und Zeit in Schallplatten investiert, vor allem in Jazzplatten.
Paschek: Unter Ihren Gedichten sind Arbeiten, die, etwa in der Anordnung der Wörter auf der Buchseite, auch als Produkte einer graphischen Gestaltung „gelesen“ werden können. So das Gedicht „martyrium petri“, das den mit dem Kopf nach unten Gekreuzigten abbildet. Sie zeichnen auch, in einigen Ihrer Bücher sind graphische Arbeiten veröffentlicht. Welche Beziehungen haben Sie zur Graphik, zur bildenden Kunst?
Jandl: Ich habe seit meiner Kindheit ein gewisses Verhältnis zur bildenden Kunst gehabt, das sich dann im Laufe der Jahre verstärkt und natürlich auch eingeengt hat. Es geht das auf den privaten und familiären Bereich zurück. Mein Vater beschäftigte sich sein ganzes Leben hindurch neben seinem Beruf als Bankangestellter mit Graphik, mit Aquarell, mit Malerei. Er war es auch, der mich als Kind in Kunstausstellungen und Museen führte und mir die bildende Kunst nahe brachte.
Während des Zweiten Weltkriegs war, durch eine ganz bestimmte Konstellation von Freunden und gemeinsamen Interessen, ein äußerst starkes und während dieser Jahre nur dürftigst gestilltes Verlangen vorhanden, die Kunst des 20. Jahrhunderts ebenso wie die Musik des 20. Jahrhunderts und natürlich auch die Literatur des 20. Jahrhunderts tatsächlich kennenzulernen. Das konnte man im vollen erst nach 1945 beziehungsweise 1946 – ich kam Anfang 1946 aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft zurück – tun: auf dem Gebiet der Musik sporadisch, auf dem Gebiet der bildenden Kunst in größerem Maße, auf dem Gebiet der Literatur an vereinzelten Beispielen. Es trat nicht das ein, was ich und einige gleichgesinnte Freunde erwartet hatten: daß mit dem Ende des Krieges, das wir zwangsläufig als mit dem Ende des Nationalsozialismus gekoppelt voraussahen, schlagartig alles kam. Das geschah nicht.
Um jetzt von der bildenden Kunst zu sprechen: Die bildende Kunst unseres Jahrhunderts war und ist für mich faszinierend, wobei ich den Expressionismus als die gegenständliche Kunst unseres Jahrhunderts sehr schätze. Einzelpersönlichkeiten, die bei der gegenständlichen Malerei geblieben sind, aber sie zur Malerei des 20. Jahrhunderts gemacht haben, das heißt, innerhalb der gegenständlichen Malerei etwas Neues geschaffen haben, ohne deswegen einer Bewegung wie etwa dem Expressionismus anzugehören, Einzelpersönlichkeiten wie Henri Matisse, Pablo Picasso oder Marc Chagall waren für mich ein sehr starkes Erlebnis. Aber auch die gegenstandsfreie Malerei war im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Mit der informellen Malerei konnte ich mich nicht mehr vorbehaltslos anfreunden. Der Drang weg von den traditionellen Mitteln der Kunst, das heißt, weg von der Bildfläche, weg von der Farbe, weg von den Werkzeugen: Hier konnte ich nicht dem Weg jedes Künstlers folgen. Das Tafelbild, das gemalte Bild bedeutet mir immer noch etwas, ebenso eine Plastik, etwa einer Barbara Hepworth. Bei der Beschäftigung mit der bildenden Kunst ist es mir passiert, daß ich erst über einen längeren Zeitraum einen Künstler zu meinem eigenen machen und seine wirkliche Größe erkennen konnte. Ein Beispiel dafür wäre Max Ernst. Wenn ich mich skeptisch geäußert habe gegenüber dem Verlassen aller traditionellen Mittel, so muß ich sagen, daß ich einen Mann wie Duchamp, der ein Revolutionär war und vieles als erster gemacht hat, was andere heute noch „verkaufen“, überaus schätze.
Paschek: Sie haben vor allem Gedichte veröffentlicht. Auf dem Gebiete der Prosa gibt es nur wenige Arbeiten von Ihnen, die etwa den Untertitel „Übung“ tragen und vielleicht auch als überaus lange Langgedichte gelesen werden können. Abgesehen von einigen autobiographischen Passagen in analytischen Aufsätzen – warum gibt es so wenig erzählende Prosa von Ihnen?
Jandl: Wenn ich gefragt werde, warum ich keine erzählende Prosa schreibe, und ich mich auf den gegenwärtigen Zeitpunkt beziehe, also im Alter von 59, dann muß ich sagen, daß ich mir während der Zeit meines Schreibens kein eigenes Modell für erzählende Prosa geschaffen habe. Ob ich dazu noch eine Chance habe – ganz abgesehen davon, ob ich überhaupt eine Neigung, einen Antrieb dazu verspüre oder verspüren könnte –, ein persönliches Modell, mein eigenes Modell einer fiktiven Prosa zu erarbeiten, das weiß ich nicht. Ich würde es eher bezweifeln. Es ist so, daß ich für Gedichte ja auch nicht ein einziges Modell habe, sondern eine ganze Anzahl Modelle. Aber wenn ich an einem Gedicht arbeite, so erkenne ich den Punkt, wo die Sache etwas wird, und den Punkt, wo die Sache etwas ist. Und diesen Weg habe ich bei der Prosa bisher nicht. Das heißt nicht, daß ich vielleicht schon seit Jahren an dem Versuch, fiktive Prosa zu schreiben, arbeite. Das ist unterblieben.
Paschek: In manchen Ihrer Gedichte finden sich Ansätze zu einer inszenatorischen Gestaltung, Regieanweisungen für eine „Aufführung“ dieses Textes, zum Beispiel in „mozarts puls“. Auch Ihre Sprechgedichte stehen in einem klaren Zusammenhang mit Bühne, Auftreten, Publikum. Eines Ihrer bekanntesten Gedichte, „ottos mops“, ist als das Stenogramm einer Zweierbeziehung sogleich als ein „Drama“ erkennbar, das eine „Handlung“ hat. Mit „Aus der Fremde“ ist Ihnen eines der wichtigsten und diskutabelsten Kammer-Sprech-Stücke der letzten Jahre gelungen. Planen Sie weitere Arbeiten für das Theater?
Jandl: Was ein Gegner von mir als Exhibitionismus bezeichnen könnte, das ist für mich ganz bewußt die Verwendung minimaler mimischer und gestischer Mittel im Gedicht. Im Gedicht, das zu Recht „Sprechgedicht“ genannt wird, man könnte auch sagen „Vortragsgedicht“, im Gedicht, das einem Publikum vorgeführt wird.
Werde ich noch ein Stück schreiben? Dies ist eine Frage, die in die Zukunft gerichtet ist. Der Gedanke daran, oder die Neigung dazu, wäre vorhanden. Ich werde aber zweifellos in der Zeit, die mir noch zur Verfügung steht, ein Lyriker bleiben, der das eine oder andere Theaterstück geschrieben hat, auch wenn ich noch ein weiteres Stück oder – ich kann keine Zahl nennen – mehrere Theaterstücke schreiben sollte. Hier würde ich zum Beispiel den Typus T.S. Eliot sehen, der für mich ein Lyriker ist, und der einige hervorragende Theaterstücke zu schreiben imstande war. Sie nur zu schreiben imstande war, weil er ein hervorragender Lyriker war.
Paschek: „Kunst als Verfahren“ und Kunst im Verhältnis zu existentiellen Erfahrungen: Ihr Gedicht, „wien: heldenplatz“ beispielsweise, ist mehrfach zu erklären versucht worden, auch von Ihnen selbst. Solche Studien haben gezeigt, daß dieses Gedicht nur scheinbar, oberflächlich gesehen, ein Text in einer verfremdeten Sprache, eine Art von Lautgedicht ist, daß vielmehr dahinter eine sehr intensive persönliche Impression steht. Läßt sich dieser Befund auch an anderen Gedichten verdeutlichen?
Jandl: Ganz gewiß. Etwa eine persönliche Erfahrung der zufälligen Art in dem Gedicht „thechdthen jahr“. Das wurde notiert während einer Straßenbahnfahrt 1957: ein Gespräch zweier Frauen beim Vorbeifahren an dem damals „Südostbahnhof“ genannten Bahnhof (jetzt spricht man nurmehr von „Südbahnhof“). Das, was ich von dem Gespräch unmittelbar in der Straßenbahn notiert hatte, bedurfte kaum einer Veränderung, es war nahezu bereits das Gedicht. Natürlich treten dann Dinge hinzu. Eine der beiden Frauen hatte einen S-Fehler, sprach also das S so aus, wie man das englische stimmlose th ausspricht. Das nun festzuhalten, eben durch das englische th, war natürlich ein Einfall. Aber die Beobachtung hatte mir das zugetragen.
In dingfest steht ein Gedicht aus dem Jahre 1953, es heißt „lebensbeschreibung“ und enthält wiederholt die Zeile „ich habe dietrich geheißen“. Dieser Dietrich, der hier neben seinen Eltern erwähnt wird, war einer meiner engsten Freunde während der letzten Jahre auf dem Gymnasium. Wir waren es, die gemeinsam die Wiederkehr der modernen Künste mit Ende des Zweiten Weltkrieges erhofften. Ich blieb leider der eine, der einzige von uns beiden, der das dann tatsächlich erreichen konnte, weil Dietrich Burkhard 1944 im Krieg ums Leben kam.
Auch manches andere Beispiel zeigt eine so direkte und offene Behandlung von etwas Erlebtem, daß der Vergleich mit „wien: heldenplatz“ schwierig wird. Denn dieses bietet sich dem Leser oder Zuhörer zuerst einmal als ein doch etwas verschlüsseltes Gedicht an, obwohl, auch wenn jemand es zum erstenmal hört, noch während des Sprechens eine Abfolge von Erkennen dieser: Vorgänge beim Hörer einsetzt, vorausgesetzt, dieses Gedicht wird richtig gesprochen, mit der entsprechenden Emphase, mit der entsprechenden Expression an den richtigen Stellen.
Im selbstporträt des schachspielers als trinkende uhr gibt es ein Gedicht, „Die kühe“. Da wird in die gegenwärtige Situation des Autors, der an der Schreibmaschine sitzt und dort seine Gedichte herunterklappert oder nicht, eine Szene aus dem Kriege, an der Westfront, eingeblendet:
eingespannt in den leichenwagen meiner schreibmaschine
und jetzt kommt ein völliges Umschlagen:
während eine nach der anderen die tretminen explodieren
unter den hufen der kühe, angetrieben von den amerikanern
in unsere richtung, worauf wir
endlich wieder fleisch in unserem essen verspüren
Hier verbindet sich der gegenwärtige Moment, meinetwegen das Jahr 1981 oder 1982, ganz bildhaft mit einem Moment aus dem Ende des Jahres 1944 oder Januar 1945.
Ich glaube, daß man sehr viele Gedichte bei mir finden wird, in denen für Leser oder Zuhörer ganz deutlich wird, daß hier persönliches Erleben verarbeitet ist. Wobei die Grade der Verarbeitung, die Grade der Verfremdung, die Art, womit das Erleben gekoppelt ist, welche Erlebnisse, oft über große Zeiträume hinweg, miteinander verkoppelt werden, sich von Gedicht zu Gedicht ändern.
Paschek: In Ihren Veröffentlichungen lassen sich zwei Bereiche unterscheiden – wie Sie selbst es auch, im Bewußtsein der Unexaktheit aller solcher Definitionen, tun: die konventionelle Seite (bei Ihnen: „Gedichte in Normalsprache“) und die experimentelle Seite (bei Ihnen: „autonome Gedichte“). Zu den frühen Arbeiten mit Laut- und Sprechgedichten, zu der Radikalisierung des Verfahrens durch Sprachexperimente und Versuche mit graphischen Gestaltungen tritt in jüngerer Zeit die Auseinandersetzung mit den Expressionsmöglichkeiten der „heruntergekommenen“ Sprache. Daneben gab es immer Gedichte in „grammatikalischer“ Sprache. Neuerdings, scheint es, vermehren sich die überkommenen Formen (die Metapher, die Parodie; der Reim tritt häufiger auf). Bei den älteren Gedichten konnte man auch den Eindruck einer methodisch kontrollierten Kälte haben, später wird das Wiederauftreten „innerer Motive“ deutlicher. Wie läßt sich das Verhältnis der beiden erwähnten Bereiche zu einander beschreiben?
Jandl: „Methodisch kontrollierte Kälte“ – ich würde das als methodisch kontrollierte „Wärme“ bezeichnen. Ich würde auf jeden Fall diesen Begriff der „Kälte“ von mir weisen. Denn ich war eigentlich in allem, was ich geschrieben habe, auch in den Sachen, in denen ein konstruktivistischer Zug im Vordergrund sichtbar ist, als ganzer Mensch mit seinem ganzen Erlebnisinhalt dabei. Ich habe niemals den Versuch unternommen, Dinge einfach zu berechnen oder von meinem Herzen total abzutrennen, sondern mein Blutkreislauf hat diese Dinge immer mit einbezogen. Genauso wie die Gedichte, die offen von meiner eigenen Situation oder von eigenen Erlebnissen sprechen, offen für jedermann, sind auch die Gedichte in laut und luise oder in sprechblasen erlebte Gedichte. Wobei das Erleben bestimmter sprachlicher oder poetischer Möglichkeiten für mich gar nicht getrennt war vom sonstigen Erleben, von einem Erleben am selben Tag als Lehrer, als Freund, als Mensch, der dieses und jenes tut, auf den Dinge eindringen.
Es hat Phasen gegeben, in denen mich die Möglichkeit, mit Sprache konstruktiv umzugehen und zum Beispiel visuelle Gebilde herzustellen, mehr aufgeregt und beschäftigt hat, als in anderen Phasen, ohne daß ich deswegen das Gedicht aus meinem Blickfeld gelassen hätte, ohne daß ich mir gesagt hätte: Du hast jetzt mit deinem konstruktivistischen Gedicht etwas gemacht, das soll fürderhin deine Marke sein, und solange nicht etwas Vergleichbares, etwas, das in diese Kategorie fällt, von dir gemacht werden kann, machst du entweder nichts oder du behältst die Sachen in der Schublade. So habe ich meine Aufgabe als Schreibender von Gedichten, die von mir an mich gestellt wird, nie gesehen.
Ich weiß, daß das Schreiben eine situationsabhängige, eine situationsgebundene Sache ist. Und meine Situtation heute im Jahre 1984 ist eine andere, als sie 1968 war, und eine andere, als 1957 oder 1952 war. Das ist verfolgbar anhand der Gedichte.
Paschek: Welche Funktionen haben – aus Ihrer Sicht – die Datierungen in Ihren Gedichtbänden, teils in den Inhaltsverzeichnissen, teils auf den Seiten selbst?
Jandl: Das Datieren hat eine ganz praktische Wurzel, es hat zu tun mit Fragen der Präzedenz, die irgendwann einmal innerhalb der sogenannten konkreten Poesie aufgetaucht sind. Als ich laut und luise 1966 veröffentlichte, waren keine Daten angegeben. Als das Buch fünf Jahre später in der Sammlung Luchterhand herauskam, waren im Inhaltsverzeichnis alle Gedichte, bei denen ich noch ein Datum vorfand, mit dem Entstehungstag datiert. Dazu kam noch eine Aufstellung der ersten Veröffentlichungen oder der ersten Lesungen. Dies hat einfach damit zu tun, daß es einmal eine Phase gegeben hat, in der auf Seiten der kritischen Rezipienten eine gewisse Unklarkeit bestand, wann was eigentlich entstanden sei. In der ersten Ausgabe von laut und luise steht im Nachwort von Helmut Heißenbüttel: „Gedichte von Ernst Jandl, verfaßt am Beginn der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts“ – das war natürlich für die Kritiker oder für die Literaturwissenschaftler zu wenig.
Eine wirkliche Funktion haben diese Daten auch in der bearbeitung der mütze, weil man sieht, daß hier, etwa in der Mitte der siebziger Jahre, eine neue experimentelle Welle eingesetzt hat, die Verwendung der sogenannten „heruntergekommenen“ Sprache.
Wieder eine andere Funktion hat die Datierung im gelben hund. Dieser Band versammelt Gedichte aus einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum, aus zwei oder drei Jahren, und reiht sie chronologisch, was dem Ganzen eine Art von poetischem Tagebuchcharakter gibt. Daher scheint mir dort die Datierung eine wiederum andere Funktion zu erfüllen.
Es gibt auch Einwände gegen diese Datierung, Einwände, die von außen kommen. Im selbstporträt des schachspielers als trinkende uhr habe ich das Datieren weggelassen. Ich vermisse es nicht.
Man darf nicht außer acht lassen, daß zwischen der Niederschrift der Gedichte in laut und luise und dem Erscheinen des Buches eine verhältnismäßig lange Zeitspanne lag, worauf ich keinen Einfluß hatte. Ich hätte natürlich fast alles in diesem Buch schon Ende der fünfziger Jahre veröffentlicht. Es dauerte aber – es war ein mühsamer Weg – bis 1966, ehe es herauskam. Das Manuskript hatte ich bereits 1963 an Reinhard Döhl und Helmut Heißenbüttel weitergegeben, aber dann vergingen immer noch drei Jahre, bis das Buch endlich erschien. Denn viele Verlage sträubten sich, Literatur dieser Art zu veröffentlichen. Erst Mitte der sechziger Jahre kam die Welle der konkreten und experimentellen Poesie in den großen Verlagen – bis zu jenem Moment, wo dies alles wieder aus war.
Der Begriff der „experimentellen“ Poesie, den ich ständig verwendete und auch heute noch verwende, hat etwas Fragwürdiges an sich. „Konkrete“ Poesie konnte man definieren, und man konnte auch, wenn man wollte, von „konkreter Poesie“ im engen Sinn oder von einer „erweiterten konkreten Poesie“ sprechen. „Experimentelle“ Poesie läßt sich nicht definieren. Gerhard Rühm wandte sich schon 1957 gegen diesen Begriff. Denn was als Gedicht der Öffentlichkeit geboten wurde, war ja eine fertige Sache und kein Experiment mehr. Natürlich, man versuchte dieses und jenes, aber solange man noch im Stadium des Versuchens war, war eine Sache noch nicht abgeschlossen. Sobald sie abgeschlossen war, in welcher Form auch immer sie hervortrat, war sie kein Experiment mehr.
Paschek: Sie treten immer wieder mit Ihren Werken in Lesungen auf. Haben Sie Vorstellungen von Ihrem Publikum? Beim Schreiben? Beim Vortragen?
Jandl: Man wird manchmal gefragt, ob man beim Schreiben an „das“ Publikum oder an „ein“ Publikum oder an eine Zielgruppe denke. Ich würde das alles verneinen.
Aber: Für mich ist es von größter Wichtigkeit, daß ich die Gelegenheit habe, meine Arbeiten, soweit sie zu sprechen sind, einem Publikum vorzutragen. Der direkte Kontakt mit einem Publikum ist für mich von größter Wichtigkeit, nicht bei der Herstellung der Texte, aber sobald sie vorhanden sind. Es gehört für mich zur Verbreitung des Textes nicht nur das Buch, nicht nur die Schallplatte, sondern auch ich selber gehöre unbedingt dazu. Und ich brauche in gewissen Intervallen – ich kann nicht ununterbrochen auf Lesereise gehen – diesen engen Kontakt mit dem Publikum.
Wobei ich sagen muß: Ich weiß nicht, und will es auch nicht wissen, wie weit meine Erfahrungen mit Publikum auf meine Produktion einen Einfluß haben. Sie werden sicher einen Einfluß haben, aber das muß dann eine Sache sein, die aus dem Unbewußten her gesteuert wird.
Im Kontakt mit dem Publikum dringt vieles in mich hinein, und manches davon, ganz sicher, bleibt in mir und wirkt weiter. Nur gehöre ich nicht zu den Schreibenden, die sich fragen, wie das Publikum dies oder jenes aufnehmen wird.
Paschek: Wie könnte man das Verhältnis von Intellektualität und Sinnlichkeit in Ihren Arbeiten andeuten, die sehr bewußte und konstruktivistische Elemente einerseits, nicht immer dechiffrierbare empirische Elemente andererseits enthalten?
Jandl: Ich kann nur schreiben, wenn ich völlig präsent bin, wenn ich völlig „anwesend“ bin. Das heißt: mit allen meinen Funktionen, mit meinem Intellekt, mit meinem emotionalen Bereich, mit dem, was man als sinnlichen Bereich ansprechen könnte.
Das gleiche gilt dann für die Wiedergabe eines Gedichts oder irgendeines Textes, den ich natürlich denkend und sprechend, aber im Grunde mit meinem ganzen Körper wiedergebe. Es ist mir der Gedanke eigentlich unmöglich, oder, wenn er mir möglich wäre, wäre er mir unerträglich, daß ich als Schreibender irgendeines Textes etwas von dem, was ich als denkender, fühlender, reagierender Mensch bin, unterdrücken müßte, um einen bestimmten Text zu gestalten. Das ist mir ein unnatürlicher Gedanke.
Es gibt von mir Gedichte, in denen einzelne Punkte kontrollierbar sind. Wo man sozusagen ein Lineal anlegen kann und sieht: Das ist eine ganz gerade Linie. Und es gibt von mir Gedichte, wo ich ganz bewußt ein unkontrollierbares Element mit einbezogen habe. Das kann natürlich auch schief gehen. Aber gerade in den letzten Jahren war es für mich von großem Interesse, letzten Endes Unkontrollierbares in das Gedicht hineinzunehmen, dem Gedicht Möglichkeiten zu geben, etwas zu enthalten, das nicht bis zum letzten Punkt rational kontrollierbar ist.
Paschek: Angesichts der aleatorischen Strukturen in Ihren Gedichten ist viel von „Spiel“ und „Spielcharakter“ dieser Arbeiten zu lesen. Wie waren, generell, Begriffe aus der neueren „Spiel“-Theorie auf Ihr Werk anwendbar?
Jandl: Um beim Gedicht zu bleiben: Ein Gedicht ist für mich deshalb eine so wichtige Form, weil sie überschaubar ist, und weil im Gedicht, wie in einem gemalten Bilde, in einer Graphik, Möglichkeit da ist, innerhalb eines Rahmens etwas zu machen, das sich von sich aus als Kunst deklariert. Es ist natürlich beabsichtigt als Kunstwerk, aber es deklariert sich auch als ein solches. Ich glaube, daß Gedichte ohne die Möglichkeit des Spiels, für den Autor wie für den Leser, nicht erzeugt werden können. Ich kann mir nicht vorstellen, daß ich an das Schreiben eines Gedichtes herangehen könnte und die Möglichkeiten des Spiels völlig ausschließe.
Auch traditionelle Formen sind, meines Erachtens, nur verwendbar, wenn man als Produzierender eine Neigung hat, mit Sprache zu spielen. Ich muß, zum Beispiel, wenn ich ein Sonett schreibe, nicht nur erfinden, sondern ich muß auch Wege finden, ich muß sozusagen meine Steine auf einem Brett, das völlig fixiert ist, ordnen. Wenn ich ein klassisches Sonett nehme, da weiß ich, das sind zweimal vier und zweimal drei Zeilen, es ist ein jambischer Fünftakter, ich kann mir noch eine bestimmte Reimstellung vorgeben: Das sind nun die Spiel-Regeln, hier muß ich nun spielen. So hat Shakespeare gespielt, als er seine Sonette geschrieben hat, und jeder, der Sonette geschrieben hat.
Paschek: Sie schreiben jedoch kaum Sonette.
Jandl: Ich mache kaum welche, aber zum Beispiel Gerhard Rühm hat einen Sonettenkranz geschrieben, der ganz beachtlich ist, „Dokumentarische Sonette“, die diesen Spielcharakter deutlich zeigen.
Ich kann mir natürlich vorstellen, ein Gedicht zu schreiben, ohne daß man während des Schreibens die Neigung zum Spiel verspürt, etwa wenn es ein Gedicht ist, das in einer Situation entsteht, wo man sich elend fühlt, und wo man dieses Gefühl als Material, als Stoff für das Gedicht verwendet. Aber selbst dann ist dieser Spieltrieb latent da.
Wenn jedoch das eng verwandte Wort „Spielerei“ ins Spiel kommt – und das ist mir auch schon einige Male vorgeworfen worden –, dann ist das allerdings eine Sache, die ich ganz weit von mir weise. Denn ein Spiel verläuft nach Regeln. Das können Regeln sein, wie beim Schach, die Jahrhunderte alt sind, oder es sind Regeln, die ich mir selber erst beim Schreiben eines Gedichtes erarbeite. Unter Umständen ist das eine Regel, die nur für ein einziges Gedicht gilt, und nur einmal verwendet wird, und dann ist das Spiel ausgespielt. Ein Spiel ist immer auf ein Ziel gerichtet, Spielerei geht ziellos vor sich.
Paschek: Wie sehen Sie Ihr Werk im Verhältnis zur sogenannten Nonsense-Dichtung?
Jandl: Was Nonsense-Dichtung betrifft, so glaube ich, daß dies eine eigene Sache ist und daß es ganz schwierig ist, ein gutes Nonsense-Gedicht zu schreiben, zum Beispiel in der Art eines Limmericks. Es gibt wunderbare Nonsense-Gedichte, und wenn mir in meiner jahrzehntelangen Produktion das eine oder andere echte Nonsense-Gedicht gelungen sein sollte, dann kann ich nur glücklich sein. Ein Nonsense-Gedicht entsteht in der Absicht, ein Nonsense-Gedicht zu schreiben. Es gibt wahnwitzige Anthologien von angeblicher Nonsense-Poesie, in denen man zum Beispiel Lautgedichte von Hugo Ball findet, die mit Nonsense-Poesie nicht das geringste zu tun haben. Ich glaube, innerhalb der deutschen Literatur haben wir der Nonsense-Poesie zu wenig Beachtung geschenkt. Christian Morgenstern hat eine Reihe wunderbarer Nonsense-Gedichte geschrieben, zum Beispiel „Das große Lalula“, das man als einen Vorläufer des dadaistischen Lautgedichts ansehen könnte, das natürlich nicht als Lautgedicht zu sehen ist, sondern als ein außerordentlich erfolgreiches Nonsense-Gedicht. Während viele Arbeiten von Gertrude Stein, in denen sie den überaus gelungenen Versuch unternommen hat, den Kubismus in den Bereich der Literatur und in den Bereich der Sprache zu tragen, keineswegs Nonsense-Produkte sind, auch wenn sie keinen kontinuierlichen semantischen Verlauf haben. Das ist nämlich der große Irrtum, daß man in dem Augenblick, wo der kontinuierliche semantische Verlauf, den unsere Sprache im allgemeinen nimmt, bewußt verhindert wird – und das ist eine große Anstrengung, das ist eine große Kunst, ihn wirklich zu verhindern –, sagt: Aha, hier ist kein kontinuierlicher semantischer Verlauf, daher ist das Nonsense. Das ist natürlich ganz falsch. Nonsense ist eine eigene Kategorie. Aber vielleicht müssen wir uns das von den Engländern erklären lassen, die wissen, was Nonsense-Poetry ist.
Paschek: Wenn man Ihre Veröffentlichungen des letzten Jahrzehnts kontinuierlich liest/hört, kann sich einem die Beobachtung aufdrängen, da wäre eine Verdunkelung im Sinne des Pessimismus und der Melancholie zu bemerken. Gewiß: Schon die frühe, deutlicher noch die mittlere Periode sind voller Irritationen. Aber jetzt scheinen Zweifel des Autors an sich, an seinem Werk, am Leben klarer wahrnehmbar zu sein. Stimmt das?
Jandl: Ich glaube, daß das, was jemand an etwas beobachtet, sofern er es beobachtet, stimmt. Ich glaube, daß eine Beobachtung immer auch ein starkes subjektives Moment hat und daß ich nur im Einzelfall, am einzelnen Ding mich mit einem anderen darüber verständigen kann, ob das, was er an diesem Ding beobachtet, auch von mir gesehen wird, oder nicht. Ob ich das also auch beobachte.
Mir ist bewußt, daß seit Gedichten in der bearbeitung der mütze, Gedichten wie etwa „von einen sprachen“ oder „von leuchten“, ein pessimistischer Zug deutlich wird, der bis zum heutigen Tag hin sichtbar ist. Das hängt zweifellos mit meiner eigenen Lebenssituation zusammen, damit, wie ich mein eigenes Leben sehe. Womit ich nicht sagen möchte, daß dieser Pessimismus oder auch dieser melancholische Zug etwas mich dauernd Beherrschendes ist. Aber es ist etwas, das sich – soweit ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen kann – für das Gedicht als Motiv verwenden läßt, das kommunizierbar ist, das nicht einem Partner, einem anderen, verschlossen und unzugänglich bliebe.
Ich habe meinerseits die Erfahrung gemacht, daß der philosophische Pessimismus eines E.M. Cioran gerade in Phasen, in denen ich selbst mich in einer sehr gedrückten Stimmung befand, mir aus einer solchen Stimmung heraushalf, vielleicht auch nur dadurch, daß ich mein eigenes Tief in dem von Cioran formulierten Tief gespiegelt und bestätigt fand.
Es ist natürlich nicht vergleichbar: „ottos mops“ ist ein Gedicht, das von vielen Kindern als Modell zum Schreiben von eigenen Gedichten verwendet wurde. Wenn ich davon höre, wenn mir geschrieben wird und wenn mir eine Schulklasse ihre Resultate schickt, so ist das etwas sehr Schönes, etwas Berührendes, etwas, das mich freut. Bei den pessimistischen Gedichten kann eine Resonanz dieser Art nicht erfolgen. Sie erfolgt aber da und dort von Einzelpersonen, die sich mir nähern, oder zu denen ich eine nähere Beziehung habe, und von denen ich dann plötzlich höre. Eörsi István, der Gedichte von mir ins Ungarische übersetzt hat, hat mir geschrieben, daß nach dem Tod seiner Mutter, der ihn sehr betroffen hat, gerade pessimistische Gedichte von mir ihm in dieser Stimmung geholfen haben.
Natürlich sind es Gedichte, die etwas Schonungsloses enthalten.
Aber das ist eine Schonungslosigkeit gegen mich wie gegen die Existenz des Menschen überhaupt. Ich glaube, daß dies eine Schonungslosigkeit ist, die andere nicht verletzt, sondern eine, auf die sie zustimmend reagieren können.
Aus: Horst Dieter Schlosser & Hans Dieter Zimmermann (Hrsg.): Poetik, Athenäum Verlag, 1988
Der genaue Orpheus
– Zur Präzision der Mund- und Schreibbewegungen bei Ernst Jandl. –
Zur Illustration des Titels meiner Ausführungen sind vielleicht zwei Beobachtungen nützlich. Die eine kann man machen bei Lesungen Ernst Jandls: seine Vorliebe für umständliche Zeremonien. Er liebt und zelebriert dabei das Aus- und Einpacken vieler Bücher, das Ordnen der Bücher in Stapeln vor sich auf dem Lesetisch; das Ganze wird transportiert in einer uralten Aktentasche, aus der die Leseutensilien hervorgeholt werden. Es ergeben sich so der Habitus und die Attitude eines Gerichtsvollziehers oder Vollzugsbeamten, eines pedantischen Gasmanns. Zu diesen Zeremonien gehören das umständliche Füllen des Wasserglases und die präzis eingehaltenen Lese- und Trinkpausen. Jandl kultiviert bei diesen Auftritten das Image des peniblen Pedanten, dem die Genauigkeit der Zeremonien schon zur Garantie des halben Erfolgs wird. Außerdem scheint es dabei um die Vermeidung alles Chaotischen und Zufälligen zu gehen. Dafür spricht z.B. das genaue Ordnen von Unterlagen und Materialien in Mappen und Ordnern, so wie es Jandl liebt. Die Beobachtungen veranschaulichen das Moment von Genauigkeit und Präzision, sie veranschaulichen es in äußeren Ritualen. Die andere Beobachtung zielt auf das Stichwort Orpheus. Dessen Berechtigung erscheint noch offenkundiger. Jandls Poesie – vor allem dann, wenn sie von ihm selbst vorgetragen wird –, das ist die Rückkehr des Gesangs und der Töne und der Geräusche in die Literatur. In der deutschen Literatur seit Jahrzehnten, möglicherweise seit Trakl und Rilke, seit Hugo Ball und Schwitters sind die Texte von Ernst Jandl der evidenteste Beweis, daß zumindest Lyrik erst in der akustischen Realisierung zu sich selber kommt. Ihre stumme Wahrnehmung realisiert nur einen Bruchteil ihrer Organisation. Die orphische Grundbedeutung von Lyrik wird realisiert durch das laute Singen, das überdies bei Jandl noch stark rhythmisiert erscheint, das ist ein Indiz für die Nähe seiner Texte zur modernen Musik. Für Jandl typisch und charakteristisch ist die Kombination von Pedanterie und Singen. Er erscheint als der pedantische Sänger, als der genaue Orpheus.
Der Name des mythischen Sängers Orpheus ist das Stichwort dafür, daß Jandl an Ältestes anknüpft, daß Jandl Traditionalist ist. Dafür steht sein Gedicht Zeichen aus dem Jahr 1953, das von ihm selbst oft zitiert wird in poetologischen Äußerungen.
zeichen
zerbrochen sind die harmonischen krüge,
die teller mit dem griechengesicht,
die vergoldeten köpfe der klassiker –
aber der ton und das wasser drehen sich weiter
in den hütten der töpfer.
Dieses Gedicht ist eine fünfzeilige Formel für Jandls Poetik, genauer: für die Vermittlung von Traditionalität und Innovation in seinen Texten. Auch wenn die Zeichen und Formeln von Antike und Klassik zerbrochen sind, werden sie registriert als ehedem normsetzend, sozusagen als das Forum Romanum einer historischen Ästhetik, in größter Analogie zu Georg Trakls zerbrechender Verwendung der Antike und ihrer Mythen, z.B. in dem Gedicht „Grodek“.
Die Materialien, mit denen schon die klassische Ästhetik operierte, sind nach dem Zeugnis dieses Gedichts in Moderne und Gegenwart die gleichen; aber sie sind sozusagen frei geworden, gelöst aus alten Normzusammenhängen. Sie werden neu verfügbar und sind und bleiben dennoch orientiert an der vergangenen kanonischen Regelhaftigkeit.
Die Frankfurter Vorlesungen Jandls sprechen von einer „geheimen Übereinkunft“ mit dieser Tradition, und an anderer Stelle dieser Vorlesungen geht Jandl selbst auf eine eigene Äußerung von 1973 zurück, in der er sagte, „daß das Schöne von einst von uns heute das Schöne von heute verlangt“. Das ist eine glasklare Feststellung: Jede Epoche hat ihre eigenen Normen des Schönen; dabei gilt es die der vergangenen Epochen zu kennen und zu achten, denn sie waren damals für die Zeitgenossen die heutigen, die gegenwärtigen, die modernen Normen. Dieser Tatbestand gebietet uns zugleich, eine strikt heutige und gegenwärtige Vorstellung des Schönen zu realisieren, eine strikt gegenwärtige Vorstellung des künstlerisch Authentischen, des ästhetischen Ausdrucks von Zeitbewußtsein. Das Vergangene verlangt nach Jandl das Heutige und umgekehrt. Dieses Konzept bleibt charakteristisch für Jandl, das Konzept einer Dialektik zwischen ehrlich bekannter Traditionalität und rigoroser Gegenwärtigkeit. Jandls Forderung nach Modernität artikuliert sich rigoros, lapidar und drastisch. „Alle Gewöhnung muß aufhören“, so heißt es wörtlich in der Schönen Kunst des Schreibens im Hinblick auf den Sprachgebrauch.
Die Frankfurter Vorlesungen fordern ein „Sagen auf neue Weise“. Nach Jandls Konzeption besteht Kunst darin, Fesseln abzustreifen oder zu sprengen, und zwar gerade dort, wo sie bisher keiner bemerkt hat, so in den Vorlesungen. Die Fesseln, die bisher keiner bemerkt hat, sind bekanntlich die haltbarsten; das Bemerken solcher bisher übersehener Fesseln ist das schwierige Geschäft des Poeten.
Kunst definiert Jandl als „das Ende des Normalen“. Das Normale, so sieht es Jandl, ist die Verfestigung und Verabsolutierung einer nur historisch und relativ gültigen Norm. Sie gilt es in der Kunst zu destruieren. Der Künstler hat es dabei auf sich zu nehmen, für dieses Geschäft „sich anprangern und anspucken zu lassen“, so die Vorlesungen. Woran eine gegenwärtige Kunst zu arbeiten habe, woran er, Jandl, selbst arbeite, das definiert er als eine „projektive Grammatik“ und ein „projektives Wörterbuch“. Er sehe seine Aufgabe darin, an diesem zwei „vorauseilenden Büchern“ zu arbeiten (die Schöne Kunst des Schreibens). Die vorauseilenden Bücher sind diejenigen, die eine spätere Normalität und Norm vorwegnehmen, jetzt schon anvisieren, antizipieren. Es geht Jandl also um Erweiterung und Veränderung, um Bewegung und Beweglich-Halten sprachlicher Möglichkeiten, und zwar sowohl der syntagmatischen als auch der paradigmatischen. Es geht ihm um Erweiterung der Syntax und des Lexikons. Der verfestigten Normalität des Sprachgebrauchs vorauseilen, das Neue antizipieren – wie weit Jandl das bisher schon gelungen ist, zeigt die Tatsache, daß eine Zeile wie „werch ein illtum“ heute schon fast zur Normalität geworden ist, schon fast Klassizität erreicht hat. Projektiv und vorauseilend, das sind für Jandl relative Größen, die immer noch orientiert bleiben an jenem Normalstand, dem man vorausdenkt. Das absolut andere, Neue, Nicht-dagewesene, das voraussetzungslos Experimentelle, das absolut und abstrakt Moderne kann es für Jandl nicht geben. Das wäre z.B. das Gedicht, das die semantische Relation von Sprache vollkommen hinter sich ließe. Dieses im wahren Wortsinn autonome Gedicht hält Jandl für unmöglich. Möglich und denkbar bleibt für ihn, auch als Arbeitsmaxime, nur die „relative Autonomie“. Auch hier erscheint also bei ihm jene charakteristische Dialektik von Traditionalität und innovatorischer Modernität. Die Synthese aus beiden hat für Jandl einen Namen, sie heißt „gründliche Simplizität“ oder „gründliche Einfachheit“. So etwa in der Schönen Kunst des Schreibens:
Alles so einfach wie möglich zu machen, um gerade dadurch die Vielschichtigkeit von allem wirklich deutlich zu machen, könnte man gründliche Simplizität nennen, im Gegensatz zu einer oberflächlichen, die ein Verkleinern und Verniedlichen ist, während in der gründlichen alles seine Erwachsenheit behält.
Diese gründliche Simplizität wird auch anschaubar im Titel der Frankfurter Poetik-Vorlesungen Jandls: Das Öffnen und Schließen des Mundes. Für ihn ist das das praktische und auch theoretische A und 0 von Poesie und Natur, es schließt das laute Sprechen und Singen von Poesie mit ein, es ist Praxis und Theorie des Orpheischen zugleich. Der letzte Schritt poetologischer Reflexion und auch Praxis bei Jandl zielt auf den Gedanken, daß die Theorie sich schließlich selbst aufhebt, daß es keinen irgendwie gearteten theoretischen Gedanken außerhalb des Gedichts geben kann und soll. Poetische Theorie und poetische Praxis, also etwa Frankfurter Vorlesungen und Gedichte, sind für Jandl identisch. Reflexion und poetisches Werk sind nicht trennbar. „Meine Vorlesungen jetzt sind meine Gedichte“, heißt es in den Frankfurter Vorlesungen. Das Gedicht ist zugleich seine Theorie und hat sie nicht separat außerhalb seiner selbst.
Hier liegt z.B. ein Grund für Jandls Treue zu einem besonderen Traditionsstrang, der benannt werden kann mit dem Namen von Gertrude Stein. Jandl sieht bei ihr und durch sie möglich gemacht das Auflösen innersprachlicher Bindungen in der Poesie und die Erkenntnis, daß Poesie möglich ist als ein Aufrufen von Benennungen. In einer solchen Konzeption sind die Wörter gegenüber den Sachen Konventionsbenennungen. Die Wörter definieren und erklären also nicht, sondern sie rufen Benennungen auf. Daher kennt man in einem solchen Konzept auch keine Unterschiede zwischen Theoriesprache und Dingsprache, zwischen Begriff und dem Dingwort fürs Konkrete. Definition, Begriff, Theorie ist gleichermaßen das Aufrufen von Benennungen, die untereinander austauschbar sind: „A rose is a rose is a rose is a rose…“
Auffallend ist die Synthese von Archaik und Modernität im Titel von Jandls Frankfurter Vorlesungen, der Hinweis auf eine ständig sich erneuernde Elementarität. Poesie, Literatur ist bei Jandl „das Öffnen und Schließen des Mundes“. Das ist in gründlicher Simplizität ihre Theorie und ihre Praxis, und das hat sie mit allem Sprechen, allem Singen, allem Atmen, auch dem der Fische, gemein. Jandl selbst hat auf Morgensterns „Fisches Nachtgesang“ hingewiesen. Dieses Öffnen und Schließen des Mundes hat Poesie mit allen gemein, zumindest den Menschen und Säugetieren. Genau darin hat sie den Rang des gründlich Einfachen und Elementaren und des zugleich permanent Aktuellen und Lebensnotwendigen.
Zu verdeutlichen ist das Ganze an zwei Beispielen aus Jandls poetischer Praxis, Beispielen, die zwei grundlegende, neuere Positionen seiner Poetik illustrieren. Die erste ist das Sprechen in „einen heruntergekommenen Sprachen“, das, was man manchmal als Gastarbeiteridiom bezeichnet hat, in Jandls Werk erscheinend seit dem Zyklus „Tagenglas“, der im März 1976 entstand. Ein Beispiel für dieses Sprechen ist das Gedicht „von einen sprachen“:
Schreiben und reden in einen heruntergekommenen sprachen sein ein demonstrieren, sein ein es zeigen, wie weit es gekommen sein mit einen solchenen: seinen mistigen leben er nun nehmen auf den schaufeln von worten und es demonstrieren als einen den stinkigen haufen denen es seien. es nicht mehr geben einen beschönigen nichts mehr verstellungen. oder sein worten, auch stinkigen auch heruntergekommenen sprachen-worten in jedenen fallen einen masken vor den wahren gesichten denen zerfressenen haben den aussatz. das sein ein fragen, einen tötenen.
Das Gedicht führt ein uns allen täglich begegnendes Phänomen vor: Ausländer, die radebrechen, die an unserer Sprache nicht voll teilhaben können, die deshalb oft deklassiert, verachtet, abgelehnt werden als diejenigen, die die schmutzige Arbeit tun und uns die Arbeit auch noch wegnehmen. Ihre Art, Deutsch zu sprechen, stimulierte Jandl zu einem dreifachen Perspektivewechsel: Erstens begreift er ihre Art zu sprechen als eine Bereicherung. Sie eröffnet der deutschen Sprache als System von Regeln neue produktive Möglichkeiten. Sie ist ein Stück der von Jandl selbst intendierten projektiven Grammatik. Zum zweiten sind solche Gedichte für Jandl ein Akt der Solidarisierung mit deklassierten Menschen und der Versuch, ihnen Heimat und Nachbarschaft im Sinne Heinrich Bölls in der für sie neuen Sprache zu verschaffen, ihnen ein legitimes Heimat- und Nachbarschaftsrecht, auch in der Kultur des Landes, in dem sie leben, zu geben, ein Versuch, sich zu ihnen zu stellen. Der Dichter als ein ohnehin von der Gesellschaft beargwöhntes Subjekt, wie Jandl öfter sagt, ist für einen solchen Akt der Solidarisierung mit Deklassierten prädestiniert. (Zur gleichen Zeit ist die Parallelbewegung in Gang gekommen, darin daß Ausländer begonnen haben, in Deutsch zu schreiben.) Der dritte Aspekt eines solchen Verfahrens ist die Tatsache, die von Jandl erkannte Tatsache, daß wir alle radebrechen vor der Realität. Wer will schon sagen, daß sein eigener Grad an Sprachkompetenz näher an die Realität heranreiche als der eines anderen. Wir alle stottern nach Jandl vor dem, was eigentlich zu sagen wäre, und das seit dem Turmbau zu Babel. Elementar zu sprechen, den Mund auf- und zuzumachen, ist das einzige, was Leben garantiert, den Mund aufmachen z.B. auch aus Protest gegen verhärtete Normen, wie Jandl das z.B. mit dem Stück „Die Humanisten“ getan hat.
Die andere Möglichkeit, die Jandl sich erarbeitet hat, ist das Sprechen im Konjunktiv und in der dritten Person. Bekannt geworden als Beispiel dafür ist die sogenannte Sprechoper Aus der Fremde:
sein eigenes stück
das entstehende
sei einfach alltagsdreck
chronik der laufenden
ereignislosigkeit
mit ihm, ihr und dem erwarteten
drei doch kein dreiecksstück
da eros und sexus
er habe den unterschied nie kapiert
nicht länger zu seiner erfahrung zählten
und er strikte mit erfahrung operiere
zum beispiel magerquark und knäckebrot
sie habe inzwischen
den anfang gelesen
und finde ihn fabelhaft
es gehöre zum besten
das er je
geschrieben habe
ob sie nicht bloß
wenn sie das sage
ihn aufmuntern wolle
verhindern
daß er sogleich wieder
in seinen abgrund stürze
daß sie ihm immer noch
aufrichtig
ihre meinung gesagt habe
oder ob irgendein
gegenbeispiel
er nennen könne
daß ihn ihr urteil
überaus freue
beinahe glücklich mache
außerordentlich diese
verwendung des konjunktivs
den sie selbst so liebe
außerdem alles
in der dritten
person
was einige
als sehr gekünstelt
empfinden würden
was es schließlich auch sei
ein dreifacher motor
strophe konjunktiv dritte person
damit sei die sache
so gut wie gelaufen
nur noch auszuschreiben
Es verhält sich hier ähnlich wie bei der „heruntergekommenen sprachen“: Wir radebrechen vor der Realität, wir alle reden syntaktisch unvollkommen und regelwidrig. Zugleich weist Jandl auf ein ihm wichtiges Phänomen hin: eine Realität vor und außerhalb der Sprache ist undenkbar und unerreichbar. Die Realität existiert nur als Sprache, als radebrechende Sprache, als erzählte, als indirekt im Konjunktiv reportierte und kolportierte. Selbst die widerwillig sich zu ihr, der Realität, hinneigenden Bühnenpersonen des Stücks sind keine Realität im normalen Sinne: sie selbst, die Bühnenpersonen, sind erzählt, erzählt in der dritten Person und im Konjunktiv. Vor allem in dem, was sie sagen, ist der Hauptsatz weggefallen, der z.B. lauten würde: ,Er sagte…‘ oder ,Er meinte, daß…‘ usw. Aber selbst wenn der Hauptsatz und sein Subjekt bekannt wären, blieben sie immer noch in der dritten Person: Sie oder Er. Es gibt kein Ich und kein Du in diesem Stück und keinen Indikativ.
Die Realität ist reportierte, sie ist nur als geredete und erzählte denkbar. Es gibt alle Wirklichkeit nur als in der Sprache gesprochene und erzählte, und die Sprache distanziert uns von aller Wirklichkeit gründlich und total, distanziert uns auch vom anderen Menschen und Partner. Wir selbst leben als Erzählte, erzählt von einer uns ungreifbaren Instanz, die als Subjekt im Hauptsatz unbekannt ist. Wir stammeln und radebrechen vor der Realität, und zugleich und dennoch wird Realität nicht anders erfahrbar ist Realität nicht anders vorhanden als durch Sprache. Deshalb ist das Öffnen und Schließen des Mundes doppelsinnig, nämlich: zum einen klappen wir vor dem Nicht-Sagbaren oder dem Schwer-Sagbaren ohnmächtig mit den Kiefern; zum anderen haben wir nicht anders Berührung mit der Realität als durch Sprechen, durch Auf- und Zumachen des Mundes.
Da diese Mundbewegung zugleich das Atmen ermöglicht und das Essen und Trinken und den Kuß, hat Jandl sie – wie mir scheint, zu Recht und ganz konsequent – als das Elementarste in die Mitte seiner Poetik gestellt. Damit landen wir bei einer Paradoxie. Der für viele abseitigste und unverständlichste Autor – Jandl ist es vielleicht deshalb, weil er jenes Elementare und Lebensnotwendigste mit den elementarsten Mitteln erfahrbar macht, z.B. auch den unartikulierten Schrei, der in jedem Familienstreit seine große Rolle spielt. Wir alle sind wahrscheinlich auf einen so literarischen Begriff von Literatur und auf einen so ästhetischen Begriff von Schönem eingeschworen, daß wir mit dem Auf- und Zumachen des Mundes mehr Probleme haben als etwa ein Karpfen.
Klaus Jeziorkowski, aus: Horst Dieter Schlosser & Hans Dieter Zimmermann: Poetik, Athenäum Verlag, 1988
Ernst Jandl und seine Götterpflicht
ach herzzerreißende Welt ich weiß es ist alles ganz anders – es ist alles ganz anders, telephoniert er mir, und springt in meiner Vorstellung als Kind durch blendend weiße Narzissenwiesen, Halbmonde auf der Stirn, es geht uns alles ab, telephoniert er mir, und wir wollen eine volle Kompensation im literarischen Bereich, aber man sollte sich dessen bewußt sein, daß man sich auf ein sehr riskantes Spiel eingelassen hat, das einem nicht immer Gewinne anzubieten hat, und es gibt Stunden, in welchen man sich tatsächlich fragt WAS HABE ICH DA BEGONNEN, WORAUF HABE ICH MICH DA EINGELASSEN, und das sind nicht immer die besten, und man hat sein ganzes Leben für die Literatur eingesetzt, und es kommt noch immer nichts heraus dabei – seine Vorzüge sind im ganzen so glänzende daß man ihm keine Fehler nachweisen könnte, seine Geistigkeit flößt mir Liebe und Hochachtung ein, er ist eine angenehme Gesellschaft, ein Meteor in einer Dunkelheit, er ist ein freier Geist, ein Meister der Konzisheit, der Sorgfalt, der Ordnungsliebe, er ist cholerisch (wie es sein Vater war), er ist melancholisch gelassen, zuweilen wird er von einer Besessenheit emsiger Akkuratheit, von einer ängstlichen Penibilität erfaßt, niemand kann ihn da erlösen, er klebt eine Briefmarke auf und es ist eine heilige Handlung, mit zwei blaß blauen Falterflügeln, Halbmonde auf der Stirn, sehe ich ihn als Kind, auf vergilbten Photos, das sind die Flügel seiner Kindheit, er sieht darauf seiner früh verstorbenen Mutter ähnlich die hätte ich immer gerne kennengelernt, wahrscheinlich hätte ich mich gut verstanden mit ihr, was für ein Stammbaum, ruft er, und meint die Teerose, ich habe ihm eine einzelne gelbe Rose auf den Tisch gestellt, er hütet sein Medikamentenarsenal, hält es vor mir versteckt, und im Wiener Arsenal haben ja auch seine Großeltern von Mutterseite gelebt, sein Profil zeigt jetzt noch manchmal den Kopf jenes Kindes auf dem Photo, die weit geöffneten Augen, der weit geöffnete Mund und während er seine hinreißenden Verse hinaus schmettert; seine Augen können aber auch traurig blicken, blaugraue Blumenbälle. Blumen im Zimmer liebt er so sehr, daß er sie bis zu ihrem äußersten Verwesungszustand im Glase beläßt, die wenigsten kennt er mit Namen, und was die Liebe zu den Tieren angeht, ist es ein Anliegen von ihm seit es ein Anliegen von mir ist, er ist auch ein Pflichtmensch. Seine blaugrauen Augen können ängstlich blicken, aber meist ist er unangreifbar solide in seinem Geist und Gesicht, ein streitbarer : ein friedenstiftender Geist, ein spontaner : ein zurückhaltender Geist, mit seiner Stimme kann er fast alles, er ist für alles kompetent, oder scheint es zu sein, er ist voll Vielfalt, er ist voll Bedächtigkeit, er ist voll Bescheidenheit, er ist voll Würde, er ist voll unbestechlicher Radikalität, er hat Löwenkräfte, er ist furchtlos, ausdauernd, beherzt; seine Gedanken so feingliedrig dennoch festgefügt und facettenreich so daß sein Facettenauge – ich meine, keine Philosophie darüber!, ach ganz gemein und gewöhnlich bin ich in meinen Gedanken wenn ich sie an den seinen messe, ich schneide schlecht ab, ich stehe mit leeren Händen da, bin unbeständig und unentschlossen, meiner nicht sicher, er hingegen so eine Existenz – du bist so eine Existenz, rufe ich, worüber er Tränen lacht. Mit seinen Facettenaugen sieht er die Welt jeden Augenblick neu, von einem Augenblick zum anderen verändert sich seine Welt, verändern sich seine Menschen, die Nachtstunden sind seine inspiriertesten, das sind Kostbarkeiten die er von sich gibt, man müßte immer gleich alles aufschreiben.
Es muß wohl so sein daß man einander zuweilen Schmerz zufügt, also der fortschreitende Altersprozeß macht auch ungerecht oder gleichgültig für einander, zwei weiße Hunde dabei, two beagles, Englisch schreibt er wie Deutsch, aber nicht von daher ist der Mops gekommen, nicht von daher der Mops im Gedicht, sondern aus seiner Liebe zu den Vokalen. Du machst ein Gesicht, sagt er zu mir über den Gasthaustisch wo wir nachtmahlen, als würdest du wieder irgend einen Hund sehen, in den du dich verliebt hast… wie stehe ich da, ein Gefühl allgemeiner Erniedrigung hat mich erfaßt, eine Subordination auf allen Linien, als literarischer Underdog grüße ich aus meiner Versteinerung, usw. Ich habe es ja immer schon mit den Hunden gehabt, usw., nosing the path… aber das ist alles ganz anders, auch spielt die Zeit keine Rolle, wir kennen einander schon seit ewigen Zeiten, Elefantenmusik, ich meine seine große Liebe gehört der Musik, namentlich der Jazzmusik, als ich in den Sechzigerjahren anfing, für Rockmusik zu schwärmen, belächelte er meine Begeisterung, wurde aber bald darauf selbst davon angesteckt, inzwischen bin ich wieder zu Chopin, Brahms, Schubert, Schumann und Bach zurückgekehrt, neuerdings habe ich Satie für mich entdeckt, er aber auch, so kreuzen sich unsere Vorlieben ein wenig vordergründig nicht wahr, oder dem Herzen Beine gemacht, denn die Wirklichkeit ist immer ganz anders. Ein Wort vor ihm zur unrechten Zeit kann die beste Stimmung über den Haufen werfen, ein unpassendes Wort kann einen ganzen Abend zerstören, die Unterhaltung einer Freundschaft ist wie so vieles andere ein Balanceakt, im letzten Paradox seiner Wachzustände bis in die frühen Morgenstunden, Phönix vermutlich eine quälende Morgenröte, ich meine durch die Belehrung in der Musik. Immer schon ist er gegen BELEHRUNG gewesen, er hat immer alles gegen BELEHRUNG gehabt, aber alles für UNTERHALTUNG, AMUSEMENT, ANIMATION wie er sagt, er ist selbst ein großartiger Animator also EINHAUCHER, Atemmensch. Die Esche vor seinem Fenster, die wir beide nicht aufhören können zu bewundern weil sie einst dem spärlichen Erdreich einer Mauerritze entsprungen ist, wächst ihm ins Zimmer, wie sehr Schreiben etwas Waghalsiges und ein gar nicht immer befriedigendes Unterfangen ich meine UNTERGANG ist, weiß er selbst am besten und man oft davon fortgetragen ist auch manchmal in Krankheit und Erschöpfung. In jüngster Zeit lacht er selten, früher hatten wir das Lachen erfunden, Halbmond oder -bruder, einen halbkreisförmigen Horizont auf dem Grunde seines Aschenbechers zeichnend, er zeichnet gerne und gut, sitzt er vor mir, unsere Übereinstimmung im Fühlen und Denken scheint vollkommen, aber auch unser Auseinanderdenken in manchen Bereichen, er FÜR, ich GEGEN die Trivialkünste, ich GEGEN, er FÜR die puristischen Formen der Konkreten Poesie, er FÜR, ich GEGEN den Free Jazz, etc., also alles Verstehen zugleich ein Nichtverstehen, Fragment eines Schattenarms, vielleicht habe ich mir etwas zuschulden kommen lassen, vielleicht scheitere ich jeden Morgen an mir selbst, aber ich habe wieder in seinen Gedanken gelesen, ich schaue in meinen Wahrheitsspiegel: SEIN AUGENPAAR.
Friederike Mayröcker, aus: Kristina Pfoser-Schewig: Für Ernst Jandl. Texte zum 60. Geburtstag. Werkgeschichte, Zirkular, Sonderheft 6, 1985
Wie man den Jandl trifft. Eine Begegnung mit Ernst Jandl, eine Erinnerung von Wolf Wondratschek.
Ernst Jandl im Gespräch mit Lisa Fritsch: Ein Weniges ein wenig anders machen.
Eine üble Vorstellung. Ernst Jandl über das harte Los des Lyrikers.
Fakten und Vermutungen zum Autor + ÖM + KLG + IMDb + PIA +
Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + weiteres 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Ernst Jandl: Der Spiegel ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Die Welt ✝ Die Zeit ✝ der Freitag ✝ Der Standart ✝ Schreibheft ✝
graswurzelrevolution
Weitere Nachrufe:
André Bucher: „ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt“
Neue Zürcher Zeitung, 13.6.2000
Martin Halter: Der Lyriker als Popstar
Badische Zeitung, 13.6.2000
Norbert Hummelt: Ein aufregend neuer Ton
Kölner Stadt-Anzeiger, 13.6.2000
Karl Riha: „ich werde hinter keinem her sein“
Frankfurter Rundschau, 13.6.2000
Thomas Steinfeld: Aus dem Vers in den Abgrund gepoltert
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2000
Christian Seiler: Avantgarde, direkt in den Volksmund gelegt
Die Weltwoche, 15.6.2000
Klaus Nüchtern: Im Anfang war der Mund
Falter, Wien, 16.6.2000
Bettina Steiner: Him hanfang war das Wort
Die Presse, Wien, 24.6.2000
Jan Kuhlbrodt: Von der Anwesenheit
signaturen-magazin.de
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Karl Riha: „als ich anderschdehn mange lanquidsch“
neue deutsche literatur, Heft 502, Juli/August 1995
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Zum 20. Todestag des Autors:
Gedanken für den Tag: Cornelius Hell über Ernst Jandl
ORF, 3.6.2020
Markus Fischer: „werch ein illtum!“
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 28.6.2020
Peter Wawerzinek parodiert Ernst Jandl.
Ernst Jandl – Das Öffnen und Schließen des Mundes – Frankfurter Poetikvorlesungen 1984/1985.
Ernst Jandl … entschuldigen sie wenn ich jandle.


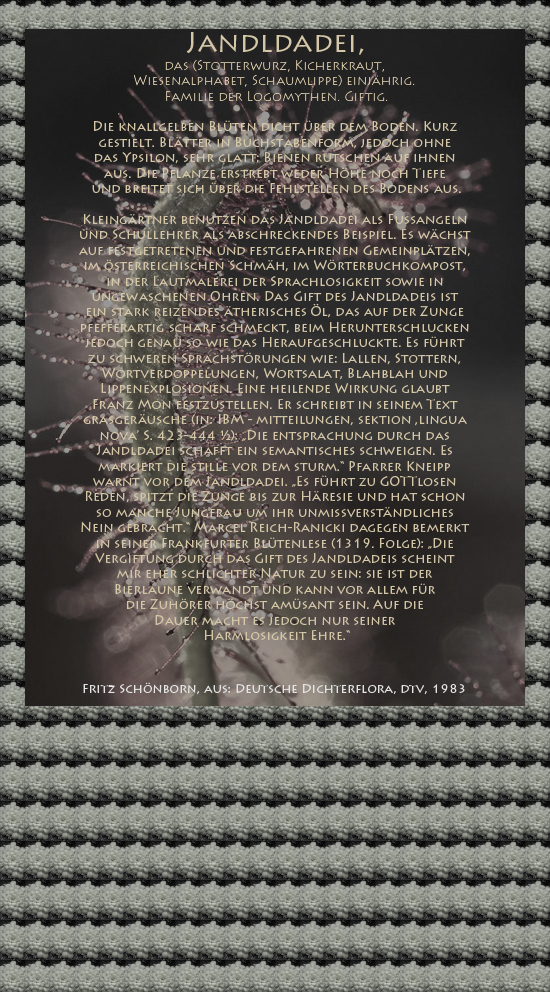












Schreibe einen Kommentar