Thomas Bernhard: Gesammelte Gedichte
HEIMKEHR
Durch die Ebene geht es hinaus,
fremd sind sie alle, der Baum und das Haus.
Mir schwankt das Land, auf dunklen Höhn
seh ich wie Grazien Wolken gehn…
Die Täler fließen in das Grün,
wo sich die alten Bauern mühn.
Die Höfe werden langsam klein.
Bald wir es gut und Abend sein,
bald bin ich dort, nur noch das Band
der Hügel und den fernen Rand,
die Zwiebeltürme, die verstreut
ins Blaue ragen – welche Zeit!
O wunderbarer Augenblick!
Nicht ein Gedanke geht zurück…
Die Welt da hinten war nicht gut.
Noch treibt sie endlos mir im Blut,
und wieder spür ichs, wie sie krankt,
da meine Seele heimwärts wankt…
Fort! Fort! Wie Schuppen fällt das Dunkel ab.
So steigt der Mensch aus seinem Grab.
Das Heu, die Ruh – ich darf hinein –
Fürs ganze Leben soll es sein!
Die erste Veröffentlichung des Dichters Thomas Bernhard
war ein Gedicht: Es erschien am 22. April 1952 im Münchner Merkur und trug den Titel Mein Weltenstück. Die erste Buchpublikation Bernhards war ein Gedichtband: Auf der Erde und in der Hölle. Ein Jahr später, 1958, erschienen gleich zwei Gedichtbände von ihm: In hora mortis und Unter dem Eisen des Mondes. Auch in den Jahren darauf verstand sich Thomas Bernhard vor allem als Lyriker.
Mit der Veröffentlichung seines ersten Romans Frost im Jahre 1963 und der Uraufführung seines ersten Stückes Ein Fest für Boris 1970 schien sich der Autor von der lyrischen Gattung abgewendet zu haben. Doch er arbeitete an seinen Gedichten und ließ in den achtziger Jahren früher geschriebene erscheinen. Dies macht deutlich, daß für den weltberühmten Prosaisten und Dramatiker seine Gedichte eine andere Art waren, sich in der den Autor kennzeichnenden Intensität und sprachlich-bildnerischen Kraft mit seinem Thema auseinanderzusetzen. Das erkannte auch die Kritik: „Da Thomas Bernhard eigentlich erst mit seinen Romanen und kurzen Prosastücken bekannt wurde, hat man den Lyriker Bernhard bereits vergessen. Das ist töricht, denn die verstrüppte Finsternis der Prosa von Thomas Bernhard läßt sich erst durchdringen, wenn man ihre Herkunft kennt, den großen lyrischen Aufbruch.“
Der Band Gesammelte Gedichte enthält alle Gedichtbände von Thomas Bernhard sowie die von ihm selbst in Zeitschriften und Anthologien publizierten Gedichtgruppen.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1993
Unbekannter Dichter
− Thomas Bernhards poetische Paradiese. −
Angefangen hat er wie Nestroy: als Bassist. Beide wollten sie Sänger werden, Nestroy, der Schauspieler, der vielen Zeitgenossen als ein leibhaftiger Teufel vorkam, und Bernhard, der Erzähler und Dramatiker, der seiner Mitwelt die Hölle zeigte, die Verdammnis in den Häusern und Hirnen gleich nebenan. Keinen von beiden kann man sich heute als Sarastro denken, vergoldet und beleuchtet und von Menschenliebe singend, daß die Kronleuchter klingeln. Und doch haben beide jahrelang daraufhin trainiert, und Nestroy hat wahrhaftig noch als Sarastro debütiert. So quälend komisch die Vorstellung von Thomas Bernhard im Aufputz der Zauberflöte oder unter dem Schlapphut Leporellos sein mag, so genau markiert diese erste Ausrichtung doch schon die Linie, auf der sein unbedingtes Kunstleben sich entwickeln sollte. Mit der Zukunftsvision vom Sänger ist die Achse gesetzt, um die herum sein Œuvre wuchs und besessen rotierte.
Jetzt sind Bernhards Gedichte in einem dicken Sammelband erschienen. Geschrieben wurden sie alle kurz vor dem ersten Roman, und es stellt sich die Frage: Ist diese Masse von Versen nun eher dem kleinen Bassisten oder bereits dem großen Autor zuzuschlagen? Die Kritik hat sich auf die Formel geeinigt: „In Bernhards Lyrik sind alle späteren Themen schon da“, und im übrigen auf eine nähere Betrachtung verzichtet. Drei frühe Gedichtbände, die zwischen 1981 und 1988 einzeln wiederaufgelegt wurden, blieben ohne Echo.
Was liegt nun mit diesem Band alles vor? Zunächst einmal muß gesagt sein: Was vorliegt, ist nicht alles. Das listige Spiel, das die deutschen Verlage mit den zwei Wörtchen „gesammelt“ und „sämtlich“ treiben, bewährt sich auch hier. Gesammelte Gedichte heißt für eine weitere Öffentlichkeit zweifellos soviel wie „Sämtliche Gedichte“. Rein sprachlich betrachtet, könnten aber schon drei, vier Texte, die einer zusammengesucht hat, als „gesammelt“ gelten. Der Ausdruck ist im Grunde nichtssagend. Für die Verlage indessen meint er etwas sehr Bestimmtes:
so viel, daß die Leute denken, es sei alles.
Im Editionsbericht betreibt der vorliegende Band allerdings keine Augenwischerei. Volker Bohn, der akkurate Herausgeber, informiert knapp und klar: Zusammengestellt ist hier alles, was zu Lebzeiten des Autors gedruckt wurde. Und man muß Bohn zugute halten, daß er auch über das große Ärgernis orientiert. Ein Typoskript von 144 Gedichten, das den Titel „Frost“ trägt – den gleichen Titel wie Bernhards erster Roman – und das 1961, zwei Jahre vor jenem Roman, vom Otto Müller Verlag abgelehnt wurde, liegt immer noch ungedruckt im Nachlaß. Ebenso verschlossen bleiben „die zahlreichen und eingreifenden Korrekturen“, die der Autor in den achtziger Jahren am Band Auf der Erde und in der Hölle vorgenommen hat.
Der Grund für solche Unvollständigkeit des „Gesammelten“ liegt, und hierüber schweigt der Editionsbericht nun wieder, in Bernhards famosem Testament. Dieses verfügt nämlich nicht nur eine Aufführungs- und Editionssperre für ganz Österreich, sondern bestimmt auch, daß aus dem Nachlaß nichts, schlicht gar nichts veröffentlicht werden darf. Erst nach Ablauf der Schutzfrist im Jahre 2059 also wird der Suhrkamp Verlag die Sämtlichen Gedichte in sämtlichen Fassungen herausbringen. Wir freuen uns alle darauf.
Ganz unbesehen sollte man die verbreitete Meinung, nach der in Thomas Bernhards Gedichten alles schon versammelt vorliegt, was später breit ausgefaltet wird, nicht übernehmen. Zur Vorsicht mahnen läßt insbesondere der Schwierigkeitsgrad dieser Gedichte. Er allein müßte eigentlich die pauschalen Thesen verbieten. Aber Germanisten geben nie gern zu, daß sie etwas nicht durchschauen. Es kommt ihnen vor wie ein Vorstoß gegen die Berufspflicht. Und wo man nichts als Bahnhof versteht, kann man schließlich immer noch sagen:
… leuchtet in die Abgründe menschlicher Existenz.
Bernhards Lyrik gibt sich äußerlich vertraut, bekannt in der Form und wenig neuartig in den Motiven. Sobald man aber mit der strengen Arbeit des Verstehens anfängt, wird deutlich, daß die Gedichte sich der Aufschlüsselung immer wieder entziehen. Fast jedes enthält Momente, ein paar Verse vielleicht nur oder eine Wortverbindung, die der Deutung hartnäckigen Widerstand leisten. Schimmernd und unzugänglich stehen diese Passagen mitten in der deutlichen Rede und strahlen auf sie zurück, durchziehen sie mit einem silbrigen Rätselgespinst.
Dabei gibt es einige Wörter, die auffallend häufig wiederkehren, in den unterschiedlichsten Zusammenhängen, und von denen man vermuten muß, daß sie eine eigene Bedeutung haben, einen genauen Sinn allein für diesen Dichter und diese Gedichte. „Norden“ gehört dazu, „Wälder“, „Vater“, „November“ und „Wind“, auch die Wortverbindung „tausend Jahre“ und nicht zuletzt „Ruhm“. „Ruhm“ ist eine besonders merkwürdige Chiffre. Sie kann fast überall auftauchen und wirkt immer fremd. Sie steckt in den Zeilen wie ein Splitter und kränkt jeden ehrlichen Deutschen. Dennoch ist es denkbar, daß eines Tages ein tüchtiger Kopf den geheimen Zusammenhang dieser Vokabeln aufdeckt und den Code entziffert, den sie zusammen bilden. Aber bis es so weit ist, sollte man die Unzulänglichkeit eingestehen. Die versiegelten Wörter erschließen sich weder aus dem Überblick über alle Gedichte noch aus der Kenntnis des späteren Werks; auch nicht, wie man eine Zeitlang hofft, aus dem Seitenblick auf die da und dort erkennbaren Vorbilder: Verlaine, Trakl, Eliot, Christine Lavant.
Einiges spricht für die Vermutung, daß man über das Studium der Vokabel „Wind“ noch am weitesten in den Sinnzusammenhang des verzifferten Redens gelangen könnte. „Wind“ ist zwar das weit unaufdringlichere Wort als etwa „Ruhm“ oder „Norden“. Es versteckt seine Zugehörigkeit zum hermetischen Diskurs hinter Konventionalität. Wenn man aber einmal gemerkt hat, daß da kein naturlyrischer Gemeinplatz vorliegt, wird es zu einem aufregenden Leitbegriff für die Lektüre.
Wie der wirkliche Wind in einer wirklichen Landschaft immer da ist, bald kaum gespürt, bald stoßhaft blasend, ist die Vokabel „Wind“ in Bernhards Gedichten allgegenwärtig. Sie zieht andere Begriffe an. „Gras“ zum Beispiel und „Vögel“ verbinden sich auffällig mit dem „Wind“. Neben die „Vögel“ treten nicht selten die „Fische“. An einigen Stellen wird nun dieser Wind überraschend deutlich mit der Sprache gleichgesetzt, und es zeichnet sich in Umrissen die alte Spekulation ab vom Geist, der als rauschende Luft aus der Höhe niederfährt und den Erwählten die Zunge löst. Das paßt nicht schlecht zu der seltsam orgelnden Frömmigkeit, die – im Unterschied zum späteren Werk – Bernhards Gedichte bewegt. „Großmächtiges Tabernakel des Windes“, beginnt zum Beispiel ein Text von 1961, „Schrift, nicht zu lesen und nicht zu sterben, / Schrift über Gras und über Totenbetten, / Schrift über mich und Schrift über dich, / Schrift meiner unerforschlichen Kälte…“ Das Tabernakel ist der Ort, an dem das Sanctissimum aufbewahrt wird, für weIches wiederum als eines der ältesten Zeichen der Fisch steht. Ob die folgende Stelle damit zu tun hat?
Ich will die Sprache der Fische hören
und die Sprache des Windes,
die der Sprache der Engel gleicht.
Hier anzuschließen wäre das hymnische „Bruchstück aus einer sterbenden Stadt“:
Die Lichter tönen wie rotes Fleisch
in den Mitternachtsgassen,
und doch ist meine Sprache die Sprache des Winds,
der über den Anger bläst wie am ältesten Tag,
der die Greuel der Wüsten bringt und die Sehnsucht
der trunkenen Palmbäume
nach dem Acker meines Vaters.
In diesen Zeilen ereignet sich unverkennbar ein Akt der Selbstvergewisserung: Ein Dichter findet sich, gewinnt die Sicherheit des Redens, den poetischen Auftrag und die Entschlossenheit zur Arbeit über der Erkenntnis, daß ihm Sprache gegeben ist und daß diese Sprache wahrheitsfähig und unanfechtbar ist. Auf eine fast skandalöse Art erklärt hier ein Autor der finstersten Moderne die Sprache für elementarisch zeitlos. Sie ist wirklich und mächtig und ohne Alter wie der Wind, der um den Planeten braust, und der Dichter hat an ihr Anteil, wie die Alten an ihr Anteil hatten, Vergil zum Beispiel oder Dante. Ave Vergil heißt ein Gedichtband; „Dante, Vergil, Pascal“ werden an einer Stelle gemeinsam angesprochen.
Es sei also vorgeschlagen, das Wort „Wind“, wo immer es in Bernhards Gedichten erscheint, in dieser Perspektive zu lesen. Das ergibt noch lange kein Passepartout für die Interpretation, aber die hermetische Schroffheit mindert sich doch ein wenig. Man fühlt sich nicht mehr so völlig ausgeschlossen und kann nun etwas anfangen mit Stellen wie:
Sprich Gras, schrei in den Himmel mein Wort!
Von Pflock zu Pflock und über das Moos
springen des Windes rote und gelbe Brüder.
Oder:
Wind und Wehen und Wahrheit
über dem Schatten der Welt…
Und wenn die Rede noch so nachtschwarz daherkommt, das Stichwort „Wind“ bewahrt in ihr vielleicht so etwas wie die Möglichkeit von Rettung:
Frühling der schwarzen Blüten, dich treibt
ein endloser Wind von Norden
ein Grab ist mein April…
Wobei man hier nun allerdings noch wissen müßte, was „Norden“ heißt beim Lyriker Bernhard. Und falls überdies die Chiffre „Vater“ entschlüsselt wäre, könnte man sich sogar jedem Gedicht nähern, das der Autor am häufigsten bearbeitet und neu vorgelegt hat, das ihm am Herzen lag wie kein anderes:
Dreitausend Jahre nach dem Vater
starb auf dem Hügel, ich, der Wind,
verbrannter Schädel, ich, der Norden,
die Buchstaben Vergils, die Reden großer Bauern,
dreitausend Jahre nach dem Vater
geh durch mein Land ich, kränkelnd,
mich fröstelt in den Septemberbetten.
Wer diesen Text auslegen kann, hat Zugang zu allen Gedichten Thomas Bernhards!
Fest steht folgendes: Diese Lyrik ist nicht das spätere Werk des Autors in Mikrogestalt. Vielmehr redet sie erstaunlich über die Bedingungen, unter denen dieses Werk entstehen wird. Der Dichter bestimmt sich als einer, der eine Aufgabe hat und angelegt ist auf große Gesänge. Als solcher stellt er sich ohne Zögern neben Vergil – in den gleichen Wind. Das unablässige Reden der großen Romane, die kurz nach diesen Gedichten zu erscheinen beginnen, wird damit erkennbar als entsprungen aus dem Willen, den antiken Gestus des epischen Gesangs wiederzugewinnen – mitten in der brandschwarzen Moderne.
Die Odysseen und Aeneiden, die da entstehen, sind allerdings aus einem „verbrannten Schädel“ heraus psalmodiert, und gesegelt wird nicht durch Stürme und Flauten einer himmelblauen Ägäis, sondern es sind Hirnreisen in geschlossenen Zimmern, verriegelten Häusern oder den immergleichen nassen Waldweg hin und zurück. Die Wogen des Meeres kehren wieder in der Endlosigkeit der zerebralen Konvulsionen, und wo einst Klippen und Tiefenwirbel lauerten, Skyllen und Charybden, Sirenen und Zyklopen, lauern jetzt, ebenso tödlich reißend, die Kollapse des Verstandes, der plötzliche Wahn und der langsame Suizid.
Im Unterschied zu den Romanen und Theaterstücken wissen Bernhards Gedichte noch von beidem: von Paradies und Glück und wohligen Tagen und von der gänzlich verkohlten Welt. Deshalb können sie auch vom Umschlag reden, vom Sturz in die Finsternis. Wo das Attribut „schwarz“ erscheint – und es erscheint fast so häufig wie der „Wind“ −, geht es immer um das Kippen aus dem Paradies in die Hölle. Beides ist unbedingt, ein Äußerstes. Die berüchtigte Absolutheit der Bernhardschen Superlative leitet sich her von der Absolutheit dieser Hölle und dieses Paradieses.
Hinter den Bäumen ist eine andere Welt…, eine schwarze Sonne.
Unter solchem Gestirn wird alles einfarbig: „schwarzes Gras“, „schwarze Blüten“, „schwarze Wälder“. Auch die Sterne sind schwarz, die Hügel und die Vögel.
Da und dort lassen die Gedichte durchblicken, wo das Paradies einst war, der „Morgen ohne Zerstörung“: bei der Mutter. Ihr Tod, scheint es, hat alles eingeschwärzt, auch das Herz, „das einmal im süßen Heu kroch und von raunenden Milchkübeln träumte“. Rührend und vollkommen zugleich ist das Gedicht, in dem der Friedhof mit der toten Mutter zum Garten des Paradieses wird und alles wieder grün sein darf und das Böse sich verkriecht vor einem nackten Kinderfuß:
Im Garten der Mutter
sammelt mein Rechen die Sterne,
die herabgefallen sind, während ich fort war.
Die Nacht ist warm, und meine Glieder
strömen die grüne Herkunft aus,
Blumen und Blätter,
den Amselruf und das Klatschen des Webstuhls.
Im Garten der Mutter
trete ich barfuß auf die Schlangenköpfe,
die durch das rostige Tor hereinschaun
mit feurigen Zungen.
Den autobiographischen Büchern Thomas Bernhards haben sich Kritik und Forschung mit ausschweifender Hingabe gewidmet. Der Lyriker blieb ungehört. Es wäre an der Zeit, dem Klang dieser Stimme das Echo zu verschaffen, das sie verdient.
Peter von Matt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.8.1991
Leuchtspuren durch das Labyrinth
− Die Lyrik des Österreichers Thomas Bernhard erhellt seine Prosa. −
Mit Lyrik debütierte der Schriftsteller, im Laufe seines literarischen Lebens war er als Epiker und Dramatiker erfolgreich. Der Lyriker wurde links liegengelassen. Alle haben daran eine Aktie: Autor, Verleger und Leser. Gemessen an der stattlichen Reihe der Prosabände und Stücke, nimmt sich die einbändige Ausgabe der Gesammelten Gedichte bescheiden aus. Sie macht jedoch seine literarische Biographie komplett.
Die späte Sammlung sämtlicher veröffentlichter Verse ist für alle, die mit dem Erzähler und Dramatiker auf vertrautem Fuße stehen, eine Offenbarung. Die Tür zur literarischen Kinderstube des Thomas Bernhard ist weit geöffnet. Zu sehen ist das ernste, bedrängte Wunderkind, das sich mit heftigen Wortgebärden gegen seine Umgebung wehrt. Die Gedichte des jungen Thomas Bernhard gleichen Glühwürmchen. Sie ziehen Leuchtspuren durch seine labyrinthische epische Literatur. Alles, was an Lebensflucht und Todessehnen, an Lebensüberwindung und Sterbewiderstand bei Bernhard in Prosa und Drama Wortgestalt wird, hat seine Stimmen in den Gedichten.
Bereits die Lyrik markiert die gesamte literarische Landkarte des Österreichers. Familiäre und landschaftliche Herkunft, die Dörfer und Wälder des Flachgaus, die gewerbetreibenden Vorfahren, das dunkel-fremde Ich sind in der Lyrik enthalten. Die Fremdheit des Heimatlichen, die Verlorenheit der Ferne, der quälende Zerfall des Individuums, die Klarheit des Todes konzentrieren die Vokabeln der Bernhardschen Verse. Ständig ist ein finsteres, keineswegs schrecklich-schmerzliches Ahnen über das irdische Gehen und Vergehen in den Gedichten.
Bernhard gibt, wie Ingeborg Bachmann, dem Verstummenmüssen eine Sprache. Es ist die Sprache eines Lyrikers, der die Stufen des Schriftstellers – Sprechen, Schreiben, Schweigen – immer wieder hinabstieg, immer wieder vor dem Abgrund stand, immer wieder den Schmerz spürte, daß keine Stufe die Antwort auf die Welt ist, wie sie ist. Über die Wirklichkeit der Welt ist auch Thomas Bernhard nicht hinweggekommen, solange er in der Welt war. In seinen Versen versuchte er Weltüberwindung zu formulieren, damit die irdischen Stunden erträglicher werden.
Bernd Heimberger, Neue Zeit, 13.5.1992
Thomas Bernhard: Gesammelte Gedichte
Während Bernhards Prosa und Theaterstücke rasch bekannt geworden sind, fanden seine Gedichte wenig Beachtung. Allenfalls wurden sie in ihrem überwiegenden Lamento-Charakter mit den Prosaarbeiten verglichen. Tatsächlich stellt sich Verlegenheit ein. In den frühen Bänden Auf der Erde und in der Hölle (1957), In hora mortis (1958), Unter dem Eisen des Mondes (1958) finden sich so viele motivische und formale Anleihen an expressionistische Lyrik (insbes. auch an Trakl), daß sich der Eindruck des Epigonalen aufdrängt. Und das unüberhörbar Eigene (etwa der Psalmton), vom pathetischen Gestus getragen, wirkt in der unmittelbaren Nähe gleichzeitiger Lyrikproduktion (Celan, Eich, Enzensberger) wenig überzeugend, eher unmodern und wenig formbewußt. Nach 1963, d.h. nach dem Debüt als Prosaautor (Frost), hat Thomas Bernhard keine neuen Gedichte mehr veröffentlicht. Deshalb mutete die Publikation Ave Vergil von 1981, eine Sammlung von Gedichten aus den Jahren 1959/60, befremdlich an. Bernhard begründete die Herausgabe mit der Anmerkung, hier sei eine „Verfassung“ jener Jahre „konzentriert“ wiedergegeben. Bezeugt ist auch die erneute Beschäftigung des Autors mit seiner weiteren frühen Lyrik in den 80er Jahren.
Solche Hinweise könnten als Zeichen gedeutet werden, daß Bernhard seine lyrischen Anfänge aus ganz persönlichen Gründen gelten ließ und sich zu der hinausgezögerten Veröffentlichung der ungedruckten Gedichte entschloß, als er sich mit den fünf sog. autobiographischen Büchern befaßte, deren letztes 1982 erschien (Ein Kind). Die so auffallende Andersartigkeit der Lyrik im Vergleich mit dem übrigen Werk wird die Thomas Bernhard-Forschung ebenso beschäftigen müssen wie deren Eigencharakter.
Dazu lädt der vorliegende Band ein. Er bringt allerdings keine Überraschungen, denn er beschränkt sich auf die gedruckten Lyrikbände und auf diejenigen Gedichte, die Bernhard zu Gruppen geordnet in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht hat, während „die frühen, in Tageszeitungen einzeln publizierten Gedichte nicht aufgenommen sind“ (Nachwort). Aber gerade diese schwerer zugänglichen Einzeltexte hätte man hier erwartet. Der Herausgeber suchte und fand einen Vorwand. Ob jedoch „Zwei Gedichte“ (vier Mal) oder „Drei Gedichte“ (zwei Mal) tatsächlich als eine derart bewußte Gruppierung anzusprechen sind, daß daraus ein „Auswahl- und Anordnungsprinzip“ des Autors abzuleiten wäre, wie im Nachwort suggeriert wird, wird nicht problematisiert. Natürlich erspart man sich mit dem scheinbar legitimen Argument Mühe und Arbeit – „Da (…) noch kein vollständiger Überblick über diese verstreuten Einzelpublikationen besteht…“. Die Editionswissenschaft kennt wahrlich schwierigere Fälle, wir hätten wohl noch etwas warten können. Kurz und rund: die Ausgabe ist nur eine halbe Sache.
Ferdinand van Ingen, Deutsche Bücher, Heft 3, 1991
Die tiefen Spuren der Väter
Das Gedicht muß klingen. Es muß nach-klingen. Dichter heißt: Der die Wahrheit Sagende. Also muß ein Gedicht vor allem wahr und echt sein.
So schrieb ein damals 21jähriger Journalist anläßlich einer Preisverleihung im Dezember 1952 im Salzburger Demokratischen Volksblatt. Eben dieser Journalist hatte wenige Monate zuvor im Münchner Merkur selbst als Lyriker debütiert mit einem Gedicht „Mein Weltenstück“, in dem es u.a. heißt:
Ein Vogel singt, und zwei und drei,
Der Schmetterling fliegt rasch vorbei,
Die Hühner fressen, Hähne krähn,
Ja lauter fremde Menschen gehn
Im Sonnenschein, jahrein, jahraus
Vorbei an unserm alten Haus.
Wohl kaum jemand würde vermuten, daß es sich bei dem Verfasser einer solchen epigonalen Reimerei um Thomas Bernhard handelt, der bei seinem Tode 1989 als Dramatiker und sprachgewaltiger Epiker weltberühmt war. Zwar hatte sich der junge Bernhard von solcher Kitschpoesie (wie sie sich ähnlich übrigens im Frühwerk auch manches anderen nachmals bedeutenden Autors findet) rasch abgewandt, nicht jedoch von der Lyrik. Es ist heute schon weithin unbekannt, daß Thomas Bernhard als Lyriker begonnen hat – und zwar nicht etwa nur mit ein paar verstreuten Versen hier und da in Zeitschriften und Anthologien, sondern mit veritablen Bänden in angesehenen Verlagen.
Die Sammlungen Auf der Erde und in der Hölle und In hora mortis erschienen 1957 bzw. 1958 im Otto Müller Verlag (Salzburg) und Unter dem Eisen des Mondes ebenfalls 1958 bei Kiepenheuer & Witsch (Köln). Später publizierte Bernhard nur noch vereinzelte Gedichte, und nach 1963 – damals machte er Furore mit seinem Romanerstling Frost – erschien so gut wie kein neuer lyrischer Text mehr von ihm. Lediglich zwei ältere, bis dahin unbekannt gebliebene Sammlungen legte Bernhard in den achtziger Jahren noch vor: 1981 das siebenteilige Langgedicht „Ave Vergil“ von 1959/60 und 1988 „Die Irren. Die Häftlinge“, einen Text, der 1962 in Klagenfurt lediglich als Privatdruck erschienen war.
Doch diese frühen Arbeiten wurden gedruckt, als sich Thomas Bernhard offenbar selbst schon historisch zu werden begann. So schrieb er in einer Notiz zu dem höchst manieristischen, an Eliots The Waste Land und Pounds Cantos orientierten alexandrinischen Poem „Ave Vergil“, der Grund dafür, es jetzt (1981) zu veröffentlichen, sei „die in diesem Gedicht wie in keinem zweiten konzentriert wiedergegebene Verfassung, in welcher ich mich gegen Ende der fünfziger – Anfang der sechziger Jahre befunden habe“.
Die persönliche Befindlichkeit des jungen Autors, seine Nöte und Bedrängnisse, sind allerdings den meisten seiner Gedichte in dem immerhin über 300 Seiten starken Band der Gesammelten Gedichte abzulesen, die Volker Bohn jüngst bei Suhrkamp herausgegeben hat. Das heißt aber nicht, daß sie nur von biographischem Interesse sind, sondern auch, daß sie die Herkunft dieses Autors zeigen, die Ursachen seiner später in Prosa und Dramen so eindringlich vorgeführten Obsessionen, die ihn zum (wie man spottete) „Alpen-Beckett“ und „Unterganghofer“ werden ließen.
Nicht wenige Gedichte des jungen Bernhard sind Artikulationen einer existentiellen Bedrängnis, sind – wie er selbst 1981 in der autobiographischen Prosa Die Kälte schrieb – Produkte eines „Verzweifelten der außer diesen Gedichten nichts mehr zu haben schien“. Hier ruft und fleht und klagt ein junger Gottsucher („Warum muß ich die Hölle sehen? Gibt es keinen anderen Weg / zu Gott?“), selbstquälerisch, anklagend, hadernd, erlösungssüchtig. Überdeutlich sind die autobiographischen Elemente, etwa in dem Gedicht des Sechsundzwanzigjährigen, in dem es heißt:
Sechsundzwanzig Jahre
der Wälder, des Ruhms und der Armut,
sechsundzwanzig Neujahrstage und keinen Freund
und den Tod
und immer wieder die Sonne
(…)
Sechsundzwanzig Jahre
in einer einzigen Ungerechtigkeit gegen alle,
versoffen unter den Mostfässern meines Vaters,
in faulen Tälern
verspielt und verlassen mit Gelächter,
nichts als Schnee und Finsternis
und die tiefen Spuren der Väter,
in denen meine tödliche Seele zurückstapft.
Immer wieder liest man in diesen frühen Gedichten des Gerichtsreporters und Musikstudenten Bernhard, der ja Sänger werden wollte, von Tod und Verzweiflung, Zorn und Trauer, Tränen und Wunden, Lüge und Qual, Frost und Kälte. Der thematische Bezug zum späteren Prosawerk ist unübersehbar. Und es scheint sich auch schon eine leichte Monotonie anzudeuten, eine – mit aller Vorsicht gesagt – gewisse Verliebtheit in die eigene Verzweiflung, die in der späten Prosa zu Repetitionen und zu einer bestimmten Routine führten.
Geprägt sind Bernhards Gedichte deutlich von tradierten religiösen Formen, von Litanei und Hymnus, Psalm und Gebet. Im durchaus begrenzten Sprach- und Themenkreis des jungen Dichters haben Pathos und Inbrunst kirchlicher Rituale ebenso ihre Spuren hinterlassen wie Expressionismus und Surrealismus, Trakl und van Hoddis. Als besonders zeittypisch fällt die exzessive Genitiv-Metaphorik ins Auge – von der „Schottergrube meiner Verzweiflung“ über die „Gewässer der Unsterblichkeit“ bis zum „Bier der Verzweiflung“.
Mit der Edition dieser Gesammelten Gedichte Thomas Bernhards kann man nicht ganz zufrieden sein. Daß hier die 144 Gedichte umfassende Nachlaßsammlung Frost nicht publiziert wurde, daß auch nicht die „zahlreichen und eingreifenden Korrekturen“ Bernhards zu Auf der Erde und in der Hölle mitgeteilt werden, ist bedauerlich – aber vermutlich lassen Bernhards rigide Testamentsbestimmungen nichts anderes zu. Nicht einzusehen aber ist es, daß in diese Publikation außer den Gedichtbänden nur die „als Gruppen in Zeitschriften und Anthologien veröffentlichten Gedichte“ aufgenommen wurden (– wobei für den Herausgeber schon zwei Gedichte eine „Gruppe“ bilden –), weil diese „offensichtlich einer Leserschaft über den Tag hinaus zugedacht waren“. Und, so muß man fragen, ein einzelnes Gedicht für eine Anthologie nicht?
So fehlt denn hier leider auch das lange Nonsens-Gedicht „Ahnenkult“, das Bernhard 1977 (!) für einen Almanach des Residenz Verlages geschrieben hatte. Es paßt zwar so gar nicht in das Bild, das man sich vom verzweifelt-todessüchtigen Wüterich Thomas Bernhard macht. Aber wenn man weiß, wie gern er privat alberte, kalauerte und blödelte (und dieser Neigung hat er dann ja auch in den Theaterstücken öfter nachgegeben), mag man auf dieses 18strophige Gedicht nicht verzichten, in dem es heißt:
es germanistelt der Germanist
bis er nicht mehr germanistelt
es slawistelt der Slawist
bis er nicht mehr slawistelt
es verlegt der Verleger
bis er nicht mehr verlegt
es erregt der Erreger
bis er nicht mehr erregt
(…)
es richtet der Richter
bis er nicht mehr richtet
es dichtet der Dichter
bis er nicht mehr dichtet.
Jürgen P. Wallmann, Park, Heft 41/42, Mai 1992
O frivol ist mir am Abend
− Die Erotik eines Lektorats: Ein Salzburger Symposium entdeckt Thomas Bernhard als unbegabten Lyriker. −
3000 Blatt mit Gedichten liegen noch im Archiv. Bernhard zeigt sich dort vor allem als pathostrunkener Dilettant.
Bei den Feierlichkeiten zu Thomas Bernhards 80. Geburtstag durfte auch Salzburg nicht fehlen. Wenn solches nicht überhaupt eine Tautologie ist, dann soll hier der „unbekannte Bernhard“ entdeckt werden. Bei einem Symposium, das immerhin die Herausgeber der Werkausgabe aufbietet, und die sitzen schließlich an den Quellen. Sie können mit kleinen Sensationen aufwarten, wie etwa die zarte Intimität des Briefwechsels zwischen Thomas Bernhard und seiner Insel-Lektorin Anneliese Botond. Tief in die Seele Bernhardscher Texte blickt Anneliese Botond in ihren Briefen, doch mit der Oberfläche hat sie ihre Not. Es ist ein Flehen um Kommas und Konjunktive. Ihnen gilt die „frivole Sorge“ der Lektorin. „Frivol, wie wenn man vor einem brennenden Haus an Seidenstrümpfe oder an einen Hut denkt.“
Am Roman Frost wird drei Jahre, zuletzt in Sonderschichten gearbeitet. Bernhard sitzt in der billigsten Pension Frankfurts, die für ihn noch erträglich ist, nimmt die Vorschläge der Lektorin entgegen und liefert täglich ein paar überarbeitete Seiten an den Verlag. Botond wünscht sich weniger Invektiven, mehr Geschichten „wie die mit dem Hund im Rucksack“. Von harmonischen Gesprächen über Manuskripte zeugen dankbare Briefe, die Bernhard aufbewahrt hat. Von gemeinsamen Wochenenden. Man meint, in manchem nicht nur die Erotik eines strengen Lektorats zu spüren.
Das Salzburger Symposium ist Heimspiel. Draußen Dauerregen. Drinnen gepflegte ältere Damen, deren andächtige Bernhard-Jubiläumsstimmung der Suhrkamp-Cheflektor gleich beim ersten Referat durchkreuzt. Bernhard ein begabter Lyriker? Mitnichten. Ein pathostrunkener Dilettant, dem jedes Gefühl für Form fehlt. Es ist das harsche Urteil eines Mannes, der den Editionsplan der Bernhard-Werkausgabe kennt. 2014 wird es den Band 21 geben. Lyrik. Herausgeber: Raimund Fellinger. 3000 Blatt mit Gedichten liegen noch im Gmundener Thomas-Bernhard-Archiv, und das ist nur der Rest eines Autodafés, das in den Fünfzigern stattgefunden hat. Die Editionsgeschichte von Bernhards Lyrik ist ebenso durchwachsen wie ihr Verkaufserfolg. 1958 werden vom Band Unter dem Eisen des Mondes 1000 Exemplare gedruckt. 1968, also nach dem großen Erfolg von Frost, warten davon noch 739 auf Käufer. Als Lyriker war Bernhard ein Netzwerker, der 1955 mit einem gewissen Sepp Hödlmoser bei der Bundespolizeidirektion Salzburg „Wochen der Dichtung“ anmeldet, deren Autoren er auch gleich noch publizistisch abfeiert. Bei S. Fischer, der dann doch nicht sein Verlag wurde, macht Bernhard Verträge über zukünftige Werke, unter anderem den Band „Dichtung I“. Aber das Selbstbewusstsein bröckelt, bis Bernhard 1961 ein Ende seiner lyrischen Produktion verkündet. Interessant die These, dass er auch aus Gründen des Misserfolgs zum „Antilyriker“ geworden ist, zum formstrengen Prosaisten durch und durch.
Die Gebrauchsspuren in Thomas Bernhards Bibliothek sind unübersehbar. In ihnen lässt sich ein jahrzehntelanger Kampf ablesen, ein Geben und Nehmen, wie Bernhard Judex zeigt. „Armer Trakl, du bist tot“, heißt es da in ironischer Zweideutigkeit. Ein Buch über Karl Marx hat Bernhard besonders intensiv gelesen. Hat sich Stellen notiert, in denen es um das brennende Problem der „Einheit von Theorie und Praxis“ geht. Marx mag in dieser Frage gescheitert sein. Thomas Bernhard hat sie transzendiert. Er war er selbst, durch und durch. Dass er gerne rororo-Monografien lese, ihn die vielen Fehler darin störten, sein darob erhitzter Zorn ihm aber das kalte Haus heize, hat Thomas Bernhard einmal an Rowohlt geschrieben. Die Anmerkung der Verlagssekretärin ist mit dem Briefbogen überliefert: „Ein Verrückter?“
Paul Jandl, Die Welt, 15.2.2011
Thomas Bernhard in meinem Kopf
vor etwa 25 Jahren treffen wir einander erstmals und zufällig im Haus des österreichischen Botschafters in Rom. Man bittet uns, im kleinen Kreis, zu Tisch, wir sitzen nebeneinander. Thomas Bernhard sagt im scherzenden Ton zu mir, „wir sind beide in Österreich schwarze Schafe“, was mir gefällt. Später wird er von einem Tischnachbar gefragt, woran er arbeitet, er sagt, er schreibt an einem Stück mit dem Titel Der Pracker.
Etliche Jahre später, an einem Sommerabend, Ernst Jandl und ich spazieren am Graben, kommt Thomas Bernhard uns entgegen, ich vermute, es war das Jahr in dem sein Buch Holzfällen erscheinen sollte. Ernst Jandl lädt ihn in eines der dortigen Lokale auf 1 Glas Wein ein. Er scheint zuerst einverstanden zu sein, nach einer Weile jedoch lehnt er ab.
Seit damals habe ich ihn nicht mehr gesehen aber immer, und immer öfter, mit großer Bewunderung und Begeisterung gelesen.
Friederike Mayröcker, 1.6.1998, Joachim Holl, Alexander Honold, Kai Luehrs-Kaiser (Hrsg.): Thomas Bernhard – eine Einschärfung, Vorwerk, 19988
Weltenstücke. Der Lyriker Thomas Bernhard
I
Gedichte müssen Fährten aufnehmen, um ihrerseits Spuren hinterlassen zu können. Thomas Bernhards Gedichte haben viele Fährten in sich; Spuren beginnen sie selbst erst zu legen. Diese Gedichte haben Schatten aufgespürt, jene von Krähen etwa,1 von Toten und jenen des eigenen Ichs. Manche der Fährten, die in diese Gedichte eingegangen sind, führen zu den Dichtungen John Donnes, T.S. Eliots, Ezra Pounds, Paul Eluards, zu Cesar Vallejo, Rafael Alberti und Jorge Guillén, wie Bernhard in einer abschließenden „Notiz“ zu seinem 1981 veröffentlichten, aber bereits 1959/60 in England und auf Sizilien entstandenen siebenteiligen Zyklus Ave Vergil vermerkte. Unter Kritikern hatte die Veröffentlichung dieser Sammlung Erstaunen ausgelöst, denn Bernhard war seit 1963 nicht mehr mit Original-Gedichten an die Öffentlichkeit getreten, damals mit zehn Gedichten in der Anthologie Frage und Formel, Gedichte einer jungen österreichischen Generation.2 Dieser Zyklus kann heute aus werkgeschichtlicher Perspektive als einer der wichtigen Übergänge von der Lyrik zur Prosa verstanden werden.3 Die zweite Schnittstelle bildet das nicht publizierte lyrische Konvolut „Frost“, aus dem dann Bernhards erste bedeutende Prosaveröffentlichung Frost wurde.
Inzwischen lässt sich jedoch behaupten, dass zumindest Teile von Bernhards erzählerischem und dramatischem Schaffen sich einer Geburt und Wiedergeburt aus dem lyrischen Material verdanken, bedenkt man die bislang weitgehend unbekannte Fülle lyrischer Texte, die sich im Nachlass gefunden hat. Zu dieser fortgesetzten Auseinandersetzung mit der lyrischen Form gehören auch die zum Teil tiefgreifenden Überarbeitungen der in den fünfziger Jahren publizierten Gedichtsammlungen. Sie kommen einer Selbstrevision des Lyrikers Bernhard gleich, die wohl um 1988 im Rahmen einer zeitweise geplanten Neuausgabe seiner Gedichte stattgefunden hat.
Das Aufspüren der Vorbilder im Vollzug lyrischen Schreibens – dieser Vorgang ist für den Einfluss Rilkes auf Bernhard nachweisbar4 und in einer ungleich größeren Intensität jener Georg Trakls auf den jungen Dichter. Bekannt ist, dass Bernhard schon früh (1957) gerade diesen Einfluss verwünscht hat:
Für die Weltliteratur wird Trakl niemals die Bedeutung der Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé haben […]; für Österreich jedoch hat er bis heute als einziger Lyriker von Rang etwas zur modernen Poesie beigetragen, wahrscheinlich, weil er, wie wenige, verachten konnte und verachtet wurde – am penetrantesten von den Bürgern und Eseltreibern seiner Vaterstadt Salzburg, die sich auch heute noch nicht geändert haben. Der Einfluß Trakls auf meine eigene Arbeit war vernichtend. Hätte ich Trakl niemals kennengelernt, wäre ich heute weiter.5
Drastische Lesespuren Bernhards in seinem Exemplar der Dichtungen Georg Trakls zeigen, wie leidenschaftlich diese Auseinandersetzung mit Trakl geblieben ist; denn vermutlich standen seine betont expressiven Kommentare zu einzelnen Trakl-Gedichten in unmittelbarem Zusammenhang mit der nicht minder emphatischen Revision seines ersten Lyrikbandes Auf der Erde und in der Hölle.6 Die sorgfältig untersuchten Trakl-Bezüge im lyrischen Frühwerk Bernhards haben die These erbracht, dass dieser Einfluss Bernhards Lyrik in eine „Sackgasse“ geführt habe, ja, in ein epigonales Abhängigkeitsverhältnis,7 von dem sie sich nur mühsam habe lösen können.8 Bernhards Kommentare zu Trakl, die einer ,Auslöschung‘ seines frühesten, wohl noch von seinem Großvater, Johannes Feumbichler, vermittelten Dichter-Vorbilds gleichen („Jedes Gedicht trieft vor Kitsch!!!“), richten sich insbesondere gegen die malenden Adjektive in Trakls Lyrik, was auch seinem Selbstkorrekturverfahren im Falle von Auf der Erde und in der Hölle entspricht. Die Anmerkungen Bernhards sind durchgängig stilkritischer Art.9 Man kann diese Kritik, die an ein Wüten grenzte, wie die Schriftzüge und der Stiftabdruck in Bernhards Trakl-Exemplar zeigen, jedoch auch als Teil von seiner Bewältigungsstrategie im Umgang mit Vorbildern sehen.10
Im lyrischen Schreiben Bernhards lassen sich mit dem der symbolistischen ,poètes maudits‘ ebenso wie mit jenem Ingeborg Bachmanns und Christine Lavants verwandte Motive und Strukturen herausarbeiten. Im Falle Lavants liegt dies besonders nahe, bedenkt man Thomas Bernhards späte Auswahl aus ihren Gedichten in der Bibliothek Suhrkamp (1987).11 Seine Auswahl nannte er „das elementare Zeugnis eines von allen guten Geistern mißbrauchten Menschen als große Dichtung, die in der Welt noch nicht so, wie sie es verdient, bekannt ist.“12
Unschwer ist die motivische Verbindung zwischen Lavants und Bernhards Gedichten zu erkennen. Diese Motive sollte man nicht rein formalistisch verstehen, sondern stets auch als Anliegen definieren; wenn etwa Lavant von der „Aber-Welt“ spricht, die ihr lyrisches Ich mit „Aber-Augen“ wahrnimmt und diese „leuchten“ lässt eingedenk des Aber-Sinns“,13 dann stimmt diese Wortbildung mit dem Gegenläufigen, das viele von Bernhards Gedichten thematisieren.14 Auch das „Überreif-von-Müdigkeit-Sein“ als Tenor zahlreicher Gedichte Lavants findet bei Bernhard eine Entsprechung, etwa in seinem Gedicht „Müde“ der ersten Sammlung Auf der Erde und in der Hölle.15
Komplexer verhält es sich mit den Bereichen thematischer Synergien, Einfluss und Selbstbehauptung im Falle von Thomas Bernhard und Ingeborg Bachmann.16 Was die lyrische Motivik angeht, wurde in der Hauptsache das gespannte Verhältnis beider – unter Einbeziehung Christine Lavants – zum Thema ,Heimat‘ der Rück- und Abkehr von ihr untersucht.17 Am Beispiel der Lyrik Bachmanns und Bernhards lassen sich jedoch auch Scheinverwandtschaften erörtern. Wenn Bachmann in ihrer intensiven Krisenzeit der frühen sechziger Jahre dichtet:
Meine Gedichte sind mir abhanden gekommen.
Ich suche sie in allen Zimmerwinkeln.
Weiß vor Schmerz nicht, wie man einen Schmerz
aufschreibt, weiß überhaupt nichts mehr18
dann läge es nahe, Bernhards vermutetes lyrisches Verstummen zu ebenjener Zeit ähnlich zu deuten; doch dies hieße, die nahezu unerschöpfliche Sprachfülle Bernhards übersehen, der sich zeitweise – um im Bild zu bleiben – eher vor dem Ansturm der Worte in den „Zimmerwinkeln“ seiner Häuser verbergen musste.
Und noch ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Autoren wäre zu benennen: Ihr Verhältnis zum Liebesgedicht. Im lyrischen Werk Bachmanns darf es als zentral gelten. Anders im Fall der Lyrik Bernhards. Sie schien allenfalls unterwegs gewesen zu sein zum vollendeten Liebesgedicht. Zuweilen gewinnt man den Eindruck, als habe seine Lyrik das Liebesmotiv nicht wahrhaben wollen. Oder vielleicht wusste er vor Liebesbedürfnis nicht, wie man ein Liebesgedicht „aufschreibt“, um Bachmanns Wendung zu paraphrasieren. Nichts illustriert dies deutlicher als sein Zyklus „Rückkehr in eine Liebe“ aus der Sammlung Auf der Erde und in der Hölle; eines eben enthält dieser Zyklus nicht, ein Liebesgedicht im ,eigentlichen Sinne‘ Das Titelgedicht befindet:
Ich weiß kein Glück, das ferner ist als diese Liebe. (GG, 106)
II
In seinen Überlegungen zum Lyriker Thomas Bernhard hat Peter von Matt versucht, dessen lyrischer Stimme jene Resonanz zu verschaffen, die Bernhard selbst Christine Lavants Gedicht angedeihen lassen wollte. Er hat den eigenständigen Beitrag der Bernhardschen Lyrik zur lyrischen Moderne angedeutet und damit implizit gefordert, die eindimensionalen, wenn nicht einfältigen Vorwürfe, sie sei nur epigonal, zu überdenken.19 Es bleibt längst überfällig, Bernhards Lyrik als integralen Bestandteil seines Werkes zu begreifen, die Deutungswürdigkeit der Gedichte ernst zu nehmen und damit ihren Stellenwert in der deutschsprachigen Lyrik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts neu zu bestimmen. Sinnvoll wäre dabei das Problem der ,Epigonalität‘ nur zu behandeln, wenn dies im Kontext der Nachkriegsperiode als kulturelles Zeitphänomen behandelt wird. Ein erster wichtiger Ansatz dazu liegt vor,20 bedarf aber einer weiterführenden Erörterung, und zwar auf vergleichender Basis; denn es zeigten sich ähnliche Tendenzen etwa auch in der englischen, italienischen und französischen Lyrik. Das prominenteste Autorenbeispiel im nicht-deutschsprachigen Bereich dürfte Stephen Spenders Lyrik sein.
Den späten Selbstrevisionen, von denen bereits die Rede war und die hier noch eigens zu thematisieren sein werden, steht ein kaum verhülltes Selbstbekenntnis zu dieser Lyrik in der autobiografischen Erzählung Die Kälte gegenüber:
ich hatte die Gewißheit, meine Gedichte sind gut, Produkte eines achtzehnjährigen Verzweifelten, der außer diesen Gedichten nichts mehr zu haben schien. Ich hatte mich schon zu dieser Zeit in das Schreiben geflüchtet, ich schrieb und schrieb, ich weiß nicht mehr, Hunderte, Aberhunderte Gedichte, ich existierte nur, wenn ich schrieb, mein Großvater, der Dichter, war tot, jetzt durfte ich schreiben, jetzt hatte ich die Möglichkeit, selbst zu dichten.21
Diese dichtende Selbstbehauptung des Ichs drückte sich bereits in Bernhards erstem veröffentlichten Gedicht „Mein Weltenstück“ (1952) aus, und zwar in der Vermessung des eigenen Blicks durch das Fenster, wobei schon in der ersten Zeile ein Motiv genannt ist, das zum Merkmal seines stilistisch-motivischen Verfahrens werden sollte, die Wiederholung:
Vieltausendmal derselbe Blick (GG, 294)
Das Gesehene trägt dieses Ich in betont schlichter Form vor; noch dominiert eine parataktische Struktur. Das Kindliche bringt sich in Erinnerung:
Der Kinder Nachmittagsgeschrei,
Als ob die Welt nur Kindheit sei
Doch dominieren in diesen frühen Gedichten keineswegs Wie- oder Als-ob-Strukturen, sonst oft Stilmerkmale in epigonaler Dichtung. Schon die umfangreiche Sammlung Auf der Erde und in der Hölle lebt von dem, was Ingeborg Bachmann im Todesarten-Projekt als „Injektionen von Wirklichkeit“ bezeichnen wird:22 lebensweltliche Eindrücke, „Weltenstücke“ eben, die dem Schönen der Form schon bald spotten werden.
Früh fallen in Bernhards lyrischem Schaffen die zyklischen Strukturen auf. Der Zyklus „Die ausgebrannten Städte“ etwa stellt eine in sich geschlossene Komposition dar, die keineswegs nachgereichte Trümmerlyrik bietet, sondern „Blicke“ auf Städte, die sterben, auch wenn sie von kriegsbedingter Zerstörung verschont geblieben sind. Auch diese Stadt-Gedichte zeichnet ein prononciert musikalischer Duktus aus, dessen zunehmende Intensität proportional zur Ausdrucksstärke seiner Sprache für das ganze lyrische Schaffen Bernhards nachgewiesen worden ist.23
Der Zyklus schließt mit dem Gedicht „Unten liegt die Stadt“:24
Unten liegt die Stadt,
du brauchst nicht wiederkommen,
denn ihr Leichnam ist von Blüten übersät.
Morgen spricht der Fluß.
Die Berge sind verschwommen,
doch der Frühling kommt zu spät.
Unten liegt die Stadt
Du merkst dir nicht die Namen.
Aus den Wäldern fließt der schwarze Wein.
Und die Nacht verstummt.
Die kranken Vögel kamen.
Und du kehrst nur mehr in Trauer ein. ( GG, 55)
Zu den Städten dieses Zyklus gehören Paris, Venedig und Salzburg, das er seine „Hauptstadt“ nannte, sowie eine sterbende Phantasiestadt. Jede Stadt, jede Kapitale der großen Kulturtraditionen hielt der junge Bernhard offenbar für ruiniert, weil tödlich in ihrer geistigen Bausubstanz getroffen.
Mit dem Gedicht „Unten liegt die Stadt“ nun versuchte Bernhard, seinem an Eliots The Waste Land angelehnten Zyklus eine Schlusswendung, die an Trakl anklingt. Nach Trakl hört sich etwa der ,schwarze Wein‘ an, aber auch die ,Einkehr‘ in die Trauer. Was die Form angeht, so parodiert Bernhard mit seinem Gedicht an Terzinen womöglich jene Hofmannsthals. Zwar verkürzt er sie und verändert deren Reimschema; bei Bernhard reimen sich nur je zwei Terzinen mit ihren zweiten und dritten Versen, wogegen die ersten Verse allein stehen, auf sich selbst angewiesen sind. Und doch bleibt insgesamt der Eindruck einer gewissen Bündigkeit, ja, Folgerichtigkeit der poetischen Aussage erhalten, die für die klassische Terzine so charakteristisch ist.
Trotz dieser offenkundigen Anlehnungsversuche an die große Tradition kann man schwerlich von einem bloß epigonalen Gedicht sprechen. Warum nicht? Weil dieses Gedicht neben anverwandelte, parodierte Sprachformen betont einfache, das Erbe entzaubernde Aussagen stellt: „du brauchst nicht wiederkommen“ – das ist bei Trakl, Hofmannsthal oder Eliot ebensowenig denkbar, wie überhaupt dieses gehäufte ,Kommen‘, das zunächst einmal eher zum Davonlaufen ist, bis sich der Verdacht erhärtet, dass dieser junge Lyriker, der in den übrigen, zumeist langen Gedichten seines Zyklus eine auffallende Sprachkunstfertigkeit an den Tag legte, mit diesem eher monotonen Gedicht den Leerlauf der zitierten Traditionen zeigen wollte; das gilt auch für den Vers: „Morgen spricht der Fluß“, nicht wie noch im romantischen Lied Schumanns ,der Dichter‘, schon gar kein Zarathustra, sondern eine unverständlich werdende Natur.
Bernhards Ich schaut auf seine Stadt Salzburg – nicht wie ein selbstbewusster Ernst Reuter auf Berlin, um der Welt zu zeigen, wie eine Stadt leidet. Nein, dieses tieftraurige Ich gestattet sich zwar eine erhöhte Perspektive, aber nicht die des Rednerpultes, sondern jene des einsamen Wanderers auf dem Mönchs- oder Kapuzinerberg, der eine Nekropolis der Kultur betrachtet. Wie zum Schein hat er Distanz gewonnen, rät einem ,Du‘, wie es sich angesichts dieser zum ,Leichnam‘ gewordenen Stadt zu verhalten habe. Aber dieses Du ist kein wirkliches Gegenüber, kein Partner, kein Freund, sondern das Ich, das sich selbst anredet.
Was hier ,aus Ruinen aufersteht‘, ist allenfalls Ratlosigkeit – auch angesichts einer Natur, zu der es kein tröstliches Verhältnis mehr geben kann. Indem die Blüten des Frühlings die tote Stadt übersäen, täuschen sie Leben vor. Aber der ,schwarze Wein‘ des allzu Späten lässt keinen Zweifel daran bestehen, dass sich hier allenfalls der Tod selbst zelebriert. Und die Zeichen der Zukunft zeigen sich nur in Gestalt ,kranker Vögel‘. Es ist ein Gedicht zum Thema unscharfe bis verfehlte Beziehungen: Verschwommene Berge, dem Vergessen anheimfallende Namen, das Missverhältnis der Zeit zur Natur („der Frühling kommt zu spät“). Nur das selbstvergewissernd sich anredende Ich scheint „bei sich“ zu sein, zwar keineswegs mit sich im Reinen, aber auch nicht mit sich selbst entzweit. Es kann jedoch leben, solange es zu trauern vermag.
Zur selben Zeit befand Gottfried Senn in seinem letzten Gedicht, dass wirkliche Trauer nicht mehr sein könne in einer Welt, in der das Ende zum Dauerzustand geworden sei und wir dazu verurteilt sind, zunehmend sprachlos vor den Relikten der geistigen Tradition zu verharren, vor den Betten und Kissen der großen Toten. Demgegenüber klagte Bernhard in seinen ersten Gedichten sein Recht auf Trauer ein, suchte nach betont schlichten Worten, ja, beinahe naiven Bildern, um an den elementaren Sinn des Trauerns zu erinnern, bevor er dann in seinen Stücken und Prosawerken diesen Sinn ins Absurde umschlagen ließ. Auf dem Weg zum Absurden sollte seine Syntax – scheinbar maßlos – komplexer werden, sein Bekenntnis zur Sinnlosigkeit obsessiver, sein Handhaben der Wiederholung auch vermeintlich nebensächlicher Gedanken penetranter, aber auch kunstvoller. Selbst wenn sie das Burleske nicht scheute, Bernhards Sprache blieb stets dieser abgrundtiefen Trauer um eine zur Selbstauslöschung verurteilten Kultur eingedenk, ein Empfinden, das seine Lyrik bereits deutlich zum Ausdruck brachte.
Gedichte Bernhards lesen sich nicht selten wie Sterbeprotokolle. Zum Leitmotiv wurde dieses Phänomen in der Sammlung In Hora Mortis (1958), die die rhetorische Gestik und rhapsodische Gebethaftigkeit von Rilkes Stunden-Buch, namentlich des ersten Teils „Das Buch vom mönchischen Leben“, parodiert. Bernhard war auch diese lyrische Sprachkomposition so wichtig, dass er sie 1987 – bis auf die entfallene Widmung25 – unverändert neu herausbrachte. Thema dieser Gedichte ist nicht das Hadern mit Gott, Welt und Schicksal, sondern mit sich selbst. Keine Hiobschen Klagen prägen diese Gedichte, eher ein lyrisches Sich-Einüben in das Sterben, ein Herbeirufen des Todes, das jedoch die Angst vor dem Grab nicht leugnet. (GG, 138)
ich will was kommen muß jetzt sehn
mein Sterben Herr
und mein Vergehn in Tränen. (GG, 136)
Bis auf die Schlusspunkte und wenige Fragezeichen sind diese Gedichte interpunktionslos, was für den musikalischen mit Notationssystemen intim vertrauten, Sprach- und Atemzeichen bewussten Lyriker Thomas Bernhard eine Besonderheit darstellt. Es ist, als dürfe nichts, nicht einmal ein Komma, den Gebetsklagestrom unterbrechen, vom Zeilenbruch abgesehen, der das rhythmische Maß vorgibt.
Der Tod ist klar im Bach
und wild im Mond
und klar
wie mir der Stern im Abend zittert
fremd vor meiner Tür
der Tod ist klar
wie Honig im August
so klar ist dieser Tod
und treu mir
wenn der Winter kommt
o Herr
schick’ einen Tod mir
daß mich friert
und mir die Sprache kommt im Meer
und nah dem Feuer
Herr
der Tod fällt nachts den Baumstamm an
und mancher Amsel Schlaf
in Finsternissen. (GG, 139)
Von ,Glauben‘ kann hier nicht mehr die Rede sein;26 der aufklarende Tod wird zu einem visuell wahrnehmbaren Phänomen, das gleichsam über sich selbst aufklärt. Von Wolframs „Lied an den Abendstern“ ist nur noch dessen „Zittern“ übrig. Der Wunsch des Rufenden richtet sich dabei auf das Vorhandensein einer Sprache, eine Hoffnung, die von fern an den Vers in Hölderlins Friedensfeier erinnert: „Daß, wenn die Stille kehrt, auch eine Sprache sei“.27 (V. 84) In Bernhards Gedicht jedoch erwiese sich erst der vom „Herrn“ geschickte Tod als Auslöser einer „Sprache“, die mit zwei der vier Elemente (Wasser und Feuer) verbunden ist und somit Elementares auszudrücken verstünde. Dies unterschiede ihn vom ,üblichen‘ Tod, von dem am Ende des Gedichts die Rede ist. Er wütet in der Natur, aber sprachlos. Das Wilde, das erste Wort des Zyklus überhaupt („Wild wächst die Blume meines Zorns / und jeder sieht den Dorn / der in den Himmel sticht“, GG, 127), kehrt in diesem Gedicht wieder und verweist auf das Ungebändigte und Unzähmbare des Todes. Es ist eine Wildheit, die sich mit der Symbolik des Mondes verbindet, und damit paradoxerweise mit dem ruhenden Pol am Nachthimmel. Auch in der folgenden Lyriksammlung Unter dem Eisen des Mondes (1958) spielt dieses Symbol eine buchstäblich herausragende Rolle, die sich aus dem Leonardo-Motto von Hora mortis ableitet: „La Luna, densa e gra[ve], densa e grave, come sta, la luna?“ (GG, 125) Diese rhythmisierte Prosanotiz Leonardo da Vincis, die mit dem Mond beginnt und mit dem Mond endet und zu dessen Zeit keine naive, sondern eine wissenschaftliche Frage war, fällt rhetorisch genau durch jenes Stilmittel auf, das für Bernhard konstitutiv werden sollte: die Wiederholung, aber auch die punktierte Rhythmik, die etwa das letzte Gedicht der Hora mortis-Reihe auf eine geradezu exzessive Weise bestimmt:
zerschnitten
ach
zerschnitten
ach
zerschnitten
ach
ach
ach
mein
Ach. (GG, 150)
In einem Gedicht dieser Reihe („Preisen will ich Dich mein Gott“, GG, 148), das einen vergleichsweise konventionellen Lobgesang anzustimmen scheint, grundiert diese synkopische Rhythmik einen Zustand des Chaos („zerflattert sind die Vögel / schwarz / und wieder / schwarz / die Zahl zerspringt / der Mond schreit auf“, GG, 148); doch kann das Ich des Gebetgesangs diesen Zustand ertragen, da es sich – überraschend genug – in Gott aufgehoben weiß. Es ist damit das einzige veröffentlichte Gedicht Bernhards, aus dem Gottesvertrauen im eigentlichen Sinne des Wortes spricht, auch wenn das poetische Umfeld dieses Geborgensein in Gott sogleich wieder relativiert. Doch selbst noch im Zyklus Unter dem Eisen des Mondes hält dieses poetische Ich daran fest, dass Gott sein Gebet höre – „in jedem Winkel der Welt“ (GG, 178), auch wenn an ein Erhören nicht (mehr) zu denken ist.
Surreale Bilder – ob bei T.S. Eliot, Paul Eluard oder dem jungen Thomas Bernhard – haben es an sich, wie Selbstverständlichkeiten zu erscheinen, wie etwa in diesem Gedicht aus dem Zyklus mit dem bereits surrealen Titel „Unter dem Eisen des Mondes“:
In den Fischen
und in den Vögeln
ist der Frühling aufgebahrt.
Der Mond spricht mit den Bäumen von des Winters
vergessenen Namen
die in großen Körben faulen
mit zusammengeschrumpftem Gesicht.
Aus schimmernden Krügen trinken wir
alle die Tage der Blüten
die in Grau und Grün gefangen sind
wie ertrunkene Nachtigallen.
Wir trinken und tragen schwarze Gewänder
in unserem eigenen Haus,
denn
in den Fischen
und in den Vögeln
ist der Frühling aufgebahrt. (GG, 200)
Unheimlich, weil nicht mehr heimelig, ist das „eigene Haus“, denn es trennt die Toten / von Sonne und Mond / und lässt graue Flöten / an kalten Wänden zerspringen“ (GG, 206), wie es in einem anderen Gedicht dieser Sammlung heißt. Und in einem weiteren überschriftslosen Gedicht sieht sich der Frühling als „Totenbett“ angesprochen. (GG, 179) Wiederholung, Alliteration, genaue Wahrnehmung und ihre Allegorisierung: das Gedicht „In den Fischen“ täuscht Schlichtheit vor und handelt doch von komplexen Empfindungen und alogischen Verhältnissen. Das Surreale wirkt durch die betonte Konkretheit plausibel; erreicht wird die in den ersten drei Zeilen vor allem durch das Insistieren auf dem bestimmten Artikel. Denn das Gedicht beginnt nicht:
In Fischen
und Vögeln
ist Frühling aufgebahrt
Vielmehr handelt es sich um einen toten Frühling in allen wahrnehmbaren Vögeln und Fischen, dem Kreatürlichen also. Die zweite Strophe konstatiert die Verwesung von Namen, die niemand mehr nennen kann, nur der Mond im Gespräch mit den Bäumen, das Astral-Leblose im Austausch mit dem Symbol irdischen Lebens. Was wir – ausnahmslos „alle“ – trinken, ist kein Elixier, sondern eine abgestandene Brühe, in der „Blüten“ als Stimmen von „Nachtigallen“ bereits ertrunken sind. „Wir“ trinken demnach Todeswasser und kleiden „uns“ gemäß, eben „schwarz“. In deutlich unaufgeregtem Sprachton kehren sich in diesem Gedicht alle konventionellen Vorstellungen von „Frühling“, „Namen“ und organischem Leben um. Was die Fische und die Vögel – ohne es wissen zu können – enthalten, ist nur totes Aufkeimen von ,Leben‘, das keines mehr ist.
Die zunächst im Jahre 1962 während der Arbeit an seinem ersten Roman Frost als Privatdruck erschienene lyrisch-aphoristische Sequenz Die Irren Die Häftlinge experimentiert mit dem Surrealen im logischen Argument, das sich damit selbst als scheinlogisch entlarvt, und mit dem Prosahaften in der lyrischen Komposition. Dieser kleine Zyklus demonstriert geradezu, wie Prosa aus dem Lyrischen hervorgeht, um danach wieder im Gedicht aufgefangen und aufgelöst zu werden.
Das Gehirn ist so unfrei und das System, in das mein Gehirn hineingeboren worden ist, so frei, das System so frei und mein Gehirn so unfrei, daß System und Gehirn untergehen. (GG, 213)
Dem folgt ein betont surreales Gedicht, das zwanghafte Momente zeigt:
Der Bucklige mit dem Wassereimer,
die mit den Zöpfen, ganz wild,
die Nonnenschwänze weiß, die Vögel
schwarz auf dem grünen Bild,
der mit dem Zeigefinger auf seine
blutige Stirn zeigt,
der mit dem gelben Strick hoch
auf den Kirschbaum steigt, ( GG, 214)
Diese lyrischen Bilder enden jeweils mit einem Komma, das andeutet, hier werde noch etwas folgen; es bleibt aber aus. Der bestimmte Artikel ersetzt in drei Fällen den Namen, ein Verfahren, das elementares Sprechen imitiert. Dieser Vorgang wiederholt sich wenig später. Auf die aphoristische Aussage, die ein Argument erprobt, folgt eine offene lyrische Sequenz, die den Kommata das letzte Wort einräumt:
Die Vernunft des Traumes fürchtet die Vernunft der Liebe, die Vernunft der Gewalt, die Vernunft des Todes, um der reinen Vernunft willen, die niemand beherrscht. (GG, 216)
die mit dem roten Haar,
mit der langen Zunge,
die mit dem Rübenmesser,
mit der kranken Lunge,
die mit dem weißen Schleier
im schwarzen Tor,
die mit dem langen Hals,
die mit dem abgeschnittenen Ohr,
die mit dem Rosenkranzzählen,
mit den Äpfeln, den Birnen,
die mit den gelben, weißen
leeren Stirnen,
die mit der Angst vor dem Arzt,
die mit dem Kohlblätterhut,
die in das Tümpelwasser
tropfen läßt ihr Blut, ( GG, 128)
Diese Strophen belegen gleichsam, dass die „reine Vernunft“ auf der Strecke bleiben muss; sie ist unverfügbar. In ihnen spricht sich nur eines aus: die Realität des Irrealen, der man mit „Furcht“ oder „Vernunft“ begegnen kann, ohne dass dadurch etwas zu verändern wäre. Wenn in diesen Texten auch kein „Frost“ herrscht und keine Winteratmosphäre auffällt, so spielen sie doch Szenen und vor allem rhetorische Strategien durch, die sich in den „Argumenten eines Winterspaziergängers“, besonders aber im Roman Frost wiederfinden werden. Das Gefangensein im Irr- oder Widersinn findet in der Schlußstrophe dieses Zyklus seine negative, offenbar bereits 1950 entstandene Apotheose:
Was bist du für ein Wein, mein Herr Urin?
Besoffen geh ich durch die kahlen Köpfe
der Unterunterwelt, durch den Ruin
und flecht aus meinem Hunger ihm die Zöpfe. (GG, 227)
III
Rätselhaft wirkt bis heute der bruchhafte Übergang Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre von der Betonung auf der Lyrik zur Konzentration auf die Prosa in Bernhards Werkbiografie. Auch innerhalb der Prosa ist ein qualitativer Sprung zu registrieren. Nichts bereitet den Leser der frühen Erzählungen und der Romanfragmente („Schwarzach Sankt Veit“, 1960, und „Der Wald auf der Straße“, 1961) auf das Prosaereignis Frost (1963) vor.28 Von den beiden inzwischen publizierten Vorstudien zu Frost, „Argumente eines Winterspaziergängers“ und „Leichtlebig“ lässt nur das Fragment „Argumente“ die neue stilistische und konzeptionelle Ausrichtung von Bernhards Prosa erkennen. Es ist, als habe sich Bernhard die imperativische Feststellung „Du mußt dein Leben ändern“ in Rilkes Gedicht „Archaischer Torso Apollos“29 in ein ,Du mußt dein Schreiben ändern‘ verwandelt. Bernhard veränderte gleichsam seine poetische Handschrift. Dieser konzeptionell-stilistische Neuansatz, datierbar auf die Zeit ab Januar 1962, ereignete sich nicht so sehr in der Prosa denn als Prosa. Zu berücksichtigen ist nämlich, dass dieser Neuansatz offenbar auch durch Erwägungen inspiriert wurde, die sich seitens Bernhards aus der Ablehnung seines Lyrik-Manuskripts Frost durch den Otto Müller Verlag Ende November 1961 ergaben. Es mag sein, dass diese Ablehnung eines Manuskripts, das ihm wichtiger war als seine vorherigen Lyrik-Publikationen, eine reaktive Energie in Bernhard freigesetzt hatte, die seinen ,Mut zum Bruch‘ mit seiner bisherigen Schreibhaltung ermöglichte. Aus der zwischen dem 12. November 1960 und 23. November 1961 geführten Korrespondenz zwischen Thomas Bernhard und Richard Moissl, dem Cheflektor des Otto Müller Verlages, geht hervor, dass das Lyrikmanuskript „Frost“ – es trug zunächst den Gesamttitel „Zaunpfähle“ – Gegenstand diverser Überarbeitungen vornehmlich in Gestalt von Umstellungen in der Reihenfolge der Gedichte gewesen war, bevor Bernhard vermelden kann:
Lieber Herr Doktor, jetzt ist FROST erst ein Buch!, und ist mein Buch!, und ich bin glücklich und es kommt mir vor, ich werde nie mehr ein besseres zusammenbringen! Sie werden es nicht mehr wiedererkennen!, jetzt ists gewaltig und ein Strom, der mich selber umwirft! – das, bitte ich, sollen Sie wissen, bevor die ,Konferenz‘ anfängt.30
Wenige Monate zuvor hatte er Moissl berichtet, ihm sei „im Kino“ der richtige Titel für diese Sammlung in den Sinn gekommen; alles weise auf ihn hin, nämlich auf „FROST“.31 Moissl begründet in seinem Schreiben vom 21. November 1961 die Ablehnung des Lyrikmanuskripts „Frost“ wie folgt:
Mit dem jetzt vorliegenden [Manuskript, R. G.] kann ich nämlich nach ganz gründlicher Lektüre doch nicht Ihr Anwalt bei der Besprechung sein. Ich bin der Meinung, dass Auf der Erde und in der Hölle viel besser ist. Und im Übrigen decken sich diese beiden Gedichtbücher inhaltlich viel zu sehr. Sie haben nur mit dem neuen den Schritt noch tiefer in die Verdüsterung, ins Schwarze getan. Das „Schwarz“ durchtränkt alle Ihre Gedichte und es ist nicht zufällig das Wort, das weitaus am häufigsten von Ihnen verwendet wird, wie schon im ersten Gedichtband. Und „der innere Winter“, „die Kälte“, „der Frost“, ist so stark durchgebrochen, dass er sogar dem neuen Gedichtband den Namen geben musste! Aber es gäbe noch vieles zu sagen! Warum diese Sucht zu lästern?! Wozu diese Perversierung selbst der „unschuldigen“ Natur?32
Bernhard antwortet postwendend am 23. November 1961 mit einer Art poetologischer Grundsatzerklärung, die eine nochmalige Überarbeitung andeutet, wobei er an der „Grundstimmung“ des Werkes glaubt nichts verändern zu können. „Frost“, das seien seine „Fleurs du Mal“:
es gibt keine Aufhellung, nur eine Hinwendung, immer mehr an und in den Gegenstand, an und in das tägliche Leben, die tägliche Qual, die es, nach den Regeln unserer Religion auch ist; es ist ein Gang durch die Hölle, der eine Weg, den ich gehe, mit vielen anderen, die ihn jemals gegangen sind und die ihn auch heute noch gehen! In Gott düster! Und bitte lesen Sie vielleicht die drei letzten Gedichte „Psalm“, „Wo“ und „Alpha und Omega“ – dann versteht man das Vorhergegangene, insoweit meine Dichtung verstanden werden kann; ein Gesang, eine Dichtung, muss immer gleich bleiben, sie hat immer nur ihr Thema!, wenn sie Ansprüche ergeben kann!, sie muss nur immer tiefer werden, sonst löst sie sich im handwerklichen, im gefallssüchtigen, Oberflächlichen auf und macht jedem Atemzug vorher Schande! Ich will alles, nur keine Schande machen, das aber als Kreatur; kreatürlich im manischen Gesang eines jeden Daseins! Mich mögen sie alle verlassen, aber ich weiss, dass ich es nicht ändern darf!, das wäre ein abgleiten, ein auslöschen, Schande ohne Ende! Also kann „düster“[,] „tragisch“ wohl ein Vorwurf, niemals ein Urteil sein, das wäre Schande, gefährlich, das wäre blind! Das Ich meiner Arbeit ist die Kreatur, die eingesetzte, gehetzte, wie das Wild, die seit den Anfängen unveränderte Natur, nicht ich, der nichts ist, Nichts! Ich kann nicht manipulieren – ich bin mir sicher, dass jedes Wort in meinem Manuskript eine Wahrheit ist, die ich durchlebt habe, von nirgends herhabe, aber das ist eine Voraussetzung! – – – Das jetzige Manuskript ist die Grundlage für ein Buch!, das sich noch verdichten lässt, indem man etliche Stücke herausnimmt!33
In der Fülle der Ausrufungszeichen spiegelt sich das dringliche Anliegen, das Bernhard mit diesem Brief zum Ausdruck bringen wollte. Wesentliche Grundmuster seines Schaffens spricht er an: vertiefende Wiederholung von Motiven, jedes kreatürliche Sein hat seinen „manischen Gesang“, jedes Wort ist durch eine erfahrene „Wahrheit“ gedeckt, das „Düstere“ ist geradezu ein poetisch eingelöstes religiöses Gebot. Bemerkenswert jedoch, dass sich Bernhard durch Moissls Kritik aufgerufen fühlte, im lyrischen „Frost“-Manuskript nun doch erst „die Grundlage für ein Buch“ zu sehen, wobei er nicht ,Lyrikband‘ schreibt, sondern dieses „Buch“ genremäßig nicht weiter qualifiziert. Aus dem Gesamtzusammenhang muss Moissl freilich vermutet haben, es werde sich um eine verkürzte und dadurch „verdichtete“ Version des ihm vorliegenden Manuskripts handeln. Es sollte sich jedoch zeigen, dass Bernhard die „Frost“-Gedichte auf eine ganz andere Art verdichtete.
In Bernhards romanhafter Prosa Frost finden sich Spuren poetologischer Reflexionen, die aus der Lyrik ableitbar sind, und sprachkritische Positionen, die sich wiederum einer lyrischen Sprachsensibilisierung verdanken (könnten). Das Lyrikmanuskript „Frost“34 wiederum weist Motive auf, die sich in veränderter Form in der Prosa wiederfinden. Beide Bezüge seien hier an einigen markanten Beispielen aufgezeigt.
Im Gedicht „Grüne Melancholie“ (GG, 11) spricht das lyrische Ich davon, dass seine „verlassenen Köpfe nicht sehen“ können, „meine Augen hören nichts mehr“. Und dann:
Ich muss in die Stadt hinunter, ich muss auf den Friedhof
meine Ohrenzeugen, meine Augenzeugen, meine Mitspieler
ich muss sie aufwecken, grüne Melancholie.
Das Melancholische grundiert auch die Frost-Prosa. Über Strauch, Maler und Bruder des Chirurgen, in dessen Auftrag das Erzähler-Ich den „berufslosen“ Künstler beobachten soll, wird berichtet, dass er sich schon als Kind in einem „Waldviertler-Dorf, ja gar über die Grenze nach Ungarn“ an der „Ebene der Melancholie“ nie habe satt sehen können.35 Dieses Ich freilich muss – in Umkehrung der lyrischen Aussage – zum Ohren- und Augenzeugen werden.
Das Motiv des Zurückkehrens, Einkehrens, Über-die-Schwelle-Tretens prägt die Gedichte wie die Prosa Frost.
Nach dem Heimgehen mit den Holzfällern
die Fledermaus im Bischofszimmer
das schwarze Flattern durch Kasten und Kommoden
das Unaufhörliche des ertrunkenen Tages. (GG, 58)
Oder im Gedicht „Franziskus“:
Im Wald bei der Schenke, da kommt er herein
wo die Lichtung das Gras überflutet
da seh ich ihn auf den Rosenkränzen
ohne Rock und Schuh, verblutet. (GG, 101a.)
Die „Nähe des Todes“ (GG, 111) ist in beiden Texten ständig spürbar, auch der „Frost vor den Toten / die aus dem Wald kommen“. Das Gedicht „Jagd“ spricht von den „toten Martern der Lüfte / dem Frost näher / als den Kindern im Dorf / das Widerhallen der Stämme / über mir, wie das verrückte Klagen / unter mir […].“ (GG, 113) Auch die für den Ich-Erzähler unerträgliche „Wirtsfrau“ und ihr Lachen tauchen in einem der Gedichte der Sammlung „Frost“ auf („Der Tod des Säufers“; GG, 137)
Doch sind es die auf das Lyrische zurückweisenden Stellen im Roman Frost, die noch deutlicher die ,Geburt‘ der neuen Prosa Bernhards aus dem Geist der Gedichte veranschaulichen. Das ,Neue‘ an dieser Prosa mag man mit einem diskursiven Prinzip bezeichnen, dass die Gedichte im Manuskript „Frost“ bereits poetisch erprobt hatten: Das Dissoziierende im Assoziativen, das Maler Strauch verkörpert. Was sich dabei zutragen kann, entwickelt eine Eigendynamik:
Wie ein Wort eine ganze Lawine von folgerichtigen Wörtern, ganze Stadtteile von Wortkonstruktionen in die Bewegung zur Tiefe setzt und nicht die geringste Auslassung zuläßt, ja zulassen kann. (F, 308 f.)
Wesentlich ist, dass ein Wort diese Wirkung entfaltet. Den Erzähler in Frost fasziniert und befremdet die verbale „Erfindungsgabe“ des Malers; sie reiche bis zu „erstaunlichen, an den Tiefsinn grenzenden Wortkonstruktionen“. Er mache sie in der Natur „ausfindig“, „im Wald, auf den Feldern, auf den Wiesen, im tiefen Schnee“. Gemeint sind auf synthetisierender Grundlage gebildete Neologismen wie diese: „Wirklichkeitsverachtungsmagister“, „Gesetzesbrechermaschinist“, „Menschenwillenverschweiger“. (F, 72) Es handelt sich dabei um – zumindest im landläufigen Verständnis – demonstrativ unpoetische Worte, die einen Bruch mit natur-lyrischen Wendungen signalisieren sollen.
Doch der Erzähler gibt sich damit nicht zufrieden. Am „vierzehnten Tag“ seiner Begegnungen mit dem Maler fragt er sich: „Was ist das für eine Sprache, die Sprache Strauchs? Was fange ich mit seinen Gedankenfetzen an? Was mir zuerst zerrissen, zusammenhanglos schien, hat seine wirklich ,ungeheuren Zusammenhänge‘; das Ganze ist eine alles erschreckende Worttransfusion in die Welt […].“ (F, 145) Indem der Erzähler sich selbst das Verhältnis Strauchs zur Sprache zu erklären versucht, betreibt er selbst „erschreckende Worttransfusionen“:
Eine Herzmuskelsprache ist die Strauchs, eine „pulsgehirnwiderpochende“, verruchte. Das ist rhythmische Selbsterniedrigung unter dem „eigenen krachenden Untergehörgebälk“. Seine Begriffe, Schliche, grundsätzlich mit dem Hundegebell in Einklang, auf das er mich gleich am Anfang hingewiesen hat […]. Ist das denn auch noch Sprache? Ja, das ist der Doppelboden der Sprache, Hölle und Himmel der Sprache, das ist das Auflehnen der Flüsse, „die dampfenden Wortnüstern aller Gehirne, die grenzenlos schamlos verzweifelt sind.“ Manchmal redet er ein Gedicht, reißt es gleich wieder auseinander, setzt es zusammen zu einem „Kraftwerk“, „Kasernierung der zu züchtenden Gedankenwelt der wortlosen Stämme“, sagt er. […] Er reißt die Wörter aus sich heraus wie aus einem Sumpfboden. Er reißt sich in diesem Wörterherausreißen blutig. (F, 146)
„Manchmal redet er ein Gedicht, reißt es gleich wieder auseinander, setzt es zusammen zu einem ,Kraftwerk‘“ – zuletzt schreibt der Erzähler dem „berufslosen Maler Strauch“ eine regelrechte „Gedankenpoesie“ zu (F, 268), ein Kompliment, das dieser ablehnt oder dahingehend modifiziert, dass er den Poesiebegriff letztlich in Luft auflöst:
„Die Poesie, die ich meine, ist etwas ganz anderes.“ […] Ich sagte: „Was ist Ihre Poesie?“ – „Meine Poesie ist nicht meine Poesie. Aber wenn Sie meine Poesie meinen, so muß ich gestehen, daß ich sie nicht erklären kann. Sehen Sie, meine Poesie, die die einzige Poesie ist und also folglich auch das einzige Wahre, genauso das einzige Wahre wie das einzige wahre Wissen, das ich der Luft zugestehe, das ich aus der Luft fühle, das die Luft ist, diese meine Poesie ist immer nur in der Mitte ihres einzigen Gedankens, der ganz ihr gehört, erfunden. Diese Poesie ist augenblicklich. Und also ist sie nicht. Sie ist meine Poesie.“ (F, 269)
Strauchs pneumatische Poesie verfügt über eine implizite Poetik und ist dabei radikal selbstbezüglich. Ihr Wahrheitsanspruch ergibt sich gerade daraus, dass sie jeglicher Form von Diskursivität entzogen bleibt. Folgerichtig daran ist, dass diese Poesie sich durch kein Gedicht konkretisiert und dass ihr ,Urheber‘, Strauch, zuletzt spurlos verschwindet, „abgängig“ ist (F, 336), sich in Luft aufgelöst hat.
Damit wäre jetzt auch genauer bestimmbar, was mit der ,Geburt‘ der Prosa aus dem Geist der Lyrik im Werk Bernhards gemeint ist: Diese dissoziierend-assoziative Prosa wäre demnach weniger die Folge eines ,Geburtsvorgangs‘ als vielmehr das Ergebnis der Auflösung der lyrischen Form und ihr Aufgehen in Prosa – zumindest in diesem frühen Stadium von Bernhards Schaffen.
IV
Im Nachlass Thomas Bernhards befindet sich, was seinen Umgang mit Lyrik angeht, ein unerwartetes Zeugnis, ein unveröffentlichtes Typoskript unter dem Titel:
Erwürgtes Lamm
Geistliche Gesänge von Dichtern des 16., 17. und 18. Jahrhunderts
ohne die Musik des Johann Sebastian Bach
herausgegeben mit einem Vorwort von Thomas Bernhard36
Gewidmet ist das wohl in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre erarbeitete Typoskript Anna Janka, die er an der Orgel der Pfarrkirche von St. Veit im Pongau, laut Bernhard „der schönste Ort des Landes“, wie es in der ersten Version seiner Einleitung zu dieser Anthologie heißt, kennengelernt hat. Mit ihr lernte er auch Hedwig Stavianicek, seinen „Lebensmenschen“, kennen.37 Der zweite umfangreichere Einleitungsentwurf lässt erkennen, dass Bernhard, der bekanntlich zeitlebens ein Verächter von Anthologien bleiben sollte, mit seiner Sammlung eine Art Gegen-Anthologie vorstellen wollte, gerichtet gegen „eine gewisse Art von deutschen Anthologien, die zum Erbrechen reizt“.38
Die für Bernhards damaliges poetisches Selbstverständnis und sein Verhältnis zur lyrischen Tradition überaus aufschlussreichen Einleitungen benennen seine mit dieser Anthologie verbundene Absicht genau: Er möchte die Texte oder „Sprachgebilde“ von der Musik Bachs „trennen“, um sie auf diese Weise der „deutschen Literatur“ zurückzugeben. Denn „der überwiegende Teil dieser Dichtungen aber ist dem heutigen Leser fremd, oder ganz grundlos vergessen, oder beim Heruntersingen in unseren Kirchen und Kathedralen beschmutzt worden.“
Es handelt sich also um „unbekannte Dichter“, die hier von neuem Geschichte machen.39 Weniger den Dichtern (namentlich genannt ist nur Johannes Rist) als den Texten möchte Bernhard durch diese Sammlung zu einer neuen Gegenwart verhelfen, wobei sein Erkenntnisinteresse nicht nur subjektiv ist, wie aus dieser Passage der zweiten Einleitung hervorgeht:
Ihr [gemeint sind die „unbekannten Dichter“, R. G.] wohltuender und schlechter Einfluss auf die Entwicklung unserer Lyrik und unseres Dramas, auch des Auslandes, ist nicht zu bestreiten. Selbst in dem bewunderungswürdigen Werk T.S. Eliots sind die Merkmale und Spuren dieser geistlichen deutschen Dichtung nicht zu ersticken, auch wenn der Autor von the waste land [sic!] immer wieder und ohne Absicht, zu verstehen gibt, die deutsche Literatur nicht zu kennen. Peguy und Claudel, ja Ezra Pound und der Russe Majakowskji wären undenkbar ohne die auf oft seltsamem Wege erworbene Kenntnis dieser zuweilen erregenden, im allgemeinen jedoch volksliedhaften, naiven einfältigen, nicht selten von einer dillettantischen [sic!] Frömmigkei[[t]] diktierten, auf ein und dasselbe Ziel gerichteten Poesie.40
Bernhard erkennt in der geistlichen Dichtung oder Kantatenlyrik eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner von kulturübergreifender Wirkung. Das ist bemerkenswert genug. Doch geht er darüber hinaus, wenn er schreibt:
Im 19. Jahrhundert wäre die Herausgabe einer Sammlung wie diese[[r]] für viele unerträglich und überhaupt unmöglich gewesen. Heute ist es nicht nur möglich gemacht, sondern notwendig, zu zeigen, dass es wichtiger ist, einige nicht zu unterschätzende Beispiele der deutschen Literaturgeschichte aus den Kompositionen eines deutschen Genies herauszuschreiben, als sich der Übersetzung und Herausgabe exotischer, oft nur einem augenblicklichen Modernismus unterliegenden Erzeugnisse zu widmen.41
Mit dieser Anthologie schien Bernhard demnach eine implizite Kritik an modischen Trends in der Lyrik seiner Zeit üben zu wollen, wie sie etwa durch Gottfried Benns Statische Gedichte vorgegeben war. Hugo Friedrich hatte diese ,modernen‘ Tendenzen in seiner einflussreichen Studie Die Struktur der modernen Lyrik (1956) analysiert, wobei er gerade die geistliche Lyrik weitgehend ausgeklammert und allenfalls in der „Sprachmagie“ Baudelaires (und später Eliots) das „ruinöse Christentum“ und sein Vokabular nachwirken sah.42
Und doch ließ Bernhard keinen Zweifel an der subjektiven Grunddisposition seines ersten und einzigen anthologischen Projekts:
Diese Auswahl hat kein System, sie folgt ungefähr jener Laune, die mich vor mehreren Jahren in einem ländlichen Armenhaus die Gedichte entdecken liess. Sie stellt eine Ordnung her, indem sie die Ordnung vermeidet.43
Das klingt nicht nur nach einem klassischen Bernhard-Satz, sondern gibt präzise das poetologische Ordnungsprinzip an, das er in seiner Anthologie praktizierte; vielleicht sollte man in diesem Fall lieber von ,poetischen Umgangsformen mit den Vorlagen‘ sprechen. Überdies ermöglicht der Hinweis auf das „ländliche Armenhaus“ wiederum einen möglichen Bezug zu Frost und dem Abschnitt „Im Armenhaus“.44 Auch wenn dieser Erzählabschnitt betont nicht-lyrisch wirkt, besteht das verbindende Element zwischen der Kantaten-Anthologie und den Schilderungen dieses Altenheims in der Todesmetaphorik beziehungsweise Todeserfahrung an diesem Ort.
Herstellung von Ordnung durch Ordnungsvermeidung – was bedeutet das für die Struktur von Bernhards lyrischer Anthologie „Erwürgtes Lamm“? Wieder Überraschendes – denn Bernhard belässt kaum einen Text in seiner ursprünglichen Form. Seine Textquelle, Johann Sebastian Bachs Sämtliche Kantatentexte (1956), ist vor allem in den mittleren Teilen durchsetzt von Lesespuren.45 Was später für die Trakl-Ausgabe gelten wird, trifft bereits hier zu: Die bearbeiteten Seiten weisen zum Teil Intensivanstreichungen auf, Ausrufungszeichen, Textumrahmungen und emphatische Streichungen, so streicht er etwa in der Kantate 70: „Wachet! Betet! Betet! Wachet!“ (26. Sonntag nach Trinitatis) mit vierfachen Strichen die Arie aus:
Läßt der Spötter Zungen schmähen
Es wird doch und muß geschehen,
Daß wir Jesum werden sehen
Auf den Wolken, in den Höhen
Welt und Himmel mag vergehen
Christi Wort muß fest bestehen
Laßt der Spötter Zungen schmähen! (325)
Dagegen hebt er nachdrücklich durch vier Ausrufungszeichen das vorangegangene Rezitativ hervor:
Auch bei dem himmlischen Verlangen
Hält unser Leib den Geist gefangen;
Es legt die Welt durch ihre Tücke
Den Frommen Netz und Stricke.
Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach:
Dies preßt uns aus ein jammervolles Ach! (325)
In der Kantate 47: „Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden“ (284) streicht er expressiv durch Klammer und Durchkreuzen die Stelle:
Der Mensch ist Kot, Stank, Asch und Erde
Mit einer Wellenlinie und dem Vermerk „weg!“ streicht er:
Und du, du armer Wurm, suchst dich zu brüsten?
Gehört sich das vor einen Christen?
Und in der Kantate 27: „Wer weiss, wie nahe mir mein Ende“ fügt er wenn ich ein:
Ach, [wer] wenn ich doch schon im Himmel wär! (278)
Wie in der Einleitung angekündigt, entkleidet er die Gedichte des Kantatenkontexts, löst sie aus ihren liturgisch-musikalischen Zusammenhängen, um sie zu eigenständigen titellosen Gedichten für sich selbst sprechen zu lassen. Keine bedeutende, aber nennenswerte Eigenheit dieser Bearbeitungen besteht darin, dass Bernhard die Großschreibung des ersten Buchstabens am Versanfang aufgibt und durch Kleinschreibung ,modernisiert‘. Teil dieses poetischen Verfahrens ist es aber vor allem, aus Kantatenteilen ,neue‘ Gedichte zusammenzusetzen oder bezeichnende Textveränderungen vorzunehmen. Ein Beispiel hierfür ist die folgende Stelle: Im einleitenden Gedicht von Johannes Rist „O Ewigkeit, du Donnerwort“ aus der Kantate 20 verändert Bernhard die Verse:
Mein ganz erschrocknes Herz erbebt
Daß mir die Zung am Gaumen klebt (186)
zu:
Mein ganz erschrocknes Herz erbebt
wenn mir dies Wort im Sinne schwebt.
Eine entliturgisierte Kirchenlyrik gehörte für Bernhard offenbar zu den Erscheinungsformen des Poetischen und der poetischen Erfahrung. Auch diese Gedichte waren im frühen poetischen Kosmos „Weltenstücke“, was seine Anthologie „Erwürgtes Lamm“ eindrucksvoll belegt. Sie gehört zu seinem lyrischen Œuvre und damit zu Bernhards Gesamtwerk. Vor allem aber ist sie Bestandteil des faszinierend Widersprüchlichen in seinem Erscheinungsbild.
Rüdiger Görner, Gegenwartsliteratur. Ein germanistisches Jahrbuch / A German Studies Yearbook, 2014
Teresa Präauer: Als Thomas Bernhard wie Georg Trakl klang
Sören Heim: Die „großen“ Essays anderswo, VII: Thomas Bernhard als Lyriker
THOMAS BERNHARD
Rotweißheiten
Verschlingen kann man das Lebendige
nur rückwärts, ausspeien muss man es aber vorwärts.
Peter Wawerzinek
Zum 15. Todestag – Cornelius Hell: Gott vernichten. Die bislang unbekannte Zensur seines ersten Lyrikbandes wirft ein neues Licht auf Bernhards Verhältnis zur Religion.
Zum 30. Todestag – Archivaufnahmen und Lesungen von und mit Thomas Bernhard
Die Lange Nacht über Thomas Bernhard
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Yossi Sucary: Dem Urteil der Anderen entkommen
die taz, 9.2.2021
Willi Winkler: Ohne Bernhard geht es nicht
Süddeutsche Zeitung, 9.2.2021
Deborah Ryszka: Der Letzte seiner Art
achgut.com, 9.2.2021
Gerrit Bartels: Meister im Demütigen
Der Tagesspiegel, 8.2.2021
Nikolai E. Bersarin: „Die Ursache bin ich“ – Thomas Bernhard zum 90. Geburtstag
bersarin.wordpress.com, 9.2.2021
Matthias Greuling: „Geh her da, Thomas Bernhard“
Wiener Zeitung, 9.2.2021
Felix Müller: „Kein Kritiker hat meine Bücher je verstanden“
Berliner Morgenpost, 9.2.2021
Bernhard Judex: Meister der Irritation
literaturkritik.de, Februar 2021
Marc Thill: Thomas Bernhard, ein Meister der Negation
Luxemburger Wort, 9.2.2021
Die Furche: Zum 90er von Thomas Bernhard
Thomas Bernhard auf perlentaucher.de
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv 1 & 2 +
Internet Archive + Kalliope + KLG + IMDb +
Hommage + Gespräche mit André Müller 1 & 2 +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA
Nachruf auf Thomas Bernhard: Tumba
Thomas Bernhard im Gespräch mit Janko von Musulin, 1967.
Ferry Radax: Thomas Bernhard / Drei Tage Hamburg 6. Juni 1970.


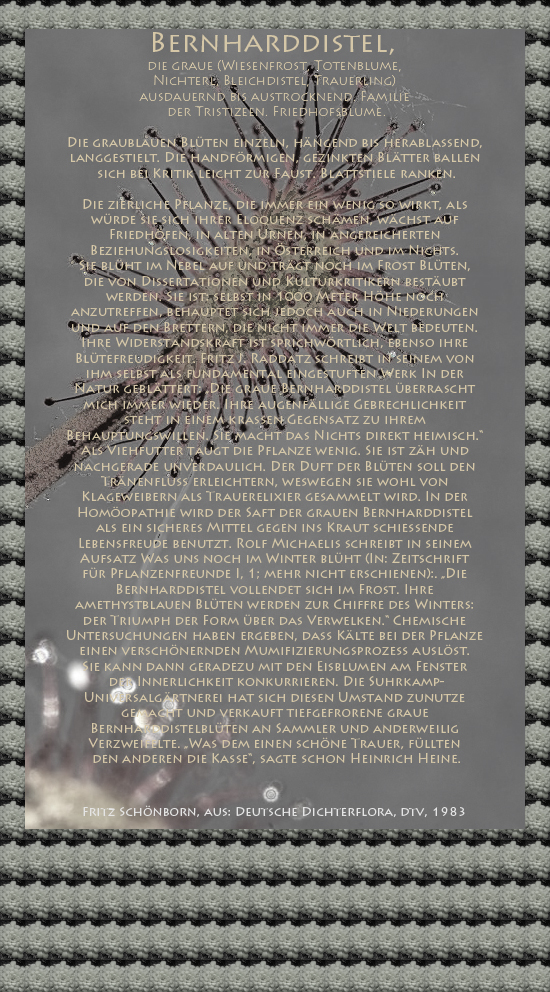
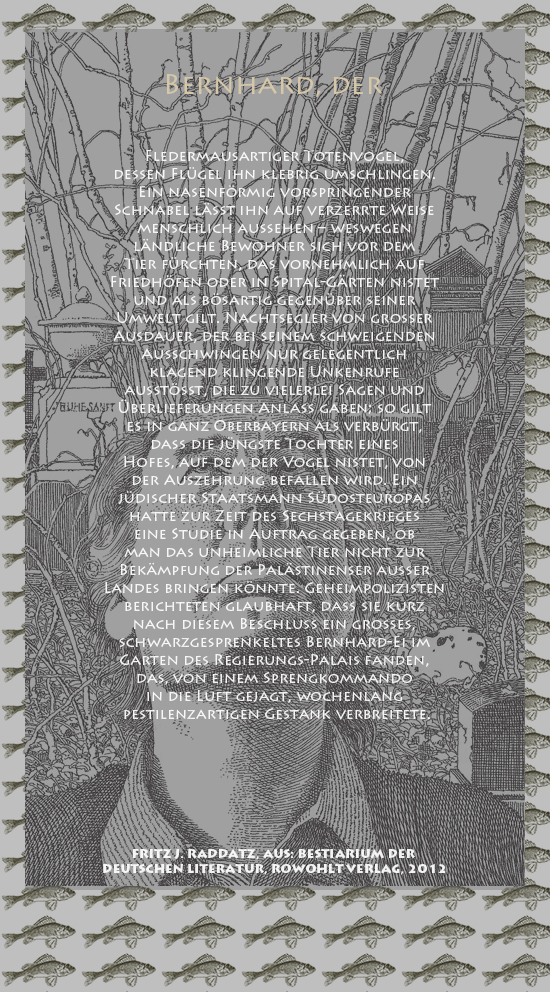












Schreibe einen Kommentar