Wulf Kirsten: erdlebenbilder
POESIE
wenn tod, wenn grab,
dann kommt uns nicht,
was ist das: poesie,
die hingabe ans wort,
das feuer, das in den worten brennt,
der stachel, der schmerzhaft einsticht,
wohin er auch blindlings trifft.
die trauer aller dinge, auch
wenn sie gar kein gesicht haben,
aus dem zu lesen wäre, die aber tot
sind und leben und wie verrückt
anfangen zu leben und wie verrückt
anfangen zu leben, in jeder zeile
sich forttragen, in jeder faser
vibrieren und wissen, was es heißt,
schweigen in schwermut, schweigen
für immer, wenn tod, wenn grab,
viel zu jung sterben die dichter
in Polen.
Nachwort
Je persönlicher, lokaler, temporeller,
eigentümlicher ein Gedicht ist; desto
näher steht es dem Zentro der Poesie.
(Novalis)
In den Versen von Wulf Kirsten hat das deutschsprachige Naturgedicht unserer Tage eine seiner selbständigsten und eigentümlichsten Gestaltungen gefunden. Das Unverwechselbare seiner Gedichte, das sich beim ersten Lesen als eine auffällige, öfter bis zur Widerborstigkeit gehende Rauheit der Diktion darstellt, offenbart sich bei näherem Zusehen als vorrangig bestimmt durch Gegenstand und Vokabular einer- und durch die Grundhaltung des poetischen Subjekts anderseits…
Davon läßt sich angemessen nur mit Blick auf Kirstens Leben und seine Entwicklung sprechen. Er stammt aus einer zwar unberühmten, jedoch keineswegs abgelegenen Landschaft, er kommt aus den linkselbischen Tälern zwischen Dresden und Meißen, an deren Rand er im häuslerwinkel von Klipphausen geboren wurde. Die südwestlich und westlich sich anschließenden fruchtbaren Gegenden, die Wilsdruffer, die Nossener und die Lommarzscher Pflege, gehören zum weiteren Raum seiner Heimat. Dort die straße alt und krumm, der schweifzug über die missingschen hügel, die Höhen um Meißen, gaben ihm, wie es in dem Gedicht „dorfstraße“ heißt, den anfang zur poesie. Damit sind die frühesten Verse aus der Mitte der fünfziger Jahre gemeint; ein kleines Sommergedicht von 1954 redet von den erntewagen, die dorfeinwärts schleifen. Das war in den Buchhalterjahren im benachbarten Taubenheim. Erst der Dreiundzwanzigjährige sollte, als er 1957 nach Leipzig ging, den engsten Kreis der Heimat verlassen. Entscheidende Entwicklungsjahre bringt er so in der betont bäuerlich-handwerklichen Welt seiner Herkunft zu. Das verzögert zwar den eigentlich literarischen und wissenschaftlichen Bildungsgang, doch was zunächst als Nachteil erscheinen mochte, erweist sich später als Vorteil, als entschiedener Lebens- und Weltgewinn. In diesen Jahren, als kaufmännischer Lehrling, auf dem Bau, hinter dem Schreibtisch, unterwegs auf der Straße, erwirbt sich Kirsten jene erstaunliche Sachkenntnis seiner Heimatwelt, die nicht nur jedem bloß gefühligen Verhältnis zu ihr entgegenwirkt, sondern auch einen entscheidenden Wesenszug in ihm zur Entfaltung bringt, die Liebe zur Genauigkeit im Detail, damit aufs engste verknüpft das, was seine Faktenversessenheit genannt werden darf. Die damals in vielseitiger Praxis sich bildende wie erfüllende Verbundenheit mit der dörflichen Heimat- und Arbeitswelt wird für Kirsten noch nach zwanzigjähriger Verlagstätigkeit im klassischen Weimar selbstverständlich sein.
Freilich, derselbe Kirsten, der – sieben Jahre nach der Bodenreform von 1946 – mit neunzehn Jahren in seinen Dörfern die Anfänge der Kollektivierung der Landwirtschaft sehr handfest und sehr bewußt als ein hartes Stück Umgestaltung der allernächsten Wirklichkeit erlebt, liest ungefähr gleichzeitig noch Hauptwerke der chauvinistisch-sentimentalen „Heimatkunst“, die Romane und Erzählungen Ludwig Ganghofers, Rudolf Herzogs und Hermann Löns’; das waren Lieblingsautoren der vorangegangenen Kleinbürgergenerationen. Was er davon allenfalls in die Zukunft mitnimmt, ist eine erste Vorstellung von literarischer Verarbeitung von lokalisierter Landschaft, Sitte und Lebensform. Doch rasch stößt er mit sicherem Gespür für das ihm Gemäßere auf Ehm Welk, vor allem aber auf Oskar Maria Graf; ihn nennt er viel später als eines seiner literarischen Vorbilder. Wie sich Heimat- und Volksverbundenheit mit Zeit- und Sozialkritik, mit drastischer Beschreibung des Dorf- und Kleinstadtlebens, nicht zuletzt mit Autobiographischem verbinden läßt (noch heute liest Kirsten mit Leidenschaft Autobiographien), das lernt der künftige Lyriker zunächst von dem bayrischen Erzähler in New York, mit dem er schließlich in Briefverbindung tritt.
Zu schreiben hat Kirsten erst mit zwanzig Jahren begonnen. Unmittelbaren Einfluß auf die lange Zeit tastenden lyrischen Versuche gewinnen damals Manfred Hausmann, Hermann Hesse und – schon einer der Vergessenen, denen seine Liebe später besonders gehört – Jakob Haringer. Stärker als diese einstigen Vaganten und Neuromantiker wirken freilich bald zwei Naturlyriker, deren Verse an konkrete Landschaften gebunden und von der Dichte der Naturdetails geprägt sind, der aus Franken stammende Friedrich Schnack und der in der Altmark aufgewachsene Peter Huchel. Von ihnen wie von den Neuromantikern bleibt die lyrische Suche lange Zeit hauptsächlich auf den Typus des vorwiegend kurzen Gedichts in vierzeiligen Reimstrophen festgelegt. Wo sie manchmal zu größeren Formen vorstößt, mag dies der frühen Beschäftigung mit dem Tschechen Petr Bezruč und dem Ungarn Attila Jószef, auf die Kirsten ebenfalls hinweist, zu verdanken sein. Zu einer wirklichen thematischen Profilierung gelangen die Versuche jener Jahre, sieht man von ihrer grundsätzlichen Naturnähe ab, nicht.
Um den poetischen Weg zu sich selbst zu finden, bedurfte es der Distanz zur Herkunftswelt ebenso wie neuer Anregungen und Eindrücke. So läßt der Dreiundzwanzigjährige sich zur Arbeiter-und-Bauern-Fakultät nach Leipzig delegieren, wechselt er vom sächsischen Dorf in die sächsische Großstadt über. Die eigentliche Bildungsstätte, sein zweites Zuhause, wird dort die Deutsche Bücherei. In dem gewaltigen Bücherschatzhaus beginnt er zielstrebig Lyrik zu lesen, legt er den Grund für eine riesige, bis heute ständig erweiterte Gedichtsammlung. Die ihm eingeborene Sammlernatur beweist sich hier genauso, wie wenn er zu Fuß oder per Rad wandernd unterwegs ist, wo immer er lebt; das Nützliche, das Bemerkenswerte, das Ungewöhnliche entgeht seinem Beobachter- und Sammlerblick kaum jemals.
Die systematische Lektüre von Lyrik gewinnt eine neue Qualität, als Kirsten nach dem Abitur in Leipzig mit dem Pädagogikstudium für Deutsch und Russisch beginnt und eher nebenher in die Germanistik hineinwächst. Er hört, in Zustimmung und Widerspruch vielseitig angeregt, nicht nur die Literaturvorlesungen Hans Mayers, sondern lernt auch ein Stück praktische Sprachwissenschaft kennen. Der Sammler wird zum freien Mitarbeiter des Wörterbuchs der obersächsischen Mundarten; als eifriger Wortsammler ist er dreieinhalb Jahre in der Wilsdruffer und Lommatzscher Pflege unterwegs und liefert gegen zwölfhundert Belegzettel ab, auf diese Weise die Heimatregion nun mit der inneren Distanz wie mit der wissenschaftlichen Neugier des Philologen durchstreifend.
Diese Zuwendung zur heimatlichen Dorfwelt auf einer neuen, höheren Stufe klärt und festigt nicht nur Kirstens Sprach- und Wortbewußtsein in Richtung auf Herkunft und Geschichte; sie hilft ebenso mit, das eigene lyrische Thema und damit zu sich selbst zu finden. Das heißt damals zuallererst, Klarheit zu gewinnen über die Tradition des deutschen Naturgedichts als Landschaftsgedichts, des Gedichts, das einen geographisch genau bestimmten Naturraum als zugleich menschlichen Lebens- und Arbeitsraum zum Gegenstand hat. In der Aufklärung setzt es mit den Ritzebütteler Gedichten von der Niederelbe des alten Gartenpoeten Brockes und mit Hallers großem Lehrgedicht „Die Alpen“ ein, findet im neunzehnten Jahrhundert seine prägnanteste Verwirklichung in den westfälischen und den Bodenseegedichten der Droste-Hülshoff und hat seine namhaftesten Vertreter in unserem Jahrhundert in Albin Zollinger, Theodor Kramer, Peter Huchel, Erich Jansen und Johannes Bobrowski. Sie alle hat Kirsten genau gelesen, in ihren Gedichtbänden und Einzeldrucken, in Anthologien und Zeitschriften verfolgt, Kramer, Jansen, Huchel und Bobrowski später auch ausdrücklich als Vorbilder benannt. Jeder von ihnen hat, sehr verschiedenartig motiviert und in je eigener Sprache, den heimatlichen Raum nicht nur als scharfgesichtig erfaßte Natur, sondern zugleich als historische, vor allem als soziale Realität ins Gedicht gebracht. Daneben studiert Kirsten die wenigen selten gewordenen Bände der Dresdner Zeitschrift Die Kolonne des Berliner Kreises um Peter Huchel, Günter Eich, Horst Lange, Oda Schaefer, Elisabeth Langgässer, aber ebenso die klassische Moderne, Brecht und Benn und was an neuer zeitgenössischer Lyrik dem allzeit Findigen und Fündigen erreichbar ist. Deutlichen Einfluß auf die eigenen Versuche gewinnt zu Beginn der sechziger Jahre vorübergehend der Hamburger Peter Rühmkorf mit der aggressiven Zeitkritik seiner ironisch-sarkastischen, Vulgär- wie Wissenschaftsjargon einbeziehenden Reimverse, ebenso dessen frühverstorbener Freund Werner Riegel.
Die allmähliche Versicherung der eigenen Tradition hat Kirsten, so zeigt sich, nicht in die Enge geführt; Heimatdichtung alten Stils, gar Heimattümelei, sind ihm nie eine Versuchung gewesen. Auch was er an Kunsttradition aus dem engeren Heimatraum in diesen Jahren aufnimmt, steht dem völlig entgegen, die Malerei und Dichtung des Expressionismus in Dresden bis in ihre vergessenen und verschollenen Vertreter, für die eigenen Intentionen wichtiger noch die Dresdner Neue Sachlichkeit mit Otto Dix an der Spitze, schließlich der von ihr herkommende Arbeiter-, später vor allem Bauernmaler Curt Querner (den Kirsten zuerst 1962 durch einen Essay von Hellmuth Heinz, später auch persönlich kennenlernt und bis zu dessen Tod besucht). Als er 1964 seine germanistische Examensarbeit schreibt, wendet er sich keinen sächsischen Dichtern, auch nicht berühmten Namen und Autoritäten, sondern solchen zu, die im Schatten der Großnamigen verblieben; er schreibt über den schwäbischen Klassizismus, über die vergessenen Zeitgenossen Schillers und des jungen Hölderlin.
Das eigene Thema und die eigene Sprache findet Kirsten während der Leipziger Studienjahre nicht schnell und sicher eher schrittweise und auf Umwegen. Die frühesten Verse, die er später, als er den Band satzanfang (1970) zusammenstellt, gelten läßt, stammen von 1961/62. Kurz vorher erst gelang auch die Lösung vom (nie ganz aufgegebenen) Reimstrophengedicht in die freiere Form aus größeren und reimlosen Versgruppen. In Kirstens Verständnis verlangte sie einen sicheren und festen Schluß des Gedichts; auf ihn hin arbeitet er die Gedichte später immer zielbewußter. Auch das ist ein langer Prozeß. Der weltoffene, geistig höchst flexible und vielseitig interessierte Kirsten ist, was die eigene Entwicklung angeht, von eher schwerer und spröder Natur. Was er tut, das tut er langsam und gründlich, bedenkt es umständlich und skeptisch, oft melancholisch. Was er schreibe, ist nie viel und ist immer ,gearbeitet‘, wenn man weiß, was das heißt: in der Sprache arbeiten. Das erinnert an die Steinmetzarbeit seines Vaters. Als er nach einem schwierigen, beinahe abenteuerlichen Jahr in Freiberg (das Lehrerdasein erwies sich ihm als völlig unlebbar) 1965 in Weimar Lektor im Aufbau-Verlag wird, erhält diese Arbeit in und mit der Sprache auch ihre weitausgreifende berufliche Dimension, die er gewissenhaft, fast darf man sagen: besessen ausfüllen wird. Bald betreut er die Reihe der Auswahlbände zur deutschsprachigen Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts und die vielbändige Ausgabe der Gesammelten Werke Johannes R. Bechers, setzt sich besonders für Autoren wie Oskar Maria Graf, Joseph Roth und Ernst Weiß ein und bereichert das Verlagsprogramm, aus der Weite seines Blickfelds und seiner Lektüre und auch in älteren Erbe-Bereichen, durch immer neue Anregungen und Vorschläge.
Mit Beiträgen in fünf Anthologien und mit einem Poesiealbum stellt sich Kirsten in den Jahren 1966 bis 1968 erstmals einem breiteren Publikum vor; da ist er Anfang dreißig. Das Warten, die geduldige Arbeit, Selbstdisziplin und Selbstkritik zahlen sich aus. Er ist sofort als eine völlig neue Stimme innerhalb der Lyrik unseres Landes kenntlich. Aus keinem Vers ist ein direktes Vorbild herauszuhören, weder Huchel noch Kramer noch Brecht und gleich gar nicht Bobrowski, dem er bereits im Sommer 1961 Gedichte vorlegte und der wenige Jahre später für so viele junge Lyriker zum nur allzu deutlich kopierten Vorbild wird. Kein begabter Anfänger, gewiß auch kein Fertiger präsentiert sich da, wohl aber einer, der sich selbst gefunden hat. Was er anderswo lernte, ist ins Eigene eingeschmolzen.
In seinem kleinen Essay „Entwurf einet Landschaft“, der den ersten Gedichtband begleitet, gebraucht Kirsten versteckt eine berühmte Formulierung Herders, wenn er eine auf sinnlich vollkommene Rede abzielende Gegenständlichkeit als möglichen Gewinn von landschaftsgebundener Naturlyrik bezeichnet. In den Kritischen Wäldern (1769) hatte Herder „das Wesen der Poesie“ als „sinnlich vollkommene Rede“ bestimmt. Darauf hatte sich – ohne daß Kirsten dies wissen konnte – schon Bobrowski 1960 in einem Vortrag über moderne Lyrik bezogen. Diese sinnlich vollkommene Rede der Poesie ist für den Jüngeren eine Sache der Gegenstände wie der Sprache.
Die Gegenstände seiner Verse werden desto konkreter und plastischer, je genauer und sicherer Kirsten sein Thema und ineins damit sich selbst findet. Gefunden ist es, als am Ende des Jahres 1964 in sechs großen reimlosen Strophen das Gedicht „die erde bei Meißen“ entsteht. Mit kühnen Strichen wird die Heimatlandschaft in herbstlich-deftiger Vielgestalt und Weite, aber auch in ihrer prallen Gegenwärtigkeit und ansatzweise in ihrer sozialgeschichtlichen Dimension entworfen; die stinkenden rübensilos und die ungeschlachten blechvögel der Agrarflugzeuge gehören ebenso dazu wie die Erinnerung an die gallebittere Zeit der fronde. Mitten darin steht breitspurig, mit großer Sicherheit alles überblickend, das lyrische Ich. Das hat etwas vom Pathos von Bezručs autobiographischen Gedichten. Die eigentlich zungelösende Kraft ging jedoch nicht von Bezruč, sondern von Bobrowski aus, und weniger von seinen Gedichten als von seinem Roman Levins Mühle, der im September 1964 erschien und den Kirsten sofort las. In diesem Roman hatte alles hand und fuss, ich habe meinen Bobrowski und bin im siebten himmel, hieß es im Oktober, inmitten einer beruflich-gesundheitlichen Krise, in einem Brief an Freunde. 1971 schreibt Kirsten rückblickend an H.D. Schäfer:
Huchel faszinierte mich schon lange, schon seit Anfang der fünfziger Jahre. Es mußte aber erst Bobrowski kommen, insbesondere sein Roman Lewins Mühle, um mich freischwimmen zu können.
Die wirklichkeitssatte, der Umgangssprache, der mündlichen Rede des Volks so stark verpflichtete Erzählprosa Bobrowskis gab erst den Mut und die Kraft, die eigene Heimatwelt in all ihren topographisch-landschaftlichen; historischen, sozialen, ökonomischen und sprachlichen Dimensionen als sein Thema im Gedicht anzunehmen und mit poetischer Freiheit und Konsequenz herauszustellen. Daß „die erde bei Meißen“ als unmittelbare Folge der Lektüre von Levins Mühle entstand, betont Kirsten noch heute. Unmittelbar darauf entstanden 1965 weitere thematisch zentrale Gedichte, darunter die „sieben sätze über meine dörfer“, die diese Überschrift erst in der zweiten, jetzt erst entsprechend gegliederten Fassung als geheime Huldigung an Bobrowski erhielten, dessen Roman im Untertitel „34 Sätze übet meinen Großvater“ hieß. So verhilft der Ost- und von weiterer Herkunft Westpreuße Bobrowski im Jahr seines frühen Todes dem sächsischen Kirsten zur lyrischen Darstellung der meißnischen Agrarlandschaft und ihres bäuerlichen Werktags, ohne daß irgendeine Art von Abhängigkeit entsteht. Wo der eine in seinen Versen von einer „Landschaft, die mit allem Recht verloren ist“ (J. B.) auf, traumhaft-visionäre Weise handelt, redet der andere in drastischer Deutlichkeit von der heutigen und ganz gegenwärtig-seinigen Welt.
Dieser bäurische Werk- und Alltag umschließt die kollektive Landwirtschaft und den Einsatz der modernen Technik. Was beide an wirklichem Fortschritt zu leisten vermögen, ist zunächst sichtbarer als die auch möglichen Gefährdungen und Verluste. Das gibt Kirstens Gedichten aus der Mitte der sechziger Jahre einen energischen und optimistischen Grundzug und macht es verständlich, daß einige Male, am deutlichsten in Kyleb, der forcierte Zukunftston Volker Brauns, der 1964/65 erste Gedichte veröffentlicht, als allgemeiner Sprachgestus vernehmbar wird.
Mitten in diese bäurische Gegenwarts- und Heimatwelt stellt Kirsten die eigene Biographie, das eigene Ich als dazugehöriges und mittätiges Subjekt. Aus einem geschlecht von handwerkern / und kleinbauern stammend, das nie aus dem Dunkel seiner Geschichte trat, versteht er sich als armer / karsthänse nachfahr, weiß er sich mit seinen duzbrüdern, / den kutschern und kombinefahrern… ein herz und eine seele. Er steht mitten in dieser Welt und doch ihr auch wieder gegenüber. Er begreift sich als ihr Sohn und zugleich als ihr chronist (die Vokabel findet sich im Schluß der ersten Fassung des Gedichts „landgasthof“). So ist die Zugehörigkeit alles andere als naiv. Wohl begegnet er uns auch ganz unmittelbar als Arbeiter, als mitwerktätig, aber weit häufiger doch als der Wanderer, als Fahrender, von Wegen, Straßen, Chausseen ist oft die Rede. Dieses Wandern ist ein Durchwandern, fast ein Durcharbeiten der Landschaft. Es schließt jedes herkömmliche „Erleben“, jede romantisierende Sicht aus. Nicht das Subjekt, sondern die Welt in der es sich vorfindet, ist Thema und Mittelpunkt von Kirstens Gedichten; das vor allem unterscheidet sie von den manchmal verwandt erscheinenden Gedichten des Landsmannes und späteren Freundes Czechowski. Die Kindheitsgedichte nicht mitgezählt, begegnet das lyrische Ich nur wenige Male noch so kraftvoll und scharf konturiert wie in „der erde bei Meißen“ und in, den „sieben sätzen über meine dörfer“. In der Hälfte der Gedichte des ersten, in zwei Drittel gar der Texte des zweiten Gedichtbandes ist kein Ich, kein Wir ausdrücklich anwesend; das hat als symptomatisch zu gelten. Die eigene Biographie ist vorrangig Mittel zum Zweck; nicht eigentlich sie, sondern die biografien aller sagbaren dinge / eines erdstrichs, das unberühmte leben der leute vom Dorf will der Autor „ans licht bringen“. Deshalb vor allem ist das Gefühl fast überall zurückgenommen, dominieren beschreibende, epische, manchmal gar balladeske Züge (bis hin zur späteren tatsächlichen ballade von den Zipser Rumäniendeutschen), strotzen die Gedichte von Faktenfülle und –dichte. Das strophische Gedicht tritt zurück, der große Versblock breitet sich aus. Erst von dieser chronistischen Grund- und Zurückhaltung, ja Bescheidung des lyrischen Subjekts her erklärt sich auch das Eigentümliche von Kirstens Sprache.
Am Schluß des Titelgedichts „satzanfang“ heißt es von dem unberühmt-gelobten Land: seine rauhe, rissige erde / nehm ich ins wort. Das ist nicht redensartlich oder metaphorisch, sondern wörtlich gemeint. Das genaue, das zutreffende Wort, wie es Kirsten im meißnischen Raum für jedes topographische, bäurisch-landwirtschaftliche und handwerkliche, aber auch allgemeine Lebensdetail sucht und findet, wird zum eigentlichen Sprachfundament des Gedichts. Mit seiner Hilfe vor allem erfüllt er, was Bobrowski 1961 die „Präzisierung der gemeinten Inhalte und der Bilder“ genannt hatte. Vom einzelnen charakteristischen Wort her oder, das ist dasselbe, auf dieses hin wird das Gedicht entworfen und gefügt. Wenn darin so etwas wie ,Erlebnis‘ noch faßbar ist, so zuallererst mittelbar in diesen Worten, die Kirsten „Grundworte“ nennt; es sind Erfahrungen und Erkundungen; die sich in ihnen spiegeln. Daraus hat er im Anfang fast eine ganze Theorie gemacht; das war für sein poetisches Selbstverständnis und Selbstbewußtsein vermutlich wichtiger als für seine Verse. Entscheidend ist die Unvoreingenommenheit, mit der er ältestes bäurisches Vokabular und den Wortschatz modernster Technik und Wissenschaft nebeneinanderstellt, wozu noch allerlei betont umgangssprachliches Wortmaterial kommt. Was aus konventioneller Sicht heterogen erscheint und doch die Kompliziertheit des Lebens von heute auch auf dem Lande bezeichnet, gewinnt in Kirstens Versen eine eigene poetische Qualität, die mit dem, was man ehemals ,schön‘ nannte, nichts mehr zu tun hat. Das führte anfangs öfter zu einer Überfülle des Spezialvokabulars, die aber ästhetisch eher als expressiv-barocke Ballung und Steigerung denn als Zeichen der Unrast oder Nervosität des Suchens zu gelten hat. Ist diese ,barocke‘ Phase im ganzen auch längst zu Gunsten von Gelöstheit überwunden, so ist Kirstens Poesie doch ohne sie nicht zu denken; ein Nachhall bleibt bis heute vernehmbar. Auch bekennt er sich gesprächsweise sehr offen und sehr einfach zu dem Nebenziel, mit solchem Zugriff einen nicht geringen Fundus alter Worte und Wendungen wenigstens an dieser Stelle vor dem gänzlichen Vergessenwerden retten zu wollen.
Darüber hinaus setzt Kirsten freilich in einem noch viel rigoroseren Sinn auf das Wort schlechthin. Das spiegelt sich schon in zahlreichen und ungewöhnlichen wort-Bildungen wider: Wo mitten im Gedicht wortbiegungen, wortfelder, wortfiguren, wortflügel, wortgespenster, wortmassen, worttrost, wortwurzeln stehen, wird damit ein höchst reflektiertes Verhältnis zur Sprache, wird Sprachbewußtsein zuallererst als Wortbewußtsein ausgewiesen. Davon spricht später ausdrücklich der Prosatext „der schreibtisch“, darin Kirsten sich als wortsüchtig erklärt. Dieser gezielte Einsatz des Einzelworts schlägt sich bald in der Häufung einsilbiger Wörter, bald im betonten Gebrauch ungeläufiger Wortkompositionen, mehr noch in der dichten Fügung ungewohnter, von Sachgehalt schwerer Vokabeln, auch im unvermittelt-kraftvollen Einsatz von Orts- und Familiennamen oder von bald anachronistisch-altertümlichen, bald modisch-modernen Fremdwörtern nieder. Er steht in engem Zusammenhang mit dem aufgerauhten, ,körnigen‘, zuweilen schier widerspenstigen, oft auf vertrackte Weise drastischen Duktus und Rhythmus von Kirstens Verssprache überhaupt. Auch ihre nicht selten derbkühne Metaphorik und ihre von Anfang an auffällige, später ständig zunehmende Prosanähe erwachsen daraus. Metrisch wird der Leser vor allem durch den Gebrauch des im deutschen Gedicht nie eigentlich heimisch gewordenen Spondeus, des Versfußes aus zwei betonten Silben, auf das Einzelwort verwiesen. Worte wie plumpsack oder einaug, schreibfleiß oder laubschleier, aber auch der Zusammenprall betonter selbständiger einsilbiger Worte leisten rhythmisch dem im Gedicht üblichen Sprach- wie dann dem Lesefluß erheblichen Widerstand; nicht die lyrische Periode, sondern das einzelne Wort oder die einzelne Wortgruppe . schieben sich in den Vordergrund, In alledem bekundet sich zugleich ,in prinzipielles Mißtrauen gegenüber jeder ,schönen‘ Rede, jedem herkömmlichen Sprachwohllaut. Wo er in seltenen Fällen und mit wenigen Worten doch zugelassen, empfängt er in solcher Umgebung einen neuen Glanz. Wenn Kirsten seit 1978 auch Prosagedichte schreibt, so ist das eine stilistisch-poetische Konsequenz, die zu erwarten war.
So sehr das lyrische Ich selbst zurücktritt oder verbal gar verschwindet, so sehr ist es in der allgemeinen Subjektivität der Verse doch ständig gegenwärtig. Diese äußert sich nicht nur in der schwerlippig-charakteristischen Sprache, im rauhen Rhythmus der Gedichte, sondern erst recht in den syntaktischen Verknappungen und Ellipsen. Die Bevorzugung unvollendeter Sätze, verbloser Aussage- und Bilderketten, eines summierenden Stichwort- und Partizipienstils deuten auf eine Darstellungsweise, die rigorose Verkürzung und Verdichtung anstrebt. Auch das verhindert jede leichte Lektüre und gibt keinen bequemen Realismus ab. Wenn mehrfach inmitten dichter Sachdarstellung Worte wie wirklichkeit oder ähnliche Abstrakta stehen, so ist das nur ein Indiz unter anderen für die Abwesenheit jeder platt-realistischen Tendenz; für das Vorwalten einer eher verfremdenden Distanzhaltung im Schreibprozeß, die auf ästhetische Souveränität gegenüber eben jenen Sachen aus ist, um derentwillen das Gedicht geschrieben wird. Erst diese Distanzhaltung erlaubt Kirsten auch jene grotesken, satirischen und ironischen Formulierungen, einschließlich der hochironischen Zitate, die vollends mithelfen, daß weder der Dichter noch der Leser in der dargestellten Welt sich wohlig einnistet.
„Die erde bei Meißen“ ist der Boden, in dem Kirstens Poesie ihr Fundament hat, von dorther gewinnt sie in stets erneuter Rückkehr bis heute gleichsam antäisch die Kraft und die Sicherheit ihrer Sprache. Das beweist noch der letzte Text dieses Bandes, der ganz in die Gegenwart gehobene abglanz eines Erntetags in der sächsischen Dorfkindheit. Als jedoch die Heimatwelt – primär als Kindheits- und als Arbeitswelt – sozusagen im ersten Durchgang poetisch Gestalt gewonnen hat, dringt Kirsten in den siebziger Jahren von ihr aus in neue Dimensionen vor, die bisher bestenfalls gestreift wurden. Seine Poesie gewinnt an Weite, Tiefe und Aktualität.
Hatte in den sechziger Jahren die Einbeziehung der kollektiven Landwirtschaft, der modernen Agrartechnik, der alten und der neuen Fachsprache in die Lyrik als neu und kühn und als im bisherigen Sinn ,unlyrisch‘ zu gelten, so nun die Rigorosität, mit der im Gedicht auch Schattenseiten der modernen Entwicklung benannt werden. Nur allmählich wurde erkannt, daß die soziale wie die Umweltentwicklung auch im Sozialismus widersprüchlicher verläuft, als Theorie und Elan der ersten Aufbaujahrzehnte nach dem Krieg glauben machten. Es spricht für Kirstens frühe kritische Intentionen, daß er schon 1963, noch vor so optimistischen Versen wie „Kyleb“, die erste Fassung des später „eisgang“ betitelten Gedichts schrieb, damals zunächst als zweiten Teil zu einem später verworfenen „brief aus der provinz“ voll ironischer Tristesse. Als „epilog“ erschienen die Verse ein Jahr später an entlegener Stelle mit drei andern Gedichten im Druck. Dann schob sich die eigentliche Konstituierung des meißnischen Landschaftsthemas machtvoll dazwischen. Bei der Zusammenstellung des ersten Gedichtbandes blieb das Gedicht beiseite, im Gegensatz zu den 1964 ebenfalls publizierten Priesterbäk-Versen. Zehn Jahre nach der ersten Niederschrift nimmt Kirsten das Gedicht wieder vor, kürzt es, komprimiert es, macht es strenger und schlanker, ohne die Konzeption zu verändern. Wohin eine unkontrollierte Entwicklung von Chemie und Technik führt; teilt das Gedicht in schlimmen Befunden mit, die ihre volle poetische Evidenz freilich erst durch die eingangs angedeuteten alten Bilder einer utopisch-unvergänglichen heilen Welt erhalten. Solcher Rückgriff schlägt auch in helleren Versen nie in Verklärung oder Nostalgie um, sondern verbleibt stets im Dienst von Kritik und Mahnung. Wird, wie in dem großen Christian-Wagner-Porträt, ein vergangener unversehrter, dämonisch erfüllter Naturbegriff erinnert, so in engstem Zusammenhang mit der Mühsal des bäuerlichen Werktags und mit dem Ausblick auf die gefährdete Bewohnbarkeit der Erde heute und morgen. Vergangene Größe hilft auch im Schluß des Titelgedichts „der bleibaum“ ein Stück schlimme Gegenwart ins Wort bringen. Wie hier ungenannt Montaigne (geist der gesetze) und Goethe (füllen wieder busch und tal), mit vollem Namen zuletzt Sappho vom Anfang der abendländischen Lyrik zitiert werden, um mit sublimer Ironie die vom Menschen verderbte heutige Natur zu verdeutlichen, das zeigt eine Höhe und eine Kraft des poetischen Zeitbewußseins an, wie sie sich auch in Kirstens Gedichten nur selten findet.
Das andere nicht weniger schmerzliche kritische Thema ist der Untergang des alten Dorfs und die Zerstörung der überkommenen bäurischen Landschaft. Nirgendwann und -wo will Kirsten ins Gewesene zurück, aber er hält schonungslos, sarkastisch, zuletzt zornig fest, was sich vor seinen Augen schier rasant vollzieht und was ein Recht darauf hat, poetisch benannt und festgehalten zu werden. Auch im Sozialismus bleibt der Mensch ein Mensch mit Vergangenheit, Herkunft und Kindheit. Von dorther ist er zu gutem Teile geprägt und in wesentlichen emotionalen Lebenswertungen bestimmt. Wenn das Dorf in seiner durch Jahrhunderte gewachsenen organischen Struktur und Lebensweise schwindet, wenn Territorialplanung und Großraumwirtschaft die Landschaft der Kindheit vernichten und altvertraute Lebensformen auflösen, so sind das schmerzhafte Prozesse, die objektive, auch psychische Verarmungen einschließen. Jeder Fortschritt hat auch seine Verlustseite. Dies ins Bewußtsein zu bringen und gleichzeitig zur Rettung des vielleicht noch Rettbaren beizutragen, gewachsene Landschaft als für den Menschen für alle Zukunft notwendiges Lebensreservat bewußt zu machen, da es die vom Menschen ,unberührte Natur‘ nicht mehr gibt, das ist eine legitime Aufgabe von Dichtung, die wirklich Gegenwartsdichtung ist, nicht anders wie einer Gesellschaft, der es um den Menschen geht. Kirsten findet eindrucksvolle Bilder. Im poetisch gesehen surrealen mahltrichter, der wörtlich genommen selbst in die bäuerliche Welt gehört, verschwinden die alten Dinge, die alten Worte, das Dorf selbst (dorf); der reißwolf des fortschritts verschlingt die Landschaft der eigenen Kindheit, die zugleich die Welt jener ist, die als bodenreformpioniere vor einem Vierteljahrhundert Träger des notwendigen und sinnvollen, des revolutionären Fortschritts auf dem Lande waren (das haus im acker). Was anstelle gewachsener Kultur die weltmaschine (wie das Fernsehen in einer früheren Fassung von „lebensspuren“ heißt) an Lebens- und Kunstsurrogaten vermittelt, das vermag Kirsten nur mit Spott aufzuzählen. Solche Bilder und Verse tragen in ihrer Härte und Offenheit dazu bei, jenes engagierte kritische Gegenwartsbewußtsein zu entwickeln, ohne das menschenmögliche, menschenwürdige Zukunft nicht mehr vorstellbar ist.
Diese rigoroseren Gedichte seit Beginn der siebziger Jahre sind wie selbstverständlich eingebettet in jene Texte, die zum kleineren Teil das meißnische Landschaftsthema ergänzend ausbauen, zum größeren Teil aber geographisch und historisch in die Weite und in die Tiefe führen. Beides gehört von Anfang an zusammen. Auch hier knüpft Kirsten an Vor-Meißnisches an. Die „erinnerung an Priesterbäk“ von 1963 griff ins Mecklenburgische aus und bot ein Stück gewissermaßen nachgelassener Kriegslandschaft, die er vier Jahre zuvor durchwandert hatte und die jahrelang ihm keine ruhe ließ, wie er noch im Oktober 1964 schrieb. Schon da war Landschaft als massive Vergegenständlichung von Geschichte erfahren und gestaltet. Trat das Ineinander von Geschichte und Landschaft in den Gedichten der sechziger Jahre nur im Ansatz und in betont sozialgeschichtlicher Perspektive hervor, so wird es jetzt in seiner Komplexität begriffen. Was bisher vor allem als überwundene, oder überstandene Geschichte erschien, stellt sich nun zunehmend als vergegenwärtigte und verdinglichte Geschichte dar. Darin war Bobrowski mit den geschichtsträchtigen Landschaften seiner sarmatischen Lyrik der unmittelbare, nicht übersehbare Vorgänger. Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit der immer weiter ausgreifenden poetischen Landnahme. Während viele von Kirstens Lyrikkollegen in fernste Landschaften ausschweifen, um dort noch schöne oder gar exotische Natur zu finden, erarbeitet, erobert er sich die dem „Meißnischen“ benachbarten Weltgegenden, Lößnitz und Erzgebirge, Lausitz, Halle, Weimar und Thüringen, Böhmen und Mähren, schließlich Rumänien (eine Mittelasienreise bleibt bezeichnenderweise ohne lyrisches Echo), dazu die städtische Existenz.
Das erst jetzt voll ausgebildete Geschichtsbewußtsein äußert sich zunächst im erfaßten Material der Geschichte, das vom Bauernkrieg bis in die Gegenwart reicht. Wenn das Gedicht „abendgang“ am Schluß die blutspur der erhebungen in Halle von 1923 aufgreift, so assoziiert es gleichzeitig eingangs die sächsische Feudalgeschichte als Geschichte des Hauses Wettin, dessen gleichnamige Stammburg unweit von Halle im Saalkreis liegt. Ähnlich wird eine fahrt durch Mähren zugleich eine Fahrt durch seine Geschichte. Auch im Historischen geht es Kirsten um Konkretheit, um genaue Namen, um die unbeschnittene Aufnahme des tatsächlich Gewesenen. Als der dinge totes gedächtnis liegt Geschichte zum Ablesen greifbar in der Landschaft. Wenn er ihre Zeichen liest, geschieht auch das in jener grundsätzlichen Distanzhaltung, die jede Sentimentalisierung, jede Verklärung aus- und die suggestiv-kritische, nicht selten ironische, immer freilich betroffen-nachdenkliche Darstellung einschließt.
Gleichsam die Innenseite dieses Geschichtsbewußiseins ist die Wahrnehmung des Prozesses, der Gegenwart und Vergangenheit verbindet, des Vergehens. Geschichtlichkeit wird vom einzelnen zuallererst als Vergänglichkeit erlebt. So ist Geschichte immer auch mahlgang der geschichte, das unwiderrufliche Hin- und Verschwinden der vom Menschen geschaffenen Dinge, der schlichten wie der bedeutsamen Zeugen seines Daseins und Wirkens. Subjektiv erfährt es der Mensch vor allem als sein Altern. Altern und Vergehen des Menschen und seiner Dinge gehören in Kirstens Gedichten zum vollen Bild einer auf elementare Weise geschichtlich verstandenen Welt. Gelassen, selbstverständlich und mit Würde stehen der alte Mensch und die alten Dinge in seinen Versen. Indem er ihre Vergänglichkeit ins Bewußtsein hebt, macht er auch den Wert ihrer Einmaligkeit bewußt. Das fordert nicht weniger als existentiell den tag ausmessen in aller schönen und schrecklichen Vielfalt des Lebens und heißt eine der ältesten Aufgaben der Dichtung erfüllen, nämlich Gedächtnis zu stiften, den Reichtum des Vergangenen und des ständig Vergehenden für Gegenwart und Zukunft aufzubewahren in geformter Sprache.
Hierher gehören dann auch die Widmungs- und Porträtgedichte Kirstens, die, selber landschaftsgesättigt, die Landschaftsgedichte seit 1965 begleiten und in der hauptsächlich von Bobrowski begründeten, bald sich breit entfaltenden Tradition des Personengedichts sofort einen eigenen Platz einnehmen. Vorwiegend sprechen sie von Dichtern und Künstlern, die ihr Lebenswerk härtesten Bedingungen abrangen oder die tragisch gescheitert sind. Ihnen gilt Kirstens deutliche Sympathie, an ihnen orientiert sich offenbar sein eigenes Lebensverständnis, das – eben weil es so dicht an den Sachen bleibt – von jeher ein tiefernstes, ein verhalten melancholisches war. Trauer schwingt in vielen seiner Gedichte untergründig mit, in den immer weniger lokalisierbaren Abend- und Herbstbildern vornehmlich. Auch jene Texte, in denen es immer entschiedener um Grundsätzlichkeiten des Lebens geht, stehen auf solch verschwiegenem Trauerfundament. Es unsichtbar zu machen, scheint nicht die geringste Aufgabe der derbdrastischen, ironischen und humoristischen Verse zu sein. Die verfremdende Distanzhaltung trägt dazu das Ihre bei. Indem sie zugleich die ästhetische Freiheit inmitten der Faszination durch die Sachen bewirkt und festhält, schafft sie immer neuen Raum für einen sehr eigentümlichen und erweiterten Realismus, der, mit Novalis zu reden, „dem Zentro der Poesie“ nahesteht.
Eberhard Haufe, Nachwort
Wulf Kirsten
ist in der Nachfolge Johannes Bobrowskis und Peter Huchels einer der großen Dichter in deutscher Sprache. Am 21. Juni 2004 feiert er seinen 70. Geburtstag. Aus diesem Anlaß erscheint diese Sammlung alter und neuer, bislang unveröffentlichter, Texte, welche die Entwicklung eines Dichters aufzeigt, der sich von Anfang an, wie die ersten Texte belegen, zur Aufgabe gemacht hat, der Sprache jene Gefühlsfelder wiederzugewinnen, die in den Worten bewahrt sind. Sein Blick richtet sich denn weniger auf seine gesellschaftskritische Zeitgenossenschaft als auf die ihn umgebende üppigreiche Natur, wenn auch die Zeitgeschichte stets im Hintergrund miterlebt ist.
Ammann Verlag, Klappentext, 2004
Der poetische Chronist
– Zum 70. Geburtstag von Wulf Kirsten
Die „Erde bei Meissen“, die der Mittelpunkt seiner Welt war, hat ihr Gesicht verändert. Wulf Kirsten, der passionierte Wörtersammler, Literaturhistoriker und Naturdichter, vernimmt die Grundtöne seiner Dorfkindheit weitab in der sächsischen Provinz nur noch ganz leise. Die „alten dörfer hinter den hügelriffen“ sind untergegangen, die „veilchenzeit“ enthält keine Verheissungen mehr. Der poetische Chronist kann als „Flurgänger“ nur noch akribisch genau die Verluste aufzeichnen.
Im Rittergutsdorf Klipphausen, das gerade einmal sechzig Häuser und dreihundert Seelen umfasste, ist Wulf Kirsten vor siebzig Jahren geboren worden. In dieser Gegend auf den Elbhöhen zwischen Dresden und Meissen hat der „entschlossene Landgänger“ die Geduld der Naturbeobachtung gelernt; dort hat er begonnen, die Flussläufe, Roggenfelder, Brennnesselwinkel, Pferdeställe und Feldscheunen zu erforschen und durch „inständiges Benennen“ in Poesie zu verwandeln. Er sei „der Okularinspektionen nie überdrüssig geworden“, bekennt der Erzähler in der Kindheitsgeschichte „Die Prinzessinnen im Krautgarten“.
Der Sohn eines Steinmetzen hat viel von der Arbeitsweise seines Vaters in die poetische Produktion hinübergerettet. Vor der Verfertigung seiner Gedichte versammelt er alle notwendigen Werkzeuge um sich, um dann beharrlich „aus wortfiguren standbilder (zu) setzen“, wie es in einem seiner Gedichte heisst.
Der junge Mann aus dem Häuslerwinkel liess sich in den fünfziger Jahren zur „Arbeiter-und-Bauern-Fakultät“ nach Leipzig delegieren, lernte die Weltliteratur kennen und faszinierte sich an seinen „Erweckungsbüchern“: an Gedichtbänden von Peter Huchel und Johannes Bobrowski und einer Anthologie von Wolfgang Weyrauch. Seine Sprachempfindlichkeit schärfte Kirsten ab 1962 durch die Mitarbeit am Wörterbuch der obersächsischen Mundarten, die es ihm nach eigener Aussage ermöglichte, „abgesunkenes Wortgut wieder auszugraben und in die Poesiesprache als Kolorit und Stilschicht hineinzunehmen“. Angestachelt von so viel Mundartenkunde, begann Kirsten alsbald sprachkritische Fundbücher anzulegen und seltene Wörter seiner bäurischen Herkunftswelt darin zu archivieren. Aus dem Spracharchäologen wurde bald einer der eigensinnigsten deutschen Dichter, der sich an der erdverbundenen Landschaftsmalerei seiner Vorbilder Huchel und Bobrowski orientierte.
„auf wortwurzeln fasse ich fuss“: Dieser frühe Vers Kirstens, formuliert in seinem Débutband satzanfang von 1970, ist bis heute das Sprachfundament seiner Lyrik geblieben. Kirsten war einer der ersten Dichter in der DDR, die die Destruktivkräfte einer rücksichtslosen Industrialisierung anprangerten. In seinem Gedichtband der bleibaum (1977) spricht er von der irreversiblen Vergiftung jener Landschaften, die den Grundstoff seiner Poesie bilden.
„Bei mir“, hat Kirsten in seiner Dankrede zum Peter-Huchel-Preis 1986 gesagt, „läuft so ziemlich alles auf Chronik und Lebensbericht hinaus.“ So werden auch in seinem Spätwerk, dem Gedichtband Wettersturz (1999) und den Erzählungen Die Prinzessinnen im Krautgarten (2000), immer wieder Urszenen seiner „biblisch-feudalen“ Kindheitsverhältnisse heraufbeschworen. Das lyrische Gesamtwerk Wulf Kirstens hat nun der Ammann-Verlag in einem prachtvollen Sammelband zusammengetragen. In den neuen, noch unveröffentlichten Gedichten, die dem Band beigefügt sind, versucht Kirsten sich gegen die bittere Einsicht in die Verlorenheit der Welt durch eine emphatische „darbietung zirzensischer natur“ aufzulehnen. Aber auch die „frohe Botschaft“ des letzten Gedichts ist nur eine Einübung ins Verschwinden.
Michael Braun, Neue Zürcher Zeitung, 21.6.2004
handgreiflich vor augen geführt
– Wulf Kirstens erdlebenbilder ziehen die Bilanz einer einmaligen dichterischen Landnahme. –
Vor einiger Zeit noch, nachdem Ende der sechziger Jahre ein neuer, an Vorbildern von Übersee geschulter, dem Alltag der Großstadt verpflichteter Ton in die deutsche Poesie hereingebrochen war, mag es ganz danach ausgesehen haben, als sei die deutsche Tradition des Landschafts- und Naturgedichts auf dem Abstellgleis untergekommen. Wie der celansche Hermetismus, so schien auch das, was ein Lehmann, Loerke, von der Vring, die Langgässer, der frühe Eich und Krolow, und nicht zuletzt Bobrowski und Huchel, an den Versen der Droste geschult, geschaffen hatten, an ein ,natürliches‘ Ende gekommen zu sein – konnten doch Huchel und Bobrowski sich selbst höchstens als letzte Mohikaner innerhalb einer Tradition verorten, der schon aufgrund politischer Zwänge und desaströser Umbrüche in Landschaft und Natur kaum eine Chance des Fortbestehens zu geben war. Eine Schar von Epigonen bringt eine Tradition noch nicht zum Wiederaufleben – da bedarf es schon eines eigensinnigen Individuums, das derart angelesene und verinnerlichte Literaturgeschichte innerhalb seiner aktuellen Lebenszusammenhänge, im Hier und Heute, aufzuheben versteht.
Es ist nicht zu hochgegriffen, in Wulf Kirsten jenen Typus des genuin-genialischen Nachfahren zu vermuten. Sein siebzigster Geburtstag, den er am 21. Juni 2004 feierte, war dem Verleger Egon Ammann Anlass genug zu einer fein gebundenen Werkschau des Dichters, die einen Überblick über die letzten 50 Jahre seiner (nicht allzu umfänglichen, dafür überblickbaren und kontinuierlichen) lyrischen Produktion gestattet. Landschaft – dieser schillernde Begriff, der „ländlich“ mit „Lebenswelt“, „(Natur-)Raum“ mit „Gestalt“ verbindet, ist Ausgangs- und Zielpunkt seiner Poesie, nicht zuletzt von ihm selbst immer wieder reflektiert, von dem „Entwurf einer Landschaft“ 1968 (in dem Essayband Textur, Ammann 1998) bis zu „Landschaft als literarischer Text“ 2003 (in dem gleichnamigen Sammelband aus Anlass seiner Jenaer Ehrenpromotion, Glaux-Verlag 2004).
„saataufgang heißt mein satzanfang“, definierte er knapp und unpathetisch in satzanfang, was bekenntnishaft seinem ersten Gedichtband (1970, Kirsten zählte 36 Jahre) zum Titel verhalf. „eine landschaft gestiftet“, wie es in seinem Gedicht auf den Orgelbauer Gottfried Silbermann heißt (zuerst 1977 in der bleibaum, dem zweiten Band, erschienen), das hat er mit seiner Poesie seitdem in mehrfacher Hinsicht. Zunächst, indem er die ostelbische Gegend um Meißen, in der er die ersten fünfundzwanzig Jahre seines Lebens verbrachte, zum selbsterklärten Sujet seiner Dichtung machte. Damit setzte er zugleich einer ländlich-archaischen Lebensweise und ihrem uns heute fremdgewordenen, erd- und dingennahen Vokabular („unmittelbar / wie griffiges mehl“) ein Denkmal, das dank der bewussten lokalen Beschränkung eine versunken geglaubte Welt mikrokosmisch detailliert, in sinnlich oszillierender Fülle gegenwärtig macht. Das lyrische Subjekt artikuliert sich als Teil der Landschaft, indem es die verschiedenen Schichten freizulegen vermag, zwischen denen sich vergangene wie gegenwärtige Geschichte abgelagert hat. Die Schlussverse von die erde bei Meißen, jenem Gedicht, das, als Titel des 1986 (Reclam) bzw. 1987 (Suhrkamp) erschienenen Auswahlbandes seinen Ruf begründete, illustrieren diese poetische Kartierung seiner selbst im geschichtlich wie unmittelbar wahrgenommenen Raum beispielhaft:
an der wetterscheide, wo im juli die gewitterbäume sömmern,
steh ich breitspurig auf der landschaft widerrist.
die flußorgeln durchbrummen das bauerngebreit.
eine schwadron schwedenreiter späht auf zugiger kuppe.
stoppelfrösche springen täppisch über den woilach des herbstes.
die grasigen senken von rindern gefleckt.
am hellichten tag zur saatzeit im hügelland
ich – auf der erde bei Meißen.
Doch mit diesen Versen ist Wulf Kirstens lyrisches Latein keineswegs am Ende angelangt (auch wenn das aus der Reclam-Ausgabe von 1986 wiederabgedruckte Nachwort es so suggeriert) – stattdessen bot ihm die frühe territoriale Restriktion v.a. in den Jahren nach der politischen Wende im Osten die Möglichkeit zur Ausweitung seiner bisherigen Sujets auf andere Landschaften und Erfahrungen, immer jedoch im Rahmen der eigenen poetischen Vorgaben. Größten Wert messe ich deshalb seinen späteren, noch weitgehend unausgeloteten Gedichten (der Bände stimmenschotter, 1993, und wettersturz, 1998) zu. Landschaften werden erkundet, die von der deutschen Poesie bislang kaum berücksichtigt waren; ihnen liegen, z.T. schon in den siebziger Jahren unternommene Reisen zugrunde, die ihn zu unseren östlichen Nachbarn führten – nach Tschechien, Polen, Rumänien zumeist. Unter diesen Nachbarn sind auch viele der direkten Stichwortgeber seiner Poesie zu entdecken – der Poetismus der Tschechen ist ihm genauso vertraut wie die Verse eines Huchel oder Bobrowski. Unübertroffen etwa die bereits 1975 entstandenen Verse, „Jiri Wolker zugedacht“ mit „jene[r] verkäuferin im kupferhaar, / eine leibhaftige göttin der morgenröte, die tag für tag / mit vollendeter anmut schallplatten auflegt.“ Und „Herbstfahrt“ (aus stimmenschotter) beschreibt eine Balkanreise so, dass wir zugleich eine Ahnung vom Reichtum der dort angesiedelten Poesie erhalten:
(…) pferdegespanne samt peitschen-
schwingenden kutschern, aufgebracht aus einem andern jahr-
hundert. im ausgetrockneten adernetz der wasserläufe rollte die
schwermut der worte zu tal, getränkt vom klaren herbstlicht und
von den einfachen wahrheiten der landleute, die neben uns saßen
mit klumpigen brotsäcken. heimwärts auf ihre abgeschrotenen
dörfer hinter den erdfalten auf dem Balkan. die köpfe der bauern
vom schlummerfieber gedrückt auf die atmenden leiber der vom
fahrtwind gefächelten fraun.
Wulf Kirstens späte Gedichte haben graphisch oft die Gestalt in eins gegossener, monolithischer Textblöcke, deren Sprache jedoch voller Bewegung, rhythmischer Atemlosigkeit ist, deren suggerierte Bilder sich in unaufhörlichem, nahezu cinematografischem Fluss befinden – ganz so, als wolle hier eine Stimme die Mannigfaltigkeit und Simultanität wahrgenommenen Lebens, das sich, kaum erblickt, schon wieder seiner Feststellbarkeit entzieht, mit eisernem Willen auf eine Seite bannen. Ich lese diese Gedichte als den Versuch, authentische, gelebte Erfahrung vor dem Verschwinden im Orkus des Vergessens zu bewahren:
wo bleibt dein auftritt, einmaliger tag,
eine himmelserscheinung, bitte sogleich,
die mich der welt zurückgibt, kaum
zu erwarten, daß er eintrifft, sich heraus-
windet aus nacht und fahlem dämmer,
ein gehölz, das ich quere, zeigt schon
konturen, eine amsel hebt an, laß mich
deine stimme hören (schon wieder zitat!)
Die Kompromisslosigkeit seines poetischen Standpunktes überzeugt. Wie er soziale Tatbestände genauso wie alltägliche Beobachtungen in meisterhafter Zuspitzung beim Namen zu nennen vermag, das nimmt für ihn ein. Billiges Wörterklauben und Metaphernjonglieren zum Selbstzweck ist seine Sache nicht – das Übersetzen des Geschauten ins genaue, treffende Wort ist ihm körperliches Bedürfnis; nicht von ungefähr zählt er gerade Steinmetze zu seinen Vorfahren – Leute, die wissen mussten, wie Lettern dauerhaft und wetterbeständig mit dem Meißel einzugravieren sind. So wäre denn auch der Pessimismus des von Ernst Meister entlehnten Mottos „und so rede ein jedes das seine / umsonst“ über dem späten Gedicht „örtlich betäubt“ am besten mit einem Fragezeichen zu versehen, denn wie sollten auch künftige Generationen von Dichtern nicht zu würdigen imstande sein, dass er uns die „schattenzungen, langhin gestreckt, / ein ausgehämmertes lichtband / einfach so achtlos hingeworfen, / des sandigen landstrichs vorgefaßtes gehabe, handgreiflich vor augen geführt“ hat, „während schon wieder / ein abend unabwendbar verwittert“, wie es darin heißt? Kirsten gehört zu den wenigen Dichtern hierzulande, deren Konfessionen man ohne Misstrauen Glauben schenken darf.
Jan Röhnert, titel-magazin, 5.7.2004
Zwei Morgen Wind
– Zum 70. Geburtstag des Lyrikers Wulf Kirsten erscheinen seine Gedichte aus fünfzig Jahren. –
Bei der Stasi wurde er unter dem Namen „Lektor“ geführt und stand unter „operativer Kontrolle“. Wulf Kirsten war und ist kein bequemer Autor. Wie nicht wenige Autoren in der DDR fand er seinen eigenen Weg, die dichterische Existenz zu behaupten und zugleich seine Verse durchsichtig zu halten: für ein entschiedenes Votum zugunsten anderer Lebensformen und Wertvorstellungen. Die große Ausgabe seiner Gedichte, mit der ihn der Ammann-Verlag ehrt, zeigt eine unverwechselbare Signatur.
Der Titel erdlebenbilder erfasst dies treffend. Kirsten, auf dem Lande groß geworden, hat wie nur wenige Sinne für die Töne, die Namen, die Farben und Geräusche des Landlebens, der Erde, die es für ihn noch wörtlich gibt. Das entsprechende Gedicht beginnt:
geboren zu Klipphausen, zwei morgen wind
hinterm haus, das war an die hügellehne
gesetzt, aus lehm und stroh die gefache,
… vorm tor stand schützend
der prellstein, drauf saß ich und sah
staunend die welt vor meinen füßen.
Dieses Staunen wurde die Quelle seiner Dichtung. Und die Leistung Kirstens ist es, nicht in das mythisierende Lob der Natur zurückgefallen zu sein, sondern einen eigenen Zugang zum Thema gewonnen zu haben.
Dass die Natur vergeht und täglich unwiederherstellbar geschädigt wird, müsste auf die Form des Nachrufs führen. Das war Kirsten zu wenig, weil zu leicht. Er eignete sich in langjähriger Forschungsarbeit das Sprachmaterial an, das die Landarbeit und den Umgang mit unserer Erde bezeichnete. Die Lust zu benennen, verbindet ihn mit Johannes Bobrowski, dessen Vorsicht („Immer zu benennen“) er beherzt überwindet: Natur haben wir als bearbeitete Natur, und die Sprache als Zeuge gibt Laut von der gegenseitigen Bildung. Vielleicht, so die schmale Zuversicht, lässt sich ein anderes denn ein nostalgisches Bewusstsein aufrufen, wenn die Verschwisterung von Land und Leuten wieder wörtlich gewusst wird. Am Ende dieses hochpoetischen Konzepts freilich steht eine resignative Geste:
aber du, aber ich, wir wollten doch kein
aufhebens machen, die geschichte nimmt sich
spielend zurück, mich wie auch dich, und nun
erst den krell beschlagen, den acker pfluglängs
abgezackt.
Der Rückgang auf ein fast verschollenes Vokabular gibt so seine Ambivalenz zu erkennen: Rettung des täglichen Hinfalls an Bräuchen und Arbeitsformen, an Wissen und Haltung ins Wort, das meint eher Archivierung denn Aktualisierung. Aber es schärft, im Gedicht und als Gedicht, den Blick auf unsere Zeit, der so viel Sprache verschlagen wird. Die dichterische Leistung liegt keineswegs nur im Sammeln altertümlicher Wörter beschlossen, sondern im gekonnten Rückgriff auf die Bedeutung der Formen. Berühmt (und oft weitergedichtet) ist das Gedicht „werktätig“ von 1975 geworden. Es sammelt Tätigkeiten in einfacher Satzform: Verb und Objekt: „korn aufschütten, ein pferd beschlagen, / den segen der kultur im korbe tragen“, und so geht es weiter mit über zwanzig Tätigkeiten und Ausdrücken. Aber das Subjekt fehlt. Irgendwann muss das der Leser merken und sich dem Sog dieser Folge entziehen, wie das Enzensberger in seiner „geburtsanzeige“ gefordert hat. Kirsten bleibt skeptisch – der Mensch bleibt der Natur auf unmenschliche Weise unterworfen:
eine leiter lehnen, haferstroh häckseln,
das zeitliche mit dem ewigen verwechseln.
Am Beispiel der Schmiede zu Blankenstein zeigt Kirsten, dass der Verlust von Wissen, von Redewendungen und Metaphern auch einen Fortschritt bezeichnen kann. Es sind tote Begriffe und schartige Sinnsprüche, die sich an das Material Eisen heften. „Amboss oder Hammer sein“(Goethe) erscheint nicht mehr als gültige Bestimmung von Volk und Herrschaft:
die vergangenheit spricht mit verrosteter stimme
von den dialogen zwischen hammer und amboss.
Kirsten hat „im handgepäck / die kleinen wortrechte, / ausgesiedelte lebensgeschichten“, ist ganz unerschöpflich in seinen Erdlebenbildern, vor allem aber in seiner höchst subtilen, gestisch-starken Verskunst. Die DDR-Leser freuten sich auch an der politischen Dimension seiner Bilder. So erkannte sich das abgeschaffte gehobene Bürgertum, wenn es las:
die oberen waldlagen
der mittleren bergstufen
von einschlägigen motorsägen
abschlägig beschieden.
kahlschlagwirtschaft, das ende
der tannen. schiefergebirge,
beschreib seine schönheit anders.
Das ist, anspielungsweise, eine Variation zu Brecht („Tannen“) und eine so subtile wie energische Kritik an der Kulturpolitik der DDR von 1976. Die neuesten Gedichte zeigen, dass Kirsten die Reibung am Überwachungsstaat nicht nötig hat, um uns mit bissigen, schlüssigen, auch humoristischen und immer poetisch reichen Versen zu erfreuen, ein Dichter, der nicht auf dem Prellstein blieb. Kirsten wohnt in Weimar – und dort ist siebzig überhaupt kein Alter.
Alexander von Bormann, Der Tagesspiegel, 21.6.2004
Das durchaus Scheißige unserer zeitigen Herrlichkeit
Hin und wieder schleicht sich ein hymnischer Ton ein in die Verse:
erde, von deinem antlitz
geht die rede
Kein Wunder – sind es doch nahezu Liebesgedichte, die Wulf Kirsten der Natur widmet, speziell der Erde bei Meißen. Da kann einer schon mal etwas vom Boden abheben. Die Gedichte des 1934 in Klipphausen bei Meißen geborenen Kirsten sind Gesänge auf die Landschaften Sachsens und Mitteldeutschlands, auf dunkle Äcker, Lehm und Moos. Es sind Landschaften, die häufig unbevölkert wirken. Dennoch zeigen sich gerade in den späteren Versen Spuren des Menschen:
meine kirschallee –
achtlos weggeworfen, meine niederste
pflaumenallee mit eisenketten als abraum
zum nächsten unratberg gezerrt, meine
feldraine gestürzt. meine quellen
vergiftet. alles versunken! Verschlungen
vom reißwolf des fortschritts.
Solch kunstvoll-plakative Klagen sind in dem schönen und umfangreichen Band gleichwohl selten zu finden, der zu Ehren des heutigen siebzigsten Geburtstag von Wulf Kirsten zusammengestellt wurde. Die meisten Strophen erinnern vielmehr an Bildbeschreibungen und Gemäldegedichte. Dabei erzeugen sie eine ungewöhnlich sinnliche Präsenz. Man meint, die Gräser und Kräuter, die Feuchtigkeit, die aus dem Boden steigt und die Pollen, die durch die Luft fliegen, zu riechen. Man spürt den weichen Matsch durch die Finger plumpsen, lauscht dem Rascheln des Röhrichts am Ufer, sieht die Fische blitzen und vor allem: Man hört zwischen den Worten die Stille der Natur. Ein stummer Wind treibt die Blätter durch die Luft, und „einmal am februarmorgen / flockten über die koppeln/ asche, verkohlte papiere“. Es sind keineswegs Idyllen, die Kirsten hier zeichnet. Das Land, das er besingt, ist nicht selten öde und unwirtlich und für lyrische Schwärmerei denkbar ungeeignet. Das Schwelgen in Klangfarben, die volltönenden Vokalsymphonien, in welche in frühen Jahren die beinahe rauschhaften Naturerlebnisse gekleidet werden, sind darum – wie diese Auswahl aus fünfzig Jahren dokumentiert – bald einer schlichteren, beherrschteren und schließlich durchscheinenderen Diktion gewichen. Geblieben aber ist eine sprachliche Vehemenz, in der sich Meinungen und Urteile auszudrücken scheinen, ohne dass jedoch ein greifbarer Gedanke Wort würde. Hier erweist sich das Dichten als eine eigene, innersprachliche Form der Reflexion, das Naturgedicht als Standpunkt und Stellungnahme. Doch wie in der Klage über das zerstörerische Fortschreiten des Menschenwerks, scheut Wulf Kirsten, der heute in Weimar lebt und zuletzt mit dem Schiller-Ring ausgezeichnet wurde, die Deutlichkeit und den polemischen Schwenk auch an anderer Stelle nicht:
was schon Goethe hat erkannt und
gerochen vorzeiten: das durchaus scheißige
dieser unserer zeitigen herrlichkeit auf erden
Und obwohl erdlebenbilder eindeutig weniger der scheißigen Seite der Herrlichkeit zuneigt, gehört es nun in die von Kirsten so genannte Kategorie „bespiene bücher, also rezensierte“.
Tobias Lehmkuhl, Berliner Zeitung, 21.6.2004
Junges Alterswerk
An diesem Buch von achtzig Seiten ist vieles blau. Der Schutzumschlag. Der Einband. Das Lesebändchen. Das lässt hoffen. Blau fördert angeblich die Konzentration und hält wach. Konzentrieren wir uns also auf Gedichte. Vorweg gesagt: Diese Gedichte würden uns auch dann wachhalten, wenn der Umschlag grün wäre. Nachdem Wulf Kirsten fünfzig Jahre Dichtkunst betrieben hatte, die in den letzten fünfundzwanzig Jahren mit Preisen und Stipendien hohe Anerkennung fand, erschien zu seinem 70. Geburtstag im Zürcher Ammann Verlag das 400-Seiten-Buch erdlebenbilder. Die meisten seiner Leser dachten dabei wohl weniger an eine Zwischenbilanz, vielmehr an den Schlussstrich unter ein beeindruckendes dichterisches Werk. Zum Glück waren die Schlussstrichdenker einem Irrtum aufgesessen. In besagtem Jubiläumsband von 2004 gab es eine Zugabe bis dato unveröffentlichter Gedichte, die aufhorchen ließen, ebenso in der erweiterten Neuauflage des Poesiealbums von 2009, was gar Hoffnungen auf einen neuen Gedichtband weckte. Zwar sind Verlag und Verleger Ammann inzwischen im Ruhestand, der Dichter aber ist es längst noch nicht. Zur freudigen Überraschung der Leser, wohl auch zu seiner eigenen, ist Wulf Kirsten mit seinen aus Ammann-Zeiten lieferbaren Büchern nicht nur in die Gnadengrube einer so genannten „backlist“ gewechselt, sondern glänzt im neuen Verlag auch unter den Neuerscheinungen mit sechzig funkelnagelneuen Gedichten.
Wer diesen Versen abliest, Kirsten sei sich treu geblieben, trifft nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte zeigt einen Dichter, der sich neu erfunden hat. Einerseits pirscht da der allbekannte Landschafter unbeirrt durch Mulm, Dörnicht und „sömmerisch bewachsne gründe“, stromert der unermüdliche Fußläufer unverdrossen über „verstrauchte“ oder „abdächige wiesen“, über „staubichte schluchtwiesen“ oder „waldumfangene wiesenpläne“. Andererseits, und das ist neu, münden die der Häuslerwirtschaft und dem Dorfleben abgelauschten Themen und Wörter öfter und kräftiger als früher in heiligen Zorn. Nicht nur artig gefügte Metaphern zur Huldigung der Vergänglichkeit, auch herzhafte Schimpfkanonaden auf zeitgenössische Unsitten gibt es. Beißender Spott richtet sich gegen kommunale Vandalen:
Kanalräumerlehre
abgebrochen wegen geistiger überanstrengung
und ausgefüllt mit der pflege
von drei hunden, für die väterchen
staat die steuern erläßt…
wahrheits-
und besenscheues element,
von einer veritablen ausdrucksarmut
geschlagen
Auch die Kanzlerin bekommt ihren Vers weg:
einmalig diese verlegenheits-
geste, wie sie ihre mundwinkel
so unnachahmlich gekonnt
nach unten zu korrigieren versteht
In dem Gedicht „denkfiguren“ werden Ärger und Zorn mit Witz und seltenem Reim auf den Punkt gebracht:
von sprachverneblern hinterlassen pseudopolyglott
die leeren worthülsen als schrott.
in dicken schwaden qualmen die phrasen,
vollmundig in den himmel geblasen.
All das gipfelt in dem Gedicht „tirade“, das zwar E.T.A. Hoffmann und Bamberg zugeschrieben ist, aber auch den Autor W. K. selbst in wohlbekannt anderer Kleinstadt meinen könnte:
nichtswürdig eingeschachtelt, marterjahre
unter hundsföttischen lakaien, abgöttisch
verachtet, hofnarr in einem schmierentheater
Überhaupt nimmt Weimar beträchtlichen Raum ein, als die „stadt im kessel“ mit ihren Verwerfungen und dem geschichtsbeladenen Ettersberg. Diesem „berg über der stadt“, über den scheinbar allzeit „wabert schlieriger grauschleierdunst“, hat Wulf Kirsten nicht nur einige Gedichte, sondern ganze Bücher und tagelange Spaziergänge zu allen Jahreszeiten gewidmet. Bitter resümiert er, wie wenig der Berg heute freien Bürgern bedeutet, Hauptsache, ihre „kraftfahrzeuge brettern die Blutstraße lang“.
Immer wieder ist an eingestreuten Namen von Orten und wegbegleitenden Dichtern, einem nicht enden wollenden „zug der gestalten“, ablesbar, worum die Kirsten-Welt kreist. Neben Hölderlin, Uhland, Goethe, Schiller und Nietzsche tauchen Harald Gerlach, Helga M. Novak, Elke Erb, Ludvík Kundera und Vilém Závada auf. Und wenn sich der Dichter einmal weit weg begeben hat, vielleicht nach Alzey, Edenkoben oder Hirsau, immer wieder kommen seine Verse ins Thüringer Land oder auf die erde bei Meißen zurück. Nahezu unschlagbar ist Wulf Kirsten, wenn er sich selbstironisch und melancholisch porträtiert als „der junge, der ich war“ und in seine dörfliche Kindheit als doppeldeutiger „erdenbürger“ zurückkehrt:
junge, was soll bloß aus dir
mal werden? Linkshänder
und zu nischde geschicke…
so ein schwartenheini wie du,
mit solch einem faulpelz
kann keiner was anfangen
Oder wenn er beinahe im Tonfall eines Volker Braun, wie in „schattenfabel“, die „tief abgesunkne geschichte, der die augenzeugen ausgehen“, noch einmal für sich und für uns heraufholt, dabei seiner Spielkameraden gedenkt, die „bevor das leben sich anschickte zu beginnen“, auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkrieges getrieben worden sind:
da liegen
sie alle sinnlos verheizt, gutgläubige
habenichtse, so wie ich sie kannte,
mit spitznamen nannte, Haddl,
Deutscher, Mäusel, Mixel, mit denen
ich umherlief einträchtig, die lebenslage
eine einzige lebenslüge, für dumm verkauft,
das kostete das leben
Schließlich setzt der Dichter mit einem Enkelinnengedicht nicht nur jene Oral History fort, die er „zaunüberwärts“ schon oft betrieben hat, sondern zeigt damit ganz plötzlich auch eine familiäre Seite, ein wunderbares Novum im Spektrum seiner poetischen Themen. 60 neue Gedichte, die man sich scheut, Alterswerk zu nennen, weil sie herzerfrischend jung wirken.
Michael Wüstefeld, Am Erker
Kirsten, Wulf: erdlebenbilder –
Gedichte aus fünfzig Jahren 1954–2004
Es bleibt immer erstaunlich, wie Wulf Kirsten, der über zwanzig Jahre lang Lektor des Aufbau Verlags in Weimar war und in dessen Zuständigkeitsbereich die Gesammelten Werke von Johannes R. Becher fielen, als Autor resistent hat bleiben können gegen die Kunstdoktrin der DDR und das gelobte „Vorbild“ des Kulturministers Becher. Heute vor siebzig Jahren, am 21. Juni 1934, als Häusler- und Steinmetzsohn im kleinen Dorf Klipphausen bei Meißen geboren, erfüllte er mit seiner Herkunft alle Voraussetzungen für einen Vorzeigeautor des Arbeiter-und-Bauern-Staates. Was hat ihn immunisiert? Gewiß auch die (freie) Mitarbeit am Wörterbuch der obersächsischen Mundarten, eine Wörterjagd, die ein wenig an Herders und Goethes begeistertes Aufspüren von Volksliedern erinnert. Denn was der Sammler hier in dreieinhalbjähriger Suche und mit zwölfhundert Belegen zusammenheimste, war ein eiserner Vorrat an Anregungen für den Lyriker Kirsten. Diese dem Volk vom Munde abgelesene Sprache bewährte sich als ein Vorbeugemittel gegen den Schwall der Phrasen und Parolen.
Das bewahrte den Lyriker vor dem Erdschollen-Mystizismus wie dem Jubelton der Traktorenpoesie. Aber Landschaft und Natur waren die ersten und blieben die wesentlichen Wahrnehmungsfelder des Dichters. Der junge Autor, der nach seinem Studium an der Universität Leipzig (1960 bis 1964) für kurze Zeit an der Schule lehrte, hatte selbst in der Poetik eine vorzügliche Lehrerin, Annette von Droste-Hülshoff. Seine Dankrede für die Verleihung des Elisabeth-Langgässer-Literaturpreises von 1994 ist eher eine Huldigung an die Droste als an die Namenspatronin des Preises (abgedruckt im Essayband Textur, 1998). Kirsten rühmt dort den „säkularen Rang“ ihrer Kühnheiten, lernt an den Gedichten der Droste, daß die Poesie „im sinnlich-konkreten Detail“ steckt.
Diese Einsicht hat Kirsten nie mehr preisgegeben. Das zeigt nun der Band erdlebenbilder, die Sammlung seiner Gedichte aus fünf Jahrzehnten (1954 bis 2004). Wie er die Naturpoesie entsüßt, sie borstig und rauh macht, so verhilft er überhaupt der glattgekämmten Sprache wieder zu ihrem natürlichen Wuchs, beutelt und walkt das eingeschliffene Deutsch. „auf wortwurzeln fasse ich fuß“, heißt es im Gedicht „An der Triebisch“. In seinem Essay „Entwurf einer Landschaft“ wies er einmal die Verwechslung von „poetisieren“ und „romantisieren“ zurück und bestand auf einer „körnigen“ Sprache, die in die Landschaftsdarstellung auch die Menschen und ihre Arbeit miteinbezieht. Seiner Erneuerung der Naturlyrik von der regionalen und mundartlichen Sprache her bleibt die metaphysisch-theologische Verankerung der Naturbilder ebenso fremd wie die innerweltliche Heiligung der Natur.
Aber Kirsten zieht auch nicht als ökologischer Teufelsaustreiber übers Land. Was nicht heißt, daß er blind sei gegen die Heuschreckenschwärme der Industrie. In zwei Zeilen des Gedichts „Der Bleibaum“ faßt er, indem er aus Goethes Gedicht „An den Mond“ zitiert, den Widerspruch zwischen überlieferter Poesie und verunreinigter Natur zusammen: „Wenn die rauchsäulen des zementwerks / füllen wieder busch und tal“, „hinterm maschendraht / ziehn giftig gelbe schwaden als frühlingsboten / über Land“ („Veilchenzeit“). Doch kennt er auch den Preis für Technikferne:
o stadt, wie liegst du verloren im acker,
zermahlen vom rad der geschichte…
vergeblich alle bemühungen
um den anschluß ans schienennetz
(„Kleinstadt“).
Kirstens Bilder von Arbeit und arbeitenden Menschen sind bestimmt durch eigene Erfahrungen der Kindheit und Jugend. Und die Erinnerung spricht mit bei seiner Wahrnehmung der Gegenwart. „Die Erinnerung hat ein ausschweifendes Wesen“, heißt es in seinem autobiographischen Buch Die Prinzessinnen im Krautgarten. Eine Dorfkindheit (2000). Und im Gedicht „erdlebenbilder“, das dem Band den Titel leiht, entstehen sie wieder, das Leben im Haus „aus lehm und stroh“ mit „zwei käfterchen oben, zwei unten“ und die „requisiten der handarbeit“, „am schleifstein geschärft“. Das Gedicht „werktätig“ läßt es noch einmal Revue passieren, das „sinnlich-konkrete Detail“ der Tätigkeiten.
Eine Erlösung aus der Fron dieses „Erdlebens“ hat Kirsten im Arbeiter-und-Bauern-Staat nicht erkennen können. Das Haus eines Philemon-und-Baucis-Paars, zweier „kollektivierter bodenreformpioniere“, ist „im acker wegprofiliert / von territorialplanern am reißbrett“, die Heimat „verödet zum allerweltsbezirk“ („Das Haus im Acker“). In grotesker Form erlebt Kirsten die Strategie, Unzulänglichkeiten in Erfolgsmeldungen umzubiegen und „getürkte zahlenkolonnen“ aufmarschieren zu lassen, in einer „ruhmreichen sowchose“ in Usbekistan (aus dem Jahr 1973), bei „spezialisten / für autogenes lobhudeln“ – „parteichinesisch: hier / wird’s ereignis“. Es fällt nicht schwer, in diesem Usbekistan ein satirisches Gleichnis für die DDR zu erkennen.
Den Ort, in dem Kirsten schon seit Jahren lebt, Weimar, umkreisen Gedichte des letzten Teils der Sammlung, „Standort“. Eine Satire auf die „berufstouristen“, die dem Ruf des „lockvogels“ Goethe gefolgt sind und täglich „herdenweise“ in die Stadt einfallen, war wohl nicht zu vermeiden. Die Situation nach der Wiedervereinigung wird illustriert durch „Die Wiedereinführung des Hausierhandels“, das Einrücken der „drückerkolonnen aus Wuppertal“, die gekommen sind, die Weimarer „über den küchentisch“ zu ziehen. Aber in der Satire ist die Lyrik Kirstens nicht in ihrem eigentlichen Element. Und nicht von ungefähr hebt sich aus den Gegenwartsskizzen ein Erinnerungstext heraus, eine Art Requiem, das den Schatten beschwört, der von Buchenwald her auf Weimar fällt: das Tryptichon „Rauher Ort“.
Man vermißt Hinweise auf vorhergehende Publikationen, deren Gedichte in diesen Sammelband eingegangen sind. Ein Nachwort von Eberhard Haufe, aus dem Jahr 1986, kann da keinen Ersatz schaffen. Mein liebstes Gedicht in dieser imponierenden Retrospektive des Lyrikers Kirsten? Es ist eine höchst kunstvolle Collage aus Tonbandprotokollen, die man von Erzählungen deutschsprachiger Bewohner der Zips, eines alten deutschen Siedlungsgebiets im heutigen Rumänien, aufgenommen hat. Dieses lange Gedicht, „Ballade“ überschrieben, liest sich wie ein Musterstück der Poetik Kirstens. Es erzählt von Lebensmühen und von einer Odyssee der Zipser, in einer mundartlichen Sprache, die durch die Jahrhunderte hindurch leicht rissig geworden ist, die Grammatik der mündlichen Rede und die Erfahrungen in sinnlicher Anschaulichkeit bewahrt und so „erdlebenbilder“ für immer im Wort festgehalten hat.
Walter Hinck, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.6.2004
Eine Wundersamentüte auf Reisen
– Die neuen Gedichte des großen ostdeuschen Naturlyrikers Wulf. –
Ende der Fünfziger kübelte Peter Rühmkorf mit seinem Spott über die „Bundes-Schäfergilde“, die ihr „höchstes Heil im Schrebergarten“ finde und höchstens mal „auf die Quendelbarrikaden“ gehe. Liest man aus jenen Jahren Gedichte von Wulf Kirsten, der auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs gerade zu schreiben begann, scheint das Rühmkorfsche Spottlied ein trefflicher Kommentar, säumen doch Quendel, Wegwarte, Günsel und Distel seine Verse, tummeln sich doch auf seiner Strophenflur die allbeliebten Lerchen, die melancholisierenden Krähen und dann und wann ein Maulwurf, den Kirsten nach dem Brauch seiner ostdeutschen Heimat „mondwolf“ nennt. Konventionell und ein wenig harmlos klingen frühe Verse:
Bald jedoch wurde Kirstens Werk zu einem idealen Biotop für endemische Arten und Wörter. Er gehörte nie zu den Feld-, Wald- und Wiesen-Eskapisten. Vielmehr war und ist er ein genau Schauender, der Feld, Wald, Wiese als – zunehmend gefährdeten – Lebensraum von vielgliedrigen, tausendnamigen Tier- und Pflanzengesellschaften erkennt, als Sphäre unendlicher bäuerlicher Plackerei. Und überall sieht er die Spuren der Menschheits-, der Erdgeschichte und seiner eigenen.
auf keiner karte verzeichnet,
nicht auffindbar mehr
region einfältiger lehmkabachen,
die wäldische kindheit
im winkel der häusler,
schlicht wie ein kalkbrennerleben,
barfuß über distel und strunk.
die satzzeichen zur biografie
rochen nach lunte und
fielen vom himmel als brandfackeln
mit feuerschwänzen.
Die Stätten seiner Kindheit gibt es, 70 Jahre nachdem Kirsten in Klipphausen bei Meißen geboren wurde, tatsächlich nicht mehr. Die Landschaft wurde vielerorts statt von Traktoren gepflügt von Planierraupen zerwühlt; wo die Landwirtschaft blieb, verwandelte die DDR-Kollektivierungspolitik kleinräumige Felder mit Hecken, Wegrainen und Wäldchen in Agrarsteppen:
ausgestorbene
wahrheiten, flurbereinigte flurnamen die fülle
Das lyrische Werk Wulf Kirstens stemmt sich seit 50 Jahren – mal resignierend, mal wütend – gegen dieses Verschwinden, indem es bewahrt, erinnert, benennt. Eine Summe daraus präsentiert sein Sammelband erdlebenbilder: über 250 Gedichte, einige darunter unveröffentlicht.
Das Buch ist, ob man Kirsten erstmals oder wiederliest, nicht weniger als eine reich gefüllte Wundersamentüte, deren keimfreudiger Inhalt bei der Lektüre auf fruchtbaren Boden fällt. Ganz von selbst erweitert sich der Wort-Schatz in diesem „weltreich der abgetauchten begriffe“, begegnen einem die Ausdrücke kombine, göpel, rajohlen, karbatschen, klabastern, liedrian, hedel und schiebbock. Im Gegensatz zu den späten verzichtet Kirsten in den frühen Texten nie auf die Poesie der Termini technici, treffen sie doch klangvoll die ihm vertraute untergehende oder untergegangene Welt. Eine Reihe der Ausdrücke findet man – wie auch Eigennamen und wenige historische Zusammenhänge – im Anhang erklärt, manche kennt allerdings nicht einmal der große Wahrig, sodass man andere Wörterbücher bemüht; und jeder Fund vertieft den Lesegenuss. Kirsten ist sich des Umstands wohlbewusst:
dein gereut ist mit worten
umzirkt, die längst keiner mehr kennt.
Seine Verse haben die Aufgabe einer Saatgutbank, sie sollen diese Worte keimfähig konservieren und im besten Falle wieder unters Volk bringen. Martin Walser beschrieb Kirstens Lyrik so:
Die Sprache urteilt nicht. Sie schleppt Sachen heran. Gegen das Vergessen.
mit dem quersack kam
der flickschuster
geschurrt im schatten der kirschbaumallee,
die tölpischen stiefel zu riestern,
kumte samt riemung zu bessern.
scharwerkern und schafscherern
ätzte granniger fusel den schlund.
sackflickersermon wehte verworren
wie ein dialog zwischen hanf und jute.
das tagwerk des gesindes
blieb randvoll gefüllt,
war nichts als schund und plack.
vom zugriff der schwieligen fäuste
die hölzernen griffe
poliert.
Obwohl er ein Mann der leisen Töne ist, schreien solche Verse danach, laut gelesen zu werden, und die vielen Gedichte mit langem Atem und Freude am Sinnsprung wie „ZUSPRUCH“ gewännen leicht Preis und Publikum bei Poetry Slams, klingen sie doch so assonanz- und binnenreimreich, so widerborstig, sinnsprungfreudig, kantig, kraft-, schwung- und humorvoll, als hätte Quirinus Kuhlmann mit August Stramm, Arno Schmidt und Ernst Jandl ein Sprach-Quartett gegründet.
Kirsten ist weit mehr als ein melancholischer Naturlyriker, er steht nicht nur in der oft genannten Nachfolge von Johannes Bobrowski und Peter Huchel. Der Band erdlebenbilder beweist schlagend, wie viele Register der Bewunderer Silbermanns zu ziehen in der Lage ist: Bitter genau bedichtet er emphatisch Kindheitserinnerungen, plastisch Erhebungen von Bauern und Arbeitern, lakonisch das Altern, akribisch den modernen Wortmüll, balladesk-böse den Brand einer Essigfabrik, souverän das Rezensentengeschwätz. An mehr als einer Stelle spürt man eine Rühmkorf verwandte Seele, die literarische Avantgarde mit Traditionssättigung, kenntnisreiche Heimatliebe mit Nationalismus-Ekel, Benennungsakribie mit kluger Sprachskepsis, bedauernde Misanthropie mit Sympathie gegenüber den Verlierern verbindet.
Natürlich lässt sich erdlebenbilder als lyrische Autobiografie im doppelten Sinne lesen, aus der man die Entwicklung des Künstlers genauer ablesen kann als die der Person. Unverdrossen hat der leidenschaftliche Radfahrer, Wanderer und „wortsüchtige“ Sammler Wulf Kirsten seine Werklandschaft durchstreift, und die dabei entstandene Kollektion erweist ihn unbestreitbar als einen der lebendigsten Lyriker Deutschlands.
Rolf-Bernhard Essig, Die Zeit, 25.3.2004
Das Gedicht, die Daten und die Schöne Zunge
(…)
In diese Geschichte gehört nicht bloß Adornos bis zum Überdruß und gern falsch zitiertes Gedichte-nach-Auschwitz-Dictum, sondern auch, was sich um einen ebenso verbrauchten Brecht-Vers angesammelt hat. Will sagen: seit den siebziger Jahren ist das Gespräch über Bäume wieder erlaubt, wenn auch vieles, was da einschlägig gedichtet wurde, sich – jedenfalls in der Bundesrepublik – ideologisch zur „Öko-Lyrik“ verkürzte. In der DDR überwinterte nicht bloß der Vorrat traditioneller Formen, sondern auch die Tradition der Naturlyrik. Huchel und Bobrowski, die aus dieser Schule kamen, wurden für einige Jüngere zum Vorbild. Der wichtigste unter ihnen ist Wulf Kirsten, der seine Gedichte aus fünfzig Jahren als erdlebenbilder gesammelt hat.
Kirsten, ein Mann des Jahrgangs ’34, kam schwer, langsam, doch umso gründlicher in diese Tradition. Er sieht sich selbst als „armer karsthänse nachfahr“. Der Steinmetzsohn aus dem meißnischen Klipphausen, nach kaufmännischer Lehre und Bauarbeiterzeit spät, nämlich mit sechsundzwanzig, zum Studium gelangt und vor allem durch autodidaktische Lektüre zu einer immensen Literaturkenntnis, ist – neben Volker Braun – der wichtigste Lyriker aus dem Nachlaß der DDR. Seine Selbstfindung gelang, als er seine Landschaft entdeckte, die erde bei Meißen (1986) und das halbverschollene Idiom ihrer Bewohner. 1987, in einem Gespräch, sagte er:
Mir war von Anfang an klar, ich wollte nicht ein traditioneller Naturdichter sein (…), ich wollte Landschaftsgedichte schreiben, angeregt also von der Droste, auch von Peter Huchel, von Bobrowski, von Theodor Kramer, von Erich Jansen.
Kirstens Landschaftsgedicht schließt die ökologische Thematik mit ein, aber ebenso die Sprache der Randständigen, der Flickschuster, Hausierer, Ziegelbrenner und Landstreicher. Er ist mit dem Fahrrad aufs Land gefahren und hat alte Bauern nach Worten abgefragt für das Wörterbuch der obersächsischen Mundarten. Seine Gedichte haben etwas Körniges, manchmal sogar Sperriges, die Zeilen sind prall von Dingen, die bei ihren oft seltenen oder vergessenen Namen gerufen werden:
dein gereut ist mit worten
umzirkt, die längst keiner mehr kennt.
Die Anmerkungen zu den gesammelten Gedichten erläutern etwa Worte wie blauschimmel (eine Tabakkrankheit), quendel (wilder Thymian), rajohlen (tief pflügen), mondwölfe (Maulwürfe), zaukenweiber (Maiglöckenpflückerinnen), lehde (Brache) oder missingsch (meißnisch).
Kirstens spröde Kunst bringt ihre schönsten Resultate, wenn Geschichte und persönliche Erfahrung in Bildern und Metaphern zusammen finden. So in dem 1988 geschriebenen Gedicht „die ackerwalze“, in dem er seinen Eltern ein Denkmal setzt. Die Eltern – so erzählt das Gedicht – spannen sich vor eine gestürzte marmorne Grabsäule und ziehen sie als Ackerwalze über das Feld, „steinzeitlich / am eisengestänge über eignen grund / und reformierten boden / bergunter, bergauf, / (…) immer mit letzter kraft in den sielen.“ Zu dem offenbaren Realgehalt des Gedichts tritt seine erstaunliche historische Symbolik. Die Ackerwalze erscheint geradezu als das Dingsymbol einer ganzen Geschichtsepoche, eben der DDR.
Wulf Kirsten, weder Mitläufer noch ausdrücklich Dissident, hat diesem Staat, anders als andere, keine Träne nachgeweint. Sein lapidarer Befund „stiefvater staat hat sich / aus dem staube gemacht“, wird durch das Eingeständnis „ein fremdling bin ich / mir selbst“ nicht aufgehoben. Die Fremde liegt vor der Haustür, also in Weimar, und das lyrische Ich schöpft aus ihr eine ebenso desperate wie robuste Energie, indem es sich vornimmt, „das leben zu bestehn / am haus eck, an das die hunde pissen.“ Für diese poetische Widerständigkeit spricht auch, daß die lyrische Produktion seit 1989 gestiegen ist. Die drei neueren Abteilungen „stimmenschotter“, „wettersturz“ und „standort“ bringen 170 weitere Gedichte. Kirsten, ein Kenner der Weltpoesie, ist einer der Stillen im Lande; er ist es auch als regionalistischer Verist, als Meister einer poetischen Landschaftsmalerei.
Den Bauernmaler Kurt Querner, den er noch selbst gekannt hat, charakterisiert Kirsten in einem Gedicht von 1968:
ein entschlossener landgänger
geht die welt an mit dem pinselstrich
am herben gebirgsrand auf kargem geviert.
ein mensch behauptet sich und hat bestand.
Darin steckt ein Selbstporträt.
Harald Hartung, Merkur, Heft 674, Juni 2005
Ein wahrer Steinmetz der Sprache
Wulf Kirsten ist kein junger Mann, er hat die Siebzig bereits überschritten. Als 1934 in der DDR Geborener hat er sich naturgemäß in Weimar sozialisiert. Er ist einer der großen Dichter in deutscher Sprache, ein Naturlyriker, vielleicht passender gesagt, einen Landschaftsdichter. Die Natur und die Landschaft sind seine Anliegen, dabei hat er nichts zu tun mit sentimentaler Naturlyrik, sondern er hat vielmehr eine eigne sehr starke Sprache entwickelt, die gedrängt, stark verkürzt, und in keiner Weise nicht experimentell ist. Ihm geht es in seiner Lyrik um „ein tieferes Eindringen in die Natur, eine auf sinnlich vollkommene Rede abzielende Gegenständlichkeit, eine Mehrschichtigkeit, mit der soziale und historische Bezüge ins Naturbild kommen“. Und diese soziale Naturbetrachtung hat vordergründig mit seiner Scholle zu tun.
Schaut man das Titelbild des Buches erdlebenbilder an, dann sieht man den Autor auf einer Steinbank sitzen. Neben ihm liegt sein Mantel. Sein Gesicht ist grau, fast ein wenig ausgetrocknet, verkarstet und genau so ist eigentlich seine Dichtung. Wulf Kirsten selbst kommt aus Klipphausen bei Meißen, er wandert durch seine Landschaft, die Elbgegend bei Dresden, ist Wanderer, Sammler und Chronist der täglichen Dinge des Lebens. Aber er ist auch „Dichter der Dörfer“, dabei ist er nie sentimental, auch wenn er das Verschwinden vieler Dinge, vieler landwirtschaftlicher Eigenarten und handwerklicher Gerätschaften beklagt. Wenn er die Landschaften betrachtet das sieht er vordergründig immer die Geschichte, die Historie, die unterschiedlichsten Entwicklungen die darüber hinweggegangen sind. So enthält jedes Landschaftsgedicht auch immer etwas Biografisches.
In einem sehr schönen Gedicht gedenkt er seiner Eltern, dabei integriert er sie reflektierend in sein poetisches Programm, in dem er eine beeindruckende Gleichung zwischen dem Bild der im Ehejoch befindlichen Eltern und eines Ochsenpaares entwirft.
Wenn er am Anfang noch sagt, dass er Biografien über alle sagbaren Dinge schreiben will, dabei die raue und rissige Erde seines geliebten Heimatlandes ins Wort nehmen will, dann werden jedoch im Laufe des Lebens seine semifiktionalen Gedichte immer düsterer, stehen zunehmend auf einem Trauerfundament. Wenn er anfangs noch ein frisches, frohes, beglückendes Naturbild zeichnet, dann wird das einhergehend mit der Zerstörung der Natur, im Laufe der Jahre immer düsterer und trauriger. Und später, heißt es dann resignierend „selbst die Wörter sind sang- und klaglos ausgewandert aus den Dingen“.
Er schimpft, er poltert, er zürnt, aber er ist nicht sentimental, er lamentiert nicht, hat von Fall zu Fall bei seinen karikierenden Weimargedichten“ einen wunderbaren satirischen Ton. Er romantisiert nicht, vielmehr poetisiert der die Dinge. Die essayistische Prosa wirft Schlaglichter auf den breiten literaturgeschichtlichen Bildungshintergrund des Autors, der eine authentische Figur im Kulturbetrieb ist.
Carl-heinrich Bock, amazon.de, 4.7.2007
„an der kummerlinie des kleinen dermaleinst“
Was hier auf etwa 400 Seiten endlich einmal geboten wird, ist Lyrik und ist Erfahrung, gegossen in rhythmisierende Texte, manchmal auch in Reimen und es führt uns Leser nach Deutschland und in die Welt.
Das ist ja unsere Freiheit, in Wirklichkeit und in Gedanken fliehen zu können (in die Freiheit).
Daß da und ab und an ein wehmütiger Ton aufkommt, mag angehen, ist angebracht.
Krolow schaut heraus, auch Friedrich Schnack, aber gemach nur (!), hier ist Eigenes zuhauf und die Wege durch alle Fluren haben ihr eigenes Ich ganz gewiss.
Lehmann, so liest man und Loerke hätten Eindruck auf ihn gemacht, später Huchel und vor allem Johannes Bobrowski, doch er erfand und sprach Eigenes, wie gesagt.
Hier ist nun endlich eine Sammlung seiner Werke herausgebracht worden, mit einem lesenswerten Nachwort von Eberhard Haufe und es entsteht der Eindruck, daß Leserinnen und Leser einen Band in Händen halten, der etwas aushält.
Das heißt, man kann ohne Mühe von vorne nach hinten lesen oder überhaupt einfach hineingehen ins Werk, ins Gewerk sozusagen und die Sprödigkeit, den Impetus des Vergänglichen aber auch des Gegenwärtigen erleben und immer wieder Neues entdecken.
Die Kleinschreibung ermöglicht ein gutes Sicheinfinden, Hineingeführtwerden in eine Welt, wie sie ist (und nichts anderes).
Ein Gefühl von Sicherheit umschleicht einen, daß alles so werden wird, wie es die Erde oder der Schöpfer gedacht.
mitten im ackerland, prosaisch
bewachsen mit rüben und hafer,
ein abgesoffenes torfloch
mählich-schmählich verlandet.
Aus dieser Materie sind wir, zu ihr werden wir. Wulf Kirsten begleitet uns zu allem hin mit seinen erdlebenbilder.
Klaus Grunenberg, amazon.de, 17.7.2007
Skeptisch…
… war ich. Wulf Kirsten? Ein Dichter aus der DDR? Eigene Nische? Aus Meißen? Hmm. Und was soll ich sagen, ich bin jetzt ein Kirsten Fan, obwohl ich selber ein Lyriker bin. Das Buch und die Texte darin sprechen eine völlig eigene Sprache, und gehen mit der Vergangenheit in einem ganz eigenen Stil um. Klar, dass er für die Stasi nicht zu greifen war. Er ist einer von denen, die ich gerne mal kennen lernen würde… (als „Wessi“).
Hanno Hartwig, amazon.de, 17.2.2013
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Christine Langer: Nur die Wahrheit im Präsens
fixpoetry.com, 12.12.2010
Rolf-Bernhard Essig: Eine Reise durchs „weltreich der abgetauchten begriffe“
literaturkritik.de, November 2004
Sylvia M. Patsch: Der Wort-Retter
Die Furche, 28.4.2005
Welt, Poesie und Sprache(n) im Gedicht
Jan Röhnert: Häufig haben Sie sich zu den deutschen Wurzeln ihrer Poesie bekannt: die Droste und Heine, Christian Wagner, Rudolf Borchardt, George, Benn, Brecht, Huchel, Bobrowski… – man müßte wohl einen ganzen (z.T. jedoch ganz anti-kanonischen!) Kanon deutschsprachiger Lyrik aufstellen, um Ihrer Rezeption gerecht zu werden. Wie aber sieht es mit fremdsprachigen Literaturen aus, gab es da Lektüreerlebnisse, die Sie als genauso prägend empfanden und die Sie Ihren deutschsprachigen Lesefrüchten an die Seite stellen mochten? Wenn ja, welche Werke und Autoren welcher Sprachen bzw. Literaturen waren das?
Wulf Kirsten: Zu jedem der aufgezählten Namen müßte ich sagen, was mich mit ihnen verbindet, was ich aus dem Werk, aus dem Denkgebäude oder dem poetischen Schreibverfahren entnommen habe, wie ich jeweils zu Prägungen gelangte, oft geht es dabei nur um punktuelle Bezüge. Generell hat mich sehr früh inspirierend bewegt, als ich nachlesen konnte, aus wie vielen Einflüssen, Einfluß-Sphären, literarischen wie ideologischen Ingredienzien sich Bertolt Brecht formend, amalgamierend sein Werk gebaut hat. Aus sehr vielen Komponenten, weit auseinander liegenden. Dazu gehört ebenso die Fähigkeit, zu negieren, sich abgrenzen zu können. Nur so konnte er unverwechselbar werden. Speziell hat mich bei Brecht die Kühnheit des gestischen Sprechens überzeugt, als eine Möglichkeit des Ausbruchs aus festgefahrenen, ausgelaugten, weil zu oft wiederholten und damit zu Tode gerittenen Gedicht-Mustern. Bei der Droste faszinierten mich zunächst die Gedichte „Das Hirtenfeuer“ und „Der Knabe im Moor“, die ich in Jakob Löwenbergs in zahlreichen Auflagen verbreiteter Anthologie Vom goldnen Überfluß entdeckte. Später, und dies hält bis heute an, gilt mir „Die Mergelgrube“ als die große Herausforderung, als ein Text, der exemplarisch vorführt, was es mit der Genauigkeit als poetischer Kategorie auf sich hat, und der zugleich am Beginn einer neuen literarischen Epoche steht, einer, die eben das einläutet, was ich unter Moderne verstehe. In der Lyrik und Prosa Heinrich Heines sehe ich eine grandiose säkulare Vorgabe. Bei allem Verständnis und bei aller Wertschätzung Goethes ist Heine mir um vieles näher, gemäßer. Mit ihm stehe ich ganz einfach auf vertrauterem Fuß. Wenn ich immer wieder betont habe, fest auf dem Boden des 19. Jahrhunderts zu stehen, hat dies grundsätzlich und zuvörderst mit Heine zu tun. Und so könnte ich fortfahren, weitere Namen hinzufügend, etwa Oskar Loerke, Wilhelm Lehmann, Gertrud Kolmar…
Wie der Kanon deutschsprachiger Lyrik seit Nietzsche aufzubrechen wäre, hätte ich gern in einer für heutige Verhältnisse zu umfangreich geratenen Anthologie demonstriert, die nun, so wie die Dinge in einer Wegwerfgesellschaft liegen, Manuskript bleiben wird.
Wie begann ich mich in andere Literaturen einzulesen? Sehr sporadisch, ohne jedes Programm. Dies war den bescheidenen Zugangsmöglichkeiten geschuldet, wie sie mir in den fünfziger Jahren in ländlicher Literaturferne geboten wurden. Zu frühen starken und sehr nachhaltigen Lese-Erlebnissen, bei denen ich mich in sozialer Übereinstimmung fühlte und wie es mir zuvor am stärksten mit den Bekenntnisbüchern des Erzählers Oskar Maria Graf gegangen war, gehören beispielsweise die Schlesischen Lieder von Petr Bezruč, in den Nachdichtungen von Rudolf Fuchs und Wilhelm Tkaczyk, die der Aufbau-Verlag 1963 herausbrachte. Von seinen Gedichten führte ein gerader Weg zu Theodor Kramers sozial genau ausgeleuchteten und abgestuften Gedichten. Es kann aber auch sein, daß ich erst auf Kramer stieß und kurz danach auf Bezruč. Noch stärker war wohl der Erweckungs-Schub, der von der schmalen Auswahl mit Gedichten Attila Józsefs ausging. Darin vor allem das Gedicht „Ungarisches Tiefland“ in der Nachdichtung von Franz Fühmann. Um ein derart konzises Landschaftsgedicht mit einer so kraftvollen, kühnen plebejischen Metaphorik aufnehmen zu können, mußte die Beschäftigung mit dem deutschen Expressionismus vorausgegangen sein. Dies war der Fall.
Vor allem hatten mich Paul Boldts bildstarke Gedichte, in denen er seine östliche Herkunftslandschaft thematisierte, enthusiasmiert. Seine wenigen Gedichte bildeten wohl einen tragfähigen Grund im Prozeß stufenweiser Aneignung. Sehr oft blieben Einflüsse punktuell auf einzelne Gedichte beschränkt, von denen dann allerdings entscheidende Impulse ausgingen, so daß sie Modellcharakter und -funktion annahmen. Gemeint sind damit Gedichte, die ich weit draußen in unerreichbarer Ferne wie Leuchtbojen erblickte, auf die es zuzuhalten galt. So könnte ich geradezu einen Kanon vorbildlicher Gedichte aufstellen, der mich weit stärker bereichert und poesie-einsichtig gemacht hat. Auch wenn diese Anziehungskraft später nachließ, galt dies in frühen Jahren für eine gewisse Zeit, während des Stufenbaus, als die Vorbilder rascher wechselten. Neugier, bis zur Lesewut gesteigerte Leselust („Zwar weiß ich viel, doch…), befähigten Neues aufzunehmen und zugleich anzuverwandeln als geistigen Besitz. Vielleicht noch entscheidender war bei diesem fluktuativen Prozeß, Altes, Vertrautes, zu dem man begeistert, aber herzlich unwissend, aufgeblickt hatte, abzustoßen. Für die Porträtgedichte war etwa neben Peter Huchel und Johannes Bobrowski Edgar Lee Masters mit seinem Zyklus „Die Toten von Spoon River“ maßgeblich (1915; dt. 1924 u. 1959), 1966 im Aufbau-Verlag erschienen, eine Dichtung, die mich bis auf den heutigen Tag fasziniert. Dies wohl gerade deshalb, weil die „Mach-Art“ in ihrer drastisch-konkreten, in ihrer ironischen Stringenz, wie lapidarer Lebensläufe erzählt, zu Grabsprüchen verkürzt und sie dabei unversehens in Poesie aufgehen läßt, unerreichbar bleibt.
In Arnfrid Astels Lyrischen Heften, die mir als Dauerbenutzer der Deutschen Bücherei ohne Probleme zur Verfügung standen, entdeckte ich César Vallejos Gedicht „Paris, Oktober 1936“, ins Deutsche gebracht von Hans Magnus Enzensberger. Von daher bekam ich einen Begriff, was es mit existentiellen Erfahrungen auf sich hat und wie man sie ins Gedicht bringt. Bedauerlicherweise nahm der Übersetzer dieses große Gedicht nicht in sein beispielhaft eingerichtetes, unübertroffenes Einführungs-Kompendium in die Weltpoesie auf, das mir späterhin als Handbuch zur Verfügung stand. Als mich nach einer Lesung eine der Zuhörerinnen ausgerechnet nach meiner Beziehung zu Vallejo fragte, war ich verblüfft. Es gibt mitunter Einflüsse, deren man sich gar nicht bewußt ist. In dem seltenen Fall hatte jemand bemerkt, über welche Brücke ich gegangen bin. Ehe man sich mitteilt, müßte man alle Brücken, über die man gegangen ist, mittelnd vorausschicken können. Von den Spaniern, die ich aufnahm, meist in den deutschen Versionen Erich Arendts, habe ich wohl am intensivsten Rafael Alberti rezipiert, vor allem den Engel-Zyklus, darunter wiederum „Die toten Engel“, von denen ich für den Hausgebrauch eine eigene, mir gemäßere Fassung herausschrieb. So verfuhr ich auch mit dem Gedicht „Mauern“ von Konstantinos Kavafis, das aus der Deutschost-Perspektive zu einem Politikum ohnegleichen geworden war, als wäre es bereits 1896 vorausschauend eigens für zu gewärtigende Einmauerungen in Deutschland verfaßt worden. Nicht von ungefähr fehlt dieses perspektiv-anzügliche Gedicht in der ansonsten so verdienstvollen Auswahl des Leipziger Insel-Verlags (1979). Es würde ins Uferlose führen, wollte ich mich rekapitulierend all jener Gedichte vergewissern, aus denen mir etwas zugeflossen ist und was mich leicht erkennbar oder auf geheime Weise weitergebracht hat. Ich war, abgesehen von der in deutscher Sprache zugänglichen, auf keine andere Literatur festgelegt. Wohl aber gehen von der tschechischen, polnischen, russischen, ungarischen Poesie doch, wie leicht herauszufinden, starke Impulse aus, die wohl auch mit emotionalen Affinitäten zu tun haben, die in die Nähe von Gleichgestimmtheiten zu rücken sein mögen. Nicht von ungefähr habe ich mich in der Laudatio auf Ludvík Kundera zu einer Schlagseite ins Östliche hin bekannt, die ihren Kulminationspunkt in einer leicht emphatisch getönten Moravophilie erreicht, was nicht nur aus einer Augenblickslaune heraus scherzhaft gemeint war.
Unter den zahlreichen Anthologien, die ich rezipierte, will ich zwei herausheben, die ich intensiv eingesogen habe. Erstens die von Ludvík Kundera und Franz Fühmann 1964 edierte Sammlung Die Glasträne. Tschechische Gedichte des 20. Jahrhunderts. Daraus müßte ich eine lange Reihe von Gedichten herausheben, zu denen sich sofort Affinität herstellte. Zweitens gehört zu diesem poetischen Grundstock die ebenfalls 1964 erschienene Sammlung Polnische Poesie des 20. Jahrhunderts, herausgegeben und übertragen von Karl Dedecius (Carl Hanser Verlag, München).
Das waren Bücher die „rechtzeitig“ in meine Hände gerieten und den Anfang einer langen Kette bilden, an dem die Aufnahmefähig- und -willigkeit noch nachhaltige Prägespuren zu hinterlassen vermochte.
Röhnert: In Textur schreiben Sie:
Wie armselig stünde das Deutsche da, auf das ich setze, zöge man das von ihm ab, was es dem Lateinischen und Französischen an bereichernden Zuflüssen zu danken hat?
Weiter fügen Sie dem dann im selben Absatz den für Ihre Herkunftsregion wichtigen Einfluß des Slawischen, Sorbischen hinzu. – Konnten Sie, von diesen Stellungnahmen ausgehend, Ihren Begriff von Sprache eingrenzen? Ist es richtig, daß durch die Lyrik, also den kalkulierten Umgang mit Sprachmaterial, erst einmal das Bewußtsein auf die Fremdheit(en) der eigenen Sprache gelenkt wird? Die ,Mutter‘, mit der wir unsere angelernte Sprache gern apostrophieren, kann ja gerade wegen ihrer scheinbaren Vertrautheit ebenso heftige Fremdheitsgefühle auslösen…
Kirsten: Da ich mich nur auf Deutsch beziehe und gewillt bin, daran festzuhalten, weil ich ohne diese Sprache nicht existent bin, ist Fremdheit gerade da nicht im Spiele, so fremd und verleidet mir auch sonst vieles ist, was mit möglichst stolzgeschwellter Brust deutsch, deutscher, am superdeutschesten daherkommt, als gelte es, nationale Minderwertigkeitskomplexe und Abstiegsängste in ein randständiges europäisches Hinterbänklertum zu kaschieren. Sprache steht für mich autonom. Sie ist mein einziger Besitz, einer, den ich teile, von dem ich gern abgebe. Allerdings gehe ich mit diesem erworbenen Reichtum kritisch um. Ich bemühe mich, Gegensprache aus einem kritischen Sprachverhalten heraus zu schreiben. Dieses Gegenhalten galt nicht nur dem an verlogenen Euphemismen so reichhaltigen Parteichinesisch und seinem „Jargon der Eigentlichkeit“ (Adorno). Gegenwärtig laufen Prozesse der Verschlampung, Verwilderung, Verwüstung viel rasanter ab. Die jetzt en détail zu diffamieren, würde von der Frage zu weit abführen. Fremdheit allenfalls, weil ich mich wie zu allen Zeiten so auch jetzt wieder in der Rolle des Außenseiters sehe, dem es nicht gelingen will, eine herzliche Beziehung zu einer an Blähsucht leidenden Bürokratie aufzunehmen, in der ich alles, was auch nur entfernt nach Staat riecht, einschließe. Von da her weht Befremdung, Fremdheit, das starke Gefühl der Nichtzugehörigkeit und die Gewißheit, daß mich in diesem Staat niemand tatsächlich vertritt.
Deutsche Sprache ist zunächst mein Materialvorrat, aus dem ich schöpfe. Mich interessiert, was kann ich davon aufnehmen. Der Ehrgeiz, mit einem möglichst großen Wortschatz umgehen zu können, so daß ich ihn auch aktiv anzuwenden vermag, kontrastiert mit landläufigem Sprachverhalten. Ich muß, um poetische Genauigkeit ansteuern zu können, differenzieren und abschatten können. Der Duden reicht da nicht aus. So wird das, was ich formuliere, ungern nachbuchstabiert, weil zu befremdlich und außerhalb eines Kanons gelegen, der es darauf absieht, sich mit einem möglichst schmalen Ausdrucksvermögen zu behelfen, das dazu noch vorwiegend auf stereotypisierte Wendungen setzt. Meine Vorstellung von Sprachbehandlung einzugrenzen wäre ein vortragfüllendes Thema für sich.
Röhnert: Ebenfalls in Textur erwähnen Sie en passant den französischen Surrealismus und den Poetismus der Tschechen als „aus anderen Poesiesprachen gewonnene Einsichten und Einflüsse“. Könnten Sie kurz umreißen, was Sie unter diesen Bewegungen verstehen und wie wichtig Ihnen diese sind?
Kirsten: Ich habe gelernt, in literarischen Epochen zu denken. Inzwischen weiß ich, wie problematisch das ist, weil zu vieles nicht in derlei Programme, Schemata paßt. Es gibt, wenn man schon in historischen Abläufen denkt, die Entwicklung suggerieren, in Wahrheit doch mehr Nebeneinander als Nacheinander. Dank der Deutschen Bücherei konnte ich während meiner sieben Jahre in Leipzig (1957–1964) sehr intensiv aufnehmen, was unter Expressionismus zu subsumieren ist. Vorzugsweise hielt ich mich dabei an die Lyrik, wie sie sich in den einschlägigen Zeitschriften und Buchreihen fand. Auf diesen reichhaltigen Fundus baut mein Moderne-Verständnis.
Den französischen Surrealismus habe ich erst später wahrgenommen. Und auch weniger die Doktrin, mehr das, was praktisch abgeleitet und umgesetzt wurde. Ich sah, welch immense Bereicherung die Poesiesprache hinzugewonnen hatte. Aber eben nicht nur die französische Lyrik, die immer wußte, woher sie kam. Was man so absolut nur noch für die Angloamerikaner sagen kann, die ohne Walt Whitman nicht zu denken sind – bis heute wohlgemerkt! Da ich immer wissen wollte, worin besteht die schöpferische Leistung einer Epoche, einer Gruppierung, habe ich vergleichend gearbeitet und dazu, ohne dies schulmäßig zu betreiben, poetologische Texte gelesen, die Lichter gesetzt haben.
Aufschlußreich war, wie etwa tschechische Lyriker die neuen Möglichkeiten, die der Surrealismus der Poesie generell eröffnet hatte, produktiv machten, indem sie diese Einflüsse kombinatorisch mit ihren angestammten nationalsprachlichen Traditionen zu verbinden wußten und dabei zu erstaunlichen Gedichten gelangten, für die es in der deutschsprachigen Lyrik keine vergleichbaren Beispiele gibt. Der Nobelpreisträger Jaroslav Seifert war einer von ihnen. Andere tschechische Dichter seiner Generation wären dieses Preises ebenso würdig gewesen. Man lese Halas, man lese den frühen Nezval. Wolker nicht zu vergessen, der bereits mit 24 Jahren starb. Rasch wurde mir bei Vergleichen bewußt, was da in Deutschland unwiederbringlich verpaßt worden war und wie rasch fortan deutsche Poesie weltliterarisch ins Hintertreffen geriet. Als hätte es da gravierende Erschöpfungszustände gegeben, nachdem sich das expressionistische Jahrzehnt totgelaufen, aufgerieben hatte. Der Späteinsatz nach Ende des Zweiten Weltkrieges konnte das eklatante Versäumnis nicht mehr gutmachen. Kurz, was mich frappierte, was mich anzog, war der „angewandte Surrealismus“. So nimmt es nicht wunder, daß die mehr selbstverliebten und selbstgenügsamen „Gewußthabenichtse“ (Viktor Klemperer) ost- wie westdeutscher Provenienz mit dem Poetismus der Tschechen nicht recht umzugehen wissen. Man müßte schon erst einmal bereit sein, Poesie als eine autochthone Lebensäußerung anzunehmen.
Poetismus schließt so vieles ein, was ich an deutscher Lyrik nicht gefunden habe: eine Phantasie, der Flügel gewachsen zu sein scheinen. Denkvermögen in kühnen Bildern und Metaphern und all dies in einer Sprache, die noch von Konkreta getragen wird. Von den Einflüssen des Surrealismus hat übrigens auch die rumänische Lyrik, der ohnehin starke Elemente des Phantastischen eigen sind, beträchtlich an Substanz gewonnen. Wichtig ist mir, bei allen Einschränkungen, zu denen mich das Deutsche zwingt, das Offenhalten, das Offenbleiben für möglichst viele poetische Möglichkeiten und sich gerade nicht einengende Vorschriften machen zu lassen von irgend einer poetologischen Doktrin. Dies gebietet erst recht, allen Denkverbeugungen und -verbiegungen auszuweichen. Womit ich wieder bei dem Begriff „Gegensprache“ angelangt bin.
Röhnert: Am Ende Ihres Vorwortes zu der von Ulrich Keicher im Wallstein Verlag besorgten zweibändigen Christian-Wagner-Ausgabe schlagen Sie von dem schwäbischen „Brahminen und Seher“ kühn den Bogen zum Dichter der Leaves of Grass – Walt Whitman. Was für eine Bedeutung messen Sie dem amerikanischen Rhapsoden bei, was interessiert Sie besonders an seiner Dichtung und der Tradition, die er in den Staaten begründet hat?
Kirsten: Wohl habe ich sehr früh Gedichte von Walt Whitman gelesen, so daß ich eine Vorstellung von seiner Sprachkraft und seiner narrativen Hymnik gewann. Wichtiger jedoch wurde er mir, als ich mich mit der sehr spät einsetzenden Whitman-Rezeption in Deutschland beschäftigte und merkte, wie weitreichend die Einflüsse sind, ohne bis zu einem genaueren Überblick vorgedrungen zu sein. Eine wissenschaftlich fundierte Abhandlung dazu, die sehr ergiebig sein dürfte, ist mir nicht bekannt. Als ich mich mit dem Expressionismus beschäftigte, war es unvermeidlich, daß ich auf Whitman-Vorgaben stieß. Und dies wiederum in Verbindung zu anderen Einflüssen gesehen, wie sie etwa nach 1890 aus der französischen Poesie in der Aktentasche von Stefan George nach Deutschland gelangten.
Röhnert: Als es noch zwei deutsche Staaten gab, betrieben die Verlage in der Ex-BRD und der Ex-DDR doch auch eine sehr voneinander abweichende Editionspolitik – gerade, was die Übersetzung, Herausgabe und Verbreitung fremdsprachiger Poesie betraf. Könnten Sie Grundlinien der Rezeption fremdsprachiger Lyrik in beiden deutschen Staaten nachzeichnen, gab es epochemachende Kompilationen, Anthologien, Reihen, herausragende Übersetzer? Was wurde in dem einen Staat herausgebracht, was es im anderen nicht gab – oder dort nicht geben durfte?
Kirsten: Nein, die Grundlinien der Rezeptionsunterschiede vermag ich nicht nachzuzeichnen. Das wäre vermessen. Drei Sätze dazu gingen zu weit an den unterschiedlichen Bedingungen vorbei. Dazu müßte ich eine umfangreiche Editionsgeschichte schreiben, was nicht ohne langwierige Vorbereitungen abginge. Für mich wäre dies auch insofern schwierig, als ich nicht in den offiziellen Kategorien gedacht habe, die mir vorgegeben waren. Ungeachtet des Papiermangels und der politischen Restriktionen, die nicht logisch zu erklären sind, weil von Zufällen abhängig, in die immer wieder indoktrinierte, auf Feindbilder getrimmte Voreingenommenheit und machtbesessene Engstirnigkeit hineinspielten, ungeachtet aller Barrieren, Eingriffe und Verhinderungen ist zumindest seit den sechziger Jahren im Osten erstaunlich viel Poesie aus anderen Literaturen in deutschen Versionen ediert worden. Und eben nicht nur aus den Ländern des Ostblocks. Polen, Rumänien waren dabei deutlich unterrepräsentiert. Die zahlreichen Gedichte rumänischer Lyriker, von deutschen Lyrikern aus Rumänien übersetzt und in Rumänien erschienen, wurden außerhalb der Landesgrenzen leider nie wahrgenommen im öffentlichen deutschen Literaturbetrieb. Weder in Deutschost noch in Deutschwest. Eine dem Museum der modernen Poesie vergleichbare Anthologie und so manch andere fundamentale Publikation, die Weltpoesie politisch unvoreingenommen vermittelt, hat es in der DDR nicht gegeben. Aber die meisten Lyriker, jedenfalls die, mit den ich näher bekannt war, wußten sich Zugang zu verschaffen zu westlichen Editionen. Zu sehen ist auch, daß die Verhältnisse in der DDR nicht so statisch blieben, wie sich das eine bestimmte Machtriege gewünscht hätte. Sie hatten es nicht in der Hand, daß da Schleichsand im Getriebe war, der allmählich rigide Verbohrtheiten ins Rutschen brachte. Nach 1960 war in der DDR eine neue Generation von Literaturvermittlern, Lyrikern, Lektoren herangewachsen, die den Kalten Krieg nicht mehr fortzusetzen gedachte und vorhandene Spielräume ausspähte und nutzte, wo sie nur konnte. Dabei wurden dann ideologisch ausgerichtete Zielvorgaben glatt (oder auch nicht immer glatt, sondern mit List und Tücke) unterlaufen. Auch wenn die bescheidenen Spielräume, die partiell der Vermittlung von Poesie in kleinen Auflagen Ausblicke in die Welt gewährten, nur Narrenfreiheit waren. Man denke an Bernd Jentzschs unübertroffene Reihe Poesiealbum, die er mit profunden Kenntnissen und Durchsetzungskraft bis zu seinem Bruch mit dem Regime (1977) über Jahre hin ausbauen konnte. Man denke an die Weiße Reihe des Verlags Volk und Welt, denen sich als „flankierende Maßnahmen“ zahlreiche Einzeleditionen anfügen ließen.
So abschreckende Prototypen von Literaturverhinderern – vornehmlich als Verfasser negativer „Gutachten“, wie sie sich vormals in Alfred Antkowiak verkörpert hatten, sind mir nach 1965, als ich beim Aufbau-Verlag arbeitete, nur noch selten über den Weg gelaufen. Mag sein, daß sie sich dann mehr auf die Geheimdossiers konzentrierten, die sie der Staatssicherheit überließen. Es mag so klingen, als wollte ich Probleme verwischen und östliche Verlagskonzepte schönreden. Pauschalisierende Dämonisierung geht aber ebenso von den tatsächlichen Gegebenheiten ab wie verklärende ostalgische Aufwallungen, die es sich der Einfachheit halber angelegen sein lassen, Restriktionen, Demütigungen, Aussperrungen, Kriminalisierungen auszusparen, mit dem Unterton, so schlecht war es doch gar nicht. Ich opponiere gegen jene, die – gleich, von welcher Seite – sich der Mühe einer um der Wahrheit willen nötigen angemessenen Differenzierung zu entziehen suchen, vollends dann, wenn Systeme und Bewohner über einen Kamm geschoren werden. Ich habe dabei den empört-verächtlichen Ausruf einer Dame im Ohr, die – ganz offensichtlich überfordert und noch auf die Nachgefechte des Kalten Krieges abonniert – Regisseur Adolf Dresen zurief: „Kommen Sie doch endlich von Ihrer Differenzierungsschiene runter!“ Ausgerechnet diesen Gefallen werde ich ihr wie auch allen anderen Differenzierungsverweigerern nicht tun.
Röhnert: Es ist nicht übertrieben, Sie zu den wenigen echten Kennern des deutschen literarischen – vor allem des lyrischen – Expressionismus, seines Umfeldes, seiner Subszenen, Abspaltungen, konkurrierenden Lager usw. zu rechnen. Interessant ist, dass der Expressionismus bei näherer Betrachtung ja überhaupt keine rein deutsche Angelegenheit war, sondern v.a. vor dem Ersten Weltkrieg eine rege Korrespondenz- und Mittlertätigkeit entfaltete, Berlin z.B. als Relaisstation zwischen dem literarischen Paris und Petersburg oder Prag fungierte. Gerade Paris, als Heimstatt des Kubismus, später des Dadaismus und Surrealismus, unverzichtbarer Lebenshintergrund von Aposteln der Moderne von Baudelaire bis Apollinaire, kann in seiner Bedeutung für den deutschen Expressionismus kaum überschätzt werden. Lassen sich auch heute ähnliche internationale literarische Zentren ausmachen?
Kirsten: Ach nein, das stimmt so nicht, und ich kann es deshalb auch nicht unwidersprochen lassen. Ich kenne eine ganze Reihe von exzellenten Expressionismus-Kennern, denen ich gern den Vortritt lasse. Jedenfalls weiß ich mich mit meinen Acquisitionen und Recherchen zu Personen, die dem Expressionismus zuzuzählen sind, nicht allein.
Ob sich heute noch irgendwo literarische Zentren ausfindig machen lassen? Ich weiß es nicht. Ich wüßte es gern. Mein Überblick über gegenwärtiges Literaturgeschehen ist nicht so gut, daß ich mit dem Brustton der Überzeugung auf ein Land oder eine Stadt verweisen könnte. Sicher bin ich nur, daß die Musik nicht gerade in Deutschland spielt, in dem Land, in dem man es nötig haben muß, einen Superdichter zu suchen. Eine Aktion, deren Kitsch kaum zu unterbieten ist. Ich muß dabei lebhaft an Brechts ironische Klage denken: „Weh dem Land, das Helden nötig hat!“
Gewichtige Stimmen sind ganz bestimmt in angloamerikanischen Gefilden zu vernehmen. Ich sehe allerdings nicht, daß sie in Deutschland wahrgenommen werden, daß man sie in einer repräsentativen Sammlung vorgestellt bekommt. Wie auch anders? Bei einer derart horrenden Poesieabstinenz! Ich weiß von keinem Journal, das sich weltläufigerweise ausschließlich der Poesie widmete und die Mittlerrolle zu übernehmen imstande wäre.
Röhnert: Deutsch als Poesiesprache heute – wie kommt man als Dichter mit der durch die Massenmedien hereinbrechenden Sprach(en)flut, ihren falschen Anglizismen, Slogans, sinnentleerten Parolen und Worthülsen zurecht? Gibt es da noch ein Refugium für die Poesie?
Kirsten: Ich denke, das ist in den vorangegangenen Antworten bereits mitgesagt. Man kann nur zurechtkommen, indem man sich verweigert, gegenhält, Gegensprache schreibt, indem ich an meiner Sprache festhalte. Das Refugium der Poesie schrumpft immer mehr zur Volière, zum Affenkäfig, an dem zu lesen steht: „Füttern verboten!“ Meldet sich während einer Lesung ein Zuhörer, der vorgibt, mein Leser zu sein, kann ich nur Hans-Dietrich Genscher imitieren, der einmal zu einem Herrn, der ihm versicherte, FDP-Wähler zu sein, sagte: „Ach, Sie sind das.“ Kurz und schmerzlich, Lyriker sind es gewohnt, mit einer Einschaltquote zu leben, die weit weit unter einem Prozent liegt, was ja wohl in Kreisen, auf die es ankommt, nicht mal mehr als Peanuts ästimiert wird. Ich weiß, daß ich lebe. Noch besser allerdings, wo ich lebe. In Deutschland!
aus Gerhard R. Kaiser (Hrsg.): Landschaft als literarischer Text. Der Dichter Wulf Kirsten, Glaux Verlag Christine Jäger, 2004
„das durchaus scheißige
dieser unserer zeitigen herrlichkeit“
– Christliches Erbgut in der Lyrik Wulf Kirstens. –
Den Herrgott einen guten Mann sein zu lassen ist – das weiß man inzwischen sogar im katholischen Bayern – gar nicht so leicht. Denn man findet sich täglich mit Um- und Zuständen konfrontiert, die einen an diesem Gut-Sein oder gar an seiner Existenz doch einige Zweifel hegen lassen. Wer immer aber im Abendland denkt und schreibt, kann einer zumindest inneren Stellungnahme zu dieser Frage und zur christlichen Tradition nicht entkommen.
Von weit mehr als einem bloßen Nicht-Entkommen zeugt nun allein die Menge christlicher Bezüge im lyrischen Œuvre Wulf Kirstens – die bei diesem so sorgsam seine Worte wählenden Dichter natürlich kein Zufall ist. Da tummeln sich: Zitate aus den Psalmen oder dem Hohen Lied, Anspielungen auf die Evangelien oder den Kirchenvater Augustin, Armesünderseelen, Selig- oder Herrlichkeiten, Heerscharen von Teufeln, nicht minder etliche Engelschaften nebst entsprechenden -leitern, Himmelreich, Glorienschein und dann und wann der liebe Gott – sogar mit diesem Adjektiv, das allerdings durchweg als Zitat und zumeist dann, wenn er sich gerade nicht als lieb erwiesen hat.
Vor diesem Hintergrund erscheint es spannend, mit Blick auf das Œuvre Kirstens – der üblicherweise nicht mit Transzendenzgedanken oder -themen in Verbindung gebracht wird – zu fragen, wie er mit dem christlichen Erbe näher umgeht und welche Aspekte seiner Gedichte man deutlicher in den Blick bekommt, wenn man sie vor dem Hintergrund der christlichen Tradition betrachtet. ,Christliches Erbe‘ sei dabei in einem breiten Sinne verstanden, wie es als Bibelwissen und religiöser Denk- und Vorstellungsbestand schon ins Kulturgut eingesickert ist.
I. Bibel, Biographie und Selbstverständnis
Im Anfang stehe Kirstens Schreibtisch bzw. das gleichnamige Gedicht.1 Dort sehen Sie griffbereit auf Armlänge eine Reihe Bücher, das erstgenannte davon die Bibel, in der Lutherübertragung, sacht modernisiert. Für seinen Büro-Schreibtisch im Aufbau-Verlag dagegen wurde Kirsten, wie er mir erzählte, zu einem der eifrigsten Ankäufer von Bibelkonkordanzen in Weimar, da dieses wichtige Arbeitsinstrument für den Lektor aus dem Verlag beständig geklaut worden sei. Die Luther-Bibel steht dabei für ein mehrfaches Traditionserbe: inhaltlich für christliches Gedanken- und Bildgut, historisch für Impulse der Reformation und sprachlich für den Beginn des modernen Hochdeutschen. Wie entscheidend diese Tradition – als ,Erbgut‘ durchaus im genetischen Sinne – Kirsten prägt, zeigen schon zwei zentrale Stellen seiner Selbstcharakterisierung. Die eine stammt aus dem Gedicht „erdlebenbilder“
[…] wer bloß gab mir auf den weg,
gott hätte die teufel gesalbt und allerlei
fürstlichkeiten über die vornehmlich
deutsche erde gesetzt? lehmgestalt,
steh auf und wandle, geh deiner wege,
warum sollte der himmel ein einsehen haben
ausgerechnet mit dir, geboren zu klipphausen?2
Die zweite aus „väterlicherseits, mütterlicherseits“:
[…] ein geschlecht von handwerkern
und kleinbauern, nie aus dem dunkel
getreten seiner und meiner leibeigenen
geschichte, überliefert auf den wurmfressigen
seiten einer bibel, von deren buchenholzdeckeln
das schweinsleder in fetzen hängt.
über die sprossen der himmelsleiter
purzeln kopfunter kälberbeine
und birnhaken. Darauf
mache ich mir einen vers.3
In diesen Zeilen liegt, wenn nicht der ganze Dichter Wulf Kirsten, so doch sehr viel von ihm: geboren zu Klipphausen, von der Erde genommen wie Adam, zum Lebenswandeln erweckt durch ein Wort Christi zu dem am Sabbath geheilten Lahmen, sieht er auf der Jakobsleiter keine Engel herniedersteigen, sondern sich Symbole der Landwirtschaft entgegenhageln – und gewinnt eben daraus das Movens seines Dichtens.
2. Reflexionen der Reformation
Von mehreren Gedichten, in denen sich Kirsten mit Luther, der Reformation oder deren Folgen beschäftigt, wähle ich hier exemplarisch ein Rollengedicht, in dem er sich – in stilistischer Annäherung an das Lutherdeutsche – zum Für-Sprecher der wider die Abgabenfron aufbegehrenden Bauern macht. Während es Luther aber 1517 mit seinen Thesen zur kirchlichen Ablasspraxis keineswegs, wie auch später nicht, um die unterdrückten Bauern ging, vergegenwärtigt Kirsten unter diesem Datum den sich erst einige Jahre später, mit den Bauernkriegen, aufständisch entfesselnden Groll gegen die grundherrschaftliche Ausbeutung. Die Bauern wüten:
[die grundherren] pochen auf ihre herrlichkeit,
als sei sie gottgegeben und vermöge der schrift.
[…]
gab ihnen gott solche gewalt und von wannen?
[…]
und ist die gewalt dieser behemoths von gott, dann nur so,
daß sie des teufels söldner sind, der satanas ihr hauptmann ist.4
Was letztlich bedeutet, dass Gott den Teufeln die Macht über die Bauern gegeben hat. Doch dazu später. Im Großteil des Gedichts geht es dagegen nicht um eine Kritik an der Religion, sondern angeprangert wird v.a. der machtpolitische und wirtschaftlich-raffgierige Missbrauch der Religion durch die Institution Kirche. Und das gilt m.E. auch für zahlreiche andere Stellen, an denen die Themen Kirche und Religion Kirsten Anlass zu Empörung werden.
Nun treten Machtmissbrauch und Habgier ja durchaus auch in weltlichen Herrschaftsgefügen auf. So mag es lohnendes Thema einer künftigen Studie sein, inwiefern Kirstens Kirchenkritik oder seine Verarbeitungen von Reformation und Revolte nicht zuletzt als Allegorien auf zeitgenössische weltlich-politische Missstände gelesen werden können. Vor allem in dieser Lesart gewinnt jedenfalls ein spätes Gedicht „pastorale“5 seine weitreichende Brisanz. Wir sehen darin – als verstörendes Gegenbild einer bukolischen Idylle – einen ausgebrochenen Hammel auf seiner Flucht in Nacht und Abgrund. Und das ärger Belämmernde ist:
hinter ihm her der schäfer
samt dezimierter herde, als wollte
auch er sich mit ihr nachtwärts
verlaufen in gottverlassenem gelände
Dies pervertiert nicht nur das biblische Bild des guten Hirten, sondern es ist abstrakter auch eine vernichtende Allegorie auf verantwortungslose Führer jedweder ideologischer Couleur, kopflose Hirten wie demente politische Leithammel.
Freilich eine Stelle der „flugschrift“ trifft ins Herz auch der Religion, nämlich der Aufschrei der Bauern:
hilf gott! doch wo hättst du je des jammers erhört?
Hierin ist letztlich die Theodizee essentialisiert, die Frage nach einer Rechtfertigung Gottes angesichts des Leidens in der Welt. Sie stellt sich im letzten Jahrhundert besonders sengend beim Blick auf das Schicksal der Juden – und wird von Kirsten auch in seiner Beschäftigung mit jüdischen Themen immer wieder gestellt. Hier sei sie anhand eines von Kirstens Dichter-Gedichten konturiert.
3. Die Theodizee-Frage
Es leuchtet ein, dass dem manisch lesenden Anverwandler Kirsten die Heillosigkeit der Welt immer wieder v.a. in Dichter- oder Künstlerschicksalen in den Blick tritt – bei Kleist, Johann Christian Günther, Heine oder in einer unerbittlich lakonischen Nänie auf gewaltsam gekappte Leben russischer, polnischer und tschechischer Dichter.6 Übergreifend lässt sich sagen, dass v.a. die Porträtgedichte es Kirsten erlauben, sich unbefangen direkter mit christlichem Gedankengut zu befassen als in seiner eigenen Stimme – etwa in einem lyrischen Ehrerweis an den „franziskanischen Evangelisten“ und pantheistisch-buddhistischen Eklektiker Christian Wagner, für dessen gesammelte Gedichte Kirsten auch ein Vorwort verfasst hat.7 Damit aber von einem Berühren der Theodizee-Frage gesprochen werden kann, muss hinzukommen, dass das entsprechende Gedicht uns zumindest an einer Stelle zu denken nahelegt: Wie kann Gott dieses Leiden oder diese Ungerechtigkeit zulassen? Und die Frage verschärft sich natürlich, wenn die Leidenden auf die Güte Gottes vertraut haben, wie etwa der tschechische Dichter, Jiří Wolker (einer von Kirstens „Leuchtbojen“).8
1900 geboren, beginnt Wolker zu dichten aus dem Geiste einer mährischen ländlichen Frömmigkeit, absorbiert begeistert den christlich grundierten Surrealismus Apollinaires, tritt aber 1921 aus der Kirche aus und in die KP ein, gerät später zwischen die Fronten von Partei und der literarischen Bewegung des Poetismus und stirbt 24-jährig an Tuberkulose. Kirsten lernte Gedichte Wolkers in der von Ludvík Kundera und Franz Fühmann 1964 herausgegebenen Anthologie Die Glasträne kennen. Er fand in Wolker 1. plastische Landschaftsschilderungen, die von starken expressionismus-affinen Metaphern belebt werden, 2. ein sozialethisches Engagement für das Proletariat und 3. – zur Gegenwartsschmiegsamkeit entstaubte – lyrische Erzähl-Formen, etwa in der erschütternden „Ballade von den Augen des Heizers“, der in einem Elektrizitätswerk schuftet, damit zwar der Gesellschaft Licht und Fortschritt schafft, aber mit jeder Schaufel Kohle, die er in den Ofen schleudert, sein eigenes Augenlicht hingibt. Kirstens Text „Jiří Wolker zugedacht“ beruht auf einer realen Begebenheit in Wolkers Heimatstadt Proßnitz, verleiht aber in buchstäblichem Sur-Realismus dem toten tschechischen Dichter selbst das Wort:
wenn in stiller sommernacht der himmel zu duften beginnt
[…]
und die kirche in der wachsstöcke flackerschein
von windmühlenfittichen geisterhaft getrieben
nach allen vier himmelsrichtungen davonfliegt
und ein erzengel aufsteht und spricht:
lazarus, erhebe dich!
dann steig ich aus dem schwarzen schrein,
geh mit euch die straße entlang,
die von Lošov führt bis ans ende der welt.
andächtig, unwandelbar, seit wir in liebe uns gefunden.9
In dieser Rede des toten Wolker aus dem Jenseits erreicht Kirsten ein völlig unverstelltes Endzeithoffnungspathos, das allerdings sofort durch eine papieren-nüchterne Realität gebrochen wird, nämlich die an Wolker gerichteten „briefschaften von dreiundzwanzig mädchen, / postlagernd bis zum jüngsten tag“ in einem Archiv seiner Heimatstadt: als Chiffre für all das, was „der liebe gott“ (hier sarkastisch explizit so genannt) ihm schuldig blieb. Das Gedicht denkt dann weiter zu der „eiserne[n] braut“ Wolkers – nicht die Jungfrau Maria, die Wolker innig in einem Gedicht geminnt hatte, sondern eine reale Person –, die im Stadtpark den Vögeln Brosamen streut. Auch ihre Schönheit hat sie weitergegeben, und zwar an Frauen, die in drei von vier Fällen mit Elektrizität arbeiten: Näherinnen am Fließband, eine Büglerin oder eine Verkäuferin, die „tag für tag / […] schallplatten auflegt“.
In seiner unterschwellig narrativen Entfaltung folgt das Gedicht dabei von Ferne Wolkers eigener geistiger Entwicklung: Dessen Sozialismus hatte begonnen im Umfeld des ländlichen Christentums, aber er hatte dann die chiliastischen Denkfiguren auf den Kommunismus umgewidmet und eine Einlösung der Träume von sozialer Gerechtigkeit schon in dieser Welt erwartet. Kirsten lässt zunächst die christliche Erlösungshoffnung zu sehnlichstem Wort kommen, setzt aber dann sehr harsch die Empirie und Gnadenlosigkeit Gottes dagegen. Wenn mit Büchner „das Leid der Fels des Atheismus“ ist, dann zerbricht an dieser Klippe auch hier das Anbranden des christlichen Zuversichts-Pathos. Danach bleibt bei Kirsten, ohne kommunistischen Millenarismus, lediglich eine sehr leibhaftige Morgenröte tätiger bzw. mild-tägiger Mitmenschlichkeit – und auf Seiten des Dichters: eine achtsame Wahr-Nehmung der ungeheilten Nöte des Proletariats. D.h. das Scheitern der Theodizee führt zu einer – gerade in ihrer Demut und Schlichtheit umso eindringlicheren – humanitären Ethik.
4. Zwischen Erde und Himmel – Bewegungen in der Vertikale
Die Kirche ist nun soziologisch und konkret siedlungs-architektonisch aus dem ländlichen Leben nicht wegzudenken, einschlägig zuständig etwa für ein „begräbnis“
unter des klöppels wucht regt sich der turm,
glocke läutet den hintritt ein,
weit trägt es den schwall, weit schwingt der sermon.
verströmt hat der tag melisches sterbegeläut.
dem sterber wohlgesinnt zitat und paraphrase
gesplittert vom munde pastoral.
in den pfarrhausfrieden brockte erde letzterhand.10
In Anapher und Alliteration „weit trägt es den schwall, weit schwingt der sermon“ wird hier unmittelbar ohrenfällig, wie die Worte des Pfarrers mit dem Glockenwummern eins werden und sich im Weiteren als hohltönende Klitterung von Uneigentlichkeit – Zitat und Paraphrase – diskreditieren. Die auf den Sarg polternden Erdklumpen mögen dabei zudem an eine Spende denken lassen, die der „sterber“ letzterhand – vielleicht in seinem Testament – in den Pfarrhausfrieden gebrockt hat. Danach ist es sowohl psychologisch verständlich wie für Kirsten weitreichend aussagekräftig, mit welchem euphorischen Auf-Atmen der Sprecher die Trauergesellschaft hinter sich lässt:
geräuschvolle fahrt über den kies der chaussee.
saatflächen grünt mich mit lerchenliedern ein!
erddunst bleib über den feldern!
steig auf, tag, irdisch wie nie!
Mit Lerchen- statt mit Kirchenliedern hebt sich hier der sterbliche Tag, eine Art emotionaler ,Auferstehung‘ aus dem Deprimierenden und der Abwärtsbewegung der Beerdigung. Auf solche Bewegungen möchte ich nun näher eingehen, weil sich ein Denken von Transzendenz zumeist in einer Raumsemantik der Vertikalität vollzieht.
Eines der schwebend-bezauberndsten Gedichte Kirstens über ein kleines Mädchen auf einer „schaukel“ (das in meinen Augen eine ähnliche Vollkommenheit erreicht wie C.F. Meyers „Der römische Brunnen“) endet:
das mädchen hebt den frühling
in den himmel.
der himmel lenkt die schaukel
wieder zur erde.11
D.h. es ist gerade nicht die Erde oder die Schwerkraft, die das Mädchen niederzieht, sondern vielmehr der Himmel weist es ab. So folgt in mehreren Kirsten-Gedichten auf eine Erhebung ein solches Zurückgeworfen-Werden oder Sich-Zurückwenden zur Erde.
Etwa in „lebensspuren“, in dessen Dämmerungslandschaft sich deskriptiv-plausibel ein Genrebild vergeblicher Trostsuche in der Religion fügt:
eine greisin zum kirchgang gerüstet,
der predigt zu lauschen mit ertaubten ohren
Treffscharf perhorresziert wird dann eine andere Art von Sermon, dessen Verortung in einem politischen Kontext keine Mühe bereitet:
vollmundig beuteln die sprechblasen,
herzensergießungen aus dem schlagwortschatz
von hurrajüngelchen.
Dass aber dieses Propaganda-Gedröhn zumindest beim Gedichtsubjekt auf taube Ohren fällt, kennzeichnet die letzte Strophe:
die stille tropft wie blut aus einer wunde.
ein engel sieht die dreifaltige Sonne.
der sechsflügelige Seraph kündet vom tage,
vom heute gewesenen tage und schlingert
mit schlagseite über die bruchstellen
deiner und meiner gestutzen biographie.12
Die beiden Engelverse spielen nun auf zwei bedeutende schwäbische Dichter des 19. Jahrhunderts an (die in der Rezeption auch oft zusammengespannt werden): Die dreifaltige Sonne ruft – neben der Dreifaltigkeit selbst – auch Christian Wagners „Drillingssonnen“ auf:
Drei, ja drei der sonngen Majestäten, –
Selig, selig, selig die Planeten!13
Gleichsam in Brudersphären Wettgesang damit kündet dann der Seraph – als einer jener Engel, die um Gottes Thron beständig „Heilig, Selig, heilig“ ausrufen – „vom Tage“ in einem Zitat des zeitlebens mit seinen Kirchenämtern hadernden und an ihnen scheiternden Pastors Mörike. Doch dieser vielfachen Erhebung – des Blicks zur Sonne, zu Gedanken der Transzendenz und stilistisch zum Kündungs-Elan – folgt ein krasses „bathos“, so der Fachbegriff für ein Niederbrechen in ein Stilregister des Alltäglichen. Fast meinen wir zu hören, wie dem Engel die Schlagseite durch den vorher erwähnten Schlagwortschatz beigebracht wird, so daß er arhythmisch über die Bruchstellen von Biographien torkelt, die gestutzt sind wie offenbar einige seiner Flügel: Einerseits natürlich zündend komisch – zugleich aber eine bis ins Physische spürbare Inszenierung von Absturz und Versehrung.
Daß die Engel selbst in Kirstens Lyrik tendenziell keine Boten der Transzendenz mehr sind, erhellt ein Blick auf eine weitere seiner „Leuchtbojen“ Rafael Alberti und dessen Gedichtzyklus „Sobra los angeles“. Darin sind die Engel aus ihrem religiösen Amt als Heils- und Trostbringer verstoßen bzw. sind tot und verheeren als ihre eigenen Widergänger und tumultuarische Seelendämonen den Sprecher in einer lichtlosen psychischen Krise. Von dem Gedicht „Die toten Engel“ hat Kirsten sogar eine eigene Übersetzung angefertigt. Was in Kirstens eigener Lyrik mit Engeln passieren kann, hören Sie unter anderem in dieser Kontrafaktur:
Wer – aus der glücksritter eskorte […]14
Hier sind Rilkes elegisch-hehre „der Engel Ordnungen“ doch recht drastisch enteignet und verrückt!
Noch einmal ganz kurz zu Vertikal-Bewegungen: Das Gedicht „zeichen“15 enthält sie schon in den ersten beiden Versen: „herz, erhebe dich, nichtwärts zur nacht! / die sonne ist schon aus dem sattel gerutscht“ – und es ist zudem stark mit christlichen Elementen gesättigt (Seligpreisungen, Engelsspur, die Teiche von Hesbon etc.). Dann aber wird Christi letztes Wort am Kreuz sehr resolut zum All-Tag-Werk herabgestimmt:
für heute ist alles vollbracht.
himmel, wie wird mir!
Dicht gefolgt von einem anderen, zunächst vor allem ironisch wirkenden Anruf:
erde, gib kraft!
Aber im Gegensatz zum Himmel tut die Erde das tatsächlich. Denn weiter beschworen mit „o pfennigkraut, o hundstod! / es lebe runk und strunk!“ gewährt sie dem Dichter in einer Art Epiphanie ein Geschenk: das „lange gesuchte wort jahralten / wachtraums“. Es bleibt zwar auch im Gedicht „unaussprechlich“ – zeitigt aber eine überbordende Feier-Fülle beschreibender Beiwörter:
winddurchblasene, brandfleckige, winterlägige,
schabenfressige, gluchzende, sterbliche
heimat der lippenblütler
Und eben damit – mit dieser Niederwendung zum erdnah wuchernden Beschreibungs- und Fach-Vokabular und der Feier der „sterblichen heimat der lippenblütler“ – sind wir in doppelter Weise wieder mitten in der christlichen Tradition angekommen.
5. Sprachliche Implikationen des christlichen Erbes – Mimesis und Lobpreis
Wulf Kirsten selbst verweist an einer Stelle16 auf Erich Auerbachs literaturwissenschaftlichen Meilenstein Mimesis von 1946. Auerbach leitet darin sein Mimesis-Konzept von biblischen Texten und insbesondere dem Neuen Testament her. Denn die Evangelien behandeln einerseits ein Sujet von höher kaum denkbarer heilsgeschichtlicher Bedeutung: die Menschwerdung des Gottessohns. Andererseits besteht ihr Figuren-Arsenal größtenteils aus sehr einfachen Leuten: Handwerkern, Hirten, Fischern oder sogar sozial Geächteten, einem Zöllner oder einer Ehebrecherin. Hierin sieht Auerbach eine Aushebelung der aus der Antike stammenden literarischen Norm der Stiltrennung, wonach einfache Menschen – in der Komödie – burlesk und lächerlich darzustellen waren, während Tragödie und Epos sich im hohen Stil den Ereignissen um die sozial Herausgehobenen, Helden und politische Führer, zu widmen hatten. Das Neue Testament dagegen zeigt – grundsätzlich stilmischend – sozial Rangniedere als Träger und erste Adressaten menschheitsgeschichtlich bedeutsamer Ereignisse und schildert diese Begebenheiten umgekehrt in einer schmucklos faktennarrativen Sprache. Dies gilt Auerbach als Ur-Keim literarischer Mimesis. Als deren weiteres Kriterium kommt in den Evangelien die historische Konkretisierung hinzu – wenn etwa die Volkszählung zu Christi Geburt mit dem Namen einer empirischen Person fixiert wird:
zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war.
Niederes Personal, historische Konkretion und Stilmischung – die Übertragung auf Kirstens Werk brauche ich wohl nicht auszuführen. Nur zwei Anmerkungen: Dass Kirsten sich der Armen und Leidenden annimmt, entspricht natürlich auch unabhängig vom Mimesis-Gedanken einer christlichen Grundhaltung, wie er sie v.a. in einem seiner Leuchttürme, in Johannes Bobrowski, vorgelebt fand. Aber diesen Transferweg des Christlichen von Bobrowski zu Kirsten aufzuzeigen, wäre ein eigener Essay. Ich blende ihn deshalb hier aus.
Zur Stilmischung dagegen hören Sie einfach Kirsten selbst: „Ich konnte beim Mischen […] verschiedener Stilschichten Hochsprache, Fachsprache und Mundart in ein spannungsvolles Bezugsgefüge setzten, das auf Lokalspezifika ebenso aus war wie auf Genauigkeit als eine wesentliche poetische Kategorie“17 – wobei „poetische Genauigkeit“ eine lyrische Erscheinungsform der Mimesis ist. Und für die Einlösung dieser Theorie einfach noch zwei Beispiele:
dem ackergaul
die eisen aufgebrannt, da flog im funkenregen
ein feuriger engel mit gläsernen flügeln […]
[…] die statthalter der mitternächtlichen macht
sind arschlings in die hölle gestürzt18
Und schließlich mein Titelzitat aus dem Gedicht „zeitgenossen“, jetzt im Kontext:
wie tröstlich was schon Goethe hat erkannt und
gerochen vorzeiten: das durchaus scheißige
dieser unserer zeitigen herrlichkeit auf erden19
Hier gehört allein das Wort „gerochen“ zwei Stilebenen an: Denn fraglos haben dem Olympier verlogene Zeitgenossen (salopp gesagt) ,gestunken‘, und er hat das in seinem Werk – mit dem starken, heute archaisch-gewählten Partizip Perfekt von ,rächen‘ – auch geahndet.
Eine wichtige Spielart Kirstenscher Stilmischung liegt nun auch darin, dass er gerade jenen niederen Wortschatz aus Mundart und Fachsprache, dem er als lexikalischer Artenschützer lyrisch Obdach gewährt, immer wieder zur Verwirklichung einer zentralen Geste des hohen Stils einsetzt. Vor allem in seinen Anfängen ist er nämlich auch ein grandios Rühmender und Feiernder. Denken Sie etwa an „satzanfang“,20 in dem er das Wortfeld Sprache naturalisiert und so mit der Landschaftsbildlichkeit ineinsblendet. „im überschwang sich erkühnend“ und inständig nimmt er sich der Dorfleute und seiner heimatlichen Elbtäler an und sprachbewirtschaftet sie buchstäblich zu einem ,gelobten Land‘. Und immer wieder bersten diese frühen Gedichte in eine Lichtmetaphorik aus, wie sie vor allem die Euphorien der Mystik kennzeichnet: „hier – mein land, ich leg mich ins mittel, / luftfurchen und wolkengang, / mein lichtrecht, ununterbrochen“.21
Nun ist das Rühmen eine der archaischsten Dichtungsgesten überhaupt und lebt im Abendland vor allem in zwei Traditionen fort: im Besingen der oder des Geliebten und im Lobpreis, der dankenden Feier Gottes und der Schöpfung. Der transzendente Adressat dieses Lobes kann dabei durchaus derart entgrenzt sein, dass er gegenüber der pragmatischen, auf die Mitwelt zielenden Suggestiv-Funktion der Hymnik weitestgehend an Bedeutung verliert. So zu beobachten insbesondere bei einer weiteren von Kirstens „Leuchtbojen“ einem glühenden Rhapsoden, der religiöses Gedankengut nahezu jeder Provenienz amalgamierte, um eine neue Religion zu stiften, nämlich diejenige der Demokratie, die er in der radikalen Vorurteilslosigkeit seiner Stilmischungen auch figurierte. Ein Zitat seines Anhebens:
Das Selbst singe ich, die schlichte Einzelperson, […]
Physiologie vom Kopf bis zu den Zehen sing ich, […]
Frohlockend fürs freieste Handeln geformt unter göttlichen Gesetzen,
Den Modernen Menschen sing ich.22
Unverwechselbar: Walt Whitman. Kirsten hat ihn nicht nur direkt, sondern zudem vermittelt durch den Expressionismus rezipiert, der sich seinerseits an der – Natur wie Zivilisation umspannenden – Verbrüderungs-Suada des Amerikaners berauscht hatte. Auch Kirstens Verhältnis zu Whitman kann ich hier nicht detailliert ausführen, nur radikal verknappend sei gesagt: Sowohl für seinen Feiergestus wie für gewisse seiner Ich-Emphasen hat Kirsten von Whitman viel gelernt. Ein Zitat aus „die erde bei Meißen“
an der wetterscheide, wo im juli die gewitterbäume sömmern,
steh ich breitspurig auf der landschaft widerrist.
die flußorgeln durchbrummen das bauerngebreit.
[…]
am hellichten tag zur saatzeit im hügelland
ich – auf der erde bei Meißen.23
Von dieser selbstgewissen Euphorie ist es allerdings ein weiter Weg zu den Gedichten, die Kirsten 2012 in seinem Band fliehende ansicht veröffentlichte.
6. Das Gottesparadox im Getreideschlag
Eines der letzten Gedichte jenes Bandes führt – als das einzige mir bekannte von Kirsten – Gott explizit im Titel. Es erwähnt einen Jäger, der als Bewohner von Zweifelbach konkretisiert wird und dem Ich eine Reihe von Vorwürfen macht:
[…] nicht mal das abrakadabra
der dohlen da drüben verstehst du,
aber sieh dich um, sieh nur, was alles
der zufall hervorbringt, und er zeigt
armlängs auf die klatschmohnbestände,
die im getreideschlag sich eingenistet
und hartnäckig halten […]
Pikant hieran ist nun zunächst, dass das Gedicht „gott im getreideschlag“24 heißt, es uns aber dort v.a. auf den Klatschmohn hinweist, d.h. nach Matthäus 13 auf das Unkraut, das der Feind gesät hat und das auf explizite Weisung des Herrn erst kurz vor der Ernte gesammelt und verbrannt werden soll. Wäre Gott selbst also das Unkraut – eines, das sein Feind gesät hat? D.h. wäre das Übel letztlich die Religion, das Gott-Sehen oder -Erwarten, wo Unkraut ist? Aber es kommt noch spannender. Denn der Gesprächspartner fährt fort:
[…] und hier zuseiten
des feldrands gedeiht der fahnenhafer,
alles so zufälle, an die nicht mal gott
glaubt, der doch sonst glaubt,
was das zeug hält.
Nun ,glaubt‘ Gott – zumindest meines Wissens – an keiner Stelle der Bibel irgendetwas; er schafft, sieht, spricht, schenkt seinen Sohn und tut alles Mögliche, aber er glaubt nicht. Höchstens könnte man – in einer sehr bemühten Deutung – für den Anfang der Genesis denken, dass er insofern an die Schöpfung glaubt, als er sie als ,gut‘ ansieht. Aber dann glaubt er – wie alle Erfahrungen mit dieser Schöpfung zeigen – offenbar etwas, was dieses Zeug eben gerade NICHT hält. Wichtiger aber ist eine andere Frage, die hier anklingt: Steht hinter dem Werden und So-Sein der Welt, die das Gedeihen von Getreide wie von Unkraut als pars pro toto bezeichnet, irgendein Plan – oder ist das alles Zufall? Wenn nun aber an „solche Zufälle“ nicht einmal Gott selbst glaubt – d.h. sonst erst recht niemand –, heißt das doch, dass alle denkenden Wesen glauben, dass diesem Wachstum irgendein Sinn, eine Richtung oder eine Intention zugrundeliegt… Freilich: Wofern es diesen Plan gibt, dann umfasst er offenbar auch den Klatschmohn, womit wir wieder bei der Theodizee-Frage wären. Als weitere Brechung kommt hinzu: Wir lesen ja hier die Worte eines anderen, die das Gedicht nur zitiert, und dieser andere kann ja durchaus ein Glaubender sein. Freilich und hinwiederum: Er behält gegenüber dem Ich das letzte Wort…
Vor diesem Geheimnis eines deus absconditus in poesia trete nun auch ich zurück und entlasse Sie mit seinem Vexierspiel unaufgelöst in Ihren Hinterköpfen: Es ist wirklich eine gute Grundlage für alle Versuche, den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen!
Nur als Coda: Wulf Kirsten erzählte mir, missgünstige Dichterkollegen hätten ihm vorgeworfen, er habe einen ,christlichen Tick‘. Wollte er nun auf diese Bezichtigung künftig ernsthaft antworten, könnte er es mit der Frage tun: Ob eine existentielle Auseinandersetzung mit dem Erbe des Christentums, die zu einer unverbrüchlich gelebten humanitären und dichterischen Ethik führt, sinnvollerweise als Tick bezeichnet werden kann? Oder er könnte – viel einfacher – auf eine in seinen Gedichten immer wieder inbrünstig angerufene Sakral-Autorität verweisen. Und vielleicht hat ihm diese ja zu seinem 80. Geburtstag einen Gratulationsbrief geschrieben, in dem es wörtlich heißt:
Daß Sie, werther Herr Kirsten, einen christlichen Tick haben, ist exakt so wahrscheinlich, wie ich einer jener Zufälle bin, an die ich nicht glaube. Darum bitte: Schreiben Sie weiter! Die Erde, der ich mich verdanke, braucht Sie! Mit hochachtungsvollen Grüßen und einem knisternden Prosit: Ihr heiliger Strohsack.
Pia-Elisabeth Leuschner, aus Wulf Kirsten – die Poesie der Landschaft. Gedichte, Gespräche, Lektüren herausgegeben von Jan Röhnert, Stiftung Lyrik Kabinett, 2016
EINE FAHRT NACH WEIMAR
Zum 80. Geburtstag von Wulf Kirsten
Auf einer Landstraße in Thüringen
hin und wieder ein paar Autos in Sicht
Ich fahre über sanfte Hügel
Roggenfelder soweit das Auge reicht
üppige Obstgärten dehnen sich am Hang
Angenehm kurvig auf und ab
führt der Weg nach Weimar
Ruhig schweben die Wellen der Hügelkette
vor- und rück- und seitwärts
ertönen Bachs Fugen
Meißner Bauern bei der Feldarbeit
sehen dir in meinen Gedanken täuschend ähnlich
Beflügelt von der Vorfreude
noch vor der Dämmerung dich zu treffen
beschleunige ich das Tempo gen Westen
Leise rufe ich dir zu: mein Bruder
Wortsammler der deutschen Sprache
Du Weimarer Lyriker
Kim Kwang-Kyu
Lesung Wulf Kirsten am 27.11.1991 im Deutschen Literaturarchiv Marbach
In der Reihe Die Jahrzehnte. Das deutsche Gedicht in der 2. Hälfte des XX. Jahrhunderts präsentierten Autoren ein frei gewähltes „fremdes“ und ein eigenes Gedicht aus einem Jahrzehnt. So entstanden Zeitbilder und eine poetologische Materialsammlung zur Dichtung eines Jahrhunderts. Das Gespräch zwischen Bernd Jentzsch, Wulf Kirsten und Karl Mickel fand 1993 in der Literaturwerkstatt Berlin statt und ist hier online zu hören.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Nico Bleutge: Sprachschaufel
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2004
Michael Braun: Der poetische Chronist
Neue Zürcher Zeitung, 21.6.2004
Wolfgang Heidenreich: Gegen das schäbige Vergessen
Badische Zeitung, 21.6.2004
Tobias Lehmkuhl: Das durchaus Scheißige unserer zeitigen Herrlichkeit
Berliner Zeitung, 21.6.2004
Hans-Dieter Schütt: „herzwillige streifzüge“
Neues Deutschland, 21.6.2004
Frank Quilitzsch: Chronist einer versunkenen Welt
Lese-Zeichen e.V., 19.6.2004
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Christian Eger: Leidenschaftlicher Leser der mitteldeutschen Landschaft
Mitteldeutsche Zeitung, 19.6.2009
Jürgen Verdofsky: Querweltein durch die Literaturgeschichte
Badische Zeitung, 20.6.2009
Norbert Weiß (Hg.): Dieter Hoffmann und Wulf Kirsten zum fünfundsiebzigsten Geburtstag
Die Scheune, 2009
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Lothar Müller: Aus dem unberühmten Landstrich in die Welt
Süddeutsche Zeitung, 21./22.6.2014
Thorsten Büker: Der Querkopf, der die Worte liebt
Thüringer Allgemeine, 22.6.2014
Jürgen Verdofsky: Querweltein mit aufsteigender Linie
Badische Zeitung, 21.6.2014
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Frank Quilitzsch: Herbstwärts das Leben hinab
Thüringische Landeszeitung, 21.6.2019
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb +
Interview + Laudatio 1 + 2 + 3 + 4
Dankesrede 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Dirk Skiba Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口 1 + 2
Nachrufe auf Wulf Kirsten: FAZ ✝︎ Tagesspiegel ✝︎
Mitteldeutsche Zeitung ✝︎ Badische Zeitung ✝︎ FR ✝︎ Blog ✝︎
Sächsische Zeitung ✝︎ SZ ✝︎ TLZ 1 & 2 ✝︎ nd ✝︎ nnz ✝︎ faustkultur ✝︎
Wulf Kirsten – Dichter im Porträt.


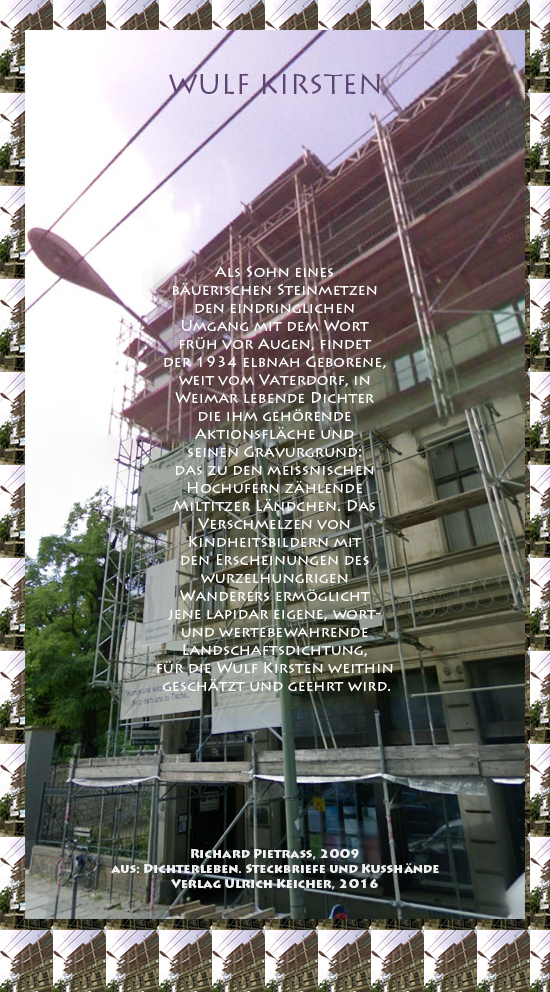












Schreibe einen Kommentar